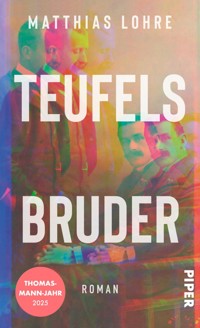Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nein, reiner Zufall ist es nicht, dass Irene in der New Yorker Unterführung plötzlich wieder vor ihm steht. Aber das kann Herman nicht wissen. Ihre Liebesgeschichte beginnt 1925 mit einer kleinen Schwindelei. Größere werden folgen. Auch veritabler, wechselseitiger Verrat. Und doch lieben sie sich und teilen den unerschütterlichen Glauben, dass die Welt zu retten sei: Gewaltige Dämme sollen das Mittelmeer absenken, Europa und Afrika so zu einem reichen, friedlichen Superkontinent verschmelzen – Atlantropa. Denn die Zeiten sind unruhig. Europa ist gezeichnet von Krieg und Wirtschaftskrise. Verseucht von Rassismus, Antisemitismus und Hass. In dieser Lage erdenkt der Architekt Herman einen wahnwitzigen Plan. Unterstützt von seiner jüdischen Frau Irene und namhaften Ingenieuren und Architekten, trägt sein Glaube an Technik und Fortschritt weit. Natürlich gibt es Zweifler, Anfeindungen, Häme. Dann entdecken Nazi-Funktionäre das "Friedenswerk" für sich – als Instrument zur Beherrschung Afrikas. Schließlich stellen sie Herman vor die ultimative Wahl: Will er mit ihrer Hilfe endlich seinen Lebenstraum wahr machen – oder Irenes Leben retten? Spannend und lebendig erzählt Matthias Lohre die vergessene Geschichte von Herman und Irene Sörgel. Ein sagenhafter Roman!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa förderte die Arbeit an diesem Roman durch ein Stipendium.
E-Book-Ausgabe 2021
© 2021 Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin www.wagenbach.de
Covergestaltung Julie August unter Verwendung einer Stereographie aus der Straße von Gibraltar, Fototeca Gilardi – Italy © gettyimages. Karte © Deutsches Museum, München / TZ 04602.
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 9783803143143
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 3336 6
www.wagenbach.de
Für Patricia, mi amor
I
1
Die Welt ist groß, doch in uns wird sie tief
wie Meeresgrund. Es hat fast nichts zu sagen,
ob einer wachte oder schlief, –
er hat sein ganzes Leben doch getragen,
sein Leid wird dennoch sein, und es verlief
sein Glück sich nicht. Tief unter schwerer Ruh
geschieht Notwendiges in halbem Lichte,
und endlich kommt, mit strahlendem Gesichte,
sein Schicksal dennoch auf ihn zu.
Rainer Maria Rilke: Die weiße Fürstin (1904)
München, 4. Dezember 1952
In zehn Minuten wollte Herman wieder die Welt retten, und er war spät dran. Sein Vorkriegs-Rad holperte auf den Pflastersteinen, während er in die Pedale trat wie in Morast. Wenn er den Kopf hoch genug hob, sah er die Ruinen um sich herum beinahe nicht mehr, und das gab ihm Kraft. Er umklammerte den Lenker, so fest er konnte, und schaute kurz dorthin, wo Baumwipfel und Häusergiebel sich mit dem schwarzblauen Dezemberhimmel trafen. Diese gebrochene Linie aus Stein, Holz und Luft musste, als er jung gewesen war, nahezu identisch ausgesehen haben. Ihr Auf und Ab stürzte nur dort, wo Bomben eingeschlagen waren, ab zur Nulllinie. Und sosehr er immer gewollt hatte, dass sich alles änderte, so sehr beruhigte ihn der Gedanke, dass es etwas gab, das von den Zeiten ungerührt, unberührt geblieben war.
Unter ihm aber zitterte das Rad, als ärgerte es sich über den Straßenbelag, der einer Metropole nun wirklich unwürdig war. Herman spannte die Muskeln rings ums rechte Auge noch fester an, damit das Monokel nicht hinabfiel. Sein Kamelhaarmantel flatterte, zu groß geworden, um den schmalen Leib.
Hupend überholte ihn ein Wagen, schier aus dem Nichts kommend, bog direkt vor ihm scharf rechts ein und schnitt ihm den Weg ab. Der Fahrer fluchte kehlig in seine Richtung, aber Herman verstand kein Wort. Lästig genug, dass der Kerl ihn genötigt hatte, so abrupt zu bremsen. Er bemerkte, dass er schon auf die Von-der-Tann-Straße gestoßen war, und bog links ab. Noch konnte er es pünktlich schaffen.
Vorsichtig tastete er mit der Linken hinter sich nach der Aktenmappe. Seit Jahren mied er solche kraftzehrenden Abendtermine. Aber vielleicht waren heute Männer mit Einfluss im Saal. Wenn der Bau bald losging, könnte er die Fertigstellung des Kernstücks in zehn Jahren noch erleben, dann wäre er 77. Was für ein Segen für Europa es wäre, ja, für die Welt. Und was für eine Katastrophe, könnten Dummheit und Niedertracht sich noch einmal verschwören gegen Fortschritt und …
»Onkel Mutz!«
Eine helle Stimme holte ihn zurück. Neben ihm fuhr ein Junge in kurzen Hosen. Er stand auf den Pedalen seines Rades wie auf einem Zirkuspferd und lächelte Herman an.
»Emanuel, mein Guter!« Aber damit hatte er den Vorrat an ungezwungenen Formulierungen im Umgang mit Kindern erschöpft, und so keuchte er bloß:
»Musst du nicht langsam ins Bett?« Er klang wie sein eigener Vater, und er wusste es.
»Kommst du Weihnachten wieder zu uns?«
»Ist dein Großvater auch da?« John hatte vielleicht eine neue Idee.
Schulterzucken. »Aber du kommst, ja?«
Herman mochte den Jungen sehr. Früher hatte er den krabbelnden Engel bestaunt, der sorgsam Holzklötze aufschichtete, nur, um das eigene Werk lachend zu Fall zu bringen. Und später den begeisterungsfähigen Volksschüler, dem er farbige Höhenkarten und Zeichnungen neuer Städte zeigte. Der Junge hatte ihn sofort verstanden, nur die Erwachsenen taten sich schwer. Doch er war groß geworden, und von Jahr zu Jahr ertrug Herman die Feiertage weniger. Sie erinnerten ihn daran, was er verloren hatte.
»Ich weiß nicht, Emanuel. Ist viel zu tun.«
»Du musst!« Die Brauen des Jungen zogen sich trotzig zusammen. Die Unfähigkeit zur Heuchelei rührte Herman so sehr, dass es sich anfühlte wie Traurigkeit.
»Ich schau’ mal, was ich tun kann.«
Emanuel schwieg und strampelte schneller. Aus dem Augenwinkel sah Herman, wie seine Wiedersehensfreude erlosch. Um mit ihm mitzuhalten, trat er noch fester in die alten Pedale, aber die mechanische Kraft ging irgendwo zwischen Kette, Rad und Boden verloren. Es war besser, den Jungen fahren zu lassen. Er wusste nicht, was er ihm noch sagen sollte, und er musste sich beeilen. Wer sollte ihn ernst nehmen, wenn er es nicht mal pünktlich zum eigenen Vortrag schaffte? Es wäre unvernünftig, dachte er, sich mit einem schmollenden Buben aufzuhalten, doch da hörte er sich schon rufen:
»Bleib’ bitte kurz stehen!«
Der Junge bremste so schnell, als hätte er darauf gewartet, und wandte sich lächelnd um.
Herman schnaufte, hielt an, griff in die Manteltasche und streckte Emanuel etwas Rechteckiges entgegen:
»Hier. Aber nicht alles auf einmal!«
Der Junge sah von seiner Hand zu Hermans magerem Gesicht, als müsste er zwischen beidem wählen. Dann griff er nach dem Schokoladenriegel und bedankte sich vokallos:
»Dnkschn.«
»Grüß’ deinen Großvater von mir, ja?« Emanuel nickte kurz und fuhr ohne ein weiteres Wort weiter, bis er nur noch ein hüpfender Strich auf verschneiter Straße war. Ratlos blickte Herman ihm hinterher und steckte das Monokel in die Jacke.
Zurück im Sattel nahm er sich vor, den Gesichtsausdruck des Jungen zu vergessen. Er durfte sich jetzt durch nichts mehr irritieren lassen. Mit jedem Atemzug feuchter Luft nahm er sich vor, dass er künftig noch zielstrebiger handeln, noch kompromissloser sein würde.
Wenn er noch geradliniger auftrat, würden die richtigen Stellen das bald merken, und wer weiß, vielleicht gelang ihm dann der entscheidende Durchbruch, vielleicht gleich heute Abend.
Hinter ihm hupte wieder und wieder ein Wagen, der langsam die Prinzregentenstraße entlangfuhr. Er konnte sich nicht zu ihm umdrehen, ohne zu riskieren, das Gleichgewicht zu verlieren. Hier, vor dem Haus der Kunst, war jede Menge Platz zum Überholen. Der abnehmende Mond beschien die gerade, freie Strecke. Warum also drängeln? Während er den Fahrer mit der Linken an sich vorbei winkte, spürte er dumpf die alte Wunde in der Brust. Das Hupen hörte auf.
Keuchend fuhr er weiter, den Blick gesenkt, um wegen der Spurrillen im Schneematsch ständig gegenzusteuern. Das knirschende Grau unter dem Rad wurde plötzlich steinhart, und als er aufsah, war er auf der Luitpoldbrücke. Mit Irene hatte er sie Hunderte Male überquert. Und jedes Mal war sie zwischen den Brückenpfeilern stehen geblieben. Wenn sie ihn dann zu sich winkte, hatte er so getan, als sei er des Panoramablicks müde. Aber insgeheim hatte er sich immer über ihre Freude gefreut. Gemeinsam hatten sie dann über die Isar-Aue geschaut wie zum ersten Mal. Und so war es ja auch: Kein Grauton der Eisschollen im Winter, kein Lichteinfall aufs entblößte Kiesbett im Sommer glich dem anderen. Und irgendwann hatte er angefangen, darauf zu warten, dass Irene ihn zu sich winkte. Denn mit diesem Blick auf den Fluss hatten sie stumm ihr Versprechen erneuert, dass nichts und niemand sie je würde trennen können.
Hinter ihm brummte niedertourig ein Automotor. Der Wagen fuhr an, ließ sich zurückfallen, kam wieder näher: ein akustischer Vorwurf in Richtung des Radfahrers. Wieder winkte Herman den Wagen an sich vorüber. Dabei strampelte er gleichmäßig weiter, um auf der vereisten Brücke nicht auszurutschen. Manchmal war weiterfahren einfacher als absteigen.
Rund hundert Meter vor ihm ragte die Säule mit dem goldenen Friedensengel ins Dunkel. Dahinter lag der Europaplatz, und dann wäre er fast am Ziel. Obwohl auf der Brücke ein kalter Wind wehte, war ihm heiß. Vorsichtig lockerte er Krawatte und feuchten Kragen und schaute auf die Armbanduhr. Nur noch sechs Minuten Zeit.
Nach der Brücke fuhr er an dürren Bäumen vorbei einen Halbkreis bergauf. Keine Laterne brannte. Er war der kreisende, dunkle Mond und der Friedensengel die Erde.
Wieder schwoll hinter ihm das Motorengeräusch an und ab, an und ab. Wenigstens hupte dieser Kerl nicht. Fuhr er wirklich so langsam? Kaum langsamer als sonst. Außerdem war die Straße eben und breit, Überholen kein Problem. Es brauchte nicht viel, um Herman davon zu überzeugen, dass alle Menschen verrückt geworden waren. Ein drittes Mal winkte er mit der Linken, schon fast eine eingeübte Choreographie. Doch der Wagen hielt sich weiter hinter ihm, ließ sich zurückfallen, kam wieder näher. Als er die Hand zurück an den Lenker legte, schwenkte er unwillkürlich nach links. Im selben Moment zog das Auto fauchend an, und hätte er nicht rechtzeitig zurück nach rechts gelenkt, hätte es ihn vielleicht umgestoßen.
Nach zwei tiefen Atemzügen merkte Herman, dass der Wagen auch jetzt nicht überholte. Er fühlte ein Ziehen im Magen, und das kam nur teilweise vom Hunger. Die beiden anderen Autos hatten ihn doch überholt – oder nicht? Womöglich hatte er sie im Halbdunkel nicht beachtet. Hatte sich ganz aufs Treten und Balancieren konzentriert. Oder sie waren schon vor der Brücke abgebogen. Vielleicht aber folgte ihm seit Minuten schon derselbe Wagen.
Oben in der schnurgeraden Hauptstraße angekommen, hätte er einfach geradeaus fahren können, zurück in die Sicherheit der Laternen und Passanten. Dann wäre er eventuell pünktlich ans Ziel gekommen. Aber obwohl ihm dafür nur noch drei Minuten blieben, schwenkte er keuchend nach links, zurück in die dunkle Umlaufbahn des Friedensengels.
Es ging steil bergab. Der Kragenschweiß kühlte Hermans Nacken. Er horchte nach dem Auto. Als er nichts hörte, war er fast ein wenig enttäuscht. Wer sollte ihn auch jagen wollen – einen alten Mann, der sich mit Süßigkeiten von Gewissensbissen freikaufte? Und warum machte er es den erfundenen Verfolgern auch noch leicht, indem er ausgerechnet hier, abseits von Passantenblicken und Laternenlicht, anderthalb Extrarunden drehte? Durch seine Dummheit würde er zu spät kommen. Noch zwei Minuten.
Hinter ihm heulte der Motor auf. Lauter, knurrender als vorhin, aber eindeutig derselbe. Er griff den Lenker, so fest er konnte. Was jetzt? Abrupt anhalten, um das Rad auf den Gehweg zu hieven, konnte er auf der abschüssigen Strecke nicht, es war zu glatt. Also fuhr er schneller. Wenn er sich rechts hielt, war er vermutlich sicher. Der Fahrer wollte ja wohl kaum gegen den Gehweg prallen. Hermans Atem formte Schleier, die hinter ihm verwehten. Im Mondlicht sah er, dort wo der Springbrunnen vor dem Friedensengel sein musste, ein paar Silhouetten beieinanderstehen. Und kurz hinter ihnen begann die Brücke. Dort konnte er vielleicht bremsen und rasch absteigen. Zumindest gab es Licht und Zeugen. Beschützt von seinem neuen Plan, fuhr er noch schneller. Keuchte voran ins Dunkel, flankiert von kriegsversehrten Bäumen.
Das Knurren ging über in unterdrücktes Brüllen. Der Fahrer musste in den ersten Gang geschaltet haben, war bereit zum Sprung.
Waren sie es also doch! Sie fürchteten Frieden, Wohlstand und Verständigung mehr als Krieg, und deshalb fürchteten sie ihn! Die Erkenntnis verlieh ihm neue Kraft, ließ ihn Schweiß und kalten Fahrtwind vergessen. Ihm war, als könnte er im Dunkeln sehen. Wie lächerlich sie doch waren in ihrem Hass, wie kurzsichtig in ihrer Gier. Sie mussten etwas wissen, was er noch nicht wusste. Vielleicht hatte er endlich die richtigen Männer überzeugt. Natürlich, das musste es sein! Er war ein alter Mann, aber einer mit einem ewig jungen Plan!
Triumphierend drehte er sich nach den Verfolgern um. Doch dabei streifte sein Vorderrad den Rinnstein. Herman verlor kurz das Gleichgewicht und stürzte beinahe. Er griff den Lenker fester. Abwärts, immer schneller. Vor ihm lag die Brücke. Eisige Luft biss ihn in Wangen und Hände, erinnerte ihn daran, dass er diesen Moment tatsächlich erlebte. Und daran, wie vollkommen allein er war.
Von der Brücke trennten ihn fünfzig Meter Dunkelheit. Das Grollen hinter ihm schwoll an und klang gleichzeitig weiter entfernt, als nähme der Wagen Anlauf. Aber er würde sich nicht totfahren lassen wie ein Reh.
Der Motor schrie auf.
Herman zog das Rad trotzig nach links. Zum Friedensengel. Dann spürte er einen mächtigen Stoß gegen sein Hinterrad, die Brutalität von Stahl in Bewegung, die ihm die Luft aus der Lunge presste und die Hände vom Lenker riss. Sein gelber Kamelhaarmantel flatterte auf, und Herman flog durch schwarze, wirbelnde Luft, hundert Jahre oder zwei Sekunden lang, bis es kein Oben und kein Unten mehr gab, nur Linien im Rausch. Bis er fiel und fiel und dumpf aufschlug auf Schneematsch und Eis und Stein und Schmerz und Nichts.
2
Wir sind, zur Ankunft gerüstet, an Deck gegangen, der Einfahrt beizuwohnen. Schon hebt im Dunst der Ferne eine vertraute Figur, die Freiheitsstatue, ihren Kranz empor (…) Es ist mir träumerisch zu Sinn, vom frühen Aufstehen, vom sonderbaren Lebensgehalt dieser Stunde. (…) Mir träumte von Don Quijote, er war es selbst, und ich sprach mit ihm.
Thomas Mann: Meerfahrt mit Don Quijote (1934)
1. Oktober 1925
Es war ein Fehler, an dieser Reise teilzunehmen. Jeder Griff ihrer Mutter ans dreireihige Perlencollier, jeder ausdruckslose Blick ins Nichts und jedes auf den Mund beschränkte Lächeln erinnerte Irene daran. Wie hatte sie vergessen können, wie sie einen Raum wortlos lenkte? Wie sie mit ihrer Art zu atmen Botschaften sandte (stoßweises, heftiges Ausatmen bedeutete Wut, ein langes Seufzen Langeweile)? Und wie ihr Vater die Botschaften stets als Befehle verstand und sofort befolgte? Zur Strafe für ihre Vergesslichkeit saß Irene jetzt im gepolsterten Lehnstuhl einer Luxuskabine der Berlin und hörte, wie ihre Mutter auf der anderen Seite des Tischchens in eine Illustrierte seufzte.
»Möchtest du aufs Promenadendeck, mein Herz?«, rief ihr Vater aus dem Nachbarraum. »Seeluft tut dir immer gut.«
Die Angesprochene blickte nicht auf. Armer Vater. Er hatte den langen Seufzer der Langeweile verwechselt mit dem noch längeren der Empörung. Mutter blätterte um und antwortete nicht.
»Oder wir gehen in den Laubengang, wenn dir das lieber …«
»Wie konntest du das bloß tun?«, fragte Mutter über den Tisch hinweg, ohne aufzublicken. Irene schien es, als hätte sie diesen Satz hinausgezögert, bis sie damit zugleich ihren Mann, der gerade das Zimmer betrat, unterbrechen konnte.
»Wir verbringen doch die meiste Zeit zusammen, Mutter. Und nach drei Tagen treffen wir uns in New York wieder. Dann fahren wir gemeinsam zurück.«
»Wusstest du davon, August?« Mutters Augen wanderten zu ihrem Mann, der gerade die obersten Knöpfe seines Oberhemdes verschloss. Am Kragen ging seine helle Haut über in dichten grauen Bart.
»Iri ist doch erwachsen«, sagte August Villanyi dem Spiegel.
Zur Antwort atmete Mutter kurz und heftig aus.
Irene hatte es zwar nicht gewagt, Nein zu sagen zu einer Reise, die sie selbst nie hätte bezahlen können. Aber immerhin war ihr früh genug eingefallen, dass sie drei Wochen allein mit ihren Eltern nicht durchstehen würde. Drei Wochen, in denen sie vorausahnen musste, wann ihre Mutter hungrig, zittrig oder schläfrig würde, damit nichts Schlimmeres geschah. Drei Wochen, in denen jedes unbedachte Wort, jeder verdächtige Blick Mutter für Tage niederstrecken konnte. Obwohl sie ihre Kindheit damit verbracht hatte, alle Signale zu lesen, um ihr – und damit auch ihrem Vater – zu helfen, wusste selbst Irene nicht immer, welche Worte und Blicke wann die falschen waren. So hatte sie gelernt, auf Zehenspitzen zu leben. Ihre Mutter war ein Schneebrett, das sich jederzeit lösen und Irene unter sich begraben konnte.
»Papa hab’ ich nichts davon erzählt. Und die Termine sind seit Wochen vereinbart. Wenn ich sie jetzt absage, schadet das meinem Ruf.« Sie wickelte sich eine Locke um den Zeigefinger.
Mutter schlug mit der flachen Hand auf die Fotos kurzhaariger junger Frauen in ihrem Schoß. Irene fühlte etwas Schweres, Weißes, Kaltes nahen. Sie griff im Aufstehen ihre Handtasche und ging zur Tür.
»Ich muss noch packen«, rief ihre Mutter. »Willst du mich schon wieder im Stich lassen?«
»Lass sie doch, mein Herz.«
Stoßseufzer.
»Schon dich, ja? Ich muss nur kurz was Wichtiges erledigen«, sagte Irene, so ruhig sie konnte. Als sie die Kabinentür hinter sich schloss, hörte sie Mutter eine Zeitungsseite ohrfeigen.
Auf dem Promenadendeck – umgeben von Fremden, die sich unterhielten, spazierten oder auf Liegestühlen unter Decken dösten – empfing sie eine warme Herbstbrise. Die niedrig stehende Sonne spiegelte sich in hunderttausend kleinen Wellen, und gemeinsam ließen sie die Panoramafenster leuchten. Wie beruhigend es war, Passagieren zuzusehen, die auf den glänzenden Holzplanken gemächlich ihre Runden drehten. Ihre Mitreisenden drängten sich ihr nicht auf, und Irene nicht ihnen. Man grüßte, plauderte und wünschte zum Abschied Gutes. Sie akzeptierten ihre Rolle als Fremde, umgeben von anderen Fremden.
Deshalb hatte sie zweiundsiebzig Stunden für sich abgezweigt. Drei Tage Zeit, um in den Seitenstraßen des Broadway die Menschen hinter den Namen und Adressen kennenzulernen, mit denen sie seit Jahren Handel trieb. Sie wusste, dass ihre Mutter damit nicht einverstanden wäre. Schlimm genug, dass Irene studiert hatte und deshalb – irgendetwas musste ja der Grund sein – mit dreißig noch immer unverheiratet war (»Da hast du das Glück, gesund zu sein wie dein Vater. Und was machst du daraus?«). Aber dass sie nun auch noch vorhatte, den ersten gemeinsamen Urlaub seit dem Krieg durch Geschäfte zu unterbrechen, empfand ihre Mutter als besondere Kränkung. Damen von Stand verdienten Geld, indem sie es heirateten.
Weil niemand sonst aufs Meer schaute, öffnete Irene ein Fenster und blickte hinaus, dorthin, wo bald ihr Ziel in Sicht kommen musste. Aber selbst mit zusammengekniffenen Augen sah sie allein weißgoldenes Wasser und hellblauen Horizont. Aus ihrer Handtasche zog sie ein Notizheft. Darin standen, in geschwungener Handschrift verfasst, Zeilen, die endeten mit »schweigen«, »Ruh«, »neigen« und »dazu«. Zeilen, die sie jetzt mit Bleistiftstrichen traktierte, bis sie hinter einer Graphitwolke verschwanden. Noch grässlicher als den Gedanken, jemand könne das Gedicht lesen, fand Irene den, dass sie es geschrieben hatte. Eine »hoffnungslose Künstlerseele« hatte ihre Mutter sie als junges Mädchen genannt und gemahnt, sie müsse »pragmatisch und nüchtern« werden. Inzwischen hatte Irene diesen Auftrag wohl weitgehend erfüllt. Nur manchmal schrieb sie noch, und jetzt auf dem Promenadendeck spürte sie, dass sie ohne die Sorge um ihre Mutter zugleich erleichtert und leer war. Sie senkte den Blick und schloss die Augen. Graphitwolke? Nein. Fremde?
»… und deshalb hat Europa seine letzte Chance vertan. Die Asiaten werden sich verbünden, die Amerikaner sind schon dabei. Und dann …«
Eine gepresste Männerstimme kam näher. Sie erinnerte Irene an die schöne Trompete, die sie neulich einem verarmten Orchestermusiker für zu viel Geld abgekauft hatte – und an die rauen, heiseren Laute, die sie ihr abgenötigt hatte.
»Einerseits«, sagte eine zweite Stimme, »haben wir Automobile, Schiffe und Flugzeuge, mit denen wir ganze Kontinente überwinden. Andererseits verbarrikadieren wir uns hinter Grenzen. Die sind aber nicht sicher.«
Fremde, ja, damit ließ sich arbeiten. Und mit Einsamkeit. Schwankender Grund. Sie hielt die Augen geschlossen, als ständen die Wörter innen an ihren Lidern. »Der Krieg hat Europa geschwächt«, sagte die zweite Stimme ruhig, als ginge es ums Wetter. »Seine Nationen haben ihre Probleme aber behalten. Sie haben nicht genügend Platz.«
»Richtig, richtig«, machte die Trompete.
Die Stimmen wurden nicht leiser. Aber Irene war nicht bereit, die Augen zu öffnen, die eigenen Worte gehen und fremde herein zu lassen.
»Die Luft wird immer schlimmer«, sagte Stimme Nummer zwei, »schon Kinder haben kranke Lungen. Wenn es so weitergeht, lenken die Mächtigen die Wut der Armen wieder nach außen, gegen angebliche Feinde. Und dann kommt ein neuer Krieg.«
Irene wollte nicht lauschen, hörte aber das leicht gerollte R, die klaren Vokale, die bedächtige Sprechweise. Eine Stimme wie das tiefe Gurgeln eines Bachs über Kieselsteinen; sie erinnerte Irene an ihren alten Vermieter, an Winterabende mit seiner Frau am Kamin – an ihr eigentliches Zuhause. Sie öffnete die Augen. Zwei Meter entfernt standen zwei Männer in schwarzen hochgeschlossenen Anzügen. Einer war klein und glatzköpfig, der andere auffallend groß und schlank.
»Tja«, presste der Trompetenmann hervor, »wir sind zum Untergang verdammt.« Dabei schüttelte er den kahlen Schädel und schnipste eine Zigarette aus dem Fenster, das Irene geöffnet hatte. Aus großen, runden Augen – das rechte noch etwas größer als das linke – blickte sein hochgewachsenes Gegenüber beruhigend auf ihn hinunter. Er war fünfunddreißig, höchstens vierzig Jahre alt. Seine Lippen waren voll, ebenso das pomadisierte Haar.
»Das habe ich nicht gesagt«, konterte er ruhig. »Sondern Wenn es so weitergeht.«
»Aber mein Herr: Professor Spengler hat doch alles dazu gesagt. Rein wissenschaftlich …«
»Ich bin mit Herrn Spengler zufälligerweise persönlich bekannt.« Der Große streckte sich leicht. »Und wer sein Buch genau liest, findet darin auch Hoffnung.«
Dreißig Meter hinter den beiden Männern sah Irene ihre Eltern auf das Promenadendeck treten. Sie tat einen Schritt zur Seite, noch näher zu den beiden Männern. Fredy und August Villanyi verschwanden hinter dem Rücken des Großen.
»Natürlich droht dem Abendland der Untergang«, sagte Irenes Sichtschutz. »Herr Spengler schreibt ja von dem Moment, in welchem das Geld seine letzten Siege feiert und sein Erbe, der Cäsarismus, leise und unaufhaltsam naht …«
Jetzt zitierte er auch noch, und der Glatzkopf lächelte wissend. Die männliche Begeisterung für Katastrophen, dachte Irene, würde sie nie verstehen.
»… Aber er preist auch den wissenden Priester der Maschine. Der kann die Gefahren des Niedergangs abwenden. Die Erschöpfung der Kohlevorräte zum Beispiel.«
»Der wissende … was?«, presste die Trompete hervor.
»Der Ingenieur.«
»Auch Ingenieure können Kohle nicht künstlich herstellen!«
Der Große drehte sich zu den Wellen.
»Aber sie finden schonendere Wege, Energie zu erzeugen. Zum Beispiel Wasserkraft.«
»Sie haben das Buch des Professors aber genau gelesen!« Der Kleine wollte sein Gegenüber offenbar besänftigen.
»Ich bin gelernter Ingenieur.«
»Ahahaaa!« Das gepresste Lachen klang wie Husten.
Die Vierteldrehung des Großen hatte Irenes Deckung zerstört. Ihre Mutter schaute in ihre Richtung und ging schnell, ohne eilig zu wirken, mit erhobenem Kinn auf ihre Tochter zu. Irene war ratlos. Wenn sie allein am Fenster stehen blieb, würde ihre Mutter erkennen, dass das »Wichtige«, das sie ihr vorzog, der Anblick silbrig glänzenden Salzwassers war. Was tun? Schaute sie konzentriert ins Notizbuch, riskierte sie, dass Mutter einen Blick hineinwarf. Sollte sie hinter den Männern auf sie warten und die freudig Überraschte geben? Unmöglich. Ihre Blicke hatten sich schon getroffen. Irene atmete schwerfällig ein.
Das Husten des Kleinen verebbte, und er sah sein Gegenüber an, als wäre es das erste Mal:
»Entschuldigen Sie: Wie, sagten Sie, lautete Ihr Name?«
»Sörgel. Regierungsbaumeister.«
»Natürlich: Ingenieur! Wasserkraft! Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wie der Vater, so der Sohn, was?«
Er hustete wieder. Hinter dem Großen kam Fredy Villanyi auf Irene zu. Und mit ihr die unangenehme Einsicht, dass sie sich gerade vor ihrer Mutter versteckte.
Irene kannte ihre eigenen, mitunter rätselhaften Macken, betrachtete sie interessiert wie eine vertraute Landschaft bei Gewitter. Aber ihre Mutter musste von ihnen doch nichts wissen!
Irene schloss das Notizbuch, trat einen großen Schritt auf die Männer zu wie auf ein Sprungbrett und sagte:
»Herr Sorbelt, ich muss Ihnen da leider widersprechen.« Der Kleine wandte überrascht den Kopf, während der Große Irene lächelnd ansah, als habe er sie erwartet. »Europa steht nicht am Abgrund. Es ist ihm gerade erst entronnen. Wer vom Untergang redet, der trauert bloß der alten Welt nach.«
Hinter ihnen bremste Mutter abrupt ab. Ein Gespräch zu unterbrechen schickte sich nicht. Zumindest so lange, bis man wusste, wie.
»Über den Abgang der Fürsten sollten wir froh sein! Dafür gewinnen wir die Freiheit der Kunst, das Wahlrecht für Frauen und den Völkerbund. Vielleicht fängt Europas größte Zeit gerade erst an.«
Vorlaut hatte ihre Mutter sie früher genannt. Nie hatte Irene ganz verstanden, was das bedeutete: War sie zu früh laut? Gab es also eine passende Zeit, um laut zu sein? Sicher nicht in der Villa mit den auch tagsüber zugezogenen Vorhängen. Nur im Atelier ihres Vaters hatte sie nie Vorwürfe gehört. Bis heute entspannte sie der Geruch von Zigarrenrauch und Ölfarben.
»Tut mir leid«, murmelte sie, »ich hätte nicht …«
»Sprechen Sie weiter.« Der Große lächelte.
Hinter ihnen wartete Mutter ungeduldig auf eine Lücke im Gespräch.
»Vielleicht«, sagte Irene, »vielleicht ist es ja wie in der Kunst: Wirklich Neues kündigt sich nicht laut an wie Reklame für Waschmittel. Es beginnt mit einem Gedanken, im Hirn eines einzelnen Menschen. Ein Maler, der sich sagt: ›Die Welt, wie ich sie erlebe, sieht anders aus, als alle anderen behaupten. Aber ich versuche sie zu malen!‹ Und dieser Gedanke pflanzt sich fort. Ich meine …«
Mit jedem weiteren Satz wusste Irene weniger, was sie meinte, aber es fühlte sich gut an zu sprechen. Irgendwo in ihr hatten sich fast unbemerkt diese Ideen eingenistet, und jetzt sprangen sie ihr aus dem Mund und ins Gesicht eines fremden Mannes, der sie dabei auch noch anlächelte.
»… oder als die ersten Frauen und Männer forderten, dass Frauen wählen dürfen. Da wurden sie nicht bejubelt, weil sie uns etwas Neues brachten. Sie wurden beschimpft, für verrückt erklärt. Neues macht den Leuten Angst.«
Der Kleine schnaufte, doch der Große lächelte unbeirrt weiter, und so war alles, was die Trompete hervorbrachte, ein gepresstes:
»Sörgel.«
»Wie bitte?« Irene war wieder nüchtern.
»Sörgel, nicht Sorbelt. Der Sohn von Hans von Sörgel.«
Erst jetzt sah Irene dem Großen direkt ins Gesicht. Seine Augen waren gar nicht unterschiedlich groß, sondern unter der rechten Braue klemmte ein dünnes Einglas. Wer trug denn noch so was? Adlige natürlich.
»Herman Sörgel«, sagte der Monokelträger mit leichter Verbeugung. In der folgenden Stille lag die Aufforderung an Irene, sich vorzustellen.
»Villanyi. Irene Villanyi.«
»Angenehm. Was führt Sie nach Amerika?«
In seinem oberbayerischen Singsang erkannte sie weder Sarkasmus noch versteckte Ablehnung.
Hinter den Männern atmete ihre Mutter tief ein und aus. Ihr Vater forschte im Gesicht seiner Frau nach einem Grund für ihre Erregung und fand ihn nicht. Vorwurfsvolles Schweigen war ein Schwert, und ihre Mutter war klug genug, es scharf zu halten. Plötzlich taten ihr beide leid, ihr Vater vielleicht ein bisschen mehr.
»Ich reise geschäftlich«, antwortete Irene und tat einen Schritt zur Seite. »Meine Spezialität sind brüske Gesprächsunterbrechungen. Ich habe Sie genug gestört. Wenn Sie mich bitte entschuldigen, ich muss …«
»Liebste«, rief eine Altstimme, »find’ ich dich endlich!« Ihre Mutter versperrte ihr mit einem breitkrempigen Hut den Ausgang aus dem Gespräch. »Möchtest du uns nicht vorstellen?«
Während die anderen ihre Namen nannten und Verbeugungen andeuteten, blickte Irene Herman Sörgel an: eine wortlose Bitte um Entschuldigung. Sie war nicht sicher, ob er verstand.
»Sie kommen im perfekten Moment«, sagte er ruhig. »Wir waren gerade dabei, Ihre Tochter mit Katastrophenszenarien zu langweilen. Sie hat uns davor bewahrt, uns vollends unmöglich zu machen.«
»Und woher kennen Sie unsere Tochter?«, fragte Mutter, als schlösse das an Sörgels Worte an.
Irenes Gesicht wurde rosa.
»Wir haben uns hier an Bord kennengelernt. Ihre Tochter ist eine exzellente Zuhörerin. Manchmal lässt sie einen glauben, sie höre gar nicht zu. Dabei ist sie sehr aufmerksam.«
»Ja, so ist sie!«, rief ihr Vater freudig.
Aus Rosa wurde Rot.
»Und damit verdienen Sie Ihr Geld?«
»Mutter …« Wie konnte jemand, der so viel Wert auf Umgangsformen legte, nur so taktlos sein?
»Ich leite eine Architekturzeitschrift. Baukunst – vielleicht sagt Ihnen der Name etwas?«
»Hans von Sörgel«, prustete der Kleine, froh, wieder Teil des Gesprächs zu sein. »Das war sein Vater!«
»Ach«, rief ihr Vater und wandte sich zu seiner Frau: »Den kennst du! Er hat die Luitpoldbrücke wiederaufgebaut, nach dem Hochwasser damals!«
»Und vergessen Sie nicht das Kraftwerk am Walchensee«, trompetete der Kleine. Das Gesicht ihrer Mutter imitierte formvollendet Interesse: fest aufs Gegenüber gerichtete dunkle Augen unter welligem und fest frisiertem Haar, das noch immer nahezu schwarz war. Sie hatte schon immer anders ausgesehen als die Damen der Gesellschaft, mit denen sie seit mehr als einem halben Leben Umgang pflegte. Östlich nannten es jene, die glaubten, einen Makel kaschieren zu müssen, und meinten jüdisch. Nie würde Mutter Irene verzeihen, wie sehr sie ihr ähnelte.
Herman drehte das Einglas um neunzig Grad und sah aufs Meer.
»Keine falsche Bescheidenheit, mein Lieber! Seinen Eltern kann man nicht entfliehen. Auch nicht in Amerika!« Der Kleine hustete, stolz auf seine Bemerkung.
»Großer Mann, Ihr seliger Herr Vater! Geadelt, nicht wahr?«, fragte Irenes Vater.
»Persönlicher Adel«, antwortete der Monokelmann wie zum hundertsten Mal. »Nicht vererbbar.«
»Großer Mann! Donnerwetter auch!«
Sörgels Lächeln versiegte, und Irene hielt sich verantwortlich dafür. Eilig sagte sie:
»Eine Architekturzeitschrift, interessant. Und was führt Sie in die USA?« Sie wusste, sie zerstörte gerade jede Restchance, dass ihre Mutter ihr das Alibi von vorhin abnahm.
»Eine Studienreise von Architekten. Ich bereite die Route vor, suche neue, interessante Gebäude. Hotels beispielsweise. Amerika soll uns da weit voraus sein. Wissen Sie, die Amerikaner haben zwar keine Kultur. Aber sie haben Zivilisation! Alle Arbeit, die auf Zweckerfüllung und maximalen Profit ausgeht, liegt ihnen im Blut.«
Jetzt suchte Sörgels Blick nach Irenes Augen.
»Wir müssen leider aufbrechen«, unterbrach ihre Mutter so kühl, wie es die Etikette gerade noch zuließ. »Du hast versprochen, mir beim Packen zu helfen. Und jetzt bleibt uns kaum noch Zeit.« Mit der flachen Hand griff sie sich ans Brustbein. Irene ignorierte es, nur noch dieses eine Mal. Das hier war ihr Gespräch. Zu Sörgel sagte sie:
»Vom Geschäftemachen verstehen bekanntlich auch die Europäer was. Und Amerika hat sehr wohl Kultur, Herr …«
»Sörgel«, hustete der Kleine.
»Bitte verstehen Sie mich recht«, sagte der Monokelmann, immer noch lächelnd, aber hastiger. »Wir haben eine reiche Kultur, aber uns fehlt moderne Zivilisation. Wir füllen unsere Städte mit Museen, und in den Armenquartieren gibt es kein fließendes Wasser. In Amerika – so hoffe ich zumindest –, in Amerika dient die Technik dem Menschen. Seine Hotels, Brücken und Bahnstationen sind – wie soll ich sagen? – demokratischer Luxus. Das Versprechen einer besseren Zukunft, geboren aus Vernunft. Das meine ich.«
Seine Augen fanden die von Irene. Sie zögerte, ihm zuzustimmen, etwas abzunicken, das womöglich klug war, vielleicht aber auch nur wirres Zeug. Je später sie sich verabschiedete, desto weniger Zeit blieb für die Schelte ihrer Mutter in der Kabine, und so sagte sie sehr langsam:
»Eine Zukunft, geboren aus …«
Mutter atmete zweimal heftig aus.
»Wie soll ich das erklären?«, sagte er mit gesenktem Blick. »Ende Achtzehn besuchte ich ein Krankenhaus. Kinderstation. Stechender Karbolgeruch, in den Bettchen vielleicht fünfzig kleine, halbnackte Leiber. Beine dürr wie Stöcke, aber die Bäuche alter Männer.« Er sah Irene an. »Das Seltsamste war: Keins der Kinder schrie. Vielleicht hier und da ein Wimmern. Sie hatten keine Kraft mehr zum Schreien.«
»Wir haben alle Opfer gebracht damals«, sagte die Trompete.
Sörgel schloss kurz die Augen.
»Was ich sagen will: Technik im Dienste der Menschen hätte das verhindern können. Wir brauchten chemischen Dünger für unsere Felder – und machten stattdessen Munition draus. Wir erschufen eine gewaltige Bürokratie, um Nahrung an die Front zu bringen – und vergaßen die Kleinsten. Aber haben Sie je einen amerikanischen Soldaten gesehen, der hungrig aussah?« Niemand antwortete. Er blickte wieder zu Boden, sah dann zu Irene:
»Jetzt habe ich mich doch noch unmöglich gemacht. Bitte entschuldigen Sie.«
»Wir müssen jetzt wirklich los«, sagte ihre Mutter tonlos. »Die Stewards sammeln schon die Koffer ein. Du weißt doch, wie sehr mir Hektik zusetzt.« Als Irene schließlich mit ihren Eltern das Deck verließ, blickte sie sich noch einmal nach dem Monokelmann um. Sie glaubte, er beobachte sie aus den Augenwinkeln, aber vielleicht lag das bloß am Einglas. Am glühenden Horizont stand eine Frau im Meer, reckte ihren kupfernen Arm in die Höhe und hieß sie willkommen.
3
Ich weiß noch, wie ich in der Wiege lagin schicksallosem Schlummer traumbefangen– an einem unerwachten, fahlen Tag,so klein, allein, von Schleiern dicht umfangen.
Die Wände ringsum kalkig, bläulich müde,sie schauten lauernd mir ins Schaukeldach;doch schützend schlich die Dämmerung, die trübe,sich in das schmale, stille Schlafgemach.
Da drang von außen her ein lichter Schimmer,sprang durch das Fenster, und – ihm kaum entronnen –stand schon im hellen Glanz das ganze Zimmer:Ich sah zum erstmal ins Licht der Sonnen!
Herman Sörgel: Das erste Licht
15. Oktober 1925
Herman war neun Jahre alt gewesen, als die Schönheit ihm das Leben rettete. Unermesslich lange hatte er auf der Holzbank gesessen, bis endlich die Glocken läuteten. Er drehte sich um und sah den Mann im knöchellangen Gewand und seine kindlichen Begleiter langsam durch den breiten, von Säulen gesäumten Mittelgang schreiten, vorbei an gesenkten Blicken und unterdrücktem Räuspern. Kniend hörte Herman dann zum hundertsten Mal, warum der Heiland für die Sünden der Menschen gestorben war. Der Tod des Messias war ein Opfer, aber auch ein Grund zur Freude, und eigentlich war er gar nicht tot. Alle Sünden hatte der Tod am Kreuz, der irgendwie keiner war, aber doch nicht ausgelöscht, denn bis heute begingen Kinder – ganz besonders Kinder – täglich neue. Sogar dann, wenn sie gar nichts taten. Ja, gerade dann. All das verwirrte Herman sehr. Bestimmt, dachte er, war es auch eine Sünde, dass er heimlich das Gewicht von einem Knie aufs andere verlagerte.
Mehr als seine Beine aber plagte ihn an jenem Frühlingssonntag das Wissen, wie viele Kreuzzeichen und Gesänge, wie viel Aufstehen, Hinsetzen und Niederknien noch zwischen ihm und der Freiheit lagen. Das rhythmische Pochen und Ziehen in den Kniescheiben wurde zum zweiten Herzschlag, der ihn betäubte und einhüllte. Um ihn herum verloren Steinboden und Buntglasfenster, Säulen und Rundbögen ihre Tiefe und Farbe. Bald wusste er nicht mehr, wo sein Gesicht aufhörte und die kühle Weihrauchluft begann. Noch immer sendeten Nerven pochende Schmerzsignale aus, aber sie verloren sich im Grau, das in ihm und um ihn herum war.
Hinter und über dem Priester, der in einer toten Sprache redete, sah er einen jungen, kraftvollen Mann ganz in Weiß schweben. Ihn umringten ein zweiter Mann, eine Frau und sechs Kinder mit Flügeln. Darunter standen im Halbkreis zehn weitere Männer, die über die Figur im Zentrum wachten oder ihr lauschten. Alle schienen zu schweben, schwerelos und gelassen.
Der Priester sprach weiter hohle Worte, und in der Kirche war es immer noch kalt, aber Herman scherte das nicht mehr. Er musste die Szene schon Hunderte Male angeschaut haben, aber jetzt sah er sie zum ersten Mal. Er wusste, die Männer flogen nicht, sondern waren für alle Zeit erstarrt. Wusste, dass er auf Farbe und Blattgold auf weißem Putz schaute. Aber wie konnten tote Dinge so viel präsenter sein als der Mann am Altar? Warum sprachen ihre Gesten, Blicke und Kleider so unmittelbar zu ihm? Musste etwas, das einen Menschen so berühren konnte, nicht selbst auf irgendeine Art lebendig sein?
Von da an brauchte Herman jedes Mal, wenn er sich während der Gottesdienste aufzulösen drohte, bloß den Kopf zu heben und sich umzuschauen. Da vorn ragte die bärtige Statue des heiligen Bonifatius aus den Wellen, dort die der Jungfrau Maria. Die geheimnisvollen Begriffe, die er in Büchern aus der väterlichen Bibliothek nachschlug – Apsis, Relief oder Kapitell –, waren Zaubersprüche, die ihm Einlass gewährten in eine neue, weite Welt. Am liebsten erforschte er sie allein. Wenn er mit hallenden Schritten durchs Mittelschiff ging, vorbei an leeren Bänken, kam er sich seltsam belohnt und beschützt vor.
Wieder daheim aber spürte Herman, kaum dass die schwere Eingangstür hinter ihm zufiel, den Blick des Vaters auf sich lasten. Der Senior war zwar meist nur an Sonntagnachmittagen zu Hause, und selbst dann zog er sich, wortlos Stille einfordernd, ins Arbeitszimmer zurück. Aber sein Schweigen erfüllte das Haus gründlicher, als Worte es vermocht hätten. Herman verstand die väterliche Stille als Missbilligung. Seine Neigung zum Weichen, Stillen und Einzelgängerischen machte ihn dem Vater suspekt, und er fühlte sich schuldig. Dass er nicht verstand, welche Sünde er beging, überzeugte ihn nur noch mehr davon, dass sie besonders schwer wog. Und so lief Herman noch häufiger zu den korinthischen Säulen, Rundbögen und Mosaiken. Allein auf einer Bank sitzend, ein schweres Buch über Architekturgeschichte vor sich, stieg etwas in ihm auf wie warmes Wasser, bis es ihn ausfüllte. Er konnte sich das wohlige Gefühl nicht erklären, aber das schmälerte es nicht, im Gegenteil. Nichts war realer, als etwas, das ohne Worte auskam. Erst wenn er Stunden später nach Hause kam, sagte ihm der besorgte Blick des Hausmädchens, dass er schon wieder vor Hunger und Kälte zitterte. Er lernte, seinen Schatz mit niemandem zu teilen, denn niemand hätte ihn verstanden.
Wer hätte gedacht, dass er ausgerechnet hier – mehr als drei Jahrzehnte später und sechstausendfünfhundert Kilometer von München entfernt, umgeben vom beißenden Geruch von Schuhwichse und gehetzten Blicken müder Großstädter auf dem Heimweg – wieder so empfinden würde wie damals?
Um ihn herum klackerten, schlurften und trippelten Schuhe auf dem Granitboden wie beim tap dance. Von den Wänden prallten die Echos hundertfach ab, mischten sich, füllten den Fußgängertunnel mit unsichtbarer Watte, hüllten Herman in einen Kokon aus Schall. Er schaute den Menschen zu, wie sie im gelblichen Kunstlicht einander auswichen und ignorierten – und bekam nicht genug davon. Er bestaunte rasierte Anzugträger beim Überholen müder schwarzer Frauen mit weißen Schürzen. Bewunderte die selbstvergessene Eleganz halber Kinder und magerer Greise, die gesenkten Blickes Schuhe aus Italien, Frankreich und New Jersey wienerten. Sah in Dutzende Gesichter – und war doch klar von ihnen getrennt. Was Herman einhüllte in der unterirdischen Passage zwischen Pennsylvania Hotel und Penn Station, war mehr als Lärm und Gedränge. Es war das Leben selbst. Die gleiche Wärme wie damals in der Kirche stieg in ihm auf. Manchmal hatte er versucht, dieses Gefühl anderen verständlich zu machen, und es Glückseligkeit genannt. Aber immer wenn das Wort seinen Mund verlassen hatte, war es abgestorben wie ein Blatt, das vom Baum fällt. Vor ihm, wo sich das gelbliche Licht mit weißerem, kälterem mischte, begann die riesige Bahnhofshalle.
Wenn er am nächsten Morgen den Dampfer bestieg, würde jede weitere Seemeile zwischen New York und ihm ein Stückchen Erinnerung an diese Reise rauben: an die rostbraunen Stahlskelette der Hoteltürme in Chicago, an den handschmeichelnden Marmor in Washington und an das demokratische Ballett der Passanten, die ihm gerade entgegenkamen. An den Schwarzen im abgewetzten grauen Wollanzug. An den dicken Metzgergehilfen mit der blutverschmierten Tasche. Oder an die Frau im braunen Mantel, deren schwarzes Haar überging in den dunklen Heiligenschein eines Pelzkragens und die, als Herman ihre Silhouette bemerkte, langsamer ging, bis sie vor ihm stehen blieb und sagte:
»Und, haben Sie sie gefunden?«
Aus dem Heiligenschein hervor traten markante Wangenknochen und ein tief liegendes Augenpaar. Einen Moment lang fragte sich Herman, welches Renaissancegemälde da zu ihm sprach, bis er begriff, wer sie war:
»Was für ein Zufall.«
»Hätte nicht gedacht, dass sich die Zivilisation hier unten versteckt.« Sie tat, als sei ihre Begegnung nicht zwei Wochen her, sondern wenige Minuten.
»Ich komm’ grad aus dem Pennsylvania. Das größte Hotel der Welt. Wie eine Kleinstadt, nur effizienter, klarer, schöner …« Mit jedem weiteren Adjektiv fühlte er sich matter. Wer nichts sagte, musste sich nicht unverstanden fühlen. »Sie sind sicher auf dem Weg zu Ihren Eltern?«
»Auch Eltern müssen mal selbständig werden. Ich will mir die Lobby anschauen. Ist vielleicht ein guter Ort für Verabredungen mit möglichen Kunden. Wird jemand aufdringlich, ist man schnell weg. Aber jetzt«, sie atmete tief aus, »sind ja Sie da. Was ist Ihr Eindruck – so als Experte fürs große Ganze?«
»Ich möchte nicht aufdringlich sein.«
»Noch sind Sie’s nicht.«
»Bestimmt werden Sie sich auch zur Lobby schnell eine ganz eigene Meinung bilden.«
Sie lächelten. Hermans Lächeln aber war eine Verteidigung. Dass sich die Zivilisation hier unten versteckt: Wollte sie sich etwa über ihn lustig machen? Er hätte ihr auf dem Schiff nicht so viel erzählen sollen. Bestimmt gehörte sie zu dieser Art Frau, die ihn immer angezogen und die zu meiden er gelernt hatte: schön – aber sich ihrer Schönheit zu deutlich bewusst. Aus gutem Hause – aber den Zufall ihrer Herkunft vor sich her tragend wie ein Verdienst. Solche Frauen glaubten, Anspruch zu haben auf einen Conférencier, damit sie sich nicht langweilten. Interessante Menschen aber langweilten sich nie, und er war kein Conférencier. Er knipste die Vierzig-Watt-Lampe seines Berufslächelns an und sagte:
»Ich möchte Sie nicht aufhalten.«
»Das größte Hotel der Welt? Klingt sehr interessant. Geben Sie mir eine Führung?«
»Das ist alles sehr technisch.«
»Alles andere würde mich auch wundern bei so einem modernen Gebäude.«
»Ich …« Er war ein Torwächter, der einen Goldschatz zu bewachen hatte, und er erfüllte seine Aufgabe miserabel. Sein Blick fand ein in grünes Leinen gefasstes Rechteck: »Was lesen Sie denn da?«
Sie schaute auf das Buch in ihrer Hand: »Ich? Nichts.«
»Nichts?«
Sie seufzte, als wäre es ihr unangenehm: »Outline of history von H.G. Wells. Gerade erst erschienen. Eine Geschichte der Erde vom Anfang bis heute.«
»Das ist doch mehr als nichts. Interessant?«
»Die Geschichte der Welt verdient es, im Sitzen erzählt zu werden.« Sie nickte lächelnd in die Richtung, aus der Herman gekommen war.
»Was fanden Sie besonders interessant?«
Irenes Lächeln hielt seine Position, aber ihre Augen kappten alle Verbindungen zum Mund.
»Wussten Sie«, sagte sie nach einer kurzen Pause, »dass Europa und Afrika einmal miteinander verbunden waren?«
»Verbunden?«
»Weil Eis fast ganz Europa bedeckte, sanken die Meeresspiegel. Vor fünfzig-, sechzigtausend Jahren war das Mittelmeer ein riesiges Tal, und an seinem Grund lag eine Seenkette. Menschen gingen vom grünen Afrika ins karge Europa.«
Herman stellte sich vor, wie Wassermassen sich zurückzogen, als folgten sie einem Plan. Wie sie sich auftürmten, neu anordneten als gewaltige Eisblöcke, und wie fruchtbares, nass glänzendes Land aufatmete, befreit von uralter Last.
»Und so was interessiert Sie?«, fragte er. »Geographie? Geschichte?«
»Mich interessiert so gut wie alles. Stoße ich auf etwas Neues, merke ich, mit wie vielen Dingen es verbunden ist. Zufälle gibt es nicht, nur Zusammenhänge, die man nicht erkennt.«
»Schönes Zitat. Von wem stammt das?«
»Irene Villanyi. In ihrem Freundeskreis ist sie weltberühmt.« Zwei dicke Männer zwängten sich an ihnen vorbei. Nach einer Weile sagte sie leiser als zuvor: »Es war interessant, Sie wiederzusehen. Ihnen noch eine schöne Zeit in New York.«
Als sie sich zum Gehen wandte, sah er hinter ihr die marmorne Haupthalle der Pennsylvania Station: ein riesiges Kraftfeld, in dem Menschen herumwirbelten wie Elektronen, rasend schnell, dicht beieinander und doch jeder für sich. Gleich würde es auch sie beide auseinanderreißen, sie auf ihre je eigene, einsame Bahn zwängen. Er fingerte am Monokel, bis eine Vierteldrehung erreicht war, und fragte:
»Wollen Sie keine Führung mehr?«
*
Irene war erstaunt, wie perfekt ihr Plan aufging. Seltsamerweise war sie sich zugleich fast sicher, dass das, was gerade geschah, gar nicht ihrem Plan folgte. Während sie neben Herman Sörgel durch den überfüllten Tunnel ging und er ihr zurief, wie viele Menschen täglich im Pennsylvania ein und aus gingen (»Dreitausend Gäste, über zweitausend Angestellte und fünftausend Besucher, erstaunlich, nicht wahr?«), dachte sie daran, wie sie am ersten Morgen in Amerika aufgewacht war und plötzlich gewusst hatte, woher sie seinen Namen kannte. Das wollte sie ihm gern erzählen, wie um etwas wiedergutzumachen. Dabei wusste sie gar nicht, was es wiedergutzumachen gab. Anstatt ihrer Mutter beim Frühstück beizustehen, während diese erst ihren fehlenden Appetit beklagte und dann ihren empfindlichen Magen, hatte Irene sich zurückgezogen, um ein teures Ferngespräch nach Munich, Germany anzumelden. Nach mehreren Minuten war endlich eine Verbindung hergestellt mit der Redaktion einer kleinen, der Vermittlung zunächst unbekannten Zeitschrift. Schließlich aber konnte sie den überraschten jungen Mann, der in der Redaktion allein die Stellung hielt, davon überzeugen, dass sie in den kommenden zwei Wochen in New York mit seinem Chef verabredet sei. Bloß habe sie vergessen, wann genau. Als der Büromensch – ein Kerl namens Heizer – antwortete, er habe den Terminkalender des Herrn Chefredakteurs vor sich, aber von einem Gespräch mit einer Frau Vanilla stehe da leider nichts, griff sie zu einem drastischen Mittel: Sie imitierte ihre Mutter. Derart eingeschüchtert, zögerte Heizer nur kurz, bis er ihr Datum und Uhrzeit von Herrn Sörgels einzigem verzeichnetem Termin in Manhattan nannte: eine Hotel-Besichtigung.
Seither hätte sie reichlich Zeit gehabt, sich davon zu überzeugen, dass es besser war, nicht herzukommen. Ablenkung gab es genug. Die Menschen hinter ihrer Geschäftskorrespondenz erwiesen sich als redselige Gentlemen und Ladies. Die weißhaarigen Mandelbaums hätten lovely Irene am liebsten adoptiert. Eingehüllt in plaudrige Herzlichkeit und Selbstironie, hatte sie sich in der überheizten Wohnung dieser Fremden heimischer gefühlt als je bei ihren Eltern. Danach war sie stundenlang durch übelriechende Straßen der Lower East Side spaziert, bis sie fror.
Und doch war sie jetzt hier. Hatte sich unterwegs ausgemalt, wie sie in der Lobby in einem gut einsehbaren Sessel sitzen und darauf warten würde, nur ein klein wenig überrascht von ihrem Buch aufzuschauen. Dann, so ihr Plan, hätte sie endlich Gewissheit. Müsste sie sich nicht länger fragen, ob sie in seinen Augen etwas gesehen hatte. Zwar hatte sie sich ermahnt, nicht so dumm zu sein. Sie war dreißig, nicht dreizehn, Himmelherrgott! Aber dennoch hatte sie zwei Nächte lang auf dünne Hoteltapeten gestarrt. Auch deshalb war sie hergekommen: um endlich wieder durchzuschlafen.
Ihr Plan hatte nicht vorgesehen, dass sie ihn zuerst sah. Dass sein Gesicht im grausamen Kunstlicht so müde wirkte. Und erst recht nicht, dass er sie so fremd und von ferne anschaute.
»Ich möchte Sie nicht aufhalten«, sagte sie, als am Ende der Passage eine Treppe in Sicht kam.
»Ich habe heute keine Termine mehr.«
Anstatt die Stufen ins Foyer zu steigen, bog er rechts ab. Sie durchschritten die feuchtwarme Dunstwolke eines Barber Shops. Der Wachmann an einem schmucklosen Treppenaufgang schien Herman wiederzuerkennen und ließ sie passieren. Hinter einer dunklen Eisentür öffnete sich ein großer, hell beleuchteter Saal, in dem weiß gekleidete Frauen Dutzende Tische rasch, aber nicht gehetzt mit Tellern und Geschirr bestückten. Obwohl keine von ihnen auch nur aufsah, glaubte Irene, eine geheime Zeremonie zu stören.
»Ich versteh’ nicht ganz.«
Er lächelte, als machte er ihr ein teures Geschenk:
»Ein Foyer ist dazu da, Gäste zu beeindrucken. Es ist das freundliche Gesicht des Hauses. Aber man kennt ein Gebäude erst, wenn man durch seinen Bauch gekrochen ist. Am besten, man beginnt in der Kellersohle und arbeitet sich nach oben. Das Ganze dürfen nur wenige sehen.«
Irene war nicht sicher, ob sie das Geschenk annehmen wollte. Sie hatte das Foyer auch deshalb als Treffpunkt gewählt, weil sie dort einigermaßen sicher war vor ihrer Klaustrophobie. Die Angst war eine Kindheitsfreundin, die ihr schon lange peinlich geworden war, aber sehr an ihr hing. Andererseits fand Irene ihr Hotelzimmer, das sie vom eigenen Geld bezahlte, auch deshalb so gemütlich wie einen zu engen Schuh. Sie erwiderte Sörgels Lächeln und nickte.
(Später dachte sie manchmal daran, was er ihr an diesem Abend alles gezeigt hatte. Oder besser: Sie fragte sich, wie er sie dazu gebracht hatte, etwas zu empfinden für Dinge, die ihr zuvor als tot, kalt und nebensächlich erschienen waren. Nie enträtselte sie ganz, wie er das geschafft hatte. Und, ob es überhaupt seine Absicht gewesen war.)
Er führte sie durch ein Labyrinth aus Gängen und Räumen, das er offenbar bestens kannte. Er stemmte sich gegen eine Eisentür, hinter der Köche mit verschwitzten Gesichtern unter weißen Mützen schweigend beieinandersaßen und rauchten. Zeigte ihr den Silver Polishing Room und den benachbarten Knife Cleaning Room. Breitete die Arme aus wie ein Zirkusdirektor, als sie eine lärmerfüllte Sauna voller komplett bekleideter Menschen betraten, die er Main Kitchen nannte. Rief in einer Halle, die Irene an den Kohlenbunker eines Ozeandampfers erinnerte, hier würden täglich fünfundzwanzigtausend Pfund Wäsche gewaschen (»Der normale Verbrauch einer Fünfundzwanzigtausendeinwohnerstadt!«). Als er von den dreitausenddreihundertvierzig Telefonapparaten im Haus sprach, klang er stolz wie ein General bei der Inspektion seiner Truppen. Und sie nickte, während er die einhundertsechsundfünfzig Techniker erwähnte, die sicherstellten, dass Heizungen, Lichtanlagen, Waschtrommeln, Eiswasserspender, Ventilatoren, Aufzüge und vieles andere über Elektrizität verfügten. Dabei spülte das Rauschen der mannshohen Geschirrwaschmaschinen auch seine Worte fort.
Sie fröstelten nebeneinander in dunklen Hallen, in denen Tonnen voller Papier, Metall, zerbrochenem Glas und Porzellan auf den Abtransport warteten. Ihre Gesichter röteten sich, als sie Männern zusahen, die Abfälle in prasselnde Ofenfeuer warfen. Flüsternd betraten sie Werkstätten für Schneider, Bügler, Schreiner, Polierer, Maler, Tapezierer und Glaser (»Alle Räume sind mit Maschinen ausgestattet«). Und sie bedauerte es, dass nur Hotelgäste die dreierlei Schwimmbecken zu sehen bekamen. All das interessierte sie mit einem Mal wirklich. Nach einer Ewigkeit, die vielleicht eine Dreiviertelstunde gedauert hatte, sah sie ein Fenster – und dahinter Straßenlaternen, Autos und Passanten mit Hüten. Herman und Irene entstiegen der Unterwelt. Ihre Ohren rauschten.
»Stellen Sie sich vor: Sie kommen heim und finden ein Maschinenschreiben auf dem Tisch«, sagte Herman. »Der Apparat hat verpasste Anrufe aufgenommen und abgetippt! Toll, oder?« Sie standen jetzt im Türrahmen eines leeren Gästezimmers. Eine Putzfrau gab sich im Vorbeigehen keine Mühe, ihre Verwunderung zu verbergen. »In jedem Stockwerk gibt es eine Leitungsfiliale, die mit der Telefonzentrale verbunden ist. Damit das funktioniert, müssen Architekt und Maschineningenieur eng zusammenarbeiten. Und wenn sie alles perfekt machen, ist das Ergebnis« – er suchte unter der Zimmerdecke nach Worten – »eine technische Großleistung im Dienste der Menschen. Zivilisation!«
Irene schaute ihm ins Gesicht. Daraus verschwunden war der Fremde aus der Passage – und zurück der heiter-selbstsichere Herr vom Schiff. Sie wollte, dass er blieb. Seltsamerweise wusste sie kaum noch, was sie in den vergangenen zwei Wochen in ihm gesehen hatte. Mit jedem Abbiegen im Labyrinth der Flure, jeder Bewegung seines großen schlanken Körpers und jedem genau akzentuierten Wort veränderte er sich. Das Beste wäre, wenn er sich als aufgeblasener Kerl erwies. Dann konnte sie zurück nach München reisen und die Erinnerung an zwei seltsame Begegnungen stoßfest verpacken und das Bündel tief im Lagerraum verstauen. Aber so weit war es noch nicht.
»Was«, fragte sie, »hat Ihnen in Amerika am meisten gefallen?«
Das, dachte sie kurz darauf, war ein Fehler.
*
Je länger der elevator sie leise quietschend in die Höhe zog, desto weiter entfernte Herman sich von dem Mann, der Irene Villanyi geantwortet hatte:
»Das zeig’ ich Ihnen. Kommen Sie!« Der Mann dort unten war überzeugt gewesen, ihr gefalle der Rundgang. Sie hatte sogar nachgefragt, was mit dem zerkleinerten Porzellan passierte. (Es kam, soweit er wusste, auf die praktisch menschenleere Insel Staten Island.) Der andere Mann war sicher gewesen, dass sie nicht bloß eine gelangweilte höhere Tochter war, die Ablenkung suchte. Warum las jemand von ausgetrockneten Meeren, lange überschwemmten Landbrücken und Eiszeiten, wenn nicht aus großäugigem Interesse an der Welt? Deshalb hatte er kurzentschlossen entschieden, ihr zu zeigen, was ihn ähnlich berührt hatte wie jene Nachmittage in Sankt Bonifaz. Ein großzügiges Trinkgeld für den Liftboy, der Herman wiedererkannte, machte es möglich, dass sie beide allein den Aufzug benutzten. Aber je näher sie dem 26. Stockwerk kamen, desto stärker wurde ein Ziehen im Bauch, das wahrscheinlich nicht von der Fahrt kam. Sie lächelte ihn an, als wollte sie ihn ermutigen, aber dann blickte sie immer wieder geradeaus, dabei war da nur dunkelbraune Wand.
»Also«, sagte er auf Höhe der sechsten Etage, »das dort oben ist natürlich nicht das Einzige, was mir an Amerika besonders gefällt. Ich war in großen Hotels in Buffalo und Washington. Sehr interessant alles, sehr funktional.«
Sie lächelte mit geschlossenem Mund und inspizierte dann den glänzenden Boden.
»Und das Panamerika-Haus in Washington erst. Kennen Sie das?«
Lächeln, Kopfschütteln, Starren. Die Stille war ein unsichtbarer Dritter, der ihnen die Luft wegatmete.
»Das ist die Zentrale der Panamerikanischen Union. Die Einheit von Nord- und Südamerika, in Stein gefasst. Kein einzelner Staat hat hier das Sagen, sondern die Gemeinschaft aller Staaten, große und kleine.«
Sie passierten erst die neunte Etage? Vorhin musste der Lift deutlich schneller gewesen sein. »Drinnen gibt’s eine Ausstellung. Große Bilder zeigen dem Südländer, was im Norden alles erzeugt wird, und umgekehrt bekommt der Nordamerikaner Lust auf die Pflanzen, Früchte, Palmen und Schönheiten des Südens. Die Vereinigung der beiden Kontinente ist bloß eine Frage der Zeit, wissen Sie?«
Er gab ihr Zeit, ihn zu unterbrechen. Aber sie sah nur starr geradeaus, als sei er der Liftboy.
»Worauf ich hinauswill«, sagte er, weil das Schweigen wirklich unangenehm wurde: »Das Haus nimmt die Einheit von Norden und Süden vorweg. Mit verändertem Bewusstsein gehen die Besucher zurück in die Welt. Das wird die Welt früher oder später verändern. Architektur erschafft also Wirklichkeit.«
Auf Höhe des elften Stocks nickte sie, ohne aufzublicken. Im zwölften hielt die Kabine mit einem leichten Ruck. Als sich die Tür öffnete, sah er fassungslos, dass niemand einstieg. Sie waren zwei verirrte Nervensignale, die das Rückgrat eines Riesen hinaufkrochen.
Beim Leuchten der 13 erzählte er vom Friedenspalast in Den Haag. Bei der 15 bedauerte er, dass der Weltkrieg die Zusammenarbeit der europäischen Staaten empfindlich verzögert habe. Als sie die 16 passierten, tröstete ihn der Gedanke an den Völkerbund, der trotz aller Konstruktionsfehler Großes leisten könne. Bei der 19 sehnte er sich nach einer Völkerbund-Zentrale in Genf, »etwas architektonisch ganz Neues, wie der Bund selbst«. Und zwischen 20. und 21. Stock war er fast sicher, dass ihm nicht nur die Kabinenwand zuhörte. Doch als der elevator verlangsamte, wurde das Ziehen in seinem Bauch stärker. Daheim in der Weinstube in der Werneckstraße hatte einer seiner Künstlerfreunde gesagt, der Sörgel doziere wie ein Doktor. Außer wenn er nervös sei, dann doziere er wie ein Professor.
Auf Höhe der 24 bekam das Ziehen im Bauch Verstärkung von einem Drücken, und er verfluchte die elegante Konstruktion von McKim, Mead and White, die sie so verlässlich ans Ziel brachte. Wenn er sich wirklich in der Frau getäuscht hatte, dann erkannte er es immerhin früh genug. Das letzte Mal hatte er seinen Fehler erst bemerkt, als er schon geheiratet hatte.
Dann glitten die Türen mit einem verhaltenen Quietschen zur Seite, und kühle Luft an den Beinen erinnerte ihn daran, dass es da draußen Jahreszeiten gab.
*
Irene drängte sich, um dem stählernen Sarg zu entkommen, eilig an Herman Sörgel vorbei. Vor sich sah sie Glasfenster und dahinter Menschen, die ihnen den Rücken zuwandten. Sie zwang ihre Füße vorwärts, links, rechts, links, und schaffte es, weder zu stolpern noch zu rennen. Riss eine schwere Schwingtür auf und stand im Freien. Ging ein paar Schritte, bis sie endlich an der steinernen Brüstung stand, und schloss die Augen. Zwei Wochen lang hatte sie es geschafft, in dieser Stadt der Aufzüge keinen einzigen zu betreten. Aber ihre Klaustrophobie schlief nicht, sie lauerte nur. Eine Brise strich ihr über Pelzkragen und Haar wie ein zartes Tuch. Sie atmete tief ein und wollte nie wieder ausatmen. Tat es dann doch. Atmete wieder ein. Bis sie sicher war, Luft holen zu können, wann immer sie wollte. Als Irene schließlich die Augen öffnete, sah sie in ein Sternenmeer.
Elektrische Sonnen erhellten die Siebte Avenue. Quadratische und rechteckige Sterne leuchteten aus Backsteinbauten herüber. Kometen schossen vorbei, aber nicht weit oben, sondern tief unten, und hupten. Auf dem Hudson River stieß ein Frachtschiff weißen Nebel aus. Darüber ging ein künstlicher Mond auf und unter und wieder auf, bis sein Pilot genug hatte und ein zweiter seine Kunststücke vorführte. Und irgendwo vor der Stadt, wo die Finsternis alles Licht verschlang, wachte Lady Liberty. Hier oben waren alle Geräusche der Stadt gedämpft. Irenes Körper aber erinnerte sich deutlich an Dampfschwaden aus mannsgroßen Waschkesseln in ihrem Gesicht. An den Geruch von gebratenem Fett, an die trockene Hitze eiserner Heizkörper, an die unwirkliche Kälte der Eiskammer, an das Rauschen Tausender Glasscherben, die in eine Tonne stürzten. Und an die Fahrstuhlwände, die sich an sie herangeschlichen hatten, bis sie geglaubt hatte, ohnmächtig zu werden. Sie legte ihre Hände auf die kühle steinerne Brüstung. Menschen hatten aus Stahl und Beton einen Riesen geformt, auf dessen Schultern sie nun stand. In dessen Innern schufteten ohne Unterlass unbekannte Menschen, wärmten, nährten, kühlten, pflegten und leerten den Riesen in einer Welt jenseits von Tag und Nacht. Sie mochten sich auf der Straße nicht erkennen, aber sie waren unsichtbar miteinander verbunden.
»Alles ›nur‹ Menschenwerk«, flüsterte sie und wusste selbst nicht genau, was sie meinte. Im Augenwinkel erkannte sie Herman Sörgel, der neben ihr stehen blieb. »Warum haben Sie mich hierhergeführt?«
»Gefällt es Ihnen?«
»Sagen Sie schon.«
»Ich will Sie nicht langweilen.«
»Wieso langweilen?«
»Ich neige dazu, Monologe zu halten.«
»Dann unterbreche ich Sie ab und zu.« Der Lichtstrahl eines Scheinwerfers tanzte über eine dunkle Backsteinfassade.
»Also«, er räusperte sich, machte eine Pause, »schauen Sie sich bitte die Avenue an«. Sie sah in die künstliche Schlucht, an deren Flanken Gebäude emporragten wie Klippen, manche wenige Stockwerke hoch, andere höher als das Hotel. Von innen wie außen beleuchtet, glichen sie dunklen Eiskristallen. »Stellen Sie sich vor, die Avenue wäre bebaut wie eine Straße in Berlin oder Paris. Überall ›einheitliche Blockfront‹, die gleiche vorgeschriebene Gebäudehöhe, alles schön ordentlich und gleichmäßig. Harmonie ist schließlich Schönheit, richtig? Aber diese Stadt wäre tot. Ihr architektonischer Nerv würde absterben, ihr Rhythmus und Pulsschlag aufhören.« Er trat einen Schritt vor, stand jetzt direkt neben ihr. »Warum übt gerade diese Stadt auf Verstand und Seele so eine Macht aus? Weil sie vollkommen absichtslos erbaut wurde. Sie strotzt vor Kraft. Will sich bewegen, wachsen, sich immerzu verändern. Sie ist wie …« Er schüttelte leicht den Kopf und legte die Hände auf die Brüstung, als wollte er sich abstützen.
»… wie das Leben selbst«, sagte sie der Abendluft.
Sie spürte, wie er ihr das Gesicht zuwandte, erst sie anschaute, dann das glänzende Halbdunkel vor ihnen. So standen sie eine Weile nebeneinander, bis er schließlich leise fragte:
»Wollen wir gehen?«
»Ich würde gern noch bleiben. Falls es Ihnen nicht unangenehm ist, hier zu sein. Allein mit einer Frau, die nicht Ihre Frau ist.«
Sie konnte nicht glauben, wie direkt sie war. Und wie wenig es sie kümmerte.
»Sie könnten mich einfach fragen, ob ich verheiratet bin. Geschieden. Seit vier Jahren.«
»Das tut mir leid.«
»Mir nicht.«
Sie lächelte. »Kinder?«
Er schüttelte sehr langsam den Kopf.
»Ich«, hörte sie sich sagen, »werde nie heiraten.«
Deshalb hatte sie ständig an ihn gedacht. Nicht, um einen seltsamen, wenn auch seltsam attraktiven Mann wiederzusehen. Zumindest nicht nur deshalb. Sondern auch, um diese andere Frau in sich hervorzulocken, die so etwas auszusprechen wagte.
»Im Krieg«, sagte sie nach einer Pause, »hörten die Soldaten in den Schützengräben, wie ihre Feinde ein paar Meter weiter Kaffee kochten, lachten, schnarchten. Dann rannten sie hinaus, um einander zu töten. Wer überlebte, zog sich erschöpft zurück, und am nächsten Tag ging’s weiter.« Sie stellte sich vor, wie das Spalier der Laternen dort unten verblasste, ein Licht nach dem anderen vor der Schwärze kapitulierte. »Meine Eltern führen seit vierunddreißig Jahren Krieg gegeneinander. Eigentlich vor allem meine Mutter gegen meinen Vater. Jeden Tag überrennt sie seine Stellung. Am nächsten Morgen steht er auf, als sei nichts geschehen. Ich glaube, das macht sie nur noch wütender.«
Es war schrecklich, so was zu sagen. Und es war gut, denn es war die Wahrheit.
»Ihre Mutter und meine Exfrau sollten einander kennenlernen«, sagte er ruhig. »Würden sich gut verstehen.«
Sie lachte auf; lachte, bis ihre Zähne kalt wurden. Dann sah sie ihrem Atem hinterher und fragte:
»Sie waren nicht einfach so auf der Kinderstation, oder? Damals, kurz nach dem Krieg?« Keine Ahnung, warum sie sich ausgerechnet jetzt an diese Szene erinnerte. Aber nicht zu fragen wäre ihr falsch vorgekommen, geradezu unehrlich. Ihre linke Hand streifte wie zufällig seine rechte, die auf der Brüstung ruhte. »Junge oder Mädchen?«
Er zog seine Hand zurück und trat einen halben Schritt zur Seite.
»Entschuldigung«, flüsterte sie. Ihr Herz raste wie vorhin im Käfig. Sie war zu weit gegangen, außer Kontrolle geraten, und zur Strafe würde sie 26 enge Stockwerke zu Fuß hinabsteigen müssen. Sie war zu viel für andere Menschen, zu laut, vorlaut.
»Das wollte ich nicht«, sagte sie noch leiser. »Ich meine …« Langsam legte er seine warme Hand auf ihre.
4
Nur in der Bewegung liegt endloser Reiz.
Erich Mendelsohn: Brief an Luise Maas (1910)
Zürich, 8. Mai 1926
Irene hielt die Augen geschlossen, damit die Nacht noch ein bisschen dauerte. Die Sonne tränkte schon das Hotelzimmer, hinter dem Fenster lärmte die Stadt, und ihr ganzer Körper erinnerte die vergangene Nacht. Alles, was sie wollte, lag in diesem Bett. Langsam legte sie sich auf die Seite und ihren Kopf auf seine schlafende Brust. Genau so, wie es in den Groschenromanen stand, die sie so lächerlich fand. Es fühlte sich herrlich an. Alles fühlte sich herrlich an mit ihrem seltsamen Heiligen.
Nachts war Herman ihr auf eine andere Weise nah als tagsüber. Am Tag konnten sie stundenlang ihre Reisen planen. War Rom im Juni schöner als Nizza im August, und was sprach für Monaco im September? Manchmal aber entfernte Herman sich von ihr, gerade indem er mit ihr redete. Wenn er von Denkmälern der römischen Antike oder der norditalienischen Gotik erzählte, veränderte sich sein Blick. Er war dann weit weg, von der Welt getrennt durch sein Einglas. Der Herman der Nacht aber war immer ganz bei ihr, auch wenn sie nicht miteinander schliefen. Er war dann ganz Körper, ganz Wärme, ganz nah.
»Liebste.«