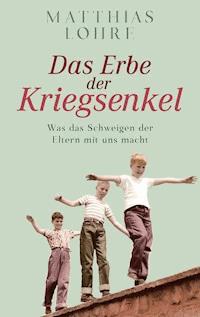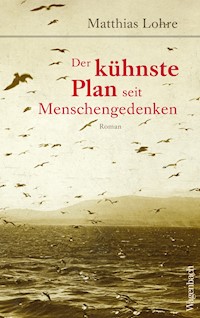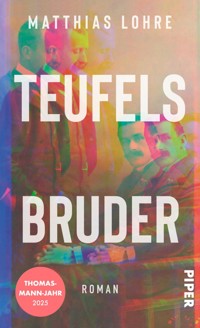
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thomas Manns letztes Geheimnis Thomas Mann ist einundzwanzig und beinahe verliebt. Als er 1896 mit seinem älteren Bruder Heinrich die lang ersehnte Italien-Reise antritt, lässt der Gedanke an seine Jugendfreundin Ilse Martens ihn nicht los. Bei ihr, hofft er, fände er den Halt, nach dem er sich so sehnt. Wäre da nicht dieser melancholisch blickende Jüngling. An ihn muss er immerzu denken, seit er ihm in Venedig über den Weg gelaufen ist. Aber warum nur? Wäre er doch bloß souverän und zielstrebig wie Heinrich. Der ist bereits, was Thomas gern wäre: Schriftsteller! Allein in Neapel will er herausfinden, was den Jungen traurig macht und ihn in einer Novelle verewigen. Doch anstatt sich so die rätselhafte Anziehung vom Leib zu schreiben, widerfährt Thomas im warmen Süden etwas zutiefst Schockierendes, das ihn für immer verändern wird. »Matthias Lohre erzählt historisch sehr genau. Und er kann sehr, sehr gut erzählen. Er löst die Grenze zwischen Fakt und Fiktion ganz hervorragend auf und ist immer sehr nah bei seinen Protagonisten. Er schafft eine ungeheuer glaubwürdige Atmosphäre.« ORF, Ö1 Ex libris In seinem neuen Roman bringt Matthias Lohre uns den vielleicht größten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts ganz nah: als ängstlichen jungen Menschen auf der Suche nach einem Platz im Leben. Damals wurde aus dem Schulversager der Autor der weltberühmten »Buddenbrooks«. Dabei, so gestand er kurz vor seinem Tod, begegnete er im Gebirgsstädtchen Palestrina dem Bösen schlechthin. »Teufels Bruder« erzählt von Erwachsenwerden, Geschwisterrivalität und der Sehnsucht nach Liebe – spannend, reif und schön.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Covergestaltung: Cornelia Niere, München, unter der Verwendung einer Collage des Autors
Coverabbildung: The History Collection / Alamy Stock Photo
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Motto
I. Kunst
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II. Leben
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
III. Tod
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
IV. Liebe
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Epilog
Dank
Kulturförderung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Für Jonathan
Motto
Der Künstler ist der Bruder des Verbrechers und des Verrückten.
Thomas Mann
Erst mit Lieben beginnt Dichten.
Heinrich Mann
I. Kunst
Hör mir zu. Setz dich wieder. Du bist nicht der, für den du dich hältst. Du gehörst hier nicht hin. Du bist ein Traum, der sich in die Welt verirrt hat. Und jetzt weißt du nicht, wohin mit dir. Du schlägst und trittst um dich, weil du festen Halt suchst, aber da ist keiner. Und weißt du, was? Da wird nie einer sein. Glaub mir, denn ich bin wie du. Entscheide dich. Willst du leben oder nur scheinen? Willst du den Schmerz, der dich spüren lässt, dass du wahrhaftig lebst? Willst du das? Willst du wirklich lieben? Das hier ist deine Chance. Sie ist deine letzte. Du weißt, ich habe recht. Hör mir zu, verdammt, denn ich habe ein Messer und du nicht. Gut. Jetzt hör zu.
Prolog
Es kenne mich die Welt, auf dass sie mir verzeihe!
August von Platen:Gedicht XXXIV(1828)
Rom, 29. April 1953
Je länger er auf dem Balkon stand, die würzige Frühlingsluft einatmete und zusah, wie dort unten junge Menschen zwischen Straßenbäumen und besonnten Hausfassaden promenierten, desto verlockender erschien es ihm, über die Brüstung zu klettern und mit der verbliebenen Entschlossenheit seiner siebenundsiebzig Jahre hinunterzuspringen. Er stellte sich vor, wie die Dinge im Fallen ihre Form abstreiften, sich auflösten in Licht und Wärme, wie er endlich mit allem eins würde, und schloss die Augen. Sein müdes Herz begann zu rasen, und er griff die Brüstung fester, bis die Hände schmerzten. Mühsam atmete er ein und aus, ein und aus, und bald erinnerte nur noch ein Zucken im Mundwinkel an den Moment der Schwäche. Dem alten, nie vergessenen Traum durfte er nachhängen, sich ihm aber niemals hingeben.
Mit einem Ruck wandte er sich ab und trat zurück in die Suite. Als er die Balkontür hinter sich schloss, sprang Algy an seinen Beinen hoch.
»Hierher. Hier!« Katia wies auf den Teppichboden neben dem Stuhl, in dem sie die morgendliche Post sortierte. Zwar gehorchte der schwarze Pudel nicht, ließ aber immerhin von seinem Herrn ab und beschnüffelte einen von Dutzenden Blumensträußen, die das Zimmer mit schwerem Duft erfüllten.
»Nach der Audienz, da hätten wir zurückreisen sollen«, sagte sie. »Wir wären jetzt schon in der Luft.«
In fast fünfzig Jahren Ehe hatte er es sich abgewöhnt, seiner Frau zuzustimmen, wenn sie recht hatte. Es kam einfach zu häufig vor. Wie er vorhin das Knie vor Pius XII. beugte und den Ring des Fischers küsste, das bildete den idealen Schlusspunkt einer Geschichte, die vor mehr als einem halben Jahrhundert in Scham und Schande begonnen hatte. Seiner Geschichte. Warum hatte er dann der Fahrt in die Berge zugestimmt?
Als es an der Tür klopfte, seufzte er gequält.
»Du hast es so gewollt«, sagte sie, ohne aufzublicken.
»Sie sind zu früh. Fast dreißig Minuten.« Er griff sich an den Hals.
Wieder klopfte jemand.
»Was ist denn?«, rief sie. Zur Antwort kam unverständliches Murmeln. »Herrgott. Na, dann kommen Sie herein!«
Ein Page trat, eine Verbeugung andeutend, ins Zimmer. Wortlos trug er zwei Blumenbouquets zu den anderen. Auf dem Rückweg legte er, ohne den Schritt zu verlangsamen, einen länglichen Umschlag auf den Tisch.
»Was ist das?«, fragte Katia laut.
Der Hotelbedienstete hielt widerstrebend inne, drehte sich um und rang die Hände. »Ein Herr bat mich, es Ihnen zu geben. Er sagte, er warte unten, für den Fall, dass Sie so freundlich sein wollen, ihn vorzulassen. Verzeihen Sie, bitte. Ich dachte, Sie wüssten davon.«
Katia schaute auf das Kuvert, an dem eine Visitenkarte heftete. »Fabius von Gugel?« Sie sah zu ihrem Mann. Der schüttelte kaum merklich den Kopf.
»Nehmen Sie’s wieder mit. Und wenn Sie so etwas noch einmal machen, melde ich Sie dem Direktor.«
Mit gesenktem Kopf griff der Page den Umschlag und eilte zum Ausgang. Als er die Klinke drückte, glitt ein Bogen Papier auf den Teppichboden. Die Tür schloss sich.
Normalerweise hätte er Katia mit einem Blick auf das Ärgernis aufmerksam gemacht. Vielleicht aber fiel ihm, als er darauf zutrat, etwas ins Auge. Jedenfalls bückte er sich ächzend und hob es auf.
Es war eine Zeichnung, schwarz auf weiß. Ihr Stil ähnelte den spätmittelalterlichen Stichen, die er im Hexenhammer gesehen hatte. Doch was sie zeigte, war einem Traum ähnlicher: Vom Himmel breiteten sich Sonnenstrahlen in alle Richtungen aus. Wo die Sonne – oder das Antlitz Jesu – hätte prangen müssen, blickte ein Augenpaar den Betrachter an. Darunter tanzten eine Nase und ein buschiger Schnurrbart, der in dunkle Wolken überging. Die untere Bildhälfte füllte eine geschwungene Küstenlinie, gesäumt von Klippen und einer Art Festungsanlage. Aus einem Gebäude loderten Flammen, doch die schien niemand zu beachten – weder das riesige Augenpaar noch die Silhouette, die im Vordergrund auf einer Anhöhe stand. Das Wesen war weder Frau noch Mann, und, abgesehen von einem Strumpfband am rechten Oberschenkel, nackt. Sein sonderbarer Mund ähnelte dem Maul eines Lurchs. In der Linken hielt es einen Mantel – oder: nein, keinen Mantel, eher eine Art Hautsack, von dem Beine, Brüste, Arme und ein Gesicht schlaff herunterhingen. Daraus troff eine dunkle Flüssigkeit, die sich in einer Lache sammelte. Das Seltsamste aber war, dass das Wesen offenbar keine Schmerzen litt, sondern gelassen, ja, erstarkt wirkte, als hätte es eine zu eng gewordene Hülle abgestreift wie eine Schlange ihre Haut.
Trotz der südlichen Wärme war ihm, als umspüle kaltes Wasser seine Füße. Als er das Blatt fortlegen wollte, fiel sein Blick auf die Handschrift auf der Rückseite.
Er las.
Erst ein Drücken in der Kehle, dann pochende, beinahe schmerzhafte Herzschläge. Das Wasser stieg.
Hastig drehte er das Blatt wieder um: Der Küstenstreifen – formte der nicht eine große Bucht? An dem Schenkel des Mannfrauwesens hing kein Strumpfband – das waren Löcher. Und der Mund – wie hatte er es übersehen können? – glich keinem Amphibienmaul, sondern einer Reihe kleiner, tiefer Stiche. Dazu das zu Boden triefende Blut, all das Blut.
Alles war wieder da, Zeit und Raum eine Illusion. Er setzte sich.
»Tommy?«
»Es geht schon.«
»Komm, ich sage ab.« Sie nahm den Hörer.
Er schüttelte den Kopf.
»Was willst du dir da oben überhaupt anschauen? Mandadori sagt doch, das alte Haus …«
»Katia …«
Widerwillig ließ sie den Hörer sinken und widmete sich – mit siebzig Jahren noch immer kopfschüttelnd über jeden Starrsinn, der nicht der eigene war – wieder der Post. Ihren Mund umgab ein Strahlenkranz aus Falten; die schwarzen Augen aber glänzten wie einst. Bis heute schien Katia, getrieben von einer ihm fremdartigen Energie, nichts und niemanden zu fürchten. Ihr würde er weder seine zitternden Hände zeigen noch erzählen von der Panik, die ihn für Augenblicke überschwemmte. Er hätte nicht herkommen dürfen, auch nicht nach all den Jahren.
Mehr als einmal hatten ihn, umringt von den immer gleichen Sektempfangsgesichtern, die Nerven im Stich gelassen. Das Klirren eines Glases, das Tremolo eines Wortes, gesprochen zwei Stehtische weiter, hatten genügt, ihn für Sekunden zu betäuben. Und in der Sixtinischen Kapelle war er, zum ersten Mal seit damals Aug in Aug mit dem Jüngsten Gericht, nicht allein vor Rührung verstummt. Vor einer Blamage bewahrt hatten ihn nur der routinierte Blick ins Leere und Katias leitende Hand.
Natürlich wäre es klüger, die strapaziöse Fahrt in die Berge abzusagen. Aber mochte auch die ganze Welt seine Rückkehr nach Italien als Triumph feiern – wenn er zurückscheute vor dem, was ihm in Palestrina begegnen mochte, wäre alles schal. Deshalb musste er dorthin. Aber hatte er die Kraft dazu?
Er hielt das Papier in seiner zitternden Hand. Das kalte Wasser stieg nicht länger, wich aber auch nicht.
»Ruf unten an.«
»Ja? Gut, Tommy. Ist besser so. Schlaf ein wenig. Ich wecke dich zum Diner.«
»Nicht das.«
Als sie aufblickte und die Zeichnung sah, zog sie die Brauen zusammen. »Du willst doch nicht etwa …«
»Wir haben noch etwas Zeit.«
»Du brauchst Ruhe.«
Doch er schwieg, und so griff sie seufzend zum Hörer.
Kurz darauf stand ein schlanker, elegant gekleideter, fast noch junger Mann im Zimmer. Den Umschlag hielt er an die Seite gedrückt und nickte seinen Gastgebern höflich, aber ohne Scheu zu.
»Wenn ich Sie recht verstehe, mein Herr, haben Sie da eine Reihe von Zeichnungen. Nun denn«, er räusperte sich und hielt das Blatt hoch, »was ist das?«
Fabius von Gugel lächelte. »Gefällt es Ihnen?«
Als er keine Antwort erhielt, blinzelte er mehrere Male, öffnete hastig den Umschlag und breitete die Bögen auf dem Esstisch aus. »Das Ganze ist ein Zyklus.« Anfangs, erklärte er, während er Bild um Bild nebeneinanderlegte, habe er das Märchen von Aschenbrödel illustrieren wollen. Aber nach und nach hätten sich ihm Figuren aufgedrängt. Seltsame Figuren, die er selbst nicht verstehe und die sich ihren Weg aufs Papier erkämpften. Mal wählten sie den Stil der frühen Moderne, mal den des Barock. Andere wollten Illustrationen der Frühen Neuzeit ähneln, ganz so, als prangten sie neben einem gestrengen Luther-Porträt, oder als ritten sie mit Dürers vier Apokalyptischen Reitern über die Seiten.
Während Katia unter protestierendem Schnaufen die Post vom Tisch räumte, beugte er sich über die Bilder. Auf einem lehnte ein männlicher Torso mit Pferdekopf lässig auf einem Polster, das aussah wie eine riesige Tube, aus der Zahncreme quoll. Auf einem anderen posierte eine Frauenfigur in wallenden Kleidern, ihre Körpermitte auseinandergezogen wie Gummi. Unter den Zeichnungen standen neben Auszügen aus Aschenbrödel auch kurze Texte. Texte wie der, der sein Herz hatte rasen lassen.
»Und die Formulierungen? Woher haben Sie die?« Wie beiläufig hielt er den Papierbogen vor sich hin.
Dein Ehrgeiz war vergeblich, stand darauf, und vergeblich ist der Gehorsam, der sich nur zur Hälfte bewährt! Die Gräber werden bleiben. Du bist nicht der, für den du dich hältst. Du gehörst nicht hierher. Du bist ein Traum, der sich in die Welt verirrt hat.
»Wie finden Sie sie?«
»Durchaus … interessant.«
Der Zeichner lächelte. »Meine Arbeiten liegen nicht jedem, ich weiß. Aber als ich erfuhr, dass Sie in Rom sind, dachte ich: ›Wenn es einen Menschen gibt, der sie zu schätzen weiß, dann der Verfasser des Doktor Faustus.«
»Ach, ja?« Er hob die Augenbrauen ein winziges Stück. »Warum?«
»Oh …« Gugel breitete die Arme aus und hielt die Handflächen nach oben, als trüge er etwas Großes und Schweres. »Ich kann mich in Bildern besser ausdrücken als in Worten. Wo soll ich anfangen?«
Die unbeholfene Art, mit der sein Gegenüber ihm Bewunderung zollte, beruhigte ihn. Er konnte sich einen weiteren Schritt ins Wasser wagen.
»Ich habe Sie heraufbitten lassen, weil Ihre Bilder Erinnerungen zurückbringen. Wissen Sie, als junger Mann verlebte ich mit meinem Bruder Heinrich eineinhalb Jahre in Italien. Damals schrieb ich nicht weit von hier die ersten Kapitel der Buddenbrooks nieder. Ich war zweiundzwanzig. Mein Bruder behauptete später, ich hätte gar nicht gewusst, was ich da tat – was daraus entstehen würde. Es verhielt sich anders. Manche Figuren standen mir früh, schon bei der Konzeption des Buches, derart lebhaft vor Augen, waren mir so intim bekannt, dass …« Er zögerte. Doch ein kurzer Blick auf die altersfleckigen Hände, die an seiner Seite ruhten, bestärkte ihn darin, weiterzumachen. »Christian Buddenbrook zum Beispiel: ein schwacher, wankelmütiger Mensch, ohne Halt und Ziel. Er bewundert seinen Bruder, den Senator, und kann doch niemals sein wie er. Wie sehr ihn diese Einsicht quälen muss! Mehr noch als die vielen Leiden, mögen diese nur in seiner Fantasie real sein oder nicht. Nun, dieser traurige Mensch geht sogar so weit zu glauben, er sähe, als er eines Tages in sein Zimmer tritt, in der Dämmerung auf dem Sofa einen Mann sitzen. Dabei konnte der Mann gar nicht vorhanden sein.«
Bei diesen Worten legte er die Zeichnung zu den anderen. Die Visite des Malers war ein Test gewesen, und er hatte ihn bestanden.
»Wir danken Ihnen für Ihr Kommen«, sagte er mit der Andeutung eines Lächelns. »Ihrer Arbeit wünsche ich viel Erfolg. Meine Frau und ich brechen gleich zu einem Ausflug in die Berge auf.«
Katia seufzte gerade laut genug, um gehört zu werden.
»Natürlich, verstehe.« Eifrig nickend, begann Gugel seine Zeichnungen einzusammeln. »Sehr schade, dass uns nicht mehr Zeit bleibt. Gern hätte ich mehr darüber erfahren, was Sie damals in Palestrina erlebt haben.«
»Wie?«
»Den Fremden im Zimmer. In den Buddenbrooks deuten Sie das nur an. Aber der Faustus schildert die Begegnung ja sehr ausführlich. Es ist doch dieselbe, richtig?«
Eine kleine Welle brach sich, spritzte an seinen Schenkeln hoch. Ebbte ab. »Beides ist Literatur«, sagte er betont ruhig. »Bitte verwechseln Sie sie nicht mit der Wirklichkeit.«
»Ich habe das Kapitel erst vor Kurzem wieder gelesen. Zur Inspiration. So kam ich darauf, mich bei Ihnen zu melden. Der steinerne Saal, das Rosshaarsofa, der kalte Windzug am warmen Sommertag, die Silhouette im Schatten – alles wirkt so anschaulich, bei aller Fremdartigkeit.«
»Weil ich es detailliert beschrieben habe. Hier.« Er deutete zum Ausgang.
»Sie sagten doch, meine Bilder förderten Erinnerungen zutage. Erinnerungen. Haben Sie ihn also damals wirklich leibhaftig vor sich gesehen?«
Der Schwindel kehrte zurück und zog konzentrische Kreise in seinem Kopf. Er stützte eine Hand auf den Tisch.
»Verzeihen Sie bitte«, sagte Gugel. »Nur habe ich selbst so manches erlebt, das ich nicht mit Worten erklären kann. Nie würde ich deshalb behaupten, es sei nicht real gewesen, denn für mich war es das. Was kann wahrer sein als die eigene Wahrnehmung? Finden Sie nicht auch?«
»Wir danken für Ihr Kommen«, sagte Katia so kühl es ging.
»Natürlich.« Gugel schob die Blätter mit beiden Armen zusammen wie verstreute Früchte. »Bitte sehen Sie es mir nach. Dass Sie mich empfangen und meine Arbeiten betrachtet haben, ehrt mich sehr. Und dass Sie mir auch noch von sich erzählen – das habe ich gar nicht zu hoffen gewagt! Deshalb bin ich vielleicht etwas zudringlich geworden. Aber ich bin so überrascht. Sie gelten schließlich allgemein als, nun ja, kalt.«
Katia blickte, die Lippen vor Empörung geschürzt, zu ihrem Mann. Doch der schwieg.
Kalt.
Natürlich wusste er, was die Leute sagten: Unnahbar sei er, abgehoben, ein Denkmal seiner selbst. Die Zuschreibungen grämten ihn schon lange nicht mehr. Er hatte gelernt, sich in sie einzuspinnen wie in einen Kokon, denn sie boten Schutz vor Aufdringlich- und Niedrigkeiten. Aber hätte jemand, der kalt bis ans Herz war, den Faustus schreiben können? Das Buch war seine Lebensbeichte, rücksichtslose Biografie. Danach hätte er, wie Wagner nach dem Parsifal, sterben sollen. Wie beschämend, wie grausam, dass er noch lebte – nur, um den Verfall seiner Kräfte erleiden zu müssen. Sah denn niemand, was offen zutage lag? Dass der Faustus blutige Realität war – seine Realität? Alles hatte er darin bekannt, bis zum Scheußlichsten. Wie blind die Menschen waren.
Die Hände zitterten wieder, und eine Strömung griff nach seinen Beinen. Gerade wollte er nach dem Portier läuten, um Gugel entfernen zu lassen, da hielt er inne. Hatte er dem Künstler nicht gerade selbst gesagt, Literatur und Leben seien verschiedene Dinge? In Wahrheit, das sah er im Moment der Schwäche klarer denn je, waren seine Werke niemals Bekenntnisse gewesen. Sie waren Labyrinthe. In ihnen hatte er sich der Welt nicht offenbart, sondern kunstvoll vor ihr versteckt, und war darüber alt geworden. Müde und sehnsüchtig schaute er durchs Balkonfenster. Der Himmel trug tröstliches Blau. Wie köstlich musste es sein, sich endlich rückhaltlos zu allem zu bekennen. Loszulassen. Die Audienz war eine Chance gewesen, Gnade zu erfahren, und er hatte sie verstreichen lassen.
Vor ihm stopfte Gugel eilig die letzten Bilder in den Umschlag.
Vielleicht, dachte er, war der Besuch des sonderbaren Malers kein Zufall. Vielleicht erwies er sich als Geschenk – als Gnade, derer er sich würdig zu erweisen hatte, indem er sie als solche erkannte.
Und letztlich war es gleichgültig, wem gegenüber man die Beichte ablegte.
»Wollen Sie vielleicht«, fragte er, »mit mir einen Blick hinaus werfen? Dann erzähle ich Ihnen eine Geschichte.«
»Tommy?«, fragte Katia.
Aber er antwortete nur: »Es ist gut.«
Kurz darauf schloss er die Flügeltüren hinter sich und seinem Gast.
*
Eine ganze Weile später – der Empfang hatte angerufen, der Wagen stand abfahrbereit – setzte Katia ihren Lieblingshut auf und nahm die Handtasche. Als nichts mehr zu tun war, klopfte sie mit dem Ehering an die Balkontür. Im nächsten Moment wurde diese aufgestoßen, und beinahe wäre sie mit Gugel, dessen Augen weit aufgerissen waren, zusammengeprallt. Wortlos eilte er an ihr vorüber, und als Algy vor Freude am Bein des Malers hochsprang, schien es fast, als unterdrücke der einen Schrei. An der Zimmertür angekommen, blickte er fragend zur Gastgeberin, nickte ihr zu – und war fort.
Katia lachte auf. »Das war amüsant, aber auch ein wenig gemein. Verdient hat er es. Was hast du ihm denn für eine Geschichte aufgetischt?«
Er ging wortlos nach nebenan, um sich frisch zu machen. Als er wenige Minuten später zurückkam, umfing ihn die schwüle Mittagsluft wie ein Bad, und er hielt sich so gerade, als balanciere er eine Krone.
»Du bist hoffentlich auf Gugels Unsinn nicht eingegangen«, sagte Katia, während sie den Sitz seiner Fliege prüfte. »Sonst tuscheln die Leute noch, du würdest senil. Nicht jeder kann mit deinem Humor …«
»Es ist wahr.«
»Ach, lass das.«
Abrupt blieb er stehen. Er fixierte ihre schwarzen Augen und sagte ruhig:
»Es ist so: Ich sah damals den Teufel.«
Sie starrte ihn an wie einen Fremden.
Er beugte sich hinab zu Algy, der seinen Herrn mit Schwanzwedeln begrüßte, und streichelte ihm den Hals. Schließlich richtete er sich auf, strich das Jackett glatt, prüfte den Sitz des Einstecktuchs und machte sich auf nach Palestrina.
1.
Der thatenscheue, willenlose Entartete, der nicht ahnt, daß seine Unfähigkeit zum Handeln eine Folge seiner ererbten Gehirn-Mängel ist, macht sich selbst weis, daß er aus freier Entschließung das Handeln verachte und sich in Thatlosigkeit gefalle, und um sich in den eigenen Augen zu rechtfertigen, baut er sich eine Philosophie der Entsagung, der Weltabkehr und Menschenverachtung auf.
Max Nordau:Entartung(1892/93)
München, 10. Oktober 1896
Wer behauptete eigentlich, um etwas von Wert zu schreiben, müsse einem Drastisches widerfahren sein? Er zumindest erlebte auch jetzt etwas, da er, umgeben von säuberlich gefalteten Hosen, gestärkten Hemden und einem halb leeren Koffer, auf seinem Bett saß und zusah, wie die Rauchkringel seiner Zigarette verwirbelten und sich unter der Zimmerdecke auflösten wie ein Traum. Ein guter Dichter, dachte er, konnte daraus etwas machen, während ein schlechter einem Vulkanausbruch beiwohnen mochte und doch scheiterte beim Versuch, das Geschehen einprägsam zu schildern. Vielleicht also, sagte er sich, während er in die Untertasse auf dem Bücherstapel neben sich aschte, vielleicht war es gut so, dass er die Reise nicht antrat.
Vom Wohnungsflur drang das Geräusch nahender Schritte herüber. Am Knarzen der Dielen – leiser als bei Clara, in kürzeren Abständen als bei der Frau Mama – erkannte er, wer es war. Als es klopfte, erwog er kurz, nicht zu reagieren. Andererseits: Wenn es jemanden gab, der seine Entscheidung verstünde, dann Ilse.
»Komm herein.«
Als sie ins Zimmer spähte, fiel ihr eine blonde, dem Zopf entkommene Strähne ins Gesicht. »Tommy, du musst los!« Abrupt blieb sie, ein Päckchen in der Hand, stehen. Ihr überraschter Blick ließ sie noch zarter und jünger wirken, als sie war.
»Ich fahre nicht«, sagte er. »Du kannst Lula die traurige Mitteilung machen, dass ich mein Zimmer behalte.«
Auf Ilses Stirn formte sich ein V.
»Das Ganze war überhaupt eine dumme Idee.« Er pflückte einen Tabakfetzen von der Tagesdecke.
Sie setzte sich auf den einzigen Stuhl und betrachtete Thomas interessiert, aber unschlüssig, als wäre er ein fremdartiges Gemälde. An anderen Tagen hätte Thomas ihren furchtlos-offenen Blick, den sie mit ihrem Bruder gemein hatte, charmant gefunden, aber nicht heute. Irgendwo musste doch noch etwas Tabak zu finden sein.
»Es ist normal, ein wenig Bammel zu haben.«
»Der Wechsel reicht schon jetzt kaum, um einigermaßen anständig durchzukommen. Wie soll ich da unten davon leben?«
»Hier.« Ilse zeigte auf einen akkurat geschichteten Zeitschriftenstapel. »Korfiz sagt, beim Simplicissimus suchen sie einen Lektor. Vielleicht könntest du deine Arbeit unterwegs erledigen und ihnen schicken.«
»Das Ganze«, sagte Thomas, als hätte er ihre Worte nicht gehört, »ist doch im Grunde ein grässliches Klischee. Jeder gefühlsduselige Schreiberling, der sich für Goethes Wiedergeburt hält, reist hin.«
»Wenn das so ist«, sie lächelte breit, »musst du doch erst recht los!«
»Ilsenschnibbe …« Er versuchte, ihren Kosenamen mit Vorwurf in der Stimme auszusprechen, und scheiterte kläglich.
»Ich dachte, es hätte dir dort gefallen.«
»Für ein paar Monate, ja. Aber was soll ich eineinhalb Jahre lang dort unten? Was, wenn mich nichts inspiriert, mir nichts einfällt?«
Zumindest nichts Gutes, dachte er. Vom ersten Italienbesuch hatte er vergangenen Herbst stolz zwei Erzählungen heimgebracht. Dafür hatten ihm Mama und der brave Schulfreund Otto Grautoff so ausdauernd höflich-kühles Lob gespendet, bis er endlich begriff und die Manuskripte, gemeinsam mit den Tagebüchern, verbrannte. Gut hatte sich das angefühlt, reinigend. Doch seither füllte sein Kopf sich wieder mit Geschichten über ungestillte Sehnsüchte und einsame Tode. »Du bist so jung«, hatte Grautoff ihm geschrieben, »und schon so alt«. Aber ihm war nun einmal, als hätten seine literarischen Figuren ihren eigenen Willen, der sie die Gemeinheit und Berechnung der Menschen meiden ließ. Sobald etwas in ihre scheinbar wohlgeordnete Welt eindrang, retteten sie sich in die Arme der Melancholie. Nicht der Tod, den er ihnen so häufig zudachte, war eine Katastrophe, sondern das Leben.
»Außerdem«, sagte er und setzte sich im Bett auf, »habe ich mich bereits entschieden.«
Ilse blickte auf den halb leeren Koffer. »Wann?«
»Gerade eben.«
»Dann weiß Heinrich noch gar nichts?«
Thomas schwieg.
»Du musst es ihm sagen.«
»Ach, der …«
»Er ist bestimmt schon auf dem Weg zum Bahnhof. Wenn du jetzt losfährst, kriegst du am Schalter vielleicht noch dein Geld zurück.«
Er wandte den Kopf ab.
»Ich dachte, der Wechsel reicht kaum.«
Er seufzte gequält, und im Zimmer wurde es still.
»Ich glaube«, sagte sie nach einer Weile, »eigentlich mag er dich. Er kann es bloß nicht so zeigen.«
Mit einem Ruck, als hätte ihn etwas gestochen, stand Thomas auf. »Das ist es nicht. Sie sind weg.«
Fast wünschte er sich, in Ilses Augen Häme oder Vorwurf zu erkennen. Dann hätte er sich wenigstens über ihre Zudringlichkeit ärgern können. Doch sie schaute ihn bloß aufmerksam an, wie damals, als er im Kasperletheater alberne kleine Stücke für sie aufgeführt hatte, und das war schier unerträglich. Leise sagte er:
»Ich habe die Billetts verloren.«
»Was?« Sie sprang auf. »Worauf warten wir?«
Er hob abwehrend die Hand. »Ich habe alles durchsucht. Das Zimmer, den Salon, sogar die Küche.«
»Wo warst du sonst? Doch bestimmt im Café.«
»Ich habe sie immer zu Hause gelassen. Gerade, um sie nicht zu verlieren.«
»Also sind sie hier irgendwo!« Die Aussicht auf eine Schatzsuche schien Ilse zu beleben. »Hast du in den Schränken nachgeschaut? In deiner Jacke?«
Er nickte.
»Aber irgendwo hier müssen sie sein.« Ihr Blick kroch in die Zimmerecken.
»Und ich sage dir, sie sind weg.«
»Aber wenn wir sie finden«, mit einem Schritt stand sie vor ihm und reckte den Zeigefinger vor seine Nase, »dann fährst du, ja? Versprichst du’s mir?«
So nah war sie ihm, seit sie erwachsen waren, noch nie gekommen. Ihm stieg Duft in die Nase, warm, blumig und beunruhigend. Er lächelte nervös. »Willst du mich etwa loswerden?«
Für einen Moment schien Ilse beinahe verärgert. »Ach, jetzt komm, Tommy. Wir haben wenig Zeit.«
»Wäre es nicht besser«, sagte er zögernd, »wenn man gar nichts täte?«
Wieder erschien das V auf ihrer Stirn. »Und wie soll uns das helfen, die Fahrkarten zu finden?«
»Nein, ich meine …« Er zuckte die Achseln, als könne er seine dummen Worte abschütteln. »Ach, es ist egal.«
Doch Ilses Blick suchte seine Augen. »Was meinst du?«
Er sah zu Boden. Wie sollte er das erklären? Es fiel ihm schon schwer genug, sich Gewissheit darüber zu verschaffen, was er dachte und empfand, wenn er allein mit sich war. Dann war er halbwegs fähig, seine streunenden Ideen an einem Punkt zu versammeln, um sie für ein paar Augenblicke zu betrachten. Das Bild, das entstand, war dunkel und flüchtig. Er war außerstande, eine Gedankenreihe von den anderen zu isolieren; noch weniger konnte er sie einem Gegenüber auseinandersetzen. Stattdessen überschwemmten ihn widersprüchliche Eingebungen, unzählige Aber, Jedoch und Andererseits, bis sich ihm die Kehle zuschnürte, er zu zittern begann und ihm der Magen klopfte wie anderen das Herz. In solchen Augenblicken ergriff ihn das Bewusstsein seiner Mangelhaftigkeit, Schwäche und Trägheit wie ein Fieber, und er fürchtete, verrückt zu werden. Das Einzige, das ihn vom Abgrund zurückzog, war das unbestreitbare Wissen darum, dass alles, sogar die peinlichste Verwirrung, eines Tages zu nichts zerfloss. Der Gedanke beruhigte ihn wie ein altes Wiegenlied. Der Tod, wie er ihn sich vorstellte, war ein Ort der Rast und Zuflucht. In dieser Heimat konnte keine Sehnsucht, kein sinnloses Hoffen ihn noch quälen. Der Tod war Friede und ewige Meeresstille.
Solange er nicht wusste, was der Süden bereithalten mochte, brauchte er sich nicht zu grämen, dass er es verpasste. Wenn er aber fuhr, würde das Erlebte ihn nur weiter verwirren. Deshalb war es im Grunde ganz einfach: Blieb er hier, ersparte er sich Leid. Doch als Thomas den Kopf hob, um Ilse das zu sagen, fixierten ihre kühl-blauen Augen ihn noch immer, und das Einzige, was er hervorbrachte, war:
»Ich … Ich will nichts mehr hoffen müssen.«
Er bereute seine Worte sofort.
»Was«, fragte sie langsam, »erhoffst du denn?«
»Na: nichts.«
»Nichts …«
»Ich hätte damit gar nicht erst anfangen sollen.«
»Wat wullt du denn nu eentlich, Tommy?«, rief sie. »Nu segg dat mal!« Ilse biss sich auf die Unterlippe. So redete vielleicht ein Mädchen, das zu viele Nachmittage bei den Arbeitern ihres Vaters verbracht hatte, aber keine Dame. »Wünschst du dir etwas, glaubst aber, dieses Etwas nicht bekommen zu können?«
»Ilse …«
»Weil du denkst, du darfst es nicht haben?«
Er atmete tief ein und aus.
»Ist es das?«
Er zog den Kopf zurück und wandte sich ab, als hielte sie ihm etwas Übelriechendes unter die Nase.
»Ach, mein guter Tommy.« Sie lachte auf. »Für jemanden, der so klug ist wie du, bist du manchmal ziemlich dumm.«
Jedem anderen Menschen hätte er die Worte übel genommen, Ilse aber tat ihm beinahe leid. Denn obwohl sie direkt vor ihm stand und hörte, was er sagte, hielt sie ihn für klug. Er aber wusste, wie er wirklich war. Und Heinrich wusste es auch.
Offenbar begriff Ilse endlich, dass es ihm ernst war. Jedenfalls rief sie mit gespieltem Ernst: »Geh nicht weg!«, drehte sich um und eilte aus dem Zimmer. Als sie kurz darauf zurückkam, hielt sie in den Händen Geige und Bogen.
»Bitte, nur ein paar Minuten. Ich sing’ dazu, ja?«
Zwar wusste er nicht, warum sie ihn ausgerechnet jetzt darum bat. Aber wenn es bedeutete, dass sie von der Suche nach den Fahrkarten abließe, sollte es ihm recht sein. Er klemmte die Geige zwischen Ohr und Schulter, und während er noch glaubte zu überlegen, was er spielen wollte, hatten seine rechte Hand und die Finger der linken sich bereits entschieden, denn im nächsten Moment lauschte er halb den – bestenfalls akzeptablen – Tönen, halb der sehnsuchtsvollen Melodie in seinem Innern. Langsam ließ er den Bogen über die Saiten dahingehen, aber nicht langsam genug für das überirdisch schöne Motiv. Er schloss die Augen, atmete tief ein und aus, und es ging ein wenig besser. Beim übernächsten Mal glaubte er beinahe zu schweben, wie damals als Halbwüchsiger in der Opernloge. Dann fiel es ihm ein, und er öffnete die Augen.
»Warum«, fragte er überrascht, »hast du nicht gesungen?«
Ilse lächelte nachsichtig, als hätte Thomas einen Scherz gemacht. Da erst begriff er, dass er sich wieder am Vorspiel des Lohengrin versucht hatte.
»Entschuldige.« Vorsichtig legte er die Geige beiseite. »Aber ich weiß jetzt, wo sie sind.«
Er hob die Untertasse mit den Zigarettenstummeln an, griff vom darunter liegenden Bücherstapel den obersten Band und öffnete ihn an der Stelle mit dem Lesezeichen. Ein Lesezeichen in Form einer Fahrkarte.
Genau genommen lagen in Jenseits von Gut und Böse zwei Billetts für die zweite Klasse: München – Zürich, Zürich – Venedig. Der erste Abschnitt verlöre seine Gültigkeit einen Monat, nachdem er ausgestellt worden war – morgen. Von der Seite, die sie markierten, hatte er sich einen Satz abgeschrieben: Die Erkenntnis wäre gering, wenn nicht auf dem Wege zu ihr so viel Scham zu überwinden wäre. Er starrte die Worte an, als könnten sie ihm raten, was er tun sollte.
In seinem Alter hatte Heinrich bereits Dresden, Berlin und halb Italien gesehen. Ihm hingegen, dem dreimaligen Sitzenbleiber, war nach dem glanzlosen Abgang vom Katharineum nichts Besseres eingefallen, als Mama, den beiden Schwestern und dem kleinen Vicco nach München zu folgen. Und das nur, um ihnen – und dem bärbeißigen Vormund daheim in Lübeck – eindrucksvoll seine fehlende Eignung zu allem Praktisch-Nützlichen zu beweisen. Anstatt im stickigen Büro Akten und Listen zu kopieren, wie es einem Volontär der Süddeutschen Feuerversicherungsbank zukam, hatte er an seinem Schrägpult Geschichten geschrieben. Deshalb (und weil er dort seine erste Erzählung publiziert hatte) war er vollends einverstanden gewesen, als die Firma ihm nach wenigen Monaten kündigte. Das war zwei Jahre her. Seither hatte er noch größere Ansprüche an sich selbst, aber kaum Erfolge. Einzig der reiche Verleger Albert Langen hatte in seinem neuen Blatt eine Erzählung veröffentlicht. Doch Der Wille zum Glück war Thomas selbst mittlerweile peinlich – das Werk eines pubertären, unerfahrenen Einzelgängers. Dass Langen ihn brieflich ermahnte, seine Kunst fester und intensiver zu gestalten, hatte sein Selbstvertrauen noch stärker erschüttert. Denn er wusste ja, er musste anders schreiben: besser, reifer, tiefer. Nur, wo anfangen? Musste man dafür nicht anders denken, anders fühlen, anders leben – gar ein anderer sein? Er war ein Tauber, der eine Sinfonie komponieren wollte.
Seit Monaten hatte er nichts geschrieben. Zugleich rückte der Tag, an dem er sich zum Militärdienst melden musste, näher. Bliebe er hier, würden Verwandte und Freunde seiner Mutter ihm mit Fragen zusetzen: Wollte Tommy es etwa hinauszögern bis zum letzten möglichen Moment – dem Tag vor seinem dreiundzwanzigsten Geburtstag –, um sich zum Dienst fürs Reich zu melden? Was sollten die Leute sagen?
Indem Thomas hier saß, las und träumte, strafte er seine störrische Hoffnung, womöglich doch eine große Zukunft zu haben, Tag für Tag Lügen. Trotzdem erneuerte diese Hoffnung sich immerzu wie Prometheus’ Leber, die ein Adler dem an den Felsen Geketteten regelmäßig zerriss. Nur, dass er kein Prometheus war, sondern bloß der Sohn eines großen Toten, den hier niemand kannte; der Bruder eines kommenden Dichters; ein Nichts von einundzwanzig Jahren. Gott, er hatte es satt, zuzusehen, wie das, was er Geduld nannte, Langeweile immer ähnlicher wurde.
Er hatte sich selbst satt.
Thomas klappte das Buch zu und warf es in den Koffer. Eilig legte er Hemden und Hosen dazu, kippte den halben Bücherstapel hinein, schloss den Deckel und rief:
»Ich muss los!«
»Gut!« Ilse sprang auf. »Ich begleite dich zum Bahnhof. Nicht, dass du es dir noch anders überlegst.«
Auch wenn er lieber allein aufgebrochen wäre – er fürchtete, die neu gefundene Entschlossenheit könnte verfliegen, wenn er sich nicht darauf konzentrierte –, konnte er ihr den Wunsch unmöglich abschlagen. Ohne sie bliese er noch immer Rauchkringel in die Luft.
Sie passierten den Salon, in dem Mama, hoch aufgerichtet im Sessel sitzend, einem Uniformierten lauschte. Als sie Thomas bemerkte, tätschelte sie dem jungen Offizier, der verwundert aufsah, begütigend die Hand und wandte sich um.
»Tommy, mein Tommy!«
Mama stand auf und breitete, halb zu ihm gewandt und halb zum Offizier, die Arme aus. Mit Mitte vierzig war sie noch immer beeindruckend. Auch wenn sie seit einiger Zeit, um die Haut am Hals zu straffen, die markante Kinnpartie anhob und dadurch vielleicht ein wenig zu stark betonte, schien von ihr noch immer etwas auszugehen, das selbst deutlich jüngere Herren für sie einnahm – und Thomas zunehmend peinlich war.
»Brauchst du noch etwas für die Fahrt? Vergiss deinen Mantel nicht. Den grauen.«
»Ich muss mich beeilen.«
»Lass dich noch einmal anschauen.« Sie trat einen Schritt zurück und wandte ihr Profil dem Offizier zu. »Gut siehst du aus. Ein bisschen blass vielleicht. Aber der Süden wird das kurieren. Die Italienerinnen werden Augen machen! Ich wünschte, ich könnte mitkommen, aber du weißt ja …« Mit dem Anflug eines Seufzers deutete sie ins Halbdunkel des Salons: auf Chinavasen und Samtvorhänge, den schwarzen Flügel, die weiße Göttinnenstatue, und dorthin, wo Vaters Porträt hängen musste.
»Der Zug geht bald.«
»Warst du das vorhin, Tommy? Du solltest wieder öfter spielen.«
»Heinrich wartet bestimmt schon.«
»Er hat sich gar nicht verabschiedet.« Ihr Blick schwankte zwischen Unverständnis und Mitgefühl – ob mit ihrem Erstgeborenen oder sich selbst, wagte Thomas nicht zu ergründen. »Weißt du noch, wie gern du immer Geige gespielt hast, diese Kindergeige? Wo ist die eigentlich hin?«
Mit einer Willensanstrengung nahm Thomas den Koffer in die Hand.
»Schon gut, Tommy.« Sie zupfte an seinem gestärkten Hemdkragen und strich darüber. »Ich will doch nur sagen: Es freut mich, dass ihr Zeit miteinander verbringt. Ihr seid schließlich Brüder. Und er kann froh sein, dass er dich hat.«
»Mama, ich …«
»Pass auf dich auf, ja? Schreib regelmäßig. Und vergiss nicht den Mantel.«
»Natürlich.« Er senkte den Kopf und spürte ihren Blick auf sich ruhen wie einen Sonnenstrahl.
An der Haustür wartete Ilse, ihr Päckchen unter dem Arm. Nach all den Jahren der Freundschaft mit Lula wusste sie, die bei den Manns ein und aus ging wie ein sechstes Kind, um die Eigenheiten der Senatorenwitwe. Und doch, sagte Thomas sich, als sie aus der Erdgeschosswohnung ins Freie traten, wäre es vielleicht angemessen gewesen, wenn Mama sich auch von der Tochter eines Sägemühlenbesitzers verabschiedete.
Ihnen blieben nur fünfunddreißig Minuten. Als sie an der Station der Pferdebahn ankamen, keuchte Thomas, und er atmete noch immer schwer, als sie sich auf die harten Sitze der Tram fallen ließen.
»Was nimmst du auch so viele Bücher mit.«
»Wer gut schreiben will, muss Gutes gelesen haben.«
»Na dann«, sie lächelte, »hättest du Heinrichs Roman hierlassen können.«
Thomas war überrascht. Weniger, weil sie mitbekommen hatte, was er in den Koffer gestopft hatte, denn Ilse hörte und sah alles. Sondern weil sie niemanden mit einem schlechten Wort bedachte; selbst über ihre Freunde scherzte sie nur in deren Gegenwart.
»Hast du es gelesen?«, fragte er.
»Selbstverständlich.«
»Und?«
Sie wiegte den Kopf.
Er hätte ihr erklären können, der Roman sei nun einmal anders als jene, die Damen wie ihre Mütter lasen. Heinrich hatte als Erster den Stil des großen Paul Bourget ins Deutsche übertragen; er war ein Neuerer, kühn und mutig. Heinrichs kürzere Sachen, allen voran Das Wunderbare, verehrte Thomas in einem Maße, für das ihm die Worte fehlten – und gerade diese Unfähigkeit erinnerte ihn schmerzlich daran, woran es ihm selbst mangelte. Doch etwas hielt ihn ab, Ilse das zu sagen, vermutlich Höflichkeit.
»Hat Armin dir geschrieben?«, fragte sie.
Er schüttelte den Kopf.
»Tut mir leid.«
»Das braucht es nicht.«
»Dir liegt noch an ihm, nicht wahr?«
Er schaute in den Straßenstaub. Ihm gefiel nicht, welchen Verlauf das Gespräch nahm. Natürlich war ihm nicht gleichgültig, dass auch ihr zweiter Bruder fortgegangen war. Nun war Ilse die Letzte, die noch daheim lebte. Wenn es ihrer Mutter jemals gelänge, ihre Tochter zum Umzug zu bewegen, würde das verwinkelte Städtchen Thomas wohl vollends unwirklich erscheinen.
Das freie, breite Lächeln, die blonden Haare und blauen Augen: Thomas fand es erstaunlich, wie sehr Ilse ihrem Bruder ähnelte. Nach der Schule hatten Armin und er Fahrradausflüge unternommen, und eines Nachmittags an der See hatte der Freund ihm den Arm um die Schulter gelegt. Die selbstgereimten Verse, die Thomas ihm voller Scheu und Angst vorgetragen hatte, waren voller Gefühl gewesen – und ihm heute peinlich. Ein Gedicht endete mit der Zeile Was hat der bleiche Tod Dir angetan?. Worauf Armin erwiderte: »Ik weet nich, man fraag em mal.«
Rückblickend musste Thomas froh sein, dass der Freund seine Schwärmerei nicht ernst genommen hatte. Fast sieben Jahre war das her. Auch wenn die Erinnerung daran in ihm seltsam lebendig geblieben war, hatte er diese zutiefst verwirrende Phase, die so viele Jungen durchlebten, doch längst überwunden.
»Du darfst es ruhig zeigen, wenn dir jemand wichtig ist«, sagte Ilse. »Weißt du, du bist manchmal so …« Sie presste die Lippen aufeinander und drückte die Arme an den schlanken Rumpf.
Thomas war es leid zu hören, wie steif er wirke. Dagegen gab es nur ein Mittel. Er hob das Kinn, ließ seinen Blick schwanken zwischen Unverständnis und Mitgefühl, und fragte in Mamas Tonfall:
»Meine Liebe, sind Sie häufiger konstipiert?«
Ilse prustete vor Lachen.
Es bimmelte, der Waggon kam quietschend zum Stehen, und für einen Moment spürte er Ilses Schulter an seiner. Die Tram hatte eine Kurve genommen. An deren Ende stand ein Pferdegespann, bis obenhin mit Kohle beladen, quer auf den Gleisen. Der Tramfahrer läutete wieder und wieder, doch der Kutscher war nirgends zu sehen. Die beiden Kaltblüter wirkten unbeeindruckt, als erlebten sie so etwas häufiger.
Jetzt, da er endlich aufgebrochen war, fürchtete Thomas, er könnte zu spät kommen. Er nahm den Koffer, stand auf und sprang vom Wagen. Diesmal lief er, obwohl der Griff ihm in die Handfläche schnitt, so schnell, dass Ilse nur mit Mühe Schritt hielt. Sie eilten über das Kopfsteinpflaster schmaler Straßen und querten einen Marktplatz voller Stände, wo sie der irritierende Geruch von Käse, Würsten und dampfenden Rinderleibern umwehte. Von sich selbst überrascht, rief Thomas einmal sogar »Weg da!«, und tatsächlich machten ihnen zwei finster blickende Mägde mit ihren Körben Platz.
Die Bahnhofshalle war schon in Sicht, da bog er – zu Ilses Verwunderung – links in eine Gasse ab. Bevor sie fragen konnte, zeigte er keuchend auf das Schild einer Schneiderei und trat ein. Drei Minuten darauf kam er, um eine Schuld und einen bedeutenden Teil seines Barvermögens ärmer, wieder heraus. Ilses spöttischem Blick begegnete er mit einem Achselzucken. Die Manns mochten ihr Ansehen verloren haben. Aber gute Kleidung erinnerte ihn daran, wer sie gewesen waren.
Als Thomas und Ilse endlich durch das Eingangstor stolperten, erfüllten Echos von Schritten, Stimmen und metallischem Quietschen die Bahnhofshalle wie fremdartige Musik. Verblüfft stellten sie fest, dass es erst acht vor zwölf war. Ihnen blieben noch dreizehn Minuten. Heinrich war nirgends zu sehen, und so gingen sie zum Gitter, hinter dem das Gleis lag. Die Lokomotive stand schon unter Dampf.
»Danke, Ilse.« Er reichte ihr unbeholfen die Hand. Doch Ilse schüttelte bloß leicht den Kopf.
»Ich bleibe, bis du abfährst.«
Ganz in der Nähe des Kontrolleurs, der mit gesenktem Blick die Eisenbahnbilletts begutachtete, stand ein derb dreinblickender Mann in Kittelschürze. Thomas beauftragte den Träger, sein Gepäck zu verstauen, und kurz darauf verschwand der Koffer in einem der hinteren Waggons. Heinrich hatte ihn gelehrt, wie man mit Stil reiste. Ein Herr trug sein Gepäck nicht selbst, auch wenn das Geld knapp war. »Wir sind nun mal«, hatte Heinrich bemerkt, »Senatorensöhne.«
Thomas griff in die Innentasche seines Jacketts, wo er sein Portemonnaie verwahrte, und klappte es auf. Suchte etwas darin. Klappte es zu. Klappte es wieder auf. Suchte den Boden zu seinen Füßen ab. Griff hastig in jede Jackentasche. Wiederholte das Ganze. Tastete sich wieder und wieder ab, bis es aussehen musste, als schlüge er sich. Nichts. Dann ließ er die Schultern sinken und schloss die Augen. Er sah sich daheim im Zimmer stehen, den Nietzsche-Band in der Hand: Er hatte ihn zugeklappt und in den Koffer geworfen. Die Fahrkarten lagen noch immer im Buch.
»Mein Koffer«, rief Thomas dem Kontrolleur zu, der gerade zwei Fahrgäste passieren ließ, »ich brauche meinen Koffer zurück!«
Der Mann reagierte nicht.
»Da drin sind die Billetts!«
»Das«, brummte der Kontrolleur, ohne aufzublicken, »ist nicht gut.«
»Kann ich durch? Ich suche den Koffer und bringe die Karte …«
Der Kontrolleur schüttelte den Kopf.
»Oder sagen Sie dem Träger, er soll den Koffer zurückbringen.«
»Ich habe anderes zu tun. Außerdem …« Er zückte seine Taschenuhr und sprach den Satz nicht zu Ende.
Je weiter er sich von Mutters Wohnung entfernt hatte, desto zielstrebiger war Thomas sich vorgekommen. Er hatte es sogar gewagt, sich auf ein Wiedersehen mit Rom zu freuen. Ja, er hatte so etwas wie Freude empfunden, kaum von Scham oder Sorge getrübte Freude! Die Einsicht in das Ausmaß seiner Unfähigkeit, Dinge des täglichen Lebens zu bewältigen, schmerzte ihn beinahe körperlich.
»Guten Morgen, Fräulein Martens«, sagte eine belegte Stimme hinter ihm. »Wie schön, dass Sie meinen Bruder verabschieden. Hoffentlich gefällt Ihnen und Ihrer Frau Mutter die Stadt. Wie lange können Sie bleiben?«
Thomas drehte sich um. Auf den ersten Blick wirkte Heinrich so vornehm wie immer. Die dunkel glänzenden Haare waren streng gescheitelt, die Spitzen des Schnauzbarts in imposante Höhen gezwirbelt, und der gepflegte Spitzbart reichte fast bis zum weißen Stehkragen. Nur die geröteten Augen und eine fast beißend medizinische Note, die sich in den üblichen Zigarrenduft mischte, ließen erkennen, dass Heinrich wieder einmal nicht geschlafen hatte.
Neben seinem Bruder stand ein beleibter Mann mit gerötetem Gesicht, der ein paar Worte mit dem Schaffner wechselte. Seine Uniform wies ihn als Mitarbeiter der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen aus. Offenbar war er dem Schaffner übergeordnet, denn wenn er redete, nickte dieser immerzu. Er schnaufte beim Atmen und schwankte kaum merklich.
»Morgen fahren wir zurück«, antwortete Ilse. »Ich bin nicht gerne lange fort aus Lübeck. Passen Sie auf den guten Tommy auf, ja?«
»Natürlich«, brummte Heinrich. »Und ich hoffe, Ihrem Herrn Bruder gefällt die neue Wirkungsstätte.« Er trennte s und t in stätte. »Sachsen kann für einen Hanseaten etwas gewöhnungsbedürftig sein.«
Wie sehr Heinrich sich im Griff hatte: Obwohl er mit seinem Kumpan offenbar irgendwo die Nacht durchzecht hatte, wahrte er die Form. Als Thomas ein süßlicher Geruch in die Nase stieg, dachte er für einen Moment, er gehöre zu Ilse. Doch so ein aufdringliches Parfum passte nicht zu ihr. Dann begriff er: Der Duft ging von seinem Bruder aus.
»Wollen wir?« Heinrichs Blick streifte Thomas.
Der wurde rot. »Ich komme nach. Vielleicht.«
»Der Zug geht in …«, Heinrich sah zur Bahnhofsuhr und kniff die eng nebeneinanderstehenden Augen zusammen, »fünf Minuten.«
»Nein, es ist so: Mir wurden die Fahrkarten gestohlen. Gerade eben.«
»Was, in meinem Bahnhof?« Der Uniformierte wandte sich mit einem Ruck vom Kontrolleur ab.
»Ich fürchte, so ist es«, sagte Thomas, ohne jemanden anzusehen.
Heinrich räusperte sich. »Mein lieber Rudolf«, raunte er seinem Begleiter zu, »da muss sich doch was machen lassen. Auf dem kurzen Dienstweg.«
»Leider nicht«, antwortete der. »Habe gerade erfahren, der Zug ist bis Zürich ausgebucht.«
»Tja.« Heinrich machte ein grunzendes Geräusch und schaute Richtung Gleis. »Ich habe dort morgen einen wichtigen Termin. Also …«
»Tommy, kann ich dich kurz sprechen?« Ilse zog Thomas von den anderen fort.
Bevor sie ihn danach fragen konnte, flüsterte er: »Die Fahrkarten sind im Koffer.«
»Aber … aber warum erzählst du das nicht Heinrich?«
Thomas rollte die Augen.
»Vielleicht findet er eine Lösung.«
»Ach, nein.«
»Willst du etwa doch hierbleiben? Und dann?«
Er starrte sie an. Verstand sie etwa immer noch nicht, was für ein degeneriertes Nervenbündel er war, nicht einmal fähig dazu, eine Zugreise anzutreten wie jeder normale Mensch?
»Ich weiß nicht mehr, was ich will.«
»Natürlich weißt du’s: Du willst dort unten leben, bis du zum Militär musst. Und du wirst die Zeit nutzen. Du wirst großartige Geschichten schreiben. Vielleicht gar einen Roman.«
»Einen ganzen Roman?« Davon hörte er zum ersten Mal.
»Hier. Wenn du all die anderen Bücher gelesen hast.«
Sie hielt ihm ihr Päckchen hin. Der Ausdruck ihres schönen, noch immer zarten Gesichts wirkte so entschlossen, dass Thomas wie zum ersten Mal die Einsicht überkam: Sie ist jetzt eine Frau.
»Danke, liebe Ilsenschnibbe.«
Er nahm das Päckchen, eilte zurück und sagte Heinrichs Zechkumpan so gefasst er konnte:
»Die Fahrkarten sind mir nicht gestohlen worden, sondern liegen in meinem Koffer, irgendwo im Gepäckwagen. Können Sie mir helfen?«
Überrascht blickte der Uniformierte zwischen Heinrich und ihm hin und her.
»Bitte«, sagte Thomas.
»Wenn ich dem Kontrolleur Order gebe, Sie durchzulassen«, sagte der Uniformierte, »und dann stellt sich raus …«
Vom Gleis drang ein Pfeifen herüber, ein Schaffner hielt eine Kelle hoch. Noch eine Minute.
»Mein Bruder ist mitunter …« Heinrich seufzte und fuhr mit der Hand durch die Luft, als verscheuche er ein Wort, das seinem Niveau nicht entsprach. »Aber ein Betrüger ist er nicht. Ich verbürge mich für ihn.«
Der Uniformierte zögerte. Dann nickte er leicht und wandte sich zum Bahnsteigkontrolleur. Kurz darauf winkte er die Brüder zu sich, schüttelte Heinrichs Hand und sagte:
»Gute Reise, mein Bester. Aber verlieben Sie sich dort unten nicht!« Er wedelte, wissend lächelnd, mit dem dicken Zeigefinger. »Wer etwas schaffen will, den hindert die Liebe bloß daran. Große Künstler lieben nicht!«
»Seien Sie beruhigt, mein lieber Rudolf. Ich lasse mich von keiner einspannen.«
Beide Männer lachten, und der beißende Geruch wurde stärker.
Thomas reichte Ilse, weil ihm nichts Besseres einfiel, noch einmal die Hand. Sie ergriff sie, und mit einem Ruck zog sie ihn zu sich. Bevor er verstand, was geschah, stellte sie sich auf die Zehenspitzen – und gab ihm einen Kuss auf die Wange.
»Schreib mir ab und zu. Und vielleicht merkst du ja«, flüsterte sie ihm ins Ohr, »dass du dir Hoffnungen machen darfst.«
2.
Tante gab mir süße Näschereien, als ich klein war. Meine Zähne hielten es aus, wurden nicht schlecht dadurch; jetzt bin ich älter geworden, bin Student; sie verhätschelt mich noch immer mit Süßigkeiten, sagt, dass ich ein Dichter bin. Ich habe etwas vom Poeten in mir, aber nicht genug.
Hans Christian Andersen:Tante Zahnweh(1872)
Erst als sie Dampf und Lärm der Bahnhofshalle hinter sich gelassen, vier- und dreistöckige Stadthäuser und niedrige Höfe passiert hatten und an frisch gemähten Feldern entlang fuhren, wagte Thomas zu seufzen. Auf seinem Fensterplatz hatte er in sich hineingehorcht wie in ein dunkles Zimmer, in Sorge, etwas könne an ihm vorbei herausstürmen und das größte Wagnis seines Lebens doch noch sabotieren. Aber je länger die Lokomotive, angetrieben von einer Kraft, die Thomas nicht verstand, vorandrängte, desto wirklicher fühlte sich an, was sein Großhirn ihm seit fast einer Stunde zu erklären versuchte: Er war tatsächlich auf dem Weg.
Thomas blickte sich um, als ein Mann, der in Kaufering zugestiegen sein musste, am Abteil vorüberging. Er sah ihn nur für einen Moment, und doch stand ihm sein Bild deutlich vor Augen: ein sehr aufrecht gehender Herr im schwarzen Anzug, dem der weiße Stehkragen fast bis zum glatt rasierten Kinn reichte, mit einem Staubfleck auf Brusthöhe. Ergrauendes, volles Haar hing ihm nach veralteter Pariser Mode über die Ohren. Wer der Unbekannte wohl war, und wohin es ihn zog? Welche Geschichte gab es über ihn zu erzählen? Thomas mühte sich, ihm eine wendungsreiche Vergangenheit zuzueignen, in der er große Herausforderungen gemeistert und zumindest zeitweise so etwas wie Liebe erfahren hatte; aber rasch eilten seine Gedanken zum Schluss der Erzählung, wo, das schien Thomas unausweichlich, der Unbekannte in Verzweiflung versänke. Und warum eigentlich, sagte er sich, sollte diese Zugfahrt nicht die letzte sein, bevor sich der Unbekannte aus nie ganz geklärten Gründen (die auf verschlungenen Wegen mit der hochmütigen Gleichgültigkeit eines anderen zu tun hatten) das Leben nahm?
Thomas lächelte, während hinter dem Abteilfenster Hügel zu kleinen Bergen wuchsen. Südliche Sonne und Kultur würden ihn vom Trübsinn befreien. Er würde sich neu erfinden und zum Künstler reifen. Er musste einfach.
»Wie geht es Mama?«
Es war das erste Mal, dass Heinrich seit der Abfahrt das Wort an ihn richtete. Thomas brauchte einen Atemzug, bis er antwortete.
»Du kennst sie ja.«
»Hat sie sich beklagt, dass ich mich nicht verabschiedet habe?«
Thomas schwieg auf eine Weise, die alles sagte.
»Hatte sie dabei Publikum?«
»Publikum?«
Heinrich blickte ihn wissend an.
»Ein Offizier war zum Tee. Etwa unser Alter.«
Heinrich nickte, als bestätigte ihm das alles, was es über ihre Mutter zu wissen gab, und entzündete eine Zigarre. Der würzig-süßliche Duft des Elternhauses erfüllte das Abteil, in dem nur sie beide saßen, der Geruch ihres Vaters.
»Und sie fragte«, sagte Thomas mit einem Lächeln, »was aus der Kindergeige geworden ist.«
Heinrich aber schien nicht zu hören, sondern schaute aus dem Fenster. In der Ferne wuchsen die ersten Gipfel, und Thomas wurde es kühl. Als er sich den Mantel über die Schultern legte, bemerkte er in der Innentasche ein Kuvert. Darauf stand:
Von Deiner Mama.
Der Bahnhof Buchloe lag hinter ihnen, als Thomas die beiden Schriftstücke endlich niederlegte. Vor seinen Augen zitterten die Voralpen. Wortlos reichte er Heinrich die Papiere: einen langen Brief von Krafft Tesdorpf und ein kurzes Begleitschreiben von Mama.
Jeder in Lübeck wusste, was für ein eigenbrötlerischer Kaufmann Tesdorpf war. Während sein Bruder Carl die Weinhandlung der Familie zu neuem Ansehen führte, konzentrierte Krafft sich mit zunehmendem Alter darauf, den allgemeinen Sittenverfall zu beklagen. Warum ihr Vater ausgerechnet ihn zum Verwalter des Firmenvermögens eingesetzt hatte, war den Hinterbliebenen ein Rätsel. Der alte Tesdorpf mehrte das ihm anvertraute Kapital kaum; Ausdauer bewies er einzig darin, den beiden großjährigen Söhnen das Erbe vorzuenthalten. Dabei war Thomas immerhin seit dem Juni einundzwanzig, Heinrich sogar schon fünfundzwanzig Jahre alt. Dennoch bewilligte Tesdorpf ihnen weiterhin nur einen Anteil an den Kapitalzinsen. Natürlich hatte das nichts zu tun mit dem Umstand, dass Tesdorpf für seine Arbeit jährlich zwei Prozent des Vermögenswertes einstrich. Als daraufhin Thomas – auf Heinrichs Anraten – einen Anwalt mit der Sache betraute, bestärkte das den Testamentsverwalter in der Überzeugung, es mit gierigen, ihres großen Vaters unwürdigen Halbwüchsigen zu tun zu haben, denn im jüngsten Brief ging er gar nicht mehr auf die Sache ein. Stattdessen schrieb er von Ehrgefühl, Anstand und hanseatischen Kaufmannstugenden und ließ keinen Zweifel daran, wie wenig davon er in den beiden älteren Söhnen des Senators erkannte. Das Wort von der verrotteten Familie Mann, das Hauptpastor Ranke von Sankt Marien in Lübeck wie Gift gestreut hatte, tat seine Wirkung.
Heinrich hatte beim Lesen immer wieder den Kopf geschüttelt. Jetzt lächelte er grimmig. »Typisch.«
»Ja«, sagte Thomas abwesend, »Tesdorpf ist wirklich …«
»Das meine ich nicht.« Heinrich hielt das andere, kürzere Schreiben hoch. »Sondern das.«
Mamas Brief? Der fasste die Misere doch bloß zusammen. Thomas las ihn noch einmal.
Lieber Tommy,
wie von Dir gewünscht, habe ich mich persönlich an Herrn Tesdorpf gewandt, um ihm meine Überzeugung darzulegen, dass Du verantwortungsvoll mit Deinem Erbteil umgehen würdest. Ich habe ihm versichert, Du wollest das Geld dazu nutzen, den Weg in einen festen, arbeitsamen Beruf zu finden. Vielleicht war es rückblickend nicht sehr klug von mir zu erwähnen, dass Du eine Stellung im Journalismus anstrebst. Zwar bin ich davon überzeugt, Du würdest dort mit Gottes Hilfe und einer straffen Führung durchaus Deinen Weg gehen. Und natürlich weiß ich um Deine schriftstellerischen Ambitionen. Aber Du kennst Herrn Tesdorpf und was er vom Pressewesen hält.
Leider macht es mir die Notwendigkeit, Lula und Carla in die Gesellschaft einzuführen, auf absehbare Zeit unmöglich, Dich von der Zahlung der Miete für Dein Zimmer zu entbinden. Sicher handle ich in Deinem Sinne, wenn ich keinen Fremden zur Untermiete in Deinem Zimmer wohnen lasse. Auch wäre dies mit unserem gesellschaftlichen Ansehen ganz unverträglich. Deine Schwestern haben es als Ortsfremde noch immer schwer, in den höheren Kreisen der Stadt Fuß zu fassen. Für ihre Erziehung und Repräsentation bleiben zudem gewisse Ausgaben unumgänglich, sollen sie zu gegebener Zeit ihrer Herkunft entsprechende Ehen eingehen.
Vicco zerschleißt auf seinen Ausflügen durch die umliegenden Gärten seine Hosen so sehr, dass ich nahezu im Wochentakt neue anfertigen lassen muss. Er vermisst seine beiden »Onkel« schon jetzt, lässt sie ganz herzlich grüßen und wünscht sich viele Postkarten und Briefe aus der Ferne. Mir ergeht es ebenso.
Bitte übermittle Heinrich meine herzlichen Grüße. Und bitte, lieber Tommy, steht einander bei, wann immer es Not tut, ihr seid schließlich Brüder.
Deine Mama
Thomas sah auf.
»Sie hat dir ihren Brief an Tesdorpf also nicht gezeigt?« Heinrich klopfte die Zigarre ab.
»Sie hatte bestimmt ihre Gründe.«
»Seit wann strebst du nach einem festen, arbeitsamen Beruf, einer Stellung im Journalismus?«
»Das ist nur so eine Idee von ihr. Sie macht sich Sorgen.«
»Und du zahlst ihr tatsächlich Miete und Geld fürs Essen?«
»Seit meinem Geburtstag. Sie zieht es direkt vom Wechsel ab. Sie sagt, das sei üblich.«
»Wann hat sie dir die Briefe gegeben?«
»Sie muss sie mir in den Mantel gesteckt haben, bevor ich zum Bahnhof fuhr.«
Heinrich stieß verächtlich Luft aus. »Mutter.«
Als Thomas ihn verständnislos ansah, fragte er: »Verstehst du es immer noch nicht?«
Er wusste nicht, was ihn mehr besorgen sollte: dass er womöglich schon bald in einem Zug zurück nach München saß, oder dass sein Bruder ihn für begriffsstutzig hielt.
»Bestimmt hat sie Tesdorpf geschrieben«, sagte Heinrich. »Aber sie wird nicht riskiert haben, ihn gegen sich aufzubringen, indem sie sich für dich offen einsetzt. Und sie gibt sogar zu, dass sie dich bei ihm schlecht hat aussehen lassen – den Hinweis auf den Journalismus hätte sie sich wirklich verkneifen können. Danach konnte sie dir guten Gewissens schreiben, sie habe alles versucht. Aber wenn sie das wirklich glaubt, warum steckt sie dir die Briefe heimlich zu? In Wahrheit will sie deine Enttäuschung nicht miterleben. Tommy«, Heinrich zog genüsslich an der Zigarre und blies Rauch aus, »sie lässt dich im Stich.« Das letzte Wort ging über in einen Hustenanfall.
Thomas wand sich, denn ihm war, als richtete der Grimm sich auch gegen ihn. Seit Papas Tod war Heinrich der klügste Mensch, den er kannte. Jedes Mal, wenn er aus Italien zu Besuch kam, wirkte er noch entschlossener und ungeduldiger. Es war fast unheimlich, wie stark der ältere Bruder – dank makellos gepflegter Kleidung, blonden Haupthaars und Spitzbarts – auch äußerlich die Züge des Senators annahm. Dessen Kälte aber, die den Jüngeren so oft hatte frösteln lassen, war geblieben.
»Die kluge Frau Mama«, krächzte Heinrich. »Einerseits tut sie, als sei sie einverstanden mit deinen schriftstellerischen Ambitionen. Andererseits bugsiert sie dich in einen festen, arbeitsamen Beruf.« Er drückte, noch immer hustend, die Zigarre aus. »Für dich ist das neu, nicht wahr? Sie so zu sehen?«
Erst jetzt kam es Thomas in den Sinn, es sonderbar zu finden, dass Mama ihn auch in seiner Abwesenheit Miete zahlen ließ. Sie hatte ihn gar nicht gefragt, was er von einem Untermieter hielte. (Wohl weil sie ahnte, dass er es kategorisch abgelehnt hätte.) Trotzdem: Die Vorstellung, Mama könne ihn bei knapper Kasse halten, damit er möglichst rasch heimkehrte und eine Anstellung annahm, schien bizarr. Natürlich war Frau Senatorin Mann, geborene da Silva-Bruhns, anders als andere Mütter, war es immer gewesen. Und vielleicht überließ sie sich seit dem Tod ihres Gatten noch ein wenig mehr ihren Neigungen und Launen. So fielen ihre Kindheitsgeschichten, die sie so gern erzählte, mit jedem Jahr länger aus. Entweder also erinnerte sie sich mit wachsendem zeitlichen Abstand tatsächlich immer genauer an Geschehnisse am Rand des brasilianischen Urwalds: an das Rauschen des Atlantiks, die Schreie der Papageien, den Geschmack der Granatäpfel und an eine Neugier, die das kleine Mädchen – trotz aller Warnungen vor dem Teufel – von den schwarzen Dienern fortlockte, um Schlangen in den Dschungel zu folgen. Oder aber ihre Anekdoten, über denen der mutige, erfolgreiche Vater stets thronte wie ein blonder Gott, zeugten von den sentimentalen Sehnsüchten einer Frau, die im kühlen Lübeck herausgestochen hatte wie eine reife Frucht an einem winterlichen Baum. Ihr – der Dunkelhaarigen mit der Schwäche für Märchen, Mythen und Musik, für einfach alles, das auflöste statt zu binden – ähnelte Thomas so sehr. Ausgerechnet sie sollte verhindern wollen, dass er die Welt sah?
»Wie lange reicht dein Erspartes?«, fragte Heinrich.
»Zwei Monate, vielleicht drei.«
Langsam – doch immer noch schneller, als ihm lieb war – begriff er das Verfahrene seiner Lage. Er hatte alle Rechnungen bei Schneidern, in Cafés und Restaurants beglichen – in der Erwartung, dass Tesdorpf endlich täte, was Gesetz und Anstand vorschrieben. Mit dem Geld, das ihm blieb, hielt er nicht einmal bis zum Jahresende durch. Aber das seinem Bruder gegenüber zuzugeben, ging über seine Kräfte. Denn er gestand sich ein, dass ihn nicht allein die Sehnsucht, große Kunst zu sehen und Dichter zu werden, nach Italien zog. Was ihn an der Aussicht, dort die nächsten eineinhalb Jahre zu leben, am stärksten fasziniert wie geängstigt hatte, war der Gedanke, sie mit einem großen Künstler zu verbringen – mit Heinrich. Und jetzt? Das Ausmaß seiner Ratlosigkeit erinnerte ihn daran, wie ernst ihm die Sache war.
»Und dir«, fragte Thomas zögerlich, »dir geht es gut? Finanziell?«
»Vorstrecken kann ich dir nichts.«
»So war das nicht gemeint.« (Es war exakt so gemeint gewesen.) »Ich könnte dir wieder etwas schreiben.«
»Fürs Zwanzigste Jahrhundert?«
»Rezensionen. Irgendwas.«
»Was man da bekommt, ist doch lächerlich. Sogar als Herausgeber habe ich gerade genug verdient, um nicht noch ärmer zu werden.«
»Was hältst du von einer Bewerbung bei Albert Langen? Ilse sagt, sie suchen jemanden für den Simplicissimus. Einen Lektor.«
»Langen versteht, dass ich Künstler bin – kein Befehlsempfänger. Wenn ich jetzt für ihn Manuskripte redigiere, dann riskiere ich, dass er den Respekt vor mir verliert. Womöglich kämen ihm sogar Zweifel, ob er meinen Novellenband veröffentlichen soll. Nein, nein, das Zwanzigste ist zwar ein Käseblatt, aber es hat zwei Vorteile: Ich kann meine Arbeit überall erledigen, und seit ich nur noch den Schriftleiter mache, komme ich endlich wieder zum Schreiben – zum richtigen Schreiben. In einem Jahr bin ich schuldenfrei. Und dann …« Heinrich atmete tief ein und aus und schüttelte etwas Unsichtbares von seinen Fingern.
»Ich meinte«, sagte Thomas unsicher, »eigentlich mich.«
»Du? Als Lektor?«
»Vielleicht lässt sich ausmachen, dass ich erst im neuen Jahr anfange. Dann könnte ich bis Weihnachten bleiben. Und wer weiß, vielleicht kann ich sogar von Italien aus arbeiten – wie du.«
»Der Simplicissimus ist ein anderes Kaliber.«
»Ich könnte Langen einen Brief schicken und fragen.«
»Das würde ich nicht tun.«
»Ich habe ihn einmal getroffen. Bevor er den Willen zum Glück gedruckt hat.«
»Ich weiß. Er sagte mir, er habe dir dringend geraten, deine Arbeiten straffer zu komponieren und nicht länger so todessehnsüchtige Geschichten zu fabrizieren.«
»Ihr habt über mich geredet?«
»Er hat mir auch gesagt, du hättest ihm weitere Geschichten versprochen.«
»Ich habe ihm die eine oder andere Erzählung in Aussicht gestellt.«
»Versprochen.«
»Sagt Langen das?«
»Stimmt es etwa nicht?«
»Ich habe ihm doch etwas geschickt.«
»Eine kurze Sache. In einem Dreivierteljahr. Und dann wieder so was Düster-Hoffnungsloses.«
»Es ist nicht …«
»Nein? Wie heißt die Geschichte?«
»Ich beantworte keine rhetorischen Fragen.« (Erst recht nicht, wenn die Antwort Der Tod lautete.)
»Herrgott, Tommy. Du hast einem einflussreichen Mann ein Versprechen gegeben und es nicht gehalten. Und jetzt erwartest du, dass er dich anstellt? Obendrein soll er dir erlauben, dass du deine Arbeit weit weg erledigst, wo er dich nicht kontrollieren kann? Warum sollte er dir vertrauen?«
Thomas ersehnte ein Mindestmaß an Kooperation seitens einer Welt, die er weder verstand noch genauer kennenlernen wollte. Stattdessen führte sie ihm wieder und wieder vor Augen, wie wenig sie sich darum scherte, dass er sich einzig für die Literatur gemacht hielt – schien ihm zuzuflüstern, dass das, was er Bestimmung