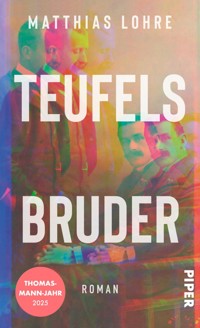9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Männer sind die neuen Frauen Ein Mann soll stürmisch im Bett sein, aber auch rücksichtsvoll und zärtlich. Er soll ein ganzer Kerl sein, aber die richtigen Windeln kaufen. Ein Ruhepol, aber kein großer Schweiger. Eine starke Schulter, aber kein Macho. Sensibel, aber bitte nicht so empfindlich. Gut aussehend, aber bloß nicht eitel. Ganz schön viel verlangt! Der milde Kerl Matthias Lohre erzählt sehr wahr und sehr komisch, wie Frauen die Männer von heute besser verstehen können!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Matthias Lohre
Milde Kerle
Was Frauen heute alles über Männer wissen müssen
Fischer e-books
»Ich glaube, ein Mann will von einer Frau das Gleiche wie eine Frau von einem Mann: Respekt.«
Clint Eastwood
Tag 1, Sonntag Mr Perfect
Frauen wollen ihn. Männer wollen er sein
20:13 Uhr: Don Draper und Justin Bieber sind schuld an diesem Buch. Und eine Frau: Nina. Sie ist zwar eine gute Freundin von mir. Wir verstehen uns blendend, soweit das zwischen Mann und Frau möglich ist. Wir haben Jobs, die uns Spaß machen, und Freunde, die wir sogar mögen. Wir gehen als jünger durch, als wir laut Personalausweis sind, sofern wir eine schlecht beleuchtete Bar besuchen. Alles könnte harmonisch sein. Aber neulich war Nina bei mir zu Besuch, es war Sonntagabend, und da fing alles an.
Es klingelte an meiner Haustür. »Hallo?«, fragte ich. Aus der Gegensprechanlage drang ein Rauschen. Nina, die unten an der Tür stand, hatte mich nicht gehört. Sie telefonierte, ich verstand nur Satzfetzen: »… echt unglaublich sexy Kerl«, sagte Nina, »diese coolen Klamotten, die stehen ihm super«. Dann kicherte sie. Recht hat sie, dachte ich, als ich auf den Türöffner drückte: Ich bin wirklich ein cooler Typ.
»Hallo.« Als Nina meine Wohnung betrat, schien sie ihre Bewunderung für mich schon wieder gut im Griff zu haben. Sie ist ja auch kein Teenie mehr, obwohl man ihr das besser nicht sagt. Sie könnte das falsch verstehen. Bei uns beiden war schnell klar, dass wir wie gemacht sind füreinander, zumindest für eine platonische Freundschaft: Wenn zwei Menschen, die sich vor kurzem kennengelernt haben, einander betrunken mit nach Hause nehmen, gemeinsam ins Bett stolpern und beim Knutschen zeitgleich einschlafen, dann ist das ein Indiz für mangelnde sexuelle Anziehung. Und wenn wir beim dritten Anlauf, bei dem wir uns vorgenommen haben, »keine Gefangenen zu machen«, schon vorm Knutschen einschlafen, dann wird daraus entweder eine deprimierende Beziehung oder eine schöne Freundschaft. Die Entscheidung fiel uns nicht schwer.
»Ich dachte mir«, sagte Nina lächelnd, »ich bringe zum DVD-Abend mal eine Staffel ›Mad Men‹ mit. Geil, oder?« Ich hätte an dieser Stelle gern doziert, dass die preisgekrönte US-Serie über eine Werbeagentur im New York der sechziger Jahre ja mindestens so viel über die Zeit damals aussagt wie über die Geschlechterbeziehungen heute. Aber da sagte Nina bereits: »Der Chef-Kreative, Don Draper, ist wirklich ein unglaublich sexy Kerl. Und dazu die coolen Klamotten!« Dann kicherte sie und plumpste glucksend auf mein Sofa.
Der unbestrittene Star bei »Mad Men« ist Don Draper: der smarte, einzelgängerische, ehrgeizige Kreativdirektor einer Werbeagentur. Ein Mann auf der Flucht vor seiner traurigen Kindheit. Auf der Suche nach dem Glück, das sich immer dann auflöst, wenn er glaubt, es fassen zu können. Auf seinem Weg stärkt sich der Kerl, der aussieht wie Superman, nur ohne das alberne Cape, mit schweren Drinks und schönen Frauen. Draper ist ein Bild von einem Mann. Ein klassischer Held mit Pomadenfrisur.
Ich schob die DVD rein und wir zwei uns Kartoffelchips. Die erste Folge beginnt mit einem alten Werbespot aus den Sechzigern: Eine schöne Frau Mitte zwanzig läuft singend auf die Kamera zu. Sie hat alles drauf: den betörenden Augenaufschlag, den koketten Blick von unten nach oben, das dezente Präsentieren ihrer Oberweite. Don Drapers Mitarbeiterin, eine eher spröde Frau, die nicht mitspielen will beim alltäglichen Sexismus der sechziger Jahre, ist angewidert: Was soll das Ganze? Draper erklärt ihr in nur zwei Sätzen, warum schöne Frauen Werbung machen. Es ist eine der wichtigsten Regeln überhaupt: »Männer wollen sie. Frauen wollen sie sein.«
»Sndrck«, murmelte Nina. Sie hatte sich dafür entschieden, gleichzeitig zu essen und zu reden. Ich fragte nach. »So ein Dreck«, wiederholte sie und zeigte auf den Fernseher. »Frauen machen sich das Leben selbst zur Hölle. Sie überlegen viel zu oft, wie sie auf Männer wirken. Und anstatt sich mit anderen Frauen solidarisch zu zeigen, machen sie sich beim Werben um Männer auch noch gegenseitig Konkurrenz. Hat sich denn gar nichts verändert seit den Sechzigern? Frauen sind immer noch das überforderte Geschlecht. Meine Herren!«
Ich sagte lieber nichts. Denn hätte ich in diesem Moment meine Gedanken zusammenfassen müssen, dann wäre es ein großer Seufzer gewesen: »›Deine Herren‹ werden mittlerweile so überfordert wie Frauen, nur anders.« Merke: Provoziere eine Frau nie in deiner eigenen Wohnung. Man kann dann so schlecht nach Hause fliehen.
Aber Nina war noch nicht fertig. »Frauen haben es verdammt schwer. In unseren Zwanzigern und Dreißigern müssen wir die Basis legen für den Rest unseres Lebens: Wir sollen und wollen Karriere machen, aber zur selben Zeit suchen wir einen Partner. Wenn wir einen Kerl gefunden haben, den wir auch nüchtern ertragen können, müssen wir uns beeilen, wenn wir Kinder haben wollen.« Nina seufzte. Sie ist Single, aber die Namen ihrer ersten beiden Kinder hat sie schon ausgewählt. »Da habt ihr Männer es viel besser.« Nina ließ sich zurück auf die Couch sinken und stopfte sich Chips in den Mund. Der Druck, attraktiv zu sein, schmälerte jedenfalls nicht ihren Appetit.
Die »Mad Men«-Folge lief weiter. Auftritt Don Draper, der Übermann. In seiner schicken New Yorker Werbeagentur konferiert er mit den Mitarbeitern Harry Crane und Ken Cosgrove. Nebenfiguren, Anzugträger und beide um die dreißig. Da hatte ich eine Idee. Als die drei Männer nebeneinander auf dem Schirm zu sehen waren, drückte ich die Pausentaste. Das Standbild erinnerte an diese alte ARD-Sendung, in der vier Journalisten aus fünf Ländern (oder umgekehrt) in dunklen Anzügen und Rauchschwaden am Sonntagmittag die Welt erklärten: »Der Internationale Frühschoppen«. Nur ohne verschwitzte Gesichter.
»Wen findest du interessanter?«, fragte ich Nina. »Den Macho Draper? Den hingebungsvollen, etwas schüchternen Gatten Crane? Oder den unkomplizierten, aber literarisch ambitionierten Cosgrove?« Auf meiner Couch rollte ein Augenpaar. »Achdschße.«
»Das habe ich ge-hö-hört! Mal ehrlich: Klar, Draper ist ’ne coole Sau, total sexy und erfolgreich. Aber er ist nur eine Erfindung.« Nina guckte mich an, als hätte sie versehentlich etwas Bitteres gegessen. Und schwieg. »Denk doch mal nach: Wenn man die ganze schicke Sechziger-Jahre-Ästhetik abzieht, sieht der Schauspieler, also Jon Hamm, nicht halb so gut aus. Er trägt in Wirklichkeit schlabbrige Hemden, ist sogar etwas schüchtern. Er ist einfach nur ein Mann mit Fehlern und Macken. Wäre es nicht klüger, Frauen würden das anerkennen? Und müssten sie dann nicht auf andere Männer stehen?«
»Zum Beispiel?«, fragte das rollende Augenpaar.
»Zum Beispiel auf einen Mann wie Harry Crane: eine ehrliche Haut, die versucht, Karriere, Frau und Kind irgendwie unter einen Hut zu bringen. Er redet mit seiner Frau über Selbstzweifel und …«
»… und er jammert und sieht nicht sonderlich sexy aus«, sagte Nina. »Aber dass er an seiner Beziehung arbeitet, macht ihn sympathisch.«
»Na gut«, sagte ich. »Dann nehmen wir Kandidat Nummer zwei: Ken Cosgrove: jungenhaft gut aussehend, erfolgreich im Job, dabei ein netter Kerl und Autor von Kurzgeschichten. So einer wäre auch heute interessant, oder?«
»Cosgrove hat keine Kanten«, konterte das Augenpaar. »Der ist ganz hübsch, man kann mit ihm bestimmt auch über Literatur reden. Aber sonst …«
»Okay, okay. Ich fasse also zusammen: Männer sollen Machos sein, aber nett zur Frau an ihrer Seite. Sie sollen hundert Prozent im Job geben, sich auch um die Kinder kümmern, nicht klagen, intellektuell stimulierend sein, gut aussehen, Kanten haben, aber keine Macken. Das kann doch niemand bieten – außer mir vielleicht.«
Nina legte bei ihrer Augenrollfrequenz eine Schippe drauf. Sie sah jetzt aus wie ein Jurymitglied bei Germany’s Next Topmodel. »Also erst mal: Herzlichen Glückwunsch zu deiner Selbstüberschätzung.«
»Danke.«
»Gern. Und zweitens: Vielleicht wollen wir ja gar nicht alles haben. Andererseits …« Sie sah jetzt aus wie eine Ärztin, die nicht recht weiß, wie sie ihrem Patienten die dramatische Diagnose beibringen soll. »Andererseits wollen Frauen natürlich schon die eierbesitzende Wollmilchsau. Einen Kerl wie Don Draper.« Nina lehnte sich nach vorne und raunte: »Frauen wollen ihn. Männer wollen er sein.« Dann lachte sie laut auf und lehnte sich zurück. Als Nina die Pausentaste lösen wollte, schnappte ich ihr die Fernbedienung weg.
»Merkst du was?«, sagte ich. »Nicht nur das Leben von Frauen ist kompliziert. Heute machen sich auch immer mehr Männer ihr Leben zur Hölle: Sie überlegen viel zu oft, wie sie auf Frauen wirken. Sie machen Karriere, und zwar auch, um Frauen zu gefallen. Und anstatt sich mit anderen Männern solidarisch zu zeigen, machen sie sich im Arbeits- und im Privatleben auch noch gegenseitig Konkurrenz. Wann hat sich all das bloß so stark verändert? Früher war es der Job der Männer, Frauen unrealistischen Erwartungen auszusetzen. Heute werden sie von Frauen und sich selbst überfordert. Jeden Tag, Woche für Woche. Meine Herren!«
»Ach ja? Die kommende Woche wird für mich totaler Stress werden. Ich habe Dates mit drei Typen, die ich im Internet kennengelernt habe. Im Job habe ich zwei neue Aufträge, die ich nur bewältigen kann, wenn ich am Wochenende arbeite. Zwischendurch will ich zum Yoga: um mich zu entspannen und gut auszusehen. Und irgendwie versuche ich bei alledem, noch Zeit für meine Freunde zu finden. Und einer von denen erzählt mir dann, Männern gehe es schlechter als Frauen. Kerle sind so selbstmitleidig.«
Die DVD lief weiter. In meinem Kopf klemmte noch der Pausenknopf. Im Fernseher spiegelte sich das Bild von Nina und mir auf der Couch. Wie kann es sein, dass zwei Menschen einander seit langem kennen, aber eigentlich doch nichts von den Problemen des anderen wissen? Nina spürt sehr genau, welcher Druck auf ihr als Frau lastet. Aber sie ahnt nicht, unter welchen Belastungen Männer heutzutage leiden. Das ist kaum überraschend. Selbst viele Männer nehmen nicht bewusst wahr, welchen Ansprüchen sie permanent zu genügen versuchen. Männer sind immer noch gut im Ignorieren, nur wollen sie heute von anderen Dingen nichts hören als früher.
Die an sie gerichteten Erwartungen sind nicht nur riesig, sondern auch widersprüchlich. Das vergrößert die Verwirrung. Einflussreichster männlichster Prominenter der Welt war im Jahr 2011 ein Teenager mit gezupften Augenbrauen namens Justin Bieber. Das seriöse US-Magazin Forbes listete den kanadischen Sänger auf Platz 3 seiner Top-100-Liste. Tiger Woods, für seine Golfkünste fast so bekannt wie für seine vielen außerehelichen Affären, kam auf Platz 6. Der alternde Bon-Jovi-Imitator Bon Jovi schaffte es auf den achten Rang. Alles Männer. Alle ganz unterschiedlich. Und alle, so unschön die Einsicht auch ist, sind Idole für Millionen Menschen. Sie sind männliche Vorbilder. Einmal träumte ich nachts, ich hätte einen Sohn, und der sagte mir freudestrahlend: »Wenn ich mal groß bin, möchte ich werden wie Justin Bieber.« Solche Albträume wünsche ich niemandem.
Das Beispiel der drei zeigt: Ein Mann kann heute vieles sein. Macho oder Teddybär. Süß oder kantig. Zuhörer oder Dauerschwadroneur. Frauenversteher oder Frauenmitnachhausenehmer. Es ist verdammt schwer zu sagen, wie Männer sind und was sie können müssen. Die Zahl möglicher Anforderungen ist gewaltig. Männer gehen das Problem ganz pragmatisch an: Sie versuchen der Einfachheit halber, alles zugleich zu sein. Denn eines wollen Männer schließlich immer sein: gut. Erfolgreich. Perfekt. Aber was bedeutet es, wenn ihr erfolgreichster Geschlechtsgenosse ein Halbwüchsiger ist, dessen künstlerische Erzeugnisse Titel tragen wie »Eenie Meenie«?
Ein Mann soll alles bieten können: Er soll stürmisch im Bett sein, aber auch rücksichtsvoll und zärtlich. Er soll ein ganzer Kerl sein, aber die richtigen Windeln kaufen. Ein Ruhepol, aber kein großer Schweiger. Eine starke Schulter zum Anlehnen, aber kein Macho. Sensibel, aber bitte nicht so empfindlich. Erfolgreich im Job, aber mit reichlich Zeit für Freundin, Familie und Freunde. Er soll gut aussehen, aber nicht eitel sein. Ein Kerl soll allen Ansprüchen genügen und dabei in sich ruhen: Don Draper, Ken Cosgrove und Harry Crane in einer Person. Solche unvereinbaren Anforderungen stellten früher doch nur Männer an Frauen!
Das führt zu einer Situation, die Frauen seit langem gut kennen, Männern aber relativ neu ist: Sie dürfen sich endlich auch als Mängelexemplare verstehen. Medien porträtieren Männer als gewaltbereite Wesen mit einem eklatanten Mangel an Einfühlungsvermögen und Klamottengeschmack. Also als eine Art verwirrten John Wayne in der Fußgängerzone. Männer, das sind diese Typen, die seit Jahrtausenden Kriege anzetteln, Frauen unterdrücken und keine Geschenkideen haben.
Damit kein Missverständnis aufkommt: Männer sind toll. Frauen sind toll. Es fällt ihnen nur immer schwerer, sich zu mögen, wie sie sind. Einflussreichster Promi der Welt (Platz 1) war laut Forbes-Liste übrigens Lady Gaga. Eine Frau, die bei den MTV Video Music Awards ein Kleid aus rohem Fleisch trug und später erklärte, sie habe damit zeigen wollen, dass wir alle für unsere Überzeugungen eintreten sollten. Männer brauchen Frauen also nicht zu beneiden.
Ständig finden Männer neue Dinge vor, die sie können müssen. Und Sachen, die sie können zu müssen glauben. Wir laufen Marathon, trinken Rhabarbersaftschorle und schieben Designerkinderwagen. Wir wollen alles richtig machen und wissen nicht mehr so recht, was überhaupt richtig ist. Wir glauben, Tausende Wahlmöglichkeiten zu haben, aber trotzdem ständig etwas falsch zu machen. Das ist furchtbar anstrengend und etwas albern. Bloß kommen wir nicht raus aus der Sehnsucht nach Perfektion. Eine alltägliche Woche meines Lebens zeigt, was schiefläuft bei den Ansprüchen, die Männer und andere Verrückte an Männer stellen. Ich muss nur genau hingucken. Dann werden auch Nina und andere Frauen verstehen: Sieben Tage als Mann sind verdammt anstrengend, und diese Anstrengungen haben viel mit den Erwartungen von Frauen zu tun. It’s a man’s week.
Die Pausentaste in meinem Kopf löste sich. Ich wendete mich zu der Mischung aus Mensch und Chipstüte neben mir und sagte: »Nina, ich zeige dir, was Männer können müssen. Eine Woche lang zeichne ich auf, welchen Herausforderungen milde Kerle wie ich täglich begegnen.« Sie sah nicht auf, als sie entgegnete: »Aber fang bitte nicht mehr heute Abend damit an, okay? Ich hab noch Chips.«
»Männer können alles«, sagte ich lächelnd, »sogar warten. Lass uns wetten: Eine Woche lang schaue ich mir an, welchen Unsinn sich Kerle täglich antun, um sich als Männer zu fühlen. Am kommenden Sonntag erzähle ich dir, was ich erlebt habe. Wenn du danach immer noch glaubst, moderne Frauen hätten ein härteres Los als moderne Männer, dann …« Mir fiel nichts ein, was Nina interessieren könnte: … dann kriegt sie eine Kiste Bier? Uninteressant. … dann verschaffe ich ihr ein Date mit Jon Hamm alias Don Draper? Unrealistisch.
»… dann besorgst du mir ein Date mit einem tollen Mann«, sagte Nina. »Schließlich ist dann bewiesen, dass die Ansprüche an Männer gar nicht so unrealistisch sind. Es muss doch einen Typen geben, der alles hat, was ich mir wünsche.«
Ich hätte ihr jetzt ein Date mit mir verschaffen können, aber ich vermutete, das war nicht, was sie meinte. Also doch ein Rendezvous mit Jon Hamm? Irgendwas würde ich mir einfallen lassen müssen in den kommenden sieben Tagen. Aber das würde schon klappen. Männer können schließlich alles, notfalls sogar improvisieren.
Gleich am nächsten Morgen begann meine Erkundungsreise in den Männer-Alltag. Eine Woche lang würde ich Dinge vorstellen, die Männer heute können müssen. Was treibt Kerle an? Was fürchten sie? Was wollen sie vom Leben? Können sie ihre Ziele auch ohne gezupfte Brauen oder Pomadenfrisur erreichen? Wie ist es zu diesem Schlamassel gekommen? Wer und was ist schuld daran? Wer hat es heutzutage schwerer: Frauen oder Männer? Und gibt es Traumprinzen tatsächlich? Einer für Nina würde mir ja schon reichen. Antworten auf diese Fragen zu finden, würde keine leichte Aufgabe. Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, noch schwieriger.
Zumindest eine Lehre zog ich schon am Sonntagabend. Egal, wie ungerecht viele Ansprüche an Männer sein mögen: Wer einer gewissen Freundin die DVD-Auswahl überlässt, ist selbst schuld.
Tag 2, Montag Arbeitstier und Kumpel
Geht nicht, gibt’s nicht
7:01 Uhr: Mein Gehirn mag mich nicht. Wenn ich aufwache, habe ich manchmal ein Lied im Kopf, fast immer ein fürchterlicher Ohrwurm. Heute ist es besonders schlimm. Ich öffne die Augen und höre die pumpenden Beats von »Rhythm Is a Dancer«. So stelle ich mir Tinnitus vor. Dieses Schicksal hat niemand verdient, nicht mal die Leute von SNAP! selbst. Nach ein paar Minuten, in denen ich überlege, ob es eine gute Idee war, je auf die Welt gekommen zu sein, stehe ich auf. Müde stapfe ich ins Badezimmer und blicke in den Spiegel. Darin sehe ich einen Mann: halb ich, halb grimmiger Fahrkartenkontrolleur. Wann habe ich angefangen, so freudlos zu gucken? Mir geht es doch blendend. Ich habe einen guten Job, Freunde, Gesundheit. Nur die MTV-Sendung »Worst of 90s Eurodance« in meinem Kopf will partout nicht zu Ende gehen. Kann es noch schlimmer kommen? Es kann. Wenn ich ganz still bin, höre ich nicht nur den stampfenden Rhythmus, sondern noch etwas anderes: eine Stimme. Ich kenne sie. Sie versucht mitzusingen, aber das Textwissen reicht nur bis zur ersten Zeile des Refrains: »Rhythm Is a Dancer, hmhm, hmhm, hm, hm. Uohoooooo!« Die Stimme wird lauter. Ich drehe mich um, aber da ist niemand. Und dann verstehe ich: Diese Stimme gehört mir, besser gesagt: mir als Teenager. Einer dieser Jungs, die es cool fanden, schlechte Musik demonstrativ gut zu finden. Sie hatten auch keine Wahl, damals in der Provinzdisco. Meine Männer-Woche beginnt also ausgerechnet mit der Stimme meines Teenage-Ichs in meinem Kopf. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wenn der Knilch wenigstens »I Don’t Like Mondays« singen würde.
Die Stimme wird lauter. Jetzt redet sie mit mir. »Alter, bitte sag mir, dass du mich verarschst!« Ich ignoriere mich. Früher in der Schule haben das die schönen Mädchen auch gut hingekriegt. Vielleicht ist es ja auch nur ein Traum. Ich drehe den Wasserhahn auf. Eine Dusche wird mich schon wach kriegen. »Ey Alter«, plärrt Mini-Me, »Du hörst morgens Deutschlandfunk? Unter der Dusche?! Mann, bist du spaßbefreit. Fehlt nur noch, dass du Gemüsesaft trinkst und dich auf die Arbeit freust!« Jetzt wünsche ich mir, der Kleine würde nur singen. Von mir aus auch was von SNAP!.
Mit sechzehn war ich ein blasser Langschläfer, der dachte, »Arbeit«, das sind die beiden Silben hinter »Haus-«, »Mathe-« und »Still-«. Ein halber Junge, der glaubte, es sei »Stress«, wenn ihm jemand im Supermarkt die letzte Palette Dosenbier vor der Nase wegschnappt. Und für den »Erfolg« bedeutete, wenn die schöne Eva aus der Parallelklasse ihn in der großen Pause beiläufig grüßte. Ich weiß nicht, soll ich mein Teenager-Ich beneiden oder bemitleiden? Ich weiß nur: Der Junge wäre stinksauer, wenn er wüsste, zu welcher Arbeitsdisziplin ich sein zukünftiges Ich zwinge.
Das Prasseln des Duschwassers ist leider nicht laut genug. Es kann die Sticheleien meines Teenager-Ichs nicht übertönen. Ich brauche dringend Kaffee. Vielleicht geht er dann wieder weg, wie leichte Kopfschmerzen. »Erstens«, sage ich mir selbst, »hör auf mit diesem ›Ey Alter‹. Das klingt peinlich. Ich in deinem Alter hätte nie … Na, jedenfalls klingt es bescheuert! Und zweitens: Ja, ich freue mich auf meine Arbeit, okay? Nicht so, wie ich mich auf ein kaltes Bier freue. Oder wenn du endlich aufhörst, mir auf den Hintern zu glotzen …«
»Woher weißt du das?«
»Ich kenn mich doch … Ich mag meinen Job nun mal. Arbeit gibt mir Selbstbestätigung. Sie fordert mich und zeigt mir, was ich zu leisten imstande bin. Das kann Spaß machen. Ich bin also nicht uncool geworden, seit ich du war. Und falls du was trinken willst: Im Kühlschrank ist jede Menge Gemüsesaft.«
»Alter!«
Der erste Morgen meiner Männer-Woche fängt ja großartig an. Eigentlich will ich doch aufzeigen, wie sehr sich Kerle Tag für Tag überfordern. Moderne Männer wie ich. Normale Männer. Und jetzt halte ich frühmorgens eine Lobrede aufs frisch-fromm-fröhliche Tagwerk? Schlimmer noch: Ich preise nackt den Sinn von Arbeit, und dabei rede ich mit einer eingebildeten jüngeren Version von mir, die sich für cool hält und Krähenfüße für die Füße von Krähen. Ich mag mein Gehirn nicht.
Warum tue ich das bloß? Ich frage mich doch oft, ob ich nicht weniger arbeiten sollte. Ob diese Überstunde nach dem ohnehin langen Bürotag unbedingt sein muss. Ob es richtig von mir ist, noch am Wochenende die beruflichen Mails abzurufen. Ob ich die besser bezahlte Stelle, die mehr Geld bringt, aber auch mehr Arbeit, wirklich will. Vielleicht fällt mir bei einer Tasse Kaffee eine Antwort ein.
Ich torkele aus der Dusche. Dabei ignoriere ich die Frage meines Teenager-Ichs, was in dieser komischen Tube sei (Na, was wohl? Clinique for Men Anti-Fatigue Cooling Eye Gel), dann trockne ich mich ab, ziehe mich an und gehe in die Küche. Es bleibt nicht viel Zeit, ich muss zur Arbeit. Der erste Schluck Kaffee des Tages. Langsam erscheint die Welt wieder in Farbe. Mein »Alter!«-Ego ist immer noch da.
»Wann bist Du bloß so, so … fleißig geworden?«, fragt es irritiert. »Du fandest Arbeit doch mal vollkommen überbewertet. Bei der Berufsberatung des Arbeitsamtes in der neunten Klasse, da spuckte das Computerprogramm dir – also mir, also uns – als Berufsempfehlung ›Landschaftsgärtner‹ aus. Weil Pflanzen einen nicht vollquatschen. Weil wir noch was anderes vorhatten mit dem Leben.«
Dafür, dass Babyface so faul ist, ist er ganz schön penetrant. Aber hat er nicht recht?
Als ich Schüler war, saß ich mit meinen Kumpels, Dosenbier in der Hand, auf dem Hügel über der Kleinstadt. Unter uns lag die Welt unserer Eltern – ihre Einfamilienhäuser, Autos und Bausparverträge. Ihre Berufe ernährten sie und uns. Und dafür waren wir ihnen auch dankbar, soweit ein Teenager zu dieser Empfindung fähig ist. Ihre Generation war aufgewachsen in der Hoffnung, dass mit dem Wohlstand das Glück kommt. Ja, dass Wohlstand und Glück dasselbe sind. Und so hatten sie gearbeitet und gespart, aber glücklich waren sie darüber nicht geworden. Nun steht die Generation unserer Eltern kurz vor der Rente oder ist schon mittendrin. Ihre Ratlosigkeit angesichts der Frage, was Glück ist, hat sich auf uns übertragen: auf die in der Kindheit materiell gut versorgten Alterskohorten der heute Über-Dreißigjährigen.
Wir sahen, dass die Berufe unsere Eltern zeitlich aus-, aber nicht erfüllten. Wir wollten es besser machen. Vor allem besser als unsere Väter, die in den meisten Familien Alleinverdiener waren oder zumindest das meiste Geld heranschafften. Arbeiten, schlafen, arbeiten und schlafen. Und ab und an ein Urlaub, in dem man endlich die Zeit fand, ausgiebig miteinander zu streiten. So war es bei den meisten von uns. Wessen Mutter oder Vater ihn allein großzog, der lernte noch schneller, dass Arbeit überlebenswichtig ist. Aber mit Spaß hatte das alles wenig zu tun. Wir wollten es besser machen.
Unsere Väter konnten ihren Söhnen keine Vorbilder sein, weil sie selbst nicht wussten, wie ein zeitgemäßes, realistisches Idol aussieht. Sie waren hin und her gerissen zwischen ihren Kindheitserfahrungen und der Welt der Gegen- wart. Vorbilder symbolisieren Werte, Ziele, Glaubensinhalte. Doch unsere Väter wurden groß in einer Zeit, in der »Werte, Ziele, Glaubensinhalte« bestenfalls altbacken klang. Im schlimmsten Fall erinnerten diese Worte an den peinlichen Ausfall des betrunkenen Großonkels auf der jüngsten Familienfeier, und mit seinem Ausruf »Der Russe kommt« meinte der vermutlich keinen weiteren Partygast. Die Generation unserer Väter wuchs in einem Wertevakuum auf: Der alte Militarismus war diskreditiert, aber etwas Neues nicht an seine Stelle getreten. Jungs hießen weiterhin »kleiner Mann« und hörten immerzu, dass Indianer keinen Schmerz kennen. Fand denn niemand, dass das nicht gerade für die Cleverness von Indianern spricht?
Indianer wurden zu Männern, und diese taten, was ihnen Tradition und Wirtschaftswunder nahelegten: Sie arbeiteten. Das hatten sie gelernt, das konnten sie. Arbeit führte zu Beförderungen, zu sozialem Ansehen, zu Frau, Kindern und Waschmaschine. Die Generation unserer Väter verdiente den Großteil des Haushaltseinkommens. Daheim reparierten sie kaputte Stühle und Autos, und wenn ihnen das zu viel wurde, bezahlten sie andere Männer, die das für sie erledigten. Unsere Väter waren vor allem eines: nützlich. Was gab es Wichtigeres, als nützlich zu sein? Unsere Antwort war: eine ganze Menge.
Wir wollten die unbekannte Welt kennenlernen, und das war so ziemlich alles jenseits unserer Kleinstadt. Die Ferne wirkte auf uns wie ein Versprechen, das wir selbst einlösen konnten. Wir mussten es bloß schlauer anstellen als unsere Väter. Wir wollten anders sein als die Männer, die im Morgengrauen zur Arbeit fuhren und abends müde und still zum Essen heimkehrten. Anders als die Väter, deren Hinterköpfe wir besser kannten als ihre Gesichter. Schließlich ging ihr Blick immer dorthin, wo wir zufälligerweise gerade nicht waren: zur Haustür, zum Schreibtisch, zum Fernseher oder zur Zeitung. Wir wollten mehr Zeit aufwenden für unsere Freundin (falls wir je eine hätten), für Freunde (moderne Männer haben so was tatsächlich), vielleicht sogar für unsere Familie. Dafür müssten wir die Sache bloß richtig angehen. Uns bloß Zeit nehmen für all das, was wir im Leben erreichen wollten. Wir wollten fokussiert sein, um entspannen zu können. Weil »Weniger arbeiten, um keinen Herzinfarkt zu kriegen« nicht so sexy klingt, erhielt dieses Vorhaben irgendwann den Namen »Work Life Balance«. Das Leben sollte Spaß machen. Wir wollten keine »kleinen Männer« sein, sondern große Jungs werden. Wir wollten nicht nur glücklich sein, sondern auf bessere Art glücklich. Sogar unsere Sehnsucht nach Zufriedenheit ist geprägt von Konkurrenzdenken, und wir haben es gar nicht gemerkt.
Nach und nach sehen Männer ein, dass sie auf dem Weg zum besseren Glück irgendwo falsch abgebogen sind. Sie arbeiten mehr als ihre Väter. Diese hatten wenigstens am Wochenende und im Urlaub frei. Das ist vorbei. Schönen Dank auch, Internet. Sie arbeiten nachts und am frühen Morgen, lesen ihre Jobmails im Café und beantworten Anfragen zum neuesten Projekt auf der Bettkante. Sie glauben, im Job unverzichtbar zu sein, haben aber ständig Angst, ihn zu verlieren. Was ist da schiefgelaufen?
Die Antwort hat mit einem harten internationalen Wettbewerb zu tun und mit immer unsichereren Arbeitsverträgen. Aber es kommt noch etwas hinzu, und das hat zu tun mit unserem Bild vom Mann. Brigitte-Leser wissen es schon seit langem. Aber wer gibt schon zu, Brigitte zu lesen?
Die Frauenzeitschrift ließ 1977 deutsche Männer zwischen 20 und 50 Jahren interviewen. Die Hauptfrage lautete: »Was erwartet Ihrer Meinung nach die Mehrzahl der Frauen heute von einem Mann?« Um die damalige Mehrheitsmeinung zu verstehen, hilft es, einen alten Schlager vor sich hin zu summen. 1977 war nicht nur die Zeit des Terrors von RAF (»Deutscher Herbst«) und John Travolta (»Saturday Night Fever«). Es war auch das Jahr, in dem eine mittelalte Frau namens Johanna von Koczian einen Schlager mit dem Titel »Das bisschen Haushalt« sang. Darin beklagt eine passiv-aggressive Hausfrau die Ignoranz ihres Gatten, der ihre Arbeit nicht wertschätzt: »Er muss zur Firma geh’n, tagein, tagaus, sagt mein Mann. Die Frau Gemahlin ruht sich aus zu Haus, sagt mein Mann.« Geschlechterdebatte à la ZDF-Hitparade.
1977 also, Helmut Kohl war noch ein aufstrebender Oppositionspolitiker, fielen die Antworten auf die Frage »Was erwartet Ihrer Meinung nach die Mehrzahl der Frauen heute von einem Mann?« so aus: 86 Prozent der Männer stimmten der Anforderung zu, »dass er eine Familie versorgen kann«. Und immerhin 72 Prozent glaubten, Frauen erwarteten, »dass er Erfolg im Beruf hat«. Johanna von Koczians Liedchen war übrigens ein Hit.
Und heute? YouTube ersetzt die ZDF-Hitparade, und Helmut Kohl heißt Angela Merkel. Aber sonst? Dreieinhalb Jahrzehnte später hat das Magazin Focus Männern dieselben Fragen stellen lassen wie einst die Brigitte. Aber wer gibt schon zu, Focus zu lesen?
Diesmal fanden 80 Prozent der befragten Männer, die Mehrheit der Frauen erwarte von einem Kerl, »dass er eine Familie versorgen kann«. Zwei Drittel gaben an, dass Frauen von einem Mann wollten, »dass er Erfolg im Beruf hat« – in beiden Fällen sind das nur sechs Prozentpunkte weniger als eine Generation zuvor. Die Erwartungen von Männern an die Erwartungen von Frauen an Männer – sie scheinen dieselben geblieben zu sein. Heute wie damals glauben Kerle, sie müssten arbeiten, um Anerkennung zu finden. Sie definieren sich nach wie vor über ihre Jobs. In gewisser Hinsicht sind sie immer noch »kleine Männer«.
Meinen »kleinen Mann« habe ich selbst übrigens auch noch nicht abgeschüttelt. Damit meine ich den Personal Teenager in meinem Kopf. Der erste morgendliche Kaffee hat meine Müdigkeit vertrieben, nicht aber den penetranten Bengel, der ich mal war. Jetzt sieht er mir bei etwas zu, das ihm noch weniger schmecken wird als Gemüsesaft: bei der Arbeit.
Ich stapfe die Treppenstufen zu meinem Büro hinauf. Auf dem linken Arm balanciere ich Briefe und Päckchen aus meinem Postfach. In der rechten Hand halte ich meinen zweiten Kaffee. Vielleicht befreit er mich von meinem lästigen Begleiter. Seufzend stelle ich mein Gepäck auf den Schreibtisch und schalte den Rechner an. Hunderte Mails haben sich angehäuft. Ich klicke bei den meisten gleich auf »Löschen«. Kehraus 2.0. Mein Teenager-Ich wird ungeduldig. »Was machst du überhaupt beruflich?«
»Ich drehe Mystery-Pornos und verkaufe sie übers Internet. Früher agierte ich selbst oft vor der Kamera, zum Beispiel in ›World of Whorecraft‹. Heute führe ich immer häufiger Regie. Mich reizt der kreative Prozess.«
»Alter, echt?!« (Meine Güte, bin ich naiv.)
»Äh, nein. Ich recherchiere und schreibe Zeitungstexte, meistens über Politik und Gesellschaft. Dazu muss ich informiert sein: morgens per Deutschlandfunk unter der Dusche, tagsüber durch die Meldungen der Nachrichtenagenturen, abends durchs Internet und die Fernsehnachrichten. Zwischendrin bekomme ich die wichtigsten Tickermeldungen aufs Handy. Eigentlich bin ich immer im Dienst. Wie die meisten hier.«
»Hmm, ja, ja, interessant. Aber noch mal kurz zurück zu ›World of Whorecraft‹ …«
Ich wünschte, der Junge ließe mich in Ruhe, damit ich arbeiten kann. Jetzt wäre wohl ein guter Moment, ihm zu eröffnen, dass Eva aus der Parallelklasse ihn total unattraktiv findet. Und dass ihr Gruß neulich in der großen Pause nicht ihm galt, sondern seinem Kumpel, der neben ihm stand. Ich erzähle es ihm nicht. Ich kann mir einfach nicht böse sein.
Mindestens zehn Stunden Arbeit liegen vor mir, wie an fast jedem Wochentag. Im Kern hat diese Arbeitswut wenig damit zu tun, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist. Meine Kolleginnen arbeiten ebenso viel wie die Männer. Und was heißt das schon: »Arbeit«? Über Jahrhunderte wurden Kindererziehung und Hausarbeit nicht als Leistung anerkannt. Nur Erwerbsarbeit galt etwas: Das bisschen Haushalt war doch kein Problem.
Was neu ist, ist nicht der Stress der Männer im Job an sich. Neu ist dessen Permanenz und der Wunsch, nicht nur dort Leistung zu bringen, sondern möglichst auch in der Beziehung, im Sport, in der Kindererziehung. Kerle wollen den gewachsenen Ansprüchen von Frauen und Arbeitgebern gerecht werden. Sie wollen weiterhin alles können, egal, wie viel das ist. Viele Männer verwechseln diese Kraftanstrengung mit einem Privileg.
Doch was ein Privileg ist, ist Ansichtssache. Beispielsweise galten in China über Jahrhunderte verstümmelte, bandagierte Frauenfüße als Zeichen hohen sozialen Status. Passanten raunten einander zu: »Guck mal, die Frau mit den schmerzenden Fußstümpfen, auf denen sie kaum laufen kann: Die hat’s gut.« Diese barbarische Sitte gibt es nicht mehr. Für Krüppelfüße sorgen heute High Heels.
Ein ähnliches Missverständnis zwischen Pein und Privileg haben sich auch Männer ausgedacht. Der neue Inbegriff des Luxus für den Mann, der schon alles hat, ist: die Vereinbarkeit von Karriere und Kindern. 2011 erklärte Eric Strutz, ein Vorstandsmitglied der Commerzbank: »Ich hatte nie die Zeit, mich so um meine Familie zu kümmern, wie ich es gerne getan hätte.« Das wolle er nun ändern. Erst mit Abstand werde der Sechsundvierzigjährige über seinen nächsten beruflichen Schritt nachdenken. Nun könnte mancher zu dem Schluss kommen: »Oho, wenn sich gar ein Topmanager, der viel zum Wiederaufstieg von Deutschlands zweitgrößter Bank beigetragen hat, ganz der Familie widmen kann, dann ist die Inanspruchnahme von Elternzeit durch Männer gesellschaftlich akzeptiert.« Aber wer so denkt, hält vermutlich auch Kerzenlicht per se für romantisch und lacht immer noch über »Kentucky schreit ficken« (höre ich etwa mein Teenager-Ich kichern?). Das Banker-Beispiel aber zeigt eben nicht, dass die Hürden für Männer, die Job und Privatleben unter einen Hut bringen wollen, niedriger geworden sind. Im Gegenteil: Es erhöht die Ansprüche.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gilt als erstrebenswert, aber schwer erreichbar. Wie innere Ruhe. Oder Sex über fünfzig. Banker Strutz ist damit ein Vorbild für »moderne Männer«. Das ist das Nachfolgemodell der »neuen Männer«. Die Bezeichnung kam spätestens 1982 in Mode durch Ina Deters Lied »Neue Männer braucht das Land«, das bis heute nichts von seiner Humorlosigkeit eingebüßt hat. »Moderne Männer« sind aus Forschersicht Herren, die für Frauenemanzipation sind, gleichberechtigte Kindererziehung wichtig finden und nichts dagegen haben, nicht der Alleinverdiener im Haushalt zu sein. Sie sind die Männer, die das Land seit langem braucht. Sie sind weder Macho noch Weichei. Der Haken ist: Diese Herren halten es nicht mit Ina Deters Albumtitel »Die Hälfte der Welt«. Sondern sie wollen alles: Superkarriere und Supervaterschaft.
»Der Mann erfährt in der Arbeit seinen Sinn.« Dieser traditionellen Ansicht stimmten 1998 in einer großen Befragung nur 21 Prozent der »modernen Männer« zu. Zehn Jahre später waren es laut Nachfolgestudie »Männer in Bewegung« 45 Prozent – mehr als doppelt so viele. Das heißt: Emanzipierte Männer wollen zu Hause voll da sein. Aber im Job wollen sie auch alles geben, wie früher. Das Beispiel des Bankers legt den Gedanken nahe, dass Männer dieses Doppelziel erreichen können – oder müssen. Das stresst. Warum setzen sich moderne Kerle diesem Druck aus? Die Antwort ist ganz einfach: Weil sie’s können.
Setzt man Männern Ziele, egal wie lächerlich, werden die meisten alles dafür tun, diese zu erreichen. Beispielsweise die Klempner. Ein Sanitärgroßhandel hat sich eine Art Meisterschaft seines Fachs ausgedacht. Zu den Klängen der Rocky-Hymne »Eye of the Tiger« und unter großem Applaus messen sich in Österreich und der Schweiz Expertenteams in Sachen Gas/Wasser/Scheiße. Duos namens »Goldfinger«, »The Incredibles« und »Geht nicht, gibt’s nicht« klotzen und kleckern, um zu entscheiden, wer der beste Rohrverleger im Land ist. Wer am schnellsten Trink- und Abwasserleitungen zusammenschraubt, aus Rohren ein Männchen baut oder die Reifen eines Landrovers wechselt, gewinnt eine Reise nach Dubai. Die Sieger der Schweizer »Challenge«, die »Mario Bros«, erhielten als Trophäe: ein Rohr. Noch Fragen?
Männer benehmen sich so dumm oder so klug, wie es die Ansprüche, denen sie sich ausgesetzt sehen, erfordern. Entwicklungspsychologen sagen: Von frühester Kindheit an werden Jungs stärker als Mädchen darauf trainiert, Leistung zu erbringen und sich im Wettkampf zu bewähren. Dazu trägt bei, dass es Jungen schwerer fällt als Mädchen, in sich hineinzuhorchen. Das erklären die Experten auch mit dem Umstand, dass Jungs durch ihre Penisse im Wortsinne viel stärker »außenfixiert« sind als Mädchen, deren Geschlechtsorgane weitgehend im Körperinnern liegen. Ihre ureigensten Wünsche überhaupt wahrzunehmen, falle vielen Jungs von Anfang an besonders schwer. Sie orientieren sich deshalb eher an messbaren Dingen. Natürlich mache ich an dieser Stelle keinen schlüpfrigen Witz über »messbare Dinge«. Das ist mir zu primitiv. Auch ein Mann mit großem Penis kann Feingefühl besitzen.
Eine Mutter prägt wie niemand sonst die frühkindlichen Erfahrungen ihres Kindes. Säuglinge sind existentiell abhängig von ihr. In dieser Zeit formen sich Verhaltensweisen, die ein Leben lang fortwirken: Erhält ein Kleinkind weniger Aufmerksamkeit, als es sich wünscht, wird es versuchen, dies auszugleichen. Viele Kinder bemühen sich instinktiv, durch Wohlverhalten Zuwendung zu erhalten: Ist das Baby nicht brav? Und es lächelt so viel. Diese Konzentration auf Ansprüche anderer wird bei vielen Menschen so allgegenwärtig und selbstverständlich, dass sie als Erwachsene gar nicht wissen, was sie – sie selbst und niemand sonst – eigentlich wollen. Stattdessen wollen sie Erwartungen anderer erfüllen. Das haben sie gelernt, und das perfektionieren sie. Diese Erfahrungen machen natürlich nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen. Aber weil viele Jungs nie gelernt haben, in sich hineinzuhorchen, fällt es ihnen im Erwachsenenalter besonders schwer, die eigenen Bedürfnisse und die Zwänge, denen sie unterliegen, wahrzunehmen. An sie herangetragene Erwartungen werden zum Ersatz für den inneren Kompass. Sie folgen dann häufig ihren Freunden, Lebenspartnern, Chefs oder Zeitstimmungen. Das kann schlimme Folgen haben: seelische Haltlosigkeit, fehlende Identität und öffentliches Rohrverlegen. Oder eine übertriebene Identifizierung mit dem Job. Vielen Männern muss die Arbeit die Bestätigung liefern, dass sie gut und gewollt sind.
Je vielfältiger die äußeren Ansprüche, desto verwirrter die Männer. Welche Erwartungen sollen sie erfüllen? Sie wollen ja tüchtig sein, Leistung bringen, Applaus bekommen – aber wofür? Immer mehr Frauen verlangen heute offen nach einem Mann, der Karriere macht, aber auch Zeit für sie und die Familie hat. Einen Kerl, der nicht den Pascha spielt, aber die Familie ernähren können soll. Diese Forderungen sind nachvollziehbar. Viele Frauen haben gelernt, ihre Bedürfnisse zu verstehen und öffentlich zu benennen. Der Haken ist nur: Die Emanzipation der Männer hat damit nicht Schritt gehalten.
Superkarriere und Supervaterschaft unter einen Hut zu bringen ist kein realistisches Modell für die meisten Männer. Der Normalo, der mit vierzig seinen ersten Herzinfarkt noch vor sich haben möchte, wird sich entscheiden müssen. Er muss Prioritäten setzen. Nicht jeder kann es wie der Commerzbank-Vorstand halten, der beruflich so qualifiziert ist und so viel verdient hat, dass er erst mal in Ruhe darüber nachdenken kann, wer ihn nach seiner Auszeit anstellen darf. Natürlich müssen Männer lernen, in sich hineinzuhorchen, um zu erfahren, was sie wirklich wollen. Aber weil viele Männer nach wie vor nach äußeren Vorgaben handeln, müssen sich auch diese Vorgaben ändern. Das heißt: Es muss gesellschaftlich stärker akzeptiert werden, wenn Männer sich ein auf sie abgestimmtes Mischungsverhältnis zwischen Arbeit und Privatleben zusammenbasteln. Mal mag der Job oberste Priorität besitzen, mal die Kinderpflege, die Versorgung Angehöriger oder das langersehnte Auslandsjahr. Prioritäten ändern sich, und Lebensabschnitte kommen und gehen – außer der Pubertät meines Teenager-Ichs.
Zu oft erhalten Männer gemischte Signale. Bekanntlich beherrschen Männer kein Multitasking, verschiedene Reize zur selben Zeit verwirren sie. Mein Schulfreund Hilmar lernte das auf einer Party, als er meinte, betrunken tanzen und zugleich seinen Würgreflex unterdrücken zu können.