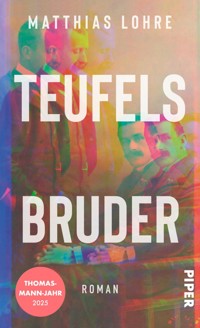8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Donald Trump, die AfD und radikale Verfechter der Identitätspolitik haben etwas Wichtiges gemeinsam: Sie sehen sich als Opfer finsterer Mächte. Die neuen Opfer unterteilen die Welt in Gut und Böse. Dialog ersetzen sie durch Empörung, Fakten durch Bauchgefühle. Sie geben sich als Richter über unsere moralischen Normen, brechen diese aber ständig selbst. Ihren wachsenden Einfluss nutzen sie allein für sich, während wirklich Machtlose leer ausgehen. Nie zuvor beklagten Menschen wegen geringerer Anlässe, ihnen widerfahre gewaltiges Unrecht - und nie zuvor hatten sie damit mehr Erfolg. Dabei liegen die wahren Ursachen, weshalb wir uns ohnmächtig, benachteiligt oder bedroht fühlen, meist nicht im Hier und Jetzt, sondern in unserer Kindheit. Bestsellerautor Matthias Lohre bietet verblüffende Einsichten in ein Phänomen, das unser Leben immer stärker prägt, und zeigt Auswege aus dem Opfer-Denken.
- Die Tricks der Demagogen
- Über die Macht des Jammerns
- Die intelligente Analyse eines bizarren Zeitphänomens
- Für politisch und gesellschaftlich interessierte Leser/innen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Matthias Lohre
Das Opfer ist der neue Held
Warum es heute Macht verleiht, sich machtlos zu geben
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2019 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlaggestaltung: init Kommunikationsdesign, Bad Oeynhausen
Umschlagmotiv: © Mopic, fotolia
ISBN 978-3-641-25006-5V003
www.gtvh.de
Inhalt
I. EINLEITUNG
1. IST DONALD TRUMP DER BEDAUERNSWERTESTE MENSCH DER WELT?
Was das Opfer zum Helden unserer Zeit macht
II. SCHULDIGE
2. WER HAT ANGST VORM FLIEGEN?
Warum der Opferstatus so attraktiv ist
3. WARUM WOLLEN DIE SOLDATEN ZURÜCK AN DIE FRONT?
Wie Opferhaltungen entstehen
4. WÜRDEN SIE IHREN HUND ESSEN?
Warum Menschen sich nach Opfern sehnen
III. OPFER
5. WIE VIELE MÜSSEN FÜR DEN FRIEDEN STERBEN?
Was Opfer mit unserer Angst vor dem Tod zu tun haben
6. FÜRCHTET EUCH NICHT!
Wie sich das Opfer vom Außenseiter zum Erlöser wandelte
7. WER HAT MIR DAS ANGETAN?
Wie das Opfer zum unschuldig Leidenden wurde
IV. LINKE
8. BELÄSTIGT SIE DIESES GEDICHT?
Wenn die Sprache des Traumas zur Waffe wird
9. ICH WEISS GENAU, WIE SIE DAS GEMEINT HABEN!
Wie die Identitätspolitik Menschen in Täter und Opfer unterteilt
10. SEI STILL!
Was passiert, wenn die Identitätspolitik sich durchsetzt
V. RECHTE
11. DARF TRUMP JEMANDEN ERSCHIESSEN?
Warum rechte Anführer sich zu Opfern erklären
12. SPRECHT MIT DEM ELEFANTEN!
Wovon Konservative sich bedroht sehen
13. WARUM SCHLUGEN DIE BRITEN DAS LOCH IN DIE DECKE?
Wie aus Opferhaltungen große Politik wird
VI. DEUTSCHE
14. DU BIST NICHTS, DEIN VOLK IST ALLES!
Wie Opferhaltungen die Nazi-Herrschaft ermöglichten
15. WIR SIND DOCH DIE GUTEN!
Wie die DDR-Führung Opferhaltungen schürte
16. DÜRFEN DEUTSCHE NICHT TRAUERN?
Warum AfDler sich für Opfer halten
VII. LÖSUNGEN
17. WAS WÜRDE YANNIK TUN?
Wie wir es schaffen, uns nicht als Opfer zu sehen
18. BRAUCHEN WIR HELDEN?
Wie wir Opferhaltungen vorbeugen
Literatur
Danksagung
I. EINLEITUNG
1. IST DONALD TRUMP DER BEDAUERNSWERTESTE MENSCH DER WELT?
Was das Opfer zum Helden unserer Zeit macht
Der bedauernswerteste Mensch der Welt erbte ein Vermögen und besuchte eine teure Elite-Uni. Danach heiratete er eine Reihe von Models – nacheinander natürlich – und verdiente Millionen als Star seiner eigenen Reality-TV-Sendung. Sein Name stand schon für Macht, Selbstvertrauen und Reichtum, als er sich seinen größten Traum erfüllte. Er kandidierte für die Präsidentschaft – und besiegte die klare Favoritin. Jetzt war er mächtiger und berühmter denn je. Als Präsident lebte er so, wie Kinder sich den Alltag eines Königs vorstellen mögen. Den halben Tag sah er fern. Er lud eine siegreiche American-Football-Mannschaft zu sich nach Hause und servierte ihr zwischen vergoldeten Kandelabern Berge von Burgern, Pommes und Pizza. Wenn ihm irgendetwas nicht passte, schrieb er im Bett oder auf dem Klo Twitter-Nachrichten, mit denen er die halbe Welt aufschreckte. Und wenn er auf seinem großen Schreibtisch einen Knopf drückte, brachte ihm ein Butler eine Diet Coke. Zwölfmal pro Tag. Trotzdem stellte Donald Trump sich, nur wenige Monate nach seiner Wahl, an ein Rednerpult und rief der Menge zu: »Kein Politiker in der Geschichte – und ich sage das mit großer Gewissheit – wurde schlimmer oder unfairer behandelt!«
Schlimm und unfair behandelt? Trump war nie gefoltert worden. Nie war er wegen seiner Überzeugungen ins Gefängnis gekommen, und nie hatte er sich verstecken müssen. Im Gegenteil schien er jederzeit zu sagen und zu tun, worauf er gerade Lust hatte. Warum also beklagte er sein Schicksal? Und warum teilten Dutzende Millionen Amerikaner seine Sicht? In ihm sahen sie einen Macher, der den Neid seiner Feinde auf sich zog. Sie glaubten Trump, wenn er ihnen sagte, eine Verschwörung hoher Staatsbediensteter wolle ihn zu Fall bringen. Sie schrien Reporter an, wenn er behauptete, TV-Sender brächen Live-Übertragungen seiner Reden ab, weil diese ihnen nicht gefielen. Sie wiederholten sein Wort von der »Hexenjagd«, durch die finstere Bürokraten ihn angeblich zu Fall bringen wollten. Sie empörten sich mit Trump, wenn dieser das Schicksal von Ex-Mitarbeitern beklagte: »Wer wird die jungen und wunderschönen Leben derer zurückgeben, die durch die verlogene Hexenjagd erschüttert und zerstört wurden?« Sie seien »mit Sternen in ihren Augen nach Washington, D.C.« gereist, um »unserer Nation zu helfen… Zurück kehrten sie in Fetzen!« Trumps Anhänger scherte es nicht, dass Gerichte diese Berater reihenweise wegen schwerer Delikte verurteilten. Im Gegenteil. Jede Kritik bestärkte sie in ihrer Überzeugung, böse Mächte wollten ihr Idol daran hindern, ihnen zu helfen. Sie glaubten Trump, wenn er seinen damals 56 Millionen Twitter-Followern schrieb: »Das Opfer hier ist der Präsident.«
Der mächtigste Mensch der Welt – ein Opfer?
»Wir alle verstehen uns als Zentrum unseres eigenen Universums«, sagt Chris Cillizza vom US-Nachrichtensender CNN. »Aber Trump treibt diese Sicht ins absolute Extrem. Er glaubt, das Universum sei hinter ihm her, und deshalb verdiene er von allen Mitleid und Sympathie.« Dabei ist Trumps aggressives Selbstmitleid nicht einmal das Bemerkenswerteste. Noch erstaunlicher ist, wie es ihm gelang, Millionen Amerikaner von seinem Opferstatus zu überzeugen. Indem er sich als von finsteren Mächten Verfolgter präsentierte, den allein die Unterstützung loyaler Anhänger vor dem Fall bewahre, schmälerte er seine Macht nicht. Er festigte sie. Der 45. US-Präsident bietet das spektakulärste Beispiel einer Entwicklung, die vor seinem Amtsantritt begonnen hat und unsere Welt lange nach seinem Abgang prägen wird: den Aufstieg des Opfers vom Außenseiter zum Helden.
In Deutschland beschwören AfD-Politiker eine »Selbstzerstörung unseres Staates und Volkes« und plakatieren den Slogan Wir sind nicht das Weltsozialamt! Angeblich betrieben Politik und Medien die »Überfremdung« Deutschlands. Das Ziel des verräterischen Regimes sei der »Volkstod«. Dass niemand außer ihnen die Verschwörung erkennt, beweist aus ihrer Sicht gerade deren Ausmaß – und ihre Erwähltheit. Ihr Bauchgefühl gilt ihnen als unanfechtbare Wahrheit.
Ähnliches sehen wir in Ungarn, wo Premier Viktor Orbán die Gefahr durch die EU beschwört: Die »virtuelle Welt der privilegierten europäischen Elite« plane einen »Bevölkerungsaustausch« durch »Massen einer anderen Kultur aus einer anderen Zivilisation«. In der Türkei behauptet Präsident Recep Tayyip Erdoğan, verantwortlich für die tiefe Wirtschaftskrise seines Landes sei eine westliche Verschwörung, um die Türkei »in die Ecke zu drängen«. In Brasilien erklärt Präsident Jair Bolsonaro, das Land müsse sich »vom Sozialismus, der Umkehrung der Werte und der politischen Korrektheit befreien«, und sein Außenminister sieht sogar im Klimawandel eine »marxistische Verschwörung«. Die vermeintlichen Opfer halten ihre Gegner für so allmächtig wie unfähig.
Die neue Lust am Opfer-Sein floriert auch unter Linken. An Universitäten fordern Studierende umfassenden Schutz vor unliebsamen Meinungen ein. Sie fürchten, selbst Worte in einem Buch könnten sie traumatisieren. Literaturklassiker erhalten deshalb »Triggerwarnungen«. Die sollen junge Leser davor bewahren, sich schockartig an schmerzvolle Erlebnisse erinnert zu fühlen. Selbst dann, wenn es gar nicht ihre Erlebnisse sind, sondern die anderer Frauen, Schwuler oder African Americans. So sei es schwarzen Studenten nicht zuzumuten, rassistische Schimpfworte in einem Artikel zu lesen – selbst wenn der Text Rassismus kritisch behandelt. Genauso müssten weibliche Jura-Studierende Vorlesungen meiden dürfen, welche die Rechtsprechung in Vergewaltigungsfällen behandeln. Die neuen Opfer erklären anderer Leute Leid zu ihrem eigenen und leiten daraus ein Recht auf Schutz ab. Ihr subjektives Empfinden genügt.Jeder Einwand, jede Verteidigung bestätigt ihnen nur die Verblendung der anderen. Die neuen Opfer halten sich für ohnmächtig, aber moralisch überlegen.
»Es sind allerdings so gut wie nie die tatsächlichen ›Opfer‹«, urteilt die Philosophin Maria-Sibylla Lotter, »sondern meist selbst ernannte Opfervertreter«. Diese wollen »anderen aufgrund ihrer Identität das Recht auf Verständnis oder auch nur freie Meinungsäußerung zu bestimmten Themen« zusprechen oder verweigern. Die Professorin an der Ruhr-Uni Bochum sieht darin eine Gefahr. Die Identitätspolitik war einmal dazu gedacht, benachteiligte Gruppen sichtbarer zu machen und zu stärken. Heute aber hat sie vielfach »die Gestalt einer Anklage durch selbst ernannte Richter angenommen«. Opfervertreter unterteilen »die Menschen je nach Hautfarbe oder anderer nicht selbst erzeugter Eigenschaften«. Die einen erklären sie zu Opfern, die anderen zu Tätern »vergangenen und systemischen Unrechts«. Aus Sicht der Opfervertreter haftet auch an den Nachfahren echter oder vermeintlicher Täter untilgbare historische Schuld. Deshalb müssten, ja dürften die Nachkommen der Opfer ihnen nie verzeihen. Die Identität als Opfer und Täter wird vererbt. Versöhnung ist ausgeschlossen.
So teilen Trump, AfD und Verfechter der Identitätspolitik eine düstere Weltsicht. Um sich herum vermuten sie abgehobene Eliten, die aufrechte Bürger wie sie erniedrigen. Immerzu wähnen sie die Zeit zur Umkehr fast abgelaufen. Häufig sehen sie gar einen dramatischen Endkampf zwischen Gut und Böse, zwischen Opfern und Tätern heraufziehen. In diesem Überlebenskampf ist ihnen jedes Mittel recht, schließlich verteidigen sie ein hehres Ideal. So verhalten sie sich unfair im Namen der Fairness, eigensüchtig im Namen des Gemeinwohls, unmoralisch im Namen der Moral.
Wir alle werden als Opfer geboren. Also als bedürftige, für die eigenen Handlungen nicht verantwortliche Wesen, die ihrer Umwelt und den Menschen um sie herum ausgeliefert sind. Im Idealfall reifen wir – dank bedingungsloser Fürsorge und liebevoller Anleitung – zu selbstbestimmten Erwachsenen heran. Auf unserem Weg lernen wir, Gefahren einzuschätzen, abzuwehren, zu minimieren oder aus dem Weg zu gehen. Auch als Erwachsene sind wir zwar nicht gefeit vor traumatisierenden Erlebnissen – etwa durch eine schwere Krankheit, den Tod eines geliebten Menschen, bei Arbeitsplatzverlust, der Trennung vom Partner oder als Ziel einer Gewalttat. Doch in der Regel bemühen wir uns nach Kräften, diese Ohnmachtserfahrungen durchzustehen und hinter uns zu lassen. Schließlich wollen wir uns nicht länger als unbedingt nötig als Opfer fühlen, sondern die Gewissheit zurückgewinnen, unser Leben im Griff zu haben. Wir wollen keine Last sein, sondern Lasten tragen können. Hingegen definieren die neuen Opfer sich durch reales oder imaginiertes Leid. Ihre vermeintliche Schwäche beeinträchtigt ihr Selbstwertgefühl nicht, sondern speist sich daraus.
In unübersichtlichen Zeiten erzählen Opfer eine kraftvolle Geschichte über Gut und Böse, Leid und Aufbegehren. Das sichert ihnen Aufmerksamkeit. Ein besonders anschauliches Beispiel bieten Pseudologen – zwanghafte Lügner. »Früher haben sich Pseudologen gerne als Adelige oder Weltreisende ausgegeben, um Anerkennung zu erlangen«, erklärt der Berliner Psychiater und Psychotherapeut Hans Stoffels. »Heute nehmen sie gerne die Opferrolle ein, zum Beispiel die Rolle des Opfers einer schweren Krebserkrankung oder einer Vergewaltigung.« Stoffels behandelte einen Mann, der »behauptet hatte, sein Sohn sei nach einem Unfall verstorben, was – wie sich später herausstellte – gar nicht stimmte. Aber zunächst hatte er viel Zuwendung und Mitleid erfahren.« Durch den Zuspruch nähren die vermeintlichen Opfer ihr geringes Selbstwertgefühl.
Ihr Status beschert ihnen also Beachtung und eine klar umrissene, positive Identität. Eine erstaunliche Entwicklung. Nicht länger gilt jener als Held, der auf sein Können, sein Glück und die Zukunft vertraut, sondern wer sich öffentlich am glaubwürdigsten als unschuldig Verfolgter präsentiert. Bei Wählern zieht nicht länger das Versprechen, dass sie es einmal besser haben werden, sondern das Heraufbeschwören apokalyptischer Gefahren. Sie wollen Kandidaten, die sie im Glauben bestärken, sie seien ohnmächtig. Vermeintliche Opfer suchen starke Anführer.
Zwar haben Politiker schon immer die Ungerechtigkeit sozialer Verhältnisse beklagt und für sich in Anspruch genommen, für Benachteiligte zu sprechen. Aber sie hätten die Behauptung, sie selber seien Opfer, als Beleidigung empfunden. Vielmehr verstanden sie sie sich als Unterdrückte, die nur darauf warteten, ihr Leid hinter sich zu lassen. Auf ihrem mühsamen Pfad zur Emanzipation erklärten sie sich bereit, Opfer zu bringen. Sie hätten es widersinnig gefunden, sich an ihren Status zu klammern wie an ein Ehrenzeichen. Den neuen Opfern aber fehlt eine positive Utopie.
Natürlich gab es immer auch positiv verstandenes Leid. Wer etwa als Soldat im Ersten Weltkrieg starb, erbrachte damit aus Sicht seiner Landsleute ein ehrenwertes Opfer, denn er gab sein Leben zur Verteidigung ihrer Heimat. Als heldenhaftester Akt der Geschichte gilt Christen bis heute Jesu Tod am Kreuz, weil er sich nach kirchlicher Lehre opferte, um die Menschheit von ihren Sünden zu befreien. Die zwei sehr unterschiedlichen Arten von Opfern unterscheidet das Englische genau. Ein sacrifice erbringt jemand im Dienst einer höheren Sache – einem Gott, Land oder Ideal – mehr oder weniger freiwillig. Das victim hingegen fällt einer Gewalttat oder Katastrophe anheim. Es ist passiv und schwach. Heute aber erklären sich rechte Politiker und linke Verfechter der Identitätspolitik zu victims. Wäre das nur Wortklauberei, dann bräuchte es dieses Buch nicht. Doch darin steckt weit mehr.
Wir werden Zeuge eines epochalen Umbruchs: Das Ideal des selbstbestimmt lebenden Individuums verblasst, und an seine Stelle tritt das immerzu Aufmerksamkeit und Mitgefühl einfordernde Opfer. Dessen Selbstwertgefühl speist sich nicht aus eigenen Leistungen, Ideen oder guten Taten. Die Selbsteinschätzung der neuen Opfer bringt der Literaturwissenschaftler Daniele Giglioli so auf den Punkt: »Wir sind stolz darauf, etwas erlitten zu haben. Wunden, tatsächliche genauso wie symbolische, sind der Nachweis für Glaubwürdigkeit.« Indem sie sich durch – reale oder vermeintliche – Verletzungen definieren, schaffen sie sich eine schlüssige Lebenserzählung. Ich leide, also bin ich.
Noch vor wenigen Jahrzehnten schien diese Entwicklung undenkbar. Wer Gewalt erfuhr, dem wurde fast immer eine Mitschuld unterstellt. Auch deshalb wiesen Holocaust-Überlebende in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die Bezeichnung »Opfer« empört von sich. Sie wähnten darin den Vorwurf, sie hätten sich wie Lämmer zur Schlachtbank führen lassen. Stattdessen betonten sie die Bedeutung jüdischen Widerstands gegen die Nazis. Opfer zu sein galt als Schande.
Seither hat unsere Gesellschaft sich radikal individualisiert. »Die Sehnsucht, irgendwo dazuzugehören, gibt es aber nach wie vor«, sagt Giglioli, Autor des Buchs Die Opferfalle. Deshalb suchen wir nach Momenten, in denen wir uns mit anderen Menschen verbunden fühlen. So unterschiedlich wir auch sind: »Auf das Gefühl, Opfer dunkler Mächte zu sein, darauf können wir uns einigen. Weil es uns nichts anderes abverlangt als das Gefühl, an nichts schuld zu sein.« Der Opferstatus befriedigt die Sehnsucht vereinsamter moderner Menschen nach Unschuld und Zugehörigkeit – ganz ohne die moralischen Grautöne und lästigen Pflichten, die echte Gemeinschaften ihren Mitgliedern zumuten.
Die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Gleichheit steckt tief in uns, sie gehört zum genetischen Erbe unser Jäger- und Sammler-Vorfahren. Für sie zählte nicht persönlicher Besitz, sondern sozialer Zusammenhalt. Nicht starre Hierarchien prägten ihren Alltag, sondern gemeinsam getroffene Entscheidungen. Für dieselben Werte glauben die neuen Opfer zu kämpfen. Die einen sehnen sich nach universeller Gleichheit – und überbetonen zugleich Unterschiede. Die anderen suchen Schutz in der Gemeinschaft – und sehen sich doch immerzu bedroht. So gesehen, sind sie Symptomträger einer unglücklichen Gesellschaft. Sie beklagen auf kontraproduktive Weise, woran es uns mangelt.
Was für eine Karriere: Das schwächliche, verachtete Opfer von einst hat sich gewandelt zur obersten moralischen Instanz. Aus einem Makel ist ein Verdienst geworden, aus einer Ausnahme ein Massenphänomen, aus einem Außenseiter die Zentralfigur unserer Zeit. Oder in Gigliolis Worten: »Das Opfer ist der neue Held.«
Das mag paradox, ja hämisch klingen. Macht sich hier jemand über Schwache, Kranke oder Diskriminierungsgegner lustig? Ich möchte eines klarstellen: Dieses Buch polemisiert nicht gegen die Emanzipation sozialer Gruppen. Natürlich gibt es weltweit viele Millionen in Not Geratene und Verfolgte, die unsere Empathie und Hilfe brauchen. Auch erfahren viele Menschen, die sich als Opfer verstehen, tatsächlich Benachteiligungen. Hier werden auch nicht jene pauschal verurteilt, die sich von Fremdem bedroht fühlen. Wenn wir andere verurteilen, können wir ihre Motive nicht verstehen.
In diesem Buch begleiten wir Menschen, die nach dem Opferstatus streben, mit seiner Hilfe Macht ausüben und ihn eifersüchtig bewachen. Wir zeigen, wie sie vergeblich versuchen, alte Wunden zu heilen, und dabei sich und anderen neue schlagen. Wir werden auf unserem Weg vielen Fragen begegnen: Wie bestärkt unsere Kultur Menschen darin, sich als Opfer zu verstehen? Welche psychologischen Gründe stecken dahinter? Wie bringen die vermeintlich Ohnmächtigen ganze Staaten ins Wanken? Und wie vermeiden wir es, Menschen für unser Leid verantwortlich zu machen, die es gar nicht sind? Denn Opfer im Sinne dieses Buchs sind nicht einfach die anderen. Als Opfer können wir alle uns fühlen, wenn wir nicht verstehen, was uns ängstigt.
Unsere Suche wird uns zurückführen bis in ferne Tage, als unsere Vorfahren die Savannen Afrikas durchstreiften. Im Nürnberger Justizpalast werden wir zu verstehen versuchen, wie sich ein KZ-Kommandant zum Opfer erklären konnte. Wir blicken einer Dozentin in Connecticut über die Schulter, während sie mit einem Aufruf zur Selbstständigkeit einen Skandal auslöst. Wir ergründen, warum viele Ostdeutsche einem Politiker zujubeln, der die Apokalypse heraufbeschwört. Und wir erfahren von einem Vater, der seinen Sohn nicht vor dem Tod retten konnte, wie er das Gefühl der Ohnmacht hinter sich gelassen hat. Wie ein Prisma die Wellenlängen des Lichts auffächert, so will dieses Buch all die Nuancen des Wortes Opfer erstrahlen lassen. »Die Geschichte der Zivilisation«, schrieben die Philosophen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, »ist die Geschichte der Introversion des Opfers.« Anders ausgedrückt: Schauen wir uns an, was wir meinen, wenn wir vom Opfer sprechen. Dann verstehen wir besser, woher wir kommen, was uns wichtig ist und was uns im Innersten bewegt.
An unserer ersten Station begegnen wir einer Frage, die auf den ersten Blick nichts mit alldem zu tun hat: Warum sind wir so gestresst?
II. SCHULDIGE
2. WER HAT ANGST VORM FLIEGEN?
Warum der Opferstatus so attraktiv ist
Als Erica Mann 22 Jahre alt war, wollte die New Yorkerin vor allem eins: weg von ihrer dominanten, kalten Mutter. Sie tat, worin in den 1960er-Jahren viele junge Frauen die Lösung sahen: »Ich heiratete mein Sweetheart vom College. Ich wollte unabhängig sein, das habe ich aber zunächst nicht alleine geschafft. Ich war 22 und ein Baby.« Ihr Gatte »war der gescheiteste Mann, den ich je getroffen hatte« – und »wurde eines Tages verrückt. Er erlitt einen schizophrenen Zusammenbruch.« Erica wusste nicht weiter. Schließlich ließ sie sich scheiden und heiratete erneut, diesmal den Psychiater Allan Jong. »Ich dachte, das würde mich vor dem Verrücktwerden schützen. Aber das hat es natürlich nicht.« Mit ihrem zweiten Mann zog sie Mitte der 1960er-Jahre nach Heidelberg. Hier behandelte Dr. Jong amerikanische Soldaten, die aus dem Vietnamkrieg zurückkehrten. Erica begann im nahen Frankfurt eine Therapie bei einem angesehenen Psychoanalytiker namens Alexander Mitscherlich. »Er war brillant. Die drei Jahre in Heidelberg und die Pendelfahrten zum Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt haben mir so sehr geholfen, dass es mir für immer besser geht. Ich hatte viele Ängste, mich zu offenbaren, in Konkurrenz zu meiner Mutter, einer Künstlerin, zu treten. Es war diese Therapie, die mich befreit hat.« In dieser Zeit fand sie die Kraft, ihren ersten Roman zu schreiben. Angst vorm Fliegen erschien 1973, wurde prompt zum Bestseller, verkaufte sich insgesamt 20 Millionen Mal und gilt heute als Klassiker der feministischen Literatur. Unter dem Namen Erica Jong wurde seine Autorin weltberühmt. Doch ihre Geschichte endet nicht an diesem Punkt. Das Happy End war nur eine Etappe. Auch Jongs zweite Ehe zerbrach, ebenso eine dritte. Ihre späteren Romane verkauften sich gut, aber kein Werk wurde auch nur annähernd so erfolgreich wie ihr Erstling. Partnerschaft, Erfolg und Wohlstand bewahrten sie nicht vor Ohnmachtsgefühlen und Ratlosigkeit. Das Älterwerden belastete sie, und immer wieder zweifelte sie, ob sie die richtigen Entscheidungen traf. Für Jong bewahrheitete sich, was sie ihrer autobiografischen Romanheldin in Angst vorm Fliegen in den Mund gelegt hatte:
»Wenn du Verantwortung übernimmst, nimmst du dein Leben in die eigenen Hände. Und was passiert? Etwas Schreckliches: Da ist niemand, dem du die Schuld geben kannst.«
Die New Yorkerin erlebte sehr bewusst, was hunderten Millionen Menschen in der westlichen Welt widerfuhr. Die traditionellen Bande aus Familie, Religion, Klasse oder Nationalität, die Menschen definierten, gaben insbesondere seit den 1960er-Jahren immer weiter nach. Damals eröffneten sich einer ganzen Generation neue Möglichkeiten. Arbeiterkinder besuchten dank Bildungsreformen Universitäten. Bauernsöhne fanden Arbeit in wachsenden Großstädten. Frauen verdienten ihr eigenes Geld. Junge Erwachsene lebten nicht mehr bis zur Hochzeit unter dem elterlichen Dach. Voreheliche Beziehungen wurden normal. Katholiken und Protestanten heirateten einander – oder gar Konfessionslose. Millionen Menschen traten aus den Kirchen aus. Mütter und Väter erzogen ihre Kinder nach eigenen Vorstellungen. Deutsche, Franzosen und Amerikaner stellten ihre Regierungen, Universitäten und Moralvorstellungen infrage. Die Nachkriegsgenerationen streiften ab, was sie einengte und zurückhielt. Jetzt entschieden sie, wer sie sein und was sie tun wollten. Das Wort Freiheit barg ein Versprechen. Erica Jongs Beispiel zeigt, wie dieses Versprechen zur Last wurde. Wenn wir uns anschauen, was seit damals schiefgelaufen ist, verstehen wir, warum es heute für viele so verlockend ist, sich als Opfer zu sehen. Die Sehnsucht nach Unabhängigkeit hat sich gewandelt zur Angst vorm Abgehängtsein.
Alles fing so vielversprechend an. Wie in den meisten westlichen Ländern, so schien auch in der Bundesrepublik ein langer Wirtschaftsaufschwung den alten, explosiven Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit aufzulösen. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit ging zurück, während die Gehälter stiegen. Fließbandarbeiter bauten sich Häuser und kauften Autos. Büroangestellte sonnten sich im Mittelmeerurlaub. Eine neue Gesellschaftsgruppe, die Rentner, lebte immer länger und finanziell abgesichert. In Neubausiedlungen und Innenstädten entstand etwas, das Soziologen bald »nivellierte Mittelstandsgesellschaft« nannten: eine viele Millionen Köpfe zählende Mitte, in der es mehr darauf ankam, was jemand konnte, und weniger darauf, welcher Konfession man anhing, welchen Beruf der Vater ausübte, ob man Union, SPD oder FDP wählte. Eine ganze Gesellschaft verinnerlichte die Lehre, dass, wer fleißig war und sich an die Regeln hielt, auch sozial aufstieg. Was die Deutschen in Bombennächten, Krieg, Flucht und Gefangenschaft erfahren hatten, schienen sie erstaunlich gut wegzustecken. Anstatt zurückzublicken, schauten sie gebannt auf den eigenen Erfolg. Nach zwei Weltkriegen, nach Vertreibungen, Besatzungen, Hungersnöten, Geldentwertungen und Millionen Toten musste ihnen der rasante Aufstieg tatsächlich wie ein Wunder erscheinen.
Doch unter der Euphorie der frühen Jahre schwelten massive Konflikte. Wer in einer Welt aufgewachsen ist und nun in einer anderen lebt, der fühlt sich in keiner von beiden ganz heimisch. Der Bauernsohn, der es zum Gymnasiallehrer brachte, fragte sich insgeheim beim Umtrunk mit Kollegen, ob er auch das »Richtige« tat, sagte und trug. Die Arbeitertochter am Kaufhaustresen ließ sich nicht anmerken, wie seltsam es ihr vorkam, vermögende Kunden in Sachen Goldschmuck zu beraten. Der aus Ostpreußen Geflüchtete schwieg lieber über die Verachtung, die ihm an seinem neuen Wohnort entgegenschlug, und trat demonstrativ dem Heimatverein bei. Eine ganze Gesellschaft übte hektisch neue Rollen ein. Benimmratgeber und Tanzschulen verliehen ihr den dafür nötigen Schliff. Anzüge ersetzten Uniformen. Angesichts ihres schwindelerregenden Aufstiegs fühlten sich viele Deutsche selbst wie Schwindler. Sie lasen zwar auch wieder Thomas Manns schwermütigen Roman DerZauberberg, aber hunderttausendfach kauften sie dessen 1954 erschienenen Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull: Statt in der Melancholie der Alten erkannten sie sich wieder in Krulls eisernem Willen zum Optimismus. Der junge Parvenü war seiner drohenden Enttarnung immer einen Schritt voraus.
Der wachsende Wohlstand half den entwurzelten Aufsteigern, ihre Nervosität in Schach zu halten. Bewies nicht ihr anhaltender Erfolg, dass sie dazugehörten? Aber ihre Selbstzweifel und die Erinnerungen an Armut, Not und Krieg vergingen nicht, sie wandelten sich bloß. Wer erlebt hatte, wie jahrhundertealte Fürstenhäuser und Städte und ein vermeintlich tausendjähriges Reich zusammenstürzten, der blieb misstrauisch. Die Kriegs- und Nachkriegsgeneration vererbte ihren Kindern neben Häuschen im Grünen und Sparkassen-Konten auch die tiefe Angst vorm Absturz: Streng dich an! Reiß dich zusammen! Träum’ nicht! So verinnerlichten die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960er-Jahre die permanente Anspannung ihrer Eltern. Sie lernten: Die Vergangenheit war schrecklich, die Gegenwart zerbrechlich, die Zukunft bedrohlich.
Die Geschehnisse der folgenden Jahrzehnte waren wie dafür gemacht, um die schizophrene Weltsicht der Babyboomer zu bestärken. Einerseits blickten sie optimistisch in ihre persönliche Zukunft. Sie sahen ihre Tariflöhne automatisch steigen, und Urlaubsreisen führten sie in immer weiter entfernte Länder. Andererseits trugen ihre neuen Fernseher Tagesschau-Berichte über Stellvertreterkriege der Supermächte, Terrorismus und Umweltzerstörung in die zentral geheizten Wohnzimmer. Das Idyll schien immer gefährdet durch die Apokalypse.
Selbst das Ende des Kalten Krieges änderte wenig an der Gemengelage aus Angst und Hoffnung. Denn wie sich rasch zeigte, fielen mit den Mauern auch viele Handelsschranken. Bayerische Maisbauern konkurrierten plötzlich mit ukrainischen Agrarbetrieben. Schwäbische Mittelständler sahen sich im Wettbewerb mit chinesischen Staatsunternehmen. In Ostdeutschland gingen Tausende Betriebe in den Nachwendejahren zugrunde, obwohl die Staatsführung bis zuletzt behauptet hatte, DDR-Produkte hätten Weltniveau. Der Druck auf Arbeiter und Angestellte stieg, während die Inflation an ihren nahezu stagnierenden Gehältern nagte. Ihr Geld verlor an Kaufkraft, und wer seinen Job verlor, bekam weniger und kürzere Zeit Arbeitslosengeld als zuvor. Ab 2008 weckten Weltwirtschafts- und EU-Schuldenkrise die alte deutsche Angst vorm Zusammenbruch, denn sie war nie ganz verschwunden.
Zwar gibt es heute genug Geld für neue Sozialleistungen wie das Elterngeld und kostenfreie Kita-Jahre, die medizinische Versorgung ist besser denn je, und die Deutschen werden immer älter. Nie zuvor gab es so viele Frauen in Führungspositionen, und mehr Mädchen als Jungen machen Abitur. Schwule und Lesben dürfen heiraten, und Transgender-Personen zieren die Titelseiten von Modemagazinen und Werbekampagnen. Allesamt Errungenschaften, die unser Zusammenleben gerechter machen und es immer mehr Menschen ermöglichen, daran teilzuhaben. Kurzum: Wir leben in historisch einzigartigem Frieden und Wohlstand. Die Krisenstimmung aber schwelt weiter.
Jährlich wächst die Zahl der registrierten Burnout-Fälle. Depressionen zählen zu den am weitest verbreiteten Erkrankungen. Durch Suizide sterben hierzulande mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle, Drogen und HIV-Erkrankungen zusammen. Die #MeToo-Debatte konfrontiert die breite Öffentlichkeit mit alltäglicher sexualisierter Gewalt gegen Frauen, und die #MeTwo-Bewegung beklagt massive Benachteiligungen von Migranten, sowie verdeckten und offenen Rassismus. Die AfD beschwört eine Endzeitstimmung, und die anderen Parteien fürchten, sie könnte damit Erfolg haben. Schon ziehen Feuilletons wie Facebook-Posts Parallelen zu den letzten Jahren der Weimarer Republik. Mitten im Wohlstandsglück sind wir von Verfallsängsten umfangen.
Die Angst verändert unsere Wahrnehmung. Im Jahr 2016 gaben mehr als 80 Prozent der Befragten einer Studie der Ruhr-Universität Bochum an, sie glaubten, es gebe mehr Raubüberfälle als im Vorjahr – in Wahrheit war deren Zahl um mehr als 15 Prozent gesunken. Fast jeder Fünfte hielt es für wahrscheinlich, im kommenden Jahr beraubt zu werden – dabei war das im Jahr 2015 nicht einmal jedem Dreihundertsten geschehen. Die Gefahr mag nicht real sein. Aber das Gefühl, in Gefahr zu sein, ist es.
Tatsächlich gibt es soziale Entwicklungen, die das Erreichte bedrohen. Nur haben sie wenig zu tun mit »Flüchtlingswellen« oder »Systemmedien«. Wir erleben »einen Wechsel im gesellschaftlichen Integrationsmodus vom Aufstiegsversprechen zur Exklusionsdrohung«, erklärt der Soziologe Heinz Bude. Mit anderen Worten: »Man wird nicht mehr durch eine positive, sondern nur noch durch eine negative Botschaft bei der Stange gehalten.« Wer nicht mithält, gehört nicht mehr dazu. »Damit geht die Angst einher, ob der Wille reicht, die Geschicklichkeit passt und das Auftreten überzeugt.« Ständig müssen wir uns anderen neu beweisen, unsere Karriere planen und Entscheidungen rechtfertigen. Das alte bundesrepublikanische Versprechen, dass Wohlverhalten und Fleiß sozialen Aufstieg garantieren, gilt nicht mehr.
Heute wachsen die Löhne zwar wieder, aber nur langsam und längst nicht für alle. Durch Erwerbsarbeit reich zu werden ist auch für Akademiker kaum noch möglich. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr, weil die Immobilienpreise kaum noch bezahlbar sind. Glück hat der, dessen Eltern rechtzeitig gespart haben. Wer hat, dem wird gegeben. Das Vertrauen darauf, dass es den eigenen Kindern einmal besser gehen wird, gibt es nicht mehr. Die Rufe Streng dich an! Reiß dich zusammen! Träum’ nicht! aber erschallen noch immer.
Jedem wird permanent »Flexibilität« abverlangt, doch ohne das Versprechen von mehr Wohlstand und Sicherheit ist das vor allem eine Drohung. Die Betreuerin meldet sich zu Beginn der Sommerferien arbeitslos – und bangt, ob die Kita sie in sechs Wochen wieder anrufen wird, denn ihr befristeter Arbeitsvertrag läuft immer nur ein Jahr. Der wissenschaftliche Mitarbeiter mit Doktortitel bekommt fürs Seminar nur eine Aufwandsentschädigung von wenigen hundert Euro – bei der Stange gehalten durch die vage Hoffnung auf eine Anstellung. Alles ist möglich, aber nichts ist sicher.
Das gilt erst recht für die wachsende Schar der Paketzusteller, Gebäudereiniger oder Sicherheitsleute. Weil sie wissen, wie austauschbar sie sind, müssen sie sich ducken vor Chefs, die mehr Arbeitsleistung fürs gleiche Geld fordern. Weil sie die Kündigung fürchten, schädigen sie ihre Rücken und Gelenke, um noch ein paar Jahre lang mit Jüngeren und Gesünderen zu konkurrieren. Um das neue Proletariat kümmern sich die Gewerkschaften, die einst als Stimme des alten Proletariats gegründet wurden, kaum. Die Abgehängten verstehen, dass die Gesetze unserer Gesellschaft nicht für sie geschrieben worden sind.
Das Wort Freiheit ist für sie alle kein Versprechen, sondern ein Hohn. Zurück bleiben Resignation, Wut – und Angst.
Diese Angst durchtränkt unseren Alltag. Wir fürchten ständig den sozialen Absturz. Unsere beruflichen Qualifikationen könnten rasch veralten; jüngere Kollegen könnten dieselbe Arbeit für noch weniger Lohn erledigen; in der nächsten Wirtschaftskrise könnte unser Erspartes verpuffen; eine neue App könnte die eigene Branche kollabieren lassen. Wem die Hoffnung auf ein besseres Morgen fehlt, kämpft nur noch für sich: Nimm, was du kriegen kannst! Zur selben Zeit müssen wir weit mehr Entscheidungen treffen als früher, und an jeder einzelnen hängen viele andere. »Die Angst kommt daher«, sagt Bude, »dass alles offen, aber nichts ohne Bedeutung ist. Man glaubt, in jedem Moment mit seinem ganzen Leben zur Disposition zu stehen. Man kann Umwege machen, Pausen einlegen und Schwerpunkte verschieben; aber das muss einen Sinn machen und zur Vervollkommnung des Lebenszwecks beitragen. Die Angst, einfach so dahinzuleben, ist schwer ertragbar.« Jede Entscheidung kann die falsche sein, und niemand garantiert uns, dass das, was heute als richtig gilt, es morgen auch noch ist.
Wenn hier von »wir« und »uns« die Rede ist, ist das natürlich eine Verallgemeinerung. Nicht alle Leserinnen und Leser werden sich in jeder Aussage wiederfinden. Aber der rhetorische Kunstgriff hilft, Abstraktes anschaulich zu machen.
Damit wir jede Entscheidung stets korrigieren können, zerfließen Haltungen zu Verhandlungsmasse. Wenn »die zwischenmenschlichen Verflechtungen dichter und unausweichlicher« werden, erklärt Soziologe Bude, versuchen wir, uns auf andere einzustellen und mit ihnen zu arrangieren. »Prämiert wird dann nicht mehr die Obsession, sich selbst zu beweisen, sondern die Kompetenz, die Perspektiven anderer zu übernehmen, sich elastisch und flexibel im Wechsel der Situationen zu zeigen und Kompromisse in der Teamarbeit zu finden.« Dann kommt es nicht mehr darauf an, was man wirklich denkt, fühlt oder will. Sondern vielmehr darauf, die Signale anderer genau wahrzunehmen und darauf blitzschnell zu reagieren. Ihr Verhalten lenkt unser eigenes. Natürlich passen wir alle uns an, weil wir uns nach Anerkennung und Zuneigung sehnen und weil wir die ungeschriebenen Gesetze von Sitte und Anstand kennen. Aber das meint Bude nicht. Woran wir uns im immer stressigeren Alltag immer häufiger orientieren, sagt der Soziologe, sind »die buchstäblich im Sekundentakt ausgehandelten Erwartungen und Erwartungserwartungen zwischen den gerade an einer Situation Beteiligten«. Was dabei in uns passiert, hat der britische Psychiater Ronald D. Laing so auf den Punkt gebracht: »Was ich denke, dass du es von mir denkst, wirkt auf das zurück, was ich über mich selbst denke, und was ich über mich selbst denke, beeinflusst wiederum die Art und Weise, wie ich dir gegenüber handele. Dies wiederum beeinflusst, wie du dich selbst empfindest, beeinflusst die Art und Weise, wie du gegenüber mir handelst.« Und immer so weiter. Statt unserer Stimmen hören wir das Fiepen einer Rückkopplung.
»Das Ich wird zum Ich der anderen«, sagt Bude. Es steht »vor dem Problem, aus den Tausenden von Spiegelungen ein Bild für sich selbst zu finden«. Die Grenzen zwischen außen und innen verschwimmen: Was gehört zu mir, was nicht? Um uns zu erklären, wer und wie wir sind, schauen wir auf Freunde, Gleichaltrige oder Kollegen.
Dabei wiegen Verluste sehr viel schwerer als Gewinne. Der Blick auf die Urlaubsfotos, Lebenspartner, Wohnungen, Kleider oder Bankkonten der anderen bestimmt, welchen Platz wir uns selbst in der Welt zuweisen. »Das Ich orientiert sich an den Anderen und kommt ins Schleudern, wenn es nicht mehr glaubt, mithalten zu können«, erklärt Bude. »Wir sind furchtsam und vorsichtig, wenn wir uns alleingelassen fühlen, und wir werden kräftiger und zuversichtlicher in dem Maße, wie wir meinen, dass wir bei anderen ankommen und sie für uns gewinnen können.« Schon immer haben Menschen sich miteinander verglichen. Nie zuvor aber sahen wir uns mit so vielen Konkurrenten konfrontiert. Der permanente Vergleich schürt unsere Angst, zu kurz zu kommen und nicht zu genügen. Weil wir in uns selbst zu wenig Halt finden, sind wir leicht zu erschüttern.
Der nagende Zweifel ist der Gemütszustand unserer Zeit. Wer jederzeit alles zu verlieren fürchtet, will wenigstens fürs eigene Kind beste Startbedingungen schaffen. Anstatt es, wie noch vor wenigen Jahrzehnten, in die nächstgelegene Schule zu schicken, wollen Eltern es perfekt gefördert wissen für einen Markt von übermorgen, dessen Anforderungen niemand kennt. Weil Wissen veraltet, zählt umso mehr die soziale Zugehörigkeit. Schon Kinder sollen Kontakte knüpfen, weil man die richtigen Leute nicht früh genug kennen kann. Und so ziehen Eltern, die es sich leisten können, in Gegenden mit weniger Armen und Migranten, weil die Schulen dort einen besseren Ruf haben. Schon früher hatten die meisten sozialen Milieus wenig miteinander zu tun. Nun schotten sie sich auch räumlich immer stärker ab – und werden einander noch fremder. Doch die Gentrifizierung macht sie nicht zufriedener, im Gegenteil. Nicht nur das Andere macht ihnen Angst, sondern auch der permanente, ängstliche Vergleich mit ihren Nachbarn und Kollegen.
Dabei belastet Menschen nicht ihre objektive Lage, sagt Bude, »sondern das Empfinden, im Vergleich mit signifikanten Anderen den Kürzeren zu ziehen«. Der Soziologe nennt so jemanden einen »außengeleiteten Charakter«. Diesem »fehlen die inneren Reserven, die ihn relativ immun gegenüber absurden Vergleichen und wahnwitzigen Verführungen machen könnten. Hinter dem ungezügelten Neid verbirgt sich die tiefe Angst, nicht mithalten zu können, außen vor zu bleiben und allein als der Düpierte übrig zu bleiben.« So verbündet er sich »mit den modischen Trends und herrschenden Meinungen und schweigt im Zweifelsfall lieber, als anzuecken und gegenzuhalten«. Er liket, was andere in sozialen Netzwerken platzieren, um gemocht zu werden, und teilt die Meinungen seiner Kollegen, um dazuzugehören. »Und in Augenblicken der Einsamkeit und Ermattung fühlt er sich von den vermuteten Bedürfnissen und Wünschen seiner Mitmenschen unterdrückt und versklavt.«
Wie passt das zur zunehmenden Liberalität unserer Gesellschaft? Noch zu Beginn des neuen Jahrtausends war es eine Sensation, als Klaus Wowereit seinen Parteifreunden im Berliner Senatswahlkampf zurief: »Ich bin schwul, und das ist auch gut so!« Wenige Jahre darauf war eine ostdeutsche, geschiedene Frau Kanzlerin, ein Schwuler leitete das Auswärtige Amt, ein gebürtiger Vietnamese zog ins Wirtschaftsressort, und ein Mann im Rollstuhl war zuständig für die Finanzen. Heute haben Eltern die Möglichkeit, im Geburtenregister das Geschlecht ihres Kindes mit divers anzugeben. Kann nicht also jede und jeder mehr denn je tun, was sie oder er will? Stimmt grundsätzlich. »Solange man seine gelebte Diversität in sexueller oder religiöser oder sittlicher Hinsicht verständlich machen kann, ist alles in Ordnung«, erklärt Bude. »Draußen ist man jedoch schnell, wenn der Unterschied für die anderen keinen Unterschied an Freude, Buntheit und Kreativität macht.« Findet unsere Abweichung keinen Zuspruch, werden wir ängstlich. Egal, ob Veganerin, Polyamorist oder Neurechter: Wir wollen nicht nur gut finden dürfen, wie wir sind. Wir wollen auch, dass alle anderen gut finden, wie wir sind.
Dabei hilft das Internet. In ihm finden und bestärken Gleichgesinnte einander, über Ländergrenzen und Ozeane hinweg. Gleichzeitig prallen darin aber auch extreme Gegensätze aufeinander: Fleisch zu essen ist gesund und unser gutes Recht versus Tierhaltung ist der größte und längste Massenmord der Menschheitsgeschichte. Oder Urlaub im Süden ist der wohlverdiente Lohn für harte Arbeit gegen Flugreisen verschmutzen die Atmosphäre und sind ein Akt des Neo-Kolonialismus. Und Europäer und Amerikaner bilden das Rückgrat der Zivilisation contra Weiße, heterosexuelle Männer unterdrücken seit Jahrhunderten die halbe Welt. Im Gefechtslärm gehen Zwischentöne unter.
Wir sind gefangen in einem Dilemma: Einerseits wollen wir von so vielen Menschen wie möglich akzeptiert werden. Andererseits stoßen wir leichter denn je auf Menschen, die alles, was wir schätzen, ablehnen. Für ihre Ablehnung aber fordern diese Menschen ebenfalls Akzeptanz ein. Gerade weil sich alle verstanden fühlen wollen, wächst allseits der Eindruck, unverstanden zu sein.
Wer beim unfruchtbaren Meinungsstreit mitschreit, bekommt rasch das Gefühl, er sei von Gegnern umzingelt. Zuhörer rätseln, wie sie sich angesichts unvereinbarer Positionen verhalten sollen. Was ist richtig, was falsch?
Wir stehen unter immensem Druck, immerzu das Richtige zu tun. Gleichzeitig können wir das in einer unüberschaubaren Welt nur selten klar erkennen. Ständig wähnen wir uns in Gefahr, Schuld auf uns zu laden. Je schwerer es uns fällt, in politischen und sozialen Konflikten Richtig und Falsch auseinanderzuhalten, und je heikler eine falsche Wahl erscheint, desto größer ist unsere Sehnsucht nach klaren Fronten. Wir selbst möchten natürlich auf der Seite der Guten stehen. Weil wir aber in uns selbst weder Halt noch Gewissheit finden, entwickeln wir Schuldgefühle: Ich könnte mehr tun! Irgendwas habe ich bestimmt übersehen! Was sagen die anderen? Wir hasten immer schneller durch eine chaotisch wirkende Welt, ohne ein Ziel zu kennen, und geraten aus der Puste.
Aus dem Versprechen, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, ist so der Zwang zum selbstoptimierten und moralisch richtigen Leben geworden. Wir müssen den perfekten Partner finden, die ideale Wohnung, den günstigsten Flug, die beste Kita. Zugleich stellen wir uns Fragen wie: Helfe ich Pflanzern in Nicaragua, wenn ich den Kaffee mit Fair-Trade-Siegel kaufe – oder nur dem Hersteller des Siegels? Tue ich etwas für meine Altersabsicherung, indem ich eine Wohnung kaufe – oder begünstigt dies steigende Mieten? Ist es in Ordnung, meine Mutter ins Pflegeheim zu geben – oder drücke ich mich vor der Pflicht, mich um sie zu kümmern? Gleichzeitig ahnen Millionen Geringverdiener, dass noch so viel Fleiß und Flexibilität ihnen nie sichere Jobs und gute Renten einbringen werden. Freiheit heißt für sie, dass sie selbst schauen müssen, wo sie bleiben. Werden die Ansprüche zu groß, sind wir zu schwach.
Was aber, wenn Menschen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verlieren? Wenn sie sich permanent in ihrem tiefsten Inneren infrage gestellt fühlen? Dann beäugen die gesellschaftlichen Gruppen einander voller Misstrauen wie am Kuchenbuffet. Ihnen kommt es nicht allein darauf an, dass ihr Kuchenstück groß genug ist, um sie satt zu machen. Ähnlich wichtig ist für sie der Vergleich mit den anderen am Tisch: Sind deren Stücke größer als meins? Haben sie das verdient? Nehmen sie sich etwas, das ihnen nicht zusteht? Blicken die anderen auf mich herab? Haben sie sich womöglich gegen mich verbündet? Die anderen, so sehen sie es, erkennen die eigenen Leistungen, Fähigkeiten, Erfahrungen, Nöte und Bedürfnisse nicht genügend an. Dann empfinden Individuen, so der US-Politologe Francis Fukuyama, sich in ihrer Würde gekränkt.
Natürlich hat es Menschen schon immer geschmerzt, wenn sie den Eindruck hatten, sie würden nicht genügend gesehen und anerkannt. Aber für Menschen, die den eigenen Wert davon abhängig machen, dass alle anderen ihnen diesen Wert bestätigen, bekommt der Schmerz etwas schier Unerträgliches. Einerseits feiern und pflegen sie ihr einzigartiges Ich, und zugleich fürchten sie seine Zerstörung. Denn insgeheim plagen sie Zweifel, ob es wirklich so einzigartig ist. Glauben sie sich nicht genügend gesehen und respektiert, fühlen sie sich unsicher, und sie ahnen, wie zerbrechlich ihr Ich in Wirklichkeit ist. Sie sehen ihre Moralvorstellungen und Lebenserfahrungen infrage gestellt – und damit sich selbst.
Diese Bedrohungsangst trägt entscheidend bei zur giftigen Stimmung öffentlicher Debatten. Wer das eigene Selbstwertgefühl infrage stellt, ist eine Gefahr. Was das Ich bedroht, muss weg. Anstatt um den Austausch von Ansichten zwischen Gleichberechtigten geht es dann darum, das Gegenüber symbolisch auszulöschen. Davon zeugen Hasstiraden in Online-Kommentaren ebenso wie Facebook-Posts und YouTube-Clips mit Titeln, in denen Andersdenkende »überführt«, »entlarvt«, verbal »auseinander genommen« oder gleich »zerstört« werden. Zwar zeigt sich darin auch der Zwang, im immer schrilleren Wettbewerb um Aufmerksamkeit mitzuhalten. Doch der Zwang ist nicht die Ursache der verbalen Aufrüstung, er verstärkt sie nur: Wer glaubt, um sein Leben zu schreien, wird immer lauter sein als andere. So werden aus Debatten Duelle. Einen Vertrauensvorschuss für den Andersdenkenden kann es da nicht geben, und Kompromisse wären Hochverrat am eigenen Ich. Weil es vermeintlich immer um alles geht, scheint es vernünftig, dem Gegenüber das Schlimmste zuzutrauen. Sicher ist sicher. Und Angriff ist die beste Verteidigung.
Die Welt, wie sie sich den Bedrängten darstellt, ist finster. In ihr herrschen Misstrauen und Furcht. Aber sie bietet auch moralische Orientierung. Hier gibt es gut und böse, richtig und falsch. Und damit Opfer und Täter.
Alles selbst zu entscheiden ist zur Bürde geworden. Das ist das »Schreckliche«, von dem Erica Jongs Romanfigur spricht. Wie die junge Schriftstellerin damals, so finden wir uns heute in einer paradoxen Lage wieder: Wir haben starre Konventionen, Verbote und Ansprüche von Kirchen, Politikern, Vereinen oder Eltern hinter uns gelassen – und sehnen uns nach dem Halt, den sie boten. Wir wollen uns akzeptiert fühlen – und glauben uns ständig infrage gestellt. Das frustriert und verwirrt. Frust und Verwirrung führen zu Angst und Wut.
Die Frage ist bloß: Warum?
Warum sehnen wir uns so sehr nach dem Respekt anderer Menschen, selbst wenn wir sie nicht persönlich kennen? Warum wollen wir zu einer Gruppe gehören, und sei sie noch so virtuell? Warum streben wir nach Gleichrangigkeit und Gemeinschaft? Die Antworten darauf sind faszinierend. Wir werden erkennen, dass Opfer gar nicht so anders empfinden als andere Menschen. Sie leiden am selben Zwiespalt wie wir alle. Nur wollen sie ihr Leid auf eine Weise auflösen, die sie nicht glücklich macht und anderen Menschen schadet. Diese innere Zerrissenheit begleitet uns seit Jahrtausenden, deshalb nehmen wir sie selten bewusst wahr. Dabei spüren wir die Schmerzen, die sie bereitet, jeden Tag.
3. WARUM WOLLEN DIE SOLDATEN ZURÜCK AN DIE FRONT?
Wie Opferhaltungen entstehen
Irgendetwas brachte Sebastian Junger dazu, schon wieder sein Leben zu riskieren. Dabei hatte der amerikanische Journalist mehr Tod und Elend gesehen als die meisten Bewohner der westlichen Welt. Im Jahr 2000 hatte er Krieger der Nordallianz begleitet, die in Afghanistan islamistische Taliban bekämpften. Er hatte gesehen, wie Feuerwehrleute in Idaho todesmutig gewaltige Waldbrände eindämmten. Und er war im belagerten Sarajevo vor serbischen Scharfschützen in Deckung gegangen. Über all das hatte der Journalist erfolgreiche Bücher geschrieben. Da hätte er sich jetzt, mit 45 Jahren, ein wenig auf seinem Bestsellerruhm ausruhen können. Trotzdem sagte er sofort zu, als er 2007 die Chance bekam, Soldaten einer amerikanischen Luftlandeeinheit ins gefährlichste Kampfgebiet Afghanistans zu begleiten. Binnen eines Jahres reiste Sebastian Junger fünfmal für jeweils mehrere Wochen in ein abgelegenes Tal. Dort lebte er mit 15 jungen US-Soldaten in einem kargen Außenposten. Was er erlebte, veränderte seinen Blick radikal: auf das Leben, unsere Gesellschaft und was es heißt, ein glücklicher Mensch zu sein.
Als der Kriegsberichterstatter bei den Truppen ankam, war er wenig beeindruckt. »Ich dachte, so sieht’s also aus am Arsch der Welt«, erinnerte er sich in einem Interview. »Dieser militärische Vorposten lag völlig ungeschützt auf einer Bergspitze über dem Korengal-Tal, das damals der am heftigsten umkämpfte Ort Afghanistans war. Es gab keine Elektrizität, kein fließendes Wasser und keine warmen Mahlzeiten.« Der Vorposten »bestand aus einem Munitionslager, einer Schutzmauer und einer Latrine, einem sogenannten ›Burn Shitter‹. Die Soldaten hausten in Holzhütten, durch die im Winter der eisige Wind pfiff, und die sich bei mehr als 40 Grad im Sommer in wahre Öfen verwandelten.« Junger und die Soldaten schliefen zu zehnt eng beieinander »auf Pritschen, die kaum einen halben Meter voneinander entfernt standen. Von dort, wo ich lag, konnte ich drei weitere Männer mit der ausgestreckten Hand berühren. Sie schnarchten, sie redeten, sie standen mitten in der Nacht auf, um pinkeln zu gehen.« Ein Leben auf engstem Raum.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: