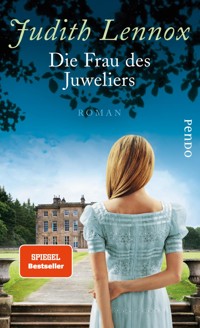9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
London in den 50er-Jahren: Hier kämpft die junge Romy Cole, die in den Kriegswirren viel zu früh ihren Vater verlor, umso leidenschaftlicher für ihre Zukunft. Doch erst als sie die geschäftstüchtige Hotelbesitzerin Mirabel kennenlernt und der attraktive Caleb in ihr Leben tritt, kann sich Romy ihrer Vergangenheit stellen. Endlich findet sie das große Glück und auch zu sich selbst. Bestsellerautorin Judith Lennox verwebt fesselndes Zeitbild und bewegendes Frauenschicksal zu einem mitreißenden Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Rosie Garwood in Liebe und Zuneigung
Übersetzung aus dem Englischen von Mechtild Sandberg
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe11. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-95340-5
© Judith Lennox 2003
Titel der englischen Originalausgabe:
»Middlemere«, Macmillan, London 2003
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2004
Umschlagkonzept: semper smile, München
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagmotiv: Daniel Murtagh / trevillion images
Dank
Ich danke Anna Clements und Simon Tattersallfür ihre unschätzbare Hilfe und Beratung.Vielen Dank auch meinem Sohn Dominic für seine Hilfe bei den Recherchen für »Das Erbe des Vaters«.
Teil 1
Die Männer im Wald
November 1942
1
ERST ALS ER DAS GEWEHR HERAUSHOLTE, bekam sie Angst.
Seit sie am frühen Morgen erwacht war, hatte sie gespürt, daß dies kein normaler Tag war. Die Strophe eines Liedes, das ihr Vater manchmal sang, ging ihr durch den Kopf. »Die Männer im Wald, die fragten mich einst: Wie viele wilde Erdbeeren wachsen im Meer?« Romy hatte das Lied immer blöd gefunden. Im Meer wuchsen doch keine Erdbeeren! Aber dieser Tag heute war so merkwürdig, daß sie an die verkehrte Welt des Liedes denken mußte, in der nichts richtig war, nichts so war, wie es sein sollte. »Mit Tränen im Auge fragt’ ich zurück: Wie viele Schiffe segeln im Wald?« Nein, der Tag war nicht normal. Aber das hatte ihr keine Angst gemacht. Angst bekam sie erst, als ihr Vater das Gewehr herausholte.
Das Gewehr wurde in einem hohen Schrank im oberen Flur aufbewahrt. Von ihrem Versteck aus sah Romy zu, wie ihr Vater den Schlüssel ins Schloß schob und die Tür aufzog. Mit seinen kräftigen, schwieligen Fingern strich er über den Doppellauf der Waffe und hielt plötzlich wie unsicher geworden inne. Aber dann öffnete er das Schloß und legte zwei Patronen ein.
Romy hatte sich in dem grünen Schrank am Ende des Flurs versteckt. Er war klein und eng, sie mußte sich hinknien, sonst hätte sie gar nicht hineingepaßt. Sie hörte die lauten Rufe aus dem Garten und beobachtete durch ein Astloch in der Schranktür ihren Vater. Immer wenn man im Haus etwas suchte und nicht fand, pflegte ihre Mutter zu sagen: Schaut doch mal im grünen Schrank nach. Alles, was alt und hoffnungslos kaputt war, landete im grünen Schrank: eine einzelne Gamasche, an der alle Knöpfe abgerissen waren; eine Teekanne mit angeschlagener Tülle und ohne Deckel. Die Teile eines Puzzlespiels drückten gegen Romys Knie, und Federn aus einem zerschlissenen alten Kopfkissen schwebten im Dunkeln um sie herum wie sanfte graue Schneeflocken. Obwohl sie Schal und Mantel anhatte, war ihr kalt; so kalt, daß ihre Zähne aufeinanderschlugen. Sie fürchtete, ihr Vater könnte es hören. Wenn er wüßte, daß sie im Haus war, würde er sie mit Mam und Jem fortschicken. Und sie mußte doch bei ihm bleiben.
Die Männer im Wald, die fragten mich einst … Romy fröstelte. Die lauten Stimmen ihrer Eltern hatten sie am Morgen geweckt; die ihres Vaters trotzig und wütend, die ihrer Mutter schrill und voller Tränen. Keiner schien an Frühstück oder Schule zu denken. Es gab kein Porridge und kein Brot. Das Feuer im Herd war ausgegangen. Niemand hatte Wasser geholt. Jem war noch nicht einmal halb angezogen, hatte nur Hemd und Unterhose an und einen Schuh. Romy half ihm ungeduldig in den zweiten, schnürte die Bänder und zog ihrem Bruder danach den Pulli so energisch über den Kopf, daß er schrie, sie reiße ihm ja die Ohren ab.
Auf der Uhr auf dem Kaminsims hatte sie gesehen, daß es halb neun war. Sie hätten längst zur Schule unterwegs sein müssen. Sie hätte sich gern über die zusätzlichen Minuten zu Hause gefreut, aber dazu war ihre Beunruhigung zu groß. Mam und Dad schienen die Schule ganz vergessen zu haben; als wäre sie völlig bedeutungslos. Romy fragte sich, was da passiert sein konnte, daß ihr Vater, der sonst immer sagte, die Schule sei das allerwichtigste, plötzlich keinen Gedanken mehr daran verschwendete.
Sie hatte, schon fertig angezogen und mit hungrig knurrendem Magen, in der Küche gestanden und gewartet, während ihre Mutter geweint und ihr Vater gebrüllt hatte, und schließlich hatte sie sich unbemerkt nach oben geschlichen, um sich dort im grünen Schrank zu verstecken. Sie mochte den grünen Schrank. Immer wenn sie traurig war oder Ärger hatte und nicht gefunden werden wollte, pflegte sie sich dort zu verkriechen. Damals, als sie Annie Paynter den Kopf in den Wassertrog getunkt hatte, war sie hinterher auch im grünen Schrank untergeschlüpft; einen Moment lang erheiterte sie die Erinnerung daran, wie Annie das schmutzige Wasser aus den triefnassen blonden Locken getropft war. Und wenn sie helfen sollte – Birnen pflücken oder Kohlen holen oder dergleichen –, versteckte sie sich ebenfalls oft im Schrank. Aber ihre Mutter fand sie immer. Jem mochte den grünen Schrank nicht, weil es drinnen so eng und finster war, da hatte er stets Angst vor Gespenstern.
Nach einer Weile hörte sie ihre Mutter schreien: »Glaub ja nicht, daß ich hierbleibe und zusehe, wie sie dich ins Gefängnis abtransportieren!« Und ihr Vater brüllte zurück: »Dann nimm auch gleich die Kinder mit. Kinder kann ich hier nicht gebrauchen, wenn die mir Middlemere wegnehmen wollen.« Ein bißchen später sagte ihre Mutter: »Wo ist dieses verwünschte Kind?« Und Jem antwortete: »Romy ist in die Schule gegangen.«
Dann wurde die Tür zugeschlagen, und eine Zeitlang war es wunderbar still. Romy aß den Apfel, den sie heimlich aus dem Korb auf dem Küchenbüfett genommen hatte, und beschloß, den ganzen Tag im Schrank zu bleiben. Das war sowieso besser als Schule, schon gleich an einem Freitag. Freitags hatten die Mädchen Handarbeiten, und Romy haßte Handarbeiten. Rechnen war ihr tausendmal lieber, als Schürzen zu nähen und Socken zu stricken. Zahlen hatten so etwas Klares, Scharfes, Zuverlässiges: Man mußte nur die Regeln begreifen, dann stimmte es jedesmal. Bei der Handarbeit hingegen konnte sie sich Mühe geben, soviel sie wollte, die Schürzen und die Socken waren früher oder später stets nur noch ein formloser verhedderter Wust.
Gerade begann sie, Mut zu fassen und zu glauben, die Welt wäre wieder ins Lot gekommen, als der Krach losging. Das plötzliche Klopfen und Hämmern brachte mit einem Schlag das ungute Gefühl des frühen Morgens zurück. Angespannt lauschend hörte sie, wie ihr Vater Türen abschloß und verriegelte. Dann vernahm sie ein neues Geräusch, lautes Knarren und Kratzen, und erkannte, daß ihr Vater irgendein schweres Möbelstück über den Küchenboden schob. Sie öffnete die Schranktür einen Spalt und sah hinaus. In der Ferne konnte sie das Brummen eines Autos hören, das den holprigen Fahrweg nach Middlemere heraufkam. Dann hörte sie ihren Vater die Treppe hinauflaufen. Hastig zog sie die Schranktür wieder zu.
Das Auto hielt vor dem Haus an. Es wurde mit Fäusten an die Haustür getrommelt und laut gerufen, aber ihr Vater blieb im oberen Flur. Die hartgefrorene Erde knirschte unter den Stiefeln der Besucher, als diese um das Haus herum nach hinten gingen. Romy hörte Männerstimmen. Laute, aufgebrachte Stimmen. Das war der Moment, in dem ihr Vater das Gewehr aus dem Schrank nahm.
Romy hatte nicht oft Angst. Sie graulte sich nicht vor Spinnen wie Annie Paynter, und sie fürchtete sich nicht vor Gespenstern wie Jem. Sie hatte nicht einmal Angst gehabt, als das deutsche Flugzeug den Inkpen Hill bombardiert und sie die grellen Feuergarben auf dem Hügelkamm gesehen hatte, auf dem Combe Gibbet, der Galgen, stand.
Sie drückte ihr Auge an das Loch in der Tür. Ihr Vater hielt das Gewehr unter dem Arm und war dabei, das Flurfenster aufzumachen. Eisige Luft wehte ins Haus. Romy fröstelte von neuem. Jetzt, wo das Fenster offen war, konnte sie ausmachen, was die Leute draußen riefen. Von der Kälte und dem Nebel gedämpft, stiegen die Stimmen aus dem Garten auf.
»Kommen Sie raus, Mr. Cole. Schluß jetzt mit dem Unsinn!«
»Sam, jetzt hör doch, es hilft nichts.«
»Ihr nehmt mir mein Haus nicht weg!« Ihr Vater beugte sich zum Fenster hinaus und schrie in den Garten hinunter. »Ihr nehmt mir Middlemere nicht weg.«
»Der Ausschuß ist berechtigt –«
Der Gewehrlauf schlug knallend auf das Fensterbrett. »Er ist zu nichts berechtigt. Zu gar nichts. Verschwinden Sie von meinem Grund und Boden, Mark Paynter.«
Mark Paynter war Annie Paynters Vater. Nach der Geschichte mit Annie und der Pferdetränke war er nach Middlemere gekommen, ein kleiner, dicker Mann mit einem pausbäckigen Gesicht und dünnem braunem Haar, durch das man den rosigen Schimmer der Kopfhaut sehen konnte. Er hatte einen Anzug angehabt und glänzend gewichste Schuhe. Romy fiel wieder ein, wie er im schlammigen Hof gerutscht und geschlingert war, das Gesicht hochrot vor Wut und Verlegenheit.
Jetzt hörte er sich gar nicht verlegen an. Eher herrisch, dachte Romy, so bestimmerisch wie die großen Mädchen in der Schule. Als würde es ihm Spaß machen, ihrem Vater Befehle zu erteilen.
Mr. Paynter sagte: »Seien Sie kein Narr, Cole.«
»Runter von meinem Grund und Boden!« brüllte ihr Vater.
»Das ist nicht mehr Ihr Grund und Boden«, sagte Mr. Paynter. »Das Land gehört jetzt dem Kreiskriegsausschuß für Land- und Forstwirtschaft. Hören Sie also auf, Schwierigkeiten zu machen, und tun Sie, was Ihnen gesagt wird. Sie haben alle Chancen gehabt. Wir warten nicht mehr.«
»Tu das Gewehr weg, Sam«, rief der andere Mann. »Du machst alles nur noch schlimmer!«
Romys Vater feuerte aus beiden Läufen. Das Krachen der Detonationen brach sich an den Hügelhängen, und Krähen flogen krächzend von den Bäumen auf. Romy wimmerte leise und hielt sich die Ohren zu.
»Sie kriegen mich hier nicht weg, Mark Paynter.« Die leeren Patronenhülsen fielen klirrend zu Boden. »Und Sie verschwinden von meinem Grundstück, wenn Sie wissen, was gut für Sie ist. Ich warne Sie – der nächste Schuß geht nicht in die Bäume. Sie wollen sich doch Ihren schnieken Anzug nicht versauen, oder? Also, verschwinden Sie und lassen Sie sich nicht wieder blicken.«
»Ich hole die Polizei. Bilden Sie sich bloß nicht ein, daß Sie damit durchkommen. Ich –«
Das Fenster flog krachend zu, die Stimmen waren nur noch undeutlich vernehmbar. Durch das Dröhnen ihrer Ohren hindurch hörte Romy ihren Vater vor sich hin schimpfen. Mit geschlossenen Augen an die Wand gelehnt, stand er da. Er atmete schnell und keuchend. Am liebsten wäre sie sofort zu ihm gelaufen, um ihn irgendwie zu trösten, aber ihre Beine zitterten so stark, und außerdem würde er böse werden, wenn er sie sah, das wußte sie. Sie sollte nicht hiersein, sie sollte in der Schule sein. Kinder kann ich hier nicht gebrauchen. Kinder kann ich hier nicht gebrauchen, wenn die mir Middlemere wegnehmen wollen.
Es blieb still. Die Männer sind wieder abgezogen, dachte Romy und ließ sich erleichtert zurücksinken. Die Männer waren abgezogen, und ihr Vater würde das Gewehr wieder in den Schrank stellen, und alles würde wieder gut werden. Niemand konnte sie aus Middlemere vertreiben. Wie denn auch? Middlemere war ihr Zuhause. Ihr Vater hatte die Männer daran gehindert, ihnen Middlemere wegzunehmen, es würde alles wieder gut werden, die Welt würde wieder in Ordnung kommen.
Doch ihr Vater blieb am Fenster. Er hielt das Gewehr, und sein Gesicht trug einen Ausdruck, der eine Mischung aus grimmiger Entschlossenheit und Furcht war. Sie wagte es noch nicht, aus dem Schrank zu klettern und zu ihm zu laufen, um ihm zu sagen: »Dad, ich bin hier, ich bin bei dir geblieben.« Mit Schrecken fiel ihr ein, daß Annie Paynters Vater gesagt hatte: Ich hole die Polizei. Wenn nun die Polizei ihren Vater ins Gefängnis steckte? Wie sollten sie dann zurechtkommen? Wer sollte sich um die Kühe und die Schafe kümmern?
Romy versuchte, sich selbst zu beruhigen. Vielleicht würde die Polizei ihnen helfen. Vielleicht würde die Polizei dafür sorgen, daß Mr. Paynter nicht wieder hierherkam. Sie hockte sich auf den Haufen Federn, legte den Kopf auf die hochgezogenen Knie und wiegte sich mit geschlossenen Augen sachte hin und her, wobei sie leise vor sich hin sang: »Die Männer im Wald, die fragten mich einst, Wie viele wilde Erdbeeren wachsen im Meer?«
Nach einer Weile wurde die Stille beängstigender, als das Geschrei es gewesen war. Auf dem Hof war es bei Tag selten still. Drinnen sorgte ihre Mam für geräuschvolle Lebendigkeit, wenn sie kochte und putzte, Brot backte und butterte, sie und Jem ermahnte, sich endlich für die Schule fertigzumachen oder bei irgendeiner Arbeit mit anzupacken. Draußen begleiteten einen die Geräusche der Tiere, der Kühe, des Schweins, des Pferdes und des Hundes, dessen Krallen auf den Kopfsteinen klapperten, wenn er an der Seite ihres Vaters über den Hof trottete; und man hörte den Wind, der durch die Bäume pfiff, wenn die Herbststürme begannen, und im Getreide raschelte, wenn es im Spätsommer gelb und hoch auf den Feldern stand. Und das alles wurde übertönt von der schallenden Stimme ihres Vaters, wenn er den Gaul über das Feld führte oder dem Knecht Anweisungen gab oder Romy und Jem, wenn sie auf dem kurzen Weg am Feldrain entlang von der Schule nach Hause kamen, ein Wort des Grußes zurief.
Wenn sie sich mit aller Kraft konzentrierte, konnte sie sich vorstellen, es wäre Sommer und sie und Jem liefen den Fußweg hinunter. Sie konnte die warme Erde riechen und das Geißblatt in den Hecken. Sie fühlte sich wohl und geborgen, weil sie nach Middlemere heimkehrte. Das Sonnenlicht fiel durch das Laub der hohen Buchen, und auf der Wiese blühten die Butterblumen. Der dunkle Teich unter den Bäumen glitzerte. Jem war neben ihr, und sie hatte ein Auge auf ihn, wie immer. Sie war ja Jems große Schwester; sie war achteinhalb, und er war erst sieben, da mußte sie doch auf ihn aufpassen … Eingehüllt in die Dunkelheit des Schranks, nickte Romy ein.
Motorengeräusch weckte sie. Mit einem Ruck fuhr sie in die Höhe und konnte sich einen Moment lang nicht erinnern, wo sie war. Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie geschlafen hatte.
So gut es ging, streckte sie die steifen Glieder und lauschte. Diesmal waren es zwei Autos. Sie hockte sich auf die Knie und drückte das Auge an das Astloch. In dem kleinen Kreis diffusen Lichts sah sie ihren Vater, der immer noch am Fenster stand und in den Garten hinunterblickte. Sie versuchte, ihre schmerzenden Knie zu entlasten und eine bequemere Stellung zu finden. In dem Schrank war es so eng wie in der Kirche, wenn man eingequetscht im Kirchenstuhl auf einem der schmalen Samtkissen kniete. Sie ging nicht regelmäßig zur Kirche wie die anderen Kinder. Sie wußte nicht, wie man sich dort richtig verhielt, und war jedesmal, wenn sie mit ihrer Klasse in langer Schlange vom Schulgebäude zur Dorfkirche marschierte, überzeugt, sie würde sich blamieren.
Ihr machte es ja nichts aus, wenn die anderen sie auslachten, sie wußte, sich zu wehren; aber Miss Pinner war mit dem Rohrstock schnell bei der Hand und machte keinen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen, wenn sie Tatzen verteilte. Und wenn dann ihr Vater davon erfuhr, rannte er schnurstracks zur Schule, um Miss Pinner seine Meinung zu sagen, und ein paar von den Mädchen – die, von denen die Väter Geschäfte hatten und keine Bauern waren, die, welche wie Annie Paynter immer gebügelte Baumwollkleider anhatten und das Haar in Locken trugen –, die verspotteten ihn dann. Weil er seinen Mantel mit einer Schnur band statt mit einem Gürtel, wegen seiner Sprache und wegen dem, was er sagte.
Plötzlich erschallte eine Stimme, so laut, daß Romy zusammenfuhr. »Mr. Cole, hier spricht die Polizei.« Die Stimme hatte einen metallischen, dumpfen Klang, als käme sie aus dem Rachen eines großen mechanischen Ungeheuers. Sie machte Romy angst.
Ihr Vater riß das Fester auf. »Runter von meinem Grund und Boden!«
»Kommen Sie raus, Sam Cole! Lassen Sie uns friedlich miteinander reden.«
»Es gibt nichts zu reden. Keiner nimmt mir meinen Hof weg.«
»Es ist nicht mehr Ihr Hof«, rief Mark Paynter zum Fenster hinauf. »Er gehört dem Kreiskriegs-«
»Verschwinden Sie! Und lassen Sie sich nicht wieder hier blicken.«
»Jetzt hat die Polizei hier das Wort«, dröhnte die metallische Stimme.
»Diese Leute wollen mir und meiner Familie das Zuhause nehmen«, rief Sam Cole. »Um die sollten Sie sich kümmern. Das sind Diebe! Sie wollen einem Mann seine Arbeit nehmen und seine Familie auf die Straße setzen.«
»Hören Sie jetzt auf, uns Schwierigkeiten zu machen, Sam. Wenn Sie vernünftig sind und friedlich runterkommen, können wir vielleicht vergessen, daß Sie von einer Schußwaffe Gebrauch gemacht haben.«
Durch das Astloch sah Romy, wie ihr Vater zwei Patronen aus seiner Tasche nahm und sie in den Lauf schob.
»Ich verlasse mein Haus nicht.«
»Los, kommen Sie runter, Cole, dann können wir das klären.«
Es blieb einen Moment still, dann sagte Sam Cole: »Das hier ist mein Zuhause. Das hier ist mein Land.« Seine Stimme hatte sich verändert, sie klang gepreßt und müde. »Middlemere wird jetzt seit fast vierzig Jahren von meiner Familie bewirtschaftet. Keiner nimmt es mir weg. Sie nicht, Mark Paynter, und genausowenig irgendein verdammter Ausschuß oder Polizist. Bilden Sie sich bloß nicht ein, daß ich das Gewehr nicht benutze! Dieses Haus bekommen Sie nur über meine Leiche.«
Romy mußte an die Woche von Maisies Tod denken, als sie ihren Vater hörte. »Und da soll man noch an einen Gott glauben?« hatte ihr Vater gesagt, als sie nach dem Begräbnis den Friedhof verlassen hatten. Wenn er kleine Babys einfach so sterben läßt? Und er hatte furchtbar müde ausgesehen, viel müder als selbst nach dem längsten Tag auf dem Feld; müde und bleich, die große, kräftige Gestalt wie geschrumpft.
»Mr. Cole –«
Das Gewehr schlug krachend auf das Fensterbrett. Die metallische Stimme schwieg. Romy sah, daß die Stirn ihres Vaters trotz der Kälte von Schweiß bedeckt war. Die Hände, die das Gewehr umfaßt hielten, zitterten. Der Drang, zu ihm zu laufen, war beinahe unwiderstehlich. Er würde bestimmt nicht böse sein. Nicht richtig böse auf jeden Fall. Er wurde nie so böse, daß er ihr eine runterhaute. Mam haute ihr manchmal eine runter, aber Dad nie. Er brüllte sie vielleicht an, aber daran hatte sie sich längst gewöhnt.
Doch wenn er merkte, daß sie im Haus war, würde er sie rausschicken, in die Schule, das wußte sie. Und halb wünschte sie sogar, sie wäre in der Schule und säße sicher und gelangweilt über ihrer Handarbeit. Aber wie sollte sie es über sich bringen, ihn ganz allein hierzulassen?
Die Hand schon an der Schranktür, hielt sie unschlüssig inne. Und in diesem Moment erschütterte ein lauter Knall – ein donnerndes Krachen, das von allen Wänden zurückgeworfen wurde – das Haus. Romy riß die Hand von der Tür und drückte die Fäuste auf die Augen, um nicht zu weinen. Sie hörte ihren Vater fluchen, hörte das Poltern seiner Nagelstiefel auf der Treppe, als er nach unten lief. Sie konnte sich nicht vorstellen, was diesen schrecklichen Lärm machte. Sie dachte an riesige Wölfe, die um das Haus tobten, mit ihren Krallen gegen die Haustür schlugen und mit rotglühenden Augen die Köpfe hoben und heulten.
Der Lärm hörte auf. Ihr Vater kam wieder nach oben gelaufen. Er riß das Fenster im oberen Flur auf und schrie: »So leicht werden Sie mich nicht los, Mark Paynter. Ich hab’s Ihnen gesagt – nur über meine Leiche.«
Wieder Stille. Romy wischte sich mit dem Ärmel die Tränen aus dem Gesicht. Sie fror und hatte Hunger und mußte dringend aufs Klo. Sie versuchte zu beten. Das taten sie in der Schule, wenn etwas Schlimmes geschah. Sie hatten gebetet, als Harry Fort Diphtherie gekriegt hatte, und sie hatten gebetet, als das Schiff von Lizzie Clarks Bruder von den Deutschen mit Torpedos beschossen worden war. Romy schloß ganz fest die Augen und drückte die Handflächen aneinander und betete, erst das Vaterunser, dann »Mit meinem Gott geh ich zur Ruh« und ein Gebet aus der Kirche, das Romy gern mochte, weil es um Schafe ging und sie dabei an die Berge denken mußte und die Herde ihres Vaters, die auf dem struppigen Gras weidete.
Sie war bei »allzu sehr sind wir den Neigungen und Wünschen unseres eigenen Herzens gefolgt …«, als der Lärm von neuem anhob. Sie konnte nicht erkennen, woher er kam. Er schien sie von allen Seiten zu umgeben, laut und bedrohlich: Wieder die Wölfe, die wütend und wild in ihr Haus einzubrechen drohten.
Draußen kam ihr Vater den Flur herunter und blickte gehetzt von einer Seite zur anderen. Vor dem Schrank, in dem sie sich versteckt hielt, blieb er stehen. Wenn sie die Tür geöffnet hätte, hätte sie nur den Arm auszustrecken brauchen, um ihn zu berühren.
Doch plötzlich wandte er sich ab und eilte zur Speichertreppe. Der Lärm kam vom Dach. Romy sah die Wölfe, wie sie die Schindeln zur Seite stießen, zwischen den Dachbalken hindurchschlüpften und mit aufgerissenen Mäulern, in denen die langen scharfen Zähne zu sehen waren, über den Speicher schlichen.
Wieder krachte das Gewehr. Ein gellender Schrei hallte durch das Haus.
Romy schluchzte. Sie zitterte am ganzen Körper vor Angst. Ihr Vater hatte einen Menschen angeschossen, ihn vielleicht sogar getötet. Ihr Vater war ein Mörder. Auf das Wort war sie vor nicht allzu langer Zeit zum erstenmal gestoßen. Mörder. Es klang ganz fürchterlich, gruselig. Obwohl sie fest die Augen zudrückte, ließ sie das Wort nicht los. Mörder. Sie erinnerte sich, wie das Schwein geschrien hatte, als ihr Vater ihm das Messer an den Hals gelegt hatte. Sie erinnerte sich an den Geruch des Schweinebluts, warm und metallisch. Sie wußte, was man mit Mördern machte. Eines der großen Mädchen in der Schule hatte es ihr gesagt: Sie hängen sie am Galgen auf. Sie hängen sie auf, bis sie tot sind.
Warum hatte sie ihn nicht aufgehalten? Warum war sie ihm nicht nachgelaufen und hatte ihn angefleht, das Gewehr wegzulegen? Zusammengekauert drückte sie sich mit geballten Fäusten in die hinterste Ecke des Schranks. Sie hörte Glas splittern. Sie wünschte, ihr Bruder wäre bei ihr; sie wünschte, ihre Mutter wäre bei ihr. Sie begann wieder, vor sich hin zu singen, summte leise wie Mam immer an Maisies Bettchen gesummt hatte: »Die Männer im Wald, die fragten mich einst …«
Aus dem Garten schallten rufende Stimmen herauf. Sie hörte hastige Schritte. Ihr Vater kam in den Flur zurück. Romy beobachtete ihn durch das Astloch. Sein Atem ging in lauten Stößen, und seine Augen waren feucht, als hätte er geweint. Er rieb sich mit einer Hand das Gesicht und sprach mit sich selbst. Seine Stimme war leise und zitterte. »Ihr wollt mir mein Haus wegnehmen, ja? Meine Familie auf die Straße setzen? Nur über meine Leiche. Nur über meine Leiche.«
Die dröhnenden Schläge unten wurden immer lauter. Sie würden das Haus niederreißen. Sie würden die Fenster einschlagen und die Mauern zertrümmern, bis nichts mehr von Middlemere übrig war. Und dann würden sie ihren Dad wegbringen und ihn aufhängen, bis er tot war. »Dad!« schrie sie, aber das Wort ging im Lärm unter. Jetzt klangen Schritte auf der Treppe, schwere, entschlossene Schritte, als marschierte eine Armee durch Middlemere. Romy drückte ihr Auge an das Astloch, aber sie zitterte so stark, daß alles, was sie sah, verwackelt war.
Ihr Vater schluchzte. Er öffnete das Schloß des Gewehrs, nahm die leeren Hülsen heraus und schob zwei neue Patronen in den Lauf. Seine Finger rutschten an dem glatten Metall ab. Romy stieß die Schranktür auf. »Dad!« rief sie noch einmal. Da drückte er ab.
Die Männer im Wald, die fragten mich einst: Wie viele wilde Erdbeeren wachsen im Meer?
Romy begann laut zu schreien.
Teil 2
Wegsuche
Frühling – Sommer 1953
2
ES WAR DER FRÜHLING des Jahres 1953, Caleb Hesketh und Alec Nash feierten in London das Ende ihrer Militärdienstzeit. Früher am Abend hatten sie feierlich ihre Entlassungspapiere verbrannt. Endlich waren alle Quadrate auf den Bögen, von denen jedes für einen Tag Militärdienst stand, schwarz ausgemalt gewesen. Siebenhundertdreißig Quadrate insgesamt. Zwei Jahre ihres Lebens.
Zwei Jahre, in denen die alte Militärparole Kopf einziehen und Klappe halten auch Calebs Maxime gewesen war. Sie hatte ihm während der Militärzeit ebensogute Dienste geleistet wie in der Schule. Und wenn er doch einmal den Mund hatte aufmachen müssen, hatte er jeweils die Sprechweise angenommen, die den Umständen am ehesten entgegenkam – die mit dem mundartlichen Anklang seiner Kindheit für die Armee, eine etwas reinere, kultiviertere für die Schule. Es war das einfachste; dann brauchte man nicht zu fürchten, daß auf einem herumgehackt würde.
Nicht, daß er sich in der Schule oder beim Militär nicht wohl gefühlt hätte. Er war jemand, der sich den jeweiligen Gegebenheiten gut anpassen konnte. Schon am Tag seiner Ankunft im Ausbildungslager Catterick vor zwei Jahren hatte er gewußt, daß er das hinbekommen würde. Beim Militär, hatte er vermutet, würde es nicht viel anders zugehen als im Internat: Man würde kalt und ungemütlich wohnen, schlecht essen und ständig gesagt bekommen, was man zu tun und zu lassen hatte. Aber damit konnte er umgehen. Genau wie die Jungs aus der Arbeiterklasse, die schon zwei Jahre auf dem Bau oder einer Werft malocht hatten. Nur die Bürschchen von den humanistischen Gymnasien, die bisher nie von zu Hause weggewesen waren, hatten in der ersten Nacht in ihr Kopfkissen geflennt.
Calebs ganze Tätigkeit während des Militärdiensts hatte darin bestanden, in einer Reihe trister Lager Papiere hin und her zu schieben. Sein schlimmster Feind war die Langeweile gewesen. Eine ziemliche Farce, seine militärische Laufbahn, hatte er oft gedacht, besonders im Vergleich zu der seines Vaters.
Calebs Vater war Schreiner gewesen. Die Depression hatte Archie Hesketh schwer getroffen und ihn um den kleinen Betrieb gebracht, den er sich in Südwestengland aufgebaut hatte. Obwohl er auf der Suche nach Arbeit sogar seinen Heimatort verlassen hatte, hatte er nichts gefunden, was von Dauer war, und die Familie hatte ständig zu kämpfen, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Trotzdem erinnerte sich Caleb, wenn er an seine frühe Kindheit dachte, nicht an Armut und Entbehrung, sondern an fröhliche Geselligkeit und Gemeinschaft. Sein Vater war ein sanftmütiger, stiller Mensch gewesen, der seinem kleinen Sohn gegenüber nicht ein einziges Mal die Stimme erhoben, sondern sich mit unerschöpflicher Geduld um ihn gekümmert hatte. Er hatte ihn auf der Schaukel im Park angestoßen, hatte ihm das Radfahren beigebracht und ihm abends vorgelesen.
Bei Ausbruch des Krieges 1939 hatte Archie Hesketh sich freiwillig zu den britischen Expeditionsstreitkräften gemeldet. Im Mai 1940 war er unter heftigem feindlichem Beschuß auf einem alten Raddampfer von den Stränden Dünkirchens geflohen. Im folgenden Jahr war er nach Nordafrika abkommandiert worden und hatte dort Anfang 1942 bei Tobruk den Heldentod gefunden. Caleb war neun Jahre alt gewesen, als das Telegramm gekommen war, das seine Mutter und ihn vom Tod seines Vaters in Kenntnis setzte. Die Nachricht hatte ihn in Verwirrung und Ungläubigkeit gestürzt, und lange Zeit hatte er danach insgeheim an dem Glauben festgehalten, das Ganze sei ein Irrtum, sein Vater sei in Wirklichkeit in Kriegsgefangenschaft geraten oder hielte sich vielleicht in der Wüste versteckt. Seine Mutter, daran erinnerte er sich noch genau, war wie eine Verlorene in dem Häuschen herumgeirrt, in dem sie damals gelebt hatten, als könnte zum erstenmal nichts von dem ihr helfen, was ihr sonst Halt zu geben pflegte – weder ihr Optimismus noch ihre Zigaretten, noch die hübschen kleinen Nippsachen, mit denen sie das Haus füllte.
Die Erinnerungen an seinen Vater erstarrten mit der Zeit und gerannen zu einer Reihe von Schnappschüssen und Anekdoten. Nicht lange nach seinem Tod war Caleb dank eines Stipendiums für die Söhne der Gefallenen aus dem Regiment seines Vaters aufs Internat gekommen und hatte sich durch die Schule so mühelos hindurchlaviert wie später durch den Militärdienst. Bei Schulabschluß hatte er flüchtig mit dem Gedanken gespielt, Berufssoldat zu werden, aber die Erfahrungen im Militärdienst hatten ihn schnell von dieser Idee geheilt. Er hatte weder Archie Heskeths Bereitschaft, sich der Autorität zu beugen, noch seine Begabung zum Heldentum mitbekommen. Diese Erkenntnis war von leichter Beschämung und einer gewissen Enttäuschung begleitet gewesen.
Er hätte die Offizierslaufbahn einschlagen und so der lärmenden Vertraulichkeit der Mannschaftskaserne entkommen können, aber er hatte sich entschieden, beim Fußvolk zu bleiben, vor allem, weil er bezweifelte, daß er sich die Rechnungen der Offiziersmesse würde leisten können, aber auch, weil es gutgetan hatte, einmal zwei Jahre lang nicht zu heucheln, nicht ständig vorgeben zu müssen, einer zu sein, der man gar nicht war. Während seiner Zeit als Stipendiat an einem unbedeutenden Privatinternat war es noch das einfachste gewesen, sich die richtige Sprechweise zuzulegen. Dafür zu sorgen, daß man nicht wegen seiner bescheidenen Herkunft Anlaß zu Spott und Hänselei gab, war ein weit schwereres Stück Arbeit gewesen.
Aber jetzt endlich hatte er Schule und Militär für immer hinter sich. Heute abend feierte er den Beginn seines restlichen Lebens. Der Abend schien ihm voller Verheißung zu sein – auf Abenteuer vielleicht oder auch Liebe; auf Befreiung aus Routine und Langeweile; auf eine Chance, nach so langer Zeit seinen eigenen Weg zu wählen.
In einem Pub am Piccadilly trafen Caleb und Alec zufällig einen ehemaligen Mitschüler, der ein paar Klassen höher gewesen war als sie – Caleb erinnerte sich, daß es aus seinem Zimmer immer nach verbranntem Toast gerochen hatte. Sie hängten sich an die Clique des Toastverbrenners und zogen mit ihr durch den kalten, regnerischen Abend. In einer überfüllten kleinen Bar in Soho, wo sie Bier und Whisky tranken, quatschten sie bei lauter Musik eine Blondine und eine Brünette an. Die Blondine hieß Helen, die Brünette Doris. Helen schloß sich Alec an, Doris Caleb. Caleb fragte sich, ob es immer so war, daß hell sich zu hell gesellte und dunkel zu dunkel.
Doris’ Haar umgab in steifen Wellen ihren Kopf. Ihr Gesicht war zu gipsweißer Glanzlosigkeit gepudert, und ihr üppiger Busen drückte sich beim Tanzen wogend gegen Calebs Brust. Sie sei aus Yarmouth, erzählte sie. Nach London gekommen, um ihr Glück zu machen (mit einem Kichern). »Und, hast du’s schon geschafft?« fragte er, und sie sah ihn verständnislos und etwas verdutzt an.
»Ich möchte Kosmetikerin werden«, erklärte sie. »Ich bin gut in Maniküre.«
Sie kauften Tüten voll Chips und aßen, während sie durch die Straßen gingen. Doris aß alle ihre eigenen Chips und den größten Teil von Helens. In einem verqualmten Pub trank sie einen Gin Orange nach dem anderen und erzählte Caleb, sie denke daran, ihr Haar blond zu färben. »Blondinen fallen den Männern immer zuerst auf«, erklärte sie sachlich. Caleb überlegte, ob er beleidigt sein sollte, fand es aber nicht der Mühe wert. Als sie wieder in die kalte Nacht hinausgingen, färbte sich Doris’ Gesicht unter den Puderschichten grün, und sie übergab sich in den Rinnstein, worauf Helen sie in ihre Obhut nahm und auf der Suche nach einem Taxi zurück zu ihrer Unterkunft mit ihr davonging.
Caleb und Alec landeten in der nächsten Bar, einer Kneipe von der Sorte, in denen erwartet wurde, daß man den Tischdamen schamlos überteuerte Getränke spendierte. Caleb schüttelte höflich lächelnd den Kopf, als eine Frau sich an ihn heranmachen wollte. Ihm ging langsam das Geld aus. Selbst Alec wirkte angesichts einer astronomischen Rechnung für ein Glas Champagner, das er einer sommersprossigen Rotblonden spendiert hatte, etwas gequält. Als niemand schaute, machten sie sich davon. Auf einem ausgebombten Grundstück hockten sie sich auf eine Mauerruine und hielten die erhitzten Gesichter zur Abkühlung in den feinen Nieselregen.
Alec schwenkte triumphierend einen Zettel. »Schau her! An der Adresse hier steigt gerade eine Riesenfete.«
Die Fete fand in einem hohen, schmalen Haus in einer Seitenstraße der King’s Road statt. Die Haustür stand offen, Musik und Licht strömten zur Straße hinaus. Drinnen war ein langer Flur mit schwarzweiß gefliestem Boden. Gäste saßen auf der Treppe, zwei oder drei jeweils auf einer Stufe. Flaschen und Gläser blitzten, und an der Decke funkelte leise schwankend ein großer Leuchter.
Caleb durchstreifte das Haus und sah sich um. Er schaute sich immer gern alles an – Häuser, Menschen, Gärten, das Meer, was auch immer. Dieses Haus war ein Prunkstück verblichener Pracht. Die Möbel waren aus dunklem, glänzendem Holz, die Vorhänge aus abgewetztem Samt. Die Gäste waren von einem Flair lässiger Eleganz umgeben; ihr Schmuck, vermutete Caleb, war echt, ihre Kleider, auch wenn sie Jahrzehnte auf dem Buckel hatten, aus Paris oder Rom.
Auf einem Bücherregal bemerkte er ein Glas mit irgendeinem Getränk, das jemand dort stehengelassen hatte, und nahm es mit, um auf seinem Rundgang von Zeit zu Zeit daraus zu trinken. Die in Öl gemalten Konterfeis strenger, schnauzbärtiger Männer blickten von den Wänden im Korridor auf ihn herab; er gewahrte sein Bild in einem goldgerahmten Spiegel und fuhr sich hastig durch sein kurzes, schwarzes Haar. Vielleicht, dachte er, hätte er einen Abendanzug tragen sollen. Beinahe alle Männer hier trugen Abendkleidung. Aber er hatte gar keinen Smoking. Er hatte überhaupt nur einen einzigen Anzug, den nämlich, den er gerade anhatte. Er hatte ihn mit achtzehn das letzte Mal getragen, und er war ihm viel zu klein, und –
»Hallo, wer sind Sie denn?« sagte jemand.
Er fuhr herum. Sie war schlank und groß – nur wenige Zentimeter kleiner als er selbst – und hatte welliges kastanienbraunes Haar. Ihre mandelförmigen Augen hatten die gleiche Farbe wie ihr saphirblaues Kleid.
»Caleb Hesketh.« Er bot ihr die Hand.
»Kennen wir uns?« Sie runzelte die Stirn. »Ich glaube nicht. An Sie würde ich mich erinnern.«
Er sagte ehrlich: »Wir sind auf dem falschen Fest.«
Sie lächelte. »Ich denke, Sie sind genau richtig hier. Ich bin Pamela Page. Es ist mein Fest.« Sie sah zu seinem Glas hinunter. »Was trinken Sie?«
»Keine Ahnung. Es schmeckt nach Terpentin.«
»Ich habe Champagner da. Der schmeckt viel besser als Terpentin.«
Er folgte ihr in ein Zimmer. »Da«, sagte sie, »auf der Kredenz. Und drehen Sie die Flasche, nicht den Korken. Ich möchte den Champagner nicht auf dem Fußboden haben. Das wäre Verschwendung.«
Er goß zwei Gläser ein. Wenn sie lächelte, zogen sich ihre Mundwinkel aufwärts wie die Spitzen eines Halbmonds. »Köstlich. Mein Lieblingsgetränk. Sie mögen Champagner doch auch, oder, Caleb?«
»Ich trinke ihn heute das erste Mal.«
»Ach, Sie armer Junge.« Sie setzte sich auf ein Sofa und klopfte auf den freien Platz neben sich. »Kommen Sie, erzählen Sie mir von Ihrer traurigen Kindheit. – Nein!« Sie krauste die Stirn. »Lassen Sie mich raten.«
Der Champagner in seinem Glas sprudelte. Während er trank, sich im Zimmer umsah, vor allem sie betrachtete, ergriff ihn prickelnde Erwartung. Sein Leben hatte endlich begonnen.
Sie sagte: »Also, geboren wurden Sie – ach, irgendwo in der Prärie. Sie haben einen Akzent, Darling, einen klitzekleinen nur, aber für so was habe ich ein feines Ohr. Dann – hm, lassen Sie mich überlegen … Ich nehme an, Sie waren auf irgendeiner gräßlichen Schule, wo Sie ständig Rugby gespielt haben, und danach …« Sie zauste ihm mit langen, schlanken Fingern das Haar. Ein Schauder rann seinen Rücken hinauf, und beinahe hätte er sich an seinem Champagner verschluckt. »Danach haben Sie offensichtlich Ihren Dienst an Königin und Vaterland abgeleistet. Sie sehen aus wie ein geschorenes Schaf.« Sie lehnte sich tiefer in die Polster. »Habe ich recht, Darling?«
»Vollkommen«, bekannte er.
»Jetzt ich.«
»Sie?«
»Ja, ich«, gab sie geduldig zurück.
Er starrte sie an. So nahe bei ihr, konnte er erkennen, daß sie einige Jahre älter war als er, aber das konnte man schließlich nicht sagen. Darum begann er einfach wild draufloszuphantasieren. »Sie sind die Tochter eines schottischen Barons. Sie sind in einem zugigen alten Schloß in den Highlands aufgewachsen. Sobald Sie konnten, sind Sie nach London geflohen, in dieses Haus hier, das Sie von Ihrer Großmutter mütterlicherseits geerbt haben, die wiederum die siebte Tochter einer siebten Tochter war.« Er hielt inne, als ihm nichts mehr einfiel.
»Vollkommen falsch«, sagte sie, aber sie lächelte. Ihr Blick schweifte durch das Zimmer. »Das hier war das Haus meines Mannes. Er ist tot. Fast zehn Jahre schon. In seiner Spitfire zu einem Häufchen Asche verbrannt.«
Ihr kühler, leichter Ton und die herzlose Wortwahl schockierten ihn. Er murmelte: »Das tut mir leid«, und sie zauste wieder sein Haar und sagte: »Es braucht Ihnen nicht leid zu tun. Es ist lange her. Und Sie – sind Sie mit dem Militärdienst fertig?«
»Seit heute morgen, ja.«
»Was haben Sie jetzt vor?«
»Ich weiß noch nicht«, gestand er. »Ich habe mich noch nicht entschlossen. Wahrscheinlich sollte ich Jura studieren oder so was.«
»Das klingt ziemlich langweilig.« Sie lächelte ironisch. »Und inzwischen – leben und Spaß haben?«
»So ungefähr, ja.« Er erklärte: »Ich bin gleich nach der Schule zum Militär gegangen. Ich mußte vorher noch nie entscheiden.«
»Es muß ja herrlich sein, wenn alles fix und fertig vor einem ausgebreitet liegt. Das ganze Leben – wie eine riesige Schachtel Pralinen.«
Sie stellte ihr Glas weg und stand auf. »Soll ich Sie mit ein paar Leuten bekannt machen, Caleb? Das wäre doch schon mal ein Anfang, hm?«
Caleb lernte Marcus kennen, der Filme machte; Caroline, die bei Norman Hartnell als Mannequin arbeitete; und Simone, die für die Vogue schrieb. Er tanzte zu kratziger Grammophonmusik mit einer blasiert aussehenden, unterkühlten Blondine und grölte, mit einem Dutzend anderer Gäste um einen Stutzflügel gedrängt, die Refrains von »Jealousy« und »Moonlight Serenade«. Er trank eine Menge und vertilgte dutzendweise belegte Brötchen. Ab und zu sah er flüchtig einen Schimmer des saphirblauen Kleids, aber immer, wenn er sich durch das Menschengewühl drängte, um Pamela zu suchen, verlor er sie gleich wieder aus den Augen. Als ihm schwindlig wurde vor Alkohol und Erschöpfen, schien sie ihm der einzige feste Punkt zu sein, ein klares blaues Leuchten an einem immer trüber werdenden Himmel.
Er verlor alles Zeitgefühl; als er das nächste Mal auf seine Uhr schaute, war es halb fünf Uhr morgens. Alec war schon vor Stunden gegangen. Gläser und Flaschen standen verlassen auf Tischen und Fußböden. Von den Gästen, die noch da waren, waren einige auf Sofas oder Treppenstufen eingeschlafen. Eine müde, traurige Stimmung durchzog das Haus; auf dem Treppenabsatz saß ein weinendes Mädchen, und in der Küche umarmte sich ein Pärchen.
Als Caleb zu einem der Fenster hinausschaute, sah er unten im Garten Pamela. Der Regen, der langsam an den Scheiben herabrollte, verwischte das blaue Kleid. Er stolperte zur Terrassentür hinaus, rutschte auf der nassen Terrasse aus und stieß einen Topf mit welken Geranien um. Im ersten Moment bemerkte er nicht, daß sie nicht allein war.
Als sie ihn ansah, war ihr Blick leer und kalt. Ihr Begleiter, der um die Dreißig war und auf eine etwas schmierige Art recht gutaussehend, sagte in arrogantem Ton: »Willst du uns nicht miteinander bekanntmachen, Pam?«
»Natürlich, Eliot, das ist –« Sie hielt mit zusammengezogenen Brauen inne. »Eliot, das ist Christopher –« Sie schüttelte ungeduldig den Kopf. »Ich meine, Colin –«
»Caleb«, sagte Caleb. »Caleb Hesketh.«
»Das ist mein Verlobter, Eliot Favell.«
Sie tauschten einen Händedruck. Ein peinliches Schweigen trat ein. Calebs gute Manieren, die ihm von seiner Mutter und auf der Schule eingetrichtert worden waren, retteten sie schließlich. »Ich wollte mich bedanken. Für Ihre Gastfreundschaft, meine ich. Es war ein tolles Fest.«
»Freut mich, daß es Ihnen gefallen hat.« Ein vages Lächeln. »Melden Sie sich, Darling, ja?« Sie wandte sich ab.
Er ging. Er war noch immer ziemlich stark betrunken, und lebhafte Bilder aus der langen Nacht begleiteten ihn, als er durch die stillen Straßen ging: Doris’ Finger mit den rotlackierten Nägeln auf seinem Arm, während sie tanzten; die sommersprossige Rotblonde aus dem Klub in Soho und Pamela natürlich, schön und eisig.
Der Himmel begann sich zu lichten, als Caleb den Victoria-Bahnhof erreichte. Die Wolken öffneten sich, und ein rosiger Schein fiel über Dächer und Türme der Stadt. Er blieb stehen, blickte nach oben und fühlte sich von einem berauschenden Hochgefühl erfaßt.
Am Eingang zur Bahnhofshalle rieb er sich die müden Augen und gähnte. Es war Zeit, nach Hause zu fahren. Heim nach Middlemere.
Der Bus setzte Romy vor dem Rising Sun ab, den Rest des Wegs nach Hause ging sie zu Fuß. Es gab zwei Pubs in Stratton, einen Laden und eine Kirche. Aus der Tür des zweiten Pubs rief ihr jemand zu und wollte ihr etwas zu trinken spendieren, aber sie schüttelte nur mit einem Lächeln den Kopf und ging weiter. Als sie am Friedhof vorüberkam, schauten die beiden Ziegenböcke, die am Straßenrand angepflockt waren, kurz zu ihr auf, dann zerrten sie weiter an der alten Zeitung, die sie sich zum Fraß auserkoren hatten.
Romy wohnte in einem der sechs Sozialhäuser, die knapp einen halben Kilometer von der Kirche entfernt auf einer Anhöhe standen. Selbst im Sommer blies hier ständig ein Wind, der an der Wäsche auf der Leine riß, daß sie knallte, und die ordentlich angepflanzten Narzissen- und Tulpenbeete plättete. Aber im Garten der Parrys standen sowieso weder Narzissen noch Tulpen; im Vorgarten des Hauses Hill View 5 gab es nur ein paar Sträucher, die mühsam ums Überleben kämpften, sowie ein kleines ungepflegtes Rasenstück, auf dem durchweichte alte Pappkartons und mitgenommenes Kinderspielzeug herumlagen.
Romys Mutter war in der Küche. Töpfe klapperten auf dem Herd. Martha hielt ein Messer in der Hand und den Kleinen auf der Hüfte. Er schrie, das rote, runde Gesicht verschmiert von Rotz und Tränen.
»Du kommst spät«, sagte Martha.
»Der Bus war voll, Mam. Ich mußte auf den zweiten warten.«
»Hier, nimm mir Gareth mal ab.« Martha reichte Romy ihren Halbbruder. »Ich weiß nicht, was er hat. Er ist schon den ganzen Tag so quengelig. Wahrscheinlich brütet er wieder irgendwas aus.«
Romy kramte in ihrer Tasche. »Zahltag, Mam.« Sie gab ihrer Mutter einen Zehn-Shilling-Schein und zwei Halbkronenstücke.
Martha lächelte mit müdem Gesicht. »Du bist ein gutes Mädchen, Romy.« Sie versteckte das Geld in einer leeren Kakaodose und schob diese ganz hinten in einen der Küchenschränke. »Wickel ihn noch einmal und bring ihn dann ins Bett, ja? Wenn Ronnie oben ist, sag ihm, er soll runterkommen.« Martha hob den Deckel von einem der Töpfe auf dem Herd und stach mit der Messerspitze eine Kartoffel an. »Der junge Pike war übrigens hier und hat nach dir gefragt«, bemerkte sie. »Ich hab ihn weitergeschickt.«
»Liam?«
Martha nickte. »So ein eingebildeter Kerl! Den müßte mal jemand gehörig zurechtstutzen.«
»Wo ist Jem?«
Martha goß die Kartoffeln ab. »Er ist noch nicht da.«
Als Romy hinausging, sagte Martha scharf: »Mach bloß nicht den gleichen Fehler wie ich und hals dir so jung schon einen Mann und Kinder auf. Dafür bist du zu gut, Romy.«
Nachdem Romy den Kleinen zu Bett gebracht hatte, ging sie in das Zimmer, das sie mit ihrer dreizehnjährigen Stiefschwester Carol teilte. Carol stand mit einem Lippenstift in der Hand vor dem Spiegel. Auf dem Bett neben ihr lag eine offene Puderdose.
Romy schnappte nach Luft. »Das sind meine Sachen! Was machst du mit meinen Sachen?«
Carols Gesicht war eingepudert wie ein Babypopo. Sie lächelte selbstzufrieden mit knallrot verschmiertem Mund. »Schau ich schön aus?«
»Du siehst fürchterlich aus.« Romy griff nach der Puderdose. Carol sprang zur Seite. Puder rieselte auf das Bett – mein Bett, dachte Romy wütend. Sie versuchte noch einmal, sich die Puderdose zu schnappen. Carol stolperte, rutschte aus und schlug mit dem Kopf gegen die Wand. Sofort begann sie laut zu schreien.
»Das sag ich Dad!« Sie rannte aus dem Zimmer.
Romy kniete nieder und fegte das Puder vom Linoleum in die Dose zurück. Sie hatte es gerade erst gekauft, es hatte einen Shilling und sechs Pence gekostet. Romy verdiente als Bürokraft ein Pfund achtzehn Shillinge die Woche. Fünfzehn Shillinge bekam ihre Mutter, zehn gab sie für Bus, Mittagessen und Kleidung aus, blieben genau dreizehn Shillinge, die sie jede Woche sparen konnte. Wenn das so weiterging, würde sie Jahre brauchen, um genug zusammenzubekommen. Romy war sehr vorsichtig mit ihrem Geld und drehte jeden Penny zweimal um.
Sie hatte nicht vor, bis in alle Ewigkeit für ein Pfund achtzehn die Woche in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Sie hatte eine unbändige Sehnsucht danach, Neues zu sehen und zu erleben. Manchmal wurde die Sehnsucht so heftig, daß sie sich beinahe krank fühlte. Sie wünschte sich so vieles. Sie wünschte sich schöne Kleider, Bücher, Kinobesuche. Sie wünschte sich, ihre Mutter wäre nicht so müde und abgehärmt. Sie wünschte sich, Jem würde es länger als ein paar Monate an einer Arbeitsstelle aushalten; sie wünschte sich, er würde nicht immer wieder tagelang verschwinden und sich von Gaunern wie den Dayton-Brüdern fernhalten.
Sie wünschte sich ein eigenes Zimmer, das sie nicht mit der blöden Carol teilen mußte. Vor allem aber wünschte sie sich weg aus Stratton. Sie wollte in der Stadt leben – in Salisbury vielleicht oder auch in Southampton; ganz gleich wo, Hauptsache nicht im langweiligen Stratton bei den gräßlichen Parrys. In jüngster Zeit quälte Romy eine immer stärkere Angst, daß sie all ihren Wünschen und Bemühungen, diese zu verwirklichen, zum Trotz unwiderstehlich vom stumpfsinnigen Einerlei und von der Engstirnigkeit Strattons eingefangen und verschlungen werden würde.
Nächstes Jahr um diese Zeit, schwor sie sich, würde sie eine bessere Stellung haben und eine eigene Wohnung. Sie würde dann neunzehn sein, fast zwanzig. Sie stellte sich vor, sie säße in einem Büro, wo sie Befehle erteilte und Schecks einlöste. Sie trüge einen eleganten Rock mit Jackett und wäre perfekt geschminkt und ihr widerspenstiges glattes Haar perfekt gelockt.
Sie versteckte das Puder unter der Matratze neben ihrem Sparbuch und klappte das Buch kurz auf, um sich die Gesamtsumme ihrer Ersparnisse anzusehen. Sie lächelte. Siebenunddreißig Pfund und sechs Shillinge. Nur noch zwei Pfund und vierzehn Shillinge, dann würde sie vierzig Pfund beisammenhaben.
Man muß nur warten können, hatte Miss Evans, ihre Lehrerin am Gymnasium, immer gesagt. Gottes Wege sind unergründlich. Nun, Gott hatte Miss Evans’ ehrgeiziges Bemühen, Romy das Universitätsstudium zu ermöglichen, nicht unterstützt, und Romy hatte es nicht über sich gebracht, Miss Evans zu sagen, daß ihrer Ansicht nach ein Studium nur monumentale Zeitverschwendung war und sich an dieser Auffassung auch nichts geändert hätte, wenn ihr Stiefvater sie noch die sechste Klasse hätte besuchen lassen. Das, was Romy wollte, bekam man nicht, indem man sich drei Jahre lang in fade Theorie vergrub. Man erreichte es nur durch harte praktische Arbeit. Und indem man sich von nichts und niemandem aufhalten ließ.
Jem kam nicht zum Abendessen. Nachdem Romy abgespült hatte, fuhr sie mit dem Fahrrad los, um ihn zu suchen.
Zuerst versuchte sie ihr Glück in den Pubs, im schummrigen rauchverhangenen Halbdunkel des George IV. und des Rising Sun. Jem war nicht da, aber Mr. Belbin, der Lebensmittelhändler, rief ihr zu: »He, wenn du deinen Bruder suchst, ich hab ihn mit Luke Dayton gesehen.« Romy sank der Mut. Sie radelte weiter den Hügel hinunter und prüfte systematisch Jems bevorzugte Schlupfwinkel: den feuchten Luftschutzbunker gegenüber der Schule, in dem es von Spinnen wimmelte; den Steinbruch, der in diesem nassen Frühjahr randvoll mit kaffeebraunem Wasser stand.
Der Steinbruch lag am Rand eines Waldes. Romy lehnte ihr Rad an einen Baum, setzte sich auf einen umgestürzten Stamm und schaute auf das glatte braune Wasser hinaus. Sie kam oft hierher; hier konnte man gut nachdenken. Zu Hause war Nachdenken unmöglich, es waren zu viele Leute um einen herum. Trotzdem war das Haus am Hill View 5 natürlich ungleich besser als die Fremdenheime und heruntergekommenen Hütten, in denen sie vorher gehaust hatten. Romy war schon seit langem klar, daß ihre Mutter Dennis Parry wegen des Hauses geheiratet hatte.
Dennis war verwitwet und hatte eine kleine Tochter. Er hatte eine Haushälterin gesucht und eine Mutter für Carol. Martha hatte für sich und ihre beiden Kinder ein Dach über dem Kopf gebraucht. Dennis Parry war von Beruf Maurer, und wenn er auch mit Unterbrechungen arbeitete, verdienten er, Martha und Romy gemeinsam doch immer genug, um die Miete bezahlen zu können. Der Luxus fließenden Wassers und eine Innentoilette schien nicht einmal mit der späteren Ankunft von Ronnie und Gareth zu teuer bezahlt.
Romy versuchte, Dennis zu ignorieren und so zu tun, als gäbe es ihn nicht. Wenn er sie anbrüllte, stellte sie sich vor, er wäre eine Maus, die in der Ecke saß und piepste. Wenn er sie schlug, versteckte sie die blauen Flecken unter langärmeligen Blusen oder blickdichten Strümpfen. Ziemlich schnell hatte sie gelernt, mit Dennis’ Wutausbrüchen zu rechnen, und meistens gelang es ihr, seinen Schlägen zu entkommen. Jem hatte das bis heute nicht raus. Allein seine Anwesenheit, sein Auftreten und sein Ton reichten aus, um Dennis zur Weißglut zu treiben. Aus irgendeinem Grund schien dieser seinen Stiefsohn abgrundtief zu hassen. All die Eigenschaften, die Romy an ihrem Bruder besonders liebte – seine Großzügigkeit, seine Gutmütigkeit, sein Charme und seine Spontaneität –, waren für Dennis offenbar die reine Provokation. All die Eigenschaften, die Romy Anlaß waren, sich um ihren Bruder zu sorgen – sein mangelndes Urteilsvermögen, seine Impulsivität und sein leicht entflammbarer Zorn, der jedoch niemals nachtragend war –, weckten den brutalen Schläger in Dennis.
Als sie ihr Fahrrad durch das Wäldchen zurückschob, hörte sie am Straßenrand ein Auto halten. Liam Pike saß am Steuer des offenen Wagens. Romy war ein paarmal mit Liam ausgegangen, bevor er seinen Militärdienst begonnen hatte. Er war groß und gutaussehend; mehrere von Romys Freundinnen waren in ihn verliebt gewesen. Aber Romy störte irgend etwas an ihm. Er hatte auch jetzt noch etwas von dem verwöhnten und verhätschelten kleinen Jungen, der er einmal gewesen war. Er war zwar auf dieselbe Schule gegangen wie Romy, aber Romys Mutter hatte früher einmal eine Zeitlang für seine Mutter geputzt, und Romy fragte sich, ob er nicht vielleicht deshalb auf sie herabsah.
Liam klopfte auf das Lenkrad. »Toller Schlitten, was? Hast du Lust auf eine Spritztour?«
Romy schüttelte den Kopf. »Ich muß Jem suchen.«
»Romy!« Liam machte ein gequältes Gesicht. »Wir haben uns seit Monaten nicht gesehen. Und ich habe nur zehn Tage Urlaub.«
»Tut mir leid.«
»Morgen dann?«
»Ich muß vormittags arbeiten.« Doch ihr Blick glitt zurück zu dem Auto mit dem Chrom und dem Leder. In einem Auto konnte man fahren, wohin man wollte. In einem Auto konnte man fliehen.
»Komm schon, Romy«, drängte Liam.
Sie zuckte mit den Schultern. »Also gut. Du kannst mich nach der Arbeit in Romsey abholen.«
Luke Dayton ließ Jem mit seinem Auto fahren; Jem trat aufs Gas und brauste den schmalen Weg hinunter, der von der Straße zum dunklen kleinen Haus der Daytons führte. Jem fuhr gern schnell. Beim Fahren hörte man auf zu denken. Da gab es nur die Straße, das Auto, das Geräusch des Motors und das Vibrieren der Räder.
Bei den Daytons rauchten sie und tranken mit Lukes Brüdern Bier. Dann spielten sie ein paar Runden Poker, und Jem verlor sein ganzes Geld. Danach holte einer der Jungen das Gewehr seines Vaters, und sie streiften auf der Suche nach Kaninchen durch das Unterholz rund um das Haus.
Aber beim Krachen des Gewehrs, in das sich johlendes Gelächter mischte, begann Jem unbehaglich zu werden, und nach einer Weile trennte er sich von den anderen und begab sich auf den Heimweg nach Stratton.
Während des langen Marschs zurück verflog die durch Alkohol und Geselligkeit erzeugte gute Stimmung, Jem zog den Kopf zwischen die Schultern und versuchte, die finsteren Gedanken, die auf ihn eindrangen, abzuwehren, indem er entschlossen vor sich hin summte. Er mochte die Dunkelheit nicht, hatte sie noch nie gemocht. Er war nicht gern im Dunkeln allein.
Es war zwei Uhr morgens, als er zu Hause ankam. Ihm war nicht bewußt gewesen, daß es so spät war. Er bemühte sich, leise zu sein, als er ins Haus trat, aber Gareths Babystühlchen stand mitten in der Küche, und er stolperte prompt darüber. Mit wedelnden Armen versuchte er, das Gleichgewicht zu halten, und fegte dabei zwei Teller vom Tisch. Wie erstarrt blieb er stehen, mit angehaltenem Atem. Eine Sekunde lang glaubte er, es würde gutgehen, der schlafende Dennis hätte das Rumoren nicht gehört, aber dann vernahm er von oben die wütende Stimme und den Klang polternder Schritte. Gleich darauf stand Dennis in Netzhemd und Pyjamahose an der Tür und brüllte ihn an. Jem entschuldigte sich, soviel Lärm gemacht, ihn geweckt, die Teller zerschlagen zu haben, und versuchte mit hastig gestammelten Worten, seinen Stiefvater zu besänftigen.
Aber er fand nicht die richtigen Worte. Er fand nie die richtigen Worte. Er war nicht gescheit genug. Der erste Schlag traf ihn seitlich im Gesicht; der nächste mitten auf den Kopf und betäubte ihn. Dann kam seine Mutter und schrie Dennis an, er solle aufhören. Der versetzte ihr einen so brutalen Schlag, daß sie gegen den Türpfosten flog.
Wut verdrängte die Angst. Ein roter Nebel schien Jem einzuhüllen. Wie ein Wilder stürzte er sich auf seinen Stiefvater, schlug ihn mit Fäusten, schrie ihn an, beschimpfte ihn, bereit, ihm das gemeine Gesicht zu zertrümmern, ihn zu töten.
Aber Jem war siebzehn und schmal, Dennis Ende Dreißig, stämmig und muskulös. Er packte Jem bei den Haaren und schlug seinen Kopf mehrmals krachend gegen die Wand. Jem schrie, die Knie wurden ihm weich. Bei der ersten Gelegenheit, als Dennis den Griff ein wenig lockerte, entwand Jem sich seiner Hand und rannte aus dem Haus. Verletzt und benommen rannte er fort von Hill View, fort aus Stratton. Es hatte zu regnen begonnen, und die Tropfen mischten sich mit dem Blut und den Tränen, die über sein Gesicht liefen.
Am Morgen lagen überall in der Küche Scherben. Romy, die sich in der Nacht heimlich heruntergeschlichen hatte, hatte gesehen, wie Dennis Jems Kopf immer wieder gegen die Wand geschlagen hatte, während Martha geschrien hatte, er solle aufhören. Martha hatte aus einer Wunde am Mund geblutet. Sie hatte Romy bemerkt und ihr mit ärgerlichen Gesten zu verstehen gegeben, auf ihr Zimmer zu gehen.
Romy hatte ihr gehorcht. Die Beschämung, die sie dabei beschlich, war vertraut. Sie konnte Dennis nicht daran hindern, Jem und ihre Mutter zu mißhandeln. Aus Erfahrung wußte sie, daß Dennis auch sie geschlagen hätte, wenn sie es versucht hätte. Trotzdem konnte sie es sich kaum verzeihen, daß sie tatenlos zugesehen hatte. Im Bett rollte sie sich fest zusammen, zog sich das Kopfkissen über den Kopf und drückte die Finger auf ihre Ohren, um das Gebrüll und Geschrei von unten nicht mit anhören zu müssen.
Den ganzen Morgen bei der Arbeit begleitete sie die Angst. Die Frage, wo Jem jetzt war, ob es ihm gutging, ließ sie nicht los. Immer wieder überlegte sie, wie lange sie brauchen würde, um genug Geld für eine eigene Wohnung zu sparen, wo Jem vor Dennis sicher wäre. Es kostete sie einige Mühe, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Sie war zutiefst niedergeschlagen und hatte Kopfschmerzen. Als gegen Mittag eine von Mr. Gilfoyles reichen Mandantinnen in die Kanzlei kam und in eine Wolke von Luxus und Geheimnis gehüllt am Schreibzimmer vorbeirauschte, starrte Romy ihr mit einer Mischung aus Neid und Sehnsucht nach, bis sie in Mr. Gilfoyles Zimmer verschwunden war. Die Mandantin, eine Mrs. Plummer, besaß dieses undefinierbare großstädtische Flair kosmopolitischer Weltgewandtheit und Eleganz. Sie trug einen Pelzmantel und ein schwarzes Hütchen mit einem schicken kleinen Schleier und hatte mehrere Tragetüten bei sich, auf denen die Namen der exklusivsten Läden von Romsey prangten. Goldene Armbänder klirrten an ihrem Handgelenk, und der Schleier ihres Hütchens sprenkelte ihr Gesicht mit kleinen tanzenden Schatten. Ihr Parfum hing noch in der Luft, als sich Mr. Gilfoyles Zimmertür längst hinter ihr geschlossen hatte – ein französischer Duft, behauptete Lindy Saunders hingerissen.
Nach einigen Minuten öffnete Mr. Gilfoyle die Tür seines Zimmers und rief Romy herein. Mit Block und Bleistift ausgerüstet nahm sie auf einem Hocker Platz, um einen Brief aufzunehmen. Das Schreiben war lang und kompliziert, es ging darin um Mieten, Treuhandfonds und Steuern. Während Romy mitstenographierte, musterte sie verstohlen Mrs. Plummer und fragte sich, wie man sich fühlte, wenn man so reich war wie diese, so alt wie diese. Sie stellte sich ihr Haus vor, eine riesengroße Villa mit goldenen Leuchtern und wertvollen Ölgemälden, mit schweren Samtvorhängen an den Fenstern und geschnitzten Schränken, in denen teures Porzellan und edle Gläser standen …
»Miss Cole?« Mr. Gilfoyles Stimme störte sie aus ihrem Tagtraum auf. »Würden Sie uns den Brief noch einmal vorlesen, bitte?«
Sein scharfer Blick ruhte auf ihr, als erwartete er, daß sie einen Fehler machen würde, aber ihre stenographischen Aufzeichnungen waren wie immer perfekt.
Als sie fertig waren, stand Mrs. Plummer auf. »Sie schicken mir die Sachen dann zur Unterschrift, Mr. Gilfoyle?«
»Sie haben Sie spätestens in einer Woche.« Mr. Gilfoyle gab Mrs. Plummer die Hand.
Romy erbot sich, Mrs. Plummer die Tüten abzunehmen. Sie trug sie nach unten zur Straße. Draußen auf dem Gehweg sagte Mrs. Plummer: »Das war sehr freundlich von Ihnen, Miss Cole.« Sie lächelte. »Wie heißen Sie mit Vornamen, Kind?«
»Romy.«
»Romy … Ein hübscher Name. Und sehr ungewöhnlich. Sie machen Ihre Arbeit sehr gut, Romy. Macht sie Ihnen denn Freude?«
»Ich hasse die Arbeit«, sagte Romy, ohne zu überlegen, und merkte, wie sie rot wurde. »Ich meine –«
»Ach, du meine Güte«, sagte Mrs. Plummer. Ihre Mundwinkel zuckten kaum merklich. »Und warum hassen Sie sie?«
Verlegen murmelte Romy: »Sie ist so langweilig.«
»Was täten Sie denn lieber?«
»Das weiß ich auch nicht.« Romy betrachtete Mrs. Plummers elegante Kleidung und sagte neugierig: »Was arbeiten Sie, Mrs. Plummer? Haben Sie ein Geschäft?«
»O nein. Ich besitze ein Nachtlokal und ein Hotel.«
Romy sah augenblicklich schummrige, verrauchte Räume voll eleganter, unglaublich kultivierter Menschen vor sich. Sie seufzte. »So ein Glück.«
»Mit Glück hat das nichts zu tun.« Mrs. Plummers Ton war scharf. »Jeder ist selbst dafür verantwortlich, was er aus seinem Leben macht. Das sollten Sie nie vergessen. Wie alt sind Sie, Romy?«
»Achtzehn. Ich werde aber bald neunzehn.«
»Dann haben sie noch viel Zeit.« Mrs. Plummer öffnete ihre Handtasche und nahm eine kleine Karte heraus. »Hier, nehmen Sie. Und wenn Sie das nächste Mal nach London kommen, besuchen Sie mich.«
Das Taxi kam und fuhr mit Mrs. Plummer im Fond davon. Romy sah ihm nach, bis es an einer Straßenbiegung verschwand. An die Hausmauer gelehnt blieb sie noch einen Moment stehen und beobachtete das Samstagmorgengetümmel in den Straßen. Sie sah auf ihre Uhr. Bald Mittag. Nur noch eine halbe Stunde bis Büroschluß. Um eins war sie mit Liam Pike verabredet. Sie schaute sich die Karte in ihrer Hand an. Der Name Mirabel Plummer stand in verschnörkelter Schrift über einer Londoner Adresse. Mirabel. Romy schloß die Augen und träumte von anderen Welten.
Über den hohen Bäumen am Straßenrand hing ein erster grüner Schimmer, als sie am Nachmittag in nördlicher Richtung aus Romsey hinausfuhren. Zwischen Hecken und Schilf zeigte sich hin und wieder der Fluß, der wie Silber glänzte. Kurz vor Andover rief Liam laut, um das Rattern des Wagens zu übertönen: »Wir könnten hier irgendwo was essen.«
Romy schüttelte den Kopf. Sie wollte im Auto bleiben. Sie wollte ewig so weiterfahren.
»Frierst du?« fragte Liam. Er lenkte mit einer Hand, mit der anderen umschloß er Romys eiskalte Finger. »Ich könnte das Verdeck hochklappen. Oder sonst liegt hinten eine Decke.«
»Nein, nein, schon gut.«
Sie fand es herrlich, den Wind in ihrem Haar zu fühlen, und begnügte sich damit, den Kragen ihres Regenmantels hochzuschlagen. Die Straße wurde schmaler und begann zu steigen. Auf den Feldern standen reetgedeckte kleine Häuser und abgeschiedene Gehöfte. Immer wieder trat dichter Wald an die Straße heran und verdunkelte die Sonne. Dann aber, als der Wagen durch die Kreidehügel aufwärts kroch, blieben die Bäume zurück.
Liams Hand glitt von ihren Fingern zu ihrem Oberschenkel. Romys Stimmung verdüsterte sich in Erwartung des unausweichlichen Kampfs. Erst würde Liam sie küssen, dann würde er versuchen, ihre Bluse aufzuknöpfen, und sie würde ihn wegstoßen. Daraufhin würde er schmollen, und sie würde ihn aufheitern müssen, und am Ende würde er sie nach Hause fahren. Sie war nicht einmal sicher, daß er sie besonders mochte. Sie vermutete, er versuchte es bei jedem Mädchen.
Die Landschaft, durch die sie fuhren, hatte jetzt etwas Vertrautes. Als hätte sie sie schon einmal im Traum gesehen. Sie schaute in die Karte, aber sie war im Kartenlesen noch nie gut gewesen, und das Durcheinander von geschlängelten Linien und Farbschraffierungen schien ihr zu den Feldern und Hügeln, die sie umgaben, in keinerlei Beziehung zu stehen.
»Wo sind wir?«
»Das ist der Inkpen Hill«, sagte Liam. »Hier in der Nähe ist Hungerford.«
Inkpen. Ihr Herz schien einen Schlag auszusetzen. Wieder starrte sie mit zusammengezogenen Brauen in die Karte, aber die half ihr nicht weiter, und sie warf sie schließlich ungeduldig zu Boden.