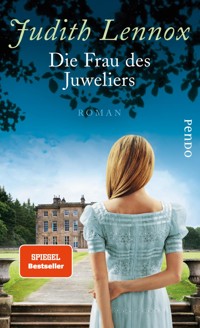9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Judith Lennox erzählt die Geschichte der temperamentvollen Thomasine – eingebettet in die Natur der ostenglischen Fenlands und in das Paris und das London der Zwanzigerjahre. Seit ihrer Kindheit in den rauhen Fens kennen sich Thomasine, die früh ihre Eltern verloren hat, Daniel, der Sohn des Dorfschmieds, und Nicholas, dessen wohlhabende Familie ein privilegiertes Leben führt. Doch als Nicholas aus dem Krieg heimkehrt und Thomasine seinem überstürzten Heiratsantrag zustimmt, ahnen sie noch nicht, wie stark die Gegensätze zwischen ihren beiden Welten tatsächlich sind …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für meinen Vater Harry Stretchund meinen Großvater Thomas Stretch,der im ersten Weltkrieg war
Übersetzung aus dem Englischen von Angelika Felenda
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe9. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95343-6
© Judith Lennox 1994
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Secret Years«, Hamish Hamilton Ltd / Penguin Group, London 1994
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2002
Umschlagkonzept: semper smile, München
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagabbildung: Veronica Gradinariu, Trevillion Images
Datenkonvertierung E-Book:
Teil I
1909 – 1914
Ein weher Lufthauch von fernen Landen mirIns Herze zieht;Welch blaue Hügel sind dies,Welch Türme, welche Farmen,Die nun mein inn’res Auge sieht?
ALFRED E. HOUSMAN, A Shropshire Lad
1
DIE KONTUREN DER fernen Hügel verschmolzen in einem kupferroten Sonnenuntergang. Thomasine kniete im Staub, sah einen Moment auf und wurde von der Sonne geblendet. Der Wind pflügte einen geisterhaften Pfad durchs Elefantengras, im Tal zupften ein paar magere Kühe welke Blätter von den Bäumen. Das Kind hielt sich die Hand vor die Augen, so daß der Blick verschwamm, die Hügel sich auflösten, flach wurden, und die Strahlen der afrikanischen Sonne sich in schmale Streifen goldenen Wassers zu verwandeln schienen.
Es hatte andere Farmen an anderen Orten gegeben. Jede Reise, sagte Papa, führe an einen besseren Ort, den richtigen Ort. Einmal hatten sie eine ganze Herde von Kühen besessen (Thomasine hatte allen Namen gegeben), aber jetzt waren es nur noch wenige.
Einmal hatte ein Sturm das Strohdach von der Hütte gerissen, aber Papa und der Junge sammelten das verstreute Stroh einfach wieder auf und banden es fest. Der Junge erklärte Thomasine, daß das Land, das sie vom Häuptling gepachtet hatten, schlechtes Land sei, Ju-Ju-Land, weshalb es auch noch niemand bebaut hatte. Thomasine fragte ihre Mutter nach dem Ju-Ju-Land. Gott erschuf die Welt in sieben Tagen, sagte Patricia Thorne. Wie sollte dann ein winziger Teil davon schlecht sein? Doch im Tausch gegen eine Locke von Thomasines rotbraunem Haar zeigte ihr der Junge die Höhlen, die die Medizinmänner benutzten. Die Höhlen waren kalt und hallten von Erinnerungen wider, ihre Eingänge führten in eine andere Welt. Wieder draußen im Licht, schnitt sie mit dem Messer des Jungen eine Strähne ihres roten Haars ab, die der Junge ehrfurchtsvoll und ängstlich betrachtete, bevor er sie zu einem Knoten band und in das Amulett an seinem Hals steckte.
Ein Mann und eine Frau von der baptistischen Mission besuchten die Thornes. Papa hatte eine der mageren Kühe geschlachtet, so daß es an diesem Tag Fleisch gab. Das Rindfleisch war zäh und schmeckte nach nichts. Der Junge und sein Vater aßen mit ihnen, wie sie es immer taten, doch als die Männer zur Arbeit gingen und Patricia Thorne den Tee bereitete, sagte die Missionarin: »Aber sie sind schmutzig, meine liebe Mrs. Thorne. Im vergangenen Monat hat es mehrere Fälle von Gelbfieber gegeben. Außerdem müssen wir ihnen doch zeigen, wo ihr Platz ist.« Patricia goß den Tee ein und antwortete: »Aber sind wir denn vor Gott nicht alle gleich, Miss Kent?«
Eines Abends nahm der Junge Thomasine mit ins Dorf, damit sie beim Tanzen zusehen konnte. Das Mondlicht und die Feuer beleuchteten die Körper der Eingeborenen, die sich wie Schilfrohr im Wind wiegten und Geschichten in den staubigen Boden zeichneten. Die Männer trugen Masken: vergrößerte und übertriebene Fratzen des menschlichen Gesichts. Das Schlagen der Trommeln dröhnte durch die Nacht, so daß auch Thomasine unwillkürlich ins Tanzen verfiel. Als die Musik aufhörte, fiel sie, von einem Gefühl der Verlassenheit überwältigt, zu Boden. Eine der Frauen half ihr beim Aufstehen und gab ihr zu trinken, eine andere schenkte ihr Perlen und ein Stück scharlachfarbenes Tuch. Eine dritte strich mit schwarzblauen Händen über ihr langes offenes Haar und redete auf die anderen Frauen in einer Sprache ein, die das Kind nicht verstand.
Mit Hilfe ihrer Mutter nähte Thomasine aus dem scharlachfarbenen Stoff einen Rock. Der Himmel blieb blau und wolkenlos. Der Weizen, der Thomasine bis zu den Knien gereicht hatte, hörte auf zu wachsen. Sie fragte ihren Vater und zog an den Zipfeln ihres Rocks, als sie über die verdorrten Felder gingen. »Der Regen ist nicht gekommen, und der Boden ist schlecht«, sagte Thomas Thorne. Ju-Ju-Land, dachte Thomasine und erschauderte. Ein paar Tage später pflückte sie einen Weizenhalm, zerrieb ihn zwischen den Fingern, und er zerbröselte wie altes Papier.
Es waren nur noch drei Kühe übrig, von denen keine Milch gab. Der Himmel war hart und metallisch wie eine Messingschüssel. Thomasine half ihrem Vater, Wasser vom Fluß heraufzutragen, aber das Flußwasser war moderig und grünlich, und das Schlammbett brach in Risse wie ein Mosaik. Die Leute verließen das Dorf, gefolgt vom langen Strom ihrer Tiere, und die farbigen Kleider der Frauen waren nur noch eine Erinnerung in der Landschaft aus Staub und Ocker. Der Junge und sein Vater gingen mit ihnen fort.
Thomasines Vater wurde dünner, ihre Mutter dicker. Thomasine verstand nicht, warum Mama dicker wurde, obwohl es nicht mehr viel zu essen zu gab. Dann lag eines Morgens ein winziges Baby auf dem Kissen neben ihrer Mutter. Thomasine wußte nicht, woher das Baby kam, und fürchtete, es zurückgeben zu müssen. Sie nannten es Hilda, nach Mamas Lieblingsschwester. Mama hatte Thomasine ein Foto von ihren drei Schwestern gezeigt: Hilda, Rose und Antonia. Sie lebten weit weg, in England.
Eines Abends wurde ihr Vater krank und machte sich am nächsten Morgen auf den Weg zum Missionshospital, um Medizin zu holen. Er nahm das große Pferd, das übellaunige, auf dem er Thomasine nie reiten ließ. Bevor er ging, bat er sie, sich um Mutter und Schwester zu kümmern. Zum Abschied winkte sie mit dem Taschentuch und sah ihm hinterher, wie er durch das Tal auf die Hügel zuritt.
Den ganzen Tag saß sie am Bett ihrer Mutter. Seit sechs Wochen, seit Hildas Geburt, war Patricia Thorne nicht mehr aufgestanden. Das Baby schlief, wurde gestillt und lag in Decken gehüllt da. Thomasine gefiel es, den warmen, samtigen Kopf zu berühren und die winzigen, seesternartigen Händchen zu betrachten. Das Baby war kleiner als ihre große Stoffpuppe.
Als Thomas Thorne nach Einbruch der Dunkelheit nicht zurückkehrte, zerkleinerte Thomasine Gemüsewurzeln, mischte sie mit Mais und kochte Suppe. Sie hockte draußen neben dem Feuer, rührte um und dachte daran, daß die Mission acht Meilen entfernt war und das übellaunige Pferd vielleicht ein Hufeisen verloren hatte. Doch der Himmel und das Land erschienen ihr sehr dunkel, sehr leer.
Ihre Mutter aß nur einen Löffel Suppe, den Rest verzehrte Thomasine selbst. Das Baby weinte viel, und Mamas Wangen waren rot, und ihre Stirn glänzte vor Schweiß. Thomas Thorne kehrte weder am nächsten noch am übernächsten Tag zurück.
Mama verstand sie nicht, als Thomasine fragte, ob sie Papa nachreiten oder ob sie bleiben und sich um das Baby kümmern sollte. Mamas Haut hatte eine merkwürdig gelbliche Farbe angenommen, und ihre Augen wirkten eingefallen. Ihr Gesicht sah aus wie eine der Masken, die Thomasine im Dorf gesehen hatte. Thomasine versuchte, sie zum Trinken zu bewegen, aber das einzige Wasser, das sie finden konnte, stammte aus dem trüben Fluß. Es rann aus Mamas Mund über Kinn und Hals und auf ihr Nachthemd hinab. Das Baby hatte irgendwann zu weinen aufgehört und schlief die meiste Zeit.
Am dritten Tag wachte Thomasine von der Stille auf. Als sie zum Bett hinüberging, glaubte sie anfangs, Mama schliefe, aber als sie ihre Hand berührte, war sie kalt. Sie begriff, daß sie jetzt, abgesehen von dem Baby, ganz allein war. Das sanfte Heben und Senken der Brust des Babys war noch zu spüren. Sie nahm an, daß die kleine Hilda ebenfalls hungrig war, und wußte, daß sie nichts hatte, um sie zu füttern.
Thomasine zog ihren scharlachfarbenen Rock an, packte alle Wertsachen in einen Beutel und sattelte das Pferd. Mit dem Baby, das sie auf afrikanische Art auf den Rücken band, ritt sie zum Missionshospital und zu ihrem Vater.
Southampton war ganz anders als Port Harcourt. Es war grauer und kälter, und vom Himmel fiel ein feiner Nieselregen. Als ginge man am Rand eines Wasserfalls entlang, dachte Thomasine.
Die Tanten erwarteten sie am Hafen. In dem Durcheinander aus Schiffen, Seeleuten und Passagieren glaubte sie nicht, sie je finden zu können, aber Miss Kent – die schwarzen Knopfaugen über der spitzen Nase starr nach vorn gerichtet – zerrte sie durch die Menge und brachte sie zu den drei Frauen, die sie von Mamas Fotografie her kannte. Entzückensrufe wurden ausgestoßen, und Thomasine wurde umarmt und geküßt.
Sie hörte Miss Kent sagen: »Wir haben den Eltern und dem Baby ein christliches Begräbnis gegeben.«
»Baby?« sagte die rothaarige Tante. (Thomasine, die sich nicht erinnern konnte, wer wie hieß, bezeichnete die drei als die große Tante, die kleine Tante und die rothaarige Tante.)
»Es gab einen Säugling«, sagte Miss Kent.
»Sie hieß Hilda«, ergänzte Thomasine.
Die große Tante blinzelte und begann, die Regentropfen von ihrer Brille zu wischen. Von einem der Schiffe ertönte lautes Sirenengeheul, und Thomasine erschauerte in ihrem dünnen schwarzen Mantel.
»Gelbfieber, wie ich in meinem Brief geschrieben habe, Miss Harker.«
»Dem armen Kind ist kalt.«
»Miss Kent – wir sind Ihnen unendlich dankbar. Kommen Sie mit uns zum Essen?«
Zu Thomasines Erleichterung schüttelte die Missionarin den Kopf. Thomasine mußte einen letzten, nach Veilchen duftenden Kuß auf die Wange über sich ergehen lassen und wurde dann an den Händen von zwei Tanten vom Dock weggeführt.
Im Teesalon, während die Tanten locker dahinplauderten, gelang es ihr, die Namen zuzuordnen. Die rothaarige Tante war Antonia, die große hieß Hilda und die kleine Rose.
»Vor allem braucht sie einen Beruf«, flüsterte Antonia. »Das arme Würmchen ist schließlich Waise.«
»Ich sage ja nicht, daß sie keinen Beruf braucht, liebe Tony. Es ist ja nur die Art des Berufs, um die es mir geht.«
»Tanzen ist absolut seriös, Hilda. Alle Mädchen aus meiner Schule werden sorgsam behütet, wenn sie an Theatern arbeiten.«
»Ich könnte Thomasine ein solides Fundament in Mathematik, Literatur und Geographie vermitteln. Ein Mädchen hat doch ganz andere Möglichkeiten, wenn es einen Schulabschluß besitzt.«
»Sie hat den Körper einer Tänzerin. Seht euch ihre Füße an – ihre Hände …«
»Sicher«, sagte Rose, und ihre Stimme zitterte ein wenig, als sie Tee nachgoß, »würde Thomasine die Landluft guttun. Sie ist doch noch ein Kind … erst zehn …«
Tante Rose reichte Thomasine die Platte mit den Gebäckteilen. Sie wählte eines in Form eines Büffelhorns aus, das mit Sahne und Marmelade gefüllt war. Nach der langen Seereise schwankte der Boden inzwischen ein bißchen weniger unter ihr, und sie hatte großen Hunger.
»Vielleicht«, sagte Hilda entschieden, »sollte Thomasine bei mir und Rose leben, aber die Ferien bei Antonia verbringen. Wir haben Kinder immer gern gehabt, nicht wahr, Rose? Und für ein Kind zu sorgen wäre jetzt, da du allein bist, schwierig für dich, Tony.«
Antonia sah aus, als wollte sie Einwände erheben, legte dann aber ihre elegant behandschuhten Finger auf die von Thomasine. »Du wirst mich oft besuchen kommen, nicht wahr, Liebling? Ich werde dir ein Paar Schuhe kaufen und ein Überkleid.«
Die Landschaft, auf die sie durch die Zugfenster hinaussah, wurde ebener und war jetzt von Wasserläufen durchzogen. Im schwachen Sonnenlicht glitzerte alles grün, blau und silbern. Als Hilda und Rose die Thermosflaschen, die Decken und Bücher in eine abgeschabte Stofftasche zu packen begannen, rief Thomasine aus: »Wohnt ihr in einem See?«
Hilda blickte aus dem Fenster. Nur Wasser war zu sehen, an dessen Rand die Zugtrasse entlangführte. Sie lächelte.
»Nein, Liebes. Einige der Felder sind überschwemmt wegen des starken Regens im Winter.«
Als sie am Bahnhof von Ely ausstiegen, zischte und pfiff der Zug und stieß jede Menge Dampf aus. Ein Dienstmann trug ihr Gepäck nach draußen, und Hilda suchte in ihrer Börse nach Kleingeld.
»Es ist ein langer Fußmarsch nach Drakesden, Liebes.«
»Ich geh gern zu Fuß.« Thomasine war zu lange in dem Schiff und dem Zug eingesperrt gewesen. »Papa hat immer gesagt, wenn man ein Land wirklich kennenlernen will, muß man zu Fuß gehen.«
Hilda trug die Tasche der Tanten und die von Thomasine. Rose hielt das Kind an der Hand, als sie dem schmalen Pfad folgten, der von Ely zum Dorf führte. Der Boden war schwarz und kreuz und quer von Wasseradern durchzogen wie ein Schachbrett. Mehrmals mußten sie über schmale, schwankende Planken gehen, die über die angeschwollenen Bäche führten. Hilda ging zuerst hinüber, so daß Thomasine sicher von einer Tante an die nächste gereicht wurde. Ihre Stiefel waren mit Schlamm bedeckt, aber beim schnellen Gehen, um mit Hilda Schritt zu halten, wurde ihr zum erstenmal seit ihrer Ankunft in England warm.
Drakesden war nicht viel größer als das afrikanische Dorf, in das der Junge sie mitgenommen hatte. Die Häuser waren mit Stroh gedeckt und aus gelblichem Ziegelstein gebaut. Es gab eine Kirche und einen Laden, und auf der Straße spielten ein paar Kinder, die Thomasine mit offenen Mündern anstarrten, als sie vorbeiging.
Hilda marschierte zur Vordertür eines der Cottages und stellte die Taschen ab, als sie die Klinke herunterdrückte. Thomasine las den Namen, der über dem Eingang stand – »Quince Cottage« –, und folgte ihrer Tante hinein.
Afrika, Mama und Papa und das Baby wurden in einem bestimmten Fach ihrer Erinnerung abgelegt. So war es leichter. Am Morgen hatte sie Unterricht bei Tante Hilly, und am Nachmittag erkundete sie Drakesden. Manchmal ging sie zu Fuß, manchmal lieh sie sich das Pony des Pfarrers und ritt. Die Dorfkinder starrten sie immer noch an, vor allem wenn sie den scharlachfarbenen Rock trug.
In der Kirche fiel sie unangenehm auf, weil sie das Gebäude als erste verließ, direkt hinter dem Pfarrer. Alle anderen blieben ruhig stehen: Vorn in den Bänken hinter dem Chorgestühl war ein Scharren zu hören, das war alles. Da sie unbedingt das dunkle, feuchte Gebäude verlassen wollte, nahm sie ihr Gebetbuch und rannte nach draußen. Sie verstand den Ausdruck auf Mr. Fanshawes Gesicht nicht, als sie sich von ihm verabschiedete, aber später erklärte ihr Tante Rose, daß die Blythes die Kirche immer als erste verließen. Am nächsten Sonntag bemerkte Thomasine, daß Mr. Fanshawe hauptsächlich die Blythes anlächelte und am wenigsten diejenigen, die die Kirche als letzte verließen. Sie, Tante Hilly und Tante Rose befanden sich ungefähr in der Mitte.
Sie stellte allen Fragen: Mrs. Carter, die den Laden führte, den Farmpächtern, den Männern und Frauen, die auf den Feldern arbeiteten. Sie diskutierte mit Mr. Naylor, der die Chalk Farm betrieb, über die Probleme des Weizenanbaus bei zu geringer Bewässerung, und er lachte und erklärte ihr, daß es in den Fens zuviel davon gab. Sie half Tante Rose im Gemüsegarten, grub aus der dunklen, krümeligen Erde winzige neue Kartoffeln aus, trug im Hühnerstall warme braune Eier zusammen und legte sie vorsichtig in einen Strohkorb.
Eines Tages ritt sie am Deich entlang, durchquerte ein mit Lorbeer und Dorngestrüpp bewachsenes Stück Land und kam am Rand einer Wiese heraus. Als sie aufblickte, sah sie Drakesden Abbey, das herrschaftliche Haus der Blythes. Es war riesig, größer als das Missionshospital. Dann blickte sie erneut auf und sah all die Leute, die sie anstarrten: Lady Blythe in einem fließenden weißen Kleid und einem großen flachen Hut, einen dunkelhaarigen Jungen, einen blonden Jungen und ein Mädchen. Verlegen murmelte sie ein paar entschuldigende Worte und drehte das Pony um. Zurück auf dem Deich traf sie Daniel Gillory, der in glucksendes Gelächter ausbrach, als sie ihm erzählte, wie sie die Blythes beim Tee im Garten der Abbey überrascht hatte.
Daniel erklärte ihr, was es mit den Deichen und Gräben, den Windmühlen und Pumpen auf sich hatte. Daniel war der älteste Sohn des Schmieds. Thomasine hatte versucht, Jack Gillory zu fragen, wie er Hufeisen anbrachte, aber er war kein guter Gesprächspartner. Daniel hingegen schon. Daniel sei ein besonders intelligenter Junge, sagte Tante Hilly. Er hatte gerade ein Stipendium fürs Gymnasium in Ely bekommen. Tante Hilly lieh ihm oft Bücher. Daniel war ein paar Monate älter als Thomasine und hatte blondes, leicht lockiges Haar und Augen, die zwischen Grün und Haselnußbraun changierten. Eines Nachmittags, als sie über die Felder ritten, während sein Vater im Otter, dem Dorfpub, war, erklärte Daniel ihr, wie Wasser vom Land in die Deiche und aus den Deichen ins Meer gepumpt wurde. Daß die Deiche und die Straßen hoch über den Feldern lagen, weil das entwässerte Moor abgesunken war. Daß die ganzen Fens vor langer Zeit nur Marschen und See, eine endlose Wasserlandschaft gewesen waren. Die Bewohner der Fens hätten damals Schwimmflossen gehabt, fügte Daniel mit ernstem Blick aus seinen grüngoldenen Augen hinzu. Dann lachte er lauthals, als er seinen Scherz eingestand, und jagte sie im Galopp den Weg entlang, während die Hufe ihrer geliehenen Ponys den Staub aufwirbelten.
Langsam gewöhnte sie sich an die wechselnden Jahreszeiten. An die Hitze und die Kälte, den Wind und die Zugluft. An die Schneeflocken, die wie weiße Blüten aus einem bleiernen Himmel schwebten, und an die Staubwirbel, die sie kurz an jenes andere Land erinnerten.
Zum Tee bei den Dockerills trug sie den scharlachroten Rock und die alte weiße Bluse ihrer Mutter, die zu groß für sie war. Thomasine mochte die Dockerills: In dem Cottage mit den drei Zimmern herrschte immer lautes und quirliges Treiben.
Mrs. Dockerill bewunderte ihren Rock und ihre Glasperlen. Ein paar der zehn kleinen Dockerills drängte sich an dem zerkratzten runden Tisch zusammen, die anderen saßen auf Hockern, Kisten und Planken. Mrs. Dockerill hob den Speckpudding aus dem Topf und nahm das Musselintuch ab. Sie schnitt ihn in zwölf Stücke und verteilte sie auf die bunt zusammengewürfelten Teller und Schalen. Jeweils ein großes Stück für Mr. Dockerill, Harry und Tom, die auf dem Feld arbeiteten, mittelgroße Stücke für Jane und Sally, die als Dienstboten beschäftigt waren, aber den Nachmittag freihatten, und kleine Stücke für die Kinder. Das Neugeborene schlief in einer Kiste in der Ecke. Der Speckpudding duftete unwiderstehlich.
Alle hatten zu essen begonnen, als von draußen das Geräusch von Schritten hereindrang. Harry Dockerill öffnete die Tür, und Lady Blythe stand davor, ihr Sohn Nicholas und ihre Tochter Marjorie hinter ihr. Lady Blythe brachte ein paar alte Laken für Mrs. Dockerill, die für das Neugeborene zerschnitten werden konnten. Thomasine beobachtete, wie Lady Blythe ins Cottage trat, nacheinander die Deckel von den Töpfen auf dem Herd hob und deren Inhalt inspizierte. Die lauten, fröhlichen Dockerills wurden plötzlich still. Sie hatten ihr Besteck abgelegt und saßen stocksteif und unbehaglich da, während das Essen auf ihren Tellern kalt wurde. Thomasine, die Ärger in sich aufkommen spürte, ohne genau zu wissen warum, spießte trotzig ein Stück Speck mit ihrer Gabel auf.
»Weißkohl, Mrs. Dockerill?« fragte Lady Blythe, in den größten Topf spähend. »Grünkohl ist genauso nahrhaft und wesentlich billiger.«
Dann entdeckte sie Thomasine. Der Blick aus den eisblauen Augen traf sich mit dem aus Thomasines meergrünen, genauso wie vor der Kirche, genauso wie damals, als sie unerlaubterweise den Rasen von Drakesden Abbey betreten hatte.
»Leg deine Gabel weg, Kind. Hast du denn keine Manieren? Weißt du nicht, wie du dich vor Höherstehenden zu benehmen hast?«
Unbändiger Zorn stieg in ihr auf. Die Erinnerung, wie ihre Mutter für die Missionarin Tee einschenkte, kam wieder in ihr hoch.
»Vor Gott sind wir alle gleich, Lady Blythe«, antwortete Thomasine entschieden. Ihr Gesicht war heiß, aber als sie wegsah, traf sich ihr Blick kurz mit dem von Lady Blythes dunkelhaarigem Sohn, und sie glaubte, weniger Kritik als Belustigung darin zu erkennen.
Diesmal lachte Daniel Gillory nicht, als ihm Thomasine erzählte, was passiert war. Er stand am Rand des Deichs und ließ flache Steine über das klare kalte Wasser hüpfen.
»Den Blythes gehören die meisten der Cottages in Drakesden«, erklärte er. »Und auch das meiste Land. Und die meisten der Farmen. Also müssen die Leute sich wohlverhalten. Wenn sie es nicht tun, haben sie sehr schnell keine Arbeit und kein Dach mehr über dem Kopf. So ist das hier nun mal.«
»Und dein Cottage, Daniel?«
»Unser Cottage – und das Land – gehört meiner Mutter. Ihr Großvater hat es den Blythes für ein paar Scheffel Kartoffeln abgekauft. Im Frühjahr steht es immer unter Wasser, wahrscheinlich haben sie es deswegen abgegeben.« Er begann, über den Deich zu wandern, Thomasine folgte ihm. »Deswegen will ich die Schule weitermachen. Wenn ich mein Abschlußdiplom schaffe, muß ich nicht für die Blythes und nicht für meinen Vater arbeiten.«
»Willst du denn kein Schmied werden?« fragte Thomasine überrascht. Ihr gefiel die Esse – die Pferde, das Zischen, wenn das heiße Metall ins Wasser getaucht wurde.
»Mein Vater verprügelt mich«, antwortete Daniel schlicht.
Thomasine wußte, daß Jack Gillory zuviel trank – das ganze Dorf wußte das –, und sie hatte Daniel häufig mit einem blauen Auge oder einer aufgeplatzten Lippe gesehen. Als sie im vorigen Sommer zusammen im Mühlteich schwammen, hatte sie rote Striemen auf seinem Rücken entdeckt. Wieder kam Wut ihr hoch.
»Was möchtest du einmal werden, Thomasine?« fragte Daniel.
»Tante Hilly möchte, daß ich Lehrerin werde. Sie meint, ich sei gut in Mathematik. Tante Rose glaubt, daß ich heiraten werde.«
Keine der beiden Möglichkeiten fand sie besonders reizvoll. Sie konnte Daniel Gillory, der in den Fens geboren war, nicht erklären, daß die Landschaft sie zuweilen einengte und sie sich regelrecht eingekerkert fühlte. Daß ihr die Enge des Dorflebens mit seinen starren Klassenschranken lästig war. Daß sie sich manchmal nach Hügeln, Farben und Musik sehnte.
»Vielleicht gehe ich auch zu meiner Tante Tony«, fuhr sie, einen geheimen Traum aussprechend, fort. »Sie hat eine Tanzschule in London. Letztes Jahr hat sie mich in ein Ballett im Alhambra-Theater mitgenommen, Daniel. Es war herrlich, absolut wunderbar.«
Der Sommer 1914 war seltsam, denn Thomasine schwankte ständig zwischen Hochstimmung und abgrundtiefer Langeweile. Die Unterrichtsstunden bei Hilda, die sie früher genossen hatte, empfand sie manchmal als lähmend, und die Abende, an denen sie nicht ausritt oder sich mit Daniel traf, kamen ihr quälend lang vor. Sie hatte alle Bücher in Quince Cottage und alle interessanten Werke aus der Leihbibliothek in Ely gelesen.
Innerhalb der Dorfgesellschaft war sie isoliert. Die Dorfkinder hatten ihr anfängliches Mißtrauen gegen sie nie ganz abgelegt, und ihre Altersgenossen waren inzwischen in Stellung oder arbeiteten auf dem Feld. Nur Daniel konnte sie als Freund ansehen, weil auch er sich wegen seines Stipendiums von seinen Kameraden unterschied. Obwohl sie ihre Tanten allmählich liebgewonnen hatte, erschien ihr deren Leben als ledige Frauen besonders eingeschränkt. Einmal stritt sie sich sogar mit Hilda und fragte, warum ihre klügste Tante nicht Lehrerin oder Krankenschwester geworden war, statt sich in Drakesden einzumauern.
»Weil mein Vater fand, daß Frauen nicht arbeiten sollten«, antwortete Hilda ruhig, »und da Rose und ich nicht geheiratet haben, waren wir gezwungen, bei ihm zu leben.« Nur Patricia und Antonia waren entkommen, durch Heirat.
Aber dennoch, wenn sie ritt, durch die Felder wanderte oder sich in ein wirklich gutes Buch vertiefte, war sie vollkommen zufrieden.
Am Pfingstfest, als Thomasine mit den übrigen Dorfbewohnern in einem großen Kreis tanzte, als alle sich umeinander herumschlängelten wie Bänder an einem Maibaum, war sie glücklich.
Zu Thomasines fünfzehntem Geburtstag, Ende Juni, buk Tante Rose einen Kuchen mit rosafarbenem Zuckerguß, und Tante Hilly schenkte ihr einen Band mit Housmans Gedichten. Nachdem Thomasine mit den Haushaltsabrechnungen fertig war (was während der folgenden zwei Jahre zu ihren festen wöchentlichen Aufgaben zählte), das Gemüsebeet gegossen und ein Stück des rosaglasierten Kuchens gegessen hatte, spazierte sie aus dem Dorf hinaus und dann den Weg entlang zu der Stelle, an der sie mit Daniel verabredet war.
Sie hatte den Pfarrer nicht gebeten, ihr sein Pony zu leihen, weil sie das neue Kleid trug, das sie gemeinsam mit Tante Rose genäht hatte. Das Kleid aus weißem Musselin mit blaßblauer Schärpe war zum Reiten nicht geeignet. Auch ihr Haar war auf andere Weise frisiert, anstatt zu Zöpfen geflochten, wurde es von einem breiten blauen Band im Nacken zusammengehalten. Auf dem Deichweg achtete sie auf ihre Schritte und vermied es, in den schlimmsten Schlamm zu treten.
Als sie das Getrappel von Pferdehufen hörte, blickte sie auf und erwartete Daniel zu sehen, der ein frisch beschlagenes Pferd zu einem Farmer zurückbrachte. Aber es war nicht Daniel, der den Weg entlangsprengte, sondern Nicholas Blythe. Sie trat zur Seite, um ihn vorbeizulassen, aber er zügelte sein Pferd, und Gras und Schlamm spritzten auf.
»Ach, Miss Thorne. Es tut mir furchtbar leid. Ich hab Sie nicht gesehen. Hab ich Sie erschreckt?«
Thomasine schüttelte den Kopf. »Überhaupt nicht.« Sie sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Nicholas Blythe und sein älterer Bruder Gerald hielten sich für gewöhnlich von April bis August nicht in Drakesden auf. »Ich dachte, Sie wären in der Schule, Mr. Blythe.«
»Ich war krank. Windpocken. Und soll in Quarantäne bleiben. Gerry hatte sie vor ein paar Jahren, deshalb ist er noch in Winchester, der arme Teufel. Im Moment ist es nur verdammt langweilig in der Abbey – Mama, Pa und Marjorie sind in London, also sind nur Lally und ich zu Hause.«
»Was für ein hübsches Pferd.« Thomasine streichelte die schwarzen samtigen Nüstern.
»Es heißt Titus. Reiten Sie, Miss Thorne?«
Sie nickte und holte ein paar Zuckerstücke aus ihrer Tasche, die sie immer bei sich trug. Das samtige Maul des Pferdes rieb sich an ihrer Handfläche.
»Mr. Fanshawe leiht mir sein Pony.«
»Ach – dieses alte Ding. Das kann doch höchstens im Trab gehen, außer man würde eine Kanone hinter ihm abfeuern.«
Thomasine grinste und sah zu ihm auf. Nicholas hatte dunkles Haar, dunkle Augen, und sein Gesicht war wie gemeißelt. »Bluebell ist schon eine Transuse«, gab sie zu.
»Sie sollten vielleicht einmal eines der Pferde aus der Abbey probieren, Miss Thorne.«
Thomasine hatte Daniel entdeckt, der vom Haus des Schmieds über den Weg auf sie zurannte.
»Morgen abend?« fügte Nicholas hinzu. »Auf der Wiese beim Wäldchen?«
Überrascht sah sie ihn wieder an. Vielleicht langweilte sich Nicholas Blythe auch, dachte sie. Die Aussicht auf neue Gesellschaft und einen Ritt auf einem der hervorragenden Pferde der Abbey war unwiderstehlich. »Das wäre herrlich. Aber Daniel kann doch auch mitkommen, Mr. Blythe?«
Daniel lief langsamer und schlurfte mit den Füßen, als er näher kam. Ein Stück weit entfernt von ihnen blieb er stehen und neigte fast unmerklich den Kopf vor Nicholas Blythe.
»Natürlich. Also bis dann«, sagte Nicholas zu Thomasine. »Bis morgen.« Er gab seinem Pferd die Sporen und galoppierte davon.
»Hast du das Boot bekommen?« fragte Thomasine, als sie und Daniel allein waren.
Zu ihrem Geburtstag hatte Daniel versprochen, Mr. Naylors flachkieliges Boot auszuleihen, damit sie den Fluß weiter erkunden konnten. Daniels Antwort bestand nur aus einem Brummen und Achselzucken. Schweigend marschierte er vor ihr den Weg entlang.
Sie wußte, daß er manchmal launisch und reizbar war, und führte das auf seine langen Arbeitsstunden zurück: den fünf Meilen langen Schulweg, die Stunden nach der Schule in der Schmiede. Sie rannte, um ihn einzuholen. Schließlich sagte er: »Ich wußte nicht, daß du mit Nicholas Blythe auf so vertrautem Fuß stehst.«
»Das tue ich nicht. Bis zum heutigen Tag hab ich kaum mehr als ein halbes Dutzend Worte mit ihm gewechselt. Er hat sich nur entschuldigt, daß er mich fast über den Haufen geritten hätte.«
Schließlich blieb er stehen, und sie schüttelte ihn leicht am Arm. »Ach, Daniel, sei nicht eingeschnappt. Nicht heute.«
Ihre Blicke trafen sich einen Moment lang, dann griff er in die Tasche und zog etwas heraus.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, sagte er.
Als sie das Seidenpapier aufwickelte, fand sie eine filigrane Brosche in Form eines Schmetterlings darin. »Sie ist nicht neu«, sagte Daniel schnell. »Ich hab sie auf dem Markt in Ely gekauft. Aber sie ist schon in Ordnung, denke ich?«
Es war das erste Mal, daß jemand, der kein Verwandter war, ein Geschenk für sie gekauft hatte. »Sie ist wundervoll, absolut wundervoll, Daniel«, sagte sie und ließ sich die Brosche von ihm an die Bluse stecken.
Nicholas Blythe wartete bereits auf der Wiese, als Thomasine und Daniel am nächsten Abend dort ankamen. Er saß auf dem riesigen schwarzen Hengst, den er am Vortag geritten hatte, und hielt ein weiteres Pferd an einem langen Zügel.
»Ich hab die beiden Rappen mitgebracht«, sagte er. »Der hier heißt Nero. Nach dem römischen Kaiser, weißt du«, fügte er an Daniel gewandt hinzu.
Daniels Gesicht verfinsterte sich, aber er erwiderte nichts.
»Darf ich Ihnen hinaufhelfen, Miss Thorne? Ich schätze, Sie wollen keinen Damensattel wie Marjie und Mama?«
Thomasine schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht. Und nennen Sie mich Thomasine, nicht Miss Thorne.«
Von Neros hohem Rücken aus ergab sich ein neuer und aufregender Blick auf Drakesden. Die Wiese schmiegte sich an den niedrigsten Hang der Insel, auf der Drakesden Abbey erbaut war. Es war natürlich keine richtige Insel, nur ein niedriger Hügel aus vergleichsweise festem Grund in diesem Meer aus schwarzem Torf, aus dem die Fens zum größten Teil bestanden. Zwischen der Wiese und den Mauern, die Drakesden Abbey umgaben, befand sich ein Wäldchen, eine der wenigen bewaldeten Stellen in einer Landschaft, in der es wegen der strengen Winter kaum Bäume gab.
Thomasine trabte mit Nero an der Umzäunung der Wiese entlang, dann ließ sie ihn in Galopp fallen. Das Tempo war belebend. Die Bäume und die Blumenteppiche entlang der Wiese verschwammen ineinander. Als sie den Hengst schließlich zum Stehen brachte, lachte sie.
»Das war herrlich!«
»Du warst herrlich.« Nicholas streckte die Hand aus, um Thomasine aus dem Sattel zu helfen. »Willst du auch mal, Gillory?«
Daniel kletterte in den Sattel. Nicholas rief: »Er ist ein Springer, Gillory!«, und Daniel lenkte das Pferd in die äußerste Ecke des Felds und drückte ihm die Fersen in die Flanken. Der Hengst wurde schneller und schneller, das Geräusch der Hufe klang wie Donner. Dann erhoben sich Pferd und Reiter in die Luft und sprangen behend über den Zaun hinweg.
Nicholas ritt durch den Wald nach Hause. Die Bäume verdeckten den blaßblauen Himmel. Die Pferdehufe zerdrückten den Bärlauch entlang des Pfads, der einen betäubenden Geruch verströmte. Das Sonnenlicht, das durch die Bäume fiel, warf goldene Streifen auf das Unterholz.
Noch immer spürte er die Berührung von Thomasines Hand. Es war seltsam, wie lange das Gefühl anhielt, als hätte sich der Druck ihrer Finger für immer in seine Handflächen eingeprägt, nachdem er ihr aus dem Sattel geholfen hatte. Als erinnerte sich seine Haut an die ihre. Dergleichen hatte er noch nie erlebt. Er wußte, daß einige seiner Schulkameraden in ähnlicher Weise auf ältere Jungen reagierten, aber Nicholas, der sich an die jedes Semester wiederholten Warnungen seines Hausvorstehers im Internat erinnerte, hatte derlei Gefühle schon immer verachtet.
Er hörte ein Rascheln im Unterholz und sah auf. Als er in die Dunkelheit spähte, sah Nicholas zwei runde schwarze Augen, ein kleines weißes Gesicht und dicke schwarze Zöpfe. »Lally.«
Zögernd stand seine jüngere Schwester auf. Ihre weiße Bluse war mit grünen Flecken übersät und der Saum ihres Rocks beschmutzt.
»Was machst du hier?«
»Dich beobachten.«
Nicholas starrte sie an.
»Dich beobachten«, wiederholte sie, »und Miss Thorne und Daniel Gillory.«
»Du warst die ganze Zeit hier?« fragte Nicholas überrascht.
»Ich war hinter dem Baum. Ich hab alles gesehen. Du hättest mich mitnehmen sollen. Es ist nicht nett, Leute so lange allein zu lassen.«
»Es ist nicht nett«, antwortete Nicholas kühl, »sich heimlich anzuschleichen. Zu spionieren. Im Krieg werden Spione erschossen – hast du das gewußt, Lally?«
Er bemerkte, wie sie sich mit aufgerissenen Augen ängstlich im Wald umsah. Dann steckte sie schnell den Daumen in den Mund. Obwohl sie fast dreizehn war, vier Jahre jünger als Nicholas, kam sie ihm zuweilen noch wesentlich kindlicher vor. Wie ein Baby, das Kleinste, kaum dem Kinderzimmer entwachsen. Einen Moment lang wünschte er sich, seine Mutter wäre zurück, um Lallys kränkliches Kindermädchen aus dem Bett zu scheuchen, um mit ihren Wutanfällen fertig zu werden und ihr zu sagen, sie solle nicht am Daumen lutschen. Aber dann fiel ihm ein, daß er seine Zeit sicherlich nicht mit Thomasine Thorne verbringen dürfte, wenn seine Mutter hier wäre. Plötzlich war Nicholas sehr froh, daß Sir William und Lady Blythe in London weilten, um alles für die Vermählung seiner älteren Schwester vorzubereiten.
Eine Woche später trafen sie sich wieder auf der Wiese. Diesmal ritt Thomasine Bluebell, das Pony des Pfarrers, und Daniel hatte sich Nero geliehen. Die drei trabten von der Wiese auf den Weg hinaus. Ganz instinktiv mieden sie das Dorf und die Farmen, ohne sich darüber absprechen zu müssen.
Wagenräder hatten tiefe Furchen in den Weg gegraben. Am Ende von Potters Field sagte Nicholas: »Komm, Gillory. Wir machen ein Rennen bis zum Deich.«
Dann waren sie fort. Im aufgewirbelten Staub der Hufe trabte Bluebell träge hinterdrein. Das abendliche Sonnenlicht glänzte auf dem schwarzen Fell der Hengste und auf den unbedeckten Köpfen der Jungen. Sie verschmolzen ineinander, zwei dunkle Umrisse, die in dem aufstiebenden Sand zu einem Bild verschwammen. Dann erreichten sie den Deich und zeichneten sich als zwei schwarze Silhouetten vor dem Himmel ab.
Thomasine holte sie ein. »Also? Wer hat gewonnen?«
Daniel grinste und entblößte weiße, ebene Zähne. »Ich.«
Nicholas war von seinem Pferd gestiegen und saß auf dem Damm. »Mist«, sagte er. »Absoluter Mist. Um eine Nasenlänge geschlagen, verdammt.«
Er lehnte sich auf die Ellbogen gestützt zurück und streckte die langen Beine aus. »Wenn man so reitet, vergißt man alles andere, stimmt’s? Nichts sonst scheint wichtig zu sein.« Er sah weder Daniel noch Thomasine an, sondern blickte auf den wolkenlosen leeren Horizont hinaus. »Wenn der Krieg lange genug dauert«, fügte er hinzu, »gehe ich zu einem Kavallerieregiment. Gerald kann sich gleich melden, der Glückspilz. Er ist gestern neunzehn geworden.«
Thomasine starrte ihn an. Erst heute morgen hatten sie und Tante Hilly Zeitungen und Atlanten studiert. Unsicher sagte sie: »Das betrifft doch sicher nicht uns? Großbritannien wird doch sicher nicht hineingezogen?«
»Kommt darauf an, ob Deutschland die belgische Neutralität respektiert«, warf Daniel ein. »Wenn nicht …«
»Wenn nicht«, fuhr Nicholas fort, »dann werden wir gegen die Deutschen kämpfen. Das wird ein Heidenspaß. Aber das geht euch Mädels nichts an.«
Er rollte sich auf den Bauch. »Schau nicht so bedrückt, Thomasine. Ich hab Durst, du nicht? Ich hätte Limonade mitbringen sollen. In der Küche der Abbey gibt’s Krüge davon. Ich sag dir was – warum kommst du morgen abend nicht in die Abbey rauf? Ich kann dir die Gärten zeigen. Hättest du Lust dazu?«
Sie erinnerte sich an das Haus, das sie nur einmal kurz gesehen hatte und das durch Mauern vom übrigen Drakesden abgeschlossen war. An die geheimnisvollen Fenster, an das Gefühl, daß diese Gemäuer nur den auserwählten wenigen zugänglich waren. Sie brauchte Abwechslung, andere Orte, andere Leute.
»Lust? Liebend gern, Nicholas.«
Daniel saß mit dem Rücken zu ihnen und ließ die Beine über den Deichrand baumeln. Thomasine berührte Nicholas’ Hand und sah verstohlen zu Daniel hinüber.
»Du natürlich auch, Gillory«, sagte Nicholas.
Nicky war ausgegangen, und Miss Hamilton lag im Bett, daher war Lally wieder sich selbst überlassen und wanderte ziellos im Haus herum. Sie bildete sich ein, jetzt die Herrin von Drakesden Abbey zu sein. Mama und Papa waren mit Marjorie in London, Gerald war noch in der Schule, Nicky ausgegangen, und Miss Hamilton, Lallys Erzieherin, lag mit Kopfschmerzen im Bett. Niemand sagte Lally, was sie zu tun hatte.
Aber Freiheit erwies sich als überraschend langweilig. Sie las nicht gern, sie nähte nicht gern, und sie fürchtete sich vor Pferden. Aus der Bibliothek schlenderte sie zum Arbeitszimmer ihres Vaters. Gerade als sie die Klinke herunterdrücken wollte, hörte sie Stimmen aus dem Innern. Zuerst die Stimme eines Mannes und dann helles Lachen. Einbrecher, dachte Lally erschrocken. Der Safe befand sich in Sir Williams Arbeitszimmer, und im Safe befanden sich Lady Blythes Juwelen und natürlich der Feuerdrachen. Lally mochte den Feuerdrachen. Gelegentlich nahm ihn Papa aus dem Safe, und sie durfte ihn halten. All ihren Mut zusammennehmend, kauerte sich Lally nieder und spähte durchs Schlüsselloch.
Mit zusammengekniffenen Augen erkannte sie das Hausmädchen Ethel. Ethel lachte, ein hohes, dünnes Kichern, das in das dunkle, ernste Arbeitszimmer nicht zu passen schien. Ethel saß auf dem Rand von Sir Williams Schreibtisch, ihre schwarzen Knopfstiefelchen schwangen langsam hin und her.
Ganz vorsichtig drückte Lally die Klinke herunter und spähte durch den Spalt. Sie erkannte Francis, den zweiten Diener. Er stand vor Ethel. Ethel hatte zu kichern aufgehört und sagte: »Nein, Frank, das darfst du nicht.« Aber sie hörte sich nicht ärgerlich an.
Lally brauchte eine Weile, bis sie begriff, was sie machten. Dann sah sie, daß sie sich küßten. Sie hatte noch nie zuvor Leute gesehen, die sich so küßten. Ihre Münder schienen aneinanderzukleben. Ethel gab komische stöhnende Laute von sich, und ihre Augen waren geschlossen. Francis hatte eine Hand auf ihren Rücken gelegt und zog sie an sich. Mit der anderen schob er ihre Röcke über die Knie hinauf. Lally sah das Ende von Ethels dicken schwarzen Strümpfen und das Stück weiße Haut darüber. Heimlich beobachtete sie die beiden weiter. Sie wußte, daß sie alle drei etwas Verbotenes taten. Die beiden mit ihrer komischen Küsserei im Arbeitszimmer ihres Vaters und sie, indem sie zusah. Lally wußte, daß sie sich schämen sollte. Aber das tat sie nicht. Während sie zusah, stellte sie nur fest, daß sie sich zumindest nicht langweilte.
Sie trafen Nicholas am Seitentor von Drakesden Abbey. Als sie durch das Tor ging, wußte Thomasine, daß sie eine andere Welt betrat. Der Blick durch den Obstgarten, seine starken Düfte nahmen ihr einen Moment lang den Atem. Als wäre sie an eine dünnere, einfachere Luft gewöhnt; als könnten ihr die Schönheit und der Überfluß von Drakesden Abbey die Sinne rauben.
Die Bäume waren dicht belaubt und trugen schwer an Früchten. Entlang der Gartenmauer rankten sich Obstspaliere. Schmetterlinge tanzten in der heißen, dunstigen Luft.
»Es gibt Äpfel, Birnen, Pflaumen, Reineclauden, Mispeln und Quitten«, sagte Nicholas beiläufig. »Ich glaub, das ist alles.«
»Und Kirschen«, sagte Daniel.
»Natürlich. Kirschen.« Nicholas ging durch den Obstgarten und schlug die hohen Grasbüschel mit einem Stock beiseite. »Und kleine Schwestern …«
Nicholas blieb stehen und hielt den Stock still. Thomasine sah eine Gestalt am Rand des Gartens auftauchen. Ein junges Mädchen kam auf sie zu.
»Hallo, Lally«, sagte Nicholas gereizt.
Sowohl die Ähnlichkeiten wie die Unterschiede zwischen den Geschwistern waren sehr ausgeprägt. Beide hatten dunkles Haar, dunkle Augen und regelmäßige Züge. Aber Lallys Mund bog sich nach unten und ihr Gesicht war eine rundere, weichere Version von dem ihres Bruders.
»Ist es nicht Zeit für dich, ins Bett zu gehen, Kleine?«
»Miss Hamilton macht ein Nickerchen, und ich fühlte mich so einsam«, erwiderte Lally Blythe mit zitternden Lippen.
Thomasine hatte Mitleid mit ihr. Das riesige Haus, die Mutter seit Wochen fort. Die Haut des Kindes war blaß, fast durchsichtig, um seine Augen zeichneten sich dunkle Ringe ab.
»Laß mich bleiben, Nicky, bitte.«
Nicholas seufzte. »Also gut, du Nervensäge. Wenn du dich benimmst.«
Lally stieß einen Freudenschrei aus und hängte sich bei Nicholas ein. Sie durchstreiften den Obstgarten und kamen in den Küchengarten mit den ordentlich angelegten Kohl- und Karottenbeeten, ganz ohne Unkraut und Schädlinge.
»Wir zeigen ihnen das Labyrinth, sollen wir, Lally?«, sagte Nicholas und ging voran. Drakesden Abbey, dessen Mauern mit purpurnen Glyzinien überwuchert waren, lag auf der einen Seite, auf der anderen fiel die Insel zum Deich hin ab. Das Labyrinth war vom übrigen Garten durch hohe Mauern und große Flieder-, Goldregen- und Ligusterhecken abgetrennt. Die Pfade waren schmal, mit Gras bewachsen und mit Farn und Spierstrauch gesäumt. Schritte und Stimmen konnte man in dem Irrgarten nur gedämpft hören, auch die Abendsonne drang nicht hindurch. Man hatte das Gefühl, unter der Erde zu sein, fand Thomasine, wie in einem wirklichen Labyrinth.
Auf der Hälfte eines Pfads blieb Nicholas vor einer Tür in der Mauer stehen und schob einen Efeuzweig von der Klinke. Qietschend sprang die Tür auf.
»Das war der Lieblingsgarten meines Großvaters.«
Die drei Blumenbeete in dem ummauerten Garten waren dicht mit Rosen bewachsen. Hier war es windstill, und die hohe verwitterte Ziegelmauer hielt außer dem Summen der Bienen alle Geräusche ab. Am Ende der drei Wege sah man gewölbte Nischen, in denen drei Statuen standen. Thomasine warf einen Blick auf diejenige, die am nächsten bei ihr stand. Eine Frau und ein Vogel. Die Frau war nackt.
»Leda und der Schwan«, sagte Thomasine. Zeus umarmte Leda. Die steinernen Federn und das gelockte Haar verschlangen sich im Schatten der Mauer ineinander.
»Und da ist Daphne«, sagte Nicholas. Daphne, um deren Fingerspitzen sich Blätter wanden, drückte sich verschämt in die hinterste Nische.
»Mama findet sie furchtbar unanständig. Vielleicht ein wenig dürftig bekleidet für englische Sommer.« Nicholas machte eine wegwerfende Handbewegung. »Und da, in der Mitte, ist unser geliebter Feuerdrachen.«
Durch die Rosenranken waren sie zu der mittleren Nische gegangen, in der ein Drachen stand, aus dessen steinernem Maul Wasser tropfte. Farne überwucherten den grünen Stein und hielten das Wasser fest.
Über der Statue konnte man ein Wappen erkennen, das gleiche, das in die Wand der Kirche von Drakesden eingelassen war. »Unser Emblem«, sagte Nicholas. »Früher haben wir in der Schlacht Fahnen mit Feuerdrachen getragen. Elisabeth I. schenkte dem ersten Sir Nicholas Blythe einen Feuerdrachen, um sich für ein schönes Wochenende zu bedanken. Eine Anspielung, verstehst du, Thomasine, weil den Blythes Drakesden gehörte. Ein Feuerdrachen ist eine Drachenart. Oder ein Meteor, wie Pa sagt.«
»Oder ein Irrlicht«, sagte Daniel.
»Wirklich? Dann paßt es ja sehr gut. Das am tiefsten liegende Land ist manchmal voller Irrlichter. Irgendeine Art Gas, wie mein Hausvorsteher im Internat sagt.«
»Marschgas«, sagte Daniel. »Methan.«
»Er ist in Vaters Arbeitszimmer, im Safe«, warf Lally ein.
Thomasine wollte kichern. Nicholas erklärte gequält: »Das Dummchen meint nicht etwa, daß das Arbeitszimmer meines armen alten Vaters voller widerlicher Dämpfe ist, sondern daß sich dort das Original des Feuerdrachens befindet. Es ist eine Brosche oder so was. Ziemlich scheußlich, deshalb trägt Mama sie nie. Los, Kleine, jetzt fort mit dir, sonst sucht dich Miss Hamilton.«
»Das ist ungerecht, Nicky.« Lally sah ihn wütend an, begann sich aber schlurfenden Schritts in Richtung Tür zurückzuziehen. Halbherzig drückte sie die Klinke herunter. »Ich kann sie nicht aufmachen.«
Nicholas seufzte erneut. »Würdest du …?« fragte er Daniel.
Daniel hielt Lally die Tür auf. Als sie sich wieder geschlossen hatte, zog Nicholas zwischen dem üppigen feuchten Farn hinter dem Feuerdrachen etwas heraus und hielt eine Weinflasche hoch.
»Ich hab keine Gläser, fürchte ich, aber wir können ja die Flasche herumgehen lassen, oder?«
Anfang August wurde es heißer und schwüler, und der dunstige blaßblaue Himmel blieb bis weit in den Abend hell. Sie ritten oft aus, und einmal spielten sie im Garten von Drakesden Verstecken, um Lally zu beschwichtigen. Thomasine versteckte sich in einem Buchsbaum und hielt den Finger vor den Mund, um Daniel zu bedeuten, er solle leise sein, als er einen Zweig wegschob und sich ebenfalls hineinzwängte. Er zog den Kopf ein und setzte sich neben sie auf einen knorrigen Ast.
»Du hast deinen Rock zerrissen.«
Thomasine sah schuldbewußt auf den langen Riß in dem marineblauen Serge-Stoff. »Ich bin an einem Zweig hängengeblieben. Ich muß ihn stopfen, bevor Tante Hilly es bemerkt.«
Die Zweige des Buchsbaums bewegten sich erneut, und Nicholas tauchte auf.
»Da seid ihr ja. Ich hab euch überall gesucht.« Nicholas kroch hinein. Er war zu groß, um im Innern stehen zu können. Es gab nicht genügend Platz, um sich neben Thomasine und Daniel zu setzen, also kauerte er sich unbequem zusammen und wischte sich mit dem Taschentuch über die Stirn.
»Also wirklich! Mir reicht’s jetzt. Es ist einfach zu heiß.«
»Wo ist Lally?« fragte Thomasine. »Sie sucht uns seit einer Ewigkeit.«
Vom Kiesweg war das Geräusch schlurfender Schritte zu hören.
»Wo seid ihr? Kommt raus! Ich kann euch nicht finden!«
Nicholas seufzte und verdrehte die Augen.
»Vielleicht sollten wir …« Daniel hatte sich erhoben. »Schließlich ist sie noch ein Kind.«
Lallys Klagen wurden immer lauter.
»Hier drinnen, Dummkopf«, rief Nicholas.
Rot vor Hitze und Wut erschien Lallys kleines rundes Gesicht zwischen den Buchsbaumblättern. »Das ist nicht fair, Nicky. Das ist zu schwierig.« Lallys Klagen begannen in Schluchzen überzugehen.
Schnell erwiderte Daniel: »Vielleicht ein anderes Spiel, was meinst du?«
Nicholas seufzte erneut und zwängte sich aus dem Buchsbaum hinaus. Thomasine folgte ihm. Grelle Sonnenstrahlen und Hitze trafen sie, als sie den kühlen Schutz der Blätter verließ. Langsam gingen sie zu dem ummauerten Garten zurück, wo sie sich ins Gras fallen ließen. Lally zog an Nicholas’ Hand.
»Ein Pfänderspiel, Nicky – laß uns ein Pfänderspiel spielen.«
Nicholas stöhnte. »Gräßliches Weihnachtsspiel …«
»Ich zuerst«, sagte Lally. »Frag mich zuerst was, Nicky.«
Nicholas lehnte sich ins Gras zurück. »Also … zähl mir die Namen der Tudor-Könige und -Königinnen auf. Alle.«
»Oh, das ist gemein! Das kann ich nicht. Du weißt, daß ich mich in Geschichte nicht auskenne, Nicky!«
»Du hast seit Jahren eine Gouvernante«, antwortete Nicholas ungerührt.
Lally verzog das Gesicht. »Elisabeth«, begann sie. »Und Heinrich …« Unsicher sah sie Nicholas an. »Acht Heinriche …«
Nicholas stöhnte. Daniel flüsterte: »Zwei.«
»Ich meine, zwei Heinriche.« Lally sah zu Daniel hinüber. »Und … und …«
»Mary und Edward«, murmelte Daniel.
»Mary und Edward«, plapperte Lally triumphierend nach. »Ich muß kein Pfand geben, nicht wahr?«
»Nein, wohl nicht. Stell lieber jemand anderem eine Frage. Frag Thomasine, Lally.«
Ein Ausdruck äußerster Konzentration trat auf Lallys kleines Gesicht. »Du mußt mir den Namen von Marjories Verlobtem sagen.«
»Ach, zum Teufel, Lal. Wie um alles in der Welt soll Thomasine den wissen?«
»Ich hab nicht die geringste Ahnung. Macht aber nichts. Sag mir, was ich tun soll, Lally.«
Es folgte eine lange Pause. Dann sagte Lally: »Ich möchte, daß du auf den Springbrunnen in der Mitte des Teiches kletterst.«
»Mach dich nicht lächerlich, Kleine. Der Teich ist ziemlich tief, und sie würde ganz naß werden.«
Thomasine war bereits aufgesprungen. »Das macht mir nichts aus.«
Der Springbrunnen, der in einem großen Teich stand, befand sich in der Mitte einer Rasenfläche hinter dem Haus. Als sie über den Rasen lief, blickte Thomasine zum Haus hinauf und sah die verhängten Fenster, die wie eine Vielzahl geschlossener Augen aussahen.
Nicholas war an ihrer Seite. »Welches ist dein Zimmer?« flüsterte sie.
»Das da«, antwortete er, auf eines deutend. »Über dem Wintergarten. Möchtest du … das Haus ansehen?« Seine Stimme klang beiläufig. »Komm morgen vormittag. Nur du allein. Ich führ dich herum.«
Lally rief: »Erfüllst du deine Aufgabe nicht?«
Thomasine streifte ihre Stiefel und Strümpfe ab und raffte ihren Rock. Das Wasser fühlte sich herrlich kühl an. Karpfen schossen zwischen den Lilienkissen hindurch wie Goldpfeile. Bald reichte ihr das Wasser bis über die Knie, dann bis zum Rocksaum und schließlich bis zu den Schenkeln. Der Brunnen war ein überladenes Barockkunstwerk mit vielen Putti und Delphinen, dessen bogenförmige Fontänen in allen Regenbogenfarben glitzerten.
»Das reicht schon, Thomasine! Du hast es getan«, rief ihr Nicholas über den Teich zu.
»Nein, das hat sie nicht. Ich hab gesagt, sie muß auf den Brunnen klettern, und sie hat gesagt, sie tut es.«
Thomasine holte tief Luft, schloß die Augen und ging weiter. Das Wasser des Springbrunnens sprühte ihr auf Gesicht, Brust und Schultern. Aber sie streckte die Hand aus, ertastete den glitschigen Stein und kletterte, mit bloßen Füßen auf dem Granit Halt suchend, triumphierend nach oben.
Nicholas stieß einen Siegesschrei aus, aber Daniel sprang ins Wasser und lief, durch Goldfische und Lilien planschend, auf sie zu. Mit einem Rutsch purzelte sie vom Brunnen in seine Arme. Er senkte kurz den Kopf, und seine Lippen strichen über ihre Stirn, so flüchtig, daß sie nicht wußte, ob die Berührung zufällig gewesen war. Sie schlang die Hände um seinen Hals, und beide wateten durch den Teich zurück. Durchnäßt und lachend ließen sie sich ins Gras fallen. Thomasine wrang ihren Rock aus.
»Ich hab eine Aufgabe für dich, Gillory. Ich möchte, daß du auf der Mauer beim Labyrinth entlanggehst«, sagte Nicholas kalt.
Mit einem Schlag erstarb das Lachen. »Du hast Daniel keine Frage gestellt«, sagte Thomasine. »Und die Mauer ist zu hoch, zu schmal und zu gewunden.«
»Deshalb wird sie ja auch als Serpentinenmauer bezeichnet«, antwortete Nicholas hochmütig. Er hatte sich bereits angeschickt, vom Teich in Richtung Labyrinth zu gehen.
Daniel lief den Hang hinunter Nicholas nach. Thomasine stand rasch auf. Mit dem Daumen im Mund und einem lauernden Gesichtsausdruck trottete Lally gemächlich hinter den beiden Jungen drein.
Daniel war bereits barfuß und warf seine Stiefel an einem Ende der Mauer ab. Eine der Sohlen hatte sich gelöst, und das Leder klaffte auf wie ein geöffneter Mund. Die Mauer war über zwei Meter hoch, stark gewunden und aus den blaßgelben Ziegeln der Fens gebaut. Als Daniel in den Efeu griff, riß er ab, und feiner Zementstaub rieselte aufs Gras.
»Du mußt eine Spitzbubenleiter für mich machen.«
Nicholas lehnte sich mit dem Rücken an die Mauer und verschränkte die Finger. Daniel stieg auf seine Hände und zog sich, mit den Füßen über die Ziegel scharrend, hinauf. Aufrecht stand er auf der Mauer und begann vorwärts zu gehen.
»Komm schon, Gillory«, sagte Nicholas höhnisch. »Das ist ja Kriechen, nicht Gehen.«
Daniel grinste und begann zu rennen.
In ihrem nassen Kleid, im Schatten der hohen Mauer, wurde es Thomasine plötzlich kalt. Zitternd beobachtete sie, wie Nicholas und Lally den gewundenen Weg entlang der Mauer hinabliefen. Sie folgte ihnen nicht, sondern kehrte in den umfriedeten Garten zurück. Dort holte sie ihre schwarzen Florgarnstrümpfe aus ihren Stiefeln und zog sie wieder an, so daß sie an ihren feuchten Füßen festklebten. Sie hatte ihr Haarband verloren, und ihr Haar hing naß und wirr über ihren Rücken hinab. Ihr Rock war feucht, schmutzig und zerrissen. Schließlich hörte sie Lallys Stimme und spürte, wie sie eine Woge der Erleichterung überkam.
»Du bist so geschickt, Daniel. So mutig.«
Nicholas ließ sich neben Thomasine nieder. »Jetzt bin ich dran.«
»Ich hab eine Aufgabe für dich«, rief Lally. »Ich weiß, was du tun sollst, Nicky!«
»Du bist nicht an der Reihe, Lal. Du brichst die Regeln. Gillory ist dran.«
»Ich hab nichts dagegen.« Daniel schnürte seine Stiefel zu.
Lally strahlte erwartungsvoll. »Also gut. Du mußt die Person küssen, die du am liebsten magst, Nicky.«
Ein kurzes Schweigen trat ein. Dann antwortete Nicholas grinsend: »Titus ist nicht da.«
Ärgerlich erwiderte Lally: »Ich meine im Garten. Jemanden im Garten.«
Nicholas’ gebräuntes Gesicht wurde blaß. »Also wirklich. Das ist ein bißchen viel, einen Jungen zu bitten … Das geht doch nicht …«
Daniel sagte: »Ich mach’s.«
In Nicholas’ Gesicht spiegelte sich eine seltsame Mischung widerstrebender Gefühle. Ärger, Abscheu und Erleichterung. »Wenn du willst«, murmelte er.
Daniel ging zum anderen Ende des Gartens. In der ersten Nische kletterte er, mit den Zehen in dem verwitterten Stein Halt suchend, hinauf. Er umarmte Ledas üppigen Leib und küßte sie auf den Mund.
Der Anblick prägte sich Thomasine ein wie eine Fotografie. Daniel Gillory in seinen feuchten, schäbigen Kleidern, der die weißen Marmorglieder umarmte und mit dem Mund die kalten, steinernen Lippen liebkoste.
Sie gingen durch den Wald nach Hause. Thomasine folgte Daniel den schmalen gewundenen Pfad entlang. Daniel schlug mit einem Stock die Brennesseln beiseite und hielt die Äste für sie zurück. Der Wald glänzte, das Unterholz war vom Licht gesprenkelt, das durch die Blätter fiel.
Daniel nahm ihre Hand, um ihr über den Zauntritt zu helfen. Sie spürte die Wärme seiner Haut, die schwieligen Stellen an seinen Fingerknöcheln. Er hob ihre Hand und drückte die Lippen auf ihren Handrücken. Die Geste wirkte seltsam altmodisch. Das Haar war ihm ins Gesicht gefallen, Thomasine strich es zurück. Seine Haut war gebräunt, aber rauh am Kinn. Da sie von Frauen aufgezogen worden war und die meiste Zeit ihres Lebens mit Frauen verbracht hatte, verspürte sie eine heftige, mit Erregung vermischte Neugier. Als sie vom Zauntritt herunterstieg, umschlangen sie seine Arme. Seine Augen waren wie Goldsprenkel im Dunkel des Waldes, und seine Lippen berührten zart und forschend die ihren.
Dann schlug die Kirchturmuhr zehnmal, und mit lautem Flügelschlag flatterte ein Fasan aus dem Unterholz auf.
»Du kommst zu spät«, sagte Daniel. »Komm weiter.«
Thomasine hatte weder Hilda noch Rose von ihren Besuchen in den Gärten von Drakesden Abbey erzählt. Sie hatte nicht gelogen – beide Tanten nahmen schlichtweg an, daß sie diesen Sommer genauso verbrachte wie die fünf vorhergehenden: mit der Erkundung von Drakesden, seiner Felder, Wege und Flüsse. Als sie am nächsten Morgen durch das Wäldchen eilte, schob Thomasine das ungute Gefühl beiseite, daß weder Hilda noch Rose damit einverstanden wäre, wenn sie den ganzen Tag allein mit Nicholas Blythe verbrachte. Doch immer wieder spürte sie nagende Schuldgefühle in sich aufsteigen, die sich zwischen ihre Gedanken drängten.
Nicholas erwartete sie auf den Stufen zur Vorderseite von Drakesden Abbey. Er führte sie zuerst in die Halle mit der großen geschwungenen Treppe. An den Wänden reihten sich Glasvitrinen, in denen sorgfältig beschriftete Sammlungen von Muscheln, Fossilien, ausgestopften Tieren und Vögeln zu sehen waren. Die schwarzen Glasaugen der Vögel blickten Thomasine teilnahmslos an, aufgereihte tote Wesen, die nicht einmal vor dem Sonnenlicht zurückzuckten, das durch die Fenster einfiel.
»Als ich klein war, haben sie mir Angst eingejagt«, sagte Nicholas. »Vor allem der Vielfraß. Er ist inzwischen ein bißchen mottenzerfressen, das alte Ding.«
Er führte sie in den Salon. Die Wände waren korallenrot, mit Bildern behängt, die Decke blau, mit reichverzierten Kranzleisten. Der Raum war von dem Licht erfüllt, das durch die großen Fenster hereinströmte: ganz anders als die beengende Düsternis von Quince Cottage.
»Den hat jemand aus Venedig mitgebracht.« Nicholas deutete auf einen Sekretär. »Im siebzehnten – oder war es im achtzehnten Jahrhundert …?«
»Weißt du das nicht? Ich meine, deine Familie …«
Er schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus. Das kriegt alles der arme Gerry, Gott sei Dank. Komm weiter.«
Weitere Räume, jeder eine verwirrende Ansammlung von Gemälden, Verzierungen, Teppichen und dick gepolsterten Möbeln.
»Der Wintergarten«, sagte Nicholas schließlich und öffnete eine Tür.
Er zog sich über die gesamte Länge des hinteren Hauses, ein eleganter Bau aus Glas und Schmiedeeisen, mit schwarzem und weißem Marmor gefliest und mit Pflanzen überwuchert. Feuchte, erstickende Hitze herrschte darin.
»Schrecklich schwül, nicht?« Nicholas wischte sich mit dem Taschentuch über die Stirn.
Die Vegetation war üppig und exotisch. Wächserne Blüten hingen herab, die Blätter leuchteten in tiefem Dunkelgrün. Die Luft im Wintergarten war heiß und stickig, ein wenig dumpf, und vom betäubenden Duft der Blumen erfüllt.
Aufgeregt frage Nicholas: »Wie findest du’s? Gefällt es dir? Wir gehen raus, wenn du dich langweilst.«
»Ach, Nicholas. Wie könnte ich mich langweilen?« Thomasine sah sich um. »Es ist einfach wundervoll. Sieh dir das an – es ist wie, es ist wie ein Dschungel. Oder wie ein Paradies.«
Nicholas trug Reithose, Reitstiefel und ein Jackett mit Hemd und Krawatte. Sein dunkles Haar klebte von der Hitze an der Stirn. »Sollen wir hier drinnen den Lunch nehmen? Nein, viel zu heiß, findest du nicht auch? Ich würde sagen –« er sprang auf –, »wie wär’s mit einem Picknick?«
»O ja, ein Picknick wäre herrlich. Draußen ist’s viel kühler.«
Sie gingen in die Küche. Als Nicholas die Tür öffnete, erstarb mit einemmal das Schwatzen, ein geschäftiges Werken mit Töpfen und Pfannen und demonstratives Klappern der Deckel traten an seine Stelle.
»Miss Thorne und ich möchten uns gern ein Picknick herrichten lassen, Mrs. Blatch. Kaltes Hühnchen und Schinken, ein bißchen Salat und … was würden Sie zum Nachtisch vorschlagen?«
Seine Stimme hatte sich verändert, seine lockere Freundlichkeit hatte einem überheblichen Ton Platz gemacht, in dem leichte Nervosität mitschwang. Die Dienerschaft, von der viele Thomasine kannten, starrte sie mit einer Mischung aus Neugier und Ablehnung an.
»Komm mit nach oben«, schlug Nicholas vor, nachdem sie die Küche verlassen hatten. »Wir haben noch zwei Stockwerke anzusehen.«
Die Treppen waren breit und geschwungen, und an den Wänden hingen die Porträts verstorbener Blythes. Auf dem Treppenabsatz trafen sie Lally.
»Geh zurück in dein Kinderzimmer«, herrschte Nicholas sie ärgerlich an. »Du solltest doch beim Unterricht sein.«
Lally zog eine Grimasse und klammerte sich an Nicholas’ Arm. »Mir ist so langweilig, Nicky. Ich möchte mit euch gehen. Bitte, Nicky.«
»Komm, zieh Leine, Lally«, antwortete Nicholas. »Geh weg.«
Während Lally schniefend die Treppe hinunterrannte, sagte Nicholas: »Mama sollte sie zur Schule schicken. Ihre Gouvernante kriegt sie einfach nicht in den Griff.«
Sie gingen in die Bibliothek, wo schwere Vorhänge und Blenden die Bücher vor dem Sonnenlicht schützen sollten. Thomasine schlenderte von einem Regal zum anderen.
»Das würde Tante Hilly gefallen! So viele Bücher!«
Nicholas gähnte. »Ich hasse diesen Raum. Er erinnert mich an die Schule.«
Nebenan, in Sir Williams Arbeitszimmer, tanzte der Staub in den Lichtstrahlen, die durch die Lücken zwischen den Vorhängen einfielen. Nicholas drehte sich zu Thomasine um.
»Möchtest du den Feuerdrachen sehen?«
Ohne ihre Antwort abzuwarten, zog er einen Vorhang zur Seite und begann, die Kombination des Safeschlosses einzugeben.
»Ich hab meinem Vater zugesehen«, erklärte er.
Der Safe öffnete sich, und Nicholas spähte in das dunkle Innere. Thomasine sah Papierrollen mit Bändern darum und Schmuckkästchen. Nicholas griff hinein und zog etwas heraus, das in ein Samttuch gewickelt war.
»Schau«, sagte er und faltete den Stoff auf. »Es ist ziemlich grotesk, nicht? Der damalige Geschmack, denke ich. Mama trägt es nie.«
Der Feuerdrachen war eine Brosche in Form eines Drachens, dicht mit Halbedelsteinen besetzt. Thomasine betrachtete den geschwungenen Schwanz, den gebogenen Rücken, das feuerspeiende Maul und die glitzernden, bösen Augen und konnte sich nicht entscheiden, ob sie die Brosche häßlich oder schön finden sollte.
»Sie ist mehr als dreihundert Jahre alt. Halt still, Thomasine.«
Seine Hände zitterten, als er den schweren Verschluß öffnete und sie an ihr Kleid heftete. »Du siehst toll aus, Thomasine«, sagte er, »einfach umwerfend.« Nicholas’ Stimme klang seltsam, und seine Augen hatten einen ähnlichen Ausdruck wie die von Daniel, bevor er sie geküßt hatte. Schnell warf sie einen Blick auf die Uhr auf dem Kaminsims und sagte: »Es ist ein Uhr, Nick. Zeit für unser Picknick.«
Die Hitze in der Schmiede war unerträglich. Wie sein Vater war Daniel von der Taille an aufwärts nackt. Sein schweißnasses Haar klebte ihm auf der Stirn, das Wasser rann ihm den Rücken hinab. In der Ecke der Schmiede stand ein kleines Wasserfaß, aber es war lauwarm und wimmelte von Ungeziefer.
Jedes Pferd zwischen Cambridge und Ely schien an diesem Tag ein Hufeisen verloren zu haben. Daniel legte Torf aufs Feuer und hielt die Pferde still, während sein Vater fluchend hämmerte. Daniels Arme schmerzten, und seine Zunge klebte am Gaumen. Er brachte es nicht über sich, aus dem Faß zu trinken, und Harry, sein jüngerer Bruder, war noch nicht mit dem Bier, das sein Vater verlangt hatte, aus dem Otter zurück.
Daniel versuchte, sich zu konzentrieren, während er sich bemühte, das Pferd festzuhalten, aber seine Gedanken schweiften immer wieder ab. Er war wieder im Wald, Thomasine lag in seinen Armen, und er küßte sie. Er hatte bereits andere Mädchen geküßt. Im Schutz einer Scheune oder in der Stille der Felder hatte er sogar Brüste berührt oder Schenkel gestreichelt. Der Drang, weiter zu gehen als letzten Abend, zu tun, was Erwachsene taten, war fast überwältigend. Aber er war noch rechtzeitig zur Besinnung gekommen. Die Kirchenglocke hatte geschlagen, und sie war nach Hause gelaufen. Doch seine erregten Triebe hielten immer noch an und lenkten ihn ab.
Die Stute schnaubte und schlug aus, Daniels feuchte Hand glitt ab, und das Pferd traf Jack Gillory am Kinn. Daniel griff nach dem Zügel, sein Vater brüllte, und Daniel wurde hart an der Schläfe getroffen. Sterne tanzten in der Dunkelheit der Schmiede, und dissonant klingende Kirchenglocken übertönten das Schnauben des Pferdes und Jack Gillorys Flüche.
Als er wieder zu sich kam, sah Daniel, daß sein Vater mit erhobener Hand über ihm stand, um ihn erneut zu schlagen. Amo, amas, amat, dachte Daniel, der ausgestreckt am Boden lag und testete, ob sein Gehirn noch funktionierte.
Harry flüsterte mit bebender Stimme: »Mr. Green hat mir kein Bier mehr gegeben, Vater. Er meint, du sollst zuerst die offene Rechnung bezahlen.«
Daniel kam wieder auf die Beine. Sein jüngerer Bruder stand in der Tür, eine leere Flasche in der Hand. Harrys Gesicht war bleich und angstverzerrt.
Jack Gillory riß dem Kind die leere Flasche aus der Hand und schleuderte sie zu Boden. Glasscherben blitzten im Licht der Feuers auf, und die Stute schlug erneut aus. »Lauf«, flüsterte Daniel Harry zu. Harry ließ sich das nicht zweimal sagen. Mit seinen bloßen Füßen Staubwolken aufwirbelnd, rannte er über den Hof davon. Etwas lief seitlich über Daniels Gesicht hinab, und als er die Hand zur Stirn hob, waren seine Fingerspitzen rot.
Auf Jack Gillroys Kinn war ein blauer Fleck in Form eines Pferdehufs. Jack trank einen Schluck aus dem Faß und drehte sich zu Daniel um. Seltsamerweise lächelte er.
»Die Sache ist die, Junge: Es gibt genug Arbeit für zwei. Ich verdiene kein Geld, verstehst du?«
Der Schweiß auf Daniels Gesicht wurde kalt. Er sagte nichts.
»Ich finde, die Schmiede braucht uns beide. Und zwar ständig.«
Daniel blinzelte. Eine Ader pulsierte an seiner Schläfe. »In den Ferien, Vater«, flüsterte er. »Vor und nach der Schule.«
Jack Gillory schüttelte den Kopf. »Das reicht nicht, Junge. Ich kann meine Rechnungen nicht bezahlen, verstehst du? Also sag dem Pfarrer, daß du keine vornehmen Kleider mehr brauchst.«
»Nein«, antwortete Daniel.
Jack ging auf ihn zu. »Nein?
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: