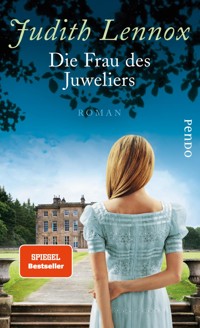9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nur ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, der das Schicksal einer jungen Frau und die Lebenswege einer ganzen Familie für immer verändert … Sommer 1914: Als junges Mädchen verbringt Alix mit der reichen Verwandtschaft die großen Ferien in Frankreich – eine unbeschwerte Zeit, die jäh endet, als ihr kleiner Cousin Charlie spurlos verschwindet. Alix trägt die Schuld daran, eine Schuld, die sie nie wieder loslassen wird. Eine dramatische Geschichte um Liebe, Verrat und Vergebung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Even, Alexis und Dominic
Übersetzung aus dem Englischen von Mechtild Sandberg
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe9. Auflage 2009
ISBN 978-3-492-95344-3
© Judith Lennox 1999
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Shadow Child«, Corgi Books / Transworld Publishers Ltd., London 1999
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2000
Umschlagkonzept: semper smile, München
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagabbildung: plainpicture, Arcangel
Teil I
Ein Geburtstagspicknick
Picardie, Juli 1914
1
JEDER SEINER STIEFEL hatte sechs Knöpfchen. Als sie sich bückte, um sie zu schließen, schlang Charlie ungestüm die Arme um ihren Kopf. »Allie, Allie, Allie!« rief er und trommelte mit seinen kleinen Fäusten auf sie ein. Charlie Lanchbury war zwei Jahre alt, ein pummeliger kleiner Kerl, den man ganz einfach liebhaben mußte. Alix hob ihn in die Höhe und gab ihm einen Kuß.
Sie sah zum Fenster hinaus in den Hof des Schlosses, wo Onkel Charles gerade Tante Marie in den Daimler half. Auch ihre kleinen Cousinen waren unten, Ella, May und Daisy, alle drei in den gleichen Kleidern, weißer Musselin mit rosaroten Schärpen. Es war Mays neunter Geburtstag, und zur Feier des Tages wollte die ganze Familie – Onkel Charles und Tante Marie, die vier Kinder, die Großeltern Boncourt und Alix – einen Ausflug machen.
»Steh mal einen Moment still, Charlie.« Seine rotblonden Locken kitzelten sie unter dem Kinn, und sie mußte lachen, während sie versuchte, die Enden seines Spitzenkragens gerade zu ziehen. Geschmeidig wie ein Fisch entwand er sich ihren Händen und galoppierte »Wert! Wert!« rufend im Zimmer umher.
Die Nachmittagssonne, die durch die Fenster fiel, warf helle Lichtquadrate auf den gewachsten Parkettfußboden. Als Alix ihr Skizzenbuch aufhob, flatterte ein Blatt Papier zu Boden. Es war eine Zeichnung, die ihren Vater und ihre Mutter zeigte, wie sie, mit riesigen Taschentüchern bewaffnet, am Quai standen und versuchten, die dicken Tränen aufzufangen, die zu ihren Füßen bereits einen kleinen See gebildet hatten. »Mr. und Mrs. Gregory beim Abschied von ihrer reiselustigen Tochter Alix« lautete der Titel über der Karikatur, die mit AJG, den Initialen ihres Vaters, unterzeichnet war.
Alix hatte in den zwei Monaten ihres Ferienaufenthalts in Frankreich kaum unter Heimweh gelitten. Dazu war sie viel zu beschäftigt gewesen und zu fasziniert von der Andersartigkeit des Lebens hier. Es waren die ersten Ferien, die sie mit ihren Verwandten zusammen verbrachte; ihre ersten Ferien im Ausland, obwohl sie schon vierzehn war. Aber als sie jetzt die witzige kleine Zeichnung betrachtete, gab es ihr doch einen kleinen Stich.
Sie schob sie wieder in das Buch zurück und begann, auf allen vieren durch das Zimmer kriechend, unter Tischen und Stühlen nach Charlies Schwert zu suchen.
»Komm, Charlie, hilf mir suchen, sonst kommen wir zu spät.«
Sie entdeckte das Spielzeug schließlich in einem Kasten Holzbauklötze. Charlie hüpfte in heller Aufregung herum und rannte zu ihr. »Wert!« rief er strahlend.
»Schwert«, korrigierte Alix ihn lachend. Sie zog das Band aus ihrem dunklen Haar, knotete es ihm um seinen kleinen Bauch mit dem Samtjäckchen und schob das hölzerne Schwert darunter. Er streckte ihr die Arme entgegen, und sie trug ihn zum Fenster. Rundherum, so weit das Auge reichte, flimmerten die Felder und Wiesen Nordfrankreichs in der Mittagshitze. Alix drückte Charlies kleinen, warmen Körper an sich. Dann nahm sie ihren Hut und lief hinaus in die Sonne.
Auf der Fahrt trug sie Skizzenbuch und Bleistift in der Tasche ihres Kleides. Das Buch war beinahe voll, nur wenige leere Seiten blieben noch. Und lauter vernünftige Zeichnungen waren es, ganz anders als die Karikaturen, durch die sie in der Schule so tief in Ungnade gefallen war. Sie bekam jetzt noch Magenflattern, wenn sie daran dachte, wie sie zu Miss Humphrey zitiert worden war und dort, auf dem Schreibtisch der Direktorin ausgebreitet, ihre eigenwilligen Darstellungen der Lehrer von Ashfield House gesehen hatte. Miss Turton, die Sportlehrerin, mit rotem Kopf und strammen Waden; Miss Bright (Geschichte) mit Glupschaugen, die über ihren Kneifer hinwegspähten. Die hervorstechendsten Merkmale ihrer Lehrer ins Überdimensionale und Lächerliche verzerrt. Die anderen Mädchen pflegten sich über ihre Zeichnungen, schnell hingeworfen auf irgendwelche Schmierblätter, zu amüsieren; sie tauschten Zitronendrops und Sahnebonbons gegen eine Karikatur. Aber Miss Humphrey hatte nichts Amüsantes an den Skizzen gefunden, und die Strafe für ihre Respektlosigkeit hatte Alix prompt und gnadenlos ereilt. Sie hatte sich nicht einmal von ihren Freundinnen verabschieden dürfen.
Das Schlimmste – und hier stieß Alix, die den blaßgoldenen Schimmer der vorüberfliegenden Landschaft jetzt gar nicht mehr wahrnahm, einen kleinen Seufzer aus –, das Schlimmste war die Bekümmerung und Fassungslosigkeit gewesen, die sie in den Gesichtern ihrer Eltern gesehen hatte, als diese sie aus dem Internat abgeholt hatten. Es quälte Alix, sie so sehr enttäuscht zu haben. Das Zweitschlimmste war die Erkenntnis gewesen, daß sie das Buch mit den Skizzen in der Schulgarderobe liegengelassen haben mußte, ein Leichtsinn, der der Folge von Kopflosigkeiten – verlorengegangene Überschuhe, abhanden gekommene Turnanzüge, spurlos verschwundene Füller –, die ihre kurze Karriere im Internat gekennzeichnet hatten, die Krone aufgesetzt hatte.
Einige Wochen nach Alix’ unehrenhafter Entlassung aus der Schule hatte ihre Mutter den Brief von Onkel Charles erhalten.
»Das ist wirklich nett von Charles und Marie«, hatte Beatrice Gregory gesagt. »Sie fragen an, ob du in den Ferien mit ihnen nach Frankreich reisen möchtest. Sie besuchen dort jedes Jahr mit allen vier Kindern Maries Eltern.« Beatrice Gregory runzelte die Stirn. »Ich weiß nicht recht … du bist erst vierzehn … und wir sollten uns eigentlich nach einer anderen Schule umsehen. Aber Nanny Barnes, das Kindermädchen, ist krank, sie kann nicht mitkommen.« Ein paar graue Haarsträhnen fielen ihr in die gekrauste Stirn. »Marie meint, du würdest ihnen damit einen großen Gefallen tun. Sie würden natürlich von dir erwarten, daß du bei der Beaufsichtigung der kleineren Kinder hilfst, Alix. Ich weiß wirklich nicht …«
Das Automobil, das von Robert, dem Stallburschen der Boncourts gelenkt wurde, holperte über die Kopfsteine. Charlie hüpfte auf Alix’ Schoß auf und nieder, während sie sich erinnerte. Hoch und heilig hatte sie ihrer Mutter versprochen, sich tadellos zu benehmen, stets auf ihre Sachen zu achten, niemals zu widersprechen oder zu klagen. Sie hätte jedes Versprechen gegeben, um die Erlaubnis zu diesem Abenteuer, einer Reise nach Frankreich, zu erwirken.
Und sie hatte ihre Versprechen im großen und ganzen gehalten. Nur einmal hatte sie Ella die Zunge herausgestreckt, als diese den Inhalt ihres Koffers inspiziert und gesagt hatte: »Baumwollhandschuhe, Alix? Wir tragen immer Glacéleder oder Spitze. Mama sagt, nur Gouvernanten und Zofen tragen Baumwollhandschuhe.« Und sie war nur einmal wütend geworden, als sie gehört hatte, wie Tante Marie Madame Boncourt zuflüsterte: »Alix’ Vater ist Lehrer. Beatrice Lanchbury hat unter ihrem Stand geheiratet – vermutlich, weil sie Angst hatte sitzenzubleiben.«
Jetzt lagen das Schloß der Familie Boncourt und die umliegenden Felder schon weit hinter ihnen. Die fruchtbare Ebene der Picardie glänzte im hellen Gelb der reifenden Weizenfelder, über die vereinzelt stehende Pappeln ihre Schatten warfen. Hitze staute sich unter dem Dach des Automobils, dessen Seiten offen waren.
Die fünfjährige Daisy fragte quengelnd: »Sind wir noch nicht da?«
»Natürlich nicht, du Dummkopf«, sagte Ella.
»Ich hab aber Hunger.« Daisy verzog weinerlich das Gesicht.
»Es dauert nicht mehr lang, Schatz. Und beim Picknick gibt es dann lauter gute Sachen«, tröstete Madame Boncourt. »Obwohl ich ja der Meinung bin, daß das französische Essen für Kindermägen einfach zu schwer ist. Es ist wirklich jammerschade, daß Nanny nicht mitkommen konnte. Sie macht immer diesen wunderbaren Reispudding mit Vanillesoße.«
Madame Boncourt, die liebenswürdig und dick war, strahlte Alix an. »Du findest deine Ferien hier doch hoffentlich schön, Alix, mein Kind?«
Alix dachte an die Kanalüberfahrt und die Strände von Le Touquet, wo sie die ersten drei Wochen verbracht hatten, an die verschlafenen französischen Dörfer und die Wegraine mit leuchtend rotem Mohn und blauer Wegwarte. Sie sah vor sich all das Beiwerk des glanzvollen Lebens, das die Lanchburys führten – Tante Maries elegante Kleider aus schwerer Seide, die Bediensteten, die ihnen jeden Handgriff abnahmen. Und das Automobil natürlich. Bis vor einem Monat war sie noch nie in einem Automobil gefahren.
»Es ist wunderbar!« sagte sie heftig. Sie drückte Charlie fest an sich und atmete den sauberen Geruch seiner Haut und seines Haars, als sie ihn auf den Scheitel küßte.
Alix zeichnete den Picknicktisch und die Dienstboten, wie sie ihn deckten. Sie begann, Robert zu zeichnen und Louise, das Kindermädchen, die halb versteckt hinter Bäumen waren, aber dann warf Charlie sich auf ihren Schoß, riß ihr den Bleistift aus der Hand und stach damit auf ihr Skizzenbuch ein.
»Lange!«
»Eine Schlange? Charlie möchte eine Schlange malen?« Alix führte die kleine, dralle Hand, die den Stift hielt. Wellenlinien krochen über das Papier.
»Lange«, sagte er wieder und wies zu den Bäumen. »Da düben.«
»Du hast eine Schlange gesehen? Da drüben?« Alix stand auf und klopfte sich ein paar welke Grashalme vom Rock. »Komm, wir schauen mal nach.« Sie hielt ihm die Hand hin.
Rosarot und weiß blitzte es im Grün und Schwarz des Waldes, als May und Daisy ihnen voraus zwischen den Bäumen hindurcheilten. Die Gespräche der Erwachsenen, die draußen im Schatten saßen, wichen in den Hintergrund zurück. Das Timbre ihrer Stimmen wurde seltsam klanglos, wie von den hohen Bäumen oder der drückenden Sommerhitze geschluckt.
»… könnten wir Amélie in Paris besuchen.« Das war Madame Boncourts Stimme.
»Aber die Ernte …« Monsieur Boncourt sprach im Gegensatz zu seiner Frau französisch.
»Ach, ja natürlich, Félix. Daran habe ich gar nicht gedacht. Natürlich müssen wir die Ernte abwarten.«
»Die Truppen des Kaisers werden vielleicht nicht so lange warten.« Charles Lanchbury hielt in seinem rastlosen Umherwandern inne.
»Also wirklich, Charles!« Madame Boncourt lachte ein wenig. »Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Dinge sich bereits so weit zugespitzt haben.«
»Nein, das kannst du natürlich nicht. Dein Optimismus war ja immer schon unverwüstlich, belle-mère.«
Charlie zog an Alix’ Hand, um sie tiefer in den Wald zu führen. In der Ferne sagte Onkel Charles: »Ich wäre gern schon morgen abgereist. Wir müssen früher nach England zurück, wenn wir …«
Dann war er nicht mehr zu hören, und Charlie flüsterte: »Lange, Allie, schau.«
Sie schauderte leicht, als sie die gewundene Form im dürren Laub sah. Dann blickte sie genauer hin und lachte. »Das ist nur eine alte Schlangenhaut, Charlie. Sieh mal, da ist gar nichts.«
Er kauerte neben ihr nieder und stocherte mit seinem kleinen silbernen Schwert nach der abgestreiften Haut. Behutsam zog Alix ihn weg. »Laß sie liegen, Charlie. Laß sie so, wie sie ist. Komm, wir suchen deine Schwestern, ja?«
Er rannte vor ihr her. Wir müssen früher nach England zurück, hatte Onkel Charles gesagt. Plötzlich überfiel Alix eine heftige Sehnsucht nach zu Hause. Sie konnte es kaum erwarten, ihrem Vater ihr Skizzenbuch zu zeigen, ihrer Mutter von den weiten, luftigen Räumen des Schlosses zu erzählen, die mit Gold und Samt überladen waren, ihr Tante Maries Kleider zu beschreiben, Spitzengeriesel und Seidenbänder, die bei jedem Schritt leise knisterten. Alix wußte, daß ihr Vater, wenn er mit ihr durch diesen Wald gewandert wäre, ihr den Namen der kleinen, weißen Blumen gesagt hätte, die mit nickenden Köpfen im Unterholz standen, daß er den Gesang des Vogels erkannt hätte, der da hoch oben im Geäst eines Baums saß. Er hätte gewußt, welche Schlange die Haut abgestreift hatte, die Charlie so in Aufregung gestürzt hatte, und er hätte ihr beibringen können, einen Picknicktisch so zu zeichnen, daß seine Beine wirklich wie aus Holz gemacht wirkten und nicht wie aus Gummi.
Traurig machte sie bei dem Gedanken an die baldige Heimkehr einzig die bevorstehende Trennung von Charlie. In den acht Wochen ihres Aufenthalts in Frankreich hatte sie sich fast ausschließlich um den kleinen Jungen gekümmert. Gleich am ersten Tag der gemeinsamen Reise hatte er sich ihr fest angeschlossen und während der ganzen Überfahrt neben ihr auf einer Bank an Deck der Fähre gekniet, um mit ihr zusammen ins graue Wasser hinunterzuschauen, in das das Schiff einen weiß schäumenden Keil pflügte. Im Hotel in Le Touquet hatte er darauf bestanden, von Alix zu Bett gebracht zu werden; auf der langen Bahnfahrt nach Amiens hatte er nur stillgesessen, wenn Alix ihn auf den Schoß genommen und ihm Geschichten erzählt hatte. Sie liebte ihn mit einer heftigen, völlig unerwarteten Zärtlichkeit; sie hatte sich nie viel aus Puppen gemacht und deshalb geglaubt, sie würde ihren zweieinhalbjährigen Vetter ebenso langweilig finden. Aber es beglückte sie schon, ihn nur an der Hand zu halten; es beglückte sie, ihn auf dem Arm zu tragen, ihr Gesicht in sein weiches, feines Kinderhaar zu drücken, wenn sie sich zu ihm hinunterneigte, um ihm einen Kuß zu geben.
Nach dem Picknick (Schinken und Huhn in Aspik, Apfeltörtchen und eine prachtvolle Geburtstagstorte mit rosarotem Guß) gesellte sich Alix zu den Mädchen, die im Gras lagen und den gepflückten Gänseblümchen mit den Daumennägeln die saftigen grünen Stengel aufschlitzten, um Kränze aus ihnen zu flechten. Charlie hockte zu Füßen seiner Mutter und piekte mit schmutzigem Zeigefinger nach einem Marienkäfer, der mühevoll von Grashalm zu Kleeblatt krabbelte.
Madame Boncourt bot ihrem Mann die Hand, um sich von ihm vom Stuhl helfen zu lassen. »Ich muß nach Hause, Marie. Es ist so heiß, und mir ist ein wenig flau. Ich fahre mit den Angestellten im Dogcart. Ich möchte euch den Tag nicht verderben.«
»Aber Maman –«
»Laß gut sein, Marie. Ich fahre lieber im Pferdewagen. Automobile sind so laut und staubig.«
Die Dienstboten waren schon dabei, Körbe und Decken in den Einspänner zu verstauen.
Onkel Charles, der spielerisch Ellas Ball in seinen Händen hin und her warf, sagte träge: »Wenn du jetzt nach Hause fährst, belle-mère, dann nimm bitte dieses unmögliche Kindermädchen mit. Sie hat ja nichts anderes im Kopf, als mit dem Stallburschen zu flirten.«
»Charles! Die Kleinen –«
»Alix kümmert sich schon um Charlie, nicht wahr, Alix? Wir spielen jetzt eine Partie Kricket. Komm, Ella, such ein paar Stöcke, die wir als Torstäbe benutzen können.«
»Sie müssen ins Bett …« Eine vage Geste mit schmaler Hand. »Wir sollten auch nach Hause fahren, Charles.«
»Ach, Unsinn! An so einem herrlichen Abend?« Onkel Charles rammte die Stöcke, die Ella zusammengesucht hatte, in den Boden. »Alix, Daisy und ich sind eine Mannschaft, Ella, May und Charlie die andere. May darf zuerst schlagen, weil sie heute Geburtstag hat.«
Die Dogcarts mit den Dienstboten, den beiden Boncourts und einer verdrossenen Louise rollten, Staubfahnen hinter sich herziehend, auf der Landstraße davon. Onkel Charles warf, und May holte mit dem Schläger aus. Der Ball flog ins Unterholz. Charlie klatschte begeistert in die Hände, und Ella schrie: »Renn, May, renn.«
Onkel Charles warf und warf. Die Füße der kleinen Mädchen hämmerten über den harten Boden. Die Sonne glitt zu den Baumwipfeln hinunter. Der Ball, der von einem blendend erleuchteten Himmel herabsauste, rutschte Alix aus den Händen.
»Tolpatsch!« sagte Onkel Charles scharf.
Das Knallen des Balls gegen das Schlagholz schlug den Takt zum Verstreichen der Zeit. Die Bäume wurden zu schwarzen Schattenrissen vor dem sich allmählich verdunkelnden Himmel. Charlie, der eigentlich im Feld stehen und den Ball fangen sollte, war zu seiner Mutter gekrochen und lutschte am Daumen. Hin und wieder beugte sich Tante Marie zu ihm hinunter und nahm schweigend seine Hand weg, aber kaum richtete sie sich auf, schob er den Daumen wieder in den Mund. Bald, dachte Alix, würde Onkel Charles bemerken, daß Daisy einen roten Kopf hatte und weinerlich geworden war, daß Ellas Mürrischkeit in Aggressivität umgeschlagen war, daß selbst Mays sonniges Gemüt sich zu trüben begann. Aber immer wieder stieg der Ball in die Luft, und immer von neuem feuerte Onkel Charles sie mit scharfen Rufen an, schneller zu laufen, sich mehr Mühe zu geben.
Der letzte Schlagmann schied aus. »Gewonnen«, sagte Onkel Charles und klatschte in die Hände.
Dunkle Schatten lagen auf dem Gras. Die Lanchburys sammelten Schlagholz und Ball, abgelegte Hüte und Handschuhe ein. Daisys rosarote Schärpe war aufgegangen und schleifte grau im Staub. Charlie fröstelte vor Müdigkeit, als seine Mutter ihn hochzog. Ella und May begannen auf dem Weg zum Auto zu streiten.
»Jetzt darf ich mit Papa fahren«, zischte Ella.
May zeigte ihr die Zähne. »Es ist mein Geburtstag. Papa hat’s gesagt.«
Alix setzte sich hinten in das Auto der Boncourts und hielt Charlie auf dem Schoß. Daisy kuschelte sich müde an sie. Die Räder rumpelten über die ausgetrocknete Erde. Charlie fielen die Augen zu. Schläfrigkeit erfaßte sie alle.
Felder und Bäche strichen vorüber. Öllampen leuchteten in den Fenstern der niedrigen Häuser, und die letzten Sonnenstrahlen überzogen die Blumen in einer Gedenkkapelle am Straßenrand mit Gold. Diesen Abend werde ich nie vergessen, dachte Alix. Ich werde mich an den Geruch des Staubs und des Grases erinnern, an die Mohnblumen an der Straße, wie sie sich im Fahrtwind des Automobils neigten und wiegten, und an Charlies Lächeln im Traum.
Als sie in ein Dorf kamen, hielten sie an. Gesichter hoben sich blaß aus der abendlichen Dunkelheit, spähten neugierig in den Wagen. Charlie setzte sich auf und rieb sich die Augen. Der Daimler, der vor ihnen hergefahren war, hatte ebenfalls angehalten.
Tante Marie kam zum Wagen. »Papa meint, ihr sollt besser alle aussteigen. Das Auto …« Die Hand im weißen Handschuh glitt von der Türkante, als sie zurücktrat, eine Hand zum verschleierten Gesicht hob und zitternde Finger an ihren Mund drückte.
Sie drängten sich auf der schmalen Dorfstraße zusammen. May neigte den Kopf zur Seite. »Ich kann Musik hören«, flüsterte sie. Aus der Ferne schallten die gedämpften Klänge von Fiedeln und Trommeln zu ihnen. »Papa, ich höre Musik.« Sie lief zur Straßenecke und spähte in die Dunkelheit.
»Das Kühlwasser kocht«, sagte Charles Lanchbury. »Wir müssen warten, bis es abkühlt.«
»Papa, da vorn ist ein Rummelplatz …«
Nicht ganz im Takt der Musik schlug Onkel Charles die Krempe seines Strohhuts gegen seinen Oberschenkel. »Ein Rummelplatz? Kommt, das wollen wir uns doch mal ansehen.«
»Papa!« May klatschte entzückt in die Hände.
»Charles – es ist schon so spät … und ein kleiner Dorfrummel …«
»Du kannst ja im Wagen bleiben, wenn du willst, Marie.« Charles Lanchbury machte sich schon auf den Weg die enge Gasse hinunter.
Die Fahrt schien sie alle neu belebt zu haben. May hopste die Straße entlang, selbst Ella machte ein freundlicheres Gesicht. Marie Lanchbury folgte ihnen widerstrebend mit Charlie an der Hand.
Die Gasse mündete in einen kleinen Platz. In seiner Mitte brannte ein großes Feuer, das die Buden und die Menschen, die sich um sie scharten, erleuchtete. Tänzer wirbelten im Feuerschein, und an einer Ecke des Platzes drehte sich ein Karussell.
May griff nach Alix’ Hand und drängte sich durch das Menschengewimmel zu den Tänzern durch. Daisy hielt Alix’ andere Hand fest. Alix drehte sich kurz um und sah Charlie, halb versteckt hinter dem fülligen Rock seiner Mutter, wie er gebannt den bunten Ringen eines Jongleurs nachschaute, die kreisend in die Luft stiegen.
»Ach, ist das schön«, sagte May, und es klang wie ein Stoßseufzer des Glücks. Ihr Blick hing fasziniert an den tanzenden Zigeunern.
»Allie, Allie, Allie!« Charlie warf sich von hinten gegen sie und hätte sie beinahe umgestoßen. Sie hob ihn hoch und nahm ihn auf den Arm.
Ella, die ihm folgte, rief: »Er will die kleinen Affen sehen.«
»Affen?«
»Da drüben ist ein Mann mit zwei kleinen Affen. Man darf einen Affen halten, und dann spielt der Mann ein Lied, und man gibt ihm Geld.« Mit gesenktem Kopf rannte Ella ihnen voraus über den Platz.
Mit traurigen kleinen Gesichtern sahen die Affen unter gestrickten Häubchen hervor. May und Ella wiegten sie wie Puppen in den Armen, während die Drehorgel dudelte, ein wehmütiges Leiern. Charlie streichelte eine faltige kleine Affenhand, und Alix gab dem Drehorgelmann ein paar Münzen, die dieser in eine abgewetzte Lederbörse fallen ließ.
Neben dem Drehorgelmann war eine Bude mit Süßigkeiten. Charlie zupfte an Alix’ Hand und wollte einen Lutscher haben, aber sie schüttelte den Kopf.
»Ich habe kein Geld mehr, Charlie. Da ist deine Mama – lauf und frag sie.«
Auf der steinernen Treppe vor der Mairie setzte Alix sich nieder und nahm ihr Skizzenbuch heraus. Durch das Schreien und Lachen der Menge und das Klirren der Tamburine drangen immer wieder die Stimmen der Lanchburys zu ihr.
»… mit deinen klebrigen Fingern an mein Kleid, Charlie. Ich habe gesagt …«
»… ist gemein! Sie hat mehr als ich. Und außerdem hat sie den schöneren Affen halten dürfen.«
»… nicht ein, warum wir uns mit solchen Leuten gemein machen müssen. Das ist doch sonst nicht deine Art, Charles. Ich weiß, du möchtest mich …«
»Ich möchte mal Ballettänzerin werden. Wenn ich groß bin, werde ich Primaballerina.«
Alix wollte Malerin werden. Sie hatte diesen Wunsch bisher noch keinem Menschen anvertraut, da sie wußte, daß sie genau den richtigen Augenblick würde wählen müssen, um ihre Eltern zu überreden, sie die Kunstakademie in London besuchen zu lassen.
Als ihr Skizzenbuch voll war, stand sie auf. Jede Seite war mit Skizzen und Zeichnungen gefüllt. Sie schaute sich um, aber die Lanchburys waren nirgends zu sehen. Mit der dichter werdenden Dunkelheit hatte die Atmosphäre auf dem Platz etwas Geisterhaftes bekommen, als wäre er von Schatten bevölkert. Ein leichter Regen hatte eingesetzt, der in feinen Fäden herabfiel und das Kopfsteinpflaster mit öligem Glanz überzog. Angst überkam sie plötzlich, daß die Lanchburys sie vergessen hatten und ohne sie zum Schloß zurückgefahren waren. Sie versuchte, sich zu erinnern, wo die Autos standen. War es nicht am Ende dieser Seitenstraße gewesen – oder dort drüben die Gasse hinunter? Sie begann zu laufen. Der Regen stach ihr in die Augen. Dann packte jemand sie am Handgelenk, und sie wirbelte herum. Eine alte Frau strich mit schwieligen Fingerspitzen über die Linien in ihrer geöffneten Hand. Alix hörte unverständliches Gebabbel, in der Aufregung hatte sie ihr ganzes Französisch vergessen.
»Sie will dir aus der Hand lesen, Alix. Das ist eine Wahrsagerin.«
»Ella!« Alix hätte beinahe gelacht vor Erleichterung. »Wo wart ihr denn? Ich hatte schon Angst, ich hätte euch verloren.«
»Die anderen gehen zu den Autos zurück. Papa hat gesagt, ich soll dich holen. Er ist furchtbar böse. Er hat gesagt, es ist schon spät, und du sollst dich beeilen.« Ella fauchte die alte Frau an: »Allez-vous en! Pas d’argent. Allez-vous en.«
Der Regen fiel jetzt dichter. Alix konnte Onkel Charles’ Hut sehen, der über der Menge wippte, während Regentropfen auf seine Krempe prasselten. Tante Marie, von Dorfbewohnern umringt, war nur ein flüchtiger Schimmer bleicher Seide.
Das dünne Baumwollkleid klebte Alix feucht an den Schultern. Zum erstenmal an diesem Tag war ihr kalt. Die Dorfbewohner drängten sich um die beiden Automobile, um sie neugierig zu betatschen. Das wütende Geschrei Mays und Ellas übertönte Stimmengewirr und Gelächter.
»Das ist gemein! Es ist mein Geburtstag!«
»Aber ich bin die Älteste. Drum darf ich mit Papa fahren.«
»Papa hat gesagt –« Ein schriller Schrei. »Du hast mich gezwickt. Alix – Ella hat mich gezwickt.«
»Petze –«
Schmerzgeheul. »Aua! Aua! Sie hat mich getreten!«
»Du lieber Gott, ihr beide gehört in den Kindergarten.« Scharf und kalt durchschnitt Charles Lanchburys Stimme das Rauschen des Regens. »Und du«, wandte er sich an Alix, »steh hier nicht so herum. Kümmere dich um sie.«
»Fahr du mit deiner Mama, Ella«, sagte Alix hastig. »May kann mit uns fahren.«
Triumphierend drängte sich Ella durch das Gewühl zum Daimler.
Alix zog May mit sich zum Wagen der Boncourts. May schlug mit Fäusten nach ihr. »Das ist gemein!« schrie sie. »Es ist mein Geburtstag.« Der Regen drückte ihr das Haar flach an den Kopf. Ihre blaßblauen Augen blitzten zornig.
»Ach, May!« Alix wischte dem kleinen Mädchen die Tränen ab. »Komm, wir machen es uns richtig gemütlich«, redete sie ihr gut zu. »Wir spielen ›ich sehe was, was du nicht siehst‹.«
May warf sich auf den Rücksitz, drückte die Hände auf die Ohren und schluchzte. Alix sah sich im Wagen um. Kein Charlie. Nur Robert, der vorn saß, eine Zigarette rauchte und dabei mit halb geschlossenen Augen vor sich hin summte.
Plötzlich besorgt, tippte Alix ihm auf die Schulter.
»Robert, wo ist Charlie?«
Robert zuckte die Achseln. »Vorn im Daimler, nehm ich an, Mademoiselle.« Er drückte seine Zigarette aus und stieg aus dem Wagen, um den Motor anzukurbeln.
Alix hörte eilende Trippelschritte auf dem Pflaster und drehte sich herum. Daisy kletterte in den Wagen und kroch zu ihr auf den Sitz.
»Ich fahr nicht mit Ella. Ella ist böse.«
»Daisy, wo ist Charlie?«
»Bei Mama«, nuschelte Daisy, den Daumen im Mund, und drückte sich an ihre Schwester.
Robert trat aufs Gaspedal, der Motor heulte auf. Regen prasselte auf das Verdeck des Wagens. Draußen stoben die Leute schutzsuchend auseinander. Alix kniete sich auf den Sitz und suchte mit angestrengtem Blick in Finsternis und Regen. Ihre Hand lag auf dem Türgriff. Nirgends in der wogenden, laufenden Menschenmenge konnte sie Charlie entdecken. Und der Daimler der Lanchburys, das Rückfenster schwarz und blind, schoß schon in schneller Fahrt zum Dorf hinaus.
Robert folgte. Der Regen klatschte gegen die Scheiben. May schluchzte laut. Alix saß mit hängenden Armen, Charlie fehlte ihr. Daisy war auf den Boden des Wagens hinuntergerutscht und eingeschlafen. Auch Alix wurden die Lider schwer. Als sie die Augen schloß, blitzten wie Schnappschüsse einzelne Szenen des Tages hinter ihren Lidern auf. Die Fahrt durch die sonnenglühende Landschaft. Charlie, sein kleines Schwert schwenkend, beim Lauf durch den Wald. Der Affe mit dem traurigen Blick tiefer Einsamkeit.
May hatte aufgehört zu weinen, atmete im Schlaf mit kurzen, heftigen Stößen. Auch Alix hätte jetzt gern ein wenig geschlafen, aber es gelang ihr nicht. Obwohl ihr vor Erschöpfung fast schwindlig war, zogen weiter bruchstückhafte, schnell wechselnde Bilder durch ihr Bewußtsein. Immer wenn sie kurz vor dem Einschlafen war, riß irgend etwas – der Schrei eines Vogels, eine Veränderung des Motorengeräuschs, wenn Robert in einen anderen Gang schaltete – sie aus der Benommenheit. Als der Wagen anhielt, öffnete sie die Augen in der Erwartung, vor sich die erleuchteten Fenster des Schlosses zu sehen. Statt dessen jedoch gewahrte sie durch Regenschleier eine endlos scheinende Kette von Eisenbahnwaggons, die, von einer stampfenden Lokomotive gezogen, auf den Gleisen, die vor ihnen die Straße kreuzten, nach Norden rollten.
Robert sagte etwas. Alix zwinkerte verwirrt und schüttelte den Kopf.
»Soldats«, wiederholte er. »Soldaten.« Er wies auf den Zug. In den beleuchteten Abteilen, die ihr Licht in die Landschaft warfen, sah sie das leuchtende Rot und Blau französischer Uniformen.
»Ich geh auch zu den Soldaten«, bemerkte Robert stolz. »Ich werd für mein Vaterland kämpfen. Dann ist’s vorbei mit dem Chauffieren und dem Stallausmisten.« Er warf den Kopf zurück und lachte.
Wie eine lange schwarz-gelbe Schlange wand sich der Zug durch Dunkelheit und Regen. Alix konnte den Daimler nicht mehr sehen. Die Straße war leer.
Schließlich fiel sie doch in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Im Schloßhof angekommen, mußte Robert sie wachrütteln. Der Schlaf zog an ihr, wollte sie nicht freigeben. Unten auf dem Boden des Wagens bemerkte sie vergessen Charlies kleines Schwert und hob es auf. Sie sah den Daimler, der im gekiesten Rondell stand. May und Daisy, beide schwankend vor Müdigkeit, stolperten neben ihr her ins Schloß. Mit dem Schwert in der Hand lief Alix nach oben. Das Kinderzimmer war dunkel, die kleine Nachtlampe brannte nicht. Sobald sie das Zimmer betrat, spürte sie, daß es leer war. Trotzdem ging sie zum Bett und sah das aufgeschüttelte Kopfkissen, die zurückgeschlagene Decke, das ordentlich gefaltete Nachthemdchen.
Die ganze Nacht lang, ihr ganzes Leben lang, blieb ihr das Gespräch mit Tante Marie im Kopf.
Wo ist Charlie? Ich wollte ihm noch einen Gutenachtkuß geben.
Charlie? Charlie war doch bei euch.
Nein, Tante Marie. Charlie ist … Die erste Ahnung einer entsetzlichen Möglichkeit meldete sich. Sie hörte den heiseren Klang ihrer Stimme, als sie sagte: Charlie ist doch mit euch gefahren. Und es wiederholte: Charlie ist doch mit euch gefahren.
Sie waren im Salon. Tante Marie hatte Hut und Schleier abgelegt. Im goldgerahmten Spiegel verdunkelte heraufziehende Angst ihren Blick.
»Ella ist mit uns gefahren.« Tante Marie läutete. Ihre Hand zitterte. »Nur Ella. Du mußt dich irren, Alix.«
Als Louise ins Zimmer kam, sprach Tante Marie mit ihr. Louise schüttelte den Kopf. »Ich wollte die Mädchen gerade baden, Madame.«
»Nein, Louise, jetzt nicht. Bringen Sie sie herunter. Gleich. Und holen Sie meinen Mann.« Tante Marie griff sich mit der Hand an den Hals. »Im Dorf – in dem Dorf, wo der Rummel …«
Der Salon füllte sich mit Menschen. Die drei kleinen Mädchen, Onkel Charles, die Boncourts. Charlie war nicht dabei. Nur ein Augenzwinkern, nur eine kurze Drehung des Kopfs, meinte Alix, und sie müßte ihn sehen, an Mays Hand auf und ab hopsend, hinter Großvater Boncourts Beinen hervorlugend.
Die Stimmen überschlugen sich.
»Vergessen?«
»Das Dorf …«
»So ein Unsinn. Wie können wir ihn vergessen haben?«
»Wo ist Charlie? Charlie soll kommen!«
»Ach, du bist so eine Heulsuse, Daisy …«
»Er war im anderen Wagen –«
»Nein, Charles, nein!« Tante Maries Stimme war ein Schrei. »Er war nicht im anderen Wagen. Das versuche ich dir doch gerade zu sagen.«
Schweigen.
»Bon Dieu!« Madame Boncourt sank schwer in einen Sessel.
»Er ist nicht im Haus?«
Flüsternd: »Nein, Charles, ich glaube nicht.«
»Wer hat ihn zuletzt gesehen?«
»Im Dorf … Er war ganz fasziniert von dem großen Feuer …«
»Ein Feuer?«
»In dem Dorf war Jahrmarkt, Maman. Alles war voller Menschen … schreckliches Gesindel …« Tante Marie sprach in zitternden Stößen. »Die Zigeuner, Charles! Du hast sie doch auch gesehen.« Mit zuckenden Fingern riß sie an der Perlenbrosche an ihrem Hals. »Jeder weiß, daß Zigeuner kleine Kinder stehlen.« Sie brach ab und starrte ihren Mann an. »Charles – Charles – du mußt sofort zurückfahren – du mußt ihn suchen …« Ihre Worte verwirrten sich und gingen in trockenem Schluchzen unter.
»Charlie war bei Alix«, sagte Ella. »Sie ist mit ihm zu den kleinen Äffchen gegangen.«
Wo ist Charlie? Charlie war bei dir.
Alle drehten die Köpfe nach ihr, starrten sie an und warteten auf ihre Worte.
Bis auf Tante Maries keuchende Atemzüge war es ganz still.
Erinnerungen rannen ineinander. Von Panik erfaßt, war Alix nicht fähig, sie in eine Ordnung zu bringen. Ein draller kleiner Finger, der behutsam über eine runzlige Affenhand strich. Eine spitze Papiertüte, und klebriger Zucker rund um Charlies Mund. Vor dem Abstecher zu den Affen? Hinterher? In dem Bemühen um Klarheit murmelte sie: »Ich habe gezeichnet … ich habe mich auf die Treppe gesetzt …«
»Gezeichnet!« Onkel Charles trat aufgebracht einen Schritt auf sie zu. »Du hast gezeichnet?«
»Aber Charlie – wo – sag doch, Alix!«
»Ich habe plötzlich niemanden mehr gesehen. Ich hatte euch verloren. Dann hat Ella mich gefunden.« Sie sprach kurz und abgehackt, voller Furcht. »Wir sind zum Automobil zurückgelaufen.« Sie kniff die Augen zusammen. Sie mußte sich doch erinnern! Hatte sie Charlie irgendwo in der Menge gesehen, als sie durch den Regen zum Auto zurückgerannt waren? Hatte sie ihn unter den Menschen bemerkt, die die Automobile umringten, nur einen Schimmer vielleicht, Blau und Weiß und rotblondes Lockengewirr?
Sie drückte die geballte Faust fest an ihre Stirn. »Ella und May haben miteinander gestritten. Ella ist in Onkel Charles’ Automobil eingestiegen. Ich habe May zu Monsieur Boncourts Wagen mitgenommen.« Plötzlich blickte sie auf und sah die anderen an. »Dann kam Daisy – ja, richtig, dann kam Daisy und sagte mir, Charlie sei bei Onkel Charles im Auto.«
»Daisy?« Onkel Charles sah seine jüngste Tochter scharf an. Seine Stimme war barsch. »Daisy? Ist das wahr? Hast du das zu Alix gesagt? Hast du ihr erzählt, Charlie wäre bei uns im Daimler?«
Daisy lutschte mit gesenktem Kopf verzweifelt am Daumen. Ihre Augen waren dunkel und voller Furcht, als sie den Blick hob. Sie schüttelte den Kopf, daß das helle krause Haar flog.
Ein seltsamer Laut durchdrang die Stille, ein tiefes, erschreckendes Stöhnen. Mit weit aufgerissenen, starr blickenden Augen wiegte Tante Marie sich hin und her und riß dabei ihr Haar mit beiden Händen in Büscheln aus seiner tadellosen Ordnung.
Alix zuckte zurück, als Onkel Charles sich ihr zuwandte. Nie zuvor in ihrem Leben hatte jemand sie mit einem solchen Blick angesehen. Mit solch eiskalter Verachtung.
»Du bist nicht einmal fähig, deine eigene Nachlässigkeit einzugestehen, wie? Du versuchst tatsächlich, die Verantwortung auf deine kleine Cousine abzuwälzen. Du hast uns versprochen, gut auf Charlie achtzugeben. Weißt du das nicht mehr? Du hast versprochen, auf ihn aufzupassen.« Er trat zu Tante Marie. »Ich fahre jetzt sofort in das Dorf zurück. Charlie muß noch dort sein. Mach dir keine Sorgen, Marie, ich werde ihn finden.«
Alix kniete auf der Fensterbank und drückte ihr Gesicht an die Scheibe. Das Haus war in diesen unerträglichen Momenten des Wartens in Stille versunken. Sie lehnte reglos am dunklen Glas. Das Haar war ihr ins Gesicht gefallen, aber sie schob es nicht zurück. Sie wußte, daß Charlie gefunden werden würde. Warum sollte er nicht gefunden werden? Irgend jemandem in der Menschenmenge mußte der kleine Junge aufgefallen sein, der da allein und verloren durch die Straßen irrte. Irgend jemand mußte sich seiner angenommen haben. Sie fühlte sich ruhig; nur in ihrer Brust saß ein merkwürdiger Schmerz. Er würde vergehen, sobald Charlie wieder zu Hause war.
Sie trieb zwischen Wachen und Schlafen. Sie sah einen kleinen Jungen, der stolpernd durch einen Wald lief. Sein Gesicht war von Schmutz und Tränen verschmiert, sein blauer Samtanzug fleckig und zerrissen. Tief hängende Äste griffen nach ihm, und das dichte Blätterdach über ihm verhüllte den Himmel. Seine kleinen Füße blieben an nackten Wurzeln hängen, schlammige Pfützen glitzerten dunkel neben dem Weg.
Lieber Gott, wenn Charlie gefunden wird, will ich nie mehr ungezogen sein. Ich will nie mehr freche Bilder zeichnen, und ich will immer folgsam sein. Ich will jeden Sonntag brav zur Kirche gehen. Und wenn Mama mir nicht erlaubt, die Kunstakademie zu besuchen, will ich auch kein Theater machen. Ich werde hier ganz still sitzen bleiben, bis Charlie gefunden ist. Ich werde mich nicht von der Stelle rühren. Ich werde nicht schlafen. Wenn ich mich nicht bewege, wird ihm nichts geschehen. Lieber Herr Jesus, mild und gut, gib einem kleinen Kinde Mut … Sie drückte ihre Fingerspitzen ans Glas. Jeder Schlag ihres Herzens sprach seinen Namen.
Sie hörte das Knirschen von Rädern im Kies und sah das Automobil mit hell leuchtenden Scheinwerfern in den Hof einfahren. Immer wieder dasselbe Wort ging ihr durch den Kopf: bitte, bitte, bitte …
Alles schien ungeheuer langsam abzulaufen. Onkel Charles stieg aus dem Daimler. Er hielt kein Kind in den Armen. Aber Onkel Charles hatte ja den Wagen gefahren, da würde sich Robert um Charlie gekümmert haben. Doch auch Robert stieg mit leeren Händen aus dem Auto. Natürlich, Charlie schlief hinten auf dem Rücksitz. Bitte, bitte, bitte …
Die beiden Männer gingen ins Haus.
Alix rutschte von der Fensterbank. Ihre Beine waren steif, und sie konnte kaum atmen, weil ihr Herz so heftig schlug.
Sehr langsam ging sie die breite, geschwungene Treppe hinunter und hielt sich dabei am Geländer fest.
Onkel Charles’ Stimme: »Nichts. Keine Spur.«
Großvater Boncourt fluchte.
»Ich habe mit der Polizei gesprochen. Ich fahre zurück, sobald es hell wird, und dann werde ich die ganze Umgebung absuchen … jetzt ist es so finster … Wir müssen ihn finden, Georges. Ich hielt es für das Beste –« Onkel Charles brach ab, als er Alix auf der Treppe sah.
Sie ging zu ihm. Sie berührte seinen Arm. »Bitte laß mich mitkommen und suchen helfen, Onkel Charles. Bitte, laß mich mitkommen.«
Der Stoff seiner Jacke kratzte an ihren Fingern, und sie hatte ein Gefühl, als zöge jemand ein eisernes Band immer fester um ihren Kopf.
»Ich kenne Charlie … ich weiß, was für Plätze er am liebsten mag … Er ist vielleicht in den Wald gelaufen … Hast du da gesucht? Vielleicht hat er sich versteckt – er spielt so gern Verstecken. Nimm mich mit. Bitte!«
Sein Mund verzog sich zu einer wütenden Grimasse. Als er sich herumdrehte, zog Alix hastig ihre Hand von seinem Arm und wich erschrocken zurück. Sie meinte, er würde sie schlagen.
Aber statt dessen neigte er sich zu ihr hinunter und sagte: »Du hattest versprochen, auf ihn achtzugeben. Niemals hätten wir einem Mädchen wie dir unseren Sohn anvertrauen dürfen. Niemals!«
Allein im leeren Kinderzimmer ging Alix zwischen Charlies Spielsachen umher, berührte eine Stoffpuppe, den Schornstein einer Spielzeuglokomotive. Im Glas des Fensters sah sie ihr Spiegelbild: ihr zerknittertes, feuchtes Kleid, ihr fleckiges Gesicht, ihr wirres Haar. Du hattest versprochen, auf ihn achtzugeben. Sie verkroch sich in einer Ecke des Zimmers und machte sich ganz klein, die Stirn an die hochgezogenen Knie gepreßt, die Arme um ihren Kopf geschlungen. Die Schuld, ihre Schuld, erdrückte sie. Als sie die Augen schloß, sah sie in dem Moment, ehe sie sich der Dunkelheit überließ, einen kleinen Jungen, der durch einen Wald lief. Das leuchtende Rotblond seiner Locken, das wie heller Feuerschein seinen Kopf umgab, verblaßte immer mehr, als die Bäume sich um ihn schlossen.
Teil II
Tanz in der Wüste
1918 – 1925
2
IHRE SCHRITTE KLANGEN unnatürlich laut auf dem glänzend gewachsten Holz der Treppenstufen. Derry und sein Vater sprachen kein Wort, während sie der Schwester in der blauen Tracht folgten. Die Stille rundherum reizte Derry, derbe Possen zu reißen oder mit lautem Gebrüll durch die trübe erleuchteten Korridore zu stürmen. In Kirchen pflegte es ihm ähnlich zu ergehen. Der Geruch nach Desinfektionsmitteln, der überall in diesem Haus hing, erinnerte ihn an die betäubenden Weihrauchdüfte.
Als hätte die Schwester gespürt, was in ihm vorging, sah sie sich um und sagte in mißbilligendem Ton: »Die Patienten haben jetzt gerade Mittagsruhe. Eigentlich dürften Sie Lieutenant Fox um diese Zeit gar nicht besuchen, aber da Sie eine ziemlich lange Fahrt hinter sich haben …«
Am Ende des Korridors öffnete sich eine Tür. Derry sah undeutlich einen Mann, der in einem weißen Bett lag, und eine dunkelhaarige Krankenschwester, die an seiner Seite stand. Er stellte sich eiternde Geschwüre und brandige Glieder vor, und sein Magen zog sich zusammen.
Die Schwester sagte: »Was tun Sie hier, Gregory? Und wieso ist die Jalousie hochgezogen? Der Patient sollte ruhen.«
Schnurrend sauste eine Jalousie herab, und das Zimmer verdunkelte sich.
»Das ist meine Schuld, Schwester«, sagte Jonathan beschwichtigend. »Das verflixte Bein hat mir elend zu schaffen gemacht, da habe ich Schwester Gregory gefragt, ob sie nicht etwas tun kann.«
»Miss Gregory, Mr. Fox«, korrigierte die Schwester, aber ihr Ton war eine Spur freundlicher geworden. »Na schön«, sagte sie zu der jüngeren Schwester, »wenn Sie hier fertig sind, können Sie die Pfannen spülen.«
»Ja, Schwester Martin.«
»Eine halbe Stunde meine Herren, dann muß der Patient ruhen.« Schwester Martin ging hinaus.
Derry schloß die Tür hinter ihr. Miss Gregory zog die Jalousie wieder hoch, und das blasse Winterlicht strömte ins Zimmer.
»Hunde, die bellen, beißen nicht«, bemerkte Jonathan, und Derry glaubte, bei Miss Gregory eine skeptisch hochgezogene Augenbraue zu sehen. Sie hatte interessante Augen, ein dunkles, strenges Grün.
»Wie schön, euch beide zu sehen«, sagte Jonathan. »Vater – Derry …«
»Wie geht es dir, mein Junge?«
»Es geht mir sehr gut, Dad.«
Nicholas Fox legte seinem ältesten Sohn die Hand auf die Schulter. »Was macht das Bein?«
»Es ist schon viel besser. Es wird mit jedem Tag besser.«
»Hier, ich habe dir ein paar Weintrauben mitgebracht. Sie sind aus Mrs. Winstanleys Gewächshaus. Nett von ihr, nicht?«
Derry zwang sich, Jonathan richtig anzusehen. Das wellige blonde Haar, das gebräunte Gesicht, die lächelnden blauen Augen (nur Jonathan konnte es fertigbringen zu lächeln, obwohl er im Geschützfeuer beinahe sein Bein verloren hatte) – alles war unverändert. Die Decke war zurückgeschlagen. Derry ließ seinen Blick zögernd zu Jonathans verwundetem Bein hinuntergleiten. Ich werde es schon aushalten können, sagte er sich, wenn ich es mit rein klinischem Interesse betrachte. Die grünäugige Schwester war wieder zu ihrer Arbeit zurückgekehrt.
Er fragte: »Haben sie auch wirklich alle Splitter rausgeholt? Was tun sie, wenn einer irgendwie mittendrin steckt? Lassen sie ihn einfach drin, oder schneiden sie –«
»Derry!« fuhr sein Vater ihn an.
»Sie bemühen sich natürlich, alle Fremdkörper zu entfernen. Sonst kann es geschehen, daß sich die Wunde entzündet.« Miss Gregorys Stimme war leise, ihr Ton herablassend.
»Ich war nicht bei Bewußtsein, als sie an mir herumgeschnippelt haben«, sagte Jonathan. »Ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Mir sind einfach anderthalb Tage verlorengegangen.« Er runzelte die Stirn. »Ich kann immer noch nicht glauben, daß es wirklich vorbei ist. Ständig denke ich, ich müßte wieder hinaus. Jeden Morgen beim Aufwachen muß ich mir erst ins Gedächtnis rufen, daß es vorbei ist.«
»Du hast dein Teil getan.« Behutsam tätschelte Nicholas Fox seinem Sohn die Schulter. »Und ich bin stolz darauf, daß einer meiner Söhne sein Teil beitragen konnte. Auch der König und das Vaterland sind stolz auf dich, mein Junge.«
Derry ging zum Fenster. Ans Sims gelehnt, sah er hinaus. Das Lazarett Fallowfield war vor dem Gemetzel von 1916 der hochherrschaftliche Landsitz irgendeiner begüterten Familie gewesen. Samtig grüne Rasenflächen, jetzt allerdings von den säuberlich gehäufelten Reihen langer Gemüsebeete durchsetzt, dehnten sich bis zum offenen Land der South Downs. Unter tropfenden Bäumen scharten sich Grüppchen von Soldaten, einige von ihnen in Rollstühlen, andere an Krücken. Dieser ganze Riesenkasten, dachte er, ist von Männern bevölkert, die ihr Teil getan haben.
Die grünäugige Schwester breitete sorgfältig die Decke über ihren Patienten. »Fühlen Sie sich jetzt etwas besser, Mr. Fox?«
»Ungleich besser. Sie sind ein Engel.«
Miss Gregorys Gesicht bekam einen weicheren Zug. Mit einem Nicken ging sie aus dem Zimmer.
»Puh!« machte Derry. »Sind die hier alle so? So bissig, meine ich.«
»Sie ist sehr nett. Hunde –«
»Ja, ich weiß, Hunde, die bellen, beißen nicht«, sagte Derry. »Wenn du in einem anderen Zeitalter gelebt hättest, Jon, hättest du wahrscheinlich das gleiche von Lucrezia Borgia gesagt – oder von Heinrich dem Achten …«
Jonathan lächelte.
Nicholas Fox sagte scharf: »Sei doch still, Derry, wenn du nichts Vernünftiges zu sagen hast.« Er zog sich einen Stuhl an Jonathans Bett. »Jetzt erzähl mal von Frankreich, mein Junge. Ich will alles ganz genau wissen.«
»Nimm’s mir nicht übel, Vater, aber ich bin ziemlich müde. Es wäre schön, wenn du mir etwas erzählen würdest. Wo ist Mutter? Konnte sie nicht mitkommen?«
»Deiner Mutter geht es in letzter Zeit leider nicht besonders gut.«
Jonathan sah ihn erschrocken an, und Nicholas Fox beeilte sich, ihn zu beruhigen. »Der Arzt meint, es sei nichts allzu Ernstes. Es sind die gleichen Beschwerden, die sie letztes Jahr schon hatte. Aber sie schickt dir natürlich liebe Grüße.«
»Danke. Grüß du sie auch von mir, ja?« Jonathan legte sich ins Kissen zurück. Unter der Sonnenbräune war sein Gesicht blaß und angestrengt. »Erzähl mir von zu Hause, Vater. Was macht die Kanzlei?«
»Ach, ich habe zu tun. Leider zieht Campkin immer noch die meisten lohnenden Fälle an Land.«
Die Kanzlei Campkin war die Konkurrenz. Jonathan drückte angemessenes Bedauern aus.
»Nun ja, ich bin immer schon der Ansicht gewesen, daß die Campkins unzulässigen Einfluß ausüben«, fügte Nicholas Fox hinzu. »Reginald Campkins älterer Bruder war ja Sir Lionel Fripps Gutsverwalter. Ohne Ronald dürfte es Reginald allerdings schwerfallen, so viele Mandate anzunehmen wie wir. Vielleicht können wir in Zukunft auf mehr Ausgeglichenheit hoffen.«
»Ronald Campkin ist in der Schlacht an der Lys gefallen«, erklärte Derry.
»Drei Töchter –«
»Vielleicht gibt dir das den entscheidenden Vorteil, Dad.«
»Wenn du wieder gesund bist, Jonathan …«
»Der arme alte Ronnie – er war ja nicht übermäßig helle, aber …«
»Die Kanzlei könnte einen jüngeren Mitarbeiter gebrauchen.«
»… wirklich entgegenkommend von ihm, daß er diesem Heckenschützen den Kopf hingehalten hat.«
Einen Moment trat schockiertes Schweigen ein. »Derry!« rief Nicholas Fox dann empört.
»Ich könnte einen Schluck frisches Wasser gebrauchen«, sagte Jonathan hastig.
»Ich verstehe nicht«, Nicholas Fox war hochrot im Gesicht, »warum du es bei jeder Gelegenheit darauf anlegst, mir das Wort im Mund umzudrehen.«
»Ich wollte doch nur sagen«, verteidigte sich Derry mit Unschuldsmiene, »daß man, wenn man sich über den Geschäftsrückgang bei Campkin freut, auch die Bemühungen des deutschen Heckenschützen würdigen muß, der den Sohn erledigt hat.«
Nicholas Fox sprang auf. Jonathan wies zu der Wasserkaraffe auf seinem Nachttisch. »Meinst du …«
Derry klemmte die Karaffe unter den Arm und eilte aus dem Zimmer. Er befand sich am Ende eines langen Korridors. Einige der Türen, an denen er auf der Suche nach einer Wasserquelle vorüberkam, standen offen, andere waren geschlossen. Er bemühte sich, nicht in die offenen Zimmer hineinzusehen, doch er hatte Mühe, seine Neugier zu bändigen. Außerdem, sagte er sich, wäre das, was er zu sehen bekäme, sicher nicht schlimmer als die Greuel, die er sich in seiner Phantasie ausmalte. Als er Stöhnen hörte, ging er schneller.
Das Haus war der reinste Irrgarten, so verwinkelt und verschachtelt, daß er bald jegliche Orientierung verloren hatte. Schwestern mit weißen Häubchen eilten mit strengen Gesichtern und zielstrebigen Schritten vorüber. Eine Frau im Pelzmantel schob einen Patienten im Rollstuhl, ihren Sohn vermutlich. Über den Beinen des Mannes lag eine Decke – nein, falsch, korrigierte sich Derry. Es war nur ein Bein; an der Stelle, wo das zweite hätte sein müssen, war eine schauderhafte Mulde, in die die Decke schlaff hineinfiel. Derry drückte sich an die Wand, um dem Rollstuhl Platz zu machen, ehe er seine Suche nach einer Toilette oder Küche, irgendeinem Raum, in dem es einen Wasserhahn gab, fortsetzte. Er hätte viel für eine Prise frischer Luft gegeben; beim Blick aus einem Fenster, stellte er sich vor, er liefe über den froststeifen Rasen und füllte die Karaffe am Fischteich.
Als er etwas später Wasser plätschern hörte, stieß er vorsichtig eine angelehnte Tür auf. Kein Krankenzimmer, Gott sei Dank. Eine Art Waschraum.
Er stieß die Tür ganz auf und sah an einem großen Spülbecken Miss Gregory stehen. Neben ihr türmte sich ein Arsenal von Bettpfannen.
»Aha! Ich wußte nicht, was für Pfannen Sie spülen sollten«, sagte Derry, »aber ich dachte mir schon, daß es etwas Unerfreuliches sein muß.«
Sie richtete ihren strengen grünen Blick auf ihn. »Kann ich Ihnen behilflich sein, Mr. –?«
»Fox«, sagte er. »Derry Fox.«
»Natürlich.« Sie runzelte die Stirn. »Der Bruder von Nummer siebzehn.«
»So sehen Sie die Patienten? Als Nummern?«
Sie drehte ihm den Rücken zu und tauchte ihre Hände in das Becken voll Seifenwasser. »Ja«, antwortete sie, »dann macht es mir nicht soviel aus, wenn sie sterben.«
Er betrachtete sie. Sie war mittelgroß, aber sehr dünn, mit scharfkantigen, knochigen Schultern und roten Händen und Handgelenken – vom heißen Wasser vermutlich. Das volle dunkle Haar war unter eine Haube geschoben, die ihrem Gesicht nicht schmeichelte.
Er fragte neugierig: »Warum nennt man Sie Miss Gregory und nicht Schwester Gregory?«
Eine weitere gespülte Bettpfanne landete klirrend auf dem Abtropfbrett. »Weil ich Hilfsschwester bin und keine ausgebildete Krankenpflegerin.«
»Und darum müssen Sie solche Arbeiten machen?«
»So viele Fragen, Mr. Fox.« Sie hatte die Ärmel hochgekrempelt, und er sah die Muskeln, die aus ihren dünnen Armen hervorsprangen, als sie mit einer Bürste schrubbte. »Aber ja, darum muß ich solche Arbeiten übernehmen.«
»Warum lassen Sie sich dann nicht als Krankenschwester ausbilden?«
»Weil ich noch nicht alt genug dafür bin.«
»Aha«, sagte er. »Noch jemand.«
Sie hielt einen Moment in ihrer Arbeit inne und trocknete sich die Hände an ihrer Schürze. Dann drehte sie sich herum und sah ihn an. »Wie meinen Sie das, ›noch jemand‹?«
Er zuckte die Achseln. »Noch jemand wie ich. Nicht alt genug.« Er zog eine Packung Zigaretten aus seiner Tasche und bot ihr eine an. Sie warf einen Blick zur Tür, dann nickte sie. Er zündete zwei Zigaretten an und reichte ihr eine. »Ich war im Mai achtzehn«, erklärte er. »Einberufungsalter war achtzehneinhalb – das wäre für mich im November gewesen. Vor einem Monat, genau als der Krieg zu Ende war. Ich denke, unsere Generation – der Sie und ich angehören – wird immer zur Bedeutungslosigkeit verdammt sein. So eine Art Generation der Zu-spät-Gekommenen. Verstehen Sie, um Haaresbreite an der Mitwirkung bei weltbewegenden Ereignissen vorbeigeschlittert.«
Sie zog an ihrer Zigarette. »Und?«
»Und darum werden wir wahrscheinlich nie recht wissen, was wir mit unserem Leben anfangen sollen, und werden es wahrscheinlich nie zu was Besonderem bringen.«
»Ist das denn so wichtig?«
»Für mich schon«, antwortete er ruhig.
Sie schwieg. Er hatte den Eindruck, daß sie versuchte, sich ein Bild von ihm zu machen. Dann sagte sie: »Wollten Sie denn Soldat werden?«
»Darum geht es nicht. Ich wäre vermutlich ein sehr schlechter Soldat gewesen, und vielleicht hätten sie mich auch gar nicht genommen, weil ich als Kind mal Lungenentzündung hatte. Außerdem wäre ich damit dem Beispiel meines großen Bruders gefolgt, und davon habe ich, ehrlich gesagt, wirklich genug.«
»Mögen Sie Ihren Bruder nicht?«
»Doch, natürlich. Er ist ein guter Mensch, ehrenhaft und tapfer, eben ganz so, wie ein rechter Mann sein sollte.«
Sie drückte ihre Zigarette in einer Untertasse aus und wandte sich dem Spülbecken zu. »So, wie Sie das sagen, könnte man meinen, es wäre eine Krankheit.«
»Durchaus nicht.«
Sie hielt ihm eine Hand hin. »Geben Sie mir die Flasche.«
Er wartete, während sie die Karaffe mit Wasser füllte. Als sie sie ihm zurückgab, sagte sie: »Sie sollten stolz sein auf Ihren Bruder, Mr. Fox. Er hat ständig Schmerzen – hat er Ihnen das gesagt? –, aber beklagt sich nie und verliert nie die Beherrschung. Sie sollten stolz auf ihn sein.«
Als Alix gegen Abend im Park des Lazaretts einen Spaziergang machte, fiel ihr wieder ein, was Derry Fox gesagt hatte. Wir werden wahrscheinlich nie recht wissen, was wir mit unserem Leben anfangen sollen, und werden es wahrscheinlich nie zu was Besonderem bringen. Und als sie ihn gefragt hatte, ob das denn so wichtig sei, hatte er sie mit nachtdunklen Augen ernst angeblickt und gesagt: »Für mich schon.« Als er ein paar Minuten später gegangen war, hatte sie darüber nachgedacht, daß sie sich dieser Tage kaum über etwas anderes Gedanken machte als ihren schmerzenden Rücken und ihre brennenden Füße, über die Unmöglichkeit, ihre Arbeit in der vorgegebenen Zeit zu schaffen, und Strategien, um Schwester Martin aus dem Weg zu gehen.
Hinter ihr knackte ein Ast, und sie drehte sich herum.
»Guten Abend, Captain North«, sagte sie lächelnd.
»Hallo, Miss Gregory.«
Captain North war seit beinahe zwei Monaten hier im Lazarett. Er war ein hochgewachsener, schlanker Mann mit sanftmütigen Augen und braunem Haar, das an den Schläfen zu ergrauen begann.
Er warf einen Blick auf das Buch in Alix’ Händen. »Haben Sie gezeichnet? Ich möchte Sie auf keinen Fall stören.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich hatte es eigentlich vor, aber das Licht ist nicht gut genug.«
»Was zeichnen Sie denn? Diese scheußlichen Rhododendronbüsche?«
Sie standen am Rand der ausladenden Hecke. Sie lächelte. »Ja, sie sind wirklich nicht sehr schön.«
»Im Frühjahr, wenn sie in Blüte stehen, sehen sie wahrscheinlich prachtvoll aus.«
»Ich glaube nicht, daß wir im Frühjahr noch hier sein werden. Was meinen Sie, Captain North?«
»Nein, wahrscheinlich nicht.« Er sah sie fragend an. »Was werden Sie dann tun?«
»Ich habe keine Ahnung.« Wir werden wahrscheinlich nie recht wissen, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Derry Fox’ Worte arbeiteten in ihr und wollten sie nicht loslassen.
»Ich habe das Gefühl, Ihnen ist kalt, Miss Gregory«, sagte er. »Wollen wir ein Stück gehen?«
Seite an Seite gingen sie langsam unter den Bäumen dahin. Schwester Martin wäre voll des Tadels gewesen, wenn sie sie gesehen hätte. Fehlende Distanz zu den Patienten, Miss Gregory! Sie konnte derartiges in einem Ton sagen, als hätte man eine Todsünde begangen. Aber Schwester Martins Ansichten würden wahrscheinlich nicht mehr lange von Bedeutung sein, sagte sich Alix.
Durch den Wald stiegen sie aufwärts. Alix, die sich im Dienst einen flotten Schritt angewöhnt hatte, ging langsam, um Captain North nicht zu ermüden. Als sie die Bäume hinter sich gelassen hatten und auf der Anhöhe standen, sah sie die weite Ebene der South Downs und jenseits das Meer, auf dessen Wasser die ersten Sterne ihr Licht streuten.
»Ich weiß nie«, sagte er nachdenklich, »welchen Blick ich schöner finde. Den auf die Wälder oder den aufs Wasser.«
»Oh, den aufs Wasser«, sagte sie sofort. »Das Meer ist mir tausendmal lieber. Ich hasse den Wald. Er ist so finster und trist.«
Er sah sie an. Er hatte ein angenehmes Gesicht, aristokratisch und intelligent. Narben, die Splitterverletzungen hinterlassen hatten, durchzogen auf einer Seite seine untere Gesichtshälfte.
»Das ist das erste Mal, daß ich so eine entschiedene Meinung von Ihnen höre, Miss Gregory.«
Sie antwortete nicht.
Nach einer Weile sagte er: »Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin. Das wollte ich gewiß nicht.« Wieder ein kurzes Schweigen. »Würden Sie mir erlauben, einen Blick in Ihr Skizzenbuch zu werfen? Ich habe früher auch gezeichnet, wissen Sie, aber ohne den Arm …«
Der rechte Ärmel seines Jacketts steckte leer in der Jackentasche. Alix schämte sich ihres Mißmuts. Sie hielt ihm das Buch hin.
»Natürlich, gern. Aber ich warne Sie, besonders gut sind die Zeichnungen nicht.«
Er blätterte in dem Buch. Das Licht reichte ihm gerade noch, um Details erkennen zu können. Einige der Skizzen waren in Bleistift ausgeführt, andere mit Feder und Tinte.
»Die sind ja hervorragend. Das Gartenhaus … Wie Sie die Schatten der Skulpturen eingefangen haben, das ist wirklich gut. Und dieses alte Bauernhaus hier …« Er schwieg einen Moment. »Hatten Sie Unterricht?«
»Ja, bei meinem Vater«, antwortete sie. »Er hat mir alles beigebracht.«
»Er ist offensichtlich ein sehr begabter Zeichner.«
»War«, korrigierte sie. »Er ist vor sechs Monaten gestorben.«
»Oh, das tut mir leid.« Er sah sie an. »Ich kann mir vorstellen, daß er Ihnen sehr fehlt.«
»Ich habe kaum Zeit, an ihn zu denken.« Sie nahm das Buch wieder an sich und wandte sich zum Gehen. »Ich habe immer soviel zu tun.«
»Ja, man sorgt dafür, daß man viel zu tun hat, nicht wahr?« Captain North eilte ihr nach.
Unter ihnen spiegelte sich der Vollmond in einem kreisrunden kleinen Teich.
»Ich habe meinen Vater 1914 verloren und meinen älteren Bruder im letzten Jahr. Seither habe ich ständig versucht, mich mit Beschäftigung abzulenken – sogar in den Urlauben –, nur um nicht zum Nachdenken zu kommen.«
Sie hörte das Rasseln seines Atems, als er sich abmühte, mit ihr Schritt zu halten, blieb stehen und legte ihm die Hand auf den Arm, um ihm Gelegenheit zu geben, sich zu erholen.
Nach einer Weile sagte er: »Das ist das Schlimme hier, man hat viel zuviel Zeit zum Grübeln.«
Sie spürte, daß ihn fröstelte. »Wir sollten ins Haus zurückgehen, Mr. North«, sagte sie. »Es ist spät, und Schwester Martin wird mir kräftig die Leviten lesen.«
In dieser Nacht träumte sie wieder von ihm. Sie war dabei, ihn anzukleiden: das Samtjäckchen mit dem Spitzenkragen, die Samthose, die dazugehörte. An jedem seiner Stiefel sechs Knöpfchen. Als sie niederkniete, um sie durch die Ösen zu schieben, schien das Leder in ihren Fingern zu schmelzen. Sie wollte ihn fassen und festhalten, aber er zog sich vor ihr zurück wie jedesmal und löste sich in den Schatten auf, bis nichts mehr von ihm übrig war als der rötliche Schimmer seines Haars und das silberne Blitzen des kleinen Schwerts …
Keuchend fuhr sie in die Höhe und rang nach Atem. Ihre Zimmergenossin stöhnte gereizt: »Mensch, Gregory, jetzt gib endlich Ruhe«, drehte sich auf die andere Seite und zog sich die Bettdecke über den Kopf.
Als die Panik nachgelassen hatte, stand Alix auf. Sie kniete sich ans Fenster, zog den Vorhang zurück und legte ihre Stirn an das kühle Glas. Sie rieb sich die Augen, aber die waren völlig trocken. Sie weinte nicht um Charlie. Sie hatte seit 1914 nicht mehr geweint.
Nachdem sie angefangen hatte, im Lazarett zu arbeiten, war ihr klargeworden, daß sie damals so etwas wie einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Sie erinnerte sich, daß die gleichen Symptome sie gequält hatten, die sie jetzt bei den vom Krieg traumatisierten Soldaten in Fallowfield wahrnahm. Alpträume schlimmster Art, die sich heimtückisch in die wachen Stunden des Tages einschlichen. Die Patienten sahen verstümmelte Kadaver und gefallene Kameraden, alle Greuel der Schützengräben suchten sie im friedvollen Park des Lazaretts heim. Alix selbst hatte vor vier Jahren überall den kleinen Charlie Lanchbury gesehen. Schattenkinder hatten sich hinter den Bäumen im Garten versteckt, waren durch das Menschengewühl auf dem Marktplatz geflitzt und verschwunden. Immer wieder hatte sie ihn im Park gesehen: in einem glitzernden Sonnenstrahl, der durch die Bäume fiel, in der sachten rhythmischen Bewegung einer Schaukel. Und immer wenn sie nach ihm greifen wollte, hatte er sich aufgelöst, war flirrend in Unsichtbarkeit zerfallen.
Abgesehen von der Erinnerung an diese Trugbilder war ihr von den Monaten, die ihrer Rückkehr nach England folgten, kaum etwas im Gedächtnis geblieben. Sie hatte überlebt, weil sie gelernt hatte, die Erinnerungen an jenen Sommer in einer Kammer ihres Bewußtseins einzusperren und die Tür niemals zu öffnen. Ihre Eltern hatten ihr geholfen zu vergessen. Ihr Vater hatte sie gezwungen, anstrengende Wanderungen mit ihm zu unternehmen, die sie körperlich erschöpft hatten; sie hatte den Namen jeder Blume, jedes Baums und jedes Vogels lernen müssen; sanft aber unnachgiebig hatte er darauf bestanden, daß sie alles zeichnete, was sie sah, jede Landschaft, jedes Gebäude. Nach einer Weile hatte sie erkannt, daß er versuchte, ihr Bewußtsein mit anderen Erinnerungen zu füllen und die Lücke zu schließen, die Charlie hinterlassen hatte.
Ihre Mutter hatte die schrecklichen Ereignisse jenes Sommers nur ein einziges Mal angesprochen. »Du darfst dir keine Vorwürfe machen, Alix«, hatte sie gesagt. »Du warst für eine solche Verantwortung viel zu jung. Wir vergessen das einfach. Wir sprechen nicht mehr darüber.« Und daran hatten sie sich gehalten. Der Name Charlie Lanchburys wurde in der Familie Gregory nie wieder erwähnt. Aber Alix hatte über die Worte ihrer Mutter bittere Tränen geweint; sie hatte begriffen, daß sie für ihre Mutter ebenso schuldig war wie für Charles Lanchbury.
Andere Narben blieben. Sie war mißtrauischer geworden. Das frühere kindliche Vertrauen war zerstört. Am wenigsten traute sie sich selbst. Sie war es zufrieden, im Lazarett die Bettpfannen zu säubern und die Böden zu schrubben, weil man dabei keine Fehler machen konnte. Die Hälfte ihres Verdiensts schickte sie jeden Monat ihrer Mutter.
Die Lanchburys und die Gregorys hatten seit dem Sommer 1914 keinerlei Kontakt mehr. Charles Lanchbury gab der Tochter seiner Schwester die Schuld am Verlust seines einzigen Sohns; er hatte daher weder Alwyn Gregorys Beerdigung beigewohnt, noch hatte er auch nur einen Finger gerührt, um seiner mittellosen verwitweten Schwester zu helfen. Schuld und Verlust hatten alle Familienbande zerrissen. Beatrice Gregory mußte Schneiderarbeiten ins Haus nehmen, um sich über Wasser halten zu können, und war trotz des eigenen Verdiensts auf die Unterstützung ihrer Tochter angewiesen.
Jetzt sah Alix Charlie nur noch in ihren Träumen. Während sie aus dem Fenster in den dunklen Park hinunterblickte, zwang sie sich, zurückzuschauen und zu versuchen, die Leerstellen zu füllen. Von der Heimreise von Frankreich nach England waren ihr einzig das Grauen in Tante Maries Augen in Erinnerung und die ängstliche Verwirrung der drei kleinen Mädchen. Tante Marie hatte auf der ganzen Reise nicht ein einziges Wort gesprochen. Der Verlust ihres Sohns hatte sie gebrochen. Sie war wie erstarrt gewesen, hilflos und lethargisch, und wäre wohl in Calais einfach im Zug sitzengeblieben, in die Finsternis in ihrem Inneren versunken, wenn nicht ihr Mädchen sie beinahe gewaltsam hinausgebracht hätte.
Onkel Charles hatte die Familie nach Hause geschickt, weil die Kriegserklärung Frankreichs an Deutschland unmittelbar bevorstand. Er selbst war in Frankreich geblieben, um die Suche nach Charlie fortzusetzen. Sowohl die örtliche Gendarmerie als auch die Einheimischen hatten ihm, wie er versicherte, als er seiner stummen Frau Lebewohl sagte, ihre Hilfe zugesagt. Aber schon wenige Wochen später waren das Schloß der Boncourts, der Wald, an dessen Saum sie ihr Picknick veranstaltet hatten, und das Dorf, wo der unglückselige Jahrmarkt stattgefunden hatte, von den einfallenden kaiserlichen Truppen überrannt und zerstört worden. Onkel Charles war ohne seinen Sohn nach England zurückgekehrt. Mit seiner Heimkehr war alle Hoffnung erloschen, und Alix hatte tagelang zusammengerollt wie ein Tier in ihrem Bett gelegen, mit niemandem gesprochen und das Essen verweigert.
Im Lauf der vergangenen vier Jahre waren die goldenen Felder Nordfrankreichs verwüstet worden, nichts war von ihnen geblieben als zu Schlamm zertrampelte Erde und Bombenkrater. Die Landbewohner hatten vor den gegnerischen Heeren, die die Ebenen Flanderns und der Picardie überzogen, aus ihren Höfen und Dörfern flüchten müssen. Wenn überhaupt noch eine Spur von Charlie geblieben war – ein Fetzchen Spitze, das sich an einem Ast verfangen hatte vielleicht, oder ein kleiner Stiefel, verloren in einem Graben –, dann hatte der Krieg sie längst ausgelöscht.
Alix sah auf ihre Uhr. Fünf nach vier. Nicht einmal mehr eine Stunde bis zum Wecken. Sie kroch wieder in ihr Bett, zog die Decke hoch und fiel augenblicklich in tiefen Schlaf.
Nach dem Frühstück nahm Schwester Turner sie beiseite.
»Sie haben heute Sonderdienst, Gregory. Nummer siebzehn hatte eine schlechte Nacht – der Arzt ist besorgt. Er meint, es sollte jemand bei ihm bleiben.«
»Jetzt gleich, Schwester?«
»Ja, jetzt gleich. Laufen Sie schon, Gregory.«
»Was fehlt ihm denn?«