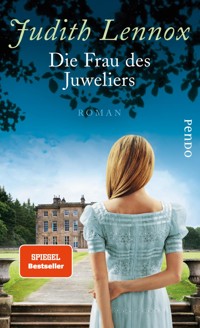9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Würde ich ihn überhaupt wiedererkennen, nach all der Zeit?« – Unzählige Briefe hat Bess an ihren Sohn geschrieben, seit sie ihn in Indien zurücklassen musste, doch sie hat nie eine Antwort bekommen. Bis es eine halbe Ewigkeit später an ihre Haustür klopft: Der selbstbewusste junge Frazer ist gekommen, um sein Erbe anzutreten … Mit Spannung und Eleganz erzählt die britische Erfolgsautorin Judith Lennox das aufregende, drei Generationen umspannende Schicksal einer Familie im 20. Jahrhundert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für meine Schwiegertochter Lizzie
Übersetzung aus dem Englischen von Mechtild Sandberg
ISBN 978-3-492-95338-2
September 2016
© Judith Lennox 2006
Titel der englischen Originalausgabe:
»A Step in the Dark« Headline Review, London 2006
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2007
Umschlaggestaltung: Mediabureau Patrizia di Stefano
Umschlagabbildung: Ilina Simeonova / Trevillion Images (Frau); Paula Moss / Getty Images (Hintergrund)
Datenkonvertierung E-Book: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Teil 1
Bess Ravenhart
1914–1919
1
AUF DEM SCHIFF, das sich immer weiter von Indien entfernte, dachte Bess Ravenhart an ihren Sohn.
An das hellblonde Haar, das zahnlose Babylächeln, die drallen kleinen Hände, wenn sie nach einem Blatt oder einer Nuss griffen, um sie ihr zu bringen. An sein glucksendes Lachen, wenn die Nuss zu Boden fiel und sie ihn in die Arme nahm und küsste.
Während sie zum tiefblauen Wasser des Indischen Ozeans hinausblickte, musste sie plötzlich daran denken, dass ihre Ehe mit einem Lachen begonnen und mit einem Lachen geendet hatte. »Ich hörte dein Lachen und habe mich nach dir umgeschaut«, hatte Jack Ravenhart einmal zu ihr gesagt. »Und als ich dich sah, wusste ich, dass ich dich heiraten würde.«
Sie hatten sich an einem indigoblauen Abend kennengelernt. Die Markthalle in Shimla war hell erleuchtet und voller Menschen, und in der Nachtluft hing der Geruch von Gewürzen und Holzfeuern. Bess war während einer Geschäftsreise ihres verwitweten Vaters bei Freunden in der Stadt zu Besuch. Ganz Shimla traf sich abends in der Markthalle. Es wurden heimliche Verabredungen getroffen, Streitigkeiten angezettelt oder beigelegt, Liebesabenteuer mit einem kurzen Blick begonnen.
Bess konnte sich später nicht erinnern, warum sie gelacht hatte. Aber sie erinnerte sich ihr Leben lang an den Moment, als sie den hochgewachsenen, gut aussehenden Jack Ravenhart das erste Mal sah. Im Sattel eines tänzelnden schwarzen Pferds auf der anderen Seite der Markthalle. Sie nahm das Blitzen von Sporen und Uniformknöpfen wahr und seinen Blick, als sie vorüberging, und ihr Lachen wurde ein wenig gezwungen. In seinen Augen erkannte sie den Ausdruck, der ihr bald so vertraut wurde, eine Mischung aus Begierde, Entzücken und Verwegenheit.
Sie heirateten drei Monate später. Jack ließ keine Einwände gelten. Er wollte sie haben, und er bekam immer, was er wollte. Bess war achtzehn, als sie Jack Ravenharts Frau und die Schwiegertochter von Fenton und Cora Ravenhart wurde. Sie und Jack lebten in einem geräumigen, ebenerdigen Bungalow in Shimla mit großer Dienerschaft und einem Stall voller Polo-Ponys und Jagdpferde.
Ein Jahr später wurde ihr Sohn Frazer geboren. An ihrem Lebensstil änderte sich dadurch kaum etwas. Ein Kindermädchen versorgte Frazer, während Bess und Jack weiterhin Kostümfeste und Bälle besuchten, an Picknicks teilnahmen, auf die Jagd gingen und zu den Pferderennen. Trotzdem hatte sich etwas verändert, Bess wusste es, aber sie behielt es für sich. Wenn sie sich für den Abend ankleidete, nahm sie sich ein paar Augenblicke, um ihr schlafendes Kind zu betrachten, gerührt von der weichen Rundung der Wange und den pummeligen kleinen Händen, bis Jack sie dort wegholte und mit sich aus dem Haus zog, während sie noch ihre Handschuhe knöpfte oder eine letzte Nadel ins Haar schob.
Die Ehe mit Jack Ravenhart war ein Abenteuer, und sie genoss es. Keine Herausforderung war ihm zu groß; er liebte die Spannung und suchte die Gefahr. Ausgelassen und unbeschwert tanzten sie durch die zwei Jahre ihrer Ehe. Sie stachelten einander an; in Jack hatte sie einen Partner gefunden, dessen Lebenshunger so groß war wie ihr eigener. Sie waren vom selben Schlag, sie lebten den Augenblick, ohne sich um die Zukunft zu sorgen.
Die Tage der Unbeschwertheit fanden mit seinem Tod ein jähes Ende. Es war früh am Morgen, noch nicht richtig hell, und sie ritten in den Hügeln oberhalb von Shimla. Er forderte sie zu einem Rennen heraus, aber eine plötzliche Furcht, eine böse Ahnung – der unbekannte steinige Weg, der Nebel, der sich in den Kiefern verfing – trieben sie dazu, ihn zurückzuhalten. »Nein, Jack!«
Ihr Schrei hing noch in der Luft, als er seinem Pferd die Sporen gab und den schmalen Pfad hinuntergaloppierte. Das Letzte, was sie hörte, bevor das Pferd ihn abwarf, waren trommelnder Hufschlag und, aus der Ferne, sein unbekümmertes Lachen.
Ein abgebrochener Ast quer über dem Weg, sagten sie ihr, und der Nebel, der den Rand einer abschüssigen Böschung verbarg. Jack Ravenhart hatte sich bei dem Sturz das Genick gebrochen. Der endlose Reigen rauschender Feste und aufregender Unternehmungen, der ihr Leben in Shimla gewesen war, hatte ein schreckliches Ende gefunden.
Mit Jacks Tod verlor es alle Farbe. Nachts, wenn sie allein im Bett lag, war ihr, als hörte sie immer noch sein Lachen.
»Was haben Sie jetzt vor?«, fragte Cora Ravenhart, Jacks Mutter, am Tag nach der Beerdigung.
Sie hatte Bess in dem Haus aufgesucht, das diese mit Jack zusammen bewohnt hatte, eine große, imposante Person mit wogendem Busen und eng geschnürter Taille. Das Schwarz ihrer Kleidung betonte die Blässe ihres vom Schmerz gezeichneten Gesichts.
»Ich dachte …«, begann Bess und sprach nicht weiter, als sie die Fallen hinter der Frage erkannte.
Cora Ravenhart setzte sich nicht. Sie ging unablässig im Zimmer umher und berührte hier eine Vase, dort einen Vorhang oder einen Paravent mit Holzschnitzereien. »Hier werden Sie leider nicht bleiben können, Elizabeth. Jack hat seine Angelegenheiten nicht gerade wohlgeordnet hinterlassen. Es sind hohe Schulden da. Die Kosten für den Haushalt – seine persönlichen Ausgaben …« Coras Blick blieb einen Moment geringschätzig an Bess haften, als sie hinzufügte: »Das Leben, das Sie und Jack geführt haben – Sie haben über Ihre Verhältnisse gelebt.«
»Das wusste ich nicht«, murmelte Bess.
»Ach nein? Das Einkommen eines Kavallerieoffiziers ist bescheiden. Niemals hätten Sie ein solches Leben führen können, wenn wir Jack nicht unter die Arme gegriffen hätten – und zwar sehr kräftig. Dieses Haus –«
»Unser Haus?«
»Es gehört natürlich Fenton.« Fenton Ravenhart, Jacks Vater, war so kalt und unzugänglich, wie sein Sohn herzlich und offen gewesen war.
Cora blieb stehen, als ihr Blick auf die Fotografie von Jack fiel, die auf dem Klavier stand. Als sie wieder zu sprechen begann, war ihre Stimme noch härter als zuvor. »Alles hier gehört Fenton. Sie haben nichts. Und kein Mensch kann verlangen, dass wir jetzt zwei Haushalte finanzieren. Die Ausgaben –«
»Sind Sie hergekommen«, unterbrach Bess heftig, »um mir mitzuteilen, dass Frazer und ich jetzt bei Ihnen leben müssen?«
Cora Ravenhart lachte. »Das würde wohl kaum gut gehen, meinen Sie nicht auch, Elizabeth? Lassen Sie mich offen sein: Ich glaube nicht, dass das uns oder Ihnen passen würde.«
Die Abneigung in Cora Ravenharts Blick, zu Jacks Lebzeiten stets sorgfältig versteckt, kam jetzt offen zum Vorschein. »Ich nahm an«, fuhr Cora Ravenhart fort, »Sie würden zu Ihrem Vater zurückkehren. Er würde Sie doch sicher aufnehmen?«
»Ja… ich weiß nicht …« Es war fast zwei Jahre her, dass sie ihren Vater das letzte Mal gesehen hatte. Joe Cadogan war ein Getriebener und ein Träumer, immer auf der Jagd nach dem einmaligen Unternehmen, mit dem er endlich sein Glück machen würde. Er war kurz nach Bess’ Heirat in das Land seiner Herkunft zurückgekehrt.
»Mein Vater lebt jetzt in England«, sagte sie.
Ihre Schwiegermutter schaute zum Fenster hinaus, eine schwarze Silhouette vor dem flirrenden Blaugrün des Gartens. »Bitte halten Sie mich nicht für kleinlich, Elizabeth. Trotz aller Differenzen zwischen uns, Sie waren Jacks Frau. Ich bin hier, um Ihnen Hilfe anzubieten. Ich werde Ihre Passage nach England bezahlen, und ich werde mich um Frazer kümmern, bis Sie ihn nachkommen lassen können.«
Ich werde mich um Frazer kümmern. Bess schluckte ihre erste zornige Erwiderung hinunter und erwiderte kühl: »Danke, aber ich nehme Frazer natürlich mit.«
Cora Ravenhart setzte sich. »Wissen Sie, wo Ihr Vater lebt?«
»Selbstverständlich.« Aber plötzlich war Bess unsicher. Sie hatte seit Monaten, vielleicht sogar seit einem halben Jahr nichts mehr von ihrem Vater gehört. Sie hatte ihm in das Hotel geschrieben, in dem er wohnte, und ihm Jacks Tod mitgeteilt, aber bisher keine Antwort auf ihr Schreiben erhalten.
»Wissen Sie überhaupt, ob er in Verhältnissen lebt, die einem Kind angemessen sind? Nein? Das dachte ich mir.« Cora Ravenhart lächelte mit schmalem Mund. »Ich habe gehört, er hätte Indien unter – nun, sagen wir, unter etwas dubiosen Umständen verlassen.« Cora Ravenhart senkte bedeutungsvoll die Stimme. »Er hatte Spielschulden, nicht wahr?«
Bess hatte Mühe, ihren aufsteigenden Zorn im Zaum zu halten.
»Ich möchte nur das Beste für Jacks Sohn«, fuhr Cora Ravenhart fort. »Wie Sie sicher auch. Deshalb schlage ich vor, Frazer bleibt hier, und Sie reisen erst einmal allein nach England, um alles vorzubereiten. Wir haben schon seit einiger Zeit vor, Sheldon, den älteren Bruder meines Mannes, in Schottland zu besuchen. Es ist alles veranlasst – wir reisen im nächsten April und bleiben den Sommer über dort, wenn alles klappt. Da können wir Frazer mitnehmen. Bis dahin sollten Sie eine passende Wohnung gefunden haben, um ein Kind großzuziehen. In der Zwischenzeit werde ich regelmäßig schreiben und Sie über seine Entwicklung auf dem Laufenden halten. Das ist sicher die beste Regelung.«
»Aber ich kann ihn doch nicht einfach hierlassen!«, rief Bess. »Er ist alles, was ich noch habe.«
»Frazer ist ein zartes Kind«, sagte Cora Ravenhart kalt und mitleidlos. »Seine Gesundheit könnte bleibenden Schaden nehmen, wenn Sie ihn jetzt mitnähmen und in irgendeiner feuchten, zugigen Wohnung in England unterbrächten. Außerdem wird die Trennung ja nicht länger als ein paar Monate dauern. Sie dürfen nicht an sich denken, Elizabeth. Sie müssen an Frazer denken, daran, was das Beste für ihn ist. Das ist im Moment das Wichtigste.«
Indien war kaum noch zu sehen, doch Bess blieb an Deck des P&O-Passagierdampfers sitzen und blickte unverwandt zu dem schmalen anthrazitgrauen Küstenstreifen zurück. Zum ersten Mal verließ sie Indien, das Land, in dem sie geboren und aufgewachsen war, und unwillkürlich musste sie an die Pferderennen in Annandale denken, dampfender Pferdeatem in der Luft, hohe Kiefern und Himalaya-Zedern, schwarz vor einem perlweißen Himmel. Sie dachte an Feste zu Hause, an die atemlose Spannung bei den Séancen und das schrille kindische Gekicher bei den Pfänderspielen. Sie dachte an die Kartenspiele bis in die frühen Morgenstunden im blauen Dunst des Zigarettenqualms rund um den grün bespannten Tisch, in dessen Mitte ein zerknitterter Haufen Fünfzig-Rupie-Scheine lag. Sie erinnerte sich an das Pink und Gelb der seidenen Kleider der Frauen, an das tiefe Violett und das Orange von Hibiskus und Bougainvillea, an das Gold der Sonne auf den weißen Gipfeln des Himalaya. Und sie dachte an Frazer, wie sie ihn das erste Mal auf dem Arm gehalten und in sein faltiges kleines Gesicht und die blauen Augen hinuntergeblickt hatte, so verschwommen noch und doch so wissend.
Ein Ehepaar namens Williamson, dem auffiel, dass sie Schwarz trug und ganz allein reiste, hatte sich ihrer angenommen. Mrs. Williamson war gutmütig, etwas zerfahren und unordentlich und sprach schnell und atemlos, ohne ihre Sätze zu vollenden. »Dieser Krieg – einfach schrecklich – die armen jungen Männer …«, sagte sie kopfschüttelnd, und Bess fiel ein, dass auf der anderen Seite der Welt ein Krieg ausgebrochen war. Was für sie allerdings ohne Bedeutung war. Alle sagten, er würde spätestens Weihnachten vorbei sein.
Mrs. Williamson erzählte ihr von ihrem Sohn, der in einem Ausbildungslager in England stationiert war, und von ihren beiden verheirateten Töchtern, von denen eine in Indien lebte, die andere in Edinburgh, wo die Williamsons zu Hause waren. Sie zeigte Bess Fotografien ernst blickender Enkel in Spitzenkleidchen und Matrosenanzügen. Abends spielten Bess und die Williamsons um Penny-Einsätze Whist und Pikett – außer natürlich an den Sonntagen. Sonntags wurde an Bord nicht Karten gespielt. Man tanzte oder las einen Roman, oder man lächelte vielleicht sogar, dachte Bess verzweifelt. Die Sonntage zogen sich in endloser, kribbelnder Langeweile hin, es gab nichts, was es leichter gemacht hätte, die Eintönigkeit des endlosen Ozeans oder die glühende Hitze des Roten Meers zu ertragen.
In Port Said, wo das Schiff angelegt hatte, um Kohle aufzunehmen, kamen Soldaten an Bord. Die weniger Schüchternen unterhielten sich mit Bess, wenn sie unter einer Markise, die sie vor der Sonnenglut schützte, an Deck saß. Die Knöpfe und Schulterstreifen ihrer Uniformen blitzten wie Gold; wenn sie mit ihnen sprach, musste sie die Augen mit der Hand beschatten, um sie vor dem grellen Glanz und dem auf dem Wasser gleißenden Licht zu schützen. Sie zwirbelten mit den Fingern ihre Bärtchen, während sie sie mit Blicken beinahe verschlangen. Wenn sie wollte, sagte sie sich, könnte sie einen neuen Ehemann finden, noch bevor das Schiff in Southampton einlief.
Abends, wenn sie in ihrer Kabine allein war, holte sie die Dinge heraus, die ihr am teuersten waren, und legte sie auf dem schmalen Bett aus. Ihre Kaschmirtücher mit den wirbelnden Mustern in Blau, Ocker und Rost, den betörenden Farben Indiens; die Halsketten, Armbänder und Broschen, die Jack ihr zu Geburtstagen und anderen Anlässen geschenkt hatte; Fotografien von Jack und Frazer sowie ein Jäckchen, das sie ihrem kleinen Sohn selbst gestrickt hatte. Das Gesicht in das Jäckchen gedrückt, atmete sie mit geschlossenen Augen den Babyduft, der noch in der Wolle eingeschlossen war.
Wenn sie auf dem Bett saß und die Fotografien betrachtete, sagte sie sich, dass ihre Schwiegermutter sie nur gezwungen hatte, der Realität ins Auge zu sehen. Sie musste diese vorübergehende Trennung Frazer zuliebe ertragen. In einer Woche würde sie in England sein. Sie würde das Hotel aufsuchen, in dem ihr Vater wohnte, und er würde ihr bei der Suche nach einem Haus, das sie mieten konnte, helfen. Dann würde sie Mrs. Ravenhart schreiben und sie bitten, Frazer unverzüglich nach England zu bringen. Vielleicht würde ihr auch ihr Vater die Reise nach Indien finanzieren, und sie würde noch einmal zurückkehren und ihr Kind selbst holen.
Trotzdem hielt das Gefühl des Unbehagens, das sie quälte, seit sie Cora Ravenharts Angebot, sich um Frazer zu kümmern, angenommen hatte, an. Sie wusste, wie sehr Cora Jack, ihr einziges Kind, geliebt hatte. Wenn sie beisammen gewesen waren, hatte sie ihn keinen Moment aus den Augen gelassen. Sie erinnerte sich, wie sie immer neben sich aufs Sofa geklopft hatte, um Jack aufzufordern, sich zu ihr zu setzen; wie milde sie jedes Mal geworden war, wenn er da war, wie sie ihn angelächelt hatte, nur ihn.
Das Schiff legte in Southampton an. Aus den Kaminen stiegen Dampfwolken auf, Träger hasteten mit Bergen von Gepäck auf ihren Karren vom Schiff zum Zug. Es war November, der Himmel war grau und wolkenverhangen. Als sie das Schiff verließ, zögerte sie am Ende der Gangway plötzlich, den Fuß auf festes Land zu setzen. Ein Schritt ins Unbekannte, dachte sie; der erste Schritt in ein fremdes Land, in ein neues Leben.
Am Bahnhof Waterloo trennte sie sich unter Umarmungen, guten Wünschen und mit dem Versprechen, in Kontakt zu bleiben, von ihren Schiffsfreunden, den Williamsons, und nahm ein Taxi. Neugierig schaute sie durch das Fenster in die Londoner Straßen hinaus und versuchte, all das Neue in sich aufzunehmen, während ihr Blick bald hierhin, bald dorthin flog. So viele Automobile und Straßenbahnen, so viele Menschen. Obwohl es erst später Nachmittag war, begann es schon dämmrig zu werden. Die kahlen Äste der Bäume hoben sich aus einem orange-grauen Nebel, und in der feuchten, dunstigen Luft hing eine Vielfalt fremder Gerüche. Als das Taxi um eine Straßenecke bog, lichtete sich der Nebel einen Moment, und Bess konnte das schwarz glänzende Wasser der Themse erkennen. Sie hörte Nebelhörner und die Rufe von Straßenhändlern. Es war kalt, viel, viel kälter als an den Abenden in Shimla. Die feuchte Kälte kroch durch ihren dünnen Mantel und ihre Baumwollhandschuhe. Ich bin in London, dachte sie mit plötzlich aufflammender Erregung. Ich bin in London, der Stadt des Reichtums und der Macht, der großartigsten Stadt Europas.
Vor dem Hotel ihres Vaters angekommen, musste sie erst die fremden Münzen sortieren, um den Taxifahrer bezahlen zu können. Das Hotelfoyer war beeindruckend. Palmen standen in großen Messingtöpfen auf dem blanken Marmorboden, goldgerahmte Spiegel warfen das Licht der Lüster zurück. Frauen in perlenbestickten Abendkleidern mit Federboas um die Schultern kamen die Treppe herunter; hinter einer offenen Tür sah Bess flüchtig Männer in tiefen Klubsesseln sitzen. Sie rauchten und lasen ihre Zeitungen und befahlen den Kellner mit einem Fingerschnalzen zu sich.
Am Empfang fragte sie nach der Zimmernummer ihres Vaters. Der Angestellte beugte sich über ein großes, in Leder gebundenes Buch. Dann sah er auf und schüttelte den Kopf.
»Es tut mir leid, Madam, aber wir haben keinen Gast dieses Namens.«
Bess bestand darauf, dass er noch einmal nachsah. Sein Finger wanderte die Liste von Namen hinunter. »Nein. Ich habe hier keinen Mr. Cadogan.«
»Aber er muss hier sein!«
»Tut mir leid, Madam, nein.« Er klappte das Buch mit einem Knall zu.
Sie blieb mit ihrem Gepäck im Foyer stehen. Was jetzt? Sie versuchte, vernünftig zu überlegen. Eine Stimme riss sie aus ihren Gedanken.
»Vielleicht kann ich Ihnen helfen, mein Kind.«
Der Mann, der sie angesprochen hatte, war groß und weißhaarig und ihrer Schätzung nach etwa im Alter ihres Vaters. »Harris mein Name«, stellte er sich mit einer leichten Verbeugung vor. »Dempster Harris. Ich wohne hier im Hotel. Und wie darf ich Sie nennen, junge Frau?«
Bess nannte ihm ihren Namen. »Mrs. Ravenhart«, wiederholte er und ließ das Wort förmlich auf der Zunge zergehen. »Enchanté.« Er küsste ihr die Hand. »Sie müssen meine Dreistigkeit entschuldigen, meine liebe Mrs. Ravenhart, aber ich hörte rein zufällig, wie Sie nach Joe Cadogan fragten.«
»Kennen Sie ihn?«
»Aber gewiss. Der gute alte Joe.« Mr. Harris’ rotes gesundes Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. »Immer ein Vergnügen, mit ihm zusammen zu sein.«
»Er ist mein Vater«, erklärte sie.
Er sah ein wenig erstaunt aus. »Sie sehen ihm gar nicht ähnlich.«
»Mir wird immer gesagt, dass ich nach meiner Mutter komme. Ich dachte, mein Vater wohnt hier. Wissen Sie vielleicht, wo ich ihn erreichen kann, Mr. Harris?«
»Tja, wir haben uns leider aus den Augen verloren.« Seine Miene drückte Bedauern aus. »Joe ist nach seinem Unfall von hier weggezogen.«
»Unfall?«
»Ja, er wurde von einer Straßenbahn angefahren, der arme Kerl. London ist schrecklich dieser Tage. Man setzt buchstäblich sein Leben aufs Spiel, wenn man nur die Straße überquert. Und Joe – der war das natürlich nicht gewöhnt nach den Jahren da unten in den Tropen.« Er schüttelte den Kopf. »Aber nein, nur keine Aufregung, mein Kind. Er war nur noch ein bisschen angeschlagen, als er aus dem Hotel ausgezogen ist. Vielleicht wollte er irgendwo in die Sonne. Zur Erholung.«
»Ich muss ihn finden.« Ihr Vater würde ihr helfen, sich in dieser dunklen, kalten Stadt ein Zuhause zu schaffen. Sie brauchte ein Zuhause für Frazer.
Er sah zu ihrem Gepäck hinunter. »Sind Sie weit gereist, Mrs. Ravenhart?«
»Ich komme aus Indien«, sagte sie.
»Aus Indien!« Er strahlte. »Davon müssen Sie mir erzählen. Wissen Sie was, wir essen zusammen. Nein, nein, ich bestehe darauf. Und dann werde ich versuchen zu überlegen, wohin unser guter alter Joe verschwunden sein könnte. Beim Essen lässt es sich viel besser denken, finden Sie nicht auch?«
Bess’ natürlicher Optimismus meldete sich zurück, als sie im Speisesaal des Hotels beim Essen saß. Sie war ein wenig beschwipst vom Champagner, den Dempster Harris bestellt hatte, und von der verschwenderischen Pracht um sie herum. Seide und Satin der Damen – sattes Karminrot, Saphirblau, tiefes Violett – hoben sich vom Kaki der Uniformen ihrer Begleiter ab. Im Vergleich zur Gewandtheit und Eleganz dieser Frauen hier erschienen ihr die Damen der besseren Gesellschaft in Shimla im Rückblick altmodisch und provinziell.
Mr. Harris lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Und was sagen Sie zu London, Mrs. Ravenhart? Gefällt es Ihnen hier?«
»Oh, ganz ungeheuer.« Sie lachte. »Vielen Dank übrigens für die Einladung zum Abendessen. Es ist ein Genuss.«
»Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite.« Er hüstelte. »Sagen Sie, Ihr Gatte…?«, erkundigte er sich taktvoll, den Blick auf ihr schwarzes Kleid gerichtet. »Sie haben ihn kürzlich verloren?«
»Ja, mein Mann ist bei einem Reitunfall ums Leben gekommen.«
»Wie entsetzlich …« In seinen Augen blitzte Interesse auf. »Und nun müssen Sie armes Ding sich ganz allein und ohne Schutz durchs Leben schlagen.« Er drückte ihre Hand. »Passen Sie auf, wie wär’s mit einem Tänzchen, wenn wir hier fertig sind? Das würde Sie aufmuntern. Ich kenne da ein fabelhaftes kleines Lokal.«
Sie entzog ihm ihre Hand mit einer höflich gemurmelten Entschuldigung.
Als sie sich verabschiedeten, hatte Bess die Namen der Freunde und Lieferanten ihres Vaters sowie die Adressen seiner bevorzugten Klubs und Pubs. In dem Zimmer, das sie sich im Hotel genommen hatte, las sie noch einmal aufmerksam die wenigen Briefe, die ihr Vater – der nie ein eifriger Briefeschreiber gewesen war – ihr nach seiner Rückkehr nach England geschickt hatte, um vielleicht einen Anhaltspunkt über seinen Verbleib zu entdecken.
Danach stand sie lange am Fenster. Unten auf den Trottoirs waren noch Leute: ein Soldat mit seinem Mädchen; ein Paar in Abendkleidung, das gerade aus einem Taxi stieg. Ihr Blick glitt von den Straßenlampen, die durch den Nebel schimmerten, zu den massigen Häusern, die in den nächtlichen Himmel hineinragten, und sie wünschte, sie könnte wie ein Vogel über diese Häuser mit ihren Läden und Büros aufsteigen und von einer Londoner Straße zur anderen fliegen, um durch Fenster und Kaminrohre zu spähen, bis sie ihn gefunden hatte.
In den folgenden Tagen fühlte sich Bess an die Schnitzeljagden erinnert, die sie und Jack in Shimla so gern veranstaltet hatten. Die Spur ihres verschwundenen Vaters führte sie von Cafés mit dunkelrot ausgeschlagenen Séparées in Restaurants, wo Kellner in weißen Schürzen mit beladenen Tellern und schweren Bierkrügen hin und her eilten. Sie sprach in roten Backsteinvillen vor und befragte Witwen und Strohwitwen von verblühter Schönheit. Die Witwen sprachen mit Wärme von Joe Cadogan, ehe sie den Kopf schüttelten und sagten, sie wüssten leider nicht, wo Joe jetzt lebte, aber sollte Bess ihn finden, wäre es nett, wenn sie ihn an die zehn Shilling erinnerte, die sie ihm geliehen hatten.
Sie suchte ihn in Pubs und Wettbüros, wo die einzigen Frauen die Bedienungen hinter der Theke waren und die Männer ihr anzügliche Blicke und herausfordernde Bemerkungen zuwarfen. Sie antwortete schlagfertig und ließ ihren Schleier zurückgeschlagen. Es fiel ihr nicht ein, sich hinter einem schwarzen Netz vor der Welt zu verstecken. Sie fuhr mit Taxis, Bussen und Untergrundzügen und legte Kilometer zu Fuß zurück. Sie fror ständig, ganz gleich, wie viele Mäntel, wie viele Paar Strümpfe und Handschuhe sie übereinanderzog, und fühlte sich immer weniger wohl, als ihre endlose Suche sie in immer schmalere, düsterere Straßen führte.
Auf einem Straßenmarkt in Spitalfields sammelten barfüßige Kinder Äpfel und Kohlblätter auf, die unter den Ständen lagen; ein in zerrissene Lumpen gehüllter Stadtstreicher schlief in einer Tornische.
Bess klopfte an die Tür eines Fremdenheims, das zwischen einem Kürschner und einer Kräuterhandlung lag. Würzige Gerüche aus der Kräuterhandlung überlagerten den Gestank der Straßen und erinnerten sie flüchtig an Indien.
Die Wirtin führte Bess in ein Zimmer im oberen Stockwerk. Ein alter Mann saß in einem Sessel am Feuer; sie erkannte ihn nicht gleich. Dann hob er den Kopf und sah sie lächelnd an.
»Bess«, sagte er. »Meine Bess. Was um alles in der Welt tust du hier, Liebes?«
Der Unfall habe ihm ein wenig zu schaffen gemacht, erzählte ihr Vater, aber jetzt sei er wieder ganz auf dem Damm. Sie glaubte ihm nicht. Seine Haut hatte einen Stich ins Gelbliche, ständige Erinnerung an die Malaria, die er sich vor langer Zeit in Indien zugezogen hatte. Als er hustete, sah sie Blut in seinem Taschentuch. Die Jahre in England hatten ihn ausgezehrt, als hätten Dunkelheit und Kälte ihn seiner Lebenskraft beraubt. Er freue sich unheimlich, sie zu sehen, sagte er; das Leben sei nicht leicht, und die meisten seiner alten Freunde in England seien tot oder hätten ihn vergessen. Die Arztrechnungen hätten ihm den letzten Penny aus der Tasche gezogen, wenn sie ihm vielleicht ein oder zwei Guineen leihen könnte …
Den Brief, in dem sie ihm von Jacks tödlichem Unfall berichtet hatte, hatte er nicht bekommen. Sie erzählte ihm von der Tragödie, und er sah sie voller Schrecken und Entsetzen an. »Der arme Junge… so jung… ach, meine kleine Bess.«
Als sie sich schließlich von ihm verabschiedete, konnte sie nur mit Mühe das Gefühl der Panik zurückdrängen, das sie beim Anblick ihres Vaters überkommen hatte, der alt und krank in diesem kleinen, kahlen Zimmer hauste.
Zurück im Hotel, nahm sie einen Saphiranhänger und ein goldenes Armband aus ihrer Schmuckschatulle. Sie fand Dempster Harris im Rauchzimmer. »Bitte verzeihen Sie, dass ich Sie belästige, Mr. Harris«, sagte sie, »aber vielleicht können Sie mir sagen, wo ich dieses hier verkaufen kann.« Sie zeigte ihm die beiden Schmuckstücke.
Er zog eine lederne Brieftasche heraus; sie hörte Geldscheine rascheln. »Aber meine liebe Mrs. Ravenhart, das ist doch nicht nötig. Einer schönen Frau wie Ihnen helfe ich immer gern.« Unter dem Schnauzbart kamen die langen gelblichen Zähne zum Vorschein, als er ihr lächelnd die Scheine hinhielt. »Machen Sie sich bitte keine Gedanken über die Rückzahlung dieses kleinen Darlehens. Es wäre mir eine Freude, wenn Sie mein –«, er suchte nach dem rechten Wort, »mein Hilfsangebot annehmen würden.«
Sie dachte an Frazer. Wie er die Ärmchen in die Höhe reckte, um ihr die silbernen Kämme aus den Haaren zu ziehen. Wie er im Garten staunend jeden Vogel, jede Blume wahrnahm. Wenn sie das Geld von Dempster Harris nahm, konnte sie Frazer morgen zu sich holen.
Doch sie lehnte ab. Sie würde schon zurechtkommen; sie würde einen Weg finden. Sie brauchte sich nicht auf einen solchen Handel einzulassen.
Dempster Harris seufzte. »Jammerschade. Wir hätten so viel Spaß haben können.« Sein Blick wurde weich. »Sie erinnern mich an ein Mädchen, das ich einmal gekannt habe. Schwarze Haare und blaue Augen wie Sie.«
Mit dem Geld, das sie für ihren Schmuck bekam, mietete Bess ein möbliertes Reihenhäuschen in Ealing. Sie stellte ein Mädchen für den Haushalt und die Wäsche ein und gab im Lebensmittelgeschäft eine Bestellung auf.
Dann schrieb sie an Cora Ravenhart und erkundigte sich nach Frazer. In eine Daunendecke eingepackt, weil ihr so kalt war, ließ sie ihre Gedanken wandern. Sie dachte an ihre Kindheit in Madras, wo ihr Vater beim Militär gedient hatte, und erinnerte sich der Jahre nach dem Tod ihrer Mutter: Nachdem Joe Cadogan beschlossen hatte, sich als Indigopflanzer zu versuchen, waren sie ins Bergland übergesiedelt. Aber die Plantage war ein Verlustgeschäft, und sie kehrten in die Gluthitze des Flachlands zurück, wo ihr Vater unter die Kaufleute ging und mit Teakholz, Mahagoni sowie indischen Baumwoll- und Seidenstoffen handelte. In diesen Jahren zogen ständig irgendwelche »Tanten« bei ihnen ein und wieder aus. Wäre sie Dempster Harris’ Geliebte geworden, hätte vermutlich auch auf sie das Schicksal einer dieser »Tanten« gewartet, die nur geschätzt wurden, solange sie hübsch und amüsant waren.
Ein beständiges Zuhause hatte Bess nie gekannt; allzu oft waren ihr Wohlbefinden und ihre Geborgenheit vom Ausgang eines Kartenspiels oder den schnellen Beinen eines Pferdes abhängig gewesen. Das Leben mit ihrem Vater war unstet und turbulent. Manchmal hatte sie den ganzen Schrank voller Seidenkleider, dann wieder saß sie schwitzend über Nadel und Faden, um Kleider, aus denen sie längst herausgewachsen war, weiter und länger zu machen. Kaum ein anglo-indisches Mädchen ihres Alters genoss so viele Freiheiten wie sie. Niemand verbot ihr, durch die Basare zu streunen oder nur in Unterwäsche mit den indischen Kindern zusammen im Bach zu baden. Niemand lehrte sie, dass sie über die derben Witze der Freunde ihres Vaters nicht herzhaft lachen durfte, niemand erklärte ihr, dass sie in Gesellschaft mit gefalteten Händen und gekreuzten Füßen zu sitzen hatte und nur sprechen durfte, wenn sie gefragt wurde.
Sie war bei Freunden ihres Vaters in Shimla zu Besuch, als sie Jack begegnete. In Shimla, dieser prüden kleinen Hauptstadt Britisch-Indiens im Hügelland, wurde sie sich zum ersten Mal der Macht bewusst, über die sie verfügte. Sie merkte, wie die Blicke der Männer ihr folgten, wenn sie, gerade in die Gesellschaft eingeführt, in ihrem geliehenen Putz auf Bällen tanzte oder die Markthalle entlangritt, und all dieses männliche Begehren konzentrierte sich für sie in Jack Ravenharts hungrigem Blick. Sie heiratete ihn, denn wie sonst sollte sie im Leben vorankommen? Wie sonst sollte sie überleben?
Hatte sie Jack geliebt? Sie war sich bis heute nicht sicher. Sie hatte ihn gemocht. Und sie hatte ihn begehrt. Von Begierde hatte sie bis zu dem Tag, an dem sie Jack begegnet war, nichts gewusst. Einen Menschen zu mögen und zu begehren, hieß das auch, ihn zu lieben? Sie wusste es nicht. Sie wusste nur, dass sie viel darum gegeben hätte, Jack jetzt bei sich im Bett zu haben, sich nur umdrehen zu müssen, um diesem brennenden Blick zu begegnen, mit dem er sie so oft angesehen hatte. Sie dachte daran, wie es gewesen war, wenn er mit den Fingerspitzen die Linien ihres Körpers nachgezeichnet hatte, wie sehr seine Berührung sie erregt und beglückt hatte, wie sehr sie sich nach dieser Erregung und Beglücktheit gesehnt hatte, wenn er nicht da gewesen war.
Sie wischte die Tränen weg. Tränen halfen nichts, an die Vergangenheit zu denken war Zeitverschwendung. Ihr Blick fiel auf den Briefumschlag auf dem Toilettentisch. Manches hatte sie Cora Ravenhart nicht geschrieben: dass ihr Vater krank war; dass sie kein Geld hatte; dass England ganz anders war, als sie es sich vorgestellt hatte; dass es zu kalt war, dass es zu viel regnete, dass sie nicht mit diesen barfüßigen Kindern, diesen armseligen Lumpenbündeln in Tornischen gerechnet hatte.
Als sie auf ihren Brief keine Antwort bekam, schrieb sie einen weiteren. Der erste, sagte sie sich, war wahrscheinlich verloren gegangen; von London nach Indien war es weit. Den ganzen Winter hindurch, während an der Westfront die erbitterten Kämpfe in eine mörderische Sackgasse führten, schrieb sie Cora Ravenhart einen Brief nach dem anderen. Eine Antwort kam nie. Wie die Stadt unter der Dunkelheit litt, als aus Angst vor Luftangriffen die Straßenbeleuchtung gedämpft wurde, so litt Bess unter den Fragen, die sie quälten. Warum schrieb Cora Ravenhart nicht? Litt Frazer unter der Trennung von seiner Mutter? Er war dreizehn Monate alt gewesen, als sie aus Indien weggegangen war – wie sollte er verstehen, warum sie ihn allein gelassen hatte? Oder war er vielleicht krank? Hatte Mrs. Ravenhart nicht geschrieben, weil sie es nicht übers Herz brachte, ihr schlechte Nachrichten zu übermitteln? Eine kaum erträgliche Spannung staute sich in ihr auf. Die Trennung von Frazer zerriss ihr fast das Herz.
Sie musste Ringe und Armbänder verkaufen, um die Arztrechnungen ihres Vaters, die Miete und das tägliche Leben bezahlen zu können. Jedes Schmuckstück war mit einer Erinnerung verbunden. Der Winter verging langsam, die Kapitel des Buchs, aus dem sie ihrem Vater vorlas, und die Kartenpartien, die sie spielten, markierten seinen schleppenden Verlauf. Nebel und Regen schienen die Stadt einzuschließen, schnitten sie von dem Leben ab, das sie einmal gekannt hatte. In den kältesten Monaten träumte sie von den Affen bei Hanumans Tempel auf dem Jakko Hill. Die Kinder von Shimla hatten sie immer mit Keksen gefüttert. In ihrem Traum rannten die Affen unter lautem Geschnatter endlos durch Kiefern und Geißblatt, und während sie mit ihnen lief, fielen Trauer und Enttäuschung, die sie den ganzen Winter begleitet hatten, von ihr ab.
Immer häufiger träumte sie von Frazer. Manchmal erkannte er sie nicht und wandte sich von ihr ab; manchmal war er merkwürdig verändert, und sie erkannte ihn nicht wieder. Einmal träumte sie, sie käme nach Hause. Als sie Shimla erreichte, fand sie den Bungalow leer; und als sie draußen die Markthalle hinunterblickte, bemerkte sie einen hochgewachsenen jungen Mann mit strahlend blondem Haar, der sich zu ihr umdrehte und ihr lächelnd Lebewohl winkte, bevor er davonging.
In diesem kalten Land blieben die Haustüren überall geschlossen, die Leute trafen sich nicht wie in Indien auf der Straße und plauderten bis lange nach Sonnenuntergang miteinander. Sie spürte die Missbilligung ihrer Nachbarn an ihrem schmallippigen, kühlen Lächeln und an der Tatsache, dass sie niemals eingeladen wurde. Wenn sie sich einsam fühlte, sprach sie mit dem Mann, der die Straßen fegte, oder mit der Frau, die im Süßwarenladen hinter der Theke stand. In der Straßenbahn unterhielt sie sich manchmal mit Soldaten, die sich, im Krieg verwundet, zur Genesung in London aufhielten.
Im Frühjahr 1915 machte sie sich mit dem Gedanken vertraut, dass ihr Vater nicht mehr lange zu leben hatte. Es war um die Zeit der zweiten Schlacht von Ypern, als die Deutschen zum ersten Mal Chlorgas einsetzten. Wie die gasvergifteten Soldaten kämpfte ihr Vater jetzt um jeden Atemzug. Wenn sie an seinem Bett saß und ihm die Hand hielt, hörte sie das Rasseln seiner Lunge und musste zusehen, wie ihm unerbittlich der Lebensmut und die Zuversicht, die immer ein Teil von ihm gewesen waren, abhandenkamen. Weit besser, bei einem Sturz umzukommen wie Jack, dachte Bess: ein kalter Luftzug, ein schnelles Ende.
Ihr Vater starb am ersten Mai. Die Bäume blühten, und zum ersten Mal seit Bess’ Ankunft in England hing ein Hauch von Wärme in der Luft. Nach der Beerdigung sah sie die Sachen ihres Vaters durch: ein Elefant aus Teakholz, eine Messinglampe, ein mit Edelsteinen besetzter Dolch, von dem ihr Vater immer behauptet hatte, ein indischer Fürst habe ihn ihm geschenkt. Die Kleider und das Bettzeug ihres Vaters mussten verbrannt werden, da er an Tuberkulose gestorben war. Seine Bücher verkaufte Bess an ein Antiquariat, den Teak-Elefanten und den Edelsteindolch an einen Antiquitätenhändler in Belgravia. Sie versetzte mehrere ihrer leichten Sommer- und eleganten Abendkleider – allein in diesem kalten Land würde sie sie ja doch nicht brauchen. Ihre restliche Habe packte sie in einen kleinen Koffer.
Während sie das Haus sauber machte, bevor sie der Wirtin den Schlüssel zurückgab, dachte sie an Cora Ravenhart. Fenton und ich haben schon seit einiger Zeit vor, Sheldon, Fentons älteren Bruder, in Schottland zu besuchen. Es ist alles veranlasst – wir reisen im April und bleiben den Sommer über in Schottland, wenn alles klappt.
Sie erinnerte sich an die Fotografie auf dem Sideboard im Haus ihrer Schwiegermutter: Es zeigte den Familiensitz, Ravenhart House, ein großer, grauer Bau, im Hintergrund ragten dunkle Berge auf. »Onkel Sheldons Hütte«, hatte Jack gesagt. »Scheußlich, nicht?«
In der Bibliothek suchte sie Ravenhart auf einer Karte der Britischen Inseln. Sie verfolgte den Weg, den sie zurücklegen musste, bis nach Perthshire in Schottland, von einem Ende der Insel zum anderen. Schreiben würde sie nicht; sie würde Cora Ravenhart nicht vorwarnen. Im Verlauf des langen kalten Winters hatte sich die innere Unruhe zu Misstrauen verhärtet. Sie sah plötzlich Coras Hand im weißen Spitzenhandschuh vor sich, wie sie Frazer über das blonde Haar strich. Diesmal würde sie sich nicht von Cora überreden lassen. Diesmal würde sie ihren Sohn mitnehmen und nie wieder fortlassen.
In Edinburgh musste Bess umsteigen, ehe sie nach Perth, hoch oben im Norden, weiterfahren konnte. Das Land war zu Bergen und Tälern zusammengeschoben wie ein Stück gefälteltes Tuch. Am Abend erreichte sie Pitlochry und übernachtete in einem Gasthaus. Nach dem Abendessen machte sie einen Spaziergang durch den kleinen Ort. Es fiel ihr schwer, ihre Aufregung zu zügeln. Morgen würde sie Frazer sehen. Morgen würde sie ihren Sohn in den Armen halten.
In einem gemieteten Einspänner machte sie sich am nächsten Morgen auf den Weg. Die Luft war frisch, und es ging ein kühler Wind. Die schmale Straße zog sich in Windungen über Hügel, durch Wälder und um Felsvorsprünge herum. Auf der gewölbten Straße neigte sich der Wagen manchmal so stark zur Seite, dass sie sich an der Rückenlehne der Bank festhalten musste. Jenseits des Flusstals ragten die Berge in die Höhe; wenn die Sonne hinter den Wolken hervorkam, leuchteten sie in ihrem Glanz. Es überraschte Bess, dass sie das Gefühl hatte, nach Hause zu fahren, und dass dieses Gefühl umso stärker wurde, je näher sie Ravenhart kamen. Die Kiefern und das wuchernde Geißblatt in den Hecken erinnerten sie an Shimla.
Endlich zeigte ein Torhäuschen, wo die Einfahrt zum Sitz der Ravenharts von der Straße abschwenkte und über eine gewölbte Brücke durch ein schmales Tal führte. Die Berge standen steil und hoch zu beiden Seiten des Pfads und warfen ihren dunklen Schatten über die ferne Seite des Tals. Ein seichter Bach sprudelte über Geröll, die Weißbirken an seinen Ufern zitterten im Wind. Alles, was sie hier sehe, sagte der Kutscher, gehöre den Ravenharts – und einen Augenblick vergaß Bess, warum sie hier war, und ließ sich von der Schönheit der majestätischen Landschaft beeindrucken. Hier draußen, in dieser grenzenlosen Weite, bekam sie zum ersten Mal seit Monaten richtig Luft. London hatte sie eingeschnürt, die Lebensfreude aus ihr herausgepresst, hier aber fühlte sie sich frei, wie unerwartet aus der Gefangenschaft entlassen.
Dann lichtete sich der Wald, und Ravenhart House erhob sich vor ihr. Jack hatte unrecht, dachte sie, es ist nicht scheußlich. Es ist wunderschön.
Treppengiebel erhoben sich über Fenstern mit kleinen Scheiben, und an den Ecken der Gebäudeflügel schwebten Türmchen mit hohen konischen Dächern wie aus dem Märchen. Das Dach über den Steinquadern und den verputzten Mauern war aus blaugrauem Schiefer. Buchsbaum und Rhododendron umfriedeten den Garten, und hohe Kiefern bildeten eine dunkle, dramatische Kulisse für das Haus.
Als der Wagen auf dem Kies des Vorhofs anhielt, blickte Bess zu den Fenstern hinauf, als wäre Frazer hinter einem von ihnen zu sehen. Aber da war nichts, nicht einmal der Schimmer einer Bewegung; es war, als würde das Haus nur von seinen Geistern bewohnt. Sie stieg aus und schaute sich um. Ravenhart House schien ihr ein Ort voller Rätsel und Geheimnisse zu sein. Welch alte Schatten und Gespenster, hinter Bäumen versteckt und von Bergen bewacht, hier wohl durch die dunklen Gänge und über die steilen Treppen wandelten?
Sie zog an der Klingel. Während sie wartete, erinnerte sie sich beinahe mit körperlichem Schmerz an Frazers weiche kleine Hand und die Wärme seines Körpers in ihren Armen. Dann durchzuckte sie plötzlich unbändige Freude; vielleicht würde sie ihn sehen, hören, wenn sie gleich ins Haus trat. Vielleicht würde sie ihn rufen, und er würde ihr entgegenlaufen. Natürlich hatte er sich in ihrer Abwesenheit verändert – er war sicher gewachsen, war nun kein Baby mehr, sondern schon ein kleiner Junge, der laufen, vielleicht auch schon die ersten Worte sprechen konnte. Dennoch, meinte sie, müsste ihm eine Erinnerung an sie geblieben sein, die beim Klang ihrer Stimme oder beim Geruch ihrer Haut wach würde.
Das Hausmädchen ließ sich ihren Namen nennen und führte sie hinein. Die Wände des Empfangsraums waren in dunklem Holz getäfelt; in dem riesigen offenen Steinkamin brannte ein Feuer. Sie konnte nicht stillstehen; sie lief im Zimmer hin und her, und ihr Blick flog von den Jagdtrophäen an den Wänden zu den Möbelstücken, so dunkel wie die Täfelung und so wuchtig und schwer, als gehörten sie in das Haus einer Familie von Riesen. Eine dünne Staubschicht bedeckte Kredenz und Tisch; ein Spinnennetz spannte sich in einem Hirschgeweih; auf der Kredenz und dem Kaminsims standen gerahmte Fotografien von jungen Mädchen in weißen Sommerkleidern und Strohhüten sowie streng dreinblickenden Frauen in Krinolinen und Schutenhüten. Männer in Jagdanzügen mit Gewehren über der Schulter posierten triumphierend hinter einem erlegten Hirsch. Ein Porträt zeigte einen jungen, melancholisch dreinblickenden Mann in der Offiziersuniform des Heeres.
Sie hatte heftiges Herzklopfen, und ihr war so heiß, als hätte sie Fieber. Sie zog die Handschuhe aus und ging zum Fenster. Vielleicht spielte Frazer im Garten. Vielleicht würde sie ihn sehen, ein kleiner weißer Irrwisch im Rhododendron.
Sie hörte Schritte und drehte sich um. »Mr. Ravenhart?«
Sheldon Ravenhart war klein und korpulent. Er wirkte so heruntergekommen wie das Haus, das schüttere graue Haar war ungekämmt, an der Weste fehlte ein Knopf. »Das Mädchen, diese dumme Gans, hat mir Mrs. Ravenhart gemeldet«, sagte er gereizt. »Ich habe ihr gleich gesagt, dass das Blödsinn ist und sie was falsch verstanden hat.«
»Ich bin Mrs. Ravenhart. Mein Mann Jack ist kürzlich verstorben«, erklärte Bess. »Ich bitte um Entschuldigung, dass ich hier unangemeldet erscheine, Sir, aber ich muss dringend mit Mrs. Ravenhart sprechen.«
Sheldon Ravenhart lachte kurz. »Da kommen Sie leider fünf Jahre zu spät. Meine Frau ist 1910 gestorben.«
Errötend drückte Bess ihr Bedauern aus und fügte erklärend hinzu: »Ich meinte Mrs. Cora Ravenhart.«
»Cora? Die ist nicht hier. Die ist in Indien.«
Sie erschrak. »In Indien?«
»Ja, natürlich.« Er kam näher. Er roch nach Pfeifentabak und irgendetwas Feuchtem, Muffigem, das sie an alte Möbel und Stoffe nach dem Monsun erinnerte. »Wenn Sie Jacks Witwe sind«, sagte er mit argwöhnischer Miene, »müssen Sie doch wissen, dass Cora und Fenton seit Jahren in Indien leben.«
Enttäuschung brach über sie herein. »Ich bin zu früh gekommen, sie sind wahrscheinlich noch unterwegs …«
»Darüber kann ich Ihnen nichts sagen«, brummte er. Im Licht des Fensters bemerkte sie die Flecken auf Sheldon Ravenharts Weste und die zerschlissenen Manschetten. »Fenton war nie ein großer Briefeschreiber.« Er sah auf seine Uhr. »Das Mädchen wird Ihnen eine Erfrischung bringen, Mrs. Ravenhart. Leider kann ich Sie nicht bitten, zum Mittagessen zu bleiben. Ich lebe sehr einfach, seit ich allein bin.«
Sie bekam Angst. »Aber Cora hat Ihnen doch geschrieben, Mr. Ravenhart?«
Sein Gesicht nahm wieder etwas Gereiztes an. »Ja, sie hat mich natürlich vom Tod ihres Sohnes unterrichtet. Ihres Ehemanns.«
»Mr. Ravenhart, Jacks Eltern kommen Sie doch diesen Sommer besuchen, oder nicht?«
»Nein, das glaube ich nicht. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt.«
Ihre Angst wurde größer. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen. Sie hielt ihn am Arm fest. »Aber die Ravenharts, Cora und Fenton, sie wollten doch kommen – vielleicht in ein oder zwei Monaten?«
Sein Ärger zeigte sich in dem kalten Lächeln. »Sie irren sich, Mrs. Ravenhart. Ich erwarte keinen Besuch von meinem Bruder und seiner Frau, so leid es mir tut.«
Das musste ein Missverständnis sein. Die Menschen auf den Fotografien, die Augen der ausgestopften Tiere an den Wänden hatten plötzlich etwas Bedrohliches.
Verzweifelt rief sie: »Aber Cora sagte doch – sie hat gesagt, es sei alles veranlasst!«
»Mag sein, dass einmal von einem Besuch die Rede war, aber ich erinnere mich nicht.« Er ging zur Tür. »Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, Mrs. Ravenhart, ich habe zu tun.«
Sosehr sie auch versuchte, sich zusammenzunehmen – ihre Stimme zitterte, als sie fragte. »Mein Sohn ist also nicht hier? Und es ist auch nicht geplant, ihn hierherzubringen?«
Die Hand schon auf dem Türknauf, blickte Sheldon Ravenhart zu ihr zurück. »Ihr Sohn?«
»Mein kleiner Junge. Frazer.«
Er sah sie an, als wäre sie verrückt geworden. »In diesem Haus ist kein Kind, glauben Sie mir. Tut mir leid, Mrs. Ravenhart, aber ich kann Ihnen wirklich nicht helfen.«
Als sie wieder abfuhr, sprang ihr Blick von Fenster zu Fenster, als brauchte sie nur scharf genug hinzuschauen, um ihn zu sehen. Dann schob sich eine Wolke vor die Sonne, und das Haus verdunkelte sich. Nichts blieb von seiner märchenhaften Schönheit, die Fenster blickten schwarz und leer.
Der Weg machte eine scharfe Biegung, die Bäume schlossen sich zu einer grünen Wand, und das Haus war verschwunden. Als sie sich umdrehte, stellte sie fest, dass auch die Landschaft jede Ähnlichkeit mit Shimla verloren hatte; auch da hatte sie sich geirrt. Dies hier war ein ganz anderes Land, und eine halbe Welt trennte sie von ihrem Kind.
Sie war wie betäubt, kaum fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Sie versuchte, sich zu konzentrieren; sie musste herausbekommen, was eigentlich geschehen war. Vielleicht hatte sie in ihrer Erschütterung und Verwirrung nach Jacks Tod Cora Ravenhart missverstanden. Vielleicht hatten die Ravenharts tatsächlich reisen wollen, und es war etwas dazwischengekommen. Was hatte Sheldon Ravenhart gesagt? Mag sein, dass einmal von einem Besuch die Rede war, aber ich erinnere mich nicht. Sie hätte ihn am liebsten geschüttelt, um ihn dazu zu zwingen.
Vielleicht hatten die Ravenharts ihre Reisepläne wegen des Krieges aufgegeben. Vielleicht hatten sie eine so lange Seereise nicht wagen wollen. Ja, so muss es sein, dachte sie und verspürte ein wenig Erleichterung. Die Schlagzeilen der Zeitungen berichteten immer wieder von Handelsschiffen, die vor der britischen Küste torpediert worden waren. Die Lusitania, ein großer Passagierdampfer, war erst Anfang des Monats vor Irland gesunken, mehr als tausend Menschen waren ertrunken. Vielleicht war es ein Irrtum gewesen zu glauben, der Krieg betreffe sie nicht. Während sie ihren Vater gepflegt und auf den Tag gewartet hatte, an dem sie ihren Sohn zurückfordern würde, hatte sich der Krieg ausgebreitet wie eine Seuche, die jeden betraf.
Aber es gab auch noch eine andere Möglichkeit. Sie schauderte, als sie daran dachte. Vielleicht war Cora gar nichts dazwischengekommen. Vielleicht war alles genau nach Plan gegangen.
Vielleicht wollte Cora Ravenhart Frazer für sich behalten.
War das möglich? Ja, jetzt erkannte sie, dass es mehr als möglich war. Cora hatte sie nie gemocht; Cora hatte versucht, Jacks Heirat mit ihr zu verhindern. In ihren Augen war Bess Cadogan, Tochter eines vagabundierenden Händlers, der nirgends Wurzeln hatte, ganz sicher nicht die passende Frau für ihren einzigen Sohn gewesen. Aber Jack, von frühester Kindheit an daran gewöhnt, seinen Kopf durchzusetzen, verwöhnt wie ein kleiner Prinz, von den Hausangestellten verhätschelt und von seiner Mutter vergöttert, hatte sich von Coras Wünschen nicht beeindrucken lassen. Genau wie Cora selbst besaß er einen eisernen Willen.
Er war gut aussehend und mutig bis zur Verwegenheit gewesen, aber er hatte auch Fehler gehabt, zum Beispiel sein unablässiges Verlangen nach Aufmerksamkeit und Bewunderung. Wenn nicht alles nach seinem Kopf ging, war er unerträglich; er schmollte und tobte. In den zwei Jahren ihrer Ehe hatten sie viel gelacht, ja, aber sie hatten auch Streit gehabt, Streit, bei dem die Türen geknallt wurden und Geschirr durch die Luft flog, so heftig, dass die Dienstboten in Deckung gegangen waren. Jack war ein liebenswürdiger Mensch gewesen, aber er hatte auch eine dunklere Seite gehabt. Nie war er bereit gewesen, auf die Gefühle anderer Rücksicht zu nehmen, wenn es ihm nicht in den Kram passte, und Kritik hatte er auch nicht ertragen können. Schuld daran war seine Mutter, die ihn verwöhnt und ihm niemals Grenzen gesetzt hatte.
Alle Liebe, deren sie fähig war, hatte Cora Ravenhart ihrem einzigen Sohn gegeben, und Bess hatte nicht eine Geste der Zuneigung oder gar Liebe zu ihrem Mann bemerkt. Wie sollte man über den Verlust des einzigen Menschen, den man geliebt hatte, hinwegkommen? Brachte man den Rest seines Lebens in Trauer zu? Oder suchte man in seinem Schmerz und seinem Hass nach einem Ersatz und holte sich diesen Ersatz ohne Rücksicht auf die Folgen, auf den Schaden und das Leid, die man damit vielleicht verursachte?
Im Zug von Perth nach Edinburgh setzte sich ein junges Paar zu Bess ins Abteil. Der junge Mann legte seiner Begleiterin verstohlen den Arm um die Taille; die schob ihn kichernd weg. »Nein, hör auf, Ken. Benimm dich.«
»Ach, komm schon …«
»Kenny.«
»Das stört Sie doch nicht, oder, Miss?« Ken lachte Bess an. »Wir haben nämlich gerade geheiratet«, erklärte er.
»Meinen Glückwunsch.«
»Obwohl wir uns erst seit einem Monat kennen.«
»So was«, sagte sie höflich.
»Wozu lange warten? Zwei Tage Hochzeitsreise, dann muss ich nach Frankreich.« Er war in Uniform. »Man weiß ja nie, was passiert, oder?«
»Ken.«
»Keine Sorge, Schatz, ich komm zurück. Mir sind zwei Nächte nicht genug.«
Der Zug ratterte auf den Gleisen. Die zwei Jungverheirateten teilten sich eine Zigarette und tuschelten miteinander. Bess wandte sich ab. Ans Fenster gedrückt, schaute sie hinaus und sah statt Bergen und Wäldern Frazer mit dem weißblonden Haar und den blauen Augen, wie er ihr nachwinkte, als sie das Haus der Ravenharts zum letzten Mal verließ.
Sie würde nach Indien zurückkehren, sagte sie sich wild entschlossen, und ihren Sohn holen. Cora würde ihn nicht behalten. Sie würde sich von Cora nicht ihr Kind wegnehmen lassen. Aber die Reise nach Indien kostete Geld. Und wenn sie Frazer erst einmal bei sich hatte, brauchte sie ein Zuhause für ihn. Sie warf einen unauffälligen Blick in ihr Portemonnaie; fünf Pfund und zwölf Shilling. Das reichte nicht, bei Weitem nicht. Am Ende läuft es doch immer aufs Geld hinaus, dachte sie voll Bitterkeit. Ohne Geld waren einem die Hände gebunden.
Gut, dann musste sie sich eben Arbeit suchen. Aber was hatte sie schon anzubieten? Sie hatte nicht viel gelernt. Sie konnte reiten wie ein Mann; sie konnte in drei verschiedenen Sprachen schimpfen. Sie war eine furchtlose Schwimmerin und Taucherin, und sie hatte beim Kartenspiel immer Glück. Aber was halfen ihr jetzt solche Fähigkeiten? Nüchtern überlegte sie, wo es für sie überhaupt Arbeitsmöglichkeiten gäbe – in einer Bar oder einem Hotel vielleicht, in einem Modegeschäft oder, das möge Gott verhüten!, im Haushalt. Im Büro, wenn sie Maschine schreiben lernte. Würde sie mit so einer Beschäftigung genug verdienen, um für sich selbst, Frazer und die Kinderfrau zu sorgen, die sie für ihn brauchen würde, wenn sie eine Arbeit annehmen wollte? Wahrscheinlich nicht.
Die Kälte hatte sich in ihrem ganzen Körper ausgebreitet und drang ihr bis ins Mark. Angst verwehrte ihr jeden klaren Gedanken. Angst, dass Cora Ravenhart nach dem Verlust ihres einzigen Sohnes beschlossen hatte, zum Ausgleich ihren Enkel bei sich zu behalten; dass sie gelogen, die geplante Reise nach Schottland erfunden hatte, um Frazer nicht hergeben zu müssen. Angst, dass sie, Bess Ravenhart, einen schrecklichen und nicht wiedergutzumachenden Fehler begangen hatte und blind in die Falle getappt war, die Cora ihr gestellt hatte.
In Edinburgh nahm sie sich in der erstbesten billigen Pension ein Zimmer. Sie war zu erschöpft, um weiterzureisen, und wohin sollte sie überhaupt? Warum nach London zurückkehren, in eine Stadt, die sie nicht mochte, in der sie kein Zuhause hatte und niemand auf sie wartete?
Ihr Zimmer lag in der vierten Etage einer Mietskaserne in der Old Town. Es war klein und feucht, und das Bettzeug war schmuddelig; ihr Fenster ging auf eine schmale Gasse, die von einer weiteren Mietskaserne begrenzt wurde. Sie schlief unruhig in kratzigen Wolldecken und versuchte zu sparen, indem sie billige Cafés aufsuchte und von Brötchen aus dem Bäckerladen lebte. Die Diamantohrringe, die Jack ihr an ihrem ersten Hochzeitstag geschenkt hatte, blaue ceylonesische Diamanten, an denen sie leidenschaftlich hing, versteckte sie hinter einem losen Stück Sockelleiste in ihrem Zimmer.
Die Stadt auf den hohen felsigen Hügeln war verwirrend im ständigen Auf und Ab ihrer steilen Straßen, sodass sie oft nicht genau wusste, wo sie eigentlich war, wenn sie plötzlich irgendwo hoch über den Dächern stand oder sich tief unten im Gewirr dunkler Gassen und Hinterhöfe wiederfand. Sie fühlte sich einsam und wusste nicht, was sie als Nächstes unternehmen sollte. Nie zuvor hatte sie so lange Zeit allein verbracht, immer war jemand da gewesen, ihr Vater, Jack, die Freunde, bei denen sie in Shimla gewohnt hatte – immer waren Menschen um sie gewesen. Die Einsamkeit quälte sie. Einmal, als sie in einem Café stundenlang über einer Tasse Tee saß und merkte, dass ein Mann sie anstarrte, war sie beinahe versucht, ihm zuzulächeln. Sie musste an Dempster Harris’ »Hilfsangebot« denken. Da war die Bezahlung wahrscheinlich besser als in einem Laden. Sie wusste, dass sie auf schmalem Grat wanderte; sie wusste, wie leicht sie abrutschen und fallen konnte.
Eines Morgens erwachte sie aus einem tiefen, traumlosen Schlaf. Während sie sich ankleidete und ihr langes schwarzes Haar bürstete, dachte sie an das Schiff, auf dem sie von Bombay nach Southampton gefahren war. Die Williamsons fielen ihr ein, die nett zu ihr gewesen waren, und die Soldaten, die mit ihr geflirtet hatten, wenn sie an Deck unter dem Sonnendach gesessen hatte. In ihrem Kopf formte sich verschwommen eine Idee. Sie versuchte, ihr Konturen zu verleihen. Noch eine Erinnerung: das jung verheiratete Pärchen im Zug von Perth nach Edinburgh. Obwohl wir uns erst seit einem Monat kennen. Sie hielt inne und starrte ihr Spiegelbild an.
Ihre zusammengekniffenen Augen waren saphirblaue Schlitze, als sie sich mit unbarmherzigem Blick im Spiegel musterte. Die ewigen Geldsorgen und die Knauserei mit dem Essen hatten an ihr gezehrt, sie hatte abgenommen, auch im Gesicht, sodass die hohen Wangenknochen und die schmale, gerade Nase stärker hervortraten. Der volle Mund, den Jack so gern geküsst hatte, drückte jetzt vor allem Entschlossenheit aus. Aber natürlich hatte sie etwas anzubieten. Alles, was Cora Ravenhart an ihr verachtet hatte, musste sie jetzt zu ihrem Vorteil einsetzen. Cora Ravenhart hatte die Fassade der Wohlerzogenheit durchschaut, die sie, Bess, gezeigt hatte, um von der guten Gesellschaft Shimlas akzeptiert zu werden; Cora Ravenhart hatte sie für eine liederliche und leichtfertige Person gehalten.
Sie musste Frazer wiederhaben. Um jeden Preis. Bess Ravenhart ging zum Fenster, riss es auf und atmete die herbe, frische Luft ein. Dann setzte sie ihren Hut auf, zog die Handschuhe an und verließ ihre Unterkunft.
Während sie Castlehill hinaufging, formte sich in ihrem Kopf ein Plan. Zuerst würde sie die Williamsons ausfindig machen und die Bekanntschaft mit ihnen erneuern. Sie würde sich gut kleiden, mit dezenter Eleganz, ihre besten Manieren zeigen und kein Wort über die Rückschläge verlieren, die sie erlitten hatte. Bess Ravenhart, Witwe von Jack Ravenhart, dem Neffen des Eigentümers des riesigen Familienbesitzes in Schottland, würde freundlich aufgenommen werden; eine mittellose Fremde, die in einer billigen Pension in einer Hintergasse wohnte, vielleicht nicht.
Sie ließ den Blick über die Stadt wandern, zuerst zu den in der Sonne glitzernden Dächern der eleganten georgianischen Häuser der New Town, dann weiter zum silbernen Arm des Firth of Forth. Sie musste sich über die Williamsons Zutritt zur feinen Gesellschaft von Edinburgh verschaffen. Sie musste dafür sorgen, dass sie überall eingeladen wurde, zu Abendessen, Gesellschaften und Bällen. Sie musste den reichsten Junggesellen Edinburghs finden und ihn heiraten.
2
ALS LETZTES VERKAUFTE BESS IHRE PERLENBROSCHE. Jetzt hatte sie nur noch den Trauring, den Verlobungsring und die Diamantohrringe. Sie versetzte ein Pelzcape, einen Abendmantel aus Samt und ein Seidenkleid an einen Mann, der mit getragener Kleidung handelte, und zog in ein kleines, aber renommiertes Hotel in der New Town um. Ihre Garderobe war stark geschrumpft und passte problemlos in ihren Koffer. Wie lange würde ihr Geld noch reichen? Ein paar Wochen vermutlich – zwei Monate, wenn sie am Essen sparte. Sie hatte immer Hunger, fürchtete ständig, es könnte sie etwas verraten – die gestopften Handschuhe, die Löcher in ihren Strümpfen. Es machte sie müde, unablässig darauf achten zu müssen, dass keiner merkte, wie arm sie war; es ging ihr auf die Nerven, die züchtige Witwe zu spielen. Aber das alles war nichts im Vergleich zu der Angst, die sie häufig in den frühen Morgenstunden überfiel, ihr Vorhaben könnte scheitern und sie am Ende mit leeren Händen dastehen.
Als sie sich entschlossen hatte, sich einen Ehemann zu suchen, hatte sie nicht bedacht, dass es in der Stadt kaum noch junge Männer gab. Dieser elende Krieg, dachte sie zornig. Er kam ihr wirklich bei allem, was sie plante, in die Quere. Über die Williamsons lernte sie verheiratete und unverheiratete junge Frauen kennen; sie zeigten ihr Fotografien ihrer Brüder, Verlobten und Ehemänner, die alle an der Front waren. Sie begegnete älteren Frauen, die Mühe hatten, ihre Sorge um ihre Söhne zu verbergen. Sie traf verheiratete Männer, Rechtsanwälte, Ärzte und Fabrikanten um die vierzig und fünfzig, die ihr mit gesenkter Stimme Komplimente machten, wenn ihre Frauen außer Hörweite waren. Sie lernte ältere Junggesellen kennen, deren fadenscheinige Manschetten und grau schimmernde Kragen verrieten, dass sich schon seit Jahrzehnten keine Frau mehr um sie gekümmert hatte. Und sie traf mit sechzehn-, siebzehnjährigen Jungen zusammen, die Flaum auf der Oberlippe und Pickel am Kinn hatten und sie mit unverhüllter Bewunderung anstarrten, während sie ihr erzählten, wie ungeduldig sie auf den Tag warteten, an dem sie alt genug sein würden, um an die Front zu gehen.
Als sie schon nahe daran war, die Hoffnung aufzugeben, wurde ihr Ralph Fearnley vorgestellt, ein unverheirateter Mann Ende zwanzig. Reich konnte man ihn nicht nennen, aber ein paar diskrete Erkundigungen bei Sarah Williamson gaben Bess die beruhigende Gewissheit, dass er in gesicherten Verhältnissen lebte. Er war Teilhaber der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sein verstorbener Vater gegründet hatte, und lebte in einem Dorf wenige Kilometer südlich von Edinburgh. Zurzeit wartete er auf die Einberufung zu seinem Regiment.
Ralph hatte rotblondes Haar, das glatt rasierte Gesicht darunter war rosig und rund, die blaugrauen Augen waren von hellen Wimpern umkränzt. Ralph Fearnley den Kopf zu verdrehen war für sie etwa genauso schwierig, wie einen Fisch einzuholen, der schon am Haken hing. Einen dicken, silbernen Fisch, der keinerlei Gegenwehr leistete. Sie brauchte ihm nicht nachzustellen, er stellte ihr nach. Plump und beharrlich. Sie brauchte nur zu erwähnen, sie würde eventuell zu diesem oder jenem Konzertabend gehen, und sie konnte sich darauf verlassen, dass Ralph sie im Foyer ihres Hotels erwartete, um sie zu begleiten. Starr vor Bewunderung stand er da, während sie in einer Wolke von L’Heure Bleu und mit funkelnden Diamanten in den Ohren die Treppe herunterschwebte. Wo immer sie war, Ralph war an ihrer Seite, stets bereit, ihr etwas zu trinken zu holen, ihr die Tür zu öffnen oder ihr in den Mantel zu helfen. Er erinnerte sie an einen Hund, den sie früher einmal in Indien gehabt hatte, einen eifrigen, treu ergebenen Labrador.
Wenn sie ihn berührte – sich bei ihm einhakte oder beim Entgegennehmen eines Glases Wein seine Hand streifte – , fuhr er jedes Mal wie elektrisiert zusammen. Oft mischte sich in die hingebungsvolle Bewunderung in seinem Blick ein Ausdruck der Verwirrung, als hätte er völlig den Boden unter den Füßen verloren. Er erzählte ihr von seiner Arbeit und seinen Freizeitinteressen: Wandern in den Pentland Hills, Angeln und das Studium der Militärgeschichte. Hatte er ein Thema gefunden, das ihn interessierte, so war von seiner Unbeholfenheit nichts mehr zu spüren. Er redete und redete, ohne Ende, wie Bess schien. Oft merkte er dann nicht einmal, dass sie mindestens zehn Minuten lang kein Wort gesagt hatte – gar keine Möglichkeiten dazu gehabt hatte. Es war doch auf der ganzen Welt das Gleiche, dachte Bess mit einem Anflug von Gereiztheit, ob in Shimla oder in Schottland: Die Männer meinten immer, sie müssten den Frauen die Welt erklären. Sogar der arme Jack hatte es fertiggebracht, stundenlang über Polo zu reden. Manchmal konnte sie bei den Gesprächen mit Ralph nur mühsam das Gähnen unterdrücken; einmal, nach einer schlaflosen Nacht, war sie tatsächlich eingenickt, während er über Schützengräben, Deckungsfeuer und Flankenfeuer dozierte, Dinge, die sie nicht im Geringsten interessierten.
Es hatte in letzter Zeit ziemlich viele schlaflose Nächte gegeben. Nachts wurde sie unsicher in ihrer Entschlossenheit und fragte sich, ob sie einen Mann heiraten konnte, den sie nicht liebte, den sie nicht einmal besonders mochte. Ralph Fearnley schien ihr ein anständiger Mann zu sein, ein ehrlicher Mensch, und seine Schwächen – ein leichter Hang zur Wichtigtuerei, eine akribische Genauigkeit – waren verzeihbar. Er verdiente keine Ehe ohne Liebe.
Aber was sollte sie tun, wenn sie Ralph nicht heiratete? Sie würde sich vielleicht niemals an die Einsamkeit gewöhnen, die seit dem Tod ihres Vaters ihr Los war. Sie war nie gern allein gewesen. Sie brauchte Menschen um sich, sie brauchte Gesellschaft, Reden und Lachen, jemanden, mit dem sie sich über die kleinen Ereignisse des Tages austauschen konnte. Vor allem aber brauchte sie Frazer. Wenn sie Ralph nicht heiratete, würde sie vielleicht niemals nach Indien zurückkehren. Und dann würde Frazer sie vergessen. Er würde sie nicht lieben. Mit der Zeit würde er vielleicht sogar glauben, sie hätte ihn aus eigenem Willen verlassen. Was würde aus ihrem einzigen, so sehr geliebten Sohn werden, wenn sie ihn Coras Erziehung überließ? Sie hatte Angst vor dem, was Cora aus ihm machen würde.
Bess hatte ein letztes Mal an Cora Ravenhart geschrieben. Sie hatte gefragt, warum sie nicht nach Schottland gekommen war, und um Nachricht über Frazer gebeten. Aber eigentlich wusste sie schon, dass Cora ihre Briefe niemals beantworten würde. Die Ereignisse des vergangenen Jahres hatten ihr die Illusionen geraubt und sie härter gemacht. Sie fegte ihre Bedenken weg und verfolgte erbarmungslos ihr Ziel, entschlossen, sich nicht von ihrem Weg abbringen zu lassen, weder von den Zweifeln, die sie nachts überfielen, noch von der gelegentlich aufblitzenden erschreckenden Erkenntnis, wie der Alltag einer Ehe mit Ralph Fearnley aussehen würde.