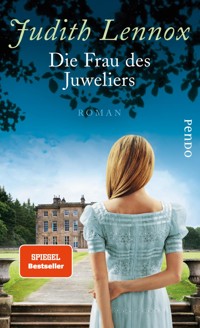
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kairo, 1938: Wir werden uns lieben, denkt Juliet, als sie den reichen englischen Juwelier Henry Winterton heiratet und mit ihm nach England geht. Sofort empfindet sie das Herrenhaus Marsh Court als ihr neues Zuhause.Doch ihre Heirat soll sich als großer Fehler herausstellen. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, wird alles noch schlimmer. Plötzlich schwelgen die Wintertons nicht mehr in Luxus, und Juliet kämpft um das Überleben der Familie. In ihrer Verzweiflung und ihrem Hunger nach Liebe lässt sie sich auf eine Affäre mit dem charismatischen Gillis ein. Doch ihn umgibt ein Geheimnis, das ihr Leben zerstören könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deFür Carwyn George Bethencourt-SmithDie Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »The Jeweller’s Wife« bei Headline Review in London.Übersetzung aus dem Englischen von Mechtild SandbergISBN 978-3-492-97508-7November 2016© Judith Lennox 2015Deutschsprachige Ausgabe:© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016Redaktion: Matthias Teiting, DresdenCovergestaltung: Mediabureau Di Stefano, BerlinCovermotiv: Irene Lamprakou/Arcangel Images, Lee Avison/Trevillion Images und Michael Jones/EyeEm/Getty ImagesDatenkonvertierung: Uhl + Massopust, AalenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Die Familien Winterton und Sinclairund ihre Freunde
In Marsh Court:
Henry Winterton
Juliet Winterton, seine Frau
Piers, ihr Sohn
Charlotte (Charley), ihre Tochter
In Maldon:
Jonathan Winterton (Jonny), Henrys jüngerer Bruder
Helen Winterton, seine Frau
Aidan, ihr Sohn
Louise, ihre Tochter
In St. Albans:
Jane Hazelhurst (geborene Winterton), Henrys und Jonnys Schwester
Peter Hazelhurst, Janes Mann
Eliot und Jake, ihre Zwillingssöhne
Gabrielle (Gabe), ihre Tochter
In London:
Gillis Sinclair, Henry Wintertons Freund
Blanche, Gillis’ Frau
Flavia und Claudia, ihre Töchter
Nathan (Nate) und Rory, ihre Söhne
In Greensea:
Joe Brandon, ein Farmer
Christine Brandon, seine Tante
Neville Stone, Joes Patensohn
Sowie:
Freya Catherwood, eine Fotografin
Anne Carlisle, ein Gast aus Amerika
Teil 1
Die Perlenkette
1938–1946
1 Oktober 1938 – Dezember 1938
BEIM FRÜHSTÜCK LIESS DAS DIENSTMÄDCHEN einen Bückling auf Henrys Schoß fallen, und er nannte sie dumm und warf sie hinaus. Sie war wirklich dumm, musste Juliet Winterton einräumen, ein armes, ungebildetes kleines Ding, das jüngste Kind einer großen Familie, die in beengten Verhältnissen in einem zu kleinen Haus in Maylandsea lebte. Doch das Mädchen tat ihr leid, und sie nahm es in Schutz, nachdem es weinend aus dem Zimmer gelaufen war.
Henry bekam diesen gemeinen Blick, den sie in den drei Monaten ihrer Ehe bereits kennengelernt hatte. »Du kannst manchmal so schwach sein, Juliet«, sagte er und riss dem Unglücksfisch das Rückgrat heraus.
Sie ließ sich nicht beirren. »Ethel kann nichts dafür. Du machst ihr Angst, Henry, du machst sie nervös. Mein Vater hat immer gesagt, man solle freundlich sein zu den Angestellten, gerade weil sie weniger Glück im Leben hatten als wir.«
»Dein Vater war ein Narr.« Er schlitzte mit dem Brieföffner einen Umschlag auf. »Er hat sein Geld verschleudert und dich mittellos zurückgelassen, wie ich mich erinnere. Weiß Gott, was aus dir geworden wäre, wenn ich dich nicht gerettet hätte.«
Sie hasste es, ihn in diesem Ton von ihrem Vater sprechen zu hören, der noch keine sechs Monate tot war. Doch sie hatte gelernt, sich vor Henrys Zunge zu hüten, deshalb strich sie nur schweigend Butter auf den Toast, den Ethel hatte anbrennen lassen. Sie hatte allen Appetit verloren, und der fischige Geruch des Bücklings schlug ihr auf den Magen.
Als sein Teller leer war, legte Henry Messer und Gabel weg. »Wir haben heute Abend einen Gast«, bemerkte er. »Sinclair hat sich angemeldet.«
Gillis Sinclair war Parlamentsmitglied und lebte in London. Henry war der Patenonkel seiner jüngeren Tochter Claudia und sprach häufig von ihm, doch Juliet hatte weder Sinclair noch seine Frau Blanche bisher kennengelernt.
»Ich lasse ein Zimmer richten«, sagte sie. »Kommt Mr. Sinclair allein?«
»Ja, Blanche fühlt sich nicht wohl. Mach ein Zimmer im Cottage fertig. Wenn die Sinclairs nach Marsh Court kommen, übernachten sie immer im Cottage.«
Henry tupfte sich den Mund mit der Serviette ab und stand auf. Er und seine beiden Geschwister, Jonathan und Jane, waren rein äußerlich wie aus einem Holz geschnitzt, blond und attraktiv wie alle Wintertons, wobei Henry der Stattlichste und Markanteste von ihnen war. »Am besten lädst du Jonny und Helen dazu ein«, fügte er hinzu. »Und die Barbours. Machen wir eine kleine Gesellschaft daraus.«
Charles und Marie Barbour, die Nachbarn der Wintertons, lebten auf einem großen Bauernhof im Süden von Marsh Court. »Lass mich noch einmal mit Ethel reden«, drängte Juliet sanft.
»Nein.« Sein Mund wurde schmal. »Wenn ich sage, sie geht, dann geht sie.«
Da sie jetzt nur noch auf die Hilfe der Köchin, Mrs. Godbold, und der alten Wirtschafterin zurückgreifen konnte, die so klapprig war, dass Juliet jedes Mal um ihr Leben fürchtete, wenn sie die Treppe hinaufkeuchte, gab es an diesem Morgen viel zu viel zu tun. Juliet bereitete selbst das Zimmer in dem hübschen kleinen Gästecottage vor und tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie am Abend Helen und Jonathan sehen würde. Jonathan war ein umgänglicherer Mensch als Henry, und Helen, ihre Schwägerin, war ihr schon fast eine Freundin geworden.
Nach dem Mittagessen ging sie nach draußen. Die Bäume hatten das Laub in diesem Jahr früh verloren, ein heftiger Oktobersturm hatte es von den Ästen gerissen und die Blätter der japanischen Fächerahorne in blutroten Wirbeln über den Rasen geworfen. Ohne den Streit mit Henry hätte Juliet ihren Skizzenblock geholt und versucht, die Farbenvielfalt des gefallenen Laubs auf Papier zu bannen, doch sie war zu aufgewühlt, um zu malen. Dein Vater war ein Narr. Er hat sein Geld verschleudert und dich mittellos zurückgelassen. Gott weiß, was aus dir geworden wäre, wenn ich dich nicht gerettet hätte.
Gerettet?, dachte sie, während sie durch das Gras ging, dessen Halme nass über ihre Fesseln streiften. So siehst du das, Henry?
Die Regenwolken hatten sich verzogen und blauen Himmel und friedliche Stille zurückgelassen. Marsh Court stand auf einer Halbinsel, die zwischen zwei Flüssen in die Nordsee hinausragte, dem Crouch im Süden und dem breiten Delta des Blackwater im Norden. Das flache Land rund um das Haus schimmerte in weichen Tönen von Grün, Grau und Braun, die dem Auge wohltaten. Juliet beobachtete eine Schar Möwen, die über dem Wasser kreiste, und aus der Ferne wirkten die weißen Vogelbrüste im Sonnenlicht wie ein einziger leuchtender Körper.
Der Garten ging, ohne Zaun oder Hecke zur Begrenzung des Landes, zuerst in Felder und dann in Salzmarsch über. Das einzige andere Haus in Sichtweite war das im letzten Jahrhundert für eine unverheiratete Winterton-Tante erbaute Cottage aus rotem Backstein, in dem Henrys Freund Gillis Sinclair die kommende Nacht verbringen würde.
Juliet blickte zurück zum Haus mit den drei breiten Giebeln, die dem Marschland und dem Watt zugewandt waren, wo die Priele und Salzmarschen vom Wasser durchwirkt schienen wie von metallischen Fäden. Unter dem jahrzehntelangen Einfluss von Sonne und Regen waren die Farben von Dach und Mauern zu zart rötlich getöntem Ocker und Gold verblasst, sodass das Haus mit seinem Umland eine harmonische Einheit bildete. Hohe Fenstertüren führten auf Terrassen voller Geranienkübel hinaus, und Bienen summten im staubigen Licht eines gesprungenen Buntglasfensters. Den Kaminsims im Salon zierten bäuerliche Holzfiguren von Adam und Eva, Eva drall und keck, Adam mit strähnigem Haar und etwas verlottert. In der Abstellkammer standen Flaggenstöcke und Schlaghölzer für Spiele, deren Regeln Juliet nicht kannte; in der Bibliothek lag ein Album, das ausschließlich Fotografien von den Hunden der Familie Winterton enthielt. Für Juliet sahen die Tiere alle gleich aus, aber wenn Henrys Schwester Jane in dem Band blätterte, sagte sie seufzend: »Ach, da ist Lucky, und, oh, schau! Meine süße alte Sally.« Und ihre Brüder nickten lächelnd dazu.
Juliet war Marsh Court gleich in jenem ersten Moment verfallen, als sie es am Ende ihrer langen Reise von Ägypten nach England aus dem Küstennebel auftauchen sah. Und doch war sie in zwei Monaten Ehe das Gefühl nicht losgeworden, dass sie die Rolle der Hausherrin nur spielte, dass sie ihr nicht zustand, dass sie ein Eindringling war, eine Hochstaplerin.
Manchmal strich sie mit der Hand über ein glänzendes Geländer oder drückte ihr Gesicht in den verblichenen Samt eines Vorhangs, als könnte sie so ein Teil des Hauses werden und ein Teil dieser Familie.
Dort, wo das Land abfiel, wurde das Gras grob und büschelig und ging nahtlos in das Feld dahinter über. Sie kam zu der Stelle, wo die Wintertons zur Feier wichtiger Familienereignisse Feuer anzuzünden pflegten. Jetzt lag nur ein kreisrunder Aschering in der Feuergrube.
Juliet begann das herabgefallene Laub zu einem Haufen zusammenzufegen: goldgelbe Eichenblätter, scharlachrote und korallenfarbene Zungen von den Kirschbäumen sowie gefingerte Kastanienblätter, die aussahen wie zerknitterte braune Hände. In ihrer Tasche fand sie einen alten Einkaufszettel – Strümpfe, Briefmarken, Aspirin. Sie knüllte ihn zusammen und stopfte ihn unter das Laub. Ihr elegantes goldenes Feuerzeug war von Winterton, ein Geschenk von Henry. Sie hielt die Flamme ans Papier, bis es Feuer fing, und trat ein Stück zurück, um den beißenden, herbstlichen Geruch des Rauchs einzuatmen, der aus den Blättern aufstieg.
Am unteren Rand des Feldes bemerkte sie einen Mann, der dort den Fußweg entlangging. Obwohl das Land, das an das Mündungsgebiet grenzte, nicht zu Marsh Court gehörte, sahen die Wintertons es gern als ihr eigenes an, zumal sich dort kaum je ein Mensch zeigte. Sie hatte sich ihrem Alleinsein hingegeben, der Vorstellung, mit dem toten Laub ihren Kummer zu verbrennen, und fühlte sich … nicht direkt ertappt, aber doch peinlich berührt, als wäre sie bei einer intimen Verrichtung wie dem Zähneputzen oder Haaremachen überrascht worden.
Der Mann auf dem Fußweg war hochgewachsen und bewegte sich leichten Schrittes. Juliet sah, wie er vom Fußweg abbog und landeinwärts ging, auf das Laubfeuer zu. Sie nahm an, dass der Mann nach dem Weg fragen oder vielleicht um ein Glas Wasser bitten würde.
Doch als der Fremde in Hörweite kam, rief er: »Sie müssen Juliet sein. Als ich hörte, dass Henry mit einer Ehefrau aus Ägypten zurückgekommen ist, war ich sehr gespannt und konnte es kaum erwarten, Sie kennenzulernen.« Die Hand zur Begrüßung ausgestreckt, trat er auf sie zu. »Verzeihen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe. Ich bin Gillis Sinclair. Henry hat Sie hoffentlich vorgewarnt und Ihnen gesagt, dass ich komme.«
Er hatte eine hohe Stirn und ausdrucksstarke blaugraue Augen unter geraden Brauen. Die hellen Haare waren gelockt, die schmale Nase war lang und gerade, der Mund groß und wohlgeformt. Juliet fand den Mann überraschend attraktiv. Sie murmelte eine Begrüßung und gab ihm die Hand.
Er lachte. »Könnte es sein, dass ich nicht Ihren Erwartungen entspreche, Mrs. Winterton? Sie hatten sich vielleicht einen etwas angejahrten Politiker vorgestellt, den die Bürde der Staatsgeschäfte vorzeitig gebeugt hat?«
Es stimmte, sie hatte einen älteren Mann erwartet. Henry war siebzehn Jahre älter als sie, und Juliet hatte angenommen, sein Freund sei etwa im gleichen Alter.
»Aber nein, keineswegs«, antwortete sie. »Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Mr. Sinclair.«
»Gillis. Ich hoffe, wir können die Förmlichkeiten lassen.«
»Dann müssen Sie mich Juliet nennen. Gillis ist ein ungewöhnlicher Name.«
»Es ist ein dänischer Name. Meine Mutter stammt aus Kopenhagen.«
»Und sprechen Sie Dänisch?«
»Ein bisschen. Sie müssen entschuldigen, dass ich einfach so in Ihrem Garten aufkreuze. Mein Auto steht mit einem kaputten Auspuff in Maldon in der Werkstatt. Das verflixte Ding hat die ganze Fahrt von Chelmsford bis hierher schwarzen Qualm gespuckt. Ein Mann von der Werkstatt bot mir an, mich herzufahren, aber ich bin lieber marschiert. Ich liebe die Wanderungen hier am Delta.«
Sein Blick ruhte auf ihr, während er sprach. Es war seltsam, dachte Juliet, dass einem ein Lächeln, ein Blick alle Ruhe rauben und zugleich bewirken konnte, dass man sich plötzlich hellwach und lebendig fühlte, so als hätte man die ganze Zeit im Schatten dahinvegetiert und wäre nun ins strahlende Licht hinausgetreten.
»Ich hörte, dass Ihre Frau sich nicht wohlfühlt. Das tut mir leid.«
»Ach ja, die arme Blanche. Sie meint, sie hätte es von den Kindern aufgeschnappt. Ich halte mich von ihnen möglichst fern.«
Er sagte es mit einem Augenzwinkern. Sie hatte immer noch Mühe mit dieser Angewohnheit der Engländer, das eine zu sagen und dabei etwas ganz anderes zu meinen. Sie fürchtete, dass ihre Konversation den Leuten hier im Vergleich recht schwerfällig vorkam.
Das Feuer war zu weiß umkränzter roter Glut heruntergebrannt. Als sie den Weg zum Haus antraten, fragte sie Gillis, wie alt seine Töchter seien.
»Flavia ist vier und Claudia – Moment! – zwei.«
»Wie niedlich.«
»Wenn ich das nächste Mal komme, bringe ich sie mit. Ich glaube, sie werden Ihnen gefallen.«
»Ja, das wäre schön.«
»Henry hat mir erzählt, dass Sie sich in Kairo kennengelernt haben. Sind Sie dort geboren?«
Juliet schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin gebürtige Engländerin, aber mein Vater und ich sind sehr viel gereist. Henry habe ich zwei Wochen nach dem Tod meines Vaters kennengelernt.«
»Das war sicher alles nicht einfach.« Er warf ihr einen Blick von der Seite zu, während sie den nassen Hang hinaufstiegen. »So ein Verlust ist ja immer schlimm. Und Henry, so gern ich ihn habe, ist nicht gerade ein einfacher Mensch.«
Juliets Vater Alexander Capel, Ägyptologe und Gräzist, hatte ein halbes Dutzend Sprachen fließend gesprochen und die Fähigkeit besessen, neue Sprachen bemerkenswert schnell zu erlernen. Im Alter von einundzwanzig Jahren hatte er England nach einem Zerwürfnis mit seinen Eltern den Rücken gekehrt und war seither auf fortgesetzter Wanderschaft durch die Länder des östlichen Mittelmeerraums gewesen. Als Juliet zwölf war, starb ihre Mutter, erschöpft von Krankheit und dem rastlosen Wanderleben. Sie war untröstlich nach diesem Verlust. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es ihr nichts ausgemacht, kein festes Zuhause zu haben; ihre Mutter hatte jede Unterkunft zu einem Zuhause gemacht. Doch nach ihrem Tod fühlte Juliet sich entwurzelt und orientierungslos.
Mit siebzehn war sie mit ihrem Vater nach Kairo gezogen. Anfangs lebten sie dort in einer Mietwohnung in Zamalek, einem wohlhabenden Viertel mit grünen Bäumen und geräumigen Villen. Sie hatten eine Hausangestellte und gingen zum Essen meistens aus. Juliet nahm Mal- und Zeichenunterricht, während ihr Vater als Übersetzer an der britischen Botschaft arbeitete. Zu ihrem Freundeskreis, der aus der gewohnten internationalen Clique bestand, gehörten Schriftsteller, Intellektuelle und Weltenbummler. Sie liebte die ausgedehnten, gemütlichen Abendessen und Gespräche, die niemals vor Mitternacht zu Ende gingen, und die Kühle der frühen Morgenstunden, die tiefschwarzen Schatten in den uralten Straßen.
Als ihr Vater krank wurde, konnte er nicht mehr arbeiten, und sie mussten die Wohnung aufgeben und sich auf der Südseite der Insel Gezira eine Bleibe suchen. Sie beschäftigten keine Angestellte mehr, Juliet selbst kümmerte sich um den Haushalt und das Kochen. Sie verdiente etwas Geld als Gesellschafterin und Briefeschreiberin einer alten Französin (sie hatte zuvor ihrem Vater mehrere Jahre mit den Schreibarbeiten geholfen) und gab drei verwöhnten englischen Schulmädchen Zeichenunterricht. Ihr Vater trank billigen Fusel, um die Schmerzen zu betäuben. Immer schon ein freimütiger Bewunderer der arabischen Kultur, ging er dazu über, sich in Dschallabija und Fez zu kleiden, und stritt sich mit seinen britischen Bekannten, die nicht mehr so oft vorbeikamen. Juliet vermutete, sie glaubten, er zähle sich nun ganz zu den Einheimischen.
Ein halbes Jahr vor dem Tod ihres Vaters, dessen historische Monografien sich in der französischsprachigen Welt einer gewissen Popularität erfreuten, führte sein Verleger, ein Franzose, Juliet zum Essen aus. Jean-Christophe warnte sie, dass man auf einen Krieg zusteuere, und riet ihr, Kairo zu verlassen. Der Sieg der Italiener in Abessinien, südlich von Ägypten, sei einer der ersten Schritte auf dem Weg in den kommenden Konflikt, der, wie er ruhig und sachlich erklärte, unvorstellbar grausam werden würde. Er habe versucht, mit ihrem Vater zu reden, sei jedoch auf taube Ohren gestoßen. Sie müsse unbedingt auf ihn einwirken.
Danach hatten sie sich erfreulicheren Dingen zugewandt. Es wurde ein netter Abend, und später nahm Jean-Christophe sie mit in seine Villa in der Abou-el-Feda-Straße und schlief mit ihr. Sie ließ sich von ihm verführen, weil sie den Trost menschlicher Berührung brauchte. Er war ein zärtlicher und einfühlsamer Liebhaber, der ihr das Gefühl gab, dass sie schön sei. Sie verliebte sich in ihn und war zutiefst niedergeschlagen, als er einen Monat später zu seiner Frau und seinen Kindern in sein Schloss an der Loire zurückkehrte.
Als die Krankheit ihres Vaters sich verschlimmerte, verkaufte Juliet nach und nach alle Wertgegenstände, um das Morphium bezahlen zu können. Es war ein langes Leiden, erschütternd mitanzusehen. In den letzten Wochen konnte sie ihm keinen Trost mehr spenden, und so blieb nach seinem Tod ein Gefühl des Versagens in ihr zurück, das sie niemals ganz abschütteln konnte.
Nachdem die dringendsten Schulden ihres Vaters bezahlt waren, blieb ihr nichts. Es war Sommer und schon unerträglich heiß. Sie hatte Kairo, diese laute, geheimnisumwitterte Stadt nie gemocht, und nun wusste sie nicht, wohin, und hätte sich einen Umzug in einen anderen Teil der Welt auch gar nicht leisten können. Sie begann, die Taschen ihrer Mäntel und Jacken nach Münzen zu durchsuchen, und versteckte sich hinter den geschlossenen Läden, wenn der Hauswirt klopfte.
Sie war allein und mittellos und hatte Angst, durch das Raster zu fallen. In Kairo mussten genug Menschen, die der Hilfe dringender bedurften als sie, auf der Straße leben. Nachts hielten nicht nur Hitze und Kummer sie wach, sondern auch die Angst vor dem Alleinsein, vor Verlassenheit und finanzieller Not. Sie war kaum noch fähig, etwas anderes zu empfinden als Entsetzen über die letzten Monate und Grauen vor der Zukunft. Sie war neunzehn Jahre alt und fühlte sich, als wäre ihr Herz verdorrt. Ihre Sehnsucht nach Liebe war stärker als ihr Hunger nach dem zuckersüßen Konfekt, das an den Straßenständen verkauft wurde.
Sie beschloss, ihr letztes Wertstück zu verkaufen, eine Perlenkette, die einst ein reicher Händler aus Aleppo ihrem Vater geschenkt hatte. Alexander Capel hatte ihm alte aramäische Texte in modernes Arabisch und ins Englische übersetzt und seinen sechs Söhnen Englischunterricht gegeben. Ihr Vater hatte ihr die Kette zum fünfzehnten Geburtstag geschenkt. Anfangs hatte sie ihr nicht gefallen, sie fand sie altmodisch und schwer, doch mittlerweile liebte sie dieses Stück und den Zauber der großen, runden Perlen mit ihrem grünlich goldenen Glanz. Es waren Meerwasserperlen, in der Lagune eines Atolls im Pazifischen Ozean geerntet, alle in Gelbgold gefasst, jede durch einen kleinen Brillanten von der anderen abgesetzt.
Henry Winterton betrat den Laden, als der Schmuckhändler, der zweifellos ihre Notlage witterte, gerade versuchte, sie kräftig zu prellen. Zu Juliets Verblüffung setzte er dem Angebot augenblicklich ein besseres entgegen und machte sich, ohne die Proteste des Händlers zu beachten, mit ihr bekannt.
»Ich habe ein Juweliergeschäft in London«, sagte er. »Winterton’s in der Bond Street. Kennen Sie es zufällig, Miss –?«
»Capel«, sagte sie. »Nein, leider nicht.«
»Wären Sie trotzdem bereit, mein Angebot anzunehmen?«
Da es ihr Genugtuung bereitete, dem schäbigen Händler einen Strich durch die Rechnung zu machen, und das Angebot großzügig war, nahm sie es dankend an. Doch irgendwie empfand sie das Geschäft als anrüchig, so als hätte sie sich auf eine Sache eingelassen, bei der es um etwas anderes ging als den Tausch einer Perlenkette gegen Geld.
Als sie aus dem Laden traten, sie mit Henry Wintertons Scheck in der Handtasche, hielt er ihr das grüne Lederkästchen hin, in dem die Perlen lagen. »Nehmen Sie sie für mich in Verwahrung«, sagte er. »Ich bleibe zwei Wochen in Kairo. Sie können sie mir vor meiner Abreise zurückgeben.« Als sie zögerte, fügte er hinzu: »Wenn sie nicht getragen werden, verlieren sie den Glanz. Ich wohne im Shepheard’s Hotel. Kommen Sie heute Abend zum Essen, ich lade Sie ein, dann können wir die Einzelheiten hinsichtlich der Rückgabe der Kette festlegen. Es ist nicht meine Gewohnheit, unschuldige Schulmädchen zu verführen, falls Sie das befürchten. Geben Sie mir Ihre Adresse, dann lasse ich Sie um acht abholen. Und tragen Sie die Kette. Sie ist ein bemerkenswertes Stück.«
Henry lud sie an jenem ersten Abend zum Essen ein und danach zwei Wochen lang jeden Abend. Juliet löste seinen Scheck nicht ein; sie legte ihn in eine Zedernholzschatulle in ihrem Zimmer und sah ihn sich hin und wieder an.
Die Ärmlichkeit ihre Tage stand in scharfem Kontrast zu der Pracht der Abende im Shepheard’s Hotel. Um acht kam ein Wagen und brachte sie dorthin. Henry erwartete sie an einem Tisch im Maurischen Speisesaal. Am ersten Abend war sie befangen und brachte kaum ein Wort heraus, und er überbrückte das Schweigen mit seinen Erzählungen. Sein Ururgroßvater, berichtete er, hatte in den 1850er-Jahren in Colchester das erste Winterton-Juweliergeschäft eröffnet. Dreißig Jahre später hatte die Familie ein zweites Anwesen in der Bond Street erworben. Es gab einen speziellen Winterton-Schliff, der einem Diamanten ein ganz außergewöhnliches Feuer verlieh, und Henry versuchte, ihr mit seinen großen gepflegten Händen eine Vorstellung von dem Verfahren zu geben. Er reiste mehrmals im Jahr ins Ausland, um rohe Schmucksteine einzukaufen; verarbeitete Steine erwarb er nur, wenn sie von höchster Qualität waren. Sein Blick hing an ihrer Perlenkette, während er sprach.
Dann erzählte er ihr von seiner Familie. Seine Schwester Jane war mit Peter Hazelhurst, einem Chirurgen, verheiratet; die beiden hatten zwei Söhne, Zwillinge, namens Jake und Eliot, und eine kleine Tochter, Gabrielle. Henrys jüngerer Bruder Jonathan war sein Partner in dem Familienunternehmen. Henry war für die Finanzen und den Einkauf zuständig, Jonathan für Personalangelegenheiten und die Führung der Geschäfte. Bei Entwurf und Herstellung neuer Stücke arbeiteten sie zusammen. Beide verfügten über das Gespür für die typische Winterton-Verbindung von Extravaganz und Eleganz. Jonathan und seine Frau Helen lebten in Maldon, in Essex, im Osten Englands, knapp sechs Kilometer von Henrys Haus Marsh Court entfernt.
Juliet stellte sich Marsh Court klamm und düster vor. In der Hitze eines Kairoer Sommers hatte das etwas Verlockendes. Ihr fiel auf, dass Henry, auch wenn er mit Wärme von seinen Geschwistern sprach, nicht vergaß, ihre Fehler und Schwächen zu erwähnen, Jonathans Unentschlossenheit, Janes Faible für moderne Methoden der Kindererziehung.
Drei Tage vor seiner geplanten Abreise aus Kairo machte er ihr einen Heiratsantrag.
»Und?«, blaffte er sie an, als sie, sprachlos überrascht, nicht gleich antwortete. »Haben Sie nichts zu sagen?«
In Panik griff sie auf die Romane des neunzehnten Jahrhunderts zurück, die sie gern las. »Ich fühle mich sehr geehrt.«
»Ehren. Schmeicheln. Das will ich nicht. Das liegt mir nicht.«
Darauf zählte er ihr die Vorteile einer Ehe mit Henry Winterton auf. Er sei sechsunddreißig Jahre alt, siebzehn Jahre älter als sie, und könne ihr und den Kindern, die sie vielleicht bekommen würden, ein bequemes Leben bieten. Er bewege sich gern in der Gesellschaft und halte sich eine Wohnung in London, sie brauche also weder Langeweile noch Unsicherheit zu fürchten. Sie werde ein Mitglied seiner Familie sein. Sie werde ein Zuhause haben.
Juliet, die sich schon halb in ihn verliebt hatte, wünschte sich das alles sehnlichst. Henry Winterton sah gut aus, war selbstsicher und intelligent und hatte sich ihr gegenüber großzügig gezeigt. Im Grunde genommen würde eine Heirat mit ihm all ihre Probleme lösen. Aber er hatte nichts davon gesagt, dass er sie liebte.
Er nahm ihre Hand. »Ich fürchte, zu langem Schwanken bleibt keine Zeit. Auf mich warten dringende Geschäfte in London, ich muss so bald wie möglich zurück.« Er senkte die Stimme. »Juliet, ich begehre Sie.«
Nicht, ich liebe Sie oder ich bete Sie an, sondern, ich begehre Sie. Sie entdeckte, dass es eine mächtige Wirkung besaß, sich begehrt zu wissen, vom anderen als Objekt der Begierde gesehen zu werden. Es entwaffnete und fesselte sie. Vielen Engländern fiel es schwer, von Liebe zu reden, sagte sie sich, und sie war sich sicher, dass die Glut in Henry Wintertons Blick alles sagte, was sie wissen musste.
Zwei Tage später heirateten sie auf dem zuständigen Standesamt im Justizministerium. Die Hochzeitsnacht verbrachten sie im Shepheard’s Hotel. Bevor sie in ihrem Nachthemd aus dem Badezimmer trat, kam ihr der Gedanke, dass sie im Begriff war, sich einem Fremden hinzugeben. Doch die Feuerprobe war bald überstanden und wirklich nicht so schlimm, wie sie gefürchtet hatte. Henry war ein kraftvoller Liebhaber, und sein Stolz verlangte, dass er ihr so viel Lust bereitete, wie er empfing. Jean-Christophe hatte dafür gesorgt, dass sie nicht völlig unerfahren war, und falls Henry das bemerkte, sagte er nichts darüber.
Am folgenden Tag bestiegen sie ihr Schiff, um nach England abzureisen. Nach Übernachtungen in Valletta und Gibraltar gingen sie in Dieppe von Bord und reisten mit der Bahn nach Paris weiter. Dort führte Henry seine junge Frau ins Modehaus Worth, um sie standesgemäß auszustatten. Er hatte ihr aufgetragen, vier Abendkleider zu bestellen. Die Verkäufer rollten Stoffballen um Stoffballen vor ihr aus, und nach einer Stunde angenehmen Überlegens und Vergleichens entschied sie sich für ein Abendkleid in Schwarz, eines in Rosé und eines in Rot.
Nur für das vierte Kleid konnte sie sich zunächst nicht entscheiden. Die Verkäuferin, eine zierliche, elegante Frau um die sechzig, schlug ein schlichtes Modell aus Ecruseide mit schwarzer Paspelierung an Halsausschnitt und Saum vor. Juliet hatte Vorbehalte, sie meinte, der Farbton hebe sich nicht genug von ihrem blassen Teint und ihren honigblonden Haaren ab, doch die Verkäuferin antwortete darauf nur mit einem Schnauben. Eingeschüchtert gab Juliet nach.
Sechs Wochen später traf der Karton mit den vier in Seidenpapier verpackten und mit Satinbändern verschnürten Abendkleidern in Marsh Court ein.
An diesem Abend trug sie das ecrufarbene Kleid und dazu die Perlenkette. Die Kette brauchte einen schlichten Hintergrund, um voll zur Geltung zu kommen. Bei kritischer Betrachtung im Spiegel stellte sie fest, dass ihr Glanz die warmen Töne ihrer Haut zum Leuchten brachten. Ihre Wangen waren noch gerötet vom Nachmittag im Garten. Sie drückte ihr Gesicht in die Hände und atmete den rauchigen Geruch des Feuers ein, der sich in ihre Haut gesenkt hatte, und sah vor sich Gillis Sinclair, wie er ihr über das Feld entgegenging.
Henry war ihr offenbar immer noch böse, denn als sie in den Salon hinunterkam, sagte er: »Ah, da bist du. Ich habe schon geglaubt, du wärst uns abhandengekommen. Ich dachte, du wärst zum Fluss hinuntergegangen, um noch ein paar Gestrandete aufzusammeln.« Dann wandte er sich seinen Gästen zu, die auf den Sofas rund ums Feuer saßen. »Juliet hat ein weiches Herz. Wenn es nach ihr ginge, würde sie mir scharenweise Schnorrer und Narren ins Haus schleppen.«
»Du hättest wohl kaum eine hartherzige Frau genommen, Henry.« Gillis Sinclair stand im Schatten neben dem Bücherschrank. Er neigte den Kopf in Richtung Juliet. »Mrs. Winterton, darf ich sagen, dass Sie bezaubernd aussehen. Henry, ich gratuliere dir zu diesem Schatz.«
»Pff«, machte Henry mit herabgezogenen Mundwinkeln. »Ich verabscheue Leichtgläubigkeit. Sie wird so gern als Gutherzigkeit verkauft, dabei ist sie der Dummheit weit näher.«
»Anteilnahme ist doch nichts Schlechtes.«
»Ich zweifle nicht, dass du sehr teilnehmend sein kannst, Sinclair, wenn es dir passt.«
Froh, nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen, gesellte sich Juliet zu Helen und Jonathan aufs Sofa. Sie hasste es, wenn Henry in dieser zynischen Stimmung war, in der er selbst noch im Handeln der Menschen, die ihm am nächsten standen, nach niedrigen Motive suchte. Den Barbours ging es vermutlich ähnlich, denn sie senkten beide die Blicke auf ihre Gläser. Jonathan und Helen hingegen schienen unerschüttert. Sie hatten solche Szenen wahrscheinlich unzählige Male erlebt. Außerdem war, wie Juliet mittlerweile festgestellt hatte, selbst der liebenswürdigste Winterton stets für einen Streit zu haben.
Sie fürchtete, Gillis könnte gekränkt sein, doch er sah Henry nur mit einem amüsierten Lächeln an. »Du hast recht, wenn es mir passt, bin ich ein wenig Heuchelei durchaus nicht abgeneigt.«
»Gillis hat nämlich ein Herz«, erklärte Jonathan. »Bei meinem Bruder hingegen hatte ich immer schon den Verdacht, dass das Ding, das ihm das Blut durch die Adern pumpt, aus hartem Stein besteht.«
Henry antwortete ihm mit einem dünnen Lächeln. »Aber du bist ja auch nicht gerade von Ehrgeiz geplagt, stimmt’s, Jonny?« Henry hatte etwas von einem eifersüchtigen Vierjährigen, der seinen kleinen Bruder mit hinterhältigen Knüffen und Püffen traktierte. Seine letzte Bemerkung war mit mehr als nur einem Spritzer Gift gewürzt. Henry war derjenige in der Familie, der dafür sorgte, dass die Geschäfte liefen; er, nicht Jonathan, hatte den altmodischen, traditionsgebundenen Goldschmiedebetrieb der Wintertons zu einem erfolgreichen Unternehmen modernen Stils gemacht.
Jonathan hob als Antwort sein Glas, und Henry wandte sich befriedigt wieder Gillis zu.
»Du gibst also zu, dass du ehrgeizig bist?«
»Ehrgeiz gehört dazu, wenn man Erfolg haben will.«
»Ehrgeiz und Heuchelei gehen Hand in Hand, oder siehst du das anders?«
»Wenn du damit sagen willst, dass in der Politik eine gewisse Fähigkeit zur Verstellung nötig ist, gebe ich dir recht.«
»Ehrlich von dir«, sagte Henry sarkastisch.
»Und wenn ich dir sagte, dass es auch anständige, bescheidene Politiker gibt …«
» … würde ich sagen, dass sie die größten Lügner von allen sind.«
Gillis blickte ins Kaminfeuer, doch Juliet bemerkte das Lächeln um seinen Mund. »Wenn ich dir also erklärte, dass sich unter meinem zugegebenermaßen attraktiven Äußeren ein anständiger und bescheidener Mensch verbirgt …«
Henry lachte schallend und schlug Gillis auf den Rücken. »Arroganz steht dir, mein Freund, du brauchst dich ihrer nicht zu schämen.« Und alle lachten mit.
Wenig später meldete das Mädchen, dass das Abendessen serviert sei.
Bei Tisch fiel Juliet erneut auf, mit welchem Geschick Gillis es verstand, Henrys Stimmung in positivere Bahnen zu lenken. Sie beobachtete ihn, in der Hoffnung, etwas von ihm zu lernen. Von seinem Freund ließ Henry sich gutmütige Spötteleien gefallen, auf die er bei jedem anderen mit Sarkasmus oder Gereiztheit reagiert hätte. Beim Abendessen vergaß Henry allmählich seinen Missmut und zeigte sich von seiner gewinnendsten Seite, charmant und liebenswürdig, der vollendete Gastgeber. Und Gillis, gewandt und heiter, erwies sich als großartiger Gesellschafter, der aus jedem Thema eine amüsante Geschichte zu machen wusste. Blanche Sinclair, dachte Juliet, konnte sich glücklich schätzen, einen so aufgeschlossenen Menschen zum Mann zu haben.
Es hätte sie interessiert, ob es die Gemeinsamkeiten waren, die die beiden Männer verbanden – Intelligenz und Bildung, scharfer Verstand und ein hervorragendes Gedächtnis –, doch im Lauf des Abends kam sie zu dem Schluss, dass gerade die Unterschiedlichkeit ihrer Charaktere die beiden Männer zueinander hinzog. Sie vermutete, dass Henry an Gillis schätzte, wie dieser sich von seiner Übellaunigkeit nicht stören ließ, und ihm erlaubte, bei den scharfen Wortgefechten, die er gern führte, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Worauf auch immer diese Freundschaft beruhte, Gillis brachte Henrys gute Seiten zum Vorschein, und dafür war sie ihm dankbar.
Das Speisezimmer von Marsh Court zeichnete sich durch eine warme und behagliche Würde aus. Kerzenlicht schimmerte auf feinem alten Porzellan, auf böhmischen Kristallgläsern und georgianischem Silber, und die karminroten Vorhänge hielten die Nacht draußen. Anfangs drehte sich das Gespräch um die Jagd und ums Segeln und um Henrys jüngsten Erwerb mehrerer Kisten französischen Weins. Juliet, die von diesen Dingen wenig verstand, sagte kaum etwas; erst als die Rede auf eine Konzertreihe in der Wigmore Hall kam, beteiligte sie sich an der Diskussion. Sie liebte die Musik, und sie liebte es, Musik zu hören, die tief auf ihre Gefühle wirkte, ob sie nun glücklich oder traurig war. Jonny und Jane Winterton spielten beide ausgezeichnet Klavier, und sie genoss es, ihnen beim Spiel zu lauschen.
Während des Essens hatte sie Mühe, Gillis nicht ständig anzustarren. Sie fühlte sich zu ihm hingezogen und konnte kaum der Versuchung widerstehen, sich in seinen Anblick zu vertiefen, den Schwung seines Mundes, den Bogen seiner Kinnlinie. Sie beobachtete sein ausdrucksstarkes Mienenspiel, wie seine blauen Augen bei einer geistreichen Bemerkung blitzten und gleich wieder nachdenklich wurden, wenn das Gespräch sich ernsteren Themen zuwandte. Einmal trafen sich ihre Blicke, und er lächelte ihr zu, ermunternd, beinahe verschwörerisch. Danach vermied sie es, ihn anzusehen.
Die politischen Entwicklungen der vergangenen zwei Monate beschäftigten die Gemüter so stark, dass eine Diskussion über die letzten Ereignisse in München unvermeidlich war. Charles Barbour fragte Gillis Sinclair, von dem alle am Tisch vermuteten, er habe dank seiner Stellung als Parlamentarischer Staatssekretär Zugang zu Informationen, die dem normalen Bürger vorenthalten wurden, ob er glaube, dass Hitler sich an die im vergangenen Monat getroffenen Vereinbarungen halten werde.
Die Erleichterung und Dankbarkeit, mit denen der Premierminister Neville Chamberlain begrüßt wurde, als er mit einem Abkommen aus Deutschland zurückkehrte, das, im Tausch gegen den Verzicht der Tschechoslowakei auf das Sudetenland, den Frieden zu garantieren schien, waren schnell von Skepsis und Schuldbewusstsein abgelöst worden. Juliet hatte die Worte ihres französischen Liebhabers, dass der nächste Krieg schrecklich werde, nicht vergessen. Sie hoffte, in Marsh Court einen sicheren Hafen gefunden zu haben.
»Nein, er wird sich bestimmt nicht daran halten«, sagte Gillis. »Das muss jedem denkenden Menschen klar sein.«
»Dann war also dieser ganze unwürdige Auftritt in München umsonst.«
»Nicht ganz. Wir haben dadurch Zeit gewonnen, und die brauchen wir dringend, um uns militärisch zu rüsten.« Gillis sah zornig aus. »Wir haben bei Weitem nicht genug Flugzeuge. Lieber Gott, wir haben nicht einmal genug Ersatzteile, um unsere Schiffe auf Vordermann zu bringen.«
»Vielleicht reicht uns die Zeit, um einen dauerhaften Frieden herbeizuführen«, murmelte Helen.
Gillis schüttelte den Kopf. »Nein, Helen, das halte ich für eine Illusion.«
»Erst vorhin haben wir von der Arroganz der politischen Kaste gesprochen«, bemerkte Jonny heftig. »Wie arrogant muss Chamberlain sein, um zu glauben, er könnte Hitler umstimmen!«
Wenig später war das Essen beendet, und die Frauen standen auf, um die Männer ihrem Brandy und ihren Zigaretten zu überlassen. Während Marie Barbour sich die Nase puderte, ergriff Helen Juliets Hand.
»Ich wollte es dir schon so lange sagen. Ich bekomme ein Kind.«
»Ach, Helen, das ist ja wunderbar. Ich freu mich so für dich.« Juliet umarmte sie. Sie wusste, dass Helen und Jonny sich schon seit mehreren Jahren ein Kind wünschten.
Das Kind werde im März zur Welt kommen, erzählte Helen und stieß einen glücklichen Seufzer aus. »Ich kann es kaum erwarten, wie ein Elefant durch die Gegend zu tappen und zu wissen, dass ich bald mein eigenes süßes Schätzchen auf dem Arm halten werde.«
Helen war groß und schlank. Es interessierte sie nicht, was in der Kleider- oder Haarmode gerade der letzte Schrei war, trotzdem sah sie in dem einfachen olivgrünen Kleid und mit dem etwas missratenen Knoten, zu dem sie ihre Haare zusammengenommen hatte, an diesem Abend strahlend schön aus, die hellbraunen Augen leuchteten vor Glück.
Als Marie ins Zimmer zurückkam, wurde nicht mehr von der Schwangerschaft gesprochen. Obwohl die drei Frauen sich bemühten, sich über Unverfängliches zu unterhalten, kehrte das Gespräch bald zur politischen Situation zurück. Helen äußerte offen ihre Furcht, Jonathan könne eingezogen werden, während Marie, deren Mann, Charles, im großen Krieg schwer verwundet worden war, überzeugt war, Derartiges nicht fürchten zu müssen.
Zum ersten Mal fragte sich auch Juliet, was auf Henry – und die Familienfirma und Marsh Court – zukommen würde, wenn es Krieg geben sollte.
Männerstimmen drangen in das intime Gespräch der Frauen ein. »Es ist eine klare Nacht«, sagte Jonathan, als er die Tür öffnete. »Wir wollen uns die Sterne ansehen. Kommt ihr mit?«
Henry hatte sich draußen im Garten ein kleines Observatorium gebaut, in dem sein Teleskop stand. Sie zogen alle ihre Mäntel über, Juliet knipste die Lichter aus, und sie gingen hinaus. Das Gras unter ihren Füßen knisterte froststarr, und die Sterne glitzerten am ganzen Himmel wie Sandkörnchen auf einem schwarz gefliesten Grund.
Fröstelnd schlugen sie ihre Kragen hoch, und ihr Atem stieg in kleinen Dampfwölkchen in die kalte Luft, während sie einer nach dem anderen durch das Teleskop sahen. Nach einiger Zeit bemerkte Juliet, dass sie sich von den anderen entfernt hatte. Sie hörte Schritte hinter sich, und als sie sich umdrehte, sah sie Gillis Sinclair kommen.
Er sah sie lächelnd an. »Juliet, das war ein wunderschöner Abend.«
»Es ist schön, dass Sie gekommen sind. Henry freut sich immer so auf Sie.«
Sie schwiegen beide, den Blick zu den Sternen gerichtet. Dann sagte er unvermittelt: »Sie sollten ihm entgegentreten. Verzeihen Sie, aber das ist das, was Henry will, jemanden, der ihm Paroli bietet.«
Sie schreckte vor dem Mitleid zurück, das sie in seiner Stimme hörte. Sie fühlte sich davon herabgesetzt. Und sie wusste, dass er sich irrte, auch wenn seine Worte gut gemeint waren. Henry schätzte Männer, die ihm entgegentraten – ja, das war richtig. Doch Juliet hatte längst gemerkt, dass eine Ehefrau mit eigenem Willen nicht nach seinem Geschmack war.
Seite an Seite gingen sie zum Haus zurück. Das herbstliche Laub und der immer lebendige Fluss verströmten ihre Gerüche, doch sie hatte das Gefühl, dass an diesem Abend noch etwas anderes in der Luft lag: ein Hauch des kommenden Winters.
Zu ihrem zwanzigsten Geburtstag wollte Henry ihr ein Armband fertigen lassen. In der gedämpften Atmosphäre kultivierter Opulenz im Laden in der Bond Street sah Juliet sich vom Glanz funkelnder Juwelen umgeben, Kolliers auf blauen Samtpolstern, Schmucksteinen von der Größe von Weintrauben in der goldenen Umarmung eines Rings, und all das ausgestellt in den blitzenden Glasvitrinen.
Henrys Perfektionismus war überall sichtbar. Die Stücke in den Vitrinen waren mit abgezirkelter Präzision ausgelegt; alle halbe Stunde prüfte ein Angestellter die Schaufenster auf Fingerabdrücke, den königsblauen Teppich auf Stäubchen. Ein Verkäufer führte Juliet zu einem Sessel. Ein anderer servierte ein Glas Champagner und ein Schälchen mit gesalzenen Nüssen.
Henry fragte Juliet, welche Steine ihr am besten gefielen.
»Smaragde«, sagte sie. Sie liebte das lebhafte grüne Feuer dieser Steine
Er betrachtete sie, während sie in ihrem Sessel saß und sich bemühte, nicht zu zappeln. »Nein«, erklärte er. »Das Armband machen wir aus Aquamarinen.«
Unwillig spürte sie, dass sie rot wurde. Sie wusste, dass Henrys Angestellte ihrem Gespräch lauschten. Tränen stiegen ihr in die Augen, und sie senkte die Lider und starrte auf die Schmuckstücke, die auf dem Verkaufstisch zur Präsentation ausgelegt waren.
Henry erwartete, dass sie zwei- oder dreimal im Monat mit ihm nach London reiste. Sie wohnten dann in der Wohnung über dem Laden, wo sie von einem Butler, einer Köchin und einem Hausmädchen bedient wurden. Er zog es vor, seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen in London nachzukommen, nach Marsh Court lud er nur seine engsten Freunde ein.
Stets unterzog Henry am Ende eines solchen gesellschaftlichen Beisammenseins die Eigenarten seiner Gäste einer akribischen Begutachtung, erging sich über ihre Dummheit und ihren Dünkel. Juliet war seine Art, andere zu sezieren, zutiefst zuwider. Nicht das kleinste Zeichen menschlicher Torheit oder Eitelkeit entging seinem Spott. Sie empfand sein Bedürfnis, bei jedem etwas zu entdecken, das nach Selbstlob oder Würdelosigkeit roch, als quälend und erniedrigend. Sie selbst zog es vor, das Beste an den Menschen zu sehen.
Mit der Zeit begriff sie, dass es zu Henrys größten Vergnügen gehörte, bei anderen nach Fehlern zu suchen. Jede moralische Schwäche, jede Fehleinschätzung, jedes Anzeichen von Unwissenheit auf den Gebieten, die den Wintertons wichtig waren – Musik und Malerei und die Natur –, griff er sofort auf, um sie der Lächerlichkeit preiszugeben. Henry sah ihr Gefallen an Smaragden als eine Äußerung von Geldgier, und er hatte sie dafür bestraft, indem er sie vor seinen Angestellten in die Schranken wies. Sie hatte nicht gewusst, dass die besten Smaragde mehr wert waren als Diamanten. Sie hatte einfach gesagt, was ihr am besten gefiel.
Aber sie lernte dazu. Sie machte keinen Fehler ein zweites Mal. Sie arbeitete an sich, um Henry keine Gelegenheit zur Kritik zu geben. Wenn sie sich in London aufhielten, besuchte sie Museen und Ausstellungen. Sie war immer wissbegierig gewesen. Auf langen Wanderungen durch die Hauptstadt entdeckte sie, dass London, trotz der anderen Kultur und des anderen Klimas, viel mit Kairo gemeinsam hatte. Auch hier gab es Armut Seite an Seite mit großem Reichtum. In den Straßen im West End, wo Menschen in lichterfunkelnden Restaurants dinierten und lachende junge Leute aus Taxis stiegen, um sich in exklusiven Nachtlokalen zu amüsieren, konnte man, wenn man sich die Mühe machte hinzusehen, ein anderes London erkennen. Sie gewöhnte es sich an, etwas Kleingeld in der Manteltasche bei sich zu tragen, um es den Männern zu geben, die schäbig gekleidet in den Türnischen hockten, meist ein Pappschild neben sich, das sie als arbeitslose Kriegsveteranen auswies. Ihre eigenen Probleme erschienen ihr gering im Vergleich, und wenn sie eine Münze in den Blechbecher warf, kam sie sich herablassend und verwöhnt vor.
Während der Sudetenkrise waren in den Parks Gräben ausgehoben und vor sämtlichen Regierungsgebäuden Sandsäcke gestapelt worden. Dieser Anblick verlieh den Straßen Londons auch nach dem Abkommen eine Atmosphäre beklommener Erwartung.
Eines Abends, als sie mit Gillis und Blanche Sinclair zu Abend aßen, traf Juliet schlagartig die Erkenntnis, dass selbst Henry – der Pessimist und Realist – gehofft hatte, Gillis werde ihnen etwas Positives zur internationalen Situation berichten können. Doch das Gegenteil war der Fall, er sprach so lange von den mörderischen Attacken gegen die jüdische Bevölkerung in Deutschland und dem Scheitern der Diplomatie, bis schließlich seine Frau eingriff. Blanche, klein und zierlich, mit dunklem Haar und blassem Teint, erinnerte ihren Mann daran, dass sie sich eigentlich getroffen hatten, um einen netten Abend miteinander zu verbringen. Daraufhin wurde das Thema Politik ad acta gelegt.
In Marsh Court fühlte sich Juliet am wohlsten. Sie bemühte sich, Henry eine bessere Frau zu werden, ihren verschiedenen Rollen als Ehefrau, Hausfrau und Gastgeberin mit Stil und Kompetenz gerecht zu werden. Sie nahm sich Helen zum Vorbild, lernte von ihr, was zu tun war, damit im Haushalt alles reibungslos klappte, wie man das Menü plante, wie man dafür sorgte, dass die Gäste sich wohlfühlten.
Nachmittags ging sie mit Farben und Staffelei zum Blackwater hinaus und versuchte, die vielen unterschiedlichen Stimmungen, in denen der Fluss sich zeigte, auf Papier zu bannen. Wenn bei Ebbe das Wasser aus dem Mündungsgebiet ins Meer hinausströmte, legte es glänzende graubraune Wattflächen bloß. Kleine Boote schaukelten auf den Strudeln, Schwimmvögel und Treibholz wurden von der Strömung mitgerissen.
Wie flachkielige Boote schienen die Inseln im Mündungsgebiet auf dem Wasser zu treiben. Thorney Island, flussabwärts von Marsh Court, war über einen aufgeschütteten Damm mit dem Festland verbunden, ein schmales Band, das manchmal da war und manchmal nicht. Auf dem Weg über den Damm zur Insel hatte Juliet das Gefühl, sich unter der Oberfläche des Flusses zu bewegen. Feucht glänzendes braunes Seegras klebte an den rauen Felsbrocken; ein starker Geruch nach Schlamm und Verfall begleitete sie, und das winterliche Licht der tief stehenden Sonne leuchtete auf dem durchweichten, unsicheren Boden neben dem Weg.
Auf der Insel stieß sie auf ein Wäldchen, eine schmale Straße, einige Felder und ein Haus, hinter dem das Land rissig war, kreuz und quer von Bächen und Rinnsalen durchzogen, kaum noch gangbar. Das Haus war von bescheidener Größe und wirkte gepflegt. In den Blumenbeeten standen braun gewordene Astern, und der Rasen war sauber gemäht.
Wer, dachte sie, würde sich einen so verlassenen, von ständigem Untergang bedrohten Ort zum Leben wählen? Vor dem Tor blieb sie stehen und stellte sich vor, wie das Wasser stieg, die Felder und den Garten überschwemmte, Blumenbeete und Rasen ertränkte, sich durch Türen und Fenster ergoss.
Mit einem Ruck machte sie kehrt und rannte zum Damm zurück – bevor die Flut kam. Als sie das Festland erreichte, atmete sie tief auf vor Erleichterung.
Wenn sie stritten, fragte sie sich häufig, was Henry gedacht hatte, als er ihr in dem Juweliergeschäft in Kairo das erste Mal begegnet war. Der Gedanke, dass er sie hatte retten wollen, wie er behauptete, war ihr unerträglich. Bemitleidet zu werden – wie erniedrigend. Doch Henrywar des Mitleids gar nicht fähig. Das konnte es also nicht gewesen sein.
Ihr Spiegel und die Blicke der Männer sagten ihr, dass ihr Aussehen etwas damit zu tun haben musste. Alle Wintertons bewunderten schöne Dinge, niemals hätten sie Hässlichkeit oder Mittelmäßigkeit in ihrem festgefügten Kreis geduldet. Henry hatte sie und ihr Perlenkollier gesehen und aus ihren Gesprächen im Shepheard’s Hotel den Eindruck gewonnen, dass es ihr nicht an Bildung fehlte. Vielleicht hatte ihm die Vorstellung gefallen, dass seine Heimkehr mit einer jungen Ehefrau in England mit Schock und Neid aufgenommen würde. Oder vielleicht hatte er sie für ein fügsames junges Ding gehalten, das er nach seinem Willen formen konnte.
Geliebt hatte er sie jedenfalls nicht. Das hatte sie mittlerweile begriffen. Sie brauchte nur Jonathan und Helen zusammen zu sehen, um zu erkennen, wie anders eine Ehe sein konnte. Wenn die beiden tanzten, lag Jonnys Hand leicht auf Helens Schulter, und manchmal streichelte er mit dem Daumen ihren Hals mit so selbstverständlicher und inniger Zärtlichkeit, dass Juliet heißer Schmerz durchzuckte. Sie gönnte ihnen ihre Beziehung von Herzen; sie wünschte nur voll Trauer, zwischen Henry und ihr bestünde wenigstens ein Hauch solcher Nähe.
Vielleicht war für gewisse Männer – Männer wie Henry – Begehren, sexuelles Verlangen alles, was die Liebe ausmachte. Aber ihr genügte das nicht. Es erschreckte sie zu denken, dass sie vielleicht ihr Leben ganz ohne Liebe würde leben müssen, und abends im Bett stellte sie sich manchmal vor, sie würde einen Koffer packen und in den nächsten Zug nach London steigen. Sie würde ihre Perlen verkaufen – obwohl sie ja von Rechts wegen Henry gehörten – und sich ein Zimmer mieten. Sie würde sich Arbeit suchen, um Essen und Wohnung bezahlen zu können. Sie wäre arm, aber sie wäre frei. Und irgendwann würde Henry auch in eine Scheidung einwilligen.
Eines Morgens dann beim Frühstück, nachdem das Mädchen Henrys Bratheringe serviert hatte, schaffte sie es nicht mehr rechtzeitig zur Toilette. Sie übergab sich auf ihr Kleid und auf das Stück Toast, von dem sie gerade abbeißen wollte. Das Mädchen machte ein Gesicht, als würde ihm ebenfalls übel, doch Henry, der, das musste man ihm lassen, nicht zimperlich war, brummte nur, das sei ja ein gelungener Tagesbeginn, und schickte sie wieder zu Bett.
Am späten Vormittag kam Dr. Vincent vorbei und eröffnete ihr nach eingehender Untersuchung, dass sie schwanger sei und das Kind im folgenden Frühjahr zur Welt kommen werde. Sie blieb im Bett, nachdem er gegangen war, beide Hände auf ihrem Bauch ausgebreitet und den Blick zum Fenster gerichtet.
Sie wusste jetzt, dass sie sich immer nach Marsh Court sehnen würde, wenn sie es verließ. Sie würde sich nach den Nachbarn sehnen, die freundlich zu ihr gewesen waren, und nach der Familie, die sie liebte und der sie sich immer stärker verbunden fühlte. Sie würde sich nach dem Nebel sehnen, der in der Morgenfrühe über der Salzmarsch lag, nach den heiseren Rufen der Seevögel und nach dem stürmischen Wasser, das die Dämme zu den Inseln überspülte. Sie wäre eine Verbannte und würde an einem heißen Augusttag die Augen schließen und sich in den Garten von Marsh Court zurückdenken. Sie würde vom silbernen Flimmern des Flusses träumen und sich an den Rosenduft in der schläfrigen Luft erinnern.
Nach langen Jahren unsteter Wanderschaft hatte sie ein Zuhause gefunden.
Nein, sie würde nicht ihren Koffer packen und in die Stadt fliehen. Sie würde Henry doch nicht verlassen. Sie würde in Marsh Court bleiben und sein Kind zur Welt bringen.
Einen Menschen, den sie lieben konnte.
2 April 1939 – Mai 1945
»ICH HOFFE, HARPER HAT DARAN GEDACHT, Flavias Vitaminsaft einzupacken«, sagte Blanche.
Sie saßen im Auto, auf der Fahrt zur Taufe aus London hinaus; die Kinder fuhren zu Gillis’ Erleichterung in Begleitung von Harper, der Kinderfrau, mit der Bahn nach Maldon. Die beiden Mädchen im Auto, das war jedes Mal eine Katastrophe, keine Kurve, die ihnen nicht auf den Magen schlug.
Gillis vermutete, dass auch Blanche lieber die Bahn genommen hätte. Sie konnte den Fahrten in seiner geliebten Crossley-Sportlimousine nichts abgewinnen und brachte sie meist nur krampfhaft ans Armaturenbrett geklammert hinter sich.
»Ganz sicher«, sagte er beschwichtigend.
»Womöglich erlaubt sie den Mädchen, das Fenster zu öffnen und sich hinauszulehnen.«
Blanche neigte dazu, sich Sorgen zu machen. Gillis wusste, dass sie bereits einen grauenhaften Unfall vor sich sah – den Sturz eines ihrer Kinder aus dem Waggon, den Schlag eines zarten kleinen Köpfchens gegen eine Mauer im Tunnel.
»Es wird nichts passieren, Liebes. Sie haben bestimmt eine Menge Spaß.« Er neigte sich zu ihr und drückte ihre Hand. Als sie nicht reagierte, hob er seine Hand wieder zum Lenkrad.
Er war fünfundzwanzig gewesen, ein aufstrebender junger Anwalt in einer renommierten Kanzlei, als er Blanche Carteret auf einem Ball in einem Haus in Belgravia begegnet war. Ihre zarte Schönheit hatte ihn sofort fasziniert, und schon sechs Wochen später hatte er ihr einen Heiratsantrag gemacht. Blanche war die einzige Tochter eines wohlhabenden Bankiers auf der Insel Jersey und brachte dringend benötigtes Geld mit in die Ehe, und Gillis, der sie aufrichtig liebte, war ehrlich genug, sich einzugestehen, dass er sie dennoch nicht geheiratet hätte, wenn sie mittellos gewesen wäre. Er musste pragmatisch denken.
Die Verbindung mit Blanche hatte es ihm ermöglicht, die Juristerei an den Nagel zu hängen und in die Politik zu gehen. Sein spektakulärer Aufstieg – mit siebenundzwanzig Parlamentsabgeordneter, mit neunundzwanzig Unterstaatssekretär und mit einunddreißig Parlamentarischer Staatssekretär – war von der Presse aufmerksam verfolgt worden. »Liebling der Götter« war eine Bezeichnung, an die er sich bald gewöhnt hatte. Jung und gut aussehend, wie er war, zierte sein Bild häufig die Titelblätter der Zeitungen. So manches Mal musste er sich deshalb Spötteleien seiner Kollegen anhören.
Die Carterets mit ihrem Einfluss und ihren Beziehungen waren ihm bei seinem Aufstieg zweifellos nützlich gewesen, doch Gillis wusste, dass er von sich aus über das notwendige Rüstzeug für eine erfolgreiche Karriere in der Politik verfügte. Er war selbstbewusst, begabt, fleißig, und er besaß Charisma. Das Einzige, was ihm fehlte, war Geld; sein Vater hatte das Familienvermögen mit Alkoholexzessen, Frauengeschichten und grandiosen Bauprojekten vergeudet, dann mit fünfzig das Zeitliche gesegnet und seinem Sohn nichts als Schulden hinterlassen. Gillis hegte den Ehrgeiz, spätestens mit fünfunddreißig den Sprung ins Kabinett zu schaffen, und er zweifelte nicht daran, dass er dieses Ziel erreichen würde.
Er bewunderte Eden und Churchill, die gegen Chamberlains Beschwichtigungspolitik zu Felde zogen, und unterstützte sie in ihrer Haltung. Zu Beginn des Jahres, als Anthony Eden aus Protest gegen die Außenpolitik der Regierung von seinem Posten als Außenminister zurückgetreten war, hatte er erwogen, ebenfalls sein Amt niederzulegen, hatte es dann aber doch nicht getan, weil er meinte, dass er über mehr Einfluss verfüge, wenn er blieb, wo er war. Im Lauf der nachfolgenden Monate hatte er allerdings feststellen müssen, dass es nicht die geringste Rolle spielte, wo er oder Eden sich positionierten: Ein Krieg war unvermeidlich. Im März 1939 hatte Hitler mit der Zerschlagung der Tschechoslowakei den letzten Funken Hoffnung auf eine friedliche Lösung erstickt.
Sie hatten London jetzt hinter sich gelassen und fuhren durch offenes Land, wo ein erster grüner Frühlingsschimmer über den Feldern und Bäumen lag. Blassgelbe Schlüsselblumen sprenkelten die Feldraine, und seine Stimmung hellte sich auf.
»Wie fühlst du dich, Liebes?«, fragte er Blanche. »Irgendwo da vorn ist ein Rasthaus. Wollen wir anhalten und etwas essen?«
Blanche sah auf ihre Uhr. »Ich fürchte, dann kommen wir zu spät zum Zug, um die Mädchen abzuholen.«
»Sie können doch notfalls ein Taxi nehmen.«
»Und mit einem Wildfremden im Auto fahren? Gillis!«
»Na schön, dann fahren wir weiter.« Er bog um eine Kurve. »Eine doppelte Taufe«, meinte er vergnügt. »Das ist doch etwas für dich, hm?«
»Ach Gott, ja. Du weißt, wie sehr ich diese kleinen Würmchen mag.«
Er antwortete nicht, hoffte, sie würde das Thema nicht weiterverfolgen.
Doch sie fragte: »Willst du es dir nicht doch anders überlegen?«
»Wir haben das besprochen«, sagte er kurz. »Wir waren uns einig. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Sobald Hitler zuschlägt, werde ich mich melden müssen.«
»Aber du hättest doch gern einen Sohn, oder nicht, Gillis?«
»Ja, natürlich.«
»Bitte, Liebster …«, sagte sie flehentlich.
Sie war ihm wirklich die ideale Frau, führte das große Haus am St. James’s Place mit Souveränität, bezauberte mit ihrem Charme, wann immer sie Gesellschaften gaben, doch im Bett blieb sie kühl. Sie gab sich seiner Umarmung nur dann mit Leidenschaft hin, wenn Schwangerschaft das Ziel war. Sonst schien sie den Geschlechtsakt als Pflicht zu betrachten. In den ersten Jahren ihrer Ehe hatte er es mit romantischen Wochenendausflügen versucht, Champagner und Rosen und sanfter Verführung, doch es war ihm nicht gelungen, ihren Widerwillen aufzulösen.
Enttäuscht und nicht ohne Groll hatte er sich schließlich damit abgefunden, dass sie ihn zwar auf ihre Weise liebte, ihre Leidenschaft, soweit sie einer solchen Regung fähig war, jedoch immer ihren Kindern gelten würde. Ihre Liebe zu Kindern war beinahe grenzenlos, sie hätte ihm eines nach dem anderen beschert, wenn es nach ihr gegangen wäre, und sie setzte sich energisch für eine Reihe von Kinderhilfsorganisationen ein. Er wusste, er brauchte nur auf ihren Wunsch nach einem weiteren Kind einzugehen, und sie würde sich ihm mit Lust hingeben. Die Versuchung war groß.
Aber nein. Die Zukunft war zu ungewiss. Für sein Gefühl wäre es verantwortungslos gewesen, in einer solchen Zeit ein Kind in die Welt zu setzen.
»Wenn es Krieg gibt«, sagte er, »musst du mit den Kindern aufs Land ziehen. Ihr könnt nicht in London bleiben. In Wiltshire seid ihr sicherer.«
Blanche hatte nichts übrig für das Haus in Wiltshire, das sie gekauft hatten, weil Gillis in seinem Wahlkreis einen Wohnsitz haben musste; es war feucht, düster und viel zu groß. Es war ein schlechter Kauf gewesen. Sie hatten vorgehabt, es zu renovieren, um es wohnlicher zu machen, aber es war ihnen beiden keine Herzensangelegenheit gewesen, und so waren sie nie dazu gekommen.
»Ich werde bestimmt nicht einfach alles stehen und liegen lassen und flüchten, Gillis«, entgegnete sie tapfer. »Du sollst immer in dein Zuhause zurückkehren können, ganz gleich, was passiert.«
»Liebes.« Ein Kaninchen flitzte vor dem Wagen über die Straße. Er bremste scharf, und das Tier verschwand im Unterholz. »Bitte, hör mir zu. Ich bin kein Unbekannter, und ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, wem meine Sympathien gelten. Die Nazis machen kurzen Prozess mit ihren politischen Gegnern, du und die Kinder wärt in Gefahr, wenn es zu einer Invasion käme. Wenn du dann auch noch schwanger wärst – oder ein Neugeborenes zu versorgen hättest –, würde das die Situation unendlich viel schwieriger machen.«
»Zu einer Invasion?«, wiederholte sie erschrocken.
»Hitler wird sich zweifellos sehr bald Polen vornehmen. Und dann – wer weiß, wer als Nächstes an der Reihe ist? Frankreich ganz sicher. Und vielleicht auch wir.«
»Papa sagt, dass Deutschland sich vielleicht mit der Tschechoslowakei zufriedengeben wird.«
»Er irrt sich.« Wieder musste er seinen Groll unterdrücken. Gerald Carteret, Blanches Vater, hatte eine Art, unausgegorene politische Äußerungen von sich zu geben, die ihn immer wieder ärgerte. »Blanche, du musst mir da vertrauen. Er irrt sich.«
Aber als er sah, wie sie sich abwandte, die Zähne auf die Unterlippe gepresst, schämte er sich, sie geängstigt zu haben.
»Vielleicht ist meine Sorge übertrieben«, sagte er sanft. »Vielleicht wird es gar nicht so schlimm, wie ich fürchte. Niemand kann in die Zukunft sehen.« Er wechselte das Thema. »Es freut mich so, dass Henry und Juliet mich zum Patenonkel des Kleinen auserkoren haben. Ich fühle mich richtig geschmeichelt.« Er würde sich alle Mühe geben, seiner Rolle als Patenonkel des kleinen Piers Winterton gerecht zu werden; wenn der Junge alt genug wäre, würde er ihn in die Konditorei Gunther’s einladen und zu den Cricketspielen im Lord’s Cricket Ground mitnehmen.
Die Taufe in der Allerheiligenkirche in Maldon verlief problemlos. Die Winterton-Säuglinge – Henrys und Juliets Sohn Piers und Jonnys und Helens Sohn Aidan – protestierten nicht allzu heftig, und die Eltern und Paten zeigten sich angemessen stolz.
Nach der Kirche fuhr die ganze Gesellschaft zum Mittagessen nach Marsh Court. Gillis, der zwischen Helen Winterton und der Frau des Hausarztes saß, beobachtete Juliet, die eben dem Mädchen bedeutete, den Tisch abzuräumen. Sie war eine strahlend schöne Frau, langgliedrig und gertenschlank, mit leicht schräg stehenden Augen, lichtes Braun mit grünen Sprenkeln, die dem Gesicht etwas ungewöhnlich Apartes verliehen. Er fragte sich, ob sie glücklich war und wie sie ihre Ehe wirklich empfand.
Gillis hatte Henry sehr gern, aber er wusste auch, dass Henrys Charakter durchaus einen hässlichen Zug hatte, einen Zug, der jener Seite von Gillis’ Wesen entgegenkam, die er gewöhnlich zu verbergen suchte: ein kühl berechnender Egoismus, den er sich in seinen Jugendjahren angeeignet hatte, um in einem zerrütteten Elternhaus überleben zu können. Juliet war warmherzig, aufgeschlossen und bestrebt zu gefallen, sicher nicht die Charaktereigenschaften, die bei Henry Winterton Bewunderung hervorriefen. Gillis vermutete, dass er sie geheiratet hatte, weil sie schön war und diese Schönheit den perfekten Rahmen für ein Brillantkollier oder ein Paar Smaragdohrringe von Winterton abgab. Konnte man ihm das verübeln?
Nach dem Mittagessen legten die Kinderfrauen ihre jüngsten Schützlinge zum Mittagsschlaf nieder, während die Erwachsenen und die älteren Kinder ins Freie hinausgingen. Die Wintertons wollten zur Feier der Geburt der beiden Cousins ein großes Freudenfeuer veranstalten. Henry hatte seinen Gärtner einen halb verfallenen alten Schuppen niederreißen und die Bretter zu einem Holzstoß stapeln lassen. Dürres Holz, Zeitungen, Kartons und Wellpappe waren dazwischengeschoben worden, um das Feuer zum Brennen zu bringen.
Es amüsierte Gillis, die Familie bei solchen Anlässen zu sehen. Alle – der boshafte Henry, der freundliche Jonathan und ihre temperamentvolle Schwester Jane – wurden sie von einer Stimmung erfasst, für die ihm nur das Wort »vorzeitlich« einfiel. Eifrig rannten sie umher, suchten Holz, um das Feuer zu nähren, schrien vor Begeisterung, wenn der Wind die Flammen packte und zum Himmel hinaufpeitschte. Unbekümmert streckten sie die Köpfe zum Feuer, wenn das Inferno an Kraft zu verlieren drohte, und achteten nicht auf die roten Funken, die das feuchte Holz ihnen entgegenspie. Über ihrer kindlichen Freude waren alle Familienzwistigkeiten vergessen.
Gillis liebte die Wintertons aufrichtig und von Herzen. Er war ihnen, die am liebsten unter sich blieben und so großen Wert auf familiären Zusammenhalt legten, dankbar dafür, dass sie ihn in ihren festgefügten Kreis aufgenommen hatten. Seine eigene Familie war ihm stets eine Enttäuschung gewesen, und seine angeheiratete Familie, die Carterets, mochte er nicht.
Die Freundschaft mit Henry Winterton und seinen Geschwistern schloss eine Lücke in seinem Leben. Er und Henry hatten sich 1934 bei einem Abendessen eines gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Sie hatten an diesem Abend ausgiebig über Sinn und Sinnlosigkeit des Völkerbunds gestritten und waren danach feste Freunde geworden.
Henry, in Tweedjackett und mit Jagdkappe, packte einen Stock, um eine lodernde Latte wieder auf den Holzstoß zu befördern. Neben ihm stand Jane Hazelhurst, seine Schwester. Ihr langes Haar war so hell wie ihr Nerzmantel, und ihr Gesicht mit der für die Wintertons typischen hohen Stirn und den leicht kalt wirkenden blauen Augen schimmerte golden im Feuerschein. Gillis mochte sie, weil man sich auf sie verlassen konnte und sie für jeden Spaß zu haben war. Sie besaß eine unglaubliche Energie und Lebenslust, war immer mit von der Partie, ob man nun einen kilometerlangen Marsch durch die Landschaft vorschlug oder zum Abschluss eines Abends noch eine Flasche Whisky köpfen wollte.
Jonny Winterton und Peter Hazelhurst standen auf der anderen Seite des Kreises. Jonnys trockenem Humor fehlte die schneidende Schärfe, mit der jede scherzhafte Bemerkung seines älteren Bruders daherkam. Er war, wie seine Schwester Jane, ein begabter Pianist, und Gillis fragte sich, ob er sich nicht, anstatt in die Familienfirma einzusteigen, für eine Karriere als Musiker entschieden hätte, wenn er die Wahl gehabt hätte. Aber die hatte er nicht gehabt: Er war ein Winterton, folglich arbeitete er in der Firma. Janes Mann Peter, groß und dunkel, war Chirurg an einem Londoner Krankenhaus, ein ausgeglichener Mensch, den so leicht nichts aus der Ruhe brachte – was sicherlich hilfreich war, dachte Gillis, wenn man in den Innereien der Leute aufräumen musste. Und wenn man mit Jane verheiratet war.
Jonnys Frau Helen, die sich mit Marie Barbour unterhielt, lächelte Gillis zu und winkte ihm, sich zu ihnen zu gesellen. Er erwiderte das Lächeln, folgte jedoch ihrer Aufforderung nicht gleich. Blanche trug die kleine Claudia, die heftig weinte, zum Cottage. Gillis’ Blick kehrte zu Juliet Winterton zurück. Es war schwer, sie aus den Augen zu lassen. Man fühlte sich zu ihr hingezogen. Sie sah gelöst und strahlend aus, der Feuerschein ließ in ihren honigblonden Haaren orangene und kupferrote Lichter aufblitzen, und auf ihrem Gesicht lag ein Ausdruck freudiger Erwartung. Ja, Henry war ein echter Glückspilz.
Gillis litt schon sein Leben lang an plötzlichen Stimmungsumschwüngen, die ihn aus heiterem Himmel in finstere Tiefen stürzen konnten. So erging es ihm jetzt. Er musste daran denken, dass in sechs Monaten vielleicht jeder der Männer, die hier gut gelaunt um das Feuer standen, eine Uniform tragen würde. Wenn der Krieg so grausam wurde, wie er fürchtete, würden sie vielleicht bald schon nicht mehr alle am Leben sein. Und die Frauen und Kinder? Würde sich Stanley Baldwins Warnung, »der Bomber kommt immer durch«, auf schreckliche Weise als zutreffend erweisen?
Um die trüben Gedanken abzuwehren, nahm er seine Tochter Flavia bei der Hand und begann mit ihr um das Feuer herumzutanzen und dazu gellendes Indianergeheul auszustoßen. Jane und ihre Zwillinge schlossen sich in wilden Sprüngen an und dann auch Jonny. Selbst Henry vergaß, von untypischem Übermut gepackt, ausnahmsweise seine Würde und tobte mit ihnen.
Gillis liebte das Meer. Eine seiner frühesten Erinnerungen führte nach Cornwall, wo er am Strand herumtappte und zusah, wie das türkisgrüne Wasser den milchweißen Sand überspülte. Er hatte jedes Mal gejauchzt vor Vergnügen, wenn die zurückflutenden Wellen den Sand unter seinen Fußsohlen wegsogen und ihn einen Moment ins Wanken brachten.





























