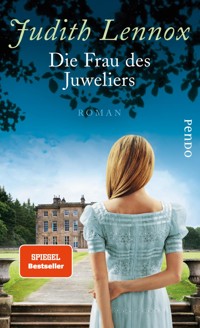11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit "Meine ferne Schwester" begeben Sie sich auf eine gefühlvolle Zeitreise in die dreißiger und vierziger Jahre – so einnehmend, dass Sie gar nicht mehr in die Gegenwart zurückkehren möchten. Rowan und Thea sind zwei Schwestern, wie sie verschiedenartiger nicht sein könnten: Während sich Rowan regelmäßig ins nächtliche Partyleben stürzt, arbeitet Thea strebsam auf ein Archäologie-Studium hin. Trotz ihrer gravierenden Unterschiede führen sie eine innige Beziehung. Ein altes Geheimnis stellt dieses schwesterliche Band allerdings auf eine harte Probe. Rowan hat Thea nämlich nicht alles über den schicksalhaften Unfall erzählt, bei dem ihre Mutter ums Leben kam. Erst als der Zweite Weltkrieg um sie herum ausbricht, kommt die ganze Wahrheit ans Licht und für die zwei Schwestern bietet sich eine Chance, wieder zueinander zu finden. Judith Lennox bewies schon mit ihren Familienromanen "Das Mädchen mit den dunklen Augen" und "Das Winterhaus", dass sie ein einzigartiges Talent dafür besitzt, mitten ins Herz ihrer Leserinnen zu treffen. Auch ihren neuen Gesellschaftsroman stattet sie mit ihrem unverwechselbaren Zeitkolorit aus, während sie zeitlose Themen und Emotionen verhandelt. Wunderschöne Frauenunterhaltung – zwei Charakterstudien in einer Welt im Wandel Zehn Jahre begleitet Judith Lennox ihre beiden faszinierenden Heldinnen, die in zwei unterschiedlichen Welten leben, sich auf ihre vollkommen eigene Weise emanzipieren und gesellschaftliche Normen abstreifen möchten. Ein Buch wie geschaffen für einen verregneten, gemütlichen Nachmittag auf der Couch. Ein Doppelleben, ein dunkles Geheimnis, ein perfekter Lesenachmittag – Judith Lennox zeigt sich wieder in literarischer Hochform "Lennox verbindet große Gefühle und Historie zu einem mitreißenden Gesellschaftsporträt." (Freundin) Sanft, einfühlsam und atmosphärisch dicht erzählt "Meine ferne Schwester" von bewegenden Schicksalen, wie es nur die Bestsellerautorin vermag. Machen Sie sich selbst ein Geschenk und versinken Sie in diesem hinreißenden Schmöker. »Neben romantischen Liebesgeschichten erzählt Judith Lennox immer auch von den Läufen der Zeit, den Wandlungen der Gesellschaft und dem Durst nach Freiheit und Eigenständigkeit der Frauen.« Buchkultur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.pendo.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Meine ferne Schwester« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Aus dem Englischen von Mechtild Ciletti
Von Judith Lennox liegen im Piper Verlag vor:
Bis der Tag sich neigt | Serafinas später Sieg |
Der Garten von Schloß Marigny | Die geheimen Jahre |
Das Winterhaus | Tildas Geheimnis | Am Strand von Deauville | Picknick im Schatten | Die Mädchen mit den dunklen Augen |
Zeit der Freundschaft | Das Erbe des Vaters | Alle meine Schwestern |
Der einzige Brief | Das Haus in den Wolken | Das Herz der Nacht |
Der italienische Geliebte | An einem Tag im Winter |
Ein letzter Tanz | Die Frau des Juweliers | Das Haus der Malerin |
Meine ferne Schwester
© Judith Lennox 2020
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Secrets Between Us«, Headline Review, London 2020
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion: Christine Neumann
Covergestaltung: u1 berlin / Patrizia Di Stefano
Covermotiv: Ildiko Neer / Arcangel Images; Jose A. Bernat Bacete / Getty Images; Daniel Vernon / Alamy Stock Foto
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Teil 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Teil 2
11
12
13
14
15
16
17
18
Teil 3
19
20
21
Dank
Für Macsen James Bethencourt-Smith
Teil 1
Wetterumschwung
1937–1939
1
Dezember 1937
Patrick hatte zur Cocktailparty der Manninghams nicht mitkommen wollen. Verärgert schob Rowan die Absage ihres Mannes auf den Streit, der sich am Morgen beim Frühstück mit weichen Eiern und Toast zwischen ihnen entzündet hatte. Er wünschte, dass sie schon am Heiligen Abend zu seinem Vater nach Guildford reisten, während sie den Besuch so lange wie möglich hinausschieben und erst am ersten Feiertag fahren wollte. Sie war dann ohne Patrick mit ihrer gewohnten Clique losgezogen, den Charlburys, den Wiltons und den Vaughans – nicht zu vergessen Nicky Olivier, der, in Hochform an diesem Abend, von einem halben Dutzend Bewunderern umgeben in seinem Polstersessel Hof hielt und über die Gastgeber spottete.
Etwas abseits im großen, mit scharlachroter Tapete ausgeschlagenen Salon mixte Davey Manninghams Butler alkoholreiche Cocktails, die im Hinblick auf Weihnachten mit einem stachligen Ilexzweiglein dekoriert waren. Auf dem Klavier klimperte jemand Weihnachtslieder, Düfte von Nelke und Orange hingen in der Luft, und im offenen Kamin knisterten Apfelholzäste. Die Frauen trugen Kleider in Smaragdgrün, Eau de Nil, Türkis, Orange und Babyrosa.
Jemand sagte: »Mrs Scott, wie reizend!«, und als Rowan, die auf einem der voluminösen Sofas saß, den Blick hob, erkannte sie Simon Pemberton, einen Cousin ihrer besten Freundin, Artemis Wilton. Sie war ihm früher schon auf Bällen und in Konzerten begegnet und murmelte jetzt eine kurze Begrüßung.
»Ich war eine Weile lahmgelegt«, erklärte er, halb über die Armlehne des Sofas gebeugt. »Ein Verwandter von mir war krank und brauchte mich. Die letzten drei Wochen habe ich auf dem Land zugebracht. Es ist eine Erlösung, zurück in der Zivilisation zu sein«, schloss er mit einem theatralischen Schaudern.
Es schmeichelte ihr, dass er ihre Aufmerksamkeit suchte. Von seinem Blick umfasst, spürte sie ein Prickeln angenehmer Erregung, die Ahnung einer Aussicht auf Tröstung und Abenteuer. Simon Pemberton war ein hochgewachsener Mann mit kurz geschnittenem kastanienbraunem Haar und tiefblauen Augen, im Profil wirkte sein Kopf wie der eines noblen römischen Senators: Adlernase, leicht grausamer Zug um den Mund.
»Mögen Sie das Land nicht?«, fragte sie.
Seine Mundwinkel zogen sich abwärts. »Fischen und Jagen sagen mir wenig, und was sonst kann man dort schon unternehmen? Es gibt keine nennenswerten Kunstmuseen in Suffolk, wo mein Onkel lebt, und kaum Gelegenheit, Konzerte zu hören, die nicht absolut amateurhaft sind. Und die Leute, mit denen man dort zu tun hat … Ist es möglich, dass Feld, Wald und Wiese jegliches Konversationstalent ersticken? Oder verkriechen sich vielleicht alle, die nicht mit ihm gesegnet sind, ganz bewusst auf dem Land?«
»Mir fehlt das Land, wenn ich zu lange in der Stadt bin«, sagte Rowan. »Sie nimmt mir die Luft.«
»Und doch leben Sie in der Stadt.«
»Es geht nicht anders. Wegen Patricks Arbeit.« Ihr Mann war Prozessanwalt, der regelmäßig bei den höheren Gerichten zu tun hatte.
Er setzte sich neben sie. »Mich hat die Ehe nie gelockt. Was hat sie schon zu bieten außer Einengung des Blickfelds und der Möglichkeiten?«
Obwohl ihre Ehe sich als herbe Enttäuschung erwiesen und sie immer mehr das Gefühl hatte, dass Patrick in jeder Hinsicht anders war als sie, ärgerte sie Simons Urteil.
»Sie bietet Sicherheit«, entgegnete sie. In der Rückschau allerdings fragte sie sich, ob sie nicht Sicherheit mit Liebe verwechselt hatte, als sie Patrick geheiratet hatte.
»Ich hatte das Glück, immer in gesicherten Verhältnissen zu leben«, fügte sie hinzu. »Aber bei uns Frauen ist es anders, wir sind von den Männern abhängig. Und Liebe – gibt es die allein in der Ehe? Ganz ehrlich, gibt es sie überhaupt noch in der Ehe, wenn die ersten Momente der Glückseligkeit vorbei sind?«
»Angemessen zynisch.«
»Verzeihen Sie. Stimmt, Zynismus ist billig und hässlich dazu. Sie haben recht, Optimismus kostet mehr Mühe, gerade heutzutage«, sagte sie, da sie vermutete, dass seine Bemerkung sich auf die Nachrichten bezog, die Gräuel des Bürgerkriegs in Spanien und das bedrohliche Umsichgreifen des Faschismus in Deutschland und Italien. »Man hat ja beinahe Angst, die Zeitung aufzuschlagen.«
Schnell und geschickt lenkte er das Gespräch in andere Bahnen. Sie unterhielten sich über zeitgenössische Kunst – er bewunderte Ben Nicholson und Stanley Spencer, für Henry Moore hingegen hatte er nur Verachtung übrig.
Die Kunst abgehakt, wandten sie sich dem Theater zu, während der Pianist The Holly and the Ivy herunterhämmerte. Simon gab vor, jedes interessante Stück in London gesehen zu haben. »Nicht, dass es mehr wären, als sich an den Fingern einer Hand abzählen lassen«, erklärte er. »Das Theater ist ausgebrannt, ein Schatten dessen, was es in seiner Blüte zu Zeiten Edwards VII. war. Im West End gibt es nichts als absolut grässliche Revuen und ordinäre Musicals.«
»Sie mögen keine Musicals?«
»Wer mit einem Funken Intelligenz mag die schon?«
»Ich liebe sie. Und das Kino? Gehen Sie ins Kino?«
»Nie wieder. Ich war einmal dort und fand es fürchterlich.«
Sie lächelte. »Vielleicht haben Sie sich den falschen Film angesehen?«
»Das glaube ich nicht. Diese schlechte Luft, der Gestank von billigen Zigaretten und Dienstmädchenparfum … diese geballten Horden mit ihrem Popcorn und ihrem Eis. Und die Banalität der Geschichte auf der Leinwand – es war unerträglich.«
»Ich gehe gern allein, am Nachmittag.« Simon war so überzeugt von sich und seiner Meinung, dass Rowan sich eine kleine Provokation nicht verkneifen konnte. »Es hat so etwas herrlich Dekadentes.«
»Und das gefällt Ihnen? Ich verabscheue diese Leute, die nach Dekadenz um ihrer selbst willen streben und so tun, als genössen sie es, sich in irgendwelchen heruntergekommenen Kaschemmen mit kreischender Jazzband herumzutreiben, weil sie glauben, das mache sie interessanter.«
»Du meine Güte!« Sie warf ihm einen belustigten Blick zu. »Muss ich jetzt Jazzmusik und Nachtlokale auf die Liste der Dinge setzen, die Sie nicht mögen?«
»Es ist doch wahr! Was ist dieses dumme Zeug im Vergleich mit einer Arie aus der Zauberflöte … oder einem Gemälde von Velazquez? Oder der Szene in Giselle, wenn die Ballerina über die Bühne zu schweben scheint wie das Geistwesen, das sie spielt?«
Rowan kannte selbst diese Momente, da einem der Atem stockte. Auch sie bewunderte Intensität und Leidenschaft und verachtete das Oberflächliche und Halbherzige. Die Ernsthaftigkeit, mit der er gesprochen hatte, machte ihn ihr sympathischer.
»Sie meinen das Erhabene«, sagte sie. »Aber das sind seltene und flüchtige Momente. Und in der Zwischenzeit müssen wir heiter bleiben.«
»Aber Sie werden mir doch zustimmen, dass das Wohlfeile und Oberflächliche uns herabzieht. Es trübt unseren Blick für das wahrhaft Schöne, und was bleibt uns dann noch?« Seine dunkelblauen Augen blitzten amüsiert. »Ich gebe es zu, ich kann Schönheit nicht widerstehen. Was glauben Sie, warum ich mich hier mit Ihnen unterhalte, Mrs Scott, obwohl wir doch offenbar wenig gemeinsam haben?«
Herzklopfen. »Sie sind ein Schmeichler.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich schmeichle nie. Wenn es um Schönheit geht, bin ich immer ehrlich. Zum Beispiel sollten Sie nicht diese Farbe tragen. Dieser Blauton nimmt Ihrem Haar das Feuer. Sie sollten Rot tragen. Frauen mit rotblondem Haar schrecken immer vor Rot zurück. Sie fürchten den Aufeinanderprall der Farben. Aber das ist ein Irrtum. Sie sähen grandios aus in einem Venezianisch-Rot. Wie eine Flamme, eine hohe, schimmernde Flamme. Ah, ich sehe schon, ich gehe Ihnen zu weit.« In seinem Ton lag keine Spur von Bedauern.
»Keineswegs«, entgegnete sie und fügte leichthin hinzu: »Ein praktischer Tipp in Modefragen ist immer hilfreich.«
Sie plauderten noch eine Weile, dann lud er sie zum Abendessen ein. Rowan war klar, dass sie im Begriff war, einen gefährlichen Weg zu beschreiten, als sie das Haus der Manninghams und ihre Freunde verließ, aber das konnte sie nicht aufhalten.
Im Simpson’s in the Strand dinierten sie in einem dunkel getäfelten Raum mit reich verzierter Stuckdecke, und Rowan fragte Simon nach seinen Weihnachtsplänen.
»Ich bleibe zu Hause«, sagte er. »Zu Weihnachten verreise ich nie, diese Familienfeiern mit schreienden Säuglingen und kreischenden Kindern finde ich unerträglich. Zum Mittagessen kommen ein paar gute Freunde, Familienmuffel wie ich, und den Abend werde ich mir mit Samuel Johnsons Essays bei einem guten alten Portwein vertreiben. Ich freue mich schon sehr darauf. Und Sie, Rowan?« Sie waren wie von selbst dazu übergegangen, einander mit Vornamen anzureden.
»Wir sind am ersten Feiertag immer in Guildford beim Vater meines Mannes und meiner Schwägerin Elaine.« Ihr graute schon jetzt vor ihnen – dem gebrechlichen alten Mann mit seiner unablässigen Nörgelei und ihrer Schwägerin, der verbitterten alten Jungfer, die ihn betreute. Schwere Speisen, stickige Räume und Langeweile.
»Meine jüngere Schwester Thea kommt auch«, fuhr sie fort. Die sechzehnjährige Thea lebte noch bei ihrem verwitweten Vater, der für Weihnachten nichts übrighatte. Er ging über die Feiertage lieber fischen oder bergwandern mit einem alten Freund namens Malcolm Reid, einem Sonderling, der abgelegen in den schottischen Highlands lebte und den sie nie kennengelernt hatten.
»Danach fahren wir drei zu Silvester nach Glasgow«, fügte sie hinzu.
»Ich habe gehört, dass in Schottland Silvester vielerorts mit mehr Trara gefeiert wird als Weihnachten.«
»Ja, das stimmt. Haben Sie Familie, Simon? Ach ja, den Onkel in Suffolk.«
»Denzil verbringt die Feiertage auch am liebsten allein für sich in seinem Haus Ashleigh Place. Es ist vielleicht das schönste kleine Herrenhaus in England.«
»Ah, da haben wir wieder die Schönheit!«
»Ja, ich bin ihr verfallen.« Sein Blick saugte sich an ihr fest. Ein ungeschickterer Mann hätte vielleicht irgendein abgedroschenes Kompliment angehängt. Er tat es nicht und rief damit nervöse Spannung bei ihr hervor und das Verlangen nach mehr.
Sie fragte, ob Ashleigh Place schon lange in seiner Familie sei.
»Nein, keineswegs, Denzil war fünfundzwanzig, als er es einem Verrückten abkaufte, einem krankhaften Selbstdarsteller, der gern Theateraufführungen veranstaltete. Vorher gehörte es einer alteingesessenen Familie, den Gardiners, die es langsam verfallen ließen. Denzil restaurierte Ashleigh Place. Es war ein gewaltiges Unternehmen, sein Lebenswerk. Man möchte es heute nicht glauben, da er so schlecht beisammen ist, aber als er noch jünger war, strotzte er vor Kraft und Energie.«
»Sie haben ihn gern, nicht?«
Er lächelte. »Ja. Abgesehen von Denzil gibt es kaum jemanden in meiner Familie, mit dem ich freiwillig meine Zeit teilen würde. Ich habe eine Schwester, Anne, die mit einem Spießer namens Edwin verheiratet ist. Sie hat zwei Kinder. Henry ist ein wackerer kleiner Bursche. Ich werde ihm einen Walnusskuchen von Fullers für seine Süßigkeitendose schicken. Meine Nichte Zorah ist ein eher schlichtes Gemüt. Was, meinen Sie, wäre das richtige Weihnachtsgeschenk für sie?«
»Wie alt ist sie denn?«
»Ich weiß nicht genau. Fünf oder sechs.«
Rowan überlegte. »Buntstifte vielleicht? Ich habe als kleines Mädchen mit Begeisterung gemalt.«
»Und malen Sie noch?«
»Heute? Selten. Unser Haus ist sehr klein, da ist kein Platz für Malsachen. Oh, ich weiß, nichts als Ausreden.« Sie seufzte. »In Wirklichkeit fällt mir einfach nichts mehr ein, was ich malen könnte. Glauben Sie, dass einem die Einfälle ausgehen, wenn man alt wird?«
»Na, alt sind Sie nun wirklich nicht.«
»Ich bin dreiundzwanzig. Manchmal fühle ich mich alt.« Dreiundzwanzig kam ihr uralt vor. Sie war knapp neunzehn gewesen, als sie von Glasgow nach London gegangen war. Es schien ihr eine Ewigkeit her zu sein. Sie erinnerte sich, wie aufgeregt sie gewesen war, mit welcher Glut sie den neuen Möglichkeiten entgegengefiebert hatte, die auf sie warteten, wie sehr sie die Streifzüge durch die Stadt geliebt hatte.
»Ich bin sechsunddreißig«, sagte Simon, »und ich fühle mich nicht älter als an dem Tag, als ich aus der Schule kam.«
Aus einem kurzen Gespräch mit Artemis, bevor sie ihren Mantel geholt hatte, wusste Rowan, dass Simon ledig war und es nicht nötig hatte zu arbeiten. »Sie haben es gut.« Sie neigte den Kopf zur Seite. »Sie können ein Leben führen, wie es Ihnen passt.«
»Finden Sie das verwerflich, oder sind Sie neidisch?«
»Keines von beiden. Glaube ich jedenfalls.«
Er lachte. »Was war das dann? Ein schottisch-puritanisches Naserümpfen?«
»Fühlt man sich nicht ziemlich … ziellos, um nicht zu sagen, orientierungslos, wenn man den ganzen Tag nichts zu tun hat, als sich zu vergnügen?«
»Nein, es ist sehr angenehm. Warum versuchen Sie es nicht einmal?« Sie wollte etwas entgegnen, schwieg aber, als er mit den Fingerspitzen ihr Handgelenk berührte. »Sie werden doch jetzt nicht so banal sein und mir erzählen, dass Sie einen Haushalt und einen Ehemann zu versorgen haben, Rowan? Das wäre wirklich enttäuschend.«
Er hob die Finger von ihrer Hand, doch seine Berührung schien einen Abdruck hinterlassen zu haben wie in weichem Ton. Sie sollte aufstehen und gehen, dachte sie, eine Verabredung vorschützen oder vorgeben, Patrick warte auf sie – irgendetwas.
Doch sie blieb, wo sie war. »Jeder hat Pflichten. Selbst Sie müssen doch welche haben.«
»Jeder tut so, als hätte er Pflichten, aber die meisten Leute sind wie ich, sie tun nur das, was ihnen in den Kram passt. Ich rede natürlich von meinesgleichen. Das Leben der unteren Schichten ist zwangsläufig eingeschränkt. Man kann natürlich auf lange Sicht planen. Ich habe meine Gründe dafür, die Unbilden des ländlichen Suffolk zu ertragen.«
»Die Schönheit.«
»Richtig.« Er sah sie forschend an. »Und ich vermute, Sie, Rowan, nehmen Ihre häuslichen Pflichten und die gesellschaftliche Routine hin, weil … weil Sie sie befriedigen.«
Bei ihrer Heirat vor drei Jahren hatte sie gemeint, es müsse ein Leichtes sein, einen Haushalt zu führen, weil so vieles, was dazugehörte, belanglos und ständige Wiederholung war. Ja, es war belanglos und immer nur mehr desselben, aber es kostete, wie sich gezeigt hatte, auch Zeit und Kraft. Sie hatte gelernt, alles unter einen Hut zu bringen, die Einkäufe im Lebensmittelgeschäft, beim Gemüsehändler, beim Fleischer und beim Fischhändler, die Wäscheabgabe und die Tageshilfe. Sie konnte inzwischen recht passabel kochen; Gwen, ihre Köchin, hatte ihr die Zubereitung verschiedener kleiner Gerichte gezeigt, die sie an Gwens freien Abenden für Patrick und sich auf den Tisch brachte. Von ihren Freunden wurde sie als amüsante und originelle Gastgeberin geschätzt. Und doch ertappte sie sich immer häufiger bei der Frage: und nun? Wo konnte sie ein Ventil finden für den Tatendrang, der sie umtrieb, für die innere Unruhe, die es ihr unmöglich machte, abends mit einem Buch oder einer Handarbeit still im Haus zu sitzen? Nichts als immer wieder die gleichen Einkaufslisten, die gleichen geselligen Abendessen die nächsten zwanzig oder dreißig Jahre?
»Wohl kaum«, entgegnete sie mit einem kleinen Lachen.
Er zündete zwei Zigaretten an und reichte ihr eine. »Oder«, sagte er gedämpft, »Sie ertragen es für Ihren Mann, den Sie lieben.«
»Er liebt mich nicht«, sagte sie und bedauerte augenblicklich ihre Offenheit. Wenn er wusste, dass sie nicht begehrt wurde, würde vielleicht sein Interesse an ihr schwinden.
Doch er zog die Augenbrauen hoch. »Dann ist er ein Narr.«
»Nein«, entgegnete sie mit Bitterkeit. »Patrick ist alles andere als ein Narr.«
»Aber warum dann?«
Sie antwortete mit einem kurzen Kopfschütteln. Sie wusste nicht, warum Patrick sie nicht begehrte. In ihren Gesprächen klammerten sie das Thema aus. Sie getraute sich nicht, ihn zu fragen, aus Angst, es könnte an ihr liegen. Sie war kalt. Sie wurde älter. Ihr fehlte die erotische Ausstrahlung. Schönheit und Attraktivität waren nicht das Gleiche. Immer häufiger beschlich sie der Verdacht, sie sei einfach nicht liebenswert.
Gedämpfter Tumult an einem anderen Tisch, wo ein Gast zu viel getrunken und die Weingläser umgestoßen hatte, bot willkommene Ablenkung. Kellner eilten mit Tüchern und Kehrschäufelchen hin und her.
»Sie machen so ein trauriges Gesicht«, bemerkte Simon sanft. »Was ist?«
Der Kellner kam und räumte ihre Teller ab. Als er gegangen war, sagte sie: »Als ich Patrick kennenlernte, lebte ich in London, allein. Ich war ziemlich deprimiert … ich hatte gerade eine unglückliche Liebe hinter mir. Bei Patrick hatte ich das Gefühl, dass er mir Halt gibt. Ich brauchte das. Kennen Sie dieses Gefühl, ziellos dahinzutreiben, ohne die geringste Ahnung, welche Richtung man einschlagen soll?«
»Nein.«
Damals, in der ersten Zeit, hatten Patricks Liebenswürdigkeit und Gelassenheit sie angezogen. Ihr selbst fiel Gelassenheit schwer, und sie fand sich nicht besonders liebenswürdig. Aber nach drei Jahren Ehe, in denen der Sex zwischen ihnen, von Anfang an nicht gerade stürmisch, völlig abgeflaut war, machte das Schweigen, in das Patrick sich zurückzog, sie nur noch ängstlich und wütend.
Mit einem feinen Lächeln fügte Simon hinzu: »Tja, ich bin zwar Ästhet und überzeugter Stadtmensch, aber wenn man ein wenig schürft, stößt man zwei Generationen zurück auf eine lange Reihe bodenständiger Bauern aus Hertfordshire. Eigentlich sollte ich jetzt wohl meine Schweine füttern.«
»Gott, da würden Sie sich ja bekleckern, Simon.« Sie lachte mit einem Blick auf seinen tadellos sitzenden Abendanzug.
»Ja, das ist wahr.« Er tätschelte ihre Hand, und sie hätte am liebsten die seine ergriffen wie einen rettenden Anker. »Rowan …« Er senkte die Stimme, während er zart die Innenfläche ihrer Hand streichelte, »ich bewundere schon seit einer Weile Ihren Glanz und Ihr Feuer. Nur die Furcht, darin zu verbrennen, hat mich bis jetzt zurückgehalten.«
Wie sollte man als Frau auf eine solche Erklärung reagieren? Sie war froh, als der Kellner mit der Dessertkarte kam. Sie wollten beide keinen Nachtisch; sie hatte den Appetit verloren, und Simon nahm nie Nachspeisen, wie er sagte. Bei Kaffee und Petit Fours unterhielten sie sich über dies und das, doch Rowan wusste, dass eine Grenze überschritten war und sie sich auf gefährliches Terrain zubewegten – aber nein, er, Mann und Junggeselle dazu, hatte nichts zu fürchten, gefährlich war es nur für sie.
Heißes Verlangen kämpfte mit lähmender Angst. Es war so lange her, dass sie einen Mann begehrt, dass sie überhaupt etwas gefühlt oder gespürt hatte, dass Lust und Vorsicht miteinander gestritten hatten. Ein Schleier hob sich. Sie war sich selbst verloren gegangen, und nun, plötzlich, hatte sie sich wieder von der Asche ihrer Ehe befreit, brach Farbe sich Bahn durch das Grau. Er begehrte sie und machte kein Geheimnis daraus. Sie fühlte sich wieder lebendig.
Draußen auf der Straße schimmerten blass in dunstigem Strahlenkranz die Gaslampen. Sie winkte einem Taxi, aber es fuhr vorbei. Solche Kleinigkeiten können ein Leben wenden, dachte sie später. Hätte das Taxi gehalten, wäre es nie zu diesem Kuss gekommen, diesem erschreckenden und leidenschaftlichen Kuss, den sie besinnungslos vor Lust und Begierde erwiderte.
Auf der frühmorgendlichen Fahrt durch die froststarren Straßen Londons sah sie zum Fenster des Taxis hinaus. Der Nebel legte verwaschene gelbe Schleier über die Reklamewände, die Gesichter der Menschen auf den Bürgersteigen wirkten wie gefroren, weiß und verzerrt, mit offenen Mündern, von Schatten zerschnitten. Ein Obdachloser, der schlafend in einer Toreinfahrt lag, wurde zu einem leeren Haufen Lumpen und alter Decken. Die dunklen Geschäfte und Büros erinnerten an finster gähnende Höhlen.
Rowan leckte sich mit der Zungenspitze die Oberlippe, die wie wund war. Ihre Euphorie war verflogen, noch nicht Reue gewichen, aber von Trübsinn verdrängt. Ihr graute vor der Heimkehr in die Mallord Street in Chelsea. Sie hatte sich aus einer Laune heraus für das Haus entschieden, verführt von der unkonventionellen Bohemeatmosphäre des Viertels, doch inzwischen hasste sie dieses ehemalige Künstleratelier in seiner ganzen Fipsigkeit und klaustrophobischen Enge. Die Räume waren klein und gedrängt, unten eine Küche mit Spülküche, ein Salon und ein Speisezimmer; oben drei Schlafräume. Die verwinkelte Mansarde mit den schrägen Decken diente als Speicher für die Möbel und den Nippes, den sie von Patricks Großmutter geerbt hatten. Das Gästezimmer, in dem Thea übernachtete, wenn sie zu Besuch kam, lag nach hinten hinaus, mit Blick auf den Hof. Das Schlafzimmer von Rowan und Patrick war vorn. Durch das Erkerfenster, das sie beim Umbau hatten einsetzen lassen, drang Wasser ein, sobald es stärker regnete.
Wenn sie sich jetzt ins Schlafzimmer stahl, würde Patrick tun, als schliefe er. Er würde nicht fragen, wo sie gewesen war, und sie würde nichts sagen. Keiner von ihnen würde die stillschweigende Vereinbarung brechen, die zwischen ihnen bestand und die sie zunehmend als Fesselung empfand. Sie schlichen auf Zehenspitzen um eine Aussprache herum, so wie sie gleich auf Zehenspitzen ins Schlafzimmer schleichen, sich leise ausziehen und abschminken würde, um den Schein zu wahren, dass er schlief.
Man konnte nicht richtig streiten mit Patrick. Wenn sie laut wurde oder weinte, wurde er nur umso passiver und distanzierter. Ihre Auseinandersetzungen entzündeten sich an Nebensächlichkeiten: Sie hatte irgendeinen gesellschaftlichen Termin mit seinen Kollegen vergessen; er hatte noch immer keinen Handwerker für den tropfenden Wasserhahn bestellt. Die Kluft, die Kränkung und Groll zwischen ihnen aufgerissen hatten, ging so tief, dass sie nicht angesprochen werden konnte.
Patrick war schmal und zart, mit hellem Haar, kleinen blauen Augen und fein gezeichneten Zügen, ein auf unaufdringliche englische Art gut aussehender Mann. Er bereitete ihr ein sorgenfreies Leben, seine Freunde konnten sich auf ihn verlassen, und wer in sein Haus kam, wurde mit offenen Armen aufgenommen. Der Vorwurf, es fehle ihm an Lust und Feuer, hätte ihn tief gekränkt, das wusste Rowan. Manchmal bemerkte sie, bevor er sich im Bett von ihr abwandte, Schuldbewusstsein und nackte Scham in seinem Blick. Aber es war nicht nur Mitleid, was sie von einer Konfrontation abhielt. Ein Wort über die Leere ihrer Ehe würde womöglich einer Flut bisher unterdrückter Gefühle und Vorwürfe die Schleusen öffnen.
So kann es nicht weitergehen, schoss es ihr durch den Kopf, während das Taxi durch Chelsea fuhr. Sie und Patrick standen am Rand eines Abgrunds. Heute Nacht hatte sie sich taumeln gefühlt. Simon hatte sie an die Macht der Begierde erinnert, die stärker war als Logik, Verstand und Pflicht. Mit einer tiefen Bitterkeit bereute sie die verlorene Zeit, die dürren Jahre ihrer Ehe.
Als sie in der Mallord Street die Haustür aufsperrte, hatte sie das Gefühl zu schrumpfen, als wollte sie sich den engen Räumen des Hauses und ihrer Ehe anpassen. Im Spiegel in der Diele vergewisserte sie sich, dass ihr Lippenstift nicht verschmiert war. Patricks Papiere lagen unordentlich verstreut auf dem Esstisch. Der von ihr ausgesuchte Weihnachtsbaum war, fand sie, zu groß für den Salon. Sie zog ihre Schuhe aus und ging nach oben.
Sie schlief ein paar Stunden. Um sieben weckte Patrick sie, um ihr zu sagen, dass ihre Schwester am Telefon sei.
Und so erfuhr sie von Thea, dass ihr Vater an einer schweren Lungenentzündung erkrankt war. Thea war am 17. Dezember aus dem Internat in Yorkshire für die Weihnachtsferien nach Hause gefahren. Ihr Vater kam am folgenden Tag von einer Geschäftsreise nach Südengland zurück. Er fühlte sich nicht wohl, wurde von Fieber und Husten geplagt, dennoch erlaubte er Thea nicht, den Arzt zu holen. Erst am nächsten Tag, als sein Zustand sich besorgniserregend verschlechtert hatte, setzte Thea sich durch. Der Hausarzt stellte eine Lungenentzündung fest. Ihr Vater sprach auf die Behandlung nicht an. Er litt seit dem Großen Krieg, als er in einen Senfgasangriff geraten war, an einer Lungenschwäche.
Patrick bestellte ein Taxi, das Rowan zum Bahnhof Euston bringen sollte, wo sie den Zug nach Glasgow nehmen wollte. Rowans Hände zitterten, während sie in panischer Angst Blusen und Röcke faltete. Tief im Innern lauerte der Verdacht, dass die Erkrankung ihres Vaters ihre Schuld sei, eine Strafe für die leidenschaftlichen Stunden mit Simon.
Als sie von unten Hupen hörte, sah sie zum Fenster hinaus. Das Taxi war da. Sie klappte ihren Koffer zu und eilte nach unten.
2
Dezember 1937
Es war nicht das erste Mal, dass Hugh Craxton Weihnachten fern seiner Familie verbrachte. Vor einigen Jahren hatten dringende Geschäfte ihn kurz vor dem Heiligen Abend nach Glasgow gerufen (er arbeitete ja so hart, der arme Hugh) und seine rechtzeitige Heimkehr verhindert. Und mehr als einmal, wenn er kurz vor Weihnachten einen Wanderurlaub gemacht hatte, um seinen einsiedlerischen Freund Malcolm Reid in den Highlands zu besuchen, hatten Wetterstürze und Schneestürme, die Straßenverkehr und Eisenbahn lahmlegten, ihm die Heimreise unmöglich gemacht. In diesem Jahr war es Anfang Dezember sehr kalt gewesen, und im Süden Englands hatte es stark geschneit, doch in der Woche vor den Feiertagen war das Wetter milder geworden. Sophie, seine Frau, hatte sich die Wettervorhersagen aufmerksam angehört, es waren keine Schneestürme oder ähnlich Ungemütliches gemeldet worden.
Sonst rief Hugh stets an oder schickte ein Telegramm, wenn er sich verspätete, um sie wissen zu lassen, dass alles in Ordnung war. Er war in dieser Beziehung sehr zuverlässig. Wenn er verreist war, meldete er sich regelmäßig. Diesmal tat er es nicht. Das trübte den ersten Weihnachtstag, die Stimmung war gedrückt und angespannt. Sophie, die sich selbst Sorgen machte, bemühte sich, ihre Söhne aufzumuntern. Ihr Vater würde sicher bald nach Hause kommen, etwas Unvorhergesehenes musste ihn aufgehalten haben. Dennoch war der fünfzehnjährige Stuart traurig und enttäuscht, während Duncan, der Ältere, mit Ärger und Groll reagierte.
Duncan und sein Vater waren im vergangenen Jahr häufiger heftig aneinandergeraten. Er war achtzehn, ein schwieriges Alter, sagte sich Sophie, kein Kind mehr, aber auch noch nicht erwachsen. Im kommenden September wollte er ein Ingenieursstudium beginnen. Hugh hatte verfügt, dass er bis dahin weiter die Schule besuchen werde, was Anlass zu Reibungen gab. Aus Angst vor neuen Streitereien hatte Sophie ihren Mann unterstützt. Rückblickend allerdings fragte sie sich, ob sie ihn nicht hätte bereden sollen, Duncan nachzugeben und ihm zu erlauben, von der Schule zu gehen und sich eine Arbeit zu suchen. Hugh hätte ihm für die Zeit bis zum Beginn des Studiums eine Aushilfsstellung in der Fabrik oder im Büro besorgen können. Mit eigener Hände Arbeit sein eigenes Geld zu verdienen war vielleicht genau die Erfahrung, die Duncan brauchte. Doch Hugh hatte von dieser Idee nichts gehalten.
Es war der Tag nach den Feiertagen. Duncan und Stuart waren mit ihren Freunden Michael und Thomas Foster unterwegs. Ohne sie war das Haus, das in einer Sackgasse in South Kensington stand, unnatürlich still. Einzig das ferne Rauschen des Verkehrs und das schwache Säuseln des Luftzugs, der durch das undichte Küchenfenster drang, waren zu hören. Und in dem Topf auf dem Herd, in dem sie die Hühnerknochen ihres Weihnachtsessens auskochte, brodelte es leise.
Sophie spülte und trocknete die Kuchenform. Stuart, der Unmengen essen konnte, hatte am Vorabend beinahe den ganzen Weihnachtskuchen vertilgt. Für Hugh war kein Stück mehr da. ›Dein Weihnachtskuchen ist der beste der Welt, Sophie, mein Schatz.‹ Als sie an Hughs Worte dachte, bekamen die Gefühle die Oberhand, die sie die ganze Zeit zu verdrängen suchte, Angst und die schreckliche Ahnung, dass ihm etwas passiert war.
Die Räume kamen ihr vor wie tot, während sie durchs Haus ging und mechanisch Ordnung machte, Dinge an ihren Platz zurückstellte. Es fröstelte sie, dann ärgerte sie sich über ihre Schwarzseherei. Das Wetter hatte ihn aufgehalten. Oder die Arbeit.
Aber diese Medizin wirkte nicht mehr. ›Sieh den Tatsachen ins Auge, Sophie.‹ Hugh war eine Woche vor Weihnachten aus London abgereist. Er hatte sich den ganzen Dezember schon angeschlagen gefühlt, dann war noch ein hartnäckiger Husten hinzugekommen, dennoch war er Hals über Kopf nach Norden aufgebrochen, als es in der Fabrik in Glasgow Probleme gab, die dringend seiner Aufmerksamkeit bedurften. Beim Abschied hatte er versprochen, spätestens zu Weihnachten wieder zu Hause zu sein.
Am zweiten Abend telefonierten sie kurz miteinander. Hugh wollte sie wissen lassen, dass er in Glasgow angekommen war. Sein Husten hatte sich verschlimmert, und er meinte, möglicherweise habe er Fieber. Er versprach ihr, sich ins Bett zu legen und sich zu pflegen. Seitdem hatte sie nicht mehr von ihm gehört. Die Angst, die sie mit sich herumtrug, wuchs von Stunde zu Stunde.
Sie glättete ein Stück Geschenkpapier, das hinter dem Sofa lag, und packte es fürs nächste Jahr weg. Hugh hatte vor seiner Abreise so blass und angestrengt ausgesehen, dass sie ihn gedrängt hatte, seine Besprechungen abzublasen und zu Hause zu bleiben, aber davon hatte er nichts wissen wollen. Wie so viele Männer hasste er es, Schwäche einzugestehen, und lehnte es ab, zum Arzt zu gehen. Lag er vielleicht mit einer Bronchitis oder Influenza allein und ohne Behandlung in irgendeinem Hotelbett? Oder mit Fieber und schwer erkrankt, womöglich in Lebensgefahr, im Krankenhaus?
Aber all diese Schreckensvorstellungen ergaben keinen Sinn. Von einem Hotel aus hätte er anrufen können. Und wenn er nicht mehr bei sich gewesen wäre und man ihn ins Krankenhaus gebracht hätte, so hätte man sie doch sicherlich telefonisch oder telegrafisch benachrichtigt. Vielleicht hätte man auch eine dieser Meldungen aufgegeben, wie man sie im Radio hörte: Die Familie von Mr Hugh Craxton, der schwer erkrankt ist, wird dringend gebeten, sich mit dem Krankenhaus Soundso in Verbindung zu setzen.
Aber nichts.
Hugh hatte seine Schwächen. Er trank. Sein Tag war aufgeteilt in hier ein Gläschen und dort ein Gläschen und ›noch einen Letzten für den Heimweg, Schatz‹. Der Alkohol war Hughs Schutzwall vor der Welt, das Ritual des Auswählens und Mixens beinahe so wichtig wie der Alkohol selbst. Einen eleganten Cocktail zu mixen lenkte ihn von geschäftlichen Schwierigkeiten ab; eine Flasche Champagner zu öffnen vertrieb eine düstere Stimmung. Hatte er vielleicht ein Glas zu viel getrunken, bevor er in den Wagen gestiegen war? Hatte er sich einen seiner seltenen, aber spektakulären Alkoholexzesse erlaubt und lag nun volltrunken in irgendeinem tristen Zimmer in einem Rasthaus an der Great North Road?
Sie und Hugh hatten es nicht so mit Geselligkeit über die Feiertage. Der Gottesdienst am Weihnachtsmorgen war so ziemlich die einzige Gelegenheit, bei der sie mit anderen zusammenkamen. Hugh war es am liebsten, wenn die Familie unter sich blieb. ›Warum soll ich meine Zeit mit anderen Leuten verbringen, wenn ich alle, die mir etwas bedeuten, hier um mich habe?‹ Das hatte er oft gesagt, als Duncan und Stuart noch klein gewesen waren, und sie hatte es dankbar aufgenommen und ihn dafür umso mehr geliebt. Jetzt dachte sie, dass dieser Mangel an gesellschaftlichem Kontakt, durch den sie sich manchmal isoliert fühlte, an diesem Weihnachten eine Erleichterung war, weil er ihr peinliche Erklärungen für Hughs Abwesenheit ersparte.
Im Wohnzimmer sammelten sich die vom Weihnachtsbaum abgeworfenen dürren braunen Nadeln in den Ritzen zwischen den Dielenbrettern. Die Kerzen des Engelsglockenspiels waren heruntergebrannt. Draußen, sah Sophie, als sie zum Fenster hinausblickte, schneite es in feinen Flocken, die zergingen, sobald sie den Boden berührten. Autos und Lastwagen fuhren langsamer als sonst, mit eingeschalteten Scheinwerfern, deren Licht in einem gespenstischen Grün leuchtete. Es war gerade drei Uhr nachmittags, aber in diesen letzten Tagen des Jahres brach die Nacht schnell herein, schon senkte sich die Dämmerung über London.
Das Telefon läutete erschreckend laut. Das musste er sein! Voller Hoffnung griff sie nach dem Hörer.
»Hallo?«, stieß sie atemlos hervor.
»Sophie? Viola hier.« Viola Foster war eine Nachbarin und Freundin, Mutter von Michael und Thomas, den Freunden ihrer Söhne. »Ich wollte dich fragen, ob es dir recht ist, wenn Duncan und Stuart zum Abendbrot bleiben.«
»Aber natürlich«, sagte sie und schluckte mit Mühe die Enttäuschung hinunter. Nach einem kurzen nichtssagenden Austausch legte sie auf. Stille kehrte wieder ein, bedrückend und unerbittlich.
Sie öffnete die Tür zu Hughs Zimmer. Sie betrat sein persönliches Terrain selten. Einmal die Woche machte Mrs Leonard, ihre Zugehfrau, dort sauber, sonst wurde das Zimmer nur von Hugh benutzt. ›Mein Reich‹, nannte er es scherzend. Mit Herzklopfen zog sie die oberste Schublade des Schreibtischs auf.
Briefpapier, Umschläge, Löschpapier, Füller und Bleistifte und ein kleines Notizbuch, das sie genau durchsah, das jedoch nur Haushaltsabrechnungen enthielt. Ein Hefter mit den Schulzeugnissen der Jungen und ein zweiter mit Rechnungen. Die einzige Überraschung war die Scotchflasche in der untersten Schublade, vielleicht noch zwei Fingerbreit Whisky darin. Ein Glas fand sie nicht. Sie hatte plötzlich ein bestürzendes Bild vor sich: Hugh, wie er, mit einer türkischen Zigarette zwischen den Fingern seiner Linken, am Schreibtisch saß, die wöchentlichen Ausgaben addierte und dazwischen immer wieder Schluck um Schluck Whisky aus der Flasche kippte.
Das gerahmte Foto auf dem Schreibtisch, das vor zwei Jahren bei einem Ausflug nach Ramsgate von einem Strandfotografen aufgenommen worden war, zeigte sie und Hugh mit den Jungen. Duncan sah groß und hübsch aus, aber missmutig. Schon zu der Zeit war er der Meinung gewesen, er sei zu alt für Familienausflüge; sie erinnerte sich, wie widerspenstig er an dem Tag gewesen war. Stuart hingegen strahlte unbeschwert.
Ihr Blick wanderte zu Hugh. Er stand ein klein wenig abseits von der Familie, groß und gut gewachsen, ein stattlicher Mann in kerzengerader, militärischer Haltung. Sein langes, schmales Gesicht mit der hohen Stirn und den schwerlidrigen Augen konnte distanziert wirken, ja streng, doch sein Lächeln war warm und gewinnend.
Sophie griff in die Taschen des alten Tweedjacketts über der Stuhllehne – ›meine Schreibjacke‹, nannte Hugh es. Ihre Suche förderte nur ein Taschentuch, einen Kamm und ein Billett für die Glasgower U-Bahn zutage. Die Zielstation auf dem Billett, Buchanan Street, sagte ihr nichts. Sie war nie in Glasgow gewesen. Hugh hatte sie und die Jungen nie zu einem Besuch der Firma Craxton & Sons, des Schreibwarenunternehmens, das er betrieb, mitgenommen. »Warum, um alles in der Welt, wollt ihr Hunderte Kilometer reisen, um euch lärmende Maschinen anzusehen, die Schreibpapier und Briefkuverts herstellen?«, hatte er gefragt. »Du fändest es furchtbar, Sophie. Ich find’s furchtbar. Das einzig Gute daran ist, dass es die Rechnungen bezahlt.«
Die Entschlossenheit, das innere Aufbegehren, die während Hughs Abwesenheit immer stärker in ihr gewachsen waren, hatten sie veranlasst, seinen Bereich zu betreten. Sie zog die Schubladen seiner Kommode auf. Er hatte sich aus seiner Militärzeit das peinliche Achten auf Ordnung bewahrt. Sie oder Mrs Leonard durften ihm seine frisch gewaschenen Sachen immer nur aufs Bett legen, er ordnete sie dann selbst in seinem Zimmer ein. Wenn ein Knopf angenäht oder irgendwo das Futter ausgebessert werden musste, legte er das betreffende Kleidungsstück in ihre Nähecke. Hugh war sehr eigen; war ein Stück nicht so gefaltet, wie er es haben wollte, so faltete er es unweigerlich neu. Sie war sich bewusst, dass sie eine Grenze übertrat, als sie daranging, in seiner Wäsche zu kramen. In der zweiten Schublade lagen Socken, Schals, Handschuhe und Sockenhalter. In der darunter fand sie Pullover und eine Jacke, die sie ihm gestrickt hatte. Er behauptete, sie zu lieben, trug sie aber kaum. Sie war wohl zu warm und zu schwer, dachte sie.
In der untersten Schublade stieß sie auf mehrere in braunes Papier eingeschlagene Päckchen, die mit roten Satinbändern verschnürt waren. Sie las die Schildchen: Meiner liebsten Sophie. Für Duncan, in Liebe von Dad. Für Stuart, alles Liebe meinem Jungen, Daddy.
In der Hocke sitzend drückte sie ihr Weihnachtsgeschenk an die Brust und kämpfte gegen die Tränen. Ach, Hugh, was ist dir zugestoßen? Komm nach Hause, ich brauche dich zu Hause. Bitte, bitte, komm nach Hause.
Sie lief in die Küche, setzte Wasser auf, löffelte Tee in die Kanne, während ihre Gedanken sich überschlugen. Sollte sie die Polizei anrufen? Ihnen sagen, dass ihr Mann verschwunden war und sie Todesangst hatte, es könnte ihm etwas passiert sein? Sie fühlte sich unfähig, irgendeine Entscheidung zu treffen. Sie konnte nicht einmal entscheiden, ob sie Duncan und Stuart die Weihnachtsgeschenke ihres Vaters geben sollte. Würde Hugh das von ihr wünschen? Sie wusste es nicht.
Doch sie konnte die Fragen vorhersagen, die die Polizei ihr stellen würde, und die Antworten, die sie würde geben müssen. ›Wo wohnte Ihr Mann, wenn er sich in Glasgow aufhielt, Mrs Craxton?‹ ›Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nie gefragt.‹ ›Aber Sie haben ihm doch sicher geschrieben?‹ ›Nein, er hat mich immer angerufen.‹ ›Und die Adresse seiner Firma dort, wissen Sie die?‹ ›Nein, die weiß ich nicht. Das war nie nötig.‹
Sie goss kochendes Wasser in die Kanne und rührte um. Nachdem sie ein, zwei Schluck vom Tee getrunken hatte, ging sie zurück in Hughs Zimmer und kniete wieder vor der untersten Kommodenschublade nieder. Zwischen verschiedenen anderen Dingen fand sie die Kästchen mit Hughs militärischen Auszeichnungen, eine Taschenlampe, zwei alte Pfeifen, einen silbernen Taufbecher und ein paar Stück Draht in einer braunen Papiertüte.
Unter der Tüte lag ein kleines Notizbuch, wie man es vielleicht zur Erinnerungshilfe in der Innentasche eines Jacketts trägt. Der blaue Ledereinband war an den Ecken abgewetzt. Sophie blätterte das Büchlein durch. Auf den Seiten waren Telefonnummern vermerkt, alle von Initialen begleitet. Stirnrunzelnd versuchte Sophie, sie einzuordnen. Keine sagte ihr etwas, bis sie auf eine stieß, neben der Hugh das Kürzel ›C & Sons‹ eingetragen hatte.
Sie zögerte. Doch es gab nur eine Möglichkeit, sich Gewissheit zu verschaffen.
Sie wählte das Amt und bat um eine Verbindung mit der Glasgower Nummer. Minuten verstrichen, es knisterte in der Leitung, dann meldete sich eine Frauenstimme.
»Craxton und Söhne, Schreib- und Büromaterialien.«
Hoffnung. »Ich würde gern Mr Hugh Craxton sprechen«, sagte Sophie.
»Es tut mir sehr leid, aber Mr Craxton ist verstorben.«
Hatte die Frau sie falsch verstanden? Oder hatte sie die Frau wegen ihres starken schottischen Akzents missverstanden? »Mr Hugh Craxton«, wiederholte sie laut und gereizt. »Ich möchte Mr Hugh Craxton sprechen.«
»Mr Hugh Craxtons Familie hat uns mitgeteilt, dass er am ersten Weihnachtsfeiertag an Lungenentzündung verstorben ist«, sagte die Frau in gelangweiltem Ton. »Alle Anrufe für ihn leiten wir an Mr Ross und Mr Paterson weiter. Soll ich Sie verbinden?«
»Nein. Danke.« Sie bekam kaum Luft.
Ich bin Hugh Craxtons Frau. Doch die Worte blieben ihr im Hals stecken, als der furchtbare Gedanke sie überfiel, dass die Frau vielleicht keinen Fehler gemacht hatte und Hugh wirklich gestorben war.
In freundlicherem Ton sprach die Frau am Telefon weiter. »Die beiden Töchter von Mr Craxton kümmern sich um die Bestattungsformalitäten. Soll ich Ihnen die Privatnummer der Familie geben?«
Der Impuls, durch die Leitung zu schreien: »Töchter? Welche Töchter?«, schwoll an, bis er kaum noch zu beherrschen war, dann fiel er kraftlos in sich zusammen, und Sophie brach das Gespräch ab. Ihre Knie gaben nach, ihr war schlecht, als sie, beide Hände auf den Mund gepresst, zitternd zu Boden glitt.
»Mr Craxtons Familie hat uns mitgeteilt, dass er am ersten Weihnachtsfeiertag an Lungenentzündung verstorben ist. Die beiden Töchter von Mr Craxton kümmern sich um die Bestattungsformalitäten.« Ihre Gedanken verschwammen. Das ergab doch alles keinen Sinn.
Es dauerte eine Weile, bis sie es schaffte, aufzustehen und ins Wohnzimmer zu gehen. Als sie sich ein Glas Kognak eingoss, zitterte ihre Hand so stark, dass ein paar Spritzer der Flüssigkeit auf die niedrige Vitrine tropften. Sie ließ sich in einen Sessel fallen und trank den Kognak in kleinen Schlucken, die sie zur Ruhe bringen sollten, während sie zum Fenster hinausstarrte, auf Straßenlampen, Mauern und Briefkästen unter blassem Schneebelag. Alles wirkte unnatürlich klar. Jedes Geräusch traf laut und schrill ihre Nerven.
»Die beiden Töchter von Mr Craxton kümmern sich um die Bestattungsformalitäten.« Wenn Hugh tot war – nein, das konnte doch nicht wahr sein, oder? – aber wenn, o Gott, es wirklich so sein sollte – nein, niemals, Hugh hatte keine Töchter. Es musste ein schrecklicher Irrtum sein. Die Frau am Telefon musste von irgendeinem anderen Craxton gesprochen haben.
Aber die Nummer, unter der sie angerufen hatte, die Nummer in Hughs Notizbuch, war die des Schreibwarenunternehmens. Und Craxton war kein geläufiger Familienname.
»Mr Hugh Craxtons Familie hat uns mitgeteilt, dass er am ersten Weihnachtsfeiertag an Lungenentzündung verstorben ist.« Die Worte überschlugen sich in ihrem Kopf. Im verschwommenen Grau des Abends erkannte Sophie zwei vertraute Gestalten, die sich dem Haus näherten. Duncan und Stuart kamen nach Hause. Sie stellte die Kognakflasche und das Glas in die Vitrine und wischte die Spritzer ab. Auf dem Weg hinaus sah sie sich flüchtig im Spiegel über dem Kaminsims: ein Ausdruck wie der einer Wahnsinnigen, dachte sie. Sie fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, als könnte sie ihn so wegwischen, dann ging sie ihren Söhnen entgegen.
Lachend, sich gegenseitig gutmütig puffend kamen sie ins Haus, die Gesichter von der Kälte gerötet. Ihre Stiefel hinterließen matschige Spuren auf den Fliesen im Flur.
»Ist Dad nach Hause gekommen?«, fragte Stuart.
Sophie schüttelte den Kopf. Und Duncan sagte: »Halt den Mund, du Idiot.«
»Ich dachte, er wäre vielleicht inzwischen da.«
»Ist er nicht, das siehst du doch. Also, sei still.«
Duncan ging nach oben. Stuart ließ seine ausgezogenen Schuhe mitten im Flur liegen und nahm Kurs auf die Küche. »Ich hab einen Riesenhunger.«
»Ich dachte, ihr hättet bei Fosters zu Abend gegessen.« Sie verstand nicht, wie sie in diesem Moment, am Rand der Katastrophe, so ruhig sein konnte.
»Das waren nur Reste.« Stuart langte zu einem hohen Brett des Vorratsregals hinauf und holte sich eine Dose Salzcracker herunter. Duncan mit den rotbraunen Haaren und hellbraunen Augen schlug seinem Vater nach, doch Stuart war ganz ihr Kind, helle Haare, blaue Augen, sanftes Naturell. Er befand sich mitten in diesem rührenden Zwischenstadium der Wandlung vom Knaben zum Mann, hoch aufgeschossen und linkisch und zugleich immer noch das anhängliche Kind, das alles richtig machen wollte.
»Haben wir Käse?«, fragte er.
»Nur noch einen Rest. Die Lieferung ist heute nicht gekommen.« Sophie musste überlegen, welcher Wochentag es war. Montag, es war Montag. Das Lebensmittelgeschäft lieferte gewöhnlich montags. Nichts stimmte mehr.
Stuart kippte ein Häufchen Cracker auf einen Teller und packte den Käse aus. Er erzählte von dem Fußballspiel, das er und Duncan mit den Foster-Jungen im verschneiten Park ausgetragen hatten. »Wenn es weiter so schneit, können wir morgen einen Schneemann bauen.« Er war einen Kopf größer als sie, aber solche Spielereien freuten ihn immer noch wie ein Kind.
Sophie rief nach oben, ob Duncan eine Tasse Tee wolle, und erhielt ein »Nein danke« zur Antwort. Sie setzte sich mit Stuart an den Esstisch, wo er an seinem Weihnachtspuzzle weitermachte, ein Bild des Royal Scot, der über eine Brücke stampfte. Nach einer Weile kam Duncan herunter und setzte sich zu ihnen. Von irgendeinem Symphoniekonzert im Radio begleitet, suchte Duncan die Teile für den Himmel zusammen, während Sophie und Stuart sich Lokomotive und Wagen vornahmen. Eigentlich war es nur Stuart. Sophie war immer noch so verstört, dass sie nicht fähig war, sich zu konzentrieren.
Stuart fragte unvermittelt: »Machst du dir Sorgen um Dad, Mum?«
»Natürlich macht sie sich Sorgen, du Trottel. Wir haben seit mehr als einer Woche nichts gehört.«
Wir haben nichts gehört, dachte Sophie. Nichts, er ist weg.
»Aber er kommt doch bald zurück, oder?«, fragte Stuart.
Sophie drückte seine Hand. »Wie wär’s, wollen wir alle einen Kakao trinken?«
»Ich mach ihn.« Duncan erhob sich und ging in die Küche.
Sie war froh, als Stuart eine Stunde später gähnend erklärte, er sei müde, und nach oben verschwand. Sie stand ebenfalls auf und sagte Duncan, der abends gern lang aufblieb, Gute Nacht. Oben legte sie sich nieder, ohne sich auszukleiden. Schon hatte sie das Gefühl, das Bett sei allein ihres. Hughs Kopfkissen war wie unberührt, von Mrs Leonard aufgeschüttelt, das Zimmer war gelüftet und roch nicht mehr nach Hughs Zigaretten.
Sie hatte Hugh während des Krieges kennengelernt, Anfang 1918. Sie war damals einundzwanzig Jahre alt und arbeitete in einem Genesungsheim für Offiziere, das ein Freund ihrer Familie in einem Haus in Knightsbridge eingerichtet hatte. Sie musste die Betten machen, die Bettpfannen leeren, die Böden wischen und dergleichen mehr. Hugh besuchte einen Freund, der bei Passchendaele verwundet worden war. Nach der Besuchszeit zeigte Sophie ihm den Weg hinaus, und er lud sie zum Abendessen ein. Sie nahm an; sie dachte keinen Moment daran, nicht anzunehmen. Während Hughs vierzehntägigem Urlaub gingen sie ins Theater und ins Kino, machten Hand in Hand lange Spaziergänge an der Themse und Einkaufsbummel am Piccadilly. Und tauschten leidenschaftliche Küsse unter Gaslaternen und in abendlich kalten Parks.
Am Tag vor Hughs Rückkehr an die Front umarmten sie sich im Schatten einer Brücke, wo das dunstige graue Wasser des Flusses leise plätschernd ans schlammige Ufer schwappte. Er öffnete den obersten Knopf ihrer Bluse. Dann den nächsten. »Hugh«, sagte sie, »nicht.« Als er den dritten Knopf öffnen wollte, sagte sie: »Nein, Hugh«, und entzog sich ihm. »Tut mir leid, tut mir leid«, murmelte er. Er lächelte sie an und sagte mit Armsündermiene: »Du bist einfach so ein verdammt hübsches Mädchen, Sophie, ich bin ganz verrückt nach dir.«
Es war nicht so, dass sie nicht in ihn verliebt war, aber sie hatte, wie jedes Mädchen, Todesangst vor der Schande, schwanger zu werden, ohne verheiratet zu sein. Seit sie alt genug war, es zu verstehen, hatte man ihr eingebläut, ihr Leben wäre vorbei, wenn das passierte. Lose Sitten führten unausweichlich in den Ruin, zu Ächtung und Ausgrenzung.
Doch als sie Hugh später vor dem Genesungsheim Lebewohl sagte, wollte sie ihn kaum aus den Armen lassen und wünschte, sie könnte die Zeit zurückdrehen. Sie hatte Angst, ihn vor den Kopf gestoßen zu haben oder er glaube womöglich, sie hätte nur mit ihm gespielt. Sie würde ihn vielleicht verlieren, weil sie seine Liebe nicht zugelassen hatte. Wie hatte sie so prüde sein können, so dumm!
Hugh kehrte in das Gemetzel an der Westfront zurück. Er schrieb ihr zweimal die Woche; sie fieberte seinen Briefen entgegen und war krank vor Angst und Sorge, wenn sie sich verspäteten. Im April kehrte Hugh nach einer Verwundung in der zweiten Schlacht an der Somme nach England zurück. Noch benommen von der Narkose, bat er sie, ihn zu heiraten. Er trug den rechten Arm in der Schlinge, als sie zwei Wochen später standesamtlich getraut wurden. Ganz konnte er sich von seiner Verletzung nie erholen; seine Schrift blieb die eines ungeübten Schuljungen.
Wer, um alles in der Welt, konnten diese Töchter sein, von denen die Frau am Telefon gesprochen hatte? Hatte Hugh etwa eine Geliebte gehabt? Tränen sprangen ihr in die Augen und liefen über. Wenn ein Mann sich eine Geliebte halten wollte, dachte sie, würde er sich sein Leben vielleicht genau so einrichten, wie Hugh seins geführt hatte. Da eines seiner Unternehmen seinen Sitz in Glasgow hatte, war er immer viel unterwegs und häufig von zu Hause abwesend gewesen. War es möglich, dass er sich irgendwann vor einigen Jahren in Schottland eine Geliebte genommen und mit ihr zwei kleine Kinder hatte? Aber nein, das passte nicht. Mr Craxtons zwei Töchter kümmern sich um die Bestattungsformalitäten. Diese Töchter mussten mindestens sechzehn Jahre alt sein, um das tun zu können, also etwa im gleichen Alter wie Stuart. Es war Sophie unmöglich zu glauben, dass Hugh so lange eine Geliebte gehabt haben sollte, ohne dass sie etwas gemerkt hatte. Und ganz gewiss besäße doch jede solche Frau, gleich, wie locker ihr Lebenswandel und ihre Moral, den Anstand, mit ihr, der betroffenen Ehefrau, Verbindung aufzunehmen, um sie vom Tod ihres Ehemannes zu verständigen. Das Ganze konnte nur ein Missverständnis sein. Sie würde das morgen klären.
Aber die Zweifel ließen nicht nach. Was wusste sie von Hugh? Nicht viel. Nach einer unglücklichen Kindheit in einem düsteren, klammen Pfarrhaus in Devon war er mit achtzehn von zu Hause weggegangen und nie zurückgekehrt. Seine Eltern waren schon tot gewesen, als Sophie ihn kennenlernte; sonst hatte er keine Familie. Ihre Mutter hatte ihn von Anfang an nicht gemocht. »Schön ist, wer schön handelt«, hatte Mrs Torrance nach ihrer ersten Begegnung mit Hugh abfällig gesagt.
Was noch? Er war nicht gern unter Menschen und liebte keinen Rummel. Deshalb gingen sie nie ins Kino oder Theater und verbrachten ihre Ferien in ruhigen Seebadeorten oder stillen Fleckchen auf dem Land. Wenn sie zum Essen ausgingen, dann meistens in irgendein bescheidenes Lokal am Ort, aber am liebsten aß Hugh, der ihre Kochkünste bewunderte, zu Hause. Er war kein Gesellschaftsmensch und verbrachte seine Abende lieber mit seiner Familie als im Kreis männlicher Freunde. Er hatte, soweit sie wusste, gar keine persönlichen Freunde außer Malcolm Reid. Ihre – Sophies – Bekannten und Nachbarn langweilten ihn, sie traf sich also meistens allein mit ihnen. Abendliche Einladungen, sei es bei ihnen, sei es bei anderen Leuten, gab es nicht. Hugh hatte sie nie mit irgendeinem seiner Mitarbeiter oder Geschäftskollegen bekannt gemacht. »Öde Bagage«, erklärte er. »Die werde ich dir nicht antun, Liebes. Es mag egoistisch sein, aber ich habe dich lieber für mich allein.«
Hugh war witzig und amüsant, einfallsreich und großzügig. Mit seiner Ausstrahlung konnte er einen Allerweltstag zum Abenteuer machen. Wenn nötig, war er zu Mut und Tapferkeit fähig, das bewiesen die Auszeichnungen, die ihm für seine dreieinhalb Jahre Einsatz an der Front im Großen Krieg verliehen worden waren. Doch er langweilte sich auch leicht, und häufig trieb innere Unrast ihn ins Freie hinaus, wo er einsame Spaziergänge machte, selbst am späten Abend, selbst bei Kälte und Regen. Er gehörte keiner Kirche oder politischen Partei an; im Krieg, hatte er einmal zu ihr gesagt, sei ihm jegliche Fähigkeit zu glauben abhandengekommen. Er war umgänglich und charmant, aber er konnte auch still und nach innen gekehrt sein. Es gab Momente, da ließ er sie nicht an sich heran.
Hugh war ein liebevoller und leidenschaftlicher Mann, aber es entging ihr nicht, wie er hin und wieder andere Frauen auf der Straße musterte. Es hatte ihr jedes Mal wehgetan. Konnte er allen Ernstes so etwas Unglaubliches getan haben? Hatte er es wirklich fertiggebracht, mit einer anderen Frau zwei Töchter zu zeugen, Halbgeschwister von Duncan und Stuart, und ihr das jahrelang zu verheimlichen? Unmöglich, sagte sie sich, als sie vom Bett aufstand und die Nadeln aus ihrem Haar zog. Ein derartiger Verrat war unvorstellbar.
Irgendwann musste sie schließlich eingeschlafen sein. Als sie in ihrem zerwühlten Bett erwachte, war es sechs Uhr morgens. In der Nacht war es wärmer geworden, der Schnee war geschmolzen, sah sie, als sie zum Fenster hinausblickte. Der Wetterumschwung drückte auf die Stimmung im Haus. Die Jungen waren brummig und gereizt, und Sophie hatte Kopfschmerzen.
Aber sie wusste jetzt, was sie tun würde. Sobald Duncan und Stuart aus dem Haus waren, rief sie die Telefonvermittlung an und erklärte, sie brauche die Nummer eines Bestattungsunternehmens in Glasgow. Innerlich flatterte sie vor Angst, während sie mit dem Telefonhörer in der Hand im Flur saß. Ein alter Freund sei gestorben, erklärte sie der Telefonistin. Sie habe zwar die Nachricht von seinem Tod erhalten, aber sonst keinerlei Informationen, sie wisse nicht, an wen sie sich wegen der Beerdigung wenden solle. Ja, es sei traurig. Wenn man sie freundlicherweise mit einigen Bestattern in Glasgow verbinden würde, könnte sie vielleicht herausbekommen, welches Unternehmen beauftragt worden war. Nein, sie wisse nicht, welches Stadtviertel am ehesten infrage komme. Sicherlich keine der ärmeren Gegenden, falls das eine Hilfe sei.
Es war verrückt, dachte sie später, dass man dasitzen und herumtelefonieren konnte, um herauszubekommen, ob der eigene Mann tot oder lebendig war, und sich zugleich Gedanken wegen der Kosten der Ferngespräche machte. Der achte Bestatter, ein Mr Peasgood von der Firma Peasgood und Price, bestätigte ihr schließlich, was die Telefonistin bei Craxton ihr am Vortag mitgeteilt hatte. Sophie erzählte von Neuem ihre Geschichte, wobei sie ihren Mädchennamen, Torrance, angab, um verwunderten Fragen zu entgehen. Ja, sagte der Bestatter in salbungsvollem Ton, Peasgood und Price seien von Mr Craxtons Töchtern beauftragt worden, die Bestattung von Mr Hugh Craxton vorzubereiten, der am ersten Weihnachtsfeiertag verstorben war; und ja, Mr Hugh Craxton sei der Generaldirektor des Schreibwarenunternehmens Craxton und Söhne gewesen.
Fassungslosigkeit und Entsetzen. Sophie musste tief durchatmen, ehe sie ruhig genug war, um Mr Peasgood eine letzte Frage zu stellen. Ob er ihr bitte den vollen Namen des verstorbenen Mr Craxton angeben könne.
Papier raschelte, dann meldete sich wieder die salbungsvolle Stimme. »Hugh James Dashwood Craxton, Mrs Torrance.«
Mühsam presste sie sich ein »Danke sehr« ab, bevor sie auflegte. Statt, wie sie vielleicht erwartet hatte, von Schmerz darüber erfasst zu werden, dass ihre schlimmsten Ahnungen sich erfüllt hatten und kein Zweifel mehr möglich war, überfiel sie unversehens eine ungeheure Wut. Sie rannte ins Wohnzimmer und kletterte auf einen Stuhl. Zuerst riss sie, auf Zehenspitzen stehend, die Papiergirlanden ab, die von der Zimmerdecke herabhingen, dann fegte sie mit einem Schwung ihres Arms sämtliche Weihnachtskarten vom Kaminsims.
Schwer atmend blieb sie danach in der Mitte des Zimmers stehen, umgeben von bunten Papierfetzen und Glitzer.
3
Januar 1938
Der Persianerkragen von Theas schwarzem Mantel kratzte. Als sie die Hand hob, um ihn zurechtzuschieben, streiften ihre Finger den dunkelroten Kaschmirschal ihres Vaters, den sie um den Hals trug, und es löste sich ein Hauch von türkischem Tabak und Blenheim Bouquet, Düfte, die sie immer an ihn erinnern würden. Sie schluckte, und Rowan, die neben ihr saß, legte ihr eine Hand auf den Arm. Rowan hatte ihren schwarzen Schleier heruntergezogen, und Thea konnte ihr tröstendes Lächeln nicht richtig erkennen, aber sie wusste, dass es da war. Ihre Schwester trug einen eleganten schwarzen Mantel, dazu einen schwarzen Hut, schwarze Strümpfe und Schuhe. Der einzige Farbfleck war der rotblonde Haarknoten in ihrem Nacken.
Auf Theas anderer Seite in der ersten Bankreihe, die der nächsten Familie vorbehalten war, saß Patrick. Thea hätte lieber irgendwo hinten gesessen, aber das hätte gegen die Regeln verstoßen. Es war bitterkalt in der Kirche, aus den Reihen hinter sich hörte sie das gedämpfte Gemurmel der anderen Trauergäste. Beim Anblick des Sarges ihres Vaters vor dem Altar erhob sich ein Gestöber so schrecklicher Gedanken in Theas Kopf, dass sie die Zähne zusammenbeißen musste, um nicht zu weinen. Sie wollte nicht hier vor den Leuten in Tränen ausbrechen. Irgendwie, dachte sie, war das völlig unlogisch; wenn überhaupt, müsste man doch bei der Beerdigung seines Vaters weinen, erst recht, wenn man keine Mutter mehr hatte. Aber vor all diesen fremden Menschen kam sie sich vor wie auf dem Präsentierteller, und dieses Gefühl war ihr verhasst. Bei der Preisverteilung in der Schule graute ihr jedes Mal vor dem Moment, wenn sie über die Bühne gehen musste, um ihr Exemplar von Der Master von Ballantrae oder was immer in Empfang zu nehmen. Sollte sie jemals heiraten, so würde sie nach Gretna Green fahren, da würde es keine Gaffer geben.
Thea versuchte, sich mit Nachdenken über die Bestattungsbräuche in Ländern der Antike abzulenken – in Ägypten, wo man die Toten einbalsamiert und von Grabbeigaben und Zaubersprüchen der Priester begleitet in die Erde gelegt hatte. Wäre es ein Sakrileg, die Gebete des Pfarrers mit Zaubersprüchen zu vergleichen? Oder in Ur, wo die bedeutenden Toten mit ihrer Gefolgschaft, den entbehrlichen Sklaven und Ehefrauen, begraben worden waren. Orgelmusik dröhnte, und ihre Gedanken wanderten zu den Bestattungen der Jungsteinzeit, den Hünengräbern in Wiltshire und den Steingräbern in Schottland, wo man die Toten mit jenen Dingen zur Ruhe gelegt hatte, die ihnen im Leben wichtig gewesen waren, Pfeilspitzen aus bearbeitetem Feuerstein, Elfenbeinspangen und Perlenschnüre. Was würde sie ihrem Vater mitgeben? Seine Wanderstiefel, dachte sie, sein Fernglas, eine Packung türkische Zigaretten und eine Flasche Whisky. Aber nicht den Kaschmirschal; von seinem Kaschmirschal könnte sie sich niemals trennen.
Das Gemurmel hinter ihr ließ ein wenig nach; gleich würde die Trauerfeier beginnen. Thea, die in der vergangenen Nacht kaum geschlafen hatte – genau genommen in den zweieinhalb Wochen seit der Erkrankung ihres Vaters kaum geschlafen hatte – und fürchtete, sie könnte in aller Öffentlichkeit hemmungslos zu weinen anfangen, wechselte das gedankliche Thema und dachte über die Psychopompoi nach. Sie war dreizehn gewesen, als sie in einem Buch über Mythologie zum ersten Mal über das Wort gestolpert war. Lange Zeit war es ihr Lieblingswort gewesen. Die Aufgabe eines Psychopompos war es, die Seele des gerade Verstorbenen ins Jenseits zu geleiten. Ein Psychopompos konnte ein Gott, ein Engel oder auch ein Tier sein. Wer würde ihren Vater in den Himmel geleiten? Ihr Vater hatte nicht an einen Himmel geglaubt. Hieß das also, dass kein hilfreicher Begleiter sich seiner annehmen würde? Wieder musste sie mit den Tränen kämpfen. Welches wäre das rechte Geschöpf, ihren Vater durchs Totenreich zu geleiten? Ein Hirsch, dachte sie, als sie sich mit schmerzhafter Klarheit an einen strahlenden Herbsttag erinnerte, an dem sie und ihr Vater in den Highlands gewandert waren. Von einem Hügelhang aus hatten sie zwei kämpfende Hirsche beobachtet. Das Krachen der aufeinanderprallenden Geweihe war mit der kalten Luft bis zu ihnen getragen worden. Ihr Vater war wie gebannt gewesen. Hirsche waren stolz, schön, stark und menschenscheu, wie er.
Lautes Orgelgebraus riss sie aus ihren Gedanken und verdichtete sich nach einer Reihe donnernder Akkorde zum Vorspiel von Dear Lord and Father. Thea wischte sich über die feuchten Augen und stand mit dem Rest der Gemeinde auf.
Dann war es vorbei, die Feier und das Begräbnis, und sie stellte fest, dass stimmte, was einige Leute vorher zu ihr gesagt hatten, sie fühlte sich ein klein wenig erleichtert. Der Wind brannte, und der Schnee knirschte unter ihren Schritten, als sie vom Grab weggingen.
Rowan berührte Theas Arm. »Geht’s dir einigermaßen, Schatz?«
Thea nickte. »Und dir?«
»Ich bin froh, wenn der heutige Tag vorbei ist. Aber jetzt noch … Schaffst du’s, den Sekretärinnen und Schreibkräften zu danken? Ich übernehme die Abteilungsleiter.«
Die Angestellten von Craxton & Söhne, die in großer Anzahl zum Begräbnis des Firmeninhabers erschienen waren, hatten sich in Grüppchen auf dem Friedhof verteilt. Fabrik und Büros waren an diesem Tag zum Zeichen des Respekts geschlossen geblieben. Thea schüttelte Hände und dankte den schwarz gekleideten weiblichen Angestellten. Obwohl sie brav die Fragen herunterleierte, die Rowan ihr am Morgen beim Frühstück eingetrichtert hatte, war sie befangen und hatte das Gefühl, ihre Sache nicht sehr gut zu machen.
Eine Frau fiel ihr auf, die allein in der Nähe des Portals stand, neben einem von grauen und orangefarbenen Flechten überwachsenen Grabstein. Sie hatte den Eindruck, dass es ihr ähnlich ging wie ihr selbst und sie das ganze Ritual als eine Qual empfand. Impulsiv ging Thea auf sie zu und bot ihr die Hand.
»Guten Morgen. Ich bin Thea Craxton.«
Die Frau mit den auffallend großen saphirblauen Augen musterte Thea, dann reichte sie ihr die Hand. »Mrs Torrance.«
Frage Nummer eins: »Haben Sie eng mit meinem Vater zusammengearbeitet, Mrs Torrance?«
Kopfschütteln. »Ich bin keine Angestellte. Ich bin … ich bin eine Freundin.«
Mrs Torrance hatte etwa die gleiche Größe wie Thea. Helles lockiges Haar quoll unter ihrem Hut hervor. Thea, deren Haare glatt und dunkel waren, beneidete jede Frau mit Naturlocken, die sich wahrscheinlich das ganze langweilige Getue mit Brennschere und Lockenwickeln sparen konnte.
Sie kam zu Frage Nummer zwei. »Hatten Sie einen weiten Weg?«
»Ich komme aus London.«
»Meine Schwester lebt in London, in Chelsea. Wohnen Sie auch dort?«
»Nein, in South Kensington.«
Mrs Torrance sah plötzlich tieftraurig aus. Sie tat Thea leid. »Beerdigungen sind etwas Schreckliches, nicht?«
Mrs Torrance starrte sie an. Thea fürchtete, etwas Falsches gesagt zu haben, und überlegte, wie sie die Situation retten könnte, als Mrs Torrance fragte: »Hat er … hat er sehr gelitten?«
»Nein, nicht allzu sehr«, murmelte Thea. Es war gelogen, aber sie konnte jetzt nicht an die letzten Lebenstage ihres Vaters denken, und außerdem hatte Rowan ihr geraten, genau das zu sagen. »Ich weiß, es ist nicht wahr, Thea, aber einige dieser Leute haben über Jahre für Dad gearbeitet, und es hat doch keinen Sinn, ihnen das Herz noch schwerer zu machen.« Auch wenn Mrs Torrance keine Angestellte der Firma war, galt doch sicher die gleiche Regel.
Mrs Torrance’ Blick schweifte über den Friedhof zu Rowan, die mit Mr Paterson im Gespräch war. »Ist das dort drüben Ihre Schwester? Mit den roten Haaren?«
»Ja, das ist Rowan. Und das ist Patrick, ihr Mann, der blonde Mann neben ihr.«
Der gequälte blaue Blick kehrte zu ihr zurück. »Ihre Schwester ist verheiratet?«
»Ja.«
»Wie alt ist sie?«
»Rowan ist fast vierundzwanzig.«
»Vierundzwanzig …« Was Thea in Mrs Torrances Gesicht sah, erschien ihr wie das blanke Entsetzen. »Und Sie?«
»Ich bin sechzehn.«
Schweigen. Dann fragte die Frau unerwartet scharf: »Wo ist Ihre Mutter?«
»Sie ist tot. Sie ist gestorben, als ich noch klein war.«
»Das tut mir leid.« Mrs Torrance senkte den Blick, schüttelte den Kopf. »Verzeihen Sie.«