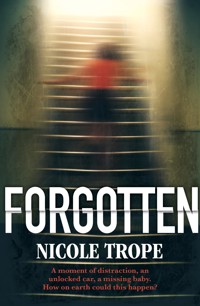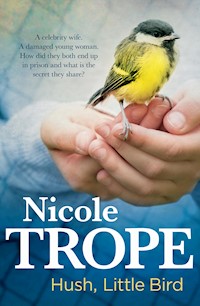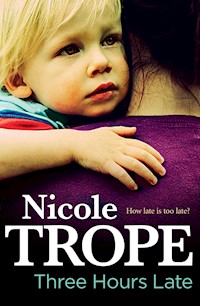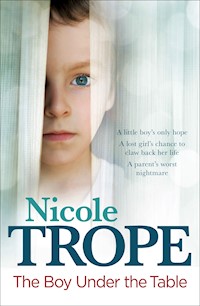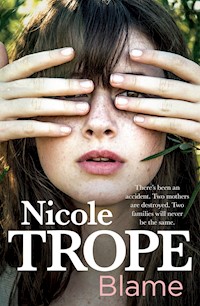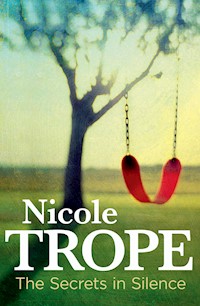9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Fünfundzwanzig Jahre hat Felicity ihre ehemalige Nachbarin Rose nicht mehr gesehen. Aber an jedem einzelnen Tag hat sie an sie gedacht, und mit jedem Tag ist ihre Wut größer geworden. Denn Felicity war damals klein, und Rose war groß. Rose hätte sie beschützen und ihr helfen müssen. Stattdessen hat sie einfach weggesehen, und jetzt scheint sie sich an nichts mehr zu erinnern. Aber Felicity wird ihrer Erinnerung schon auf die Sprünge helfen - und dafür sorgen, dass sie für ihre Fehler bezahlt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Danksagung
Über das Buch
Fünfundzwanzig Jahre hat Felicity ihre ehemalige Nachbarin Rose nicht mehr gesehen. Aber an jedem einzelnen Tag hat sie an sie gedacht, und mit jedem Tag ist ihre Wut größer geworden. Denn Felicity war damals klein, und Rose war groß. Rose hätte sie beschützen und ihr helfen müssen. Stattdessen hat sie einfach weggesehen, und jetzt scheint sie sich an nichts mehr zu erinnern. Aber Felicity wird ihrer Erinnerung schon auf die Sprünge helfen – und dafür sorgen, dass sie für ihre Fehler bezahlt …
Über die Autorin
Nicole Trope hat ihr Jurastudium abgebrochen, als sie festgestellt hat, dass sie statt juristischer Abhandlungen lieber Geschichten schreibt. Sie wurde Lehrerin und nutzte die Ferien, um an ihrer Karriere als Schriftstellerin zu arbeiten und ein Literaturstudium abzuschließen. Seit der Geburt ihres ersten Kindes widmet sie sich ganz dem Schreiben. Nicole Trope lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Sydney.
Nicole Trope
DAS FINKENMÄDCHEN
ROMAN
Aus dem australischen Englisch von Carola Fischer
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2015 by Nicole TropeTitel der australischen Originalausgabe: »Hush, Little Bird«Originalverlag: Allen & Unwin
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Jutta Wieloch, OstbevernTitelillustration: © Artulina/shutterstock; © Anastasia Zenina-Lembrik/shutterstock; © Anastasia Nio/shutterstockUmschlaggestaltung: Manuela Städele-MonverdeE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5596-3
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für alle Frauen in meinem Leben, früher und heute:die Großmütter,die Mütter,die Töchter,die Schwestern,die Tanten,die Nichten,die Cousinenund die Freundinnen
Kapitel eins
Sie kommt heute. Sie kommt hierher. Genau hierher, wo ich bin.
Ich dachte, ich müsste warten, bis ich wieder frei bin, um sie zu sehen. Ich dachte, ich müsste zwei Jahre warten, bis ich sie sehe. Zwei ganze lange Jahre. Ich habe sie schon sehr viel länger als diese zwei Jahre nicht mehr gesehen. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit ich acht Jahre alt war, und jetzt bin ich dreiunddreißig. Das macht fünfundzwanzig Jahre.
Als ich acht war, wollte ich nichts anderes als weg von ihr, von ihm. Von ihnen. Ich wollte weit weggehen und sie vergessen, aber auch nachdem ich umgezogen war, blieben sie in meinem Kopf. Sie blieben in einer Ecke meines Gehirns, sie taten nichts, sie waren einfach nur da, aber eines Tages geschah etwas, etwas Schreckliches, Furchtbares und Schlimmes, und danach waren sie fast das Einzige, woran ich denken konnte. Und ich wusste, ich musste sie wiedersehen.
Ich hatte einen Plan. Ich wollte mit dem Bus zu ihrem Haus fahren. Anfangs wollte ich mit dem Bus zu ihremgemeinsamen Haus fahren, aber jetzt ist nur noch sie da. Also ist es nur noch ihr Haus.
Ich weiß, wie man mit dem Bus oder der Bahn fährt. Ich weiß, wie ich auf meinem Telefon »Wegbeschreibungen« finde. Ich kann gehen, wohin ich will, aber nicht jetzt, denn jetzt muss ich hierbleiben. Das weiß ich. Ich kann Dinge lernen und mich an sie erinnern, wenn man sie mir wieder und wieder sagt. Ich muss die Dinge nur mehrmals hören. Manchmal muss ich etwas unzählige Male hören. Die Tür zu meinem Gehirn steht immer offen. Da kommt Zeug rein, und bevor ich es begreife, ist es wieder draußen. Anscheinend kann ich die Tür nicht schnell genug zumachen.
Ich weiß jetzt Dinge. Mehr Dinge, als die Menschen glauben. Ich bin nicht so dumm. Ich kann lesen und schreiben, plus- und minusrechnen. Ich weiß, wer ich bin und was ich bin. Ich weiß, dass ich nicht schlau bin. In meiner ganzen Schulzeit hat kein Lehrer je zu mir gesagt: »Sie muss sich mehr anstrengen.« Alle sagten: »Sie tut, was sie kann. Sie gibt sich wirklich Mühe.«
Manchmal schrieb der Lehrer auf Lilas Zeugnis: Lila nutzt nicht ihr gesamtes Potenzial. Potenzial ist das, was man tun kann. Lila ist klug, sehr klug, aber Mum sagt, sie sei auch faul. Über mich haben sie das nie geschrieben. Ich habe immer mein gesamtes Potenzial genutzt, auch wenn das nicht viel Potenzial war.
Ich bin schlau genug, zu wissen, dass ich etwas dumm bin, oder »langsam«, wie Mum gern sagt. Ich bin schlau genug, zu wissen, dass ich langsam bin. So schlau bin ich. Früher wurde ich wütend, weil ich langsam war, weil ich Dinge nicht verstand, weil ich sie immer wieder lernen musste, aber jetzt ist das okay für mich.
»Nicht jeder kann Klassenbester sein«, sagte Mum jedes Mal, wenn ich mein Zeugnis nach Hause brachte. Aber ich wollte gar nicht die Klassenbeste sein. Ich wollte nur nicht die Klassenletzte sein. Aber das war ich, und das blieb ich. Ich hatte niemals wirklich viel Potenzial.
Mum sagte, sie finde es in Ordnung, wenn ich die Klassenletzte sei, aber das stimmte nicht. Eigentlich nicht. Nur weil sie sagte, sie finde das in Ordnung, muss das nicht die Wahrheit sein. Ich weiß, was sie wirklich dachte. Als ich klein war, habe ich es gehört. Ich habe sie immer wieder die Wahrheit sagen hören.
»Wie soll ich mit ihr fertigwerden? Ich habe keinen Mann, der mir hilft. Wie soll ich das schaffen? Ich werde den Rest meines Lebens auf sie aufpassen müssen. Wann kümmert sich mal jemand um mich, Violet? Wann?«
Ich sollte nicht lauschen. Ich sollte nebenan spielen, aber ich versteckte mich und hörte zu, wenn Mum mit Tante Vi sprach, die in London lebte. Ich war gut im Verstecken. Ich konnte lange still sein. Wenn ich still war, hörte ich viele Dinge, die ich nicht hören sollte. So bekam ich auch mit, dass Mum es nicht in Ordnung fand, dass ich die Klassenletzte war.
»Das weiß ich, Violet. Ich sage ja gar nicht, dass ich sie aufgegeben habe, aber sie wird halt immer ein bisschen anders sein, oder? Ich meine, sie ist jetzt fast acht, und die anderen Kinder fangen an, es zu bemerken … Ich weiß, dass du nichts tun kannst. Du lebst in einem anderen Land. Ich bitte dich auch nicht, irgendwas zu tun. Ich brauche nur jemanden zum Reden. Du hast ja keine Ahnung, wie schwer man es allein auf dieser Welt hat, keinen blassen Schimmer.«
Ich saß im Schrank unter der Treppe, wo die Winterkleidung aufbewahrt wurde. Mein Gesicht berührte den Pelzmantel, der Mum gehörte. Sie trug den Mantel nie, denn sie mochte ihn nicht, daher lebte er wie ein einsames Haustier unter der Treppe. Er war weich und kuschelig.
»Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen soll. Im Augenblick schaffe ich es einfach nicht. Ich musste das Haus verkaufen. Habe ich dir das erzählt? Wir ziehen in ein scheußliches kleines Loch irgendwo draußen in einem schrecklichen Vorort. Mehr konnte ich mir nicht leisten, Violet … Ich bitte dich um nichts. Ich versuche nur, mit dir zu reden. Ich fühle mich so … so gedemütigt von alldem. Was habe ich getan, dass ich so ein Leben verdiene? Was bloß?«
Mums Stimme war ganz zittrig. Ich wusste, dass sie weinte. Sie weinte, weil sie das Haus verkaufen musste, sonst würde die verdammte Bank kommen und es holen. Damals dachte ich, die verdammte Bank wäre ein Riese, der das ganze Haus mit einer Hand hochheben und wegnehmen könnte. Nachts träumte ich, von den Riesenfingern der verdammten Bank zerquetscht zu werden. Ich hatte mein Lieblingsspielzeug hinter meiner Kommode versteckt. Wenn die verdammte Bank das Haus holen kam, würde ich mein Spielzeug schnappen und durch die Vordertür abhauen. Während ich unter der Treppe saß, tätschelte ich Mums einsames Pelzmanteltier und dachte darüber nach, es auch zu verstecken. Heute weiß ich, dass eine Bank nur ein Gebäude ist, wo man sein Geld aufbewahrt.
Ich hatte Angst, die Bank würde uns alles wegnehmen, aber ich war nicht traurig, dass wir umzogen. Es war mein größter Wunsch, aus dem Haus auszuziehen. Ich hasste es. Wir würden sehr weit fortziehen. Unser neues »Loch« war total klein. Ich würde immer noch mein eigenes Zimmer haben, aber der Teppich war grau und voller klebriger Flecken, ganz anders als der Teppich in meinem Zimmer in dem großen Haus. Dieser Teppich war pfirsichfarben und weich. Ich mochte es, meine Wange daraufzulegen und das Kitzeln auf der Haut zu spüren. Ich wusste, dass der klebrige graue Teppich sich nicht gut auf meiner Wange anfühlen würde, aber trotzdem war mir das Loch lieber als das große Haus.
»Hör auf, mir etwas von Neuanfängen zu erzählen, Violet«, sagte Mum. »Dein Mann hat dich nicht für eine andere verlassen. Dein Mann sitzt jetzt wahrscheinlich in seinem Sessel und liest Zeitung. Das ist kein Neuanfang für mich. Das ist das Ende meines gewohnten Lebens. Er hätte wenigstens den Anstand besitzen können, mich noch ein paar Jahre hier wohnen zu lassen, aber die Schickse, die er geheiratet hat, will ihr eigenes Haus.«
Mum weinte nicht mehr, sie schrie Tante Vi an. Sie schrie Tante Vi oft an, nachdem Dad uns verlassen hatte, um mit der Schickse zusammenzuleben. Lila und ich haben die Schickse nie kennengelernt. Mum wollte das nicht. »Euer Vater schert sich einen Dreck um euch beide«, sagte sie.
Ich habe meinen Vater fast mein ganzes Leben lang nicht gesehen. Er hatte blaue Augen, und wenn er sich rasierte, schnitt er sich und sagte: »Scheiße.«
Wenn ich mich unter der Treppe versteckte, hatte ich Angst vor Mum, die Tante Vi anschrie und weinte. Denn an manchen Tagen, wenn Mum genug davon hatte, Tante Vi anzuschreien, schrie sie mich an. Ich mochte die Schreitage nicht.
Das ist so viele Jahre her. Manche Dinge bleiben in meinem Kopf, auch wenn ich das gar nicht will. Traurige Dinge und schlimme Dinge gehen nicht raus, selbst wenn ich die Tür offen lasse.
Sie sind in meinem Kopf geblieben. Die ganze Zeit über. Ich denke an ihn, und ich denke an sie. Sie sitzen beide in meinem Kopf fest, aber jetzt ist er tot, und sie kommt hierher.
Sie kommt heute hierher.
Ich dachte, ich würde mehr Zeit zum Vorbereiten haben, bevor ich sie sehe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man sie hierherbringt, zu mir. Ich hätte Zeit gebraucht, um zu planen, was ich sagen und tun würde, aber seit ich weiß, dass sie kommt, habe ich keine Ahnung mehr, was passieren wird.
Nein, das stimmt nicht. Ich weiß, was passieren wird; ich weiß nur nicht, wie es passieren wird.
Ich habe keine Ahnung, wer als Erster herausgefunden hat, dass sie hierherkommt, aber inzwischen weiß es jeder. Und alle sind nervös und aufgeregt.
Die Neuigkeiten über sie wurden herumgeflüstert, bis jede es wusste. Niemand hat es mir zugeflüstert, aber Jess hat es mir gesagt. Sie erzählt mir alles, was ich wissen muss.
»Eine richtige Prominente, stell dir vor«, hat Jess gesagt, aber sie hat nicht gelächelt, deshalb glaube ich nicht, dass sie wirklich glücklich darüber war.
Wochenlang haben alle Frauen meiner Wohneinheit sie im Fernsehen gesehen und überlegt: Hat sie es getan?
Ich wohne mit Maya, Mina und Jess in Haus sieben. Sie schreien und streiten und lachen, wenn sie darüber sprechen, »ob sie es getan hat oder nicht«. Sie schreien und lachen und reden über viele Dinge. Sie wissen alle über so vieles Bescheid. Sie kennen sich mit Prominenten und Sport, Geschichte und dem Wetter aus. Sie können kochen und nähen und wissen, wem man vertrauen kann und wem nicht. Jess sagt: »Ich denke …«, und Mina sagt: »Also, meiner Meinung nach …«, und Maya sagt: »Ich weiß.«
Ich rede nicht mit ihnen. Ich bleibe still. Ich bin eine gute Zuhörerin.
Mir ist es egal, ob sie es getan hat oder nicht. Ich bin bloß froh, dass er tot ist und unter der Erde bei den Würmern liegt. Ich hoffe, dass sie überall auf seiner Haut herumkriechen. Ich muss mir die Arme reiben, wenn ich daran denke, dass es auf seiner Haut von Würmern nur so wimmelt. Ich muss sicher sein, dass bei mir keine Würmer sind.
Wenn ich daran denke, dass sie hierherkommt, muss ich immerzu schlucken, damit ich mich nicht übergebe.
Letzte Nacht lag ich im Bett und habe mich gefragt, ob sie mich erkennen würde oder nicht. Ich habe an meinen Fingernägeln gekaut, während ich im Dunkeln lag und grübelte und grübelte. Meine Finger haben geblutet. Im Dunkeln konnte ich das Brennen auf der Haut spüren, was bedeutet, dass ich ein großes Stück Nagel abgerissen habe, und wenn Jess das sieht, wird sie sagen: »Ach Birdy, du hast so gut durchgehalten.«
Ich hasse es, Jess zu enttäuschen. Am Ende der Woche wollte sie eine richtige Maniküre bei mir machen. Ich habe schon die Farbe ausgesucht. Ein hübsches Rosa, das »No Baggage Please« heißt. Das ist ein komischer Name für einen Nagellack, aber ich mag ihn trotzdem.
Ich hinterließ ein paar Blutflecken auf den Laken, denn auch wenn es wehtut, kann ich nicht aufhören, an den Nägeln zu kauen. Ich weiß, dass Allison bei ihrem Kontrollgang den Kopf schütteln und seufzen wird, aber sie wird mich nicht die Laken wechseln lassen. Ich werde bis zum nächsten Waschtag darin schlafen müssen.
Heute Morgen habe ich nach dem Aufwachen in den kleinen Spiegel über dem Waschbecken im Badezimmer geschaut, und mir war klar, dass es dumm war, zu denken, sie könnte mich erkennen. Ich bin nicht mehr der Mensch, den sie damals kannte. Ich färbe mein Haar schwarz, und ich bin erwachsen. Ich nehme auch sehr viel mehr Raum ein. Sehr viel mehr Raum.
»Du brauchst nicht so viele Kohlenhydrate«, sagt Jess zu mir, wenn wir Abendessen kochen, aber ich mag Kartoffeln und Reis. Ich bin gern dick. Außerdem sind Reis und Kartoffeln billig. Sie machen einen schön satt. Wir müssen unser eigenes Essen kaufen, und es ist nie genug Geld da. Ich bin gut darin, mein Geld zu zählen. Ich bewahre es sicher auf bis zum Kantinentag.
Am Kantinentag geben wir unser Geld für Dinge aus, die wir haben möchten, nicht nur für Dinge, die wir brauchen. Man braucht Brot, aber man braucht keine Schokolade. Maggie leitet die Kantine, und wenn sie mich sieht, dann lächelt sie und sagt: »Und was kann ich heute für dich tun, Birdy?«
Ich mag Maggie. Einmal hat sie mir einen Schokoriegel geschenkt. Er war total zerdrückt, aber er schmeckte so wie immer. Jess sieht mich nicht gern Schokolade essen. Sie schüttelt dann den Kopf und sagt: »Wenn du dich nur ein bisschen zurückhalten würdest, könntest du etwas abnehmen.«
»Aber ich will gar nicht abnehmen«, antworte ich ihr dann immer. »Ich bin gern groß und stark.«
»Hier ist niemand, vor dem du Angst haben müsstest, Birdy«, sagt Jess. »Du musst nicht groß und stark sein.«
Ich würde Jess gern sagen, dass sie nicht weiß, wovor ich Angst haben muss, aber sie weiß einiges über mich, und sie weiß auch, was es bedeutet, Angst zu haben. Jeder hier weiß, was es bedeutet, Angst zu haben. Wir sind hier alle eingesperrt wegen Dingen, die wir gemacht haben, als wir Angst hatten.
Egal, hier drinnen habe ich vor nichts Angst. Ich will nur sichergehen, dass man mich sehen kann. Als ich klein war, konnte ich nicht gesehen werden. Selbst als ich erwachsen war und so groß wie Mum, konnten mich einige Leute nicht sehen. Mum hat mich niemals richtig gesehen. Ich wollte gesehen werden, aber ich wollte auch leicht und frei sein und fortfliegen. Man kann Dinge sehen, die leicht und frei sind, wenn man genau hinschaut, aber sobald man sie sieht, sind sie auch schon fort. Jetzt bin ich groß und kann nicht fortfliegen, aber zumindest kann man mich sehen.
»Aus dem Weg mit dir, du Fettkloß«, sagte Jess einmal, als sie zum Wasserkocher wollte, und dann sagte sie: »Tut mir leid, Birdy.«
Es macht mir nichts aus, Fettkloß genannt zu werden. Ein Fettkloß ist da, das weiß man. Man kann nicht so tun, als wäre er nicht da. Als ich leicht und klein war, gab es viele Dinge, die mir Angst machten. Jetzt bin ich ein Fettkloß, und manchmal haben die Leute Angst vor mir.
Ich frage mich, wovor sie wohl Angst hatte. Ich frage mich, ob sie vor ihm Angst hatte. Ich frage mich, ob sie Angst hat, hierherzukommen.
Es ist sowieso nicht wichtig. Es interessiert mich nicht, was sie denkt oder fühlt. Es interessiert mich nicht, was sie getan hat oder nicht.
Das Einzige, was mich interessiert, ist, was ich ihr antun werde.
Kapitel zwei
Dieser Ort ist wirklich nicht so schrecklich, wie ich befürchtet habe. Es ist beinahe eine Erleichterung, hier zu sein, denn jetzt ist das Warten endlich vorüber. In den letzten Wochen gab es einige unwirkliche Momente, in denen ich überzeugt davon war, für immer im Ungewissen darüber zu bleiben, was mit mir geschehen würde. Während ich auf die Urteilsverkündung wartete, blieb ich abends manchmal an diesen erbärmlichen Gefängnisserien im Fernsehen hängen. Mein Entsetzen wuchs mit jeder Folge, und ich kam zu dem Schluss, dass ich wahrscheinlich schon in der ersten Woche meiner Inhaftierung von einer Frau mit einem riesigen Totenkopf-Tattoo unter der Dusche niedergestochen werden würde. Der Gedanke, eine Gemeinschaftsdusche benutzen zu müssen, war furchtbar erniedrigend, dabei wusste ich nicht einmal, ob es Gemeinschaftsduschen geben würde oder nicht.
Eines Abends stand ich fast eine Stunde lang vor meinem Standspiegel im Schlafzimmer und betrachtete meinen Körper aus jedem Blickwinkel. Ich war auf der Suche nach Makeln. Mir war bewusst, wie lächerlich es war, sich darüber Sorgen zu machen, aber ich machte dennoch weiter. Ich stellte mir die Blicke von Hunderten fremder Frauen auf meinem Körper vor und wünschte mir, ich könnte mich zu einem Ball zusammenrollen und für immer unter der Bettdecke bleiben.
»So wird es überhaupt nicht sein, Mutter«, sagte Portia.
»Aber wie wird es dann sein?«, fragte ich und hatte Mühe, nicht gleich in Tränen auszubrechen.
Portia duldet kein Selbstmitleid. Sie verbringt viel Zeit mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen und denkt, dass niemand sonst das Recht habe, sich zu beschweren. »Wenn du das gesehen hättest, was ich gesehen habe« ist einer ihrer Lieblingssätze. Damit wird jedes Gespräch im Keim erstickt. Es ist wenig hilfreich, sie daran zu erinnern, dass ich meine Kindheit in einem Vorort verbracht habe, wo Einwanderer verzweifelt versuchten, sich ein neues Zuhause zu schaffen. Vielleicht habe ich meinen Kindern gegenüber die Wahrheit geschönt, wenn ich in Erinnerungen an jene Tage schwelgte.
Ich bin sicher, dass ich Portia niemals von den Nächten erzählt habe, in denen unsere Nachbarin Lena bei uns klopfte und uns aus dem Schlaf riss. In ihrem Gesicht war dann immer eine frische Verletzung zu sehen, und ihre dreijährigen Zwillinge standen müde und verweint neben ihr. Wir bereiteten ihnen schnell ein paar Schlafplätze auf dem Boden im Wohnzimmer. »Schlaf deinen Rausch aus, Rolf«, hörte ich meinen Vater durch die verriegelte Haustür rufen, wenn wieder geklopft wurde. »Schlaf deinen Rausch aus!«
Manchmal ist Portia unerträglich, aber in letzter Zeit ist sie mein Fels in der Brandung. Ich brauche jetzt eher logisches Denken als Mitleid.
»Ich glaube nicht, dass man dich ins Gefängnis schickt. Und wenn doch, wird Eric Berufung einlegen. Wenn die nicht gleich durchgeht, wird er wieder Berufung einlegen, so lange, bis du frei bist. Du verfügst über genügend Mittel, Mutter.«
»Geld kann nicht jedes Problem lösen, Portia«, sagte ich.
»Es kann einige Probleme lösen«, erwiderte sie. »Ich bin sicher, am Ende kommst du da dank deines Geldes raus.«
»Wo raus?«, schrie ich.
»Beruhige dich. Beruhig dich mal! Hör zu, egal was passiert, du solltest wissen, dass wir alles tun, damit du nicht ins Gefängnis musst. Und wenn doch, wird das nur so eine Einrichtung mit minimaler Sicherheitsstufe sein. Schließlich bist du für niemanden eine Bedrohung.«
Ich weiß nicht, warum Portia zu wissen glaubte, was passieren würde. Vielleicht fand sie es unvorstellbar, dass man mich wie eine gewöhnliche Kriminelle einsperren würde, so wie sie sich früher nicht vorstellen konnte, dass man mich wegen eines Verbrechens anklagen würde. Das Leben kann voller böser Überraschungen sein. Den größten Teil der vergangenen achtzehn Monate habe ich in einem Schockzustand verbracht.
Auch wenn ich ihr gern glauben wollte, blieb meine Angst, dass das absolut Schlimmste eintreten würde. Was den Prozess anging, hatte ich recht behalten. Ich hatte gewusst, dass die Geschworenen mich schuldig sprechen würden, auch wenn man mir vorher etwas anderes erzählt hatte. Ich wusste, dass es keinen Grund gab, warum ich nicht wegen Totschlags ins Gefängnis gehen sollte.
»Gefängnis ist die letzte aller Möglichkeiten«, sagte ich, und Portia schüttelte den Kopf angesichts meiner Sturheit.
Der Prozess scheint jetzt schon lange her, obwohl seitdem nur gut ein Monat vergangen ist. Wenn ich die Augen schließe, kann ich mir den schalen Geruch des Gerichtssaals in Erinnerung rufen. Ich spüre immer noch meinen übersäuerten Magen, während ich zuhörte, wie die Staatsanwältin mein gesamtes Leben ruinierte.
Ich wusste, dass die Geschworenen mich schuldig sprechen würden. Den ganzen Prozess über hatte ich ihre Gesichter studiert, und ab einem bestimmten Punkt hatten sie einfach aufgehört, mich anzusehen. Sieben von den zwölf Geschworenen waren Frauen. Ich dachte, dass das vorteilhaft wäre, aber es hat anscheinend gar nichts geholfen. Eine der Frauen schien in meinem Alter zu sein, aber ihr fehlten einige Zähne, und sie hatte diesen müden Blick von jemandem, der für alles im Leben kämpfen muss. Ich habe solche Gesichter schon früher gesehen. Meine Mutter hatte diesen Gesichtsausdruck. Ich konnte sehen, dass die Frau mich vom ersten Tag an hasste. Vielleicht hätte ich nicht das Chanel-Kostüm tragen sollen, aber es ist ja nicht so, dass sie nicht wussten, wer ich bin. Sein Gesicht war überall in den Medien gewesen, bevor es passierte. Und meins danach auch.
Wenn man mir erlaubt hätte, das Wort an die Geschworenen zu richten, hätte ich ihnen erklärt, dass ich das blassrosa Kostüm trug, weil ich um ihn trauerte und ihn ehren wollte. Auf unserer ersten Parisreise war er mit mir in eine Chanel-Boutique gegangen und hatte darauf bestanden, dass ich das Kostüm anprobierte. Ich hatte nur nachgegeben, weil ich dachte, wir täten das zum Spaß, aber dann kaufte er das Kostüm für mich. Er versah den Kreditkartenbeleg mit einem Schnörkel und lächelte.
»Das ist zu teuer«, sagte ich.
»Für dich ist gar nichts zu teuer«, antwortete er.
Natürlich brachte die Staatsanwältin auch Geld ins Spiel. Als die enorme Summe erwähnt wurde, beobachtete ich, wie die Augen der meisten Geschworenen glasig wurden. Klatsch über Millionen von Dollar gehört in Zeitschriften, nicht ins echte Leben.
»Sie werden über seine Lebensversicherung sprechen«, hatte Eric mir gesagt.
»Davon habe ich gar nichts gewusst«, hatte ich erwidert.
Er hatte genickt. »Ich werde dafür sorgen, dass die Geschworenen das erfahren.«
Früher wusste ich nichts über das australische Rechtssystem, heute könnte ich ein Buch darüber schreiben. Bin ich das?, dachte ich häufig während des Prozesses. Sitze ich wirklich hier und höre mir all das an? Kann ich überhaupt der Mensch sein, über den hier gesprochen wird?
»Was ist nur mit uns geschehen?«, jammerte Rosalind, nachdem sie den ersten von vielen Artikeln über den Prozess gelesen hatte.
Rosalind konnte damit nicht gut umgehen. Dabei war der Prozess nur der schreckliche Höhepunkt der fürchterlichen letzten eineinhalb Jahre. Eric versicherte mir, dass man mich nicht anklagen würde, vor allem nicht nach dem, was wir durchgemacht hätten; aber als ich angeklagt wurde und das ganze Rechtssystem auf Hochtouren lief, konnte ich, konnten die Mädchen nur noch abwarten.
Ich hätte Rosalind von meinen Ängsten vor dem Leben im Gefängnis erzählen können, aber sie wäre nur in Tränen ausgebrochen, und das hätte nichts gebracht. Rosalind schien, noch mehr als ich selbst, mit den Nerven am Ende zu sein. Ich hätte ihr gern geholfen, aber ich konnte mich auf niemand anderen als mich selbst konzentrieren. Ich war nicht die Mutter, für die ich mich immer gehalten hatte. Ich sollte selbstlos sein, nicht selbstsüchtig.
Sobald die Geschworenen mich nicht mehr ansahen, wusste ich, dass ich verurteilt war. Ich wusste, was sie gerade taten. Es muss schwierig sein zu wissen, dass das Schicksal eines Menschen an der einen Entscheidung hängt, die man selbst treffen muss. Es wäre schwer, jemandem in die Augen zu schauen, dessen Leben man gerade zerstört. Es ist bestimmt leichter, diese Entscheidung zu treffen, wenn man die betroffene Person entmenschlicht. In irgendeinem Moment musste aus Rose Winslow, der Mutter, Großmutter und gut angezogenen Dame, die still neben ihrem Anwalt sitzt, Rose Winslow, die Angeklagte, geworden sein. Rose Winslow, Mörderin. Oder Totschlägerin? Ich weiß gar nicht, wie man jemanden nennt, der der Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt ist.
Die Presse sprach von mir als einer Mutter und Großmutter, und in einigen Artikeln wurde ich auch als schön beschrieben. Ich würde nie zugeben, dass ich mir ausgerechnet dieses Detail gemerkt habe, aber es ist mir definitiv aufgefallen. Ich mochte es, als schön bezeichnet zu werden, auch wenn ich nicht schön bin, bloß gut gepflegt. Im Gerichtssaal trug ich mein langes braunes Haar zu einem tiefen Dutt zusammengenommen, und mein Gesicht war nur wenig geschminkt, gerade so viel, dass die kleinen Altersflecken und die dunklen Ringe unter den Augen abgedeckt waren. Als einzigen Schmuck trug ich meinen schlichten goldenen Ehering. Ich denke, an einem guten Tag kann ich mit dem richtigen Make-up wie fünfzig aussehen, vielleicht sogar wie Ende vierzig. Das Leben beginnt heutzutage mit fünfzig, heißt es – oder war es vierzig? Ich kann mich nicht erinnern. Nicht dass das wichtig wäre. Mein Leben ist im Wesentlichen vorbei, vermute ich.
Nachdem das Urteil verkündet wurde, tat Eric sofort seine Absicht kund, Berufung einzulegen. Bei der Urteilsverkündung war er relativ gefasst. Im Prozess war er, wie wir alle, schockiert über das Strafmaß gewesen. Aber man hatte ihm das nicht angesehen. Seine Lippen wurden ein klein wenig dünner, ansonsten änderte sich nichts an seiner stets aufrechten Haltung und seinem unbeweglichen Gesicht. Ich bin sicher, dass das niemandem außer mir im Gerichtssaal aufgefallen ist. Aber schließlich bin ich auch die Einzige, die ihn seit dreißig Jahren kennt.
»Eine gute Familie hat immer einen guten Anwalt, Liebling«, sagte Simon, nachdem er mich mit Eric bekannt gemacht hatte. Damals hatte Eric gerade als Anwalt angefangen. Heute prangt sein Name außen an seinem eigenen Bürogebäude. »Sieh mal, wie weit wir es gebracht haben, alter Freund«, sagte Simon in späteren Jahren oft zu Eric, und dann stießen sie mit Whisky an und rauchten Zigarren. »Eric wird immer für dich da sein, Rose. Er wird dir helfen, wenn ich einmal nicht mehr da bin«, sagte Simon jedes Mal, wenn wir über unseren Lebensabend sprachen.
»Und wenn ich zuerst sterbe?«, fragte ich Simon, wenn er mich darüber belehrte, was nach seinem Tod zu tun wäre, denn ich konnte mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Ich war sicher, dass ich dann nur noch auf dem Sofa sitzen und auf den Tod warten würde.
»Ach, mein liebes Mädchen«, sagte Simon lachend. »Mein liebes, liebes Mädchen.«
Er hatte sich so lange um mich gekümmert, dass ich zuerst nicht einmal daran denken konnte, wie ich das selbst anstellen sollte. Ich weiß, dass Portia deswegen frustriert war.
»Was meinst du damit, du kennst das Kennwort für das Online-Banking nicht?«, fragte sie, als wir darüber sprachen, wie wir die Beerdigung bezahlen sollten.
»Dein Vater muss es irgendwo aufgeschrieben haben«, sagte ich. »Ich habe es einfach noch nie gebraucht.«
»Sei nicht so hart zu ihr«, sagte Rosalind.
»Hör auf, sie in Watte zu packen, Rosalind. Das ist wichtig, das sollte man wissen. Du wirst diese Dinge in die Hand nehmen müssen, Mutter. Ich habe einen Job, und Roz hat Kinder. Du musst erwachsen werden und dich um dich selbst kümmern.«
Zu einem anderen Zeitpunkt hätte ich sicherlich die Schultern gestrafft und gesagt: »Glaub bloß nicht, dass du mich so behandeln kannst, Portia.« Aber in Wirklichkeit fühlte ich mich wie ein Kind, das einen Elternteil verloren hat. Meiner Wurzeln beraubt.
»Bitte mach mir keine Vorhaltungen«, sagte ich stattdessen. »Das ist nicht der richtige Moment.«
»Ich mache uns einen Tee«, sagte Rosalind, die wie immer hoffte, sie könne Portia ablenken, bevor diese sich in etwas hineinsteigerte.
»Mein Gott, verschone mich mit einer weiteren Tasse Tee«, sagte Portia. »Was soll die ganze Teetrinkerei eigentlich? Es ist ja nicht so, dass dadurch die Toten wiederauferstehen.«
»Bitte sei etwas respektvoller zu Mum«, sagte Rosalind.
»Ihr beiden, ich glaube, ich lege mich kurz hin«, sagte ich. Im letzten Jahr habe ich mich häufig kurz hingelegt. Während des Prozesses und während wir wochenlang auf das Urteil warteten, habe ich mich etliche Stunden in meinem Schlafzimmer vor meinen Töchtern versteckt. Sie meinten es gut, aber beide zusammen waren etwas zu viel für mich.
Nach dem Schuldspruch brach der gesamte Gerichtssaal in Raserei aus. Portia und Rosalind, die den ganzen Prozess hindurch Muster der Selbstbeherrschung gewesen waren, enttäuschten mich, indem sie die Kontrolle verloren. Portia fing an zu schreien, und Rosalind schlug sich weinend die Hände vors Gesicht. Simon hätte das sehr missfallen. Seine Mutter war Engländerin gewesen und hatte ihm beigebracht, wie wichtig es war, stets Haltung zu bewahren. (Tatsächlich schien er manchmal mehr Engländer als Australier zu sein. Eine Manieriertheit, an der er unter allen Umständen festhielt. Die meisten Menschen nahmen bei ihrer ersten Begegnung mit ihm an, dass er den größten Teil seines Lebens nicht in Australien verbracht hatte. Simon war dann immer begeistert. »Ich hätte im Oberhaus sitzen können«, sagte er gern. Ich widersprach ihm nie. Irgendwann gewöhnte ich mich an sein eingebildetes Leben als Engländer.)
»Sie hat mir immer eingeschärft, wie wichtig es ist, dass ich meine Gefühle in Schach halte, besonders wenn mein Vater sich schlecht benahm«, sagte er oft über seine Mutter.
»Was meinst du mit ›schlecht benahm‹?«, fragte ich dann, aber er gab mir niemals eine klare Antwort darauf. Die Wahrheit über Simons Vergangenheit war sein gut gehütetes Geheimnis. Manchmal sprach er von einem Zuhause voller Gewalt und Unterdrückung, nahm aber seine Worte sogleich zurück und weigerte sich, mehr zu erzählen.
»Was meinst du damit, wenn du sagst, er war gewalttätig, Simon?«, fragte ich ihn. »Was hat er getan?«
»Es gibt Dinge, Rose, die sind zu schrecklich, um sie auszusprechen, einfach zu schrecklich, um auch nur daran zu denken. Ich möchte dich nicht damit belasten.«
Ich weiß nicht, ob das die Wahrheit war. Ich habe nie jemanden aus seiner Familie kennengelernt. Wenn er in einem Interview nach seinen Verwandten gefragt wurde, lächelte er geheimnisvoll. »Ach, ich glaube nicht, dass sie gern über ihre Privatangelegenheiten in der Zeitung lesen würden«, sagte er dann und überließ es den Journalisten, ihre eigenen Vermutungen über seine Vergangenheit anzustellen.
Ich erinnere mich an einen Artikel, in dem darüber spekuliert wurde, ob er königlicher Abstammung sei. Er war begeistert. »Wie sind die bloß auf diese Idee gekommen?«, fragte ich ihn, aber er antwortete nur mit einem merkwürdigen Lächeln. Ich bin sicher, dass sich ein oder zwei Reporter für seine Familie interessierten, aber sie haben nie intensiv nachgeforscht. Damals war es anders, man hatte weniger Möglichkeiten, die Wahrheit zu finden, und auch noch mehr Respekt vor der Aura des Unantastbaren, die Prominente umgab.
Als wir uns zum ersten Mal trafen, hielt ich diese Unergründlichkeit für einen Teil seines Charmes. Inzwischen denke ich, dass es furchtbar einfältig von mir war, ihm solche Antworten durchgehen zu lassen. Vielleicht hätte ich mehr erfahren, wenn ich öfter nachgefragt hätte. Vielleicht aber auch nicht. Jetzt, da ich weiß, wie sorgfältig sein Image konstruiert war, wie viel er verbarg, kann ich mir nicht vorstellen, dass er seine Geheimnisse so ohne Weiteres preisgegeben hätte.
Als der Richter das Urteil verlas, konnten sich auch die Presseleute, die zur Verhandlung zugelassen waren, nicht zurückhalten. Es war sehr laut. Sie wollten, dass ich mich umdrehte, und riefen immer wieder meinen Namen. Sie wollten meinen Gesichtsausdruck sehen.
Ich sank in meinen Stuhl und saß regungslos mit meinen Händen im Schoß da. Ich hörte die Rufe, aber aus der Ferne, als kämen sie aus einem anderen Raum. Mein Herzschlag war lauter als die Geräusche meiner Töchter, die direkt hinter mir saßen. Ich drehte unentwegt meinen Ehering am Finger und konzentrierte mich auf meine Atmung. Was?, dachte ich. Was? Als ich zu meinen Töchtern und Eric blickte, wusste ich einen Moment lang nicht, wer sie waren.
Ich hatte den Schuldspruch erwartet, genauso wie ich ihn nicht erwartet hatte. Jetzt ist mir klar, dass ich mit der Annahme, alles würde gut ausgehen, besser dran gewesen wäre. Ich hätte die Zeit zu Hause genießen können, anstatt von früh bis spät darüber nachzugrübeln, ob man mich schuldig sprechen würde oder nicht. Ich hörte, wie Eric nach einer Kaution fragte und diese gewährt wurde. Obwohl ich wusste, dass meine Sorgen nichts änderten, quälte ich mich weiter, während ich auf die Festsetzung des Strafmaßes wartete. Die Gottlosen finden wirklich keine Ruhe.
Erics Lippen wurden in dem Chaos nach der Urteilsverkündung noch ein wenig schmaler. Ich habe mich oft gefragt, wie Eric beim Orgasmus aussieht. Zwar wollte ich nie mit ihm schlafen, aber ich hätte gern gewusst, ob sich sein Gesichtsausdruck verändert. Ich könnte Patricia, seine Frau, fragen, aber wir stehen uns nicht so nah, dass ich sie auf so etwas ansprechen könnte. In dreißig Jahren habe ich Eric bei all den Mittagessen, Dinnerpartys und Brunchs nie mit einem anderen Gesichtsausdruck gesehen. Selbst wenn er lächelt oder lacht, bleibt seine obere Gesichtshälfte reglos, und nur sein Mund bewegt sich. Patricia und den Kindern muss das eigenartig vorkommen.
Der Strafverteidiger, den wir für die Verhandlung verpflichtet hatten, war auch etwas verstört über das Ergebnis. Seine Perücke rutschte zu einer Seite, und ich hätte über ihn gelacht, aber er flößte mir etwas Angst ein. Er hat ein Schlangentattoo, das sich seinen starken Arm hinaufwindet. Als ich ihn zum ersten Mal in seinem eindrucksvollen holzgetäfelten Büro in der Stadt aufsuchte, hielt ich ihn für einen Handwerker, der gerade etwas reparierte. Der Mann hatte tatsächlich einen Hammer in der Hand und ein paar Nägel im Mund.
»Entschuldigung«, sagte er, als er Eric und mich in seinem Büro bemerkte. »Aber wenn man etwas erledigt haben will, sollte man es am besten selbst tun.«
Er trug eine schwarze Hose und ein Hemd ohne Krawatte, und als er sich vorbeugte, um einige Unterlagen von Eric entgegenzunehmen, rutschte sein Ärmel nach oben, und ich sah ein tätowiertes Schwanzende auf seinem Handgelenk.
»Das ist eine Schlange«, sagte er, als er meinen Blick auffing.
»Oh, ich habe gar nicht …« Ich spürte, wie meine Wangen rot wurden.
»Machen Sie sich keine Gedanken«, unterbrach er mich lachend. »Wenn ich gewusst hätte, dass ich das Tattoo mein ganzes Leben lang erklären muss, hätte ich es mir nicht stechen lassen. Aber was soll man machen? Jugendlicher Leichtsinn.«
Ich nickte, um ihm zu zeigen, dass ich ihn verstand, aber das Tattoo war nicht der Grund für mein Erröten. Robert hat kräftige Handgelenke und breite Schultern. Er sieht einfach viel zu gut aus für einen Strafverteidiger. Mag die Öffentlichkeit auch denken, ich hätte meine beste Zeit schon hinter mir, ich kann mich immer noch zu einem attraktiven Mann hingezogen fühlen.
»Er ist der Beste auf seinem Gebiet«, sagte Eric, als wir Roberts Büro verließen.
»Das sollte er auch für diesen Batzen Geld«, erwiderte ich.
»Rose, wir werden dafür sorgen, dass du nicht ins Gefängnis musst. Ich bin sicher, dass Simon das so gewollt hätte, und ich werde ihn nicht enttäuschen«, sagte Eric, und dann waren wir beide einige Minuten lang traurig.
Diese kleinen Anfälle von Traurigkeit waren am schwersten zu meistern. Es mag sonderbar klingen, aber große Wellen von Trauer sind einfacher, denn dann kann man nur still verharren und warten, bis die Welle über einen hinweggeglitten ist. Die großen Wellen sind so überwältigend, dass man nichts anderes tun kann, als ihnen nachzugeben. Vielleicht wird man ein wenig hin und her geschleudert, aber irgendwann kann man wieder aufstehen und atmen. Die kleinen Wellen, die nur an die Füße platschen, kommen ohne Vorwarnung und sind deshalb viel niederschmetternder. Meist erreichen sie einen in einem ganz gewöhnlichen Moment, sie stürzen heran, wenn man am wenigsten mit ihnen rechnet.
Ich glaube nicht, dass Simon Robert gemocht hätte – er war immer misstrauisch gegenüber Männern, die keine Krawatten trugen. Simon liebte Seidenkrawatten. Jahrelang waren sie an Weihnachten oder zum Geburtstag das übliche Geschenk der Mädchen für ihn. Am Abend vor der Urteilsverkündung saß ich auf dem Boden seines Kleiderschranks und rieb mein Gesicht an seiner Lieblings-Paisley-Krawatte. Sie roch noch leicht nach Zigarre und dem Aftershave, das er immer benutzt hatte. Ich kann nicht ohne ihn leben, dachte ich. Ich kann einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Rosalind nicht an meine Tür geklopft hätte.
»Du glaubst mir doch, Eric, oder nicht?«, hatte ich gefragt, während wir nach diesem ersten Treffen mit Robert auf ein Taxi warteten. »Dass ich die Wahrheit sage über das, was passiert ist?«
Diese Frage habe ich Eric wahrscheinlich mindestens hundert Mal gestellt. Er antwortet immer gleich. Er sagt niemals wirklich Ja oder Nein, sodass ich mir letztlich weiter den Kopf zerbreche. In erster Linie zerbreche ich mir den Kopf, weil ich nicht sicher bin, ob ich mir selbst glaube.
»Rose, ich kenne dich schon seit dreißig Jahren«, sagte er an jenem Tag zu mir. »Du hast noch nicht einmal einen Strafzettel bekommen, und ich weiß, wie sehr du Simon geliebt hast. Es wäre nie deine Absicht gewesen, ihn zu verletzen.«
Ein Taxi hielt neben uns, und Eric öffnete die Tür für mich. Ich wäre lieber mit dem Zug nach Hause gefahren, aber das hätte Eric nie zugelassen. Ich starrte aus dem Fenster auf all die Menschen, die ihrem Alltag nachgingen – vielleicht überlegten sie, was sie zu Mittag essen würden –, und dachte über Erics Worte nach: Es wäre nie deine Absicht gewesen, ihn zu verletzen.
Die Menschen, die mir am nächsten stehen, hatten meine Version der Ereignisse anscheinend akzeptiert. Schließlich gab es niemanden, der meine Version anzweifeln konnte. Ich war immer dankbar für die Unterstützung meiner Lieben, bin es noch, aber ich habe mich viele Nächte lang gefragt, was sie wirklich glauben. Ich weiß, dass Rosalind mir gerne noch mehr Fragen stellen würde, aber sie war noch nie jemand, der Druck auf andere ausübt. Sie hat Portias Einstellung zu den Ereignissen übernommen. Ich bin sicher, wenn meine Mutter oder mein Vater noch am Leben wären, wüsste ich, was sie wirklich glauben würden, aber ich lebe schon seit Jahren ohne die beiden.
Immer wieder spiele ich die Ereignisse jenes Abends im Kopf durch. Ich versuche zu einem anderen Ende zu kommen, ich versuche die Realität zu verbiegen. Ich weiß, was ich getan habe, und vielleicht auch, warum ich es getan habe. Aber was ist, wenn ich mich geirrt habe? Ich grübele weiter. Was ist, wenn ich mich geirrt habe?
»Ich bin überzeugt, es wird einen Freispruch geben«, sagte Robert zu mir, Eric und den Mädchen, während wir auf die Geschworenen warteten, nachdem sie sich zurückgezogen hatten. Wir hatten uns nicht die Mühe gemacht, nach Hause zu gehen, weil Robert meinte, das Urteil werde schnell gefällt, deshalb saßen wir in einem Café und aßen ein eher mäßiges Mittagessen. Ich hatte ein Stück Lachs-Quiche mit Salat vor mir. Die Quiche schmeckte fade, und der Salat war labberig. Portia hatte ein Nudelgericht und ein Glas Wein bestellt. Ich weiß nicht, ob der Wein, der in Cafés serviert wird, trinkbar ist, aber sie leerte das Glas schnell. Wahrscheinlich machte der Wein die Nudeln etwas schmackhafter. Rosalind bestellte sich ein Stück Kuchen, das sie dann nicht aß, weil sie sich Sorgen um die Kinder machte.
»Ich bin sicher, dass Jack gut mit ihnen fertigwird«, sagte ich zu ihr, nachdem sie zum zehnten Mal innerhalb von fünf Minuten ihr Telefon überprüft hatte.
»Oh, natürlich wird er das«, erwiderte sie und schaute wieder auf ihr Telefon.
»Sie sind doch noch in der Schule, warum bist du so hysterisch?«, fragte Portia.
»Portia, warum isst du nicht einfach deine Nudeln?«, entgegnete Rosalind.
»Also wirklich, Mädchen!«, entfuhr es mir. Manchmal vergesse ich, dass sie erwachsene Frauen sind. Sie streiten sich immer noch wie Kinder.
Eric sah verlegen aus, aber Robert schien glücklich mit seinem Steak-Sandwich. Er aß ordentlich und mit Bedacht und machte nur ab und an eine Pause, um Portia anzusehen oder mir ein paar beruhigende Worte zu sagen. Portia hatte ihr Haar zusammengebunden, aber sie hat Locken, und gewöhnlich lösen sich einige Strähnen. Eine blonde Locke hatte sich unter ihr Kinn gekringelt, und ich hätte mich gern nach vorn gebeugt und sie ihr aus dem Gesicht gestrichen. Ich glaube, Robert wollte das Gleiche tun, denn er hob ein paar Mal seine Hand, fuhr sich dann aber durch die eigenen Haare.
Portia ist betörend schön. Sie ist der Typ Frau, um den sich Männer prügeln. Rosalind und ich, wir ähneln uns, aber Portia sieht wie Simon aus. Die Lippen, die bei einem Mann ein bisschen zu voll wirken würden, sind bei Portia perfekt.
Das Café lag gegenüber dem Gerichtsgebäude, daher kamen ständig Leute herein oder gingen hinaus, und so ziemlich jeder schaute zu uns herüber. Ich hasse es, erkannt zu werden. Während ich meine Quiche salzte, träumte ich von einer langen Reise, sobald mein Fall verhandelt sein würde; auch wenn ich ahnte, dass ich diese Gelegenheit nicht bekommen würde. Damals wusste ich noch nicht, dass man nach dem Urteilsspruch nach Hause geht und einige Wochen später zur Verkündung des Strafmaßes zurückkehrt. Weder Robert noch Eric hatten diesen Teil des Gerichtsverfahrens mit mir besprochen. Alle hatten stets angenommen, dass ich nach Hause zurückkehren würde, von allen Vorwürfen entlastet und frei, mein eigenes Leben zu leben.
Ich wusste, dass man mich schuldig sprechen würde, und doch wusste ich es nicht. Ich dachte: Wenn ich mit dem Schlimmsten rechne, wird es nicht eintreffen. Jetzt erkenne ich, dass dies die vollkommen falsche Denkweise ist. Auch wenn man sich auf das Schlimmste vorbereitet, trifft es einen wie aus heiterem Himmel, wenn es wirklich passiert.
»Wir haben Beweise dafür vorgelegt, dass Sie nicht wollten, dass das passiert. Es war eher seine Entscheidung als Ihre, und wir haben Ihre Geistesverfassung und auch seine dargelegt. Die Geschworenen müssen Ihre Geistesverfassung zum fraglichen Zeitpunkt berücksichtigen«, sagte Robert zu mir, während er an seiner Diät-Cola nippte und meine Tochter anstarrte.
Ich wollte wirklich nicht, dass es passierte, oder vielleicht wollte ich es doch. Ich habe keine Ahnung mehr. Roberts Plädoyer klang wirklich plausibel, und nachdem er fertig war, wusste ich, dass er die Situation perfekt dargelegt hatte. Aber je länger wir darauf warteten, dass die Geschworenen zurückkamen, desto unsicherer wurde ich. Ich hatte den Eindruck, dass die zwölf Geschworenen nicht nur tief in meine Seele geblickt, sondern auch jede Lüge enttarnt hatten, die ich mir vielleicht selbst erzählt hatte. Ich weiß, dass es dumm war, den Geschworenen solch eine Allwissenheit zuzuschreiben, aber schließlich lag mein Leben in ihren Händen.
Seit jener schrecklichen Nacht befand ich mich in diesem Zustand der Ungewissheit. Ich fuhr aus unruhigem Schlaf hoch, überzeugt, dass ich ein Opfer der Umstände gewesen war, und einige Stunden später rügte ich mich selbst und erklärte mich zur Mörderin. Mörderin? Meine Gedanken bewegten sich hin und her und immerzu im Kreis. Ich war erschöpft.
Letztlich ließen wir das Essen stehen und gingen zurück in Roberts Büro. »Sie werden mich verurteilen«, sagte ich zu Eric.
»Rose, du bist fünfundfünfzig Jahre alt. Niemand wird dich wegen dieses Verbrechens verurteilen. Robert hat den Geschworenen die mildernden Umstände erklärt. Ich bin überzeugt, dass sie richtig entscheiden werden.«
Nun ja, es kam anders.
Wenn Eric und Robert ihre Berufung nicht durchbringen, muss ich eine Gefängnisstrafe von mindestens drei Jahren absitzen. Die Journalistin einer Boulevardzeitung hat einen langen Artikel darüber geschrieben, wie unfair mein kurzes Strafmaß sei. Portia hat mir davon erzählt, als ich sie anrufen durfte. Die Journalistin machte den »Prominentenkult« dafür verantwortlich. Ich würde sie gern einladen, hier einen einzigen Tag zu verbringen, dann können wir darüber diskutieren, wie kurz drei Jahre sind.
Ich dachte, dieser Ort wäre richtig übel, aber so wie Portia es vorhergesagt hat, herrscht nur die minimale Sicherheitsstufe. Anscheinend wurden im Hintergrund viele Fäden gezogen, damit ich hierherkomme.
Das Strafmaß wurde einen Monat nach der Verurteilung verkündet. Das war in dem Moment zu früh und gleichzeitig doch nicht früh genug. Ich wollte es schnell hinter mich bringen, aber ich hatte auch fürchterliche Angst vor der Höhe des Strafmaßes, während ich mich damit marterte, mir das Leben im Gefängnis vorzustellen. Portia zog bei mir ein, während ich wartete.
Robert ließ die Mädchen vor Gericht für mich aussagen. Patricia kam und auch ein paar andere alte Freunde, obwohl ich von den meisten seit Monaten nichts gehört hatte. Ich war dankbar für ihr Erscheinen, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie im Grunde nur Gesprächsstoff für ihre Plaudereien beim Abendessen sammelten. Ich versuchte, gelassen zu wirken. Ich lächelte sogar Joan an, von der ich in den vergangenen zwölf Monaten nichts gehört hatte.
Den Richter rührten die glühenden Worte zu meinen Gunsten nicht. Er schickte mich trotzdem ins Gefängnis. Es stellte sich heraus, dass Robert und Eric diese Möglichkeit bereits bedacht hatten. »Wir werden so schnell wie möglich Berufung einlegen«, sagte Eric.
Sobald der Prozess zu Ende war, zog sich die Presse etwas zurück, wenn auch nur wenig. Portia und ich verbrachten viel Zeit damit, Wein zu trinken und alte Filme zu schauen. Wir sprachen nicht über Simon. Wenn ich nachts allein im Bett lag, quälten mich unzählige Sorgen. Ich schlief nicht viel in diesen Tagen.
»Ich habe das Gefühl, dass ich dich im Stich gelassen habe«, sagte Eric, kurz bevor ich abgeführt wurde, um auf den Transport zu meinem neuen »Zuhause« für die nächsten drei Jahre zu warten.
»Robert hatte die Verantwortung, und er hat sein Bestes getan«, sagte ich. »Mit so einem Ergebnis konnte keiner von euch rechnen.« Meine Stimme klang selbst in meinen eigenen Ohren flach und gefühllos. Anscheinend hatte ich überhaupt keine Energie mehr.
»Wir holen dich so schnell wie möglich aus dem Gefängnis, Rose. Ich werde nicht ruhen, bis du frei bist.«
»Du musst dich ausruhen«, erwiderte ich. »Patricia wird mir böse sein, wenn du dich nicht ausruhst.«
»Es wird erträglich sein. Da, wo du hinkommst, wird es erträglich sein.«
»Woher willst du das wissen?«
Eric schenkte mir ein kurzes Lächeln und tätschelte beruhigend meine Hand. Dann spürte ich die Hand eines Polizisten auf meinem Rücken, der mich zur Tür am anderen Ende des Gerichtssaals schob – weg von Robert und Eric, weg von meinen Töchtern.
Und jetzt bin ich hier. Ich glaube, dass Eric und Robert sogar schon vor Beginn des Prozesses an diesen Ort gedacht hatten. Ich nehme an, sie werden dafür bezahlt, an alle Eventualitäten zu denken. Es sieht wie ein sehr einfaches Spa aus, aber es ist definitiv ein Gefängnis. Es besteht aus einer Ansammlung kleiner Gebäude, die sich auf einem sehr großen Gelände verteilen. Es gibt auch einen Zaun, aber er ist nur aus Draht, und das Tor steht Tag und Nacht weit offen, als wolle es beweisen, dass niemand je von hier fortlaufen möchte. Vielleicht liegt das auch an dem umliegenden Dickicht, das sich bis zu den Bergen erstreckt, ohne dass noch ein einziges Haus zu sehen ist. »Wo würdest du schon hingehen?«, scheint das Tor zu fragen. Die Luft fühlt sich klarer und kälter an, als ob sie direkt von der Bergkette herüberweht. Die Fahrt hierher hat nur ein paar Stunden gedauert, sodass Portia und Rosalind mich besuchen kommen können, wenn sie dürfen.
Als ich ankam, haben sie mir all meine Kleidung weggenommen, und ich musste mir in einem Raum voller alter Sachen etwas zum Anziehen aussuchen. Die Wahl beschränkte sich auf Jogginghosen und Flanellhemden. Als ich mich wieder angezogen hatte, sah ich aus wie eine Stadtstreicherin. Die Sachen waren mir viel zu groß. In den Wochen des Wartens auf mein weiteres Schicksal konnte ich kaum etwas essen.
»Die Kleidung soll rein funktional sein«, erklärte mir Sergeant Rossini.
»Diese Sachen sind auf jeden Fall funktional«, sagte ich, und dann musste ich mir auf die Lippe beißen. Ich wollte nicht vor ihr in Tränen ausbrechen. Die Vorstellung, mich vor Hunderten von Frauen auszuziehen, hatte mich entsetzt, aber seltsamerweise war es noch demütigender, sich vor einer einzigen Frau zu entkleiden. Dann musste ich überall abgetastet werden. Ich glaube nicht, dass ich diese Erfahrung je vergessen werde.
»Sie können Natalie zu mir sagen«, bemerkte Sergeant Rossini. »Wir wollen, dass es hier ein bisschen lockerer zugeht.«
Natalie trug eine Uniform, aber ihr dunkles Haar fiel ihr offen über den Rücken. Während sie mit mir sprach, drehte sie es zu einem Knoten, und ich sah ihren langen Hals. Sie ist ziemlich hübsch mit ihrer olivfarbenen Haut und den dunklen Augen. Sie nahm meine Kleidung und meinen Schmuck, trug alles sorgfältig in ein Buch ein und packte es dann weg. »Sie bekommen die Sachen wieder, wenn Sie uns verlassen.«
»Kann ich vielleicht meinen Ehering behalten? Es ist ein schlichter Goldring.«
»Tut mir leid, nein. Wir möchten sichergehen, dass alle Frauen hier in etwa die gleichen Sachen haben. Wir wollen nicht, dass irgendjemand schikaniert wird, weil er schöne Dinge hat, oder sich schämt, weil er nichts hat. Wir wollen auch nicht, dass etwas gestohlen wird. Wenn alle hier gleich aussehen und das Gleiche haben, wird das Zusammenleben sehr viel leichter.«
Ich fand es immer schwieriger, die Tränen zurückzuhalten. Ich trage meinen Ehering schon seit fast vierzig Jahren. Ich habe ihn noch nie abgelegt. Selbst als ich schwanger war und meine Hände anschwollen, behielt ich ihn an.
»Jetzt«, sagte Natalie, »bringe ich Sie zu Ihrer Unterkunft. Sie sind in Haus vier, das Sie mit drei anderen Frauen teilen. Die Leute hier kommen und gehen, die Bewohner der Einheiten wechseln schnell. Wenn Sie also mit jemandem nicht zurechtkommen, dann regen Sie sich nicht auf. Das lohnt sich nicht.«
»Ich werde nicht so bald wieder gehen«, erwiderte ich.
»Hm«, machte Natalie nur und gab mir keine Möglichkeit, sie in ein Gespräch zu verwickeln. »Sie müssen selbst kochen und sauber machen. Jeder bekommt zehn Dollar am Tag, davon müssen Sie Nahrungsmittel kaufen und alles, was Sie sonst noch brauchen. Wenn Sie sich in ein paar Monaten unser Vertrauen erworben haben, können Sie in dem Altenheim arbeiten, mit dem wir eine Abmachung haben, oder auch in einem der anderen Jobs draußen, und auf diese Weise Geld verdienen.«
Ich muss völlig geschockt ausgesehen haben, denn Natalie lächelte mich an und klopfte mir auf die Schulter. »Machen Sie sich keine Sorgen, Mrs Winslow. Sie werden sich schnell an alles gewöhnen. Es ist wirklich nicht so schrecklich hier.«
Einen flüchtigen Moment lang dachte ich daran, meiner Verzweiflung nachzugeben. Obwohl ich in einem Gefängnis war, hatte ich das Gefühl, bei Natalie sicher zu sein, wenn ich einfach auf den Boden sinken und aufhören würde, stark zu wirken. Stattdessen atmete ich tief durch und schluckte schwer.
Natalie drehte sich um, und ich folgte ihr aus dem Hauptgebäude auf das Gefängnisgelände. »Das sieht wirklich nicht wie ein Gefängnis aus«, sagte ich.
»Ja, das stimmt. Wir wollen nicht, dass es wie ein Gefängnis aussieht, aber da es eines ist, gibt es Regeln. Es wird Ihnen Ihre Zeit hier sehr erleichtern, wenn Sie die schnell lernen.«
»Ja«, erwiderte ich, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte.
Ich stolperte mit meinem dünnen Gefängnishandtuch, Bettlaken und einer Decke auf dem Arm hinter ihr her und zwang mich, nicht darüber nachzudenken, wie viele Stunden drei Jahre an diesem Ort bedeuteten.
»Wir kontrollieren ungefähr fünfmal am Tag die Anwesenheit«, erklärte Natalie. »Entweder gibt es eine Ankündigung über Lautsprecher, oder eine Sirene ertönt. Sie müssen dann das, was Sie gerade tun, unterbrechen und sich zu einem der Treffpunkte begeben, bis Ihr Name auf einer Liste abgehakt wurde.«
»Ach du liebe Güte«, sagte ich und wusste, dass das lächerlich klang. Schließlich war mir nicht einfach nur die Milch für den Tee ausgegangen.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Mrs Winslow, Sie werden sich daran gewöhnen. Das verspreche ich Ihnen«, sagte Natalie noch einmal.
Ich glaube, ich hätte sie bitten sollen, mich Rose zu nennen, aber im Augenblick bin ich mit Mrs Winslow glücklicher. Ich trage meinen Ehering nicht mehr. Woher soll man sonst wissen, dass ich … verheiratet bin … verheiratet war?
»Sie haben jetzt etwas Zeit, sich einzurichten. Dann komme ich wieder und bringe Sie zu Allison. Sie ist die Gefängnisdirektorin.«
Überall auf dem Gelände stehen kleine Fertighäuser. Das sind die Wohneinheiten. Jedes Haus hat Platz für bis zu fünf Frauen, meistens sind es aber nur vier. Das Bad wird geteilt, aber ich habe mein eigenes Schlafzimmer. Es ist sehr klein, so als ob man ein normales Zimmer geteilt hätte. Aber es gibt einen Schreibtisch. Den habe ich mit einigen kostbaren Andenken an zu Hause geschmückt, die Natalie mir gelassen hat. Ich habe lauter falsche Dinge mit hierhergebracht.
Die meisten meiner Sachen sind jetzt weggeschlossen. Man sollte eine Liste bekommen, auf der steht, was man mitbringen darf und was nicht, aber das hier ist wohl keine Klassenfahrt.
Man hat mir erlaubt, Fotos von Portia und Rosalind, von Lottie, Sam und Jack zu behalten. Natürlich habe ich auch ein Foto von Simon. Meine Lieblingsbücher stehen hier und meine Gesichtscreme, aber mein Parfüm durfte ich nicht mitnehmen. »Zu teuer«, sagte Sergeant Rossini, also Natalie.
Die drei Frauen, mit denen ich die Unterkunft teile, waren bei der Arbeit, als ich ankam. Ich war froh, dass ich ungestört auspacken und weinen konnte. Ich weiß bereits, dass ich nicht viel Privatsphäre haben werde. Ich dachte, ich hätte genug geweint in den letzten Monaten, aber anscheinend war das nicht der Fall.
Eine halbe Stunde später kam Natalie mich abholen. Ich wartete im Büro auf Allison und versuchte, mich unter Kontrolle zu bekommen. Es war nicht so, dass ich niemals in einer winzigen Wohnung gelebt hatte oder mit faktisch keinem Cent zurechtkommen musste. Ich hatte das alles schon durchgestanden, und ich sagte mir, dass ich es wieder durchstehen könnte.
Ich schloss die Augen und versuchte mich an die erste Wohnung zu erinnern, die Simon und ich gemietet hatten. Ich war so jung, ich fühlte mich überhaupt nicht wie eine verheiratete Frau. Es kam mir vor wie ein Spiel. Der Vermieter wohnte im Erdgeschoss in seiner eigenen Dreizimmerwohnung. »Eine Rose für Rose«, sagte er jeden Freitag zu mir, wenn ich an seiner Tür vorbei nach draußen ging, um Einkäufe zu erledigen. Dann überreichte er mir eine einzelne rote Rose. Er wartete auf mich, da bin ich sicher. Ich fand ihn sehr reizend.
»Ich mag es nicht, wenn er dich so lüstern ansieht«, sagte Simon, als ich ihm davon erzählte.
»Simon, er ist mindestens hundert Jahre alt. Er ist nur nett zu mir.« Wenn ich jetzt daran zurückdenke, wird mir klar, dass der Mann nicht älter als sechzig gewesen sein kann.
Ich versuchte, mich an die Farbe des Wohnzimmerteppichs unserer alten Wohnung zu erinnern – entweder gelb oder grün –, als eine telefonierende Frau den Raum betrat. »Das ist in Ordnung, ja, ja«, sagte sie ungeduldig. Sie legte das Telefon auf den Schreibtisch vor mir, und ich sah mich gezwungen aufzustehen.
»Ich bin Allison«, sagte sie und streckte die Hand aus. Als ich ihre Hand schüttelte, fühlte ich mich absurderweise wie bei einem Geschäftstermin.
»Setzen Sie sich«, sagte sie und sank auf einen Stuhl auf der anderen Seite des Schreibtischs. Ich setzte mich.
»Also, Mrs Winslow«, sagte sie. »Haben Sie sich schon eingewöhnt?«
»Soweit das möglich ist, ja.«
»Die ersten Wochen werden schwer sein, aber ich weiß, dass Sie das schaffen.«
»Ich wünschte, ich könnte das auch sagen«, sagte ich.
Vernünftigerweise ignorierte Allison meinen Unmut. »Wo möchten Sie gern den Tag verbringen? Sie haben es wahrscheinlich schon bemerkt, wir sind eine Landwirtschaft mit Vieh und Gemüseanbau.«
Ich hatte das bereits bemerkt. Der Geruch nach Jauche verpestete die Luft. Selbst in Allisons Büro konnte ich in der Ferne die Kühe hören. Ich glaube, das nennt man muhen. Simon und ich sind einmal übers Wochenende mit den Mädchen auf den Bauernhof gefahren, wo sie begeistert Kühe melkten und Eier sammelten. Rosalind versuchte uns zu überreden, ein neugeborenes Lämmchen als Haustier mit nach Hause zu nehmen. Simon hasste den Bauernhof. »Dieser Gestank ist einfach zu viel für mich, Liebling.« Er verbrachte fast das ganze Wochenende in unserem Häuschen mit Lesen. Die Ferienhäuser waren als Luxus-Unterkünfte beschrieben worden, aber der »Luxus« stand in diesem Fall einzig und allein für Sauberkeit. Sie sahen nicht anders aus als die Häuser hier.
»Nun ja, ich denke, im Garten könnte ich mich nützlich machen«, sagte ich überrascht. »Ich habe nicht erwartet, mir etwas aussuchen zu können.«