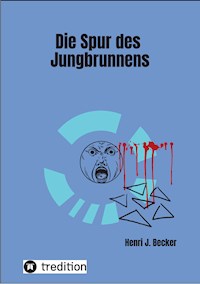9,99 €
Mehr erfahren.
Hanna und Alex. In ihrem jungen Leben wollen sie ihre Träume und Ideale verwirklichen. Ohne es zu ahnen, verstricken sie sich dabei in ein kriminelles Geflecht. Spannung, Romantik, Einblicke und Einsichten und das alles im Rahmen einer Handlung, die die beiden jungen Leute vor harte Entscheidungen stellt und sie in ironisch schicksalhafter und tragischer Weise an Verbrechen teilhaben lässt, obwohl sie sich in ihrem Leben dem Guten verschrieben haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
© 2022 Henri J. Becker
ISBN Softcover:
978-3-347-52511-5
ISBN Hardcover:
978-3-347-52515-3
ISBN E-Book:
978-3-347-52517-7
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschlieβlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Henri J. Becker
Das finstere Herz des Jungbrunnens
Erster Teil
1
Als ich in Mülheim die Brücke über die Mosel auf meinem Fahrrad zügig überquerte, schwebte noch leichter Nebel über dem Fluss und im Tal. Hinter mir lag die Kindheit, die Jugend vor mir. Am frühen Morgen war ich von Veldenz aus durch verträumte Wiesen losgefahren. Der Ort liegt landeinwärts etwa zwei Kilometer südlich von der Mosel, idyllisch am Fuße der ersten Bergzüge und Wälder des Hunsrück. In dem kleinen Dorf hatte ich bei meiner Oma mütterlicherseits gerade drei Wochen meiner diesjährigen Sommerferien genossen. Der Fünfzehnjährige freute sich über die bestandene mittlere Reife. Ich war wissbegierig, ja geradezu von einer philosophischen Neugier, die Welt zu begreifen und zu verstehen. Auch deshalb sah ich dem kommenden Schuljahr mit ausgeprägtem Interesse entgegen, gewillt, meine Lernaufgabe an unserem Gymnasium sorgfältig anzugehen. In der Welt herrschten trotz aller Spannungen und Konflikte Aufbruchstimmung und Optimismus. Menschen waren voriges Jahr erstmals auf dem Mond gelandet, nicht wenige sahen die Fahrzeuge in unseren Städten schon in naher Zukunft auf Magnetbahnen dahinschweben und viele glaubten, dass man manch schwere Formen von Krankheit schon in wenigen Jahren besiegen würde. Noch befeuert von einem solchen Zeitgeist, sah ich mich aber ohnehin in meinem zukünftigen Leben auf der Seite derer, die für die Menschen ein besseres Leben anstrebten. Am verabscheuungswürdigsten erschien mir ein Lebensentwurf als Verbrecherlaufbahn. Die Jugend, in mir, ließ mich mit Idealismus und Tatendrang erwartungsvoll in die Weite einer Welt voller Erlebnisse, Abenteuer und zu erringender Siege blicken, zu erringender Siege über Krankheit und Alter, über verbrecherische Gewalt, über Naturkatastrophen, über wirtschaftliche Not. Ich radelte an dem prachtvollen Schloss Lieser vorbei und folgte – immer der Mosel entlang ‒ dem Weg nach dem kleinen romantischen Moselstädtchen Bernkastel-Kues. Eine vollkommene Ruhe umgab mich. Vor mir niemand, der mir entgegenkam, hinter mir nichts, das sich näherte. Immer mal wieder lenkte ich in meiner Fahrspur in lang geschwungener Linie mein Rad spielerisch von einer Seite auf die jeweils andere, genoss Bewegung, Raum, wohltuende Freiheit. Im Stadtteil Kues glitt ich am Nikolausufer und in der Saarallee an schmuckem Fachwerk und aus Schieferstein erbauten repräsentativ-herrschaftlichen, bewundernswert schönen Häusern entlang , drehte an der Mündungskreuzung der Moselbrücke nach links und erreichte etwa hundert Meter weiter mein Ziel: den Bahnhof Kues. Er fungierte damals als Kopfbahnhof der Abbiegerstrecke Wengerohr - Platten - Siebenborn - Maring - Lieser - BernkastelKues, die diese Ortschaften an die Hauptzuglinie Koblenz-Trier anschloss. Ende der Achtzigerjahre wurde der Schienenverkehr auf der Zweigstrecke Wengerohr - Kues ganz eingestellt. Die Leute nutzten mehr und mehr Pkw und Lastkraftwagen und selbst manche von denen, die mit dem kleinen Bahnverkehr aufgewachsen waren und heimlich Bedauern über das Schließen dieser Bahnverbindung empfanden oder gefühlsbetont zum Ausdruck brachten, mussten einräumen, dass sie selber immer weniger die Bahn als Verkehrsmittel in Anspruch nahmen. Die Trasse ist heute Teil des Maare-Mosel-Radweges. Das im frühen 20. Jahrhundert aus Schieferbruchstein errichtete Bahnhofsgebäude beherbergte nach der Stilllegung der Strecke später unter anderem auch ein Restaurant mit eigenem gebrauten Bier, ein angrenzendes Gütergebäude wurde restauriert und multifunktional genutzt. Hier am Bahnhof Kues wollte ich mein vorletzte Woche in Mülheim gekauftes, neues Fahrrad aufgeben, um es mit der Bahn nach Luxemburg transportieren zu lassen. Meine eigene Abreise war für den nächsten Tag angesetzt.
2
Sie gefiel mir, sehr sogar. Das blonde Mädchen hatte ihr Gespräch mit dem Mann in der Gepäckannahme unterbrochen, als sie bemerkte, dass ich näher trat, und war mit einladender Geste und einem kleinen Lächeln, bei einem «Danke schön» meinerseits, zwei drei Schritte zur Seite getreten. Der kurze Blick, den ich beim Herannahen auf sie hatte werfen können, schien eine makellos reine Haut zu offenbaren, auf die der Sommer eine leichte, angenehme Bräune gebracht hatte. Unter ihrer Bluse und dem eng anliegenden, bis kurz oberhalb der Knie reichenden Rock hatte sich ein wohlproportionierter Körper abgezeichnet, der kräftig, weiblich üppig, aber ohne jeden Anflug von Übergewicht war. Die Begegnung hatte mich überrascht und ich fühlte mich innerlich abgelenkt bei der Abwicklung der Formalitäten für mein Fahrrad. Ich verspürte den Drang, irgendetwas zu ihr zu sagen, aber etwas Passendes wollte mir auf die Schnelle partout nicht einfallen. Schließlich war mein Rad abgewogen und alle Papiere ausgefüllt. Beim Abgang schickte ich noch einen kurzen freundlichen Blick zu ihr hinüber. Ich sah in ein kluges Gesicht. Ihre Augenfarbe war blau. Im Vorbeigehen fiel mir eine kleine Narbe an ihrer linken Wange auf, nichts Verunstaltendes, aber gerade sichtbar.
Draußen empfand ich mich als Versager. Wie konnte es sein, dass ich nichts zu ihr gesagt hatte? Sie war ungefähr gleichaltrig mit mir. Routiniert im Ansprechen von Mädchen, mit denen ich nicht bekannt war, war ich nicht. Aber ich war auch nicht schüchtern, zurückhaltend schon. Vor allem aber – wie ich nicht zum allerersten Male an mir bemerkt hatte ‒ hemmte mich gerade dann, wenn ein Mädchen mir besonders gefiel, die Vorstellung, ich müsse etwas besonders Kluges sagen, etwas der Bedeutung der Person Angemessenes äußern, um die Bekanntschaft zu beginnen, kein Smalltalk, keine Belanglosigkeiten. Damit ging mir die für solche Situationen nötige Leichtigkeit und Lockerheit verloren. Das eventuell noch Gesagte wirkte verkrampft, nicht mehr unbefangen. Auch sind ja Anfänge besondere Momente. Man erinnert sich besonders gut an sie: der erste Schultag, der erste Arbeitstag, der Lehrer an seine erste Klasse, der Arzt an seinen ersten Patienten, der Geschäftsmann an seine ersten Kunden, der Anwalt an seinen ersten Prozess, der Richter an seinen ersten Fall. Und es gibt eine ganze philosophische Literatur über das Phänomen des Anfangs. Aber all das konnte jetzt kein Trost für mich sein, entschuldigte meine Schwäche nicht. Und auch nicht der Gedanke, dass ich bei ihr bei näherem Kennenlernen eventuell auf unangenehme Überraschungen stoßen könnte. Ich steuerte auf die Moselbrücke zu. Der Diensthabende, mit dem sie sich unterhalten hatte, mochte ein Bekannter gewesen sein, vielleicht hatte sie einen Ferienjob am Bahnhof, vielleicht war der Mann sogar verwandt mit ihr. Ich hatte den Fluss fast ganz überquert, als in meiner Gehrichtung ein Fahrrad an mir vorbeisauste. Es war das Mädchen! Es betätigte an der Brückenmündung die Rücktrittbremse, drosselte die Geschwindigkeit ein wenig und verschwand dann geradewegs in der Altstadt von Bernkastel.
Ich eilte, hastete hinterher. Vielleicht ließ sich das Verpasste nachholen oder ein Anhaltspunkt gewinnen, um es schon bald nachzuholen! Vorbei an dem nahe der Brücke sich eindrucksvoll erhebenden, aus unverputztem Bruchstein erbauten und an einen Wehrturm erinnernden hohen Turm der St. Michaeliskirche setzte ich hinterher. Für die herrliche Stadtkulisse mit ihren größtenteils aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammenden Fachwerkhäusern, dem Marktplatz mit dem zauberhaften Michaelisbrunnen, dem noch im Mittelalter erbauten schiefen, zerbrechlich wirkenden Spitzhäuschen, das auf einem viel zu kleinen Sockel um Gleichgewicht zu ringen schien, dem Renaissance-Rathaus , den malerischen Gassen und Plätzen, die sich an die Altstadtmitte anschlossen, für all das hatte ich diesmal nur wenig Aufmerksamkeit. Überall hielt ich Ausschau nach einem Fahrrad mit blauem Rahmen, wagte mich manchmal in Eingangsbereiche, blickte sogar dreimal mit Herzklopfen hinter halb geöffnete Scheunen- und Haustüren. Vergeblich! Schβßlich gelangte ich wieder an die Mosel. Die Bauten aus Stein und von repräsentativer Schönheit, die hier auf den Fluss blickten und dem märchenhaften Charme der Altstadt ein mondänes Flair hinzufügten, sahen mich ratlos an. Abgespannt, desillusioniert, enttäuscht, müde beschloss ich abzubrechen. Vielleicht hatte sie Bernkastel bereits wieder verlassen. Vielleicht war sie zu einer Freundin in Bernkastel geradelt und beide waren zu einer Fahrradtour aufgebrochen. Vielleicht … Einen Augenblick überlegte ich dann noch, zum Bahnhof zurückzukehren und dem Herrn in der Gepäckannahme bei irgendeiner fingierten Suche um Auskunft, Informationen über seine Gesprächspartnerin zu entlocken. Aber es erschien mir sinnlos: Der Mann konnte sich denken, warum ich mehr wissen wollte und Fremden gegenüber gibt man keine sehr persönlichen Dinge preis. Ich hätte noch nicht einmal vortäuschen können, sie hätte Geld verloren, hatte ich doch selber nur noch ein paar Groschen dabei.
Ich trottete Richtung Stadtrand. Gegen Ende der Ausfallstraße nach Andel probierte ich, mitfahren zu dürfen, per Anhalter. Das war damals insbesondere bei jungen Leuten nichts Ungewöhnliches. Längst nicht alle Haushalte besaßen ein Auto oder gar mehrere, eventuelle Busverbindungen waren über den Tag spärlich verteilt. Ein fünfzehnjähriger Junge, der am Straßenrand Autofahrer um Mitfahrt bat, erweckte wenig Misstrauen. In den Dörfern steckte der Tourismus, der "Fremdenverkehr", noch in den Anfängen. Manche Bewohner der Moselgegend fühlten sich so sicher, dass sie immer noch nicht einmal nachts ihre Haustür zusperrten. Und die Anhalter selber, meist jüngere Leute, sahen im Allgemeinen in dieser Art des Sichbefördernlassens ein hinnehmbares Risiko.
Anfang der 70er gab es in dieser Gegend noch wenig Fahrzeugverkehr. Einige Autos fuhren an mir vorbei. Aber nach einer Weile steuerte jemand an mich heran. Ich öffnete die Beifahrertür. Es war ein Herr in mittleren Jahren.
„Fahren Sie vielleicht nach Mülheim?”, erkundigte ich mich höflich.
‒ „ Das liegt auf meinem Weg, steig ein Junge!”, erwiderte der Mann.
Es war, wie sich im Gespräch herausstellte, ein Winzer aus Piesport. In Mülheim konnte ich bei dem kleinen Spielzeug- und Zeitungsladen neben der Apotheke aussteigen. Ich bedankte mich fürs Mitnehmen und sagte „Auf Wiedersehn!"
Über die Veldenzer Straße verließ ich Mülheim. Der eher schmale Weg nach Veldenz zog sich durch ein breites malerisches von Weinbau, Wiesen, Obstbäumen und Feldern geprägtes Tal, durch das der, von Bäumen und Büschen umsäumt, Veldenzer Bach floss. Die Straße wurde später breit ausgebaut und verlockt seither immer wieder Leute hier zu schnell zu fahren, besonders im Bereich einer bestimmten Kurve. An ihr kommt der Bach nahe an die Straße heran und wenn die Pflanzen an ihm hoch genug sind, ist diese Kurve nur mehr wenig einsehbar. Ich legte den restlichen Weg nach Hause zu Fuß zurück. Nicht zum ersten Mal. Wenn wir auf unserer Reise zu meinen Großeltern in Lieser den Schienenbus verlassen hatten, brachte uns die nicht weit entfernte Fähre über den Fluss und von da an ging es samt Gepäck meist zu Fuß weiter. Abgesehen davon, dass eine Taxifahrt für einen Arbeitergeldbeutel auch schon ein bisschen Luxus war, gab es in den Dörfern nur selten Taxifahrer und wenn, dann nebenberuflich und daher auch nicht unbedingt sofort fahrbereit. Zudem konnte die Erreichbarkeit schwierig sein. Viele Telefonanschlüsse gab es in einer Ortschaft nicht. Wer telefonieren wollte, musste normalerweise erst mal zum Postamt, und wer eine Nachricht per Anruf erhielt, bekam diese mitgeteilt von einem guten Nachbarn, der den Anruf mit seinem Fernsprecher überhaupt hatte entgegennehmen können. Nach dem Bau der Moselbrücke war der Fährverkehr im April 1968 eingestellt worden. Viele Male hatten meine Eltern und ich, ab und zu ausruhend, schwere Koffer und Taschen die Landstraße hinauf zum Dorf meiner Großeltern geschleppt. Die Koffer hatten damals noch keine Räder. Zwar gab es schon im 19. Jahrhundert vereinzelt Rollkoffer, aber ihre große Zeit kam erst in den Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts, als man auf genügend Straßen zählen konnte, die nicht mehr holprig und schlammig waren. Selten fuhr ein Auto an uns vorbei. Und es kam vor, dass wir Glück hatten und der Fahrer eines Wagens stehen blieb und anbot, uns mitzunehmen.
Die Begegnung mit dem Mädchen, wie dieser ganze Morgen überhaupt, kamen mir immer mal wieder in Erinnerung, ich dachte manchmal an sie zurück und einige Male träumte ich sogar davon. Sie blieben mir im Gedächtnis.
3
Nach dem Abitur studierte ich Philosophie, Literatur- und Sprachwissenschaft, zunächst ein Jahr in Luxemburg, danach 3 Semester in Trier. Und dann wollte ich mal etwas anderes sehen, eine für mich ganz neue Region kennenlernen und wechselte nach Heidelberg. Nicht zufällig. Ich bevorzugte Städte, wo der Weg ins Grüne nicht weit war und die zugleich historisch-romantisches Flair hatten. Zudem zogen ein sehr umfangreiches Angebot an Studienfächern und der gute Ruf der Universität viele Tausende junge Menschen an. Ich freute mich auf einen Neubeginn, darauf, mir einen neuen Bekannten- und Freundeskreis zu schaffen, mochte man sich am Anfang in der noch fremden Stadt auch manchmal etwas einsam fühlen. Ich hatte durch Zufall im Schlosswolfsbrunnenweg ein Zimmer in einer stattlichen, aus rotem Sandstein erbauten Villa oberhalb des Schlossparks mieten können. Der steile Aufstieg zu Fuß zu meiner Straße, manchmal mehrmals am Tag und oft auch nachts, wäre wohl manchem zu beschwerlich gewesen. Mir aber gefiel meine Wohnlage. Oft unternahm ich längere Spaziergänge in den Wäldern oberhalb des Schlosses. Eines Tages, auf einem dieser Streifzüge, es dunkelte bereits, erblickte ich in der Rheinebene eine viele Kilometer lange Lichterkette sich schlängeln. Es war in meinem Leben das erste Mal, dass eine Kolonne, eine Schlange von Fahrzeugen, die ununterbrochen von einer Ortschaft zu einer anderen reichte, mir vor die Augen kam. – Ich war kein Student, der sich ausschließlich mit seinen von ihm gewählten Fächern beschäftigte. Wenn mich eine Frage, ein Thema ganz besonders interessierte, kam es durchaus vor, dass ich nach Maßgabe meiner Vorkenntnisse versuchte, in einer Vorlesung oder Bibliothek mehr darüber zu erfahren.
An den Universitäten wurde in den Siebzigern insbesondere im Rahmen der Kapitalismus-Sozialismus-Systemkonfrontation viel über Politik diskutiert, es wurde demonstriert, es wurde protestiert. Ich nahm es zur Kenntnis. Sicher war es wirtschaftlich gerechter, alle Produktionsmittel, also Betriebe, Mietshäuser und so weiter, zu verstaatlichen und damit auch die Möglichkeit abzuschaffen, sie zu vererben. Aber es schien mir auch aus der Sache heraus und ohne irgendeine ideologische Voreingenommenheit klar, dass eine Beseitigung des freien Unternehmertums zu einer weniger produktiven Wirtschaft führen würde: Wenn eine Behörde, eine Kommission, eine kleine Gruppe einfach festlegte, was produziert wurde, dann musste sich ein Produkt auch nicht mehr am Markt in freier Konkurrenz zu anderen durchsetzen und von daher gab es auch weniger Anreiz, weniger Veranlassung, eine Ware oder Dienstleistung laufend zu verbessern. Man musste sich schon entscheiden, was man hier wollte, aber man sollte sich frei entscheiden können. War man für eine Marktwirtschaft, musste der Staat natürlich den Auswüchsen des Marktes, wie zum Beispiel Hungerlöhnen bei einem Überangebot an Arbeitskräften, einen Riegel vorschieben.
Die vielen Menschen, die ich während meiner Studienjahre näher kennengelernt habe, sind noch immer in mir lebendig, das mit ihnen Erlebte und Erfahrene entfaltet weiter seine Wirkung in mir, obschon ich bis heute nur sehr wenigen von ihnen später noch einmal begegnet bin.
4
Als ich Anfang der Achtzigerjahre nach meinem Studium nach Luxemburg zurückkehrte, hatte ein aufstrebender internationaler Finanzplatz die kriselnde Stahlwirtschaft als Wirtschaftslokomotive abgelöst. Eine neue Zeit war angebrochen. Davon zeugten auch bereits einige neue imposant-repräsentative Bauten von Geldinstituten, deren Fassaden, wenn es zu dunkeln begann, in Licht erstrahlten und glitzerten, – Wahrzeichen neuer wirtschaftlicher Macht.
Ich hatte an einem Gymnasium meinen «Stage pédagogique», meine Referendarzeit, begonnen. Einmal pro Woche fanden für die Vermittlung der theoretischen Kenntnisse für alle Referendare eines Jahrgangs Lehrveranstaltungen an den «Cours Universitaires» statt. Die Universitätskurse in Luxemburg waren damals in einem alten Klostergebäude auf dem Limpertsberg in Luxemburg-Stadt untergebracht. Wenn wir aus unseren Seminarräumen nach draußen schauten, sahen wir in einen Park mit vielen schönen großen alten Bäumen. Mittagspause machten wir, meist zu mehreren, oft in einem Café.
Eines Morgens frühstückte ich in einem Café der Oberstadt. Meine Kurse begannen an diesem Tag erst später. Das war uns schon letzte Woche angekündigt worden. Einer unserer Dozenten fehlte. Es hieß, er sei zu einer Tagung. Als ich gerade einen Kaffee nachbestellen wollte, nahm ein elegant gekleideter Herr um die fünfzig am Tisch unmittelbar neben mir Platz. Die junge Bedienung kam.
„Guten Morgen, was möchten Sie trinken"?, erkundigte sie sich bei meinem neuen Nachbarn.
„Kaffee, bitte, und ein belegtes Brötchen. Was haben Sie da?"
– „Das Brötchen müssen Sie an unserer Theke vorne auswählen. Ich bringe es Ihnen dann."
– „Dürfte ich auch noch einen Kaffee haben?", fügte ich noch schnell ein, bevor die geschäftige Kellnerin sich wieder umdrehen konnte.
– „Gerne!", lächelte sie freundlich.
Der Herr begab sich zur Ladentheke im Eingangsbereich, wo auch die Kunden bedient wurden, die nur etwas zum Mitnehmen kauften. Er hatte gleich neben mir seine Jacke auf der durchgehenden Sitzbank hinterlassen und so etwas wie einen Prospekt auf seinen Tisch gelegt. Darauf zu sehen neben ein paar Beschriftungen: das Gesicht einer schönen jungen Frau. Ihre Züge schienen mir etwas zu sagen, etwas zu bedeuten, kamen mir irgendwie bekannt vor. Der Herr, er sprach übrigens Deutsch, kehrte zurück.
„Entschuldigen Sie!", wandte er sich an mich, „ich suche eine bestimmte Bank hier vor Ort, kennen Sie sich aus?"
Dabei zeigte er mir die Werbeschrift und wies auf den Namen und die Adresse eines Finanzinstitutes. Den Namen der Bank, „Bank for Development and Innovation, BDI-Bank" hatte ich noch nie gehört, vielleicht war sie neu am Platz, die Straße aber kannte ich. Da fiel mein Blick noch einmal auf die junge Frau. Als ich die winzige Narbe auf ihrer Wange sah, fing mein Puls an schneller zu schlagen. Es war das Mädchen, das Mädchen dem ich damals, vor Jahren, in Bernkastel begegnet war, als ich mein neues Fahrrad nach Luxemburg aufgab! Sie musste es sein. Das jüngere Gesicht war hinter dem leicht veränderten auf dem Prospekt urplötzlich hervorgetreten. Die ganz kleine Narbe störte nicht. Im Gegenteil, sie verlieh der Person Lebensechtheit, Authentizität und damit Glaubwürdigkeit.
Jetzt wurde ich gesprächig, versuchte aber, mir meine Aufregung nicht anmerken zu lassen. Das 'Mädchen' war ohne Zweifel das Gesicht der Bank, das Kunden anlocken und Geld einwerben sollte. Ich versuchte jetzt, so viel zu erfahren wie nur möglich.
Der Herr kam aus Traben-Trarbach an der Mosel.
„Wissen Sie", äußerte er, Geld sollte man nicht einfach nur gewinnbringend, sondern nach Möglichkeit wenigstens zum Teil auch sinnvoll anlegen!"
Dieser Aussage konnte ich in ihrer Allgemeinheit nur zustimmen.
‒ „Und das ist bei Ihrer Bank möglich?"
– „Ja, sie wirbt jedenfalls damit, dass sie Investitionen in Zukunftstechnologien und in medizinische Forschung fördert. Das kommt uns allen zugute!"
Er ließ sich nun über die Wichtigkeit und Triftigkeit von Forschung aus. Wie von mir vermutet, hatte die Bank sich tatsächlich erst seit Kurzem, wie er ausführte, am Finanzplatz angesiedelt. Er erzählte auch etwas über Investitionsfonds, in die jeweils viele Leute einzahlen könnten. Diese Fonds würden dann von Experten verwaltet. Diese Kenner des Marktes würden das Geld in Form von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren in eine Vielzahl von Unternehmen investieren. Damit würde über eine Risikostreuung auch mehr Sicherheit für die Anleger gegeben sein. Ich wusste natürlich, was ein Sparbuch war. Aber darüber hinaus hatte ich damals von Finanzprodukten so gut wie keine Ahnung. Ich wollte mehr über das Mädchen wissen.
Als er sich daher anschickte aufzubrechen, ging ich so weit, augenzwinkernd zu fragen :
„Und jetzt haben Sie einen Termin mit dieser jungen Dame?"
‒ „Leider, nein!", lachte er, „kein Rendez-vous und noch nicht einmal einen Termin, mir ist ein Herr zugeteilt worden."
‒ „Wissen die denn nicht, dass Frauen die Begabteren darin sind, die ersten Kontakte zu knüpfen?", scherzte ich weiter.
‒ „Na ja", meinte er, „nicht jedes Model ist notwendigerweise auch eine Mitarbeiterin."
‒ „Das stimmt."
5
Ich hatte weder Frau noch Kind und derzeit nicht einmal eine Freundin. Wie es bei ihr privat aussah, wusste ich nicht. Moralisch bedeutete dies, dass sie im Augenblick für mich mehr sein durfte als nur ein interessantes Studienobjekt. Zwar verfügte ich als Gymnasiallehrer über eine gewisse zeitliche Flexibilität, hielt es aber für keine gute Idee, um ihren eventuellen Arbeitsplatz herumzulauern. Ein solches Vorgehen konnte schnell sehr zeitintensiv und sehr frustrierend werden, waren doch die Unwägbarkeiten zu groß dabei: Gehörte sie überhaupt zum Personal der Bank? Sie konnte gleitende Arbeitszeiten haben, sich verspäten, früher nach Hause gehen, gerade krankfeiern, Urlaub machen, bei Kunden im Außendienst sein, in einer Werbeagentur als Fotomodel tätig sein und so weiter und so fort. Ob sie noch bei ihren Eltern lebte? Ob sie eine Wohnung in Luxemburg hatte? Ob sie ein Auto fuhr? Ob dieses Auto eventuell in Luxemburg immatrikuliert war? Ob sie an Ostern oder Weihnachten ihre Eltern besuchte? Sie war Werbeträgerin, doch ob sie auch Kunden bei Geldanlagen beriet? Ob sie überhaupt über das notwendige Sach- und Fachwissen für eine seriöse Geldanlegeberaterin verfügte? Die Prospekte waren – wie auf ihnen vermerkt – von einer Werbeagentur gestaltet worden. Vielleicht ließ sich bei der auf irgendeine Weise mehr erfahren. Aber welchen Werbeauftrag sollte ich in Aussicht stellen? Doch zunächst wollte ich mich einmal in ihrem möglichen Arbeitsplatz umsehen unter dem Vorwand, einen kleinen Betrag Franken in DM umzutauschen.