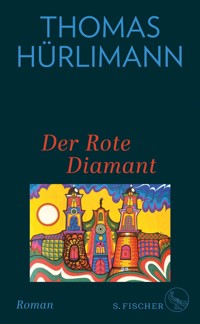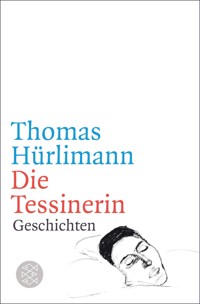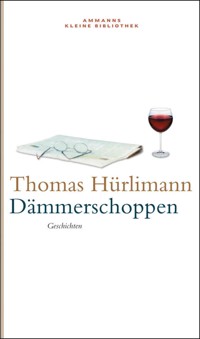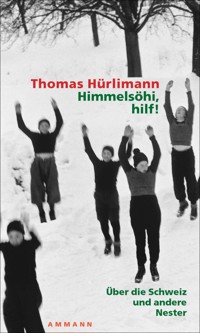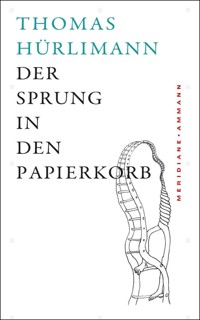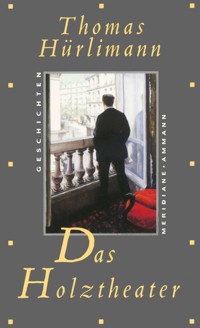8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte um Liebe, Alter und Vergänglichkeit Nach dem Tod des einzigen Sohnes beginnt ein stummer Kampf zwischen den Eltern. Der Vater hat sich einen Rosenstock für das Grab des Sohnes gewünscht, seine Frau läßt einen großen Granitfelsen setzen. Fortan begleitet er sie widerwillig auf den täglichen Gängen zum Friedhof. Als er hinter dem Grabstein eines Tages eine halbverhungerte Katze erblickt, sorgt er fortan für ihre Verpflegung. Eigensinnig verteidigt er vor seiner Frau sein Geheimnis mit immer neuen Ausreden. Als seine »Schande« eines Tages offenbar wird, gibt er die Friedhofsgänge auf, und von da an treffen sich die Eheleute im Gartenhaus, um ihren Erinnerungen an den Sohn nachzuhängen. Ein kleines Meisterwerk, so die einhellige Meinung der Kritik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Thomas Hürlimann
Das Gartenhaus
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
I
Jung war sein Sohn gestorben, noch vor der Rekrutenschule. Ein Rosenstrauch, meinte der Oberst, würde schön und bescheiden an das früh verblühte Leben erinnern. Lucienne jedoch, seine Gattin, wollte von einem Strauch nichts wissen – ein Stein mußte her, ein Granit. Er schrie, sie schluchzte. Nach langen Tagen in dumpfer Trauer konnten sie endlich wieder Wörter sagen, sie fielen sich in die Arme, sie fühlten sich schuldig, sie waren alt, und ihr Sohn, der einzige Sohn, war vor ihnen gestorben. Der Oberst bestand auf den Rosen, sie auf dem Stein. Er verhandelte mit einem Gärtner, und am selben Tag reiste Lucienne in die Berge, von Ossi Rick, dem jungen Steinmetz, geführt. Als sie, spät in der Nacht, nach Hause kam, waren ihre schwarzen Strümpfe mit Lehmspritzern besprenkelt, und der Oberst hätte schwören können, die leidgeprüfte Mutter habe unter der Dusche gesungen. Er wußte, daß er die Schlacht verloren hatte. Es war Winter, und der Boden war bis zur Sargtiefe gefroren – erst im Frühling konnte sein Strauch gepflanzt werden. Da sank er in seine Trauer zurück, in ein tagelanges Dämmern. Lucienne hielt sich in Ricks Atelier auf. Sie wolle zusehen, hatte sie erklärt, wie aus dem rohen Fels das Grabmal hervorwachse. An einem eisigen Nachmittag war es dann soweit. Der Oberst, von seiner Gattin zum Grab bestellt, traute seinen Augen nicht. Hinter der Friedhofsmauer stand ein Kran, Stimmen brüllten, plötzlich erlosch die Sonne, und wie eine freischwebende Liftkabine surrte ein Getüm über die Mauer, schwebte aufwärts, hoch und immer höher, dann kam es, von lauten Rufen dirigiert, vom Himmel herunter, ein knirschender Klang, Gesplitter von Holz, der Grabstein war auf einem Betonsockel gelandet. Drei Männer lösten die Stahlseile ab, warfen sie in die Luft, und Sekunden später schwangen sie über die Friedhofsmauer davon. Eigentlich seien Steine dieser Größe gar nicht erlaubt, erklärte ihm eine weibliche Stimme, nur aus Achtung für ihn und sein Regiment habe sie der Friedhofsverwaltung eine Ausnahmegenehmigung abgerungen.
Er sah zum Kranführer empor, er verstand kein Wort.
»Nach dem Tod«, fuhr sie lächelnd fort, »kommen wir alle in den Stein, auch ich, auch du. Aber bei dir, mon cher, stellt sich ein gewisses Problem – du brauchst mehr Platz als unser Sohn oder ich.«
Der Oberst erschrak.
»Dein Rang«, sagte sie, »dein Regiment!«
»Was bleibt davon übrig?« fragte er.
»Nichts«, sagte sie, »aber hinter deinen Namen und die Jahreszahlen werden wir auch noch deinen Rang und das Regiment setzen müssen.«
Im nahen Wald schrillte eine Motorsäge. Er starrte seine Gattin an. Mehr als eine Zeile, hatte sie noch gesagt, stehe einem Toten nicht zu. Er stopfte die Fäuste in die Taschen seines ledernen Offiziersmantels und sah, wie sich der Kranführer hoch oben aus seiner Kabine hangelte. Aber seltsam – nicht der waghalsige Himmelsturner, sondern er, der doch mit beiden Füßen fest auf der Graberde stand, wurde plötzlich vom Schwindel gepackt. Um eine fahle Sonnenblase herum gerieten Mann, Kran und Kabine ins Kreisen, immer schneller ins Kreisen, ins Wirbeln und Schwirren und Strudeln, eine Trauerweide wischte vorüber, dann Lucienne und wieder Lucienne und jetzt, schwer, der Schlag. Der Oberst schnaufte. Der Schwindel zog ab. Gottseidank, er war auf den Beinen geblieben. Eine unsichtbare Brandung hatte ihn auf den Granitfelsen geworfen, auf den Grabstein seines Sohnes. Wie ein Blinder fuhr er tastend über die Inschrift.
»Gute Arbeit«, sagte er heiser, »verdammt gute Arbeit.«
»Danke«, sagte Lucienne und stapfte trotz der Kälte im offenen Persianer auf den Bildhauer zu. Der stand, eine Pfeife im Mund, bei den Arbeitern. Da verließ der Oberst den Friedhof, und er ging, ohne es vorerst zu merken, in ein anderes Land hinaus, in ein neues Leben.
Wie entsteht ein Verhängnis?
Indem es seine Entstehung verbirgt. Es schleicht sich heran, es gewöhnt sich an uns, und im Augenblick, da wir seine Fratze erkennen, lacht sie uns aus. Es ist zu spät, flüstert das Verhängnis.
Nachdem das Grabmal errichtet war, verließ Lucienne jeden Nachmittag das Haus. Sie gehe zum Sohn, sagte sie, und der Oberst glaubte ihr aufs Wort. Er saß in seinem Stuhl, sah stundenlang auf den See hinaus, fern schellerten Güterzüge, die Möwen zogen ab, und die Luft wurde lau. Erst nach Einbruch der Dämmerung kehrte sie heim, lächelnd, setzte sich auf das Kanapee und zog ihre Gummistiefel aus. Unter dem Regenmantel trug die Frau eine Gärtnerschürze und auf dem Kopf, je nach Wetter, einen Strohhut oder eine durchsichtige Plastikhaube. So, dachte der Oberst, besucht man keinen Künstler. Trotzdem nagte ein Zweifel an ihm, ein leiser Verdacht. Sie roch nach Parfüm, ihre Lippen waren geschminkt, und eines Abends ging der Oberst zum Friedhof, um die Grabbepflanzung zu inspizieren. Lucienne kniete vor dem Granitfelsen, eine Kindermelodie vor sich hinsummend, und legte Blumenzwiebeln in eine Reihe ausgestochener Löcher hinein. Es sehe nach Gewitter aus, sagte der Oberst, er habe einen Schirm mitgebracht. Sie warf einen Blick über die Schulter, sah lächelnd zu ihm herauf. Da zog er sich zurück, ging um die Abdankungskapelle herum und setzte sich unter einer alten Linde auf die Parkbank. Der Friedhof stieg in breiten Terrassen hügelan, von einer hohen Mauer umfaßt. In alter Pestzeit war er angelegt worden, weitab von den Menschen, seit dem Ende des letzten Jahrhunderts jedoch hatte die Stadt zu wachsen begonnen und war ihren Toten mit Einfamilienhäusern und Wohnblöcken so nahe gekommen, daß hie und da ein Kindergeschrei über die Mauer sprang, bunt wie ein Ball. Die Abdankungskapelle war fast immer belegt, darin hatte auch sein Sohn gelegen, in einer nach Blumen und Weihrauch riechenden Kühle, die von Tag und Nacht vibrierenden Generatoren erzeugt wurde. Er spürte eine Hand auf seiner Schulter. Sie sei mit der Arbeit fertig, sagte Lucienne. Eine Weile saßen sie nebeneinander auf der Bank. Dann fielen ein paar erste, schwere Tropfen, der Oberst spannte den Schirm auf, bot ihr den Arm, und beim Ostertor ließ er seiner Gemahlin galant den Vortritt. »Age after beauty«, sagte er.
Anderntags, ohne daß sie sich abgesprochen hätten, verließen sie das Haus gemeinsam, und schon bald hatten sie sich an den Gang zum Grab wie an eine alte und liebe Regel gewöhnt. Sie waren die Eltern eines toten Sohnes. Sie hatten ihren Nachkommen überlebt, den Namensträger und Erben, der das Geschlecht hätte fortsetzen sollen in die Zukunft. Das war ein Widersinn der Natur. Dem zollte man, teils aus Trauer, teils zur Buße, mit dem täglichen Friedhofsbesuch den stillen Tribut.
Und es wurde Sommer, und der Sommer wurde heiß, und täglich um drei, zur Stunde des Karfreitags, tranken sie im Herrenzimmer ihren Tee. Dann befahl der Oberst den Abmarsch, Zielrichtung Grab, Arm in Arm gingen sie los, und von Zeit zu Zeit, wenn Lucienne es für nötig hielt, hängte sich der Oberst seine Golftasche über die Schulter, worin, anstelle der Schläger, ein Kinderrechen und eine Spitzhacke steckten. Hin und wieder war er seiner Gattin beim Gärtnern behilflich. Er ging zum Brunnen und füllte die Spritzkanne mit Wasser. Oder er kniete sich an ihrer Seite in die Blumen und jätete das Unkraut aus. Aber meist saß er auf seiner Bank, die Golftasche oder den Schirm zwischen den Knien, er dachte an dieses und an jenes, halb war er wach und halb wieder nicht. Hatte er geträumt? Der Oberst fuhr auf. Es war ein Abend im späten August. Nein, kein Traum, er hatte geschlafen, eilte jetzt zum Grab, sah zum Brunnen,
»Lucienne«, rief er, »Lucienne, wo bist du?«
Sie war nach Hause gegangen. Hilflos stand er da, vielleicht nur Sekunden, vielleicht lange, bange Minuten lang, und hinter dem Grabstein kroch behutsam ein dürres Wesen hervor, knochig, zittrig und sah ihn mit großen Augen an.
Wie entsteht ein Verhängnis?
Abends saß der Oberst allein am langen Familientisch. Hie und da hörte er aus dem oberen Stock ein leises Wimmern – die Traurigkeit seiner Frau nahm in der Dunkelheit nicht ab, sie nahm zu. Er dachte an seinen Sohn und an längst vergangene Manövertage. Er trank eine Flasche Whisky, rauchte eine Schachtel Zigaretten, er hatte Hunger und keinen Appetit. So nahm er, fast ohne es zu merken, eine alte Soldatengewohnheit wieder auf. Er steckte jeden Morgen etwas Proviant in seine Tasche und verpflegte sich, wenn der Magen nach einem Happen verlangte.
Das Tier schnappte danach und war hinter dem Granitfelsen verschwunden.
Eines Nachts besuchte ihn Lucienne in seinem Zimmer. Der Oberst lachte, und das Licht, damit sie sein Gesicht nicht erkenne, knipste er aus. Es war seit dem Tod ihres Sohnes das erste Mal, daß sie miteinander schliefen, er schnaufend, sie weinend.
Und das Tier wurde zahm, es wurde geduldig, und ließ er die Fütterung einmal ausfallen, schien nichts zu passieren. In den ersten Wochen lief alles glatt. Der Oberst zog eine Gartenschere aus der Tasche und stieg hinter den Grabstein. Er wolle der Schneckenplage Herr werden, hatte er gesagt, aber nicht mit Gift, er hasse Gift, er zwacke die Schnecken entzwei.
»Du mit deinem Schneckenspleen«, sagte Lucienne.
Sie bat ihn, das Töten in ihrer Abwesenheit zu besorgen, setzte sich auf die Bank unter der Linde oder auf den Brunnenrand, und kam eine Witwe hinzu, um ihre Vase zu füllen, bot sie lächelnd ihre Hilfe an. Da gab dann ein Wort das andere, die Witwe beschwor das Leben ihres Gatten, Lucienne das Sterben ihres Sohnes, und der Oberst, hinter dem pompösen Grabmal allen Blicken entzogen, konnte seelenruhig den Nachschub für sein Tier deponieren. Manchmal häufte er etwas Erde darüber, und schließlich grub er die tägliche Ration etwa zwei oder drei Zentimeter unter der Oberfläche in die Graberde ein. Anderntags, wenn er nachsah, war nichts mehr da, und im Lauf zweier Monate war aus der zittrigen Jammergestalt ein gut ernährtes Kätzchen geworden.
Das Fleisch und die Essensreste nahm er aus dem Kühlschrank und schmuggelte sie in seiner Kitteltasche zum Grab. Einmal Troupier – immer Troupier. Er war und blieb frontorientiert, konzentrierte seine gesamte Aufmerksamkeit nach vorn, die im rückwärtigen Bereich spielenden Kräfte jedoch, wie sich alsbald zeigen sollte, bekam er nicht in den Griff. Am Grab ging er umsichtig vor, jede seiner Handlungen bedenkend, hier war die Front, hier konnte ihn nichts überraschen. Sah er die Katze kommen, befahl er den Abmarsch.
»Gehen wir?«
»Gehen wir.«
Aber den haushälterischen Blick seiner Gattin verkannte der Oberst. Unbekümmert schnitt er vom Sonntagsbraten eine Scheibe ab, stopfte eine Wurst in die Tasche, hundert Gramm Leber, etwas vom Schinken, und eines Nachmittags steckte er von einer Portion Hackfleisch, die sie am Vormittag gekauft hatte, die Hälfte ein.
»Ißt du rohes Fleisch?« fragte Lucienne.
Der Oberst verneinte.
»Dann bescheißt uns der Metzger«, sagte sie.
Er nickte. Dem Mann, bemerkte er, habe er nie getraut, und sie beschlossen, ihre Fleisch- und Wurstwaren künftig im Supermarkt zu kaufen – er war noch einmal, wie es in der Kasernensprache heißt, aus der Bratpfanne gesprungen, aber die Lage war kritisch geworden, gefährlicher als zuvor. Denn er brauchte Fourage, und wie konnte er, hinter ihrem Rücken, die tägliche Ration requirieren?
Ich bin ein alter Mann, dachte der Oberst. Ich habe ein gewisses Recht auf schrullige Gewohnheiten. Er ging am Vormittag in die Stadt, trank einen Zweier Roten oder in der City Bar du Bœuf einen Whisky und beschaffte sich auf dem Nachhauseweg die Nahrung, die er brauchte. Seinen Offiziersmantel hängte er in die Garderobe.
»Du wirst alt«, sagte Lucienne, und sie lächelte.
Er sei, sagte der Oberst, im Supermarkt gewesen, habe Zigaretten gekauft. Dann schluckte er, und sein Schlucken hörte sich an wie ein verwürgtes Klopfen. Glänzend pariert – die Packung mit dem Katzenfutter war nur wenig größer als eine Schachtel Gitanes.
Das Zeug habe sie weggeschmissen.
Was für ein Zeug?
Oh, nichts, nichts, gurrte Lucienne, und der Oberst mußte ihr versprechen, demnächst einen Augenarzt zu konsultieren.
»Muß mich wohl vergriffen haben«, sagte er noch.
Die Tage wurden kühler, der See kochte Nebel aus, und Lucienne bat ihren Gatten, die morgendlichen Gänge aufzugeben. Er gehorchte. Er hatte im Innern des Hauses ein Fleischlager angelegt.
Der Oberst kauerte hinter dem Grabstein seines Sohnes und drückte die tägliche Ration in die feuchte, klumpige Erde hinein. Es war kühl, es war klar und immer noch hell. Lucienne arbeitete auf der Vorderseite des Granitblocks. Offenbar versuchte sie, mit einer Seifenlauge die eingemeißelten Buchstaben sauberzubürsten; ein Hauch von Grünspan hatte den Namen verschattet. So rasch, dachte der Oberst, begann die Verwitterung. Vor einem halben Jahr war das Getüm vom Himmel herabgeschwebt, und glaubt man unseren Totengräbern, so braucht eine Leiche neun Monate, um alles Vergängliche vergehen zu lassen; diese Zeit war vorbei.
»Kommst du voran, Liebes?«
Sie schrubbte vergeblich, er wußte es. Der leise Zerfall war stärker als Lucienne und ihre Laugen.
Sie sei jetzt an der Neun, rief Lucienne. Das war die Neun des Jahrhunderts. Was bleibt von uns übrig, ein Name, eine Zahl und unter der Erde die Knochen. Er war in den Bergen aufgewachsen. Dort hatten sie die alten Gebeine, die sie aus den Gräbern holten, zu Mehl gemahlen; damit war der Sonntagskaffee gewürzt worden, und ging es ans Sterben, war das Knochenpulver die letzte Medizin. Er lauschte auf das regelmäßige Reibgeräusch ihrer Bürste, er hörte ihr Schnaufen – zwischen ihnen stand der Grabstein, der sie voreinander verbarg. Ob sie da unten, unter diesem Sockel, aufhören würden, voreinander zu fremden? Lucienne war die Tochter eines Textilfabrikanten, eine Mehrbessere, und er war aus den Bergen herabgestiegen, ein ganzes Menschenalter war es her, eine lange Zeit. Heimweh? Er hatte sich gegen die Steingröße gewehrt, aber nun, wie so oft in seinem Leben, wurde er für die erlittene Niederlage auf wunderbare Weise entschädigt. Dieser Felsen, den sie gegen seinen Befehl errichtet hatte, bot ihm den Schutz, den er brauchte. Hier, zwischen der Rückseite des Grabmales und der Friedhofsmauer, konnte er seine Pflicht ungestört erfüllen. Mit dem Handballen drückte er die Erde über dem eingebuddelten Fleisch noch etwas fester, dann erhob er sich, beugte sich über den Stein wie über eine Brüstung und sah hinab auf die kniende, reibende Gattin. In drei Wochen sei Allerseelen, hatte sie gesagt, zu Allerseelen wolle sie einen sauberen Stein haben.
»Woran denkst du?«
Nichts, sagte der Oberst, er denke an nichts.
Im weiten Gräberfeld zündete jemand eine Kerze an, jemand kluppte einen verdorrten Stengel ab, jemand stand am Brunnen und füllte eine Vase mit Wasser. Er nahm seine Handschuhe vom benachbarten Grabstein und zog sie an. Dann nickte er den Friedhofsgärtnern, die wie ausgesperrte Bettler vor der Abdankungskapelle hockten, einen Gruß zu. Sie rauchten Zigaretten, einer aß einen Apfel. Ein paar von ihnen grüßten zurück, ihrerseits mit den Köpfen nickend, und miteins stand jener Kranführer vor seinem Auge, der den Felsen über die Friedhofsmauer gehoben hatte, ein Siegertyp, dachte der Oberst, allerdings Kommunist, irgendwie schlitzäugig, das Kinn gereckt und auf der Pelzmütze ein roter Stern. Wann war das gewesen? Offiziersschule Walenstadt, kalter Krieg, im Saal eine Bruthitze, Tenue-Erleichterung nicht gestattet – hier sehen Sie Ihren Feind, meine Herren, so sieht er aus, das nächste Bild, und klickend warf der Projektor einen Panzerfahrer an die Wand, dann einen Flieger, Rak-Schützen, Infanteristen, eine schier endlose Galerie, ein ganzes Regiment, Mongolen, Kirgisen, Georgier, und alle mit Pelzmützen und – auf der Mütze der rote Stern. Saallicht an, aufgestanden, und Kamerad Kessler, der damals sitzengeblieben war – er hatte sämtliche Iwans verschlafen – ging für vierundzwanzig Stunden in Arrest, bei Zollikofer gab es kein Pardon. Zollikofer, sagte der Oberst, er habe an Zollikofer gedacht.