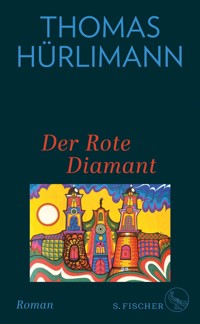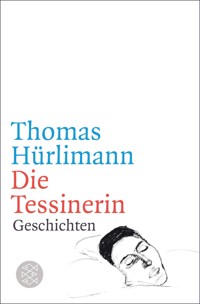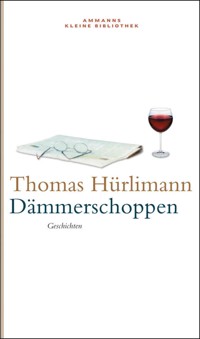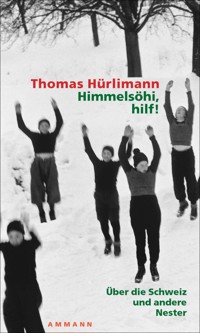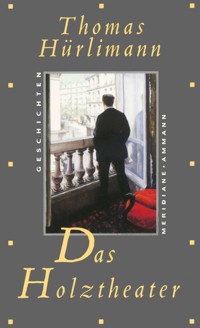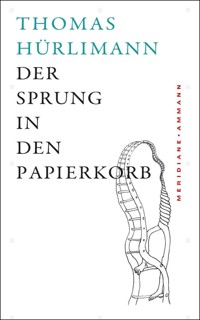
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach ›Das Holztheater‹ und ›Himmelsöhi, hilf!‹ ist ›Der Sprung in den Papierkorb‹ Thomas Hürlimanns dritter Essay- und Geschichtenband. Ein Motiv, das darin immer wieder auftaucht, ist die Treppe. Thomas Hürlimann findet sie in Platons Höhle, aber auch in den Fußballstadien oder an einem Zypressenhang am Comer See. Über die Treppe führt er uns zu Jean Paul, zu Friedrich Schiller und zu Botho Strauß. Und er erzählt von der über sieben Decks und Etagen in den Speisesaal hinabführenden Treppe der Titanic, die am 14. April 1912, um 23 Uhr 40, auf 41° nördlicher Breite, 30° westlicher Länge, untergegangen ist. »Mit der Titanic ging sie unter, und zwar nicht nur die Treppe der Titanic, sondern – das war ihr bitterer Witz – die Treppe als Treppe. In dieser Größe gab es sie nie mehr, ihre Zeit war vorbei.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Thomas Hürlimann
Der Sprung in den Papierkorb
Geschichten, Gedanken und Notizen am Rand
FISCHER E-Books
Inhalt
DER SPRUNG IN DEN PAPIERKORB
Schreiben
Beim ersten Mal war ich gut, sehr gut sogar, doch wurde ich für meine Leistung nicht belohnt, sondern bestraft.
Damals war ich vierzehn Jahre alt und Klosterschüler im ehrwürdigen Stift zu Einsiedeln. Wir hatten einen wundervollen Deutschlehrer, Pater Erlebald. Er las uns seine Lieblingsgedichte vor und Szenen aus dem König David von Reinhard Sorge. Beim Eintritt ins Kloster hatte Pater Erlebald seine Stimme verloren, und noch heute höre ich die schönsten Verse der Menschen, die Gottfried Bennschen, von seiner fast tonlosen Stimme hervorgekrächzt.
An einem sonnigen Frühlingsmorgen lag Pater Erlebald, wie in letzter Zeit öfter, fieberkrank in seiner Zelle, und Pater Walafried, der Subpräfekt, erhielt vom Gütigen – so wurde der oberste Präfekt genannt – den Auftrag, unsere Klasse zu einem Stundenaufsatz ins Freie zu führen, auf einen Hügel hinter dem Kloster. Dort sollten wir, wie der Ersatzlehrer an Ort und Stelle verkündete, eine Baumgruppe beschreiben. Glücklich, der Steinwelt des Klosters entronnen zu sein, legte ich los. Durch die Blätter blitzte die Sonne, Dunst lag überm Land, und es fiel mir leicht, die sieben Linden als Naturkathedrale zu beschreiben, aus Luft und Licht gebaut, von uralten Säulen getragen. Nach einer Stunde sammelte Ersatzlehrer Walafried unsere Hefte ein und hieß uns Zöglinge, die wir schwarze Kutten trugen, ins Kloster zurückmarschieren. Damit hätte sein Auftrag geendet, Pater Walafried jedoch, der seit Jahren davon träumte, in den Schuldienst eintreten zu dürfen, wollte die Bewertung der Aufsätze nicht dem kranken Erlebald überlassen, sondern selber vornehmen. Während des abendlichen Studiums bestellte er mich in seine Zelle, zeigte auf mein Heft und fragte: »Wo hast du das abgeschrieben?«
»Ich habe nicht abgeschrieben, Herr Walafried«, antwortete ich leise.
Er blieb dabei, bezichtigte mich der Lüge und wiederholte seine Frage. Vorsichtig wies ich den Pater darauf hin, er habe uns das Thema erst auf dem Hügel eröffnet, weshalb es mir gar nicht möglich gewesen wäre, mitten in der Natur ein Buch zu erwischen, um mich daraus zu bedienen. Walafried, seiner Meinung sicher, grinste meinen Einwand beiseite: »Gesteh, Lügner!«
Ich weigerte mich, ein falsches Geständnis abzulegen. Da befahl er mir, ihm die Innenflächen meiner Hände zu zeigen, und während er laut und lauter fragte, wer der Dichter sei, dem ich die herrlichen Sätze gestohlen habe, hieb er mit einem vierkantigen Lineal auf mich ein. Meine Handballen schwollen an, die Haut drohte zu platzen, er schrie, ich winselte, er schlug, ich heulte, doch heulte ich die Wahrheit: »Ich habe nicht abgeschrieben, Herr Walafried, ich habe nicht abgeschrieben.«
So wurde ich mit einem Lineal zum Dichter geschlagen, und wenn ich in späteren Jahren verrissen wurde, dachte ich wehmütig: Wenn wir wirklich gut sind, wird es uns heimgezahlt.
Mit sechzehn schrieb ich mein erstes Stück, stieg aus der Kutte, schlang mir einen Schal um den Hals, kletterte über die Klostermauer, fuhr per Autostopp nach Zürich, betrat die Direktion des Schauspielhauses und erklärte einer verdutzten Sekretärin, hier sei die Dichtung, auf die das Haus seit Jahren warte. Ich bat sie, mir so bald als möglich mitzuteilen, wann die Uraufführung stattfinde, und es kommt mir heute wie ein Wunder vor, daß ich nach einigen Wochen von Dietbert Reich, dem Dramaturgen, zum Gespräch geladen wurde.
Meine Komödie handelte von Adligen, die während der Französischen Revolution ins Innere der Erde geflohen sind. Dort zeugen sie sich fort, und als einer (ich!) nach langer Zeit an die Oberfläche zurückkehrt, stellt sich heraus, daß er nur noch an der Decke gehen kann. Dummerweise verliebt er sich in eine gewisse Gisela, die Frau des Einsiedler Fotografen, und da sie mit ihren schönen Beinen fest auf der Erde steht, bleibt die Liebe des jungen, kopfüber von der Decke hängenden Grafen ebenso unsterblich wie unerfüllbar. Dramaturg Reich erklärte mir, das Theater sei kein Zirkus, und meine Chance, gespielt zu werden, werde sich beträchtlich erhöhen, wenn ich künftig auf artistische Vorgaben verzichte. Ich fühlte mich verkannt, und wäre Gisela nicht gewesen, die ich vor meinem Freitod ein einziges Mal küssen wollte, hätte ich mich an einem Lindenast meiner Naturkathedrale aufgehängt, natürlich mit den Füßen nach unten. Aber Gisela zog es vor, ihre Ehe und mein Leben zu retten – sie verweigerte mir den Kuß. So schrieb ich, statt den Strick zu nehmen, einen Liebesroman, und aus Gründen, die auf der Hand lagen, der geschlagenen, stand im Mittelpunkt des in Hexameter gegossenen Werks ein gewisser Frunz, voller Pickel, die Nase krumm, vorstehend die Zähne, aber mit dem Talent versehen, sich bei einbrechender Dämmerung in einen Adler zu verwandeln. Frunz wagt es nicht, in einem Fotogeschäft sein Paßbild abzuholen, als Adler jedoch landet er nachts auf dem Dach, unter dem die schöne Gisela mit ihrem Fotografen das Bett teilt, stößt wilde Brunstschreie aus, ra raak, ri riik, und bestimmt ist es besser, wenn ich den Rest verschweige (der arme Vogel konnte alles außer vögeln).
Wieder wurde meine Dichtung verkannt, trotzdem schrieb ich weiter, ich mußte es tun, ob ich wollte oder nicht, nulla dies sine linea, kein Tag ohne Zeile, nur in den Wörtern konnte ich atmen, nur auf einer Seite, die bis zum Rand gefüllt war, ohne jeden Freiraum, wie heutzutage die Gemälde der Sprayer auf Betonwänden, war ich vorhanden. Erfolglos vorhanden. Was ich verschickte, sei’s an Theater, an Verlage, an Zeitungen, ging verloren oder kam mit vorgefertigten Absagen retour. Seit ich dreizehn war, führte ich die Existenz eines Dichters, aber ich mußte dreißig werden, bis es mir gelang, auf der Bühne und in einem Verlag, erst noch einem neu gegründeten, zu landen.
Der mir liebste Mensch war mein Bruder. Er hatte Knochenkrebs und kämpfte vier Jahre gegen den Tod. Sein Sterben verwandelte mich. Ihm zeigte sich alles im Abend- und Abschiedslicht, in den Tönen der Dämmerung, und fast ohne es zu merken, begann ich seine Sicht zu übernehmen. Ich lernte, daß das Schöne, wie Rilke sagt, der Anfang des Schrecklichen ist und das Schreckliche der Anfang des Schönen. Am Bett des Sterbenden schrieb ich erneut ein Theaterstück, und mit wachsender Erregung nahm ich wahr, wie ich zum ersten Mal etwas Eigenes erschuf. Mit neuer Hoffnung sandte ich das Stück, Großvater und Halbbruder, an einige Verlage sowie an die Jury des Stückemarkts beim Berliner Theatertreffen – und hatte zum ersten Mal Glück. Eines Abends, es war kurz vor zehn, erhielt ich das schönste Telefonat meines Lebens. Sigrid Wiegenstein meldete sich, die Vorsitzende der Jury, und teilte mir mit, mein Stück sei angenommen. Es wurde von den besten Schauspielern Westberlins gelesen, unter anderen von Fritz Lichtenhahn und Otto Sander, und plötzlich war ich in der komfortablen Lage, Dramaturgen und Verlagslektoren, die mich mit Angeboten köderten, stehenzulassen. Über Nacht hatte sich mein Lebenswunsch erfüllt, ich hätte jubeln müssen, doch als ich am nächsten Morgen erwachte, hatte ich einen üblen Kater. Subpräfekt Walafried, dachte ich, hat recht behalten. Wie war ich zum Autor geworden? Indem ich etwas Eigenes geschaffen hatte. Aber es war sein Eigenes. Das Eigene meines Bruders. Nicht ich, er war der Autor. Die Dämmertöne gehörten ihm. Er, nicht ich, hatte das Stück erdacht. Es kam an. Im »Berliner Tagesspiegel«, der wichtigsten Zeitung der Stadt, konnte ich lesen, daß ein neuer Name aufgetaucht sei, ein Name, den man sich merken müsse. Schön. Sehr schön. Dumm war nur, daß es ein Toter war, erst noch mein Bruder, der dieses Bravourstück hingelegt hatte. Der unverdiente Erfolg quälte mich, und er quälte mich so gewaltig, daß ich im Moment des Durchbruchs den Entschluß faßte, mit dem Schreiben aufzuhören.
Da klingelte es. Im Flur des Berliner Hinterhauses, wo ich damals wohnte, stand Egon Ammann, der Leiter der Suhrkamp-Dépendance in Zürich. Die kleine Nihal, eine Türkin, die mit ihrer Familie eine Treppe höher wohnte, hatte ihn zu mir geführt, und zu meinem Erstaunen sprach der Herr aus Zürich mit Nihal fließend Türkisch.
Obwohl mir kein Mensch abnimmt, was sich bei dieser Begegnung ereignet hat, sei sie kurz berichtet. Wir lehnten uns gegenseitig ab. Der Herr aus Zürich gab mir mein Stück zurück (vor einigen Monaten hatte ich es auch an ihn gesandt). »Vergessen Sie das Theater«, meinte er, »schreiben Sie Prosa, dann werden wir Sie herausbringen.«
Ich schlug sein Angebot aus. Wir schüttelten uns die Hände und sagten: »Adieu.«
So stand am Anfang unserer Beziehung deren Ende – oder war es umgekehrt? War dieses Ende jener Anfang, den wir suchten?
Die Szene im TreppenhausTreppenhaus: Ich bin ein Schüler des Doktors (siehe L’esprit de l’escalier), und schon hier, auf der ersten Treppe dieses Bändchens, sei vermerkt, daß für meinen Lehrer die Treppe ein wichtiges Thema war. Man wird ihr im folgenden hie und da begegnen, mal verborgen, mal prunkvoll, hier empor-, dort hinabführend. »Stägeli uuf, Stägeli ab«, lautet der Refrain in einem Volkslied meiner Heimat, »Treppchen rauf, Treppchen runter.« der Kreuzberger Mietskaserne wirkte bei beiden nach. Ich mußte immer wieder an den Schweizer Basarhändler denken, der, auf seinen Fersen hockend, mit Nihal gescherzt hatte, und ihm war es zum ersten Mal widerfahren, daß einer nein sagt, wenn ihm Suhrkamp die Visitenkarte unter die Nase hält.
Meine damalige Freundin hieß Ute und jobbte als Serviererin im Litfin, jener Westberliner Gastwirtschaft, deren Eingang direkt an der Mauer lag. Schäferhunde, die im Todesstreifen Hasen jagten, ließen von drüben ihr Gehechel hören, und der Scheinwerfer eines Wachturms gab den Novembernächten eine gespenstische Helle. Als Ammann wiederkam, nun mit Marie-Luise Flammersfeld, seiner Partnerin, führte ich die beiden hierher. Ute brachte uns die Biere, und schon nach den ersten Schlucken deuteten die Besucher aus Zürich an, daß sie einen verwegenen Plan hegten: die Gründung eines eigenen Verlags.
Die letzten Gäste hatten sich davongemacht. Von drüben jaulten die Hunde, und strich der Scheinwerfer über die Fenster, versetzte er uns ins Niemandsland. Ich erzählte von meinem Bruder, dem wahren Dichter, aber die beiden Verlagsgründer hielten mich keineswegs für einen Betrüger, sondern meinten: »Darüber mußt du schreiben.«
»Das schaffe ich nie«, wandte ich ein.
»Darum geht’s«, sagten die beiden.
Ute, müde vom stundenlangen Servieren, saß nun bei uns am Tisch. Sie war der EngelEngel: Ein sehr schöner Engel, einiges größer als ich, mit kurzen blonden Haaren, schmalen Händen und knisternden Flügeln. Aber erst ein Jahr später, im Augenblick unserer Trennung, sollte ich erfahren, wieviel dieser Engel von Literatur verstand – siehe Lehrjahre in Platons Höhle., der die Verlagsgründung begleitet hat, und zugleich seine erste Gönnerin – die von ihr gestiftete Flasche Wodka tranken wir gemeinsam aus.
Als über der schwarzen Mauer ein aprikosenfahler Himmel erschien, schlossen wir auf einem feuchten Bierdeckel einen Vertrag, und bald danach wurde mein Erstling, Die Tessinerin, das erste Buch des neu gegründeten Ammann Verlags. Mit der Titelgeschichte konnte ich mich vom Gefühl, ich hätte abgeschrieben, für immer befreien. Es geschieht auf wenigen Zeilen. Mitten im Text steht mit seinen eigenen Worten, mit seinem Namen und seinen Daten, wie ein Grabstein mein Bruder. Indem ich ihn zitierte, war ich zum Autor geworden.
Im Foyer
Noch regnet es nicht in Zürich, hell ist der Abend und sommerlich heiß. Die Theater-Arche steht bereit zur Aufnahme der Paare, und bereit stehen im Foyer auch wir, die Garderober, um die Mäntel und Schirme des Publikums zu empfangen. Das Jaulen einer Sirene, schwirrende Stimmen, fröhliches Lachen – draußen lebt die Stadt. Draußen. Nicht hier. Noch nicht. Wir Garderober, in zwei Chorhälften geteilt, stehen einander an den Seitenwänden gegenüber, und wiewohl sich um diese Zeit, vierzig Minuten vor Beginn der Vorstellung, zwischen unseren Tresen eine gähnende Leere erstreckt, geben wir die Hoffnung nicht auf, die eine oder andere Blechmünze mit der eingestanzten Nummer vom Haken zu nehmen und durch ein Kleidungsstück zu ersetzen. Unsere Hoffnung hat eine schöne, altbewährte Quelle: Freitag-Abo B.
Plötzlich knallen Türen. Aus dem oberen Foyer kommen drei Bühnenarbeiter die Treppe herabgeschlendert. Einer trägt ein Gemälde unseres Intendanten Marthaler, einer trägt den Werkzeugkasten und einer die Verantwortung. In den Korridoren, die zum Parkett führen, hängt der Intendant in Galeriestärke, mal mit Strohhut, mal mit Bierflasche, mal kubistisch, mal lebensgetreu, weshalb es uns Garderober nicht erstaunt, daß den vielen Porträts ein neues, gar ein goldgerahmtes, hinzugenagelt werden soll: Intendant Marthaler als Kapitän der Theater-Arche. Fürwahr ein sinniges Bild! Von Sturmregen und Gischt umtost, steht er auf der Brücke, das Steuer fest in den Pranken.
»Aber halt, halt, das ist der falsche Platz!« befiehlt auf einmal eine weibliche Stimme von oben, und die drei Bühnenarbeiter machen sich samt Gemälde, Werkzeugkasten und Verantwortung auf leisen Sohlen davon. Das war die Carp, die Chefdramaturgin. Sie braucht gar nicht hinzusehen, sie weiß Bescheid: Stets und ständig läuft alles schief. Die Bühnenarbeiter wollen an der falschen Stelle Bilder aufhängen; die Schauspieler leisten sich ein falsches Bewußtein, und das Publikum paßt nicht zu den dekonstruierten Stücken. Wir Garderober sind dieser Vorfrau in Ehrfurcht verbunden. Wenn der Intendant, von Getreuen umlagert, in seiner Kajüte vor sich hin summt und die Schauspieler in der Kantine die letzten paar Textreste vergessen – die Carp wird es schon richten! Dabei gilt es allerdings zu bedenken, daß in diesem Haus, das der Darstellung geweiht ist, selbst die Führungskunst unserer Vorfrau über eine Demonstration nicht hinausgelangt. Sobald es die Arche vom Grund hebt, haben wir nur noch zu schwimmen, zu schaukeln, zu treiben – auf einer Welt ohne Land gibt es keine Richtung, eine Arche läßt sich nicht pilotieren.
Endlich das erste Paar, sie im Abendkleid, er im Smoking!
Nein, der Taxifahrer hat sich in der Adresse geirrt, das Paar will in die Oper, macht kehrt, zieht ab, und der Neid auf unsere Kollegen im Opernhaus, das selbst an den schönsten Sommerabenden bis auf den letzten Klappsitz gefüllt ist, frißt sich wie Gift in unsere Seelen.
Ah, da kommt Herr Hitz, eine andere Größe der Arche!
Mit elastischen Schritten strebt er den Verkäuferinnen des Programmheftes zu (uns Garderobern hat die Gewerkschaft das Anbieten von Programmheften untersagt) und kontrolliert, ob die Stapel vorschriftsgemäß in den Armbeugen liegen. Dabei blättert er wie zufällig ein Heft auf und liest sich im selbstfabrizierten Tiefsinn fest. Notate zum Begriff des Realen bei Lacan! Es durchlaufen ihn Schauer.
Die sinkende Sonne durchschneidet mit waagrechten Strahlen die Foyerleere. Hitz schenkt seinem Text ein Lächeln, dann winkt er uns aufmunternd zu und verschwindet im Laufschritt treppauf, zurück in seine Kabause unterm Dach, wo er seit vielen Monaten an einem Manifest wider das postdramaturgische Theater feilt. Wir aber, Hunderte leerer Haken im Nacken, sind wieder allein. Wo bleiben die Wasser-, wo die Zuschauermassen?
Punkt halb acht hallt die Stimme von Frau Herbst, der Inspizientin, über die hinteren und unteren Decks. »Neunzehn Uhr dreißig«, meldet sie, »noch eine halbe Stunde bis zur Vorstellung!«
Daß die Inspizientin Herbst heißt, hat etwas Tröstliches. Im Herbst gehen die großen Regen nieder, und bereits jetzt, um halb acht, würden uns einige tropfend nasse Plastikpelerinen ein Lacansches Realitätsgefühl vermitteln. Kommt heute kein einziges Paar?
Keines. Die Haken, die Nummern, die Schirmrechen warten vergeblich. Heute, da die Stadt mit übervollen Straßencafés, verliebten Pärchen und blühenden Linden nach Sommer, Feierabend und Wochenende duftet, müssen wir, der Chor der Garderober, unsere weißen Hände auf dem Rücken ruhen lassen. Furcht befällt uns, düstere Betrübnis. Weh uns, weh dieser Arche!
Irgendwann humpeln dann doch einige herein. Altersmühsalbeladene. Gutgesinnte. Freitag-Abo-B-ler der ersten Stunde, allzeit bereit, ihre Sitzpflicht zu erfüllen. Ursprünglich nickte man sich höchstens einen Gruß zu, nach soundso vielen Theaterabenden jedoch, da man sich zu Beginn, in der Pause und nach der Vorstellung kaum ausweichen konnte, begann man einen zarten Kontakt herzustellen. Er fand im gleichen Geschmack eine sichere Basis, und je höher sie ins Rentenalter stiegen, desto einiger vermochten die Abo-B-Veteranen ihr Urteil zu fällen: Stück zu lang, Inszenierung furchtbar, die Schauspieler na ja. »Ausgenommen die Dings«, rief eine, und die andern, denen der Name ebenfalls auf der Zunge lag, antworteten einstimmig: »Ja, die Dings, die war gut.«