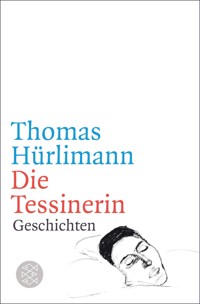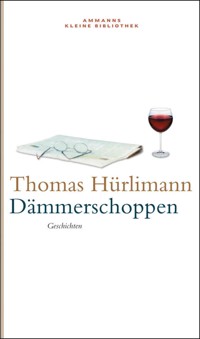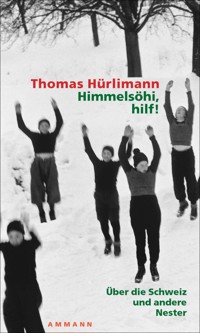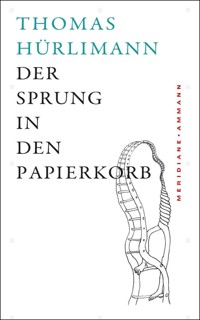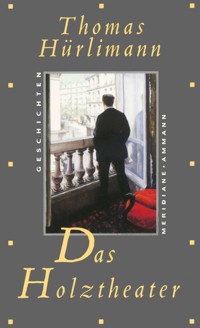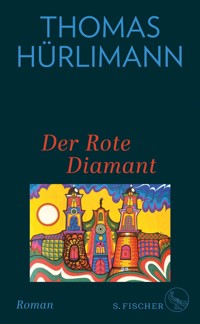
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Dieser Autor überwältigt.« Jochen Hieber, FAZ »Pass dich an, dann überlebst du«, bekommt der elfjährige Arthur Goldau zu hören, als ihn seine Mutter im Herbst 1963 im Klosterinternat hoch in den Schweizer Bergen abliefert. Hier, wo schon im September der Schnee fällt und einmal im Jahr die österreichische Exkaiserin Zita zu Besuch kommt, wird er zum »Zögling 230« und lernt, was schon Generationen vor ihm lernten. Doch das riesige Gemäuer, in dem die Zeit nicht zu vergehen, sondern ewig zu kreisen scheint, birgt ein Geheimnis: Ein immens wertvoller Diamant aus der Krone der Habsburger soll seit dem Zusammenbruch der österreichischen Monarchie im Jahr 1918 hier versteckt sein. Während Arthur mit seinen Freunden der Spur des Diamanten folgt, die tief in die Katakomben des Klosters und der Geschichte reicht, bricht um ihn herum die alte Welt zusammen. Rose, das Dorfmädchen mit der Zahnlücke, führt Arthur in die Liebe ein, und durch die Flure weht Bob Dylans »The Times They Are a-Changinʼ«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Thomas Hürlimann
Der rote Diamant
Roman
Über dieses Buch
»Pass dich an, dann überlebst du«, bekommt der elfjährige Arthur Goldau zu hören, als ihn seine Mutter im Herbst 1963 im Klosterinternat hoch in den Schweizer Bergen abliefert. Hier, wo schon im September der Schnee fällt und einmal im Jahr die österreichische Exkaiserin Zita zu Besuch kommt, wird er zum »Zögling 230« und lernt, was schon Generationen vor ihm lernten.
Doch das riesige Gemäuer, in dem die Zeit nicht zu vergehen, sondern ewig zu kreisen scheint, birgt ein Geheimnis: Ein immens wertvoller Diamant aus der Krone der Habsburger soll seit dem Zusammenbruch der österreichischen Monarchie im Jahr 1918 hier versteckt sein. Während Arthur mit seinen Freunden der Spur des Diamanten folgt, die tief in die Katakomben des Klosters und der Geschichte reicht, bricht um ihn herum die alte Welt zusammen. Rose, das Dorfmädchen mit der Zahnlücke, führt Arthur in die Liebe ein, und durch die Flure weht Bob Dylans »The Times They Are a-Changinʼ«.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Thomas Hürlimann wurde 1950 in Zug, Schweiz, geboren. Acht Jahre lang, zwischen 1963 und 1971, besuchte er das Gymnasium im Kloster Einsiedeln, dann studierte er in Zürich und Berlin Philosophie und begann seine Karriere als Autor von Theaterstücken. Seine Werke, darunter die Novelle »Fräulein Stark« und der mit Bruno Ganz verfilmte Roman »Der große Kater«, wurden in 21 Sprachen übersetzt. Nach vielen Jahren in Berlin lebt er heute wieder in seiner Heimat.
Für Fedora Wesseler
EINS
Ich wandelte als ein Fremder unter ihnen. Kein Wort, kein Blick erreichte mich mehr, aber auf einmal sprachen die Dinge zu mir, etwa die alte Gießkanne. Oder die Hollywoodschaukel. Oder auf dem Gartentisch ein leeres Glas, in dem eine Wespe surrte. Alles um mich herum wurde deutlicher, als würde ich es zum ersten Mal richtig sehen, dabei sah ich es zum letzten Mal. In der hohen Sonne ahnte man schon den Herbst. Mimi, meine Maman, trug ein Seidentuch um die Schultern, und ich fragte mich, ob ich sie so, in dieser Pose, mit einem Drink in der Hand und in einem gelb-weißen Pucci-Kleid, in meiner Erinnerung mitnehmen würde – und mit ihr ein Stück unseres Gartens im warmen Sommerabend. Wie hätte sich Scott in meiner Lage verhalten? Hätte er die letzten Tage vor der Ausfahrt ins Polareis in einer Kühlkammer verbracht, um sich an den Frost zu gewöhnen? Oder hätte er sich noch einmal der Sonne hingegeben, ihrer Abendflamme, die sich flach über das dunstige Land legte? Das Kloster, in dessen Internat ich morgen Nachmittag als Zögling eintreten würde, lag in den Bergen. Es war der Himmelskönigin geweiht und hieß Maria zum Schnee.
Wie immer, wenn bei uns (oder sollte ich sagen: bei ihnen, in diesem Haus?) wichtige Ereignisse bevorstanden, wurden sie durch den Auftritt von Major Stadler angekündigt. Der Oberst schickte ihn jeweils vor, um »die Dinge zu regeln«. Zum Geburtstag des Obersten bereitete Stadler das Feuerwerk vor, eine Batterie von Raketen, die dann, zu Mimis Entsetzen, aus den Rosenbüschen abzischten, und am Heiligen Abend schmückte er den Baum. Mimi und ich mokierten uns über den Major, allerdings sahen wir ein, dass der Oberst in diesen friedlichen Zeiten einen Untergebenen brauchte, den er herumkommandieren konnte. »Herr Major, bringen Sie meinem Filius bei, wie man anständig packt!«
»Jawohl, Herr Oberst.«
Zu meiner Überraschung lag der Koffer bereits parat, Mimi hatte ihn eigenhändig vom Dachboden geholt und in die silbernen Schlösser etwas Salatöl geträufelt. Die Lederkappen hingen lose an den Ecken, und der Henkel war abgegriffen, aber dieser Koffer stellte ein Stück Familiengeschichte dar: Mit ihm war Sender Katz, unser Urahn, zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus Galizien, dem ärmsten Kronland der Donaumonarchie, in die Schweiz eingewandert. Später hatte ihn mein Großvater auf viele Reisen mitgenommen und stolz dafür gesorgt, dass der Koffer, den man in der Familie den »Galizier« nannte, mit allerlei Hotel- und Zolletiketten bepflastert wurde. Am abgegriffenen Henkel flatterte der Bordzettel einer Schiffspassage von Southampton nach New York, und in einem roten Anhänger steckten unter einer Klarsichtfolie der Name und die Adresse von Mimi Katz – der Galizier hatte meine Maman ins Pensionat und später nach Bern begleitet, ins Konservatorium, wo sie als Meisterschülerin des berühmten Fadejew brilliert hatte. Dann verliebte sich Mimi auf den ersten Blick – es war ein Aufblick mit klimpernden Wimpern – in einen jungen Leutnant, der hoch zu Ross an ihr vorüberritt, drei Wochen später war man verlobt, nach drei Monaten verheiratet, und Mimis Absicht, mit dem Galizier auf Konzerttournee zu gehen, löste sich in Luft auf.
Dass mein Vater, der Oberst, aufgetaucht war, hatte mich überrascht. Er schärfte Mimi ein, sich morgen ja nicht zu schminken, einen kniebedeckenden Rock und Wollstrümpfe anzuziehen, auf den Hut zu verzichten und unter allen Umständen rechtzeitig loszufahren. Der Präfekt der Stiftsschule, fügte er mit ergriffen tremolierender Stimme hinzu, habe am Russlandfeldzug des Deutschen Reichs teilgenommen und sei aus dem Weltkrieg als Heiliger hervorgegangen. Er werde im ganzen Schweizerland verehrt, ich möge mich glücklich schätzen, von einem Knabenerzieher und Seelenführer dieses Formats zum Mann gemacht zu werden.
Vor dem Haus stand mit laufendem Motor und röchelndem Funkgerät der Jeep, am Steuer der Major, behelmt, gefechtsbereit und startklar zum Manöver – der Oberst erreichte seine Ziele auf die Minute pünktlich. Er erteilte mir noch die eine oder andere Ermahnung – die Fingernägel mit der Messerspitze reinigen, die Anweisungen des Heiligen befolgen, in den Gottesdiensten das Gähnen unterdrücken –, dann trat er vor den Garderobenspiegel, ließ sich von Mimi den schwarzen Ledermantel über die Schultern legen, klappte sich die Offiziersmütze auf den Scheitel und sprach zu seinem Spiegelbild: »Mein lieber Filius, ich kenne keine Versager.«
Mit wippender Antenne brauste der Jeep davon.
Anderntags standen Mimi und ich wie befohlen in aller Herrgottsfrühe auf, aber, typisch Mimi, die Kostümfrage nahm dann doch einige Zeit in Anspruch. Als ich den Galizier ins Auto legte – Major Stadler hatte unseren Ford Taunus 17 m vor dem Haus bereitgestellt, nach vorschriftsgemäß durchgeführter Kontrolle: Reifendruck, Ölstand, Tankfüllung –, öffnete sich oben, im bereits etwas welken Blätterkleid, das die Rückseite des Hauses bewuchs, ein Fenster. Was war denn los? Musste Mimi gerade jetzt ins Land hinausträumen? Aus dem Schlafzimmer tönte Klaviermusik, vermutlich eine Sonate von Schubert, ihrem Liebling, und meine Maman rief aus dem Fenster: »Arthi-Darling, würdest du bitte einen Moment heraufkommen?«
Oben im Schlafzimmer war die Geheimlade mit ihrem Schmuck aus der Kommode gezogen, und Mimi stand ratlos davor, in der Linken ein Collier, in der Rechten ein Medaillon am Goldkettchen.
»Glaubst du, die Patres erwarten, dass ich mir die Madonna umhänge? Es wäre zu peinlich, wenn sie es als Anbiederung missverstehen – deine Maman will dir keinesfalls schaden. Ach, reich mir doch bitte die Brosche. Nein, die andere.«
Ich entnahm der mit rotem Samt gepolsterten Schatulle eine goldene Rose, und Mimi hielt sich das Juwel vor dem Spiegel an die linke Brust.
»Die göttliche Jungfrau ist die Rosa mystica«, sagte sie. »Das Stift ist ihr geweiht. Ob die Patres die Anspielung verstehen? Sie sollen ja sehr gebildet sein. Dann wäre es allerdings möglich, dass sie in der Rose das Dunkel sehen, gewissermaßen den Anfang aller Dinge … Darling, du bist überhaupt keine Hilfe. Äußere dich gefälligst!«
»Mimi, wir verlieren Zeit!«
»Mit Juwelen? Oh nein, mein Sohn, mit Juwelen tritt man aus der Zeit heraus. Sie haben etwas Ewiges. Wie ein gutes Gedicht«, flötete Mimi und entschied sich für eine kleine silberne Muschel.
Auf der Fähre über den See blieben die meisten Passagiere im Auto sitzen, aber ich und ein paar andere standen wie blutlose Schatten an der Reling, und indem sich das Ufer, wo wir abgelegt hatten, entfernte, fiel mir auf, dass die Passage anders verlief als bei früheren Fahrten. Der See lag im Glast eines schwülen Nachmittags, und als beide Ufer in einer bleichen Ferne lagen, war es mir, als würden wir über den Acheron dampfen. ›Die klassischen Sagen des Altertums‹ waren mein Lieblingsbuch, ich hatte es in den Galizier gelegt, zusammen mit dem Tagebuch des Captain Scott, und unter einem Schwarm von Möwen fragte ich mich bang, ob ich auf dieser Überfahrt etwas Ähnliches erlebte wie die Verstorbenen, die zwischen den Ufern die Erinnerung an ihr Leben verloren.
Als wir dann durch schattendunkle Täler in die Berge fuhren, ging es bereits auf den Abend zu. Mimi schlug vor, in einem der Dörfer an der Strecke eine Kleinigkeit zu essen, wieder verloren wir Zeit, und beim Verlassen der Gastwirtschaft empfing uns eine merkwürdige Stille. Kein Auto war unterwegs, kein Vogel pfiff. Am Talende lagen die Firne im Abendglühen, im Osten glitzerten über den schwarzen Wänden schon erste Sterne. Die Straße wurde steiler, und in den Kehren hätte Mimi mit Zwischengas vom zweiten Gang in den ersten, vom ersten wieder in den zweiten schalten sollen, doch Stöckelschuhe mit spitzen Absätzen, da hatte sie recht, waren für dieses Manöver ungeeignet. Viel zu hochtourig, fast immer im ersten Gang, quälte sie den Ford bergauf, die Arme seitlich abgespreizt, die Büste nah am Steuer, und man brauchte kein Prophet zu sein, um vorhersagen zu können, dass sich der kochende Kühler, der jähe Temperaturabfall sowie das plötzliche Verschwinden des Firnglühens unaufhaltsam zu einer Katastrophe zusammenballten.
Es knallte dann erstaunlich sanft –
Der Ford glitt in einer Steilkurve von der Fahrbahn und rutschte in den Graben, wo der Motor mit einer dicken Rauchfahne aus der Kühlerhaube verröchelte. Endete meine Klosterschulzeit, bevor sie begonnen hatte? Gegen den Widerstand eines gefrorenen Buschs stieß ich die Tür auf und kraxelte auf allen vieren zur Straße hoch. Hier merkte ich gleich, was die Vögel zum Verstummen, den Verkehr zum Erliegen gebracht hatte: der Winter. Der Winter war da. Aus der Stille winselte leis der Wind, ein Gebirgswind mit wirbelnden Flocken, in den Innerschweizer Bergen fiel schon jetzt, im späten Sommer, der erste Schnee. Das Kloster schien irgendwo weiter oben in den dunklen Wolken zu schweben, und während ich dabei war, den Schaden abzuschätzen, begannen in der Ferne Glocken zu läuten. Das Kühlwasser schien sich in der kalten Luft zu beruhigen, und die Ölwanne, stellte ich schnuppernd fest, war nicht leck geschlagen. Das Heck ragte schräg empor, wie bei der untergehenden Titanic (auf der Großvater Katz, Mimis Vater, und der Galizier durch eine Kette unglaublicher Zufälle überlebt hatten), und mit bereits klammen Fingern klappte ich den Kofferraum auf. Ich hätte es mir denken können. Das Pannendreieck fehlte.
»Wolltest du nicht einen Wagen anhalten, Arthi-Darling?«
Mimi hatte ihr Beauty-Case ausgepackt und war dabei, die vom überhitzten Motor aufgewärmte Wagenkabine in einen Schönheitssalon zu verwandeln. Sie zog die Lippen nach, tupfte Puder auf die Wange, gab dann etwas Spucke in ein Döschen mit schwarzer Tusche und malte damit ihre langen, gekrümmten Wimpern an.
»Wir kommen zu spät«, sagte ich.
»Mit mir kommt man immer zu spät«, sagte Mimi, konzentriert in den Rückspiegel blickend. »Hast du das Pannendreieck aufgestellt?«
»Das hast du irgendwo stehen lassen.«
»Zu dumm, nicht wahr? Ich müsste mir bei Gelegenheit ein Dutzend von diesen Dingern anschaffen.«
Woher Mimi ihre Seelenruhe hatte, war mir klar. Eigentlich hieß sie Maria, nach der Gottesmutter, und wenn sie in Not gerieten, diese Marien, erschien meist ein jüngerer Herr und bot seine Hilfe an. Auf Golgotha war es Johannes gewesen, und vermutlich hatte die Gottesmutter unter dem Kreuz ähnlich reagiert wie jetzt Mimi, als ein Sportwagenfahrer an ihr Seitenfenster klopfte: »Oh, haben Sie ein wenig Zeit für mich«, flötete sie, »das wäre zu liebenswürdig.«
Das Kloster Maria zum Schnee hatte mit seiner grauen, breiten, den Himmel stauenden Front die Wirklichkeit eines Traums. Erbaut für alle Ewigkeit. Ein Gebirge, doch mit Hunderten von Fenstern, viele beleuchtet. Selbst Mimi verschlug es die Sprache. In der Mitte, gerahmt von den beiden Türmen, empfing die Kathedrale mit drei Toren die Pilger. Gesang tönte heraus, von einer Orgel begleitet, doch wie von fern, aus dem Innern des Himmels. Mimi, die es sogar im Sommer fror, schien unter der erhaben düsteren Steinmasse dieser Fassade vergessen zu haben, dass es Winter geworden war. Flocken fielen auf ihren Sommerhut. Der Gesang setzte aus, setzte wieder ein, und jetzt ertönten hoch oben, wo sich die Kuppeln der Türme in der Winternacht verloren, vier Viertelschläge, dann ging über dem Klosterplatz eine Folge präziser Donner nieder, die volle Stunde, acht Uhr abends.
»Arthi-Darling«, sagte Mimi mit einem bezaubernden Lächeln, »ich fürchte, wir haben uns ein wenig verspätet.«
Die aus schwarzen Marmorquadern gefügte Kapelle, die im hinteren Teil des Kirchenschiffs fremd und gotisch in der süßen Barockwelt stand, war wie ein Bühnenkasten zum Publikum hin offen. Über dem schmalen Altar schwebte inmitten eines flachen Gewitters aus Blattgold die Schwarze Madonna, ein Krönchen auf dem Haupt, in der rechten Hand ein Zepter, auf dem linken Arm das Kind, ebenfalls dunkel, ebenfalls gekrönt.
»Heilige Maria Mutter Gottes«, beteten Mimi und ich und waren im Angesicht der Himmelskönigin zum letzten Mal ein Herz, eine Seele, eine Zunge. »Heilige Maria Mutter Gottes, wir finden dich wunderschön, bitte gib uns etwas von der Liebe, die wir für dich hegen, zurück. Steh uns bei, wenn wir allein sind. Nimm uns an die Hand, wenn es dunkel wird. Und bitte, liebste heiligste Mutter Gottes, sorge dafür, dass wir nicht weinen (oder höchstens ein bisschen), wenn der Moment kommt, da wir uns voneinander verabschieden müssen, Amen.«
Sie sah mit ihren Holzaugen über Mimi und mich hinweg in eine Ferne, die vielleicht das Land meiner Kindheit war, das nun unterging. Mimis Parfum hatte bereits einen leichten Hautgout, als wäre es ein Duft von gestern.
»Ihre Röcke und Mäntel waren im Escorial Philipps II. bei den Ersten Damen en mode«, flüsterte sie mir zu. »Dies ist ein Glockenrock.«
»Mich erinnert er an ein Pannendreieck.«
»Man hat eben seinen Stil«, sagte sie beleidigt. »Ich, wie du weißt, orientiere mich an Coco Chanel. Komm jetzt. Wir müssen uns beeilen.«
… aber vor dem Ausgang blieben wir noch einmal stehen, drehten uns um und blickten empor in die flaumige Dämmerung eines Raums, wie ich ihn noch nie gesehen hatte, weit und hoch und voller Zierrat, alles in einem wuchtigen Durcheinander, da Massiges, da Weiches Ragendes Tragendes Fallendes Fließendes Fliehendes …
»Barock«, sagte Mimi zur hohen, schon dunkelnden Kuppel hinauf, »im Übergang zum Rokoko.«
»Alle Formen«, flüsterte ich, den Kopf ebenfalls in den Nacken gedrückt, »und von allem zu viel.«
»Arthi-Darling«, sagte sie spitz, »solche Sottisen solltest du künftig unterlassen.«
Wir standen wie bei einer Flugschau, und um mich in all den Symbolen nicht völlig zu verlieren, zeigte ich auf einen Wappenschild im Zenit des höchsten Bogens. Auf dem Wappen sah ein schwarzer Vogel mit zwei Köpfen nach links und rechts und trug eine Krone mit einem kleinen Kreuz. Das sei der Doppeladler, erklärte Mimi, das Wappen der Donaumonarchie.
»Hat es dir der Vater nicht gesagt? Maria zum Schnee ist eine habsburgische Stiftung. Ihr Zöglinge seid die letzten Untertanen der Kaiserin. Stell dir vor«, flüsterte sie ehrfürchtig, »früher hat den Habsburgern die halbe Welt gehört, ganz Mexiko und der halbe Osten, bis weit nach Russland hinein. Sender Katz, unser Urahn, war Monate unterwegs, um von Drohobytsch, wo er bei Svatopluk & Kohn eine Pelzmütze und den Koffer gekauft hat, in die Schweiz zu kommen.«
»Monate?«, fragte ich ungläubig.
»Jahre«, antwortete Mimi, »Sender hat zu Fuß den ganzen Landozean durchquert. Im Galizier hatte er nichts als die Gebetsriemen, ein paar geklaute Kartoffeln und seine Schneiderschere.«
Mimi zog ihre Autohandschuhe aus, tunkte zwei Finger ins Weihwasserbecken, und ein Zucken ihrer frisch rougierten Lippen verriet, dass das Wasser eiskalt sein musste, nah am Gefrieren.
»Arthi-Darling, trag Sorge zu dir. Und bitte«, Mimis Augen wurden feucht, »vergiss mich nicht.«
Als sie das Knie beugte, sah ich auf ihrem breitrandigen Sommerhut schmelzende Schneekristalle glitzern, und plötzlich war mir klar, dass die Überquerung des Acheron doch die bekannten Folgen hatte. Die Wespe im Glas war verstummt. Die Hollywoodschaukel stand nicht mehr auf der Wiese. Und Mimi? Im Stift Maria zum Schnee würde ich sie verlieren, wir ahnten es beide.
»Ich denke, du wirst die Kaiserin demnächst kennenlernen«, wechselte Mimi in den Ton der Fremdenführerin und entkam so ihrer Wehmut. »Am Todestag des Kaisers nimmt sie jeweils an der Seelenmesse teil, die die Patres für ihn lesen.« Jetzt versuchte sie sogar zu lächeln. »Aber sie könnte noch einen anderen Grund für ihre Besuche haben. Sagt man jedenfalls.«
Das Portal fiel donnernd hinter uns zu, und wieder drohte uns die Fassade, die bestimmt so lang war wie die Titanic, zu erschlagen.
»Bei den Patres«, fuhr Mimi fort, »wirst du über das Geheimnis der Kaiserin mehr erfahren. Vielleicht teilst du es mir par occasion mit – brieflich. Oder im nächsten Sommer, wenn wir uns wiedersehen. Ich wüsste zu gern, ob es ihn tatsächlich gibt, den berühmten Diamanten.«
»Was für ein Diamant?«, fragte ich gereizt.
»Rot soll er sein. Ein roter Kristall. Und strahlen soll er, sogar im Dunkeln, wie ein Stern. Früher war er im Besitz der Habsburger, aber beim Zusammenbruch der Monarchie ging er verloren.«
»Hä?«
»Der Rote Diamant gilt als verschollen«, sagte Mimi träumerisch. »Angeblich wird er hier im Kloster aufbewahrt. Schau dir nur diese Fassade an! Oder die Türme! Hier wimmelt es von Verstecken.«
»Maman«, entgegnete ich, »wir sind hoffnungslos zu spät. Und ich fürchte, ich werde anderes zu tun haben, als einen … Diamanten zu suchen!«
Mimi zog an der Gymnasiumspforte ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal den Stab. Irgendwo im Innern bimmelte eine Glocke, doch nichts geschah. Die hohe Klosterfront blieb stumm, das Portal zu. Es schneite stärker. Pilger, unter Schirme gebückt, tappten über den leicht abschüssigen, bereits weißen Klosterplatz zum Dorf hinab, von ihren schwarzen Fußabdrücken gefolgt.
»Eine Dame warten zu lassen«, schimpfte Mimi, »was erlauben sich diese Mönche!«
Da tat sich in der Tür ein Spalt auf, und aus gespitzten Lippen, über denen sich ein Schnauz kräuselte, kam täuschend echt ein Vogelzwitschern.
»Sind Sie der Pförtner?«
Der männliche Vogel war kaum größer als ich, trug ein Hütchen mit langen Federn und eine Brille mit dick gerillten Gläsern. Er erinnerte mich an den zerzausten Doppeladler.
»Ja, Maman«, übersetzte ich für Mimi das Gezwitscher, »das ist der Pförtner.«
»Bitte ihn, den Koffer aus dem Wagen zu holen, dann bekommt er einen Obolus.«
Sie suchte in ihrem Unterarmtäschchen die Zigarre, die uns der Vater für den Pförtner mitgegeben hatte, und ich führte ihn über den Platz zu unserem Ford, wobei er mir mit einem Kopfrucken zur Turmuhr bedeutete, das Schuljahr habe bereits am Nachmittag begonnen. Der Galizier enthielt die vorgeschriebene Wäsche für ein ganzes Trimester: zwei Dutzend schwarze Wollsocken, baumwollene Unterhosen, Frottiertücher, Waschlappen, das Necessaire, die Serviette sowie die Dose mit dem Essbesteck, in das die Nummer 230 eingraviert war. Ich zeigte dem Vogelmann das in den Kragen meines Wintermantels eingenähte Stoffschildchen, worauf er mir trillernd zu verstehen gab, die 230 sei eine ziemlich gute Nummer.
Der pfeifende Vogelmann nahm den Koffer auf die linke Schulter, und indem ich hinter ihm herging, fiel mir ein, dass der Galizier Mimi nicht nur ins Berner Konservatorium begleitet hatte, sondern auch zu ihren Geburten ins Spital, wie ein Talisman. Mir hatte er damals tatsächlich Glück gebracht. Nach zwei Totgeburten war ich der Erste, der durchkam, und ich konnte nur hoffen, dass mir der Talisman auch im Kloster zu überleben half.
Über breite Sandsteinstufen ging’s in eine obere Etage, dann durch einen langen feuchten winterkalten Korridor in ein weiches Dunkel hinein. Mimis Stöckelschuhe riefen auf den Steinplatten ein Klickern hervor, das wie ein Kastagnettentanz von den Wänden hallte, und mit eingezogenen Köpfen schlichen wir an einer Statue vorbei, die mit Marmorsandalen auf einem Marmorsockel stand, die Rechte erhoben, als wollte sie Mimi eine knallen. »Ego sum via, veritas et vita«, lautete im Sockel die Inschrift. Bald würde ich sie übersetzen können.
Links eine lange Reihe hoher Fenster, rechts schwarz glänzende Türen, alle römisch beziffert, vermutlich waren es die Schulzimmer. Eine Girlande düsterer Lampen verlängerte den Gang ins Endlose. Und kalt war’s. Eisig. So musste sich Scott gefühlt haben, als er mit der Karawane seiner hilflos stapfenden Ponys und den überfrachteten Schlitten hinausgezogen war in die Polarnacht, die ihn töten würde.
Der Gang machte einen Knick. Der Vogelmann stellte den Galizier ab und flüsterte, den Schnabel nah an meinem Ohr: »Ich warte hier.«
»Stimmt es, dass der Heilige im Krieg war?«
Mimi verdrehte die Augen. »Arthur, bitte! Ich muss noch den ganzen Weg zurückfahren, bei Nacht und Nebel.«
»Und Schnee«, pfiff der Vogel, »und Schnee, viel Schnee. Es ist die dritte Tür links.«
Keine Möbel, keine Bilder – da war einfach nichts. Nichts als Leere. Leere und ein fahles Licht aus weißen Kugellampen. Nur stehen konnte man auf dem glänzenden Linoleumbelag – oder knien. Knien und beten. Oder auf den Knien den Linoleumboden saubermachen. Und du lieber Himmel, was steckte hinter all den geschlossenen Schranktüren, die den unteren Teil der Wände bildeten? Wurden da Akten aufbewahrt, die Namen und Daten der Zöglinge: Goldau Arthur, Sohn des Hans und der Maria, genannt Mimi, einer geborenen Katz?
In einem der zahllosen Schränke tickte eine Uhr – vielleicht war sie eingeschlossen, weil der Heilige nur die Ewigkeit gelten ließ. Aber dann bimmelte es kurz. Viertel nach. Offenbar wurde selbst ein Heiliger die Zeit nicht los. Wir sahen durch ein hohes Fenster in die Nacht hinaus, wo es unaufhörlich schneite, und auf einmal spürte ich ein leises Schnauben in meinem Nacken. Ich drehte mich langsam um, und, mein Gott, er war da, herangeschwebt: der Heilige!
Unter dem schwarzen Kuttensaum sahen in abgelatschten Sandalen nackte weiße Riesenzehen hervor. Die Nägel hatten Trauerränder, auf den Gliedern sprossen schwarze Haarbüschel, und kaum zu glauben – da gab es Lücken. Einige Zehen fehlten. Es flimmerte mir vor den Augen, irgendwo knallte eine Tür zu, laut und lauter tickte die eingesperrte Zeit. Oh, wie peinlich war es, diese Zehen anzustarren! Die Füße waren mindestens so groß wie die Marmorfüße der Jesus-Statue, an der wir uns vorhin vorbeigedrückt hatten, doch kamen mir die Zehen des Heiligen, soweit überhaupt vorhanden, schrecklich nackt vor – so nackte Zehen hatte ich noch nie gesehen. Ich konnte nur hoffen, dass sich Maman entschieden hatte, dem Heiligen ins Antlitz zu sehen, sonst würde ihr übel.
Den Kopf zwischen die Schultern duckend, drehte ich den Blick vorsichtig nach oben und bemerkte, dass sich vor mir ein Riese aufgebaut hatte, größer als der Vater, schwer breit stark, doch hatte der Riese lange seidene Wimpern. Wie Mimi – seine waren allerdings blond, ihre schwarz. Und sein Geruch, sein Geruch! Der Heilige stank derart enorm nach Ziegenbock und Weihrauch, dass Mimi und ich verzweifelt versuchten, nur gerade das Nötigste an Luft hereinzuholen – was nun leider zu einer Slapsticknummer führte. Mimi und ich griffen zum Taschentuch, doch im selben Moment wurde uns bewusst, dass es der Heilige als Affront empfinden könnte, wenn wir beide, noch dazu gleichzeitig wie Synchronschwimmer, ein Tuch an die Nase hielten. Also ließen wir’s verschwinden, sie in ihren Blusenärmel, ich in die Manteltasche – nein, nicht ganz. Da auch Mimi das Tuch wegsteckte, konnte ich es ja wieder hervorziehen, und da Mimi in derselben Sekunde das Gleiche dachte, drückten wir am Ende aller Anstrengungen beide die Nase ins Taschentuch.
»Hochwürdigster Herr Pater«, ließ sich Mimi gedämpft vernehmen, »ich bin Madame Goldau. Leider haben wir uns ein wenig verspätet.«
… und auf einmal unterlief der sonst so parkettsicheren Dame ein Fehler nach dem andern. »In protestantischen Kantonen«, fuhr sie fort, »sind die Straßen eindeutig gepflegter als in den katholischen. Zum Glück ist uns ein junger Gentleman zu Hilfe gekommen, sonst wären wir im Graben zugeschneit worden – mit so einer Wetterlage rechnet man ja nicht, in den tieferen Regionen.« Dem folgten ein Seufzer und ein Klimpern ihrer schwarzen Halbmonde. »Und dann dieser Vogelmensch!«, setzte Mimi noch einen drauf, weiterhin ihr Tüchlein im Gesicht. »Puh, das war vielleicht eine Nummer! Völlig meschugge. Hat die ganze Zeit gezwitschert und gepfiffen, wie eine Drossel.«
»Die angebliche Drossel«, sprach der Heilige mit sanfter Stimme, »ist ein Armer im Geiste, der im Stift Unserer Lieben Frau Obdach und Brot gefunden hat.«
Es reichte Mimi nur zu einem Lächeln, auch der Heilige lächelte, und mir war völlig klar, dass sie meinen Einstand komplett vermasseln würde.
»Tja«, meinte sie verlegen, »das ist Arthi, unser Sohn, hochwürdigster Herr Pater.«
»Bruder«, korrigierte er sie mit einer noch sanfteren Stimme. »Gott der Herr hat es nicht gewollt, dass ich die höheren Weihen empfange. Ich bin der Bruder Frieder.«
»Bruder Frieder«, wiederholte Mimi, »Ihr Vogel-, Pardon, Ihr Pfortenmensch konnte uns leider nicht garantieren, dass Arthi einen Kühlschrank zugewiesen bekommt. Arthi ist kein besonders guter Esser, müssen Sie wissen. Deshalb habe ich mir erlaubt, ihm ein paar von seinen Lieblingsspeisen einpacken zu lassen, unter anderem eine Wildpastete.«
Auf so einen hatten sie hier gewartet – Kühlschrank Lieblingsspeise Wildpastete! Madonna, flehte ich, bitte verhindere, dass Mimi ihr Täschchen aufknipst … und schon begann sie, hektisch darin zu wühlen.
»Nach Ansicht meines Gatten«, plapperte sie ungeniert weiter, »pflegen die hochwürdigen Herren dem Himmel ein Rauchopfer darzubringen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Duft dieser Havanna auch dem lieben Gott gefällt.«
Der Heilige hob abwehrend die Pranke, aber dann, ein schelmisches Schmunzeln um die Lippen, nahm er die Gabe doch entgegen: »Grüßen Sie Ihren Herrn Gemahl von mir. Ist er im Feld?«
»Im Gebirgsmanöver.«
Maman und der Heilige lächelten wieder um die Wette, beide mit den Wimpern klimpernd, sie mit den schwarzen, er mit den blonden, aber auf einmal beugte sich der Heilige vor und betrachtete intensiv das silberne Müschelchen, das am Revers von Mimis blauem Mantel blitzte. »Na«, säuselte er, »was für ein hübsches Käferchen!«
Mimi warf mir über das geneigte Haupt einen Blick zu, der Bände sprach, und meinte süßsauer: »Ein Marienkäferchen, aber ich fürchte, Bruder Frieder, ich sollte jetzt aufbrechen. Es schneit, und stellen Sie sich vor, ich habe kein einziges Pannendreieck dabei! Ist das die Tür nach draußen? Oder landet man hier im Besenschrank?«
Sie riss eine der vielen Türen auf – und heraus glotzte das seekranke Gesicht eines jüngeren Paters. Er saß in seiner Koje an einem Schreibpult, wurde von einem Lämpchen mit grüner Haube beschienen und hielt einen Federkiel in der Rechten. Mimi, die durch die nächste Tür entkommen wollte, begann plötzlich zu lachen – auch in diesem Schrank steckte ein Pater! Er kniete auf einer Betbank und trug einen Kopfhörer mit dicken runden Hörmuscheln. Mir ging ein Licht auf. Der Oberst hatte gegen seine Frau entschieden, der aus dem Weltkrieg hervorgegangene Heilige sei der richtige Erzieher für mich, doch typisch Mimi – dank ihrem Pannentalent war es ihr gelungen, ein Schlamassel anzurichten, das nun zu ihren Gunsten ausging.
»Arthi-Darling«, flötete sie mit einem entzückenden Lächeln, »würdest du so liebenswürdig sein, mich nach Hause zu begleiten? Ich denke, das Kloster ist nichts für uns.«
Ich habe sie ziehen lassen. Ich wollte hier zum Mann gemacht werden, wie vom Vater verlangt, und vielleicht, wer weiß, war Maman an meiner Entscheidung nicht ganz unschuldig. »Rot soll er sein«, hatte sie gesagt, »ein roter Kristall. Und strahlen soll er, sogar im Dunkeln, wie ein Stern …«
Wortlos war sie davonstolziert, den linken Arm erhoben, mit dem Autohandschuh ein Winken andeutend, wobei die spitzen Absätze ihrer Stöckelschuhe eine Spur winziger Hufeisen in den Linoleumbelag stachen …
»Sie hat mir den Boden versaut«, wimmerte Bruder Frieder –
… aber da war ich schon losgerannt, hetzte erst das düstere Treppenhaus hinab, dann durch den endlos langen Gang an den schwarz gebeizten, finster glänzenden Türen vorbei ins nächste Treppenhaus, das hinunterführte zur Pforte. Abgeschlossen. Mit Ketten verriegelt. Mit Eisenstangen verrammelt. Das Kloster war eine Festung, ein Gefängnis, jetzt war ich zu spät gekommen. Heulend schlug ich meine Fäuste gegen das Portal.
»Maman«, schrie ich, »nimm mich mit! Ich werde dir immer helfen, den richtigen Schmuck auszuwählen …«
Ein schummriges Licht ging an, das Pfortenfenster wurde geöffnet, und der Pförtner mit den gerillten Brillengläsern, dem Federhütchen, dem Schnauz legte den Kopf in die Schräge.
»Ah, die Nummer 230!«, zwitscherte er amüsiert, »zu dieser Stunde noch unterwegs?«
Seine Kralle ergriff meine schweißnasse Hand und führte mich wortlos die Treppe hoch und durch den ewig langen, inzwischen noch dunkleren Gang wieder ins Innere. »Hör zu, 230«, zwitscherte er vorsichtig, das Federhütlein an die Vogelbrust gedrückt, »als alte Drossel gebe ich dir einen guten Rat. Du musst dich mit deinem Käfig arrangieren, oder du gehst ein. Natürlich kann man auch eingehen, wenn man sich arrangiert, aber die Regel ist: Pass dich an, dann überlebst du. Schau, ich habe mich auch angepasst. Vor mehr als vierzig Jahren war ich der Sängerknabe mit der reinsten Stimme und ein begabter Kunstpfeifer. Ich bin sogar mit Leo Slezak aufgetreten. Kennst du den?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Was, du kennst Leo Slezak nicht?«
»Nein«, sagte ich verwirrt.
»Das darf nicht wahr sein, 230! Leo Slezak war ein weltberühmter Tenor, aus dem Mährischen. Es war die Zeit nach dem Untergang des Habsburger Reichs. In Wien haben sie die Republik ausgerufen und das Kaiserpaar aus der Hofburg verjagt. Schlechte Zeiten für die Kunst, Geld gab es damals nur noch in der Schweiz. Ich nehme an, das war der Grund, weshalb ein so berühmter Mann wie Leo Slezak bei uns im Fürstensaal eine Operngala präsentiert hat, etwas Schöneres kannst du dir nicht vorstellen! Aus Puccinis ›La Bohème‹ sang er die Arie des Rudolf, ›Wie eiskalt ist dies Händchen‹, und als Krönung erschien er im Kostüm des Lohengrin mit Helm, Schwert und Schild und sang die Gralserzählung: ›Alljährlich naht vom Himmel eine Taube, um neu zu stärken seine Wunderkraft.‹ Wir Sängerknaben sangen die Orchesterbegleitung. Vor dem Konzert gab es eine Probe, gemeinsam mit dem berühmten Tenor, der bereits als Lohengrin kostümiert war. Er trug einen Blechhelm und einen Schild, besetzt mit lauter Juwelen, natürlich nichts Echtes, nur billige Klunker. Statt meinen Part zu singen, pfiff ich fröhlich mit. Auf einmal verstummten alle. Leo Slezak kam auf mich zu und fragte: Bist du das zwitschernde Vögelchen? Ich dachte, holla, jetzt gibt’s ein Donnerwetter!«
»Das hätte ich auch gedacht.«
»Natürlich. Jeder hätte es gedacht. Aber der große Leo Slezak, ein Mann von Weltruf, hat mich gebeten, die Stelle zu wiederholen, wie vorhin, als Vögelchen. Ich fragte: Amsel oder Drossel? Drossel, schlug er vor, ich pfiff drauflos, und du glaubst es nicht, 230, da lud er mich ein, mit ihm und seiner Truppe auf Tournee zu gehen. Ein Vogel, sagte Leo Slezak, hat uns noch gefehlt. Vielleicht hätte ich mitgehen sollen.«
»Oh ja!«
»Ach was. Hier lebt man gar nicht so schlecht. Draußen geht es sehr viel schlimmer zu. Da fallen die Menschen übereinander her. Es gibt Kriege mit Gasangriffen.«
»Nein, nur Manöver, da schießen sie mit blinder Munition. Der Feind wird supponiert, sagt der Major.«
»Supponiert?«
»Es gibt ihn nicht.«
»Und trotzdem wird er bekämpft?«
»Ja. Und immer gewinnt Papa. Sagt er jedenfalls.«
»Hast du die Zehen des Heiligen gesehen?«
»Meinen Sie die Zehen, die ihm fehlen?«
»Genau die meine ich. Früher war er Soldat. Er hat den Russlandfeldzug mitgemacht, im eisigen Winter. Da war alles echt, das kannst du mir glauben. Und warum, frag ich dich, ist der weltberühmte Leo Slezak bei uns aufgetreten? Weil in Wien alle Theater geschlossen waren, auch die Hofoper. Sie hatten keine Kohlen mehr, um die riesigen Zuschauersäle zu heizen. Da geh ich doch nicht mit nach Wien, wo alles untergegangen ist, die ganze Donaumonarchie, und stell mich auf die zugige Bühne und bringe mit den zitternden Lippen nicht einmal eine Amsel zustande, geschweige denn eine Nachtigall.«
Wir stiegen im Treppenhaus langsam die Stufen hoch, zu den Schlafsälen, und erst jetzt, da ich ihn mit vorgeschobener Lippe keuchen hörte, merkte ich, wie alt der Pfortenvogel war. »Herr Drossel«, sagte ich, »stimmt es, dass hier im Kloster ein Diamant versteckt ist?«
»Ein Diamant? Hier im Kloster?« Der Pfortenvogel verneinte. Davon sei ihm nichts bekannt. »Dein Bett findest du im Saal E, Elysium. Subpräfekt Walafried erwartet dich.«
»Vielleicht frage ich den.«
»Besser nicht, 230. Geh jetzt schlafen. Deine Klamotten habe ich eingepufft. Der Koffer ist im Dachstock, versehen mit deiner Nummer. Wenn du uns dereinst verlässt, wird er dir ausgehändigt. Ach ja, da wäre noch etwas. Du musst mir deine Schuhe geben, sie werden ebenfalls eingelagert. Am Spind hängt deine Kutte; die übernimmst du von einem älteren Zögling. Er wird dir auch seine Sandalen überlassen.«
»Tragen hier alle Sandalen?«
»Wie unser Herr Jesus Christus.«
»Auch jetzt, im Winter?«
»Winter nennst du das? Das ist nur der Anfang, 230. Der Frost kommt erst.«
»Da hätten Sie auch mit Herrn Slezak gehen können. Viel kälter wird es in der Hofoper nicht gewesen sein.«
»Nimm dich in acht, 230. Mit deinem losen Maul bringst du dich in Teufels Küche. Und erzähl niemandem, dass wir miteinander gesprochen haben. Den Diamanten gibt es nicht.«
Der Herr der Steinstadt war der Bruder Frieder. Ursprünglich war er im Fleischteil der Küche tätig gewesen und hatte als Schlachter, wie die Küchengesellen schaudernd erzählten, manchen alten Ochsen mit dem Beil erschlagen. Wie er dann zu seinem Amt als Präfekt gekommen war, würde wohl immer ein Geheimnis bleiben. Er selbst behauptete, der Abt habe ihn ernannt, doch wäre das ein veritables Wunder gewesen – der Fürstabt vom Stift Maria zum Schnee, Meinradus der Dämmerer, befand sich seit Jahr und Tag im Zustand der Erloschenheit. Nun, vielleicht war es ein Wunder, jedenfalls hatte der ehemalige Schlachter den Aufstieg aus der blutigen Küche in die erhabene Halle der Präfektur, wo alles Menschliche in Schränken weggeschlossen war, erstaunlich leicht bewältigt. Offiziell war Bruder Frieder der Praefectus puerorum (Knabenerzieher) und Psychopompos (Seelenführer), doch beherrschte er mit unumschränkter Macht das ganze Stift, auch seine Mitbrüder, und viele unter ihnen sahen im Frieder nicht den Tyrannen, sondern den Katechon, den Aufhalter des Untergangs. Die Kraft dazu hatte er, auch den Willen, die Zähigkeit. Bruder Frieder ließ die Risse in den Wänden verfugen, die feuchten Flecken übertünchen, ächzende Balken im Dachstuhl ersetzen, schiefe Mauern stützen, zerbrochene Scheiben reparieren. Die Haare der Zöglinge hielt er kurz. Wer nicht zur Beichte ging, wurde abgemahnt. Wer zu spät zum Morgengebet, zum Studium oder zu einer Mahlzeit erschien: Küchendienst. Ein schludrig gemachtes Bett: Putzdienst; Schwätzen in der Silentium-Zone: Schneeschippen. Wenn man in der Rekreation (Erholung) zu zweit, nicht in einer Gruppe wandelte, musste man damit rechnen, einem Verhör über »krankhafte Neigungen« unterzogen zu werden, und wer allein in einer Fensternische stand, wo er hinausstarrte in das unaufhörliche Schneien, setzte sich dem Verdacht aus, heimlich Gedichte zu verfassen. Eine Abweichung vom Mittelmaß, also besonders gute oder schlechte Leistungen, erregten den persönlichen Zorn des Psychopompen, dem alles Auffällige verhasst war. »Individualismus« hielt er für eine Todsünde. Stoffe, Teppiche oder Pflanzen tolerierte er ausschließlich in der Kathedrale. Unsere Kutten waren schwarz wie die Kruzifixe an den weiß gekalkten Wänden, und nur entzündete Pickel in den wachsbleichen Gesichtern oder die fleischige Unterlippe von Vizepräfekt Maria Servilius tupften etwas Farbe in die gräuliche Luft. Das erste Gebot der Steinstadt lautete: Sei wie alle, Maß Mitte Durchschnitt. Ein talentierter Orgelspieler, der von seiner Brillanz nicht lassen wollte, wurde mehrmals zu Strafexerzitien verurteilt, und die Patres waren angehalten, begabten Schülern die Flügel zu stutzen.
Unermüdlich war der Bruder Frieder tätig, und obwohl er sich im russischen Winter mit einer Rosenschere vier erfrorene Zehen abgezwackt hatte, war keiner länger auf den Beinen als er, der demütigste Diener an der Gemeinschaft, der Heiligmäßige schon zu Lebzeiten, der von einfältigen Gemütern sogar als Nothelfer angebetet wurde. Mitten in der Nacht trug er einen Fiebernden ins Lazarett, in der Frühe schaufelte er Kohlen in die Heizungskessel, nachmittags empfing er eine Pilgergruppe zum geistlichen Gespräch, und wenn die tumben Küchengesellen mit dem Waschen der Kutteln im Verzug waren, eilte er ihnen zu Hilfe, um eigenhändig die Fütterung der immer hungrigen Mäuler sicherzustellen.
Im länglichen Speisesaal führte ein Mittelgang auf das mächtige, den ganzen Saal dominierende Kruzifix zu. Unter ihm thronte auf einer kleinen Bühne die Heilige Dreifaltigkeit: in der Mitte Bruder Frieder, ihm zur Rechten Vize Servilius, ihm zur Linken Subpräfekt Walafried.
Es war ein Ritual, das sich dreimal täglich wiederholte: Wenn sich die Heilige Dreifaltigkeit die fettgefleckte Serviette in den Kalkkragen gestopft und sich an der Tafel niedergelassen hatte, krachten wir Zöglinge auf die Stühle und konnten es kaum erwarten, bis der Wagen mit den Speisen in den Saal gefahren wurde. Dieser Wagen verfügte über mehrere Etagen und wurde von zwei buckligen, apathisch glotzenden Küchengesellen durch den Mittelgang geschoben, so dass die beiden Tischsenioren, die ihre Plätze am Gang hatten, die Platten aus den Etagen ziehen und sich als Erste schöpfen konnten. Dann gaben sie die bereits etwas reduzierten Speisen weiter, die nächsten packten ebenfalls zu, und da wir pro Tisch acht Mann waren, nach Klassen gestuft, wurde ein Frischling, der ganz unten am Schluss der Tafel hockte, Biafra genannt (nach einem afrikanischen Hungergebiet). Ein Biafra tat gut daran, der Tischordnung eine Lehre fürs Leben zu entnehmen: Friss oder stirb.
War das Essen nach 27 Minuten beendet, erhob sich die Dreifaltigkeit, und mit diabolischer Lust verfolgten dreihundert Augenpaare, wie es dem Subpräfekten Walafried mit schöner Regelmäßigkeit misslang, die Serviettenrolle synchron mit Bruder Frieder und Vize Servilius durch den Silberring zu stecken.
»Mikro!«, fauchte Frieder dem Vize zu.
Der gab den Befehl an den Sub weiter, »Mikro!«, worauf sich der Sub an den Pfortenvogel wandte, der gerade dabei war, neben der Bühne einen Kabelsalat zu entwirren: »Drossel, schalt endlich das Mikro ein!«
Die Blechtrichter, die über unseren Nacken unterm Gewölbe hingen, gaben ein Knistern von sich, dann donnerte die Durchsage des Allmächtigen wie ein Düsenjäger über dreihundert sich duckende Köpfe hinweg: »Unverzüglich in der Präfektur einzufinden hat sich der Zögling 101.«
Der Aufgerufene erblasste – als hätte ihn der Lautsprecherkübel mit Kalk übergossen. Beim Verlassen des Saals drängten wir von ihm weg, und hinter vorgehaltener Hand teilte uns ein Spitzel mit: »Die 101 war hinter dem Roten Diamanten her.«
… es gab ihn nicht, doch war er ein Wort, eine Sage, ein Gerücht, ein Gerücht im Kloster Maria zum Schnee, eine Sage in der Wüste. Und wenn die Karawanen rasteten, die Kameltreiber und Kaufleute um das Feuer saßen und über ihnen die Sterne funkelten, war da stets ein Weitgereister, der einen kannte, der ihn gesehen hatte mit eigenen Augen: den Roten Diamanten. Und die Kaufleute und Kameltreiber, die der Sage lauschten, trugen sie in die Städte aus Marmor und in die Stadt aus Messing, und kam die Rede auf ihn, erglänzten die Augen der Lauschenden, als würden sie ihn sehen: den Roten Diamanten. Vom Himmel sei er gefallen, meinten die einen, und andere wussten zu berichten, dass er in den Regenwäldern hinter den Quellen des Nils dem Schoß der Erde entstiegen war. Dort ließen die Herrscher jener Zeiten nach ihm suchen, doch mussten Jahrhunderte, gar Jahrtausende vergehen, bis er aus der afrikanischen Unendlichkeit wieder auftauchte: im ägyptischen Theben, laut Homer »die Königsstadt der hundert Tore«. Die Stadt lag am Nil, und ein Steinfisch hatte das Ei aus Kristall in ein verlassenes Schwanennest erbrochen. Priester errichteten dem göttlichen Fund einen Altar, und siehe da, nicht nur in der Glut der Sonne, auch im Widerschein des Nachthimmels flammte er wie Feuer, ein Feuer, das keiner Nahrung bedurfte.
Die Kunde der Ewigen Flamme flackerte nilabwärts in die Welt hinaus, worauf Glücks- und Goldsucher aller Länder zu Kamel, zu Pferd, auf Eseln und Barken herbeijagten, um einen Funken der Ewigkeit zu erhaschen. Die Zinnen über jedem der hundert Tore waren von Pfeilschützen besetzt, aber die Anstürmenden waren zu zahlreich, die Tore barsten, und die eben noch glücksberauschte Königsstadt verwandelte sich in eine Flammenhölle. Als der Rauch verweht, die Asche erkaltet und die einst stolze Umfassungsmauer des königlichen Theben eine verkohlte Ruine geworden war, war auch der Stein verschwunden, doch nicht die Sage, nicht das Gerücht, nicht sein Name, und auf einmal war er wieder da, er, der Rote Diamant: am Hals der Königin Kleopatra.
Kleopatra glaubte gegen Rom bestehen zu können, indem sie sich den zwei mächtigsten Römern hingab, erst Julius Cäsar, dann Marcus Antonius. Als Antonius von Augustus besiegt wurde, verlor Kleopatra nicht nur den Geliebten, sondern auch ihre Macht – in den eigenen Gemächern wurde sie zur Gefangenen, und als sie hörte, man werde sie im Triumphzug durch Rom führen, am ledernen Halsband, wie eine Hündin, bat sie um einen Korb mit Feigen. Plutarch berichtet, dass der Korb anstandslos die Wache passierte, denn die entthronte Königin war nackt auf ihrem Lager hingegossen, und die Wächter, römische Legionäre, hatten nur Augen für Kleopatras Brüste, zwischen denen ein Stern strahlte, der Rote Diamant. Kaum war sie wieder allein, nahm die Gefangene zwei Vipern aus dem Korb und setzte jede an eine Brust. Die Vipern bissen zu, und als das brennende Gift in sie einströmte, stöhnte die sterbende Königin wie in einer lustvollen Umarmung. Es war der Tod, der sie umarmte. Die Vipern entkamen – in eine Mauerritze, behauptete der eine Wächter; durch das vergitterte Fenster in den Garten, schwor der andere, und noch unter dem Galgen beteuerten beide, mit den Vipern sei auch er verschwunden, der Heilige Stein, der Rote Diamant.