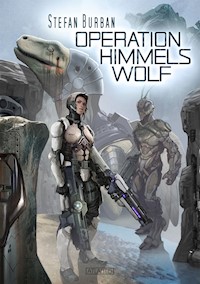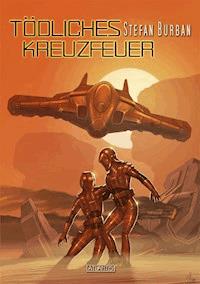8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das gefallene Imperium
- Sprache: Deutsch
Die durch die Schlacht um das Solsystem erzwungene Waffenruhe ist vorüber. Die Nefraltiri nehmen die Invasion wieder auf und schicken ihre Horden erneut gegen die Menschheit in den Kampf. Die Sklavenarmeen der Nefraltiri zerschlagen dabei den Widerstand jeder Welt, die auf ihrem Weg liegt. Die menschlichen Sternennationen unter Führung der Republik, leisten erbitterten Widerstand. Es gelingt ihnen aber lediglich, den Vormarsch des Feindes zu verlangsamen, jedoch nicht zu stoppen. Als dann nach einer blutigen Schlacht auch noch der Planet Sultanet, das Hauptquartier des republikanischen 12. Korps, fällt, steht die Menschheit endgültig am Abgrund. Über der Welt Argyle II kommt es schließlich zur schicksalhaften Begegnung. Dort rüstet sich die Republik für ihr letztes Gefecht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Teil I. Aufmarsch
1
2
3
Teil II. Konfrontationen
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Teil III. Die Republik am Abgrund
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Epilog
Weitere Atlantis-Titel
Prolog
Stiefelschritte hallten blechern über das Deck. Für einige wohltuende Sekunden war es das Einzige, was Professor Gustavo Ericssons Ohren vernahmen.
Dann setzte erneut der Schrecken ein, in all seiner Klarheit, all seiner Prägnanz. Das Stottern von Nadelgewehren erfüllte von einem Moment zum nächsten die Luft. Die Kampfgeräusche wurden als unheimliche Echos von den Wänden des Forschungsschiffes zurückgeworfen. Es dröhnte so stark durch Ericssons Kopf, dass er den Eindruck gewann, seine Trommelfelle würden bersten. Er hielt sich die Ohren mit aller Kraft zu. Er wusste, was nun folgen würde. Dasselbe, was schon auf jedem Deck, angefangen bei den Laboren, geschehen war. Die Nadelgewehre verstummten. An ihre Stelle trat das Schreien der Legionäre, die immer noch versuchten, Widerstand zu leisten.
Die schrillen Laute erstarben mit einer Plötzlichkeit, die fast mehr an den Nerven zerrte als die Todesschreie der Soldaten zuvor.
Eine Tür zu seiner Rechten öffnete sich. Eine Laborassistentin taumelte heraus und fiel ihm praktisch in die Arme. Er fing sie auf und ließ sie zu Boden gleiten. Das Ding in seinem Griff war noch am Leben, aber kaum mehr menschlich zu nennen. Die Frau blutete aus Ohren, Nase, Mund und Augen. Sie starrte ihn aus großen Pupillen an, nicht länger der menschlichen Sprache fähig. Das Grauen stand ihr ins Gesicht geschrieben.
Ihr Name war Sybille irgendwas, meinte er sich zu erinnern. Er hatte kaum drei Sätze mit ihr gewechselt, seit er auf die Charlotte versetzt worden war. Sie schien ein freundliches, hilfsbereites Wesen gehabt zu haben. Nun bereute er, sie nicht näher kennengelernt zu haben. Die Erinnerungen, die die Menschen an Bord im Verstand anderer hinterließen, waren vielleicht das Einzige, was von ihnen allen übrig bleiben würde.
Etwas brüllte hinter ihm. Sein Leib zitterte fast unkontrolliert. Erst mit einiger Verspätung erkannte er, dass das Geräusch nicht real gewesen war, jedenfalls nicht in dem Sinne, den ein Mensch darunter verstehen würde. Das Brüllen hatte in seinem Geist stattgefunden.
Nass vor Angstschweiß, ließ er den Kopf der sterbenden Frau los und rannte weiter. Wohin er auch sah, der Wahnsinn grassierte. Die Besatzung der Charlotte begann, übereinander herzufallen. Kollegen und Freunde, die sich schon seit Jahren kannten und zusammen arbeiteten, schlachteten sich gegenseitig euphorisch lachend ab. Nicht wenige begingen anschließend Selbstmord.
Gustavo sprang über Leichen und kämpfende Menschen hinweg. Sein Ziel war klar. Es gab lediglich einen wirklich sicheren Ort an Bord: die Kommandobrücke. Sie war der einzige abgeschirmte Bereich, der noch nicht überrannt worden war. Wenn er die Brücke erreichte, hatte er eine Chance.
Gustavo bemühte sich auszublenden, was rings um ihn vor sich ging. Er sah Menschen sterben, die er geschätzt hatte. Nur das Wissen, dass er nichts für sie tun konnte, half ihm, entfernt so etwas wie geistige Gesundheit zu bewahren.
Voraus tauchte der Zugang zur Kommandobrücke auf. Etwa zwanzig Legionäre eskortierten einen alten Mann, der sich auf einen Gehstock stützte. Die Gruppe wurde vom Captain der Charlotte respektvoll begrüßt und mit einer einladenden Handbewegung dazu eingeladen, die Brücke zu betreten. Bei dem alten Mann handelt es sich um den Forschungsleiter der Charlotte. Er hatte all die Experimente auf dem Schiff initiiert. Unter seiner Leitung war hier alles eskaliert. Und nun machte er sich einfach aus dem Staub und ließ den Rest elendig krepieren.
Ericsson wusste nicht einmal, wie der Mann hieß. Sein Dienstgrad innerhalb der Hierarchie des Schiffes rangierte so weit unter diesem Mann, dass dieser für ihn fast einen Halbgott darstellte.
»Warten Sie!«, brüllte er. »Bitte warten Sie auf mich!«
Der Leiter der Einrichtung hielt kurz inne, drehte sich um und sah ihm für einen Moment direkt in die Augen. Anschließend gab er einen knappen Befehl. Die Legionäre zogen sich auf die Kommandobrücke zurück und zu Ericssons Schrecken begannen die Stahllamellen, mit denen der Zugang gesichert werden konnte, sich gnadenlos aufeinander zuzubewegen.
»Nein!«, brüllte er erneut. »Das können Sie doch nicht machen!«
Doch es war zu spät. Das Letzte, was Ericsson von dem Forschungsleiter mitbekam, war der mitleidlose Blick, mit dem dieser ihn bedachte. Die Stahllamellen schlugen mit endgültigem Ton gegeneinander, gerade als er sie erreichte. Der Wissenschaftler prallte dagegen. Seine Fingernägel kratzten am blanken Metall, unfähig aufzugeben. Der Zugang blieb ihm allerdings trotz jeglicher Anstrengung verwehrt.
Ericsson rutschte zu Boden. Seine gesplitterten Fingernägel hinterließen blutige Striemen an der Brückenpanzerung. »Das könnt ihr doch nicht machen!«, jammerte er immer leiser werdend. »Seid doch keine Unmenschen.«
Mit einem Mal hob er den Kopf. Der Korridor hinter ihm war plötzlich seltsam still. Jeglicher Kampf schien beendet zu sein. Er wandte sich langsam um. Er keuchte. Eine Menge hatte sich versammelt und starrte ihn an aus toten Augen, bar jedes Lebensfunkens. Viele von ihnen waren so schwer verletzt, dass man sich wundern musste, wie sie überhaupt noch aufrecht stehen konnten. Sie musterten ihn ungerührt, beseelt von einem Willen, der nicht länger der ihre war.
Ericsson kauerte sich auf den Boden, den Kopf in den Händen vergraben. »Was haben wir nur getan?«, heulte er. »Was haben wir nur Schreckliches getan?«
Das Wesen, das von niederen Völkern als Nefraltiri bezeichnet wurde, merkte auf. Es besaß keinen Namen. Nefraltiri besaßen nichts Derartiges. Sie verfügten auch nicht über eine Sprache, die man wirklich als solche bezeichnen konnte. Ihre Kommunikation untereinander lief lediglich über Eindrücke, Bilder, Gedanken und Gefühle ab. In dieser Form funktionierte auch ihre gegenseitige Identifikation. Die Notwendigkeit, Namen zu führen, hatten sie im Laufe unzähliger Äonen bereits abgelegt. Inzwischen empfanden sie dies als etwas beinahe Obszönes.
Hätte die Spezies der Nefraltiri noch etwas Derartiges wie Namen oder eine Sprache besessen, dann wäre das Wesen, das sich regte, wohl am ehesten als Licht-in-der-Stille-des-schwarzen-Ozeans bezeichnet worden. Oder auch in aller Kürze einfach nur als Licht.
Licht regte sich und griff mit seinen Sinnen hinaus. Es spürte eine Präsenz inmitten der Sterne, von der es geglaubt hatte, sie nie wieder wahrnehmen zu dürfen.
Licht stupste einen seiner Artgenossen mental leicht an. Dessen Bezeichnung ließ sich am besten mit Blatt-im-übermächtigen-Sturm in Worte fassen. Er befand sich an Steuerbord von Lichts Schwarmschiff, auf der Brücke seines eigenen.
Sturm regte sich kaum. Dessen Gefühlswelt konnte man allenfalls mit Depression gleichsetzen. Davon wurde derzeit das, was von den Nefraltiri noch übrig war, durchsetzt und es schien für keinen von ihnen ein Entkommen zu geben. Zumindest war dies bisher der Fall.
Sturm!, drängte Licht erneut.
Lass mich in Ruhe, gab sein Artgenosse unwirsch zurück. Ich bin beschäftigt.
Mit Schmollen?, fragte Licht in Gedanken. Er machte nicht einmal den Versuch, seine Belustigung zu verbergen. Findest du das nicht etwas unter deiner Würde?
Schmollen ist etwas für niedere Lebensformen, erwiderte Sturm, der langsam aus seiner Apathie erwachte. Ich denke über den Sinn meiner Existenz nach.
Was immer du gerade machst, hör auf damit, antwortete Licht. Hast du das soeben auch gespürt?
Nein.
Die einsilbige Antwort seines Artgenossen verärgerte Licht. Dann öffne deinen Geist. Greif mit deinen Sinnen hinaus in die Weite des Universums.
Sturm übertrug etwas, das man wohl als Seufzen bezeichnen konnte, wäre er ein Mensch gewesen. Natürlich hätte Sturm überaus zornig reagiert, hätte Licht diesen Vergleich tatsächlich in den Raum gestellt. Aber Sturm fügte sich. Das war immerhin schon ein Fortschritt.
Sturm zögerte. Licht bemerkte dessen anfängliche Verwirrung, schließlich aufkeimende Hoffnung. Das ist unmöglich, gab der Nefraltiri zum Ausdruck.
Dann spürst du es also auch? Licht war kaum in der Lage, seine Freude im Zaum zu halten.
In der Tat, bestätigte Sturm. Was machen wir jetzt? Es sind nur noch wenige von uns übrig. Eine direkte Konfrontation mit den Menschen erscheint mit kaum ratsam. Bisher hat jeder Konflikt dazu geführt, dass am Ende noch weniger von uns übrig waren.
Ich stimme dir zu, überlegte Licht. Die Schwarmschiffe in den Bereich ihrer Streitkräfte zu führen, könnte sich als fatal erweisen. Aber zum Glück gibt es Alternativen.
Sollen wir die anderen konsultieren?, fragte Sturm.
Das scheint mir unumgänglich, bestätigte Licht. Aber zuvor müssen noch gewisse Steine ins Rollen gebracht werden.
Mit einem simplen Gedanken, rief der Nefraltiri einen seiner Untergebenen zu sich. Die Tür zur Brücke des Schwarmschiffes öffnete sich und ein bulliger, hochgewachsener Hinrady trat ein.
Das normalerweise schwarze Fell war von tiefen, grauen Furchen durchzogen. Der Hinradyoffizier war schon sehr alt, selbst für die Verhältnisse seines eigenen Volkes.
Der Hinradygeneral verneigte sich vor Licht, bis seine Stirn den Boden berührte. Für die Hinrady waren Nefraltiri Götter. Lichts Spezies wurde bereits derart lange von niederen Lebensformen angebetet, dass sie inzwischen selbst daran glaubten, Götter zu sein.
Aus diesem Grund hatten die enormen Verluste, die sie während der Schlacht um die Menschenwelt erlitten hatten, die ganze Spezies auf einer tief emotionalen Ebene verstört. Götter starben eigentlich nicht. Und doch waren Dutzende von ihnen im Schlund eines Schwarzen Loches verschwunden. Für immer verloren.
Seit jener Schlacht überdachten die Nefraltiri ihr weiteres Vorgehen. Sie verspürten nun eine Emotion, die sie seit langer Zeit nicht mehr gekannt hatten: Angst.
Angst um das eigene Leben. Angst um den Fortbestand ihrer Art. Angst ganz allgemein. Diese Emotion hatte sie zögerlich gemacht. Unsicher. Nicht mehr auf das ferne Ziel fokussiert.
Bei der Schlacht um die Menschenwelt hatten sie so viel mehr verloren als Schwarmschiffe und Artgenossen. Sie hatten die Larve der Königin verloren. Damit war alles vorbei.
An die vielen toten Jackury und Hinrady dachte Licht noch nicht einmal. Nachschub an Sklaven gab es immer. Sie waren wertlos und eigentlich nur zum Verheizen geeignet. Die Nefraltiri waren der strahlende Stern in einem feindlichen, dunklen Universum. Nur sie zählten wirklich. Warum verstanden die Menschen das nicht?
Licht konzentrierte sich auf die vorliegende Problematik. Nun besaß ein Ereignis das Potenzial, die Dinge wieder ins Rollen zu bringen. Und Licht gedachte nicht, diese Chance zu verspielen.
Nefraltiri besaßen keine Augen, dennoch wusste der Hinradygeneral namens Nakatiritomi, dass die Aufmerksamkeit seines Herrn ganz allein ihm galt. Der alte Krieger richtete sich auf.
Sammle deine Truppen, befahl Licht und war kaum in der Lage, seine Vorfreude zu verhehlen. Ich habe eine Aufgabe für euch.
Die TRS Hector glitt jenseits der Systemgrenze des Darimor-Systems aus dem Hyperraum. Die Sensoren des Tarnkreuzers tasteten die nähere Umgebung ab.
Captain Alvaro Gutierrez warf seiner XO einen kurzen Blick zu. Diese erwiderte ihn kühl und schüttelte den Kopf, bevor sie sich erneut ihrer Station zuwandte.
Alvaro leckte sich über die Lippen und aktivierte über einen Schalter an seiner rechten Lehne eine Komverbindung. »Keine Feindschiffe in unmittelbarer Nähe«, informierte er die Person am anderen Ende. »Einsatz beginnen.«
Die Hector war nicht groß genug, um ein Sturmboot für eine volle Zenturie in seinen Beiboothangars aufnehmen zu können. Daher trug sie das Landungsschiff unter dem Rumpf an einer speziellen Aufhängung.
Ohne eine Antwort koppelte das Sturmboot ab und nahm Kurs auf den einzigen Planeten des Systems, auf dem komplexeres Leben möglich war. Der Pilot nutzte dabei geschickt die Überreste der Schlacht, die vor über sieben Jahren hier stattgefundenen hatte.
Lieutenant Colonel Amanda Carter trat aus dem Personenabteil ins Cockpit und spähte über die Schulter des Piloten hinweg. Angesichts der Vielzahl an zerstörten menschlichen Schiffen, rümpfte sie die Nase.
Darimor hatte zur Kooperative gehört und war während der zweiten Welle von den Hinrady überrannt worden. Das war kurz vor der Schlacht um die Erde gewesen.
Carter erinnerte sich nur mit Schaudern an die damaligen Ereignisse. War diese Schlacht tatsächlich schon sieben Jahre her? Ihr kam es vor, als hätte sie erst gestern stattgefunden. Lebendige Albträume hielten sie immer noch nachts wach. Diese Schlacht machte auf sie auch heute noch den Eindruck, als hätte diese lediglich aus Fleisch und Zähnen bestanden. Viel zu viele ihrer Kameraden waren damals von den Jackury in Stücke gerissen oder von den Hinrady zermalmt worden.
Ihr Blick fiel auf das Abzeichen an ihrer Rüstung: ein Falke auf einer Baumkrone, der wachsam in die Ferne starrte.
Nach der Schlacht um das Solsystem hatte man das Militär der Republik leicht neu angeordnet. Die Fremdenlegionen waren aufgelöst und in das republikanische Militär eingegliedert worden, um die überall klaffenden Lücken in der Aufstellung zu stopfen.
Carter hatte dabei aufgrund ihrer Erfahrung eine eigene Legion erhalten und durfte sogar den überwiegenden Teil ihrer ehemaligen Fremdenlegionäre mitnehmen. Man hatte den Moment zudem genutzt, neue Einheiten ins Leben zu rufen, die man im Kampf gegen den Feind dringend benötigen würde.
Carter kommandierte inzwischen die 5. FAL, also die 5. Fernaufklärungslegion. Sie war Teil des 12. Korps auf Sultanet. Jeder Soldat der Fünften hatte sich das Motto der Legion auf die rechte Wange tätowiert: Honoris, Fide, Amet – Ehre, Treue, Pflicht.
Carter beobachtete missmutig den Planeten, dem sie sich näherten. Weder die Nefraltiri noch die Hinrady waren in den letzten sieben Jahren weiter vorgerückt, was es der Republik und ihren Verbündeten gestattet hatte, aufzurüsten und sich auf den nächsten Schlagabtausch vorzubereiten.
Dennoch stellte sich jedermann die Frage, würde das auch reichen, wenn sich der Feind dazu entschloss, den Vormarsch wieder aufzunehmen? Im Moment bestand so etwas wie ein unausgesprochener Konsens, das Gebiet der jeweils anderen Seite nicht mit Invasionsflotten oder groß angelegten Offensiven zu bedrohen. Das bedeutete aber nicht, es herrschte Frieden. Ganz sicher nicht.
Kämpfe und Grenzscharmützel waren an der Tagesordnung und immer wieder verschwanden Schiffe auf Patrouille. Etwas lag in der Luft und jeder spürte den kommenden Sturm bereits am Horizont aufziehen.
Immerhin hatte der Feind seine Strategie in der letzten Phase des Krieges geändert. Er setzte die Jackury nicht mehr verschwenderisch ein. Darimor zum Beispiel war von einer großen Hinradystreitmacht eingenommen worden, aber ohne Unterstützung durch Jackurynester.
Der Grund hierfür war ganz simpel. Eine Welt, die von den Jackury überrannt wurde, ließ sich von keiner Seite mehr nutzen. Und die Hinrady hatten inzwischen beschlossen zu bleiben. Auf Darimor stand eine umfangreiche Hinradygarnison, welche auch den Grund für Carters Anwesenheit im System darstellte.
Sie klopfte dem Piloten leicht auf die Schulter. Dieser wandte den im Helm steckenden Kopf in ihre Richtung.
»Irgendwelchen Sensorechos?«
»Nicht auf unserer Flugbahn«, gab er zurück. »Ein paar Feindschiffe sind gerade hinter dem Planetenhorizont verschwunden. Bis die wieder in Sensorreichweite kommen, sind wir längst unten.«
Carter nickte zufrieden. »Endlich verläuft auch mal was nach Plan.« Trotz ihrer Worte behielt sie die Scanner und Sensoren auf der Armaturenleiste des Sturmboots genau im Blick. Aber die Aussage des Piloten schien zutreffend. Der Weg war frei.
Amanda spähte zum Cockpitfenster hinaus. »Was ist mit dem zweiten und dritten Mond? Können wir dort irgendwelche Aktivitäten ausmachen?«
Der Pilot schüttelte den Kopf. »Die liegen gerade mal in Sensorreichweite, aber auch dort nichts Besonderes. Hoffen wir mal, dass es so bleibt.«
Amanda nickte. Laut den neuesten Aufklärungsberichten der FAL-Einheiten und der Schattenlegionen unterhielten die Hinrady auf beiden stellaren Objekten gut gesicherte Flottenstützpunkte. Das Fehlen jeglicher Aktivität hätte sie eigentlich beruhigen müssen, stattdessen war das Gegenteil der Fall. Ein flaues Gefühl machte sich in ihrer Magengegend breit.
»Bringen Sie uns runter, so schnell es die Sicherheitslage erfordert. Ich kann es kaum erwarten, mir die Lage vor Ort anzusehen.«
Das Sturmboot setzte inmitten eines von Leben erfüllten Dschungels auf. Der Pilot und einige Legionäre blieben zurück, während der Rest der Zenturie sich auf den Weg zum Treffpunkt machte.
Die Soldaten trugen Rüstungen der neuesten Generation. Das war einer der wenigen Vorteile, die Einheiten der Fernaufklärung genossen. Die Rüstungen verfügten über Systeme zur Geländetarnung. Im Klartext bedeutete es, die Panzerung nahm die Farben der jeweils vor Ort herrschenden Strukturen an.
In der Wüste färbten sich die Rüstungen in mehrere Braun- und Beigetöne, in einer Stadt wandelte sich ihr Erscheinungsbild in Grau und im Dschungel nahmen die Panzeranzüge verschiedene Grüntöne an, die in verwaschenen Streifen über Kopf und Torso bis hinunter zu den Beinen verliefen.
Carter führte ihre Truppe fast eine Stunde lang durch unwegsames Gelände. Nicht selten mussten sie durch flache, beinahe moorartige Gewässer waten. Ihre gepanzerten Beine machten jedes Mal schmatzende Geräusche, sobald sie sich aus dem Morast hoben.
Ihre Leute waren wie die Maultiere beladen mit allerhand Gepäck. Geschenke für die Einheimischen, wie die Legionäre es flapsig bezeichneten. Es war nicht respektlos gemeint, aber Carter war kein Freund von derartigen Scherzen.
Das Grünzeug ringsum raschelte mit einem Mal verräterisch. Carter hob die gepanzerte Faust. Die Kolonne hinter ihr kam unvermittelt zum Stehen.
Der Dschungel wurde lebendig, als Dutzende Bewaffneter aus ihren Verstecken traten. Die Menschen boten einen mitleiderregenden Anblick. Schmutzverkrustete Kleidung hing an ausgemergelten Gestalten herab. Die Körper waren kaum massig genug, um Hosen und Hemden überhaupt auszufüllen. Viele standen am Rande der Unterernährung. Die Waffen in ihren Händen jedoch befanden sich in erstklassigem Zustand.
Die meisten trugen Nadelgewehre, aber es waren auch Hinradywaffen zu sehen. Die Menschen boten das typische Bild einer Widerstandsbewegung, wobei der Begriff bezogen auf die jetzige Situation etwas zu romantisch veranlagt war. Eine Widerstandsbewegung wurde dazu aufgestellt, den Feind anzugreifen. Diese Menschen hatten nur den Wunsch zu überleben. Und das schaffte man auf einer vom Feind besetzten Welt am besten, indem man den Flohteppichen aus dem Weg ging.
Carter schlang sich die Schlaufe des Nadelgewehrs um die Schulter und hob anschließend beide Hände. Sie öffnete ihren Helm und sah sich aufmerksam in der Runde um, bis sie denjenigen fand, nach dem sie Ausschau hielt.
Ihre Lippen verzogen sich zu einem erfreuten Lächeln. »Begrüßt man auf diese Weise seine Freunde, Gaston?«
Der Angesprochene grinste und senkte das Nadelgewehr. »Vorsicht ist besser, als sich die Radieschen von unten anzusehen«, erwiderte dieser frotzelnd.
Gastons Leute entspannten sich, während ihr Wortführer näher trat. Carter umarmte den Anführer der auf Darimor lebenden Menschen herzlich. Seine Leute strömten auf die Legionäre zu und auch dort begrüßten bekannte Gesichter einander mit offenen Armen. Die Widerstandskämpfer nahmen den Soldaten die mitgebrachten Güter ab. Nachdem sich Carter und Gaston voneinander trennten, bedeutete der Mann der Offizierin mit einem Kopfnicken, ihm zu folgen.
Sie schloss sich ihm bereitwillig an. Während sie durch die Wildnis stapften, begutachtete sie ihn aus dem Augenwinkel. Er wirkte sichtlich gealtert seit ihrem letzten Zusammentreffen vor vier Monaten. Außerdem war er dünner als damals. Die Versorgungslage musste prekär sein.
»Gab es Schwierigkeiten?«, wollte sie wissen.
Gaston schüttelte den Kopf. »Das Übliche. Ein paar Zusammenstöße mit den Flohteppichen. Ein paar Patrouillen gingen verloren und der Kontakt zu zwei Siedlungen ist abgebrochen. Aber in den letzten zwei Monaten hatten wir keine nennenswerten Probleme mehr.«
Mitgefühl ergriff von Carter Besitz. Der Mann sprach dermaßen ungerührt über den Tod von Menschen und den Verlust von Siedlungen, dass man den Eindruck gewinnen könnte, er wäre völlig abgestumpft. Nur wenn man ganz genau hinsah, bemerkte man eine einzelne Träne in seinem Augenwinkel. Der Mann trauerte. Wenn auch lautlos, aber er trauerte definitiv.
Gaston schob einiges an Blätterwerk beiseite und sie betraten endlich die größte Gemeinschaft, die auf Darimor übrig war.
Carter mochte sich vielleicht täuschen, aber sie kam ihr wesentlich kleiner vor als bei ihrem letzten Besuch.
Mehrere Frauen und ältere Kinder standen um Lagerfeuer herum und bereiteten das Abendessen zu. Es handelte sich um eine Suppe, die mehr aus Wasser denn aus wirklichem Inhalt zu bestehen schien. Kein Wunder, dass die Menschen hier wirkten, als wären sie Gespenster – mehr tot als lebendig.
»Dürfen wir euch zum Abendessen einladen?«, fragte Gaston galant.
Am liebsten hätte Carter abgelehnt. Diese Menschen hatten ohnehin nicht viel und sie waren auch noch bereit, das wenige zu teilen. Aber sie wusste, diese Leute würden sich in der Gegenwart der Legionäre eher entspannen, wenn sie ein gemeinsames Mahl zu sich nahmen. Also nickte sie ergeben und zwang sich zu einem schmalen Lächeln.
Die von den Legionären mitgebrachten Säcke enthielten zuallererst Grundnahrungsmittel und Medikamente. Diese wurden begeistert aufgenommen und sofort angemessen verteilt.
Des Weiteren übergaben die Legionäre Gastons Leuten kistenweise Waffen und Munition, damit sie sich im Fall eines Angriffs wenigstens ihrer Haut erwehren konnten.
Auf Carters wortlosen Wink hin setzten sich die Legionäre der Zenturie und verteilten sich um die Lagerfeuer. Ihr Blick blieb wachsam.
In der letzten Phase der Invasion hatten die Hinrady mehr als zwei Dutzend Welten so schnell überrannt, dass nicht alle Einheimischen hatten evakuiert werden können. Carter rümpfte die Nase. Die Menschen waren zeitweise sehr gut im Organisieren von Rückzügen geworden. Das war ein bitteres Manko, dem sich das republikanische Militär irgendwann würde stellen müssen.
Die Zurückgebliebenen hatten Gemeinschaften wie diese gegründet, verborgen in der Wildnis, der ständigen Gefahr ausgesetzt, von ihren Feinden entdeckt zu werden.
Die Republik sowie die Sternennationen, die es noch gab, organisierten in regelmäßigen Abständen Versorgungsflüge auf die besetzten Welten, um diese Menschen wenigstens mit dem Notdürftigsten zu versorgen und um sie wissen zu lassen, dass man sie nicht vergessen hatte.
Im Gegenzug hielten die Widerstandskämpfer Augen und Ohren offen und versorgten die Republik mit Informationen direkt aus dem Feindgebiet. Diese Leute konnten an Orte gehen, die selbst den FAL oder den Schattenlegionen verschlossen blieben.
Es war im Prinzip eine Win-win-Situation. Carter beobachtete, wie eine Frau Essen an mehrere Kinder austeilte, und sie senkte betrübt den Kopf – falls man das wirklich so nennen konnte.
Gaston setzte sich zu ihr und reichte der Offizierin eine Schale mit Suppe. Der Inhalt sah aus wie eine Dreckpfütze. Sie nahm einen Bissen. Erfreulicherweise schmeckte die Pampe nach gar nichts und nicht so, wie sie aussah.
Sie wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab und schielte zu Gaston hinüber. »Gute Suppe«, lobte sie. Der Mann lächelte verhalten und stocherte in seiner eigenen Schale herum. Natürlich war sie nicht in der Lage, ihn zu täuschen. Er wusste sehr genau, wie das Zeug schmeckte.
Sie setzte die Schale mit ernster Miene ab. Es wurde Zeit, das Geschäftliche zu besprechen. »Nun? Was hast du heute für mich?«
Gaston warf ihr einen vorsichtigen Blick zu. »Weniger, als du vielleicht denkst. Wie du weißt, haben wir keine Möglichkeit, die Flottenbasen der Flohteppiche zu beobachten.« Auch er stellte die Schale ab. »Aber dafür haben wir ihre Stützpunkte auf Darimor sehr genau im Auge behalten. Bis vor zwei Monaten gab es sehr hektische Aktivität. Es trafen fast täglich neue Einheiten ein. Außerdem gab es eine Menge Schiffsverkehr zwischen den Basen auf der Oberfläche und ihren Schiffen im Orbit einerseits sowie den Schiffen im Orbit und den Mondbasen andererseits.« Er kratzte sich am Kinn. »Ich würde annehmen, zeitweise befanden sich gut hunderttausend feindliche Soldaten auf der Oberfläche.«
Carter pfiff leise durch die Vorderzähne. »Das ist eine ganze Menge.« Gaston nickte. »Was passierte dann?«, bohrte Carter weiter.
»Die meisten rückten ab.«
Carter runzelte die Stirn. »Sie rückten ab? Wie viele?«
»Ich schätze, etwa um die achtzig Prozent. Sie ließen lediglich eine Rumpfmannschaft zurück.«
Carters Miene versteinerte. »Um ihre Stützpunkte zu schützen.«
Gaston schielte in ihre Richtung. »Was hältst du davon?«
Sie erwiderte seinen Blick eisern. »Du sagtest, ihr hattet seit etwa zwei Monaten keinen Ärger mehr mit ihnen. Richtig?«
Abermals nickte Gaston.
Carters Gedanken überschlugen sich. »Manchmal ist das Fehlen von Aktivität schon Hinweis genug«, sinnierte sie vor sich hin.
Gaston runzelte die Stirn. »Was meinst du damit?«
»Sie jagen euch nicht mehr, weil sie mit was anderem beschäftigt sind. Und ihre Truppen sind abgezogen, weil sie woanders hinbeordert wurden. Sie nutzten Darimor als Aufmarschgebiet.«
»Achtzigtausend Mann sind aber nicht genug, um die Republik zu bedrohen.«
»Es sei denn, das Ganze hat sich noch auf einem Dutzend anderer Welten genauso abgespielt. Anstatt ein großes Aufgebot zu versammeln, sammelten sie mehrere kleinere und führen sie unbemerkt zusammen.«
»In der Hoffnung, dass es der Aufmerksamkeit der Republik entgeht«, spann Gaston den Faden weiter.
Carter grinste. »Das ist ja auch der Fall. Ihr habt es entdeckt. Dafür danke ich deinen Leuten und dir. Die Flohteppiche haben etwas vor und vielleicht ist es noch nicht zu spät, sie aufzuhalten. Falls wir das schaffen, dann nur durch eure Hilfe.«
Gastons Miene blieb von dem Lob unberührt. In Gedanken versunken, stocherte er weiterhin in seiner Suppenschale herum. Schließlich sah er auf. Carter wusste noch im selben Moment, was nun folgte: dasselbe Gespräch, das sie bereits seit Jahren führten.
»Hast du mit deinen Vorgesetzten gesprochen?«
Carter machte eine verkniffene Miene. »Ja, aber ihre Antwort dürfte dir nicht gefallen.«
Schnaubend stellte Gaston seine Schale vor sich ab. »Wieso nicht? Ihr haltet uns schon seit Jahren hin. Die Hinradygarnison ist so klein wie schon lange nicht mehr. Eine Evakuierung wäre günstig. Vielleicht bekommen wir nie wieder eine solche Chance.«
Carter legte dem Mann freundschaftlich die Hand auf die Schulter. »Gaston, ich verstehe dich ja. Aber du musst auch uns verstehen. Um euch hier herauszuholen, müssten wir eine Flotte herschicken. Und das bedeutet, wir müssten eine Schlacht schlagen, zu der meine Vorgesetzten vorläufig noch nicht bereit sind. Wir würden zwangsläufig bei eurer Rettung mehr Leben verlieren, als wir evakuieren könnten. Das steht in keinem Verhältnis zueinander.«
Gaston ließ die Schultern sacken. »Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass endlich der Augenblick gekommen ist, an dem ihr uns aus dieser Hölle befreit.«
Sie legte ihren Arm um die Schultern des Mannes. »Haltet bitte noch etwas durch. Dieser Krieg wird nicht ewig andauern. Irgendwann wird die Republik keine andere Wahl haben, als in die Offensive zu gehen. Dann wird eure Stunde kommen. Ich verspreche es.«
Gaston zwang sich zu einem knappen Lächeln. »Ja, du hast natürlich recht.« Er nahm die Schale wieder auf und löffelte lustlos die Flüssigkeit darin. Tief in seinem Inneren glaubte ihr der Mann kein Wort. Aber er klammerte sich an die geringe Hoffnung, dass sie vielleicht doch die Wahrheit sprach.
Sie seufzte. Carter hätte sich sehnlichst gewünscht, Gaston etwas anderes sagen zu können. Aber die Dinge waren nun einmal, wie sie waren.
Die Legionäre blieben so lange, wie die Etikette es erforderte, nicht unhöflich zu wirken. Im Anschluss machten sie sich auf den Rückweg zum Sturmboot. Carter hing weiterhin ihren Gedanken über Gastons Worte nach. Der Anflug auf Darimor war noch nie derart problemlos verlaufen. Der Grund könnte darin liegen, dass die Hinrady nicht nur das Gros ihrer Truppen, sondern auch noch die meisten ihrer Schiffe abgezogen hatten. Das war durchaus plausibel.
Ihr Master Sergeant gesellte sich zu ihr und fiel unbewusst neben ihr in Gleichschritt. »Weiß er es?«
Carter sah ihn an und der Sergeant blickte vielsagend über die Schulter den Weg zurück, den sie gekommen waren. Sie wusste genau, wovon er sprach.
Sie richtete ihr Augenmerk erneut auf das unwegsame Gelände voraus. »Nein«, erwiderte sie wortkarg.
»Das gefällt mir kein bisschen«, meinte der Sergeant kurz angebunden.
Carter sagte nichts dazu. Sie war insgeheim seiner Meinung, aber was brachte es schon, dies auch noch laut auszusprechen? Die deprimierende Wahrheit bestand darin, dass die Republik diese Menschen sehr wohl hätte evakuieren können, sogar relativ leicht. Aber die Menschheit befand sich in einem Krieg, der durchaus ihr letzter sein könnte. Ohne diese Widerstandskämpfer verloren sie Augen und Ohren im Feindgebiet. Die Menschheit und ganz besonders die Republik waren auf alle Ressourcen angewiesen, wollten sie diesen Krieg gewinnen. Und man durfte sich keiner Illusionen hingeben. Die Informationen dieser Leute stellten sogar eine äußerst wichtige Ressource dar, auf die die Herren Admiräle und Generäle keinesfalls verzichten wollten.
Also mussten diese Leute leiden. Zum Wohl und für das Überleben aller Menschen.
»Nach Ihrer Meinung hat niemand gefragt, Sarge«, entgegnete Carter schließlich in seltsam neutralem Tonfall. Der Mann ließ sich daraufhin etwas zurückfallen. Sie hatte ihn getroffen. Das wusste sie. Aber ihm musste vor Augen geführt werden, dass keiner von ihnen eine Wahl hatte.
»Und nach meiner auch nicht«, wisperte sie in die Stille ihres Helms hinein.
Teil I. Aufmarsch
1
Master Sergeant Tian Chung drillte seine Leute bis zur völligen Erschöpfung. Feuertrupp Blutiger Dolch hetzte durch den Schlamm, stürmte eine Barrikade und im Anschluss verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zum nachgebauten Eingang eines Jackurynestes. Hologramme in Form und Gestalt der Insektoiden leisteten dabei Widerstand. Nach Abschluss der Aktion hatte der Feuertrupp drei Tote und einen Verwundeten zu beklagen. Obwohl die Übung streng genommen ein Erfolg gewesen war, stemmte Tian unzufrieden die Fäuste in die Hüften, als sich sein Trupp schwer atmend und erschöpft um ihn versammelte.
Er maß die Mitglieder seiner Einheit nacheinander mit festem Blick. Kara Mitchell wirkte als Einzige zerknirscht. Das neueste Mitglied des Trupps diente bereits seit über sieben Jahren unter ihm, galt aber bei den anderen gemeinhin immer noch als Küken, was dazu führte, dass sie sich hin und wieder zurückgesetzt fühlte.
Francine Hernandez setzte den Helm ab, zog einen Kaugummi aus der Tasche, packte ihn aus und begann lustlos darauf herumzukauen. Sie begegneten seinem vorwurfsvollen Blick mit Gleichmut. Antonio Jimenez und Nico Keller hatten sich beide rücklings auf die Erde gelegt. Es schien fast, als wären sie willens, jeden Augenblick einzuschlafen. Wenn man bedachte, dass sich die Einheit seit drei Tagen fast ununterbrochen im Manöver befand, war dies zwar nachvollziehbar, aber deswegen trotzdem nicht zu entschuldigen. Schlafentzug war Teil der strapaziösen Übungen, die sie durchlebten. Soldaten bekamen selten Schlaf, wenn sie ihn benötigten.
Tian sah sich um. So weit das Auge reichte, waren Legionäre am Trainieren und der Drill war hart. Die Sergeants, die ihre Einheiten antrieben, kannten keine Gnade. Auf Jackury und Hinrady traf das schließlich auch zu.
Sultanet war der Hauptplanet von Sektor 12 der Republik und somit auch das Hauptquartier des 12. Korps. Normalerweise waren die Einheiten eines Korps über deren ganzen Sektor verstreut auf Garnisonsposten. Doch im Moment weilten von den zwanzig Legionen des 12. Korps sechzehn auf Sultanet und trainierten gemeinsam.
Tian schnalzte mit der Zunge und spie anschließend aus. Das gefiel ihm kein bisschen. Irgendetwas ging vor sich. Etwas, von dem der Großteil der Truppe noch nichts ahnte. Man konnte es förmlich schmecken. Es ähnelte dem Geruch eines Sturms, der sich im Wind zusammenbraute, obwohl noch kein einziger Regentropfen fiel. Man wusste, dass etwas auf einen zukam, auch wenn die Vorboten noch auf sich warten ließen.
Tian wandte sich seinen Leuten zu. Ziemlich unsanft stieß er erst Nico, dann Antonio mit dem gepanzerten Stiefel an. »Hoch mit euch. Legt etwas mehr Disziplin an den Tag.«
Die beiden Angesprochenen erhoben sich mühsam. Nico zog die Knie in eine hockende Position heran und stützte seine Arme und anschließend auch den Kopf auf ihnen ab. Antonio stupste den Legionär sanft mit dem Ellbogen an. Tian war nicht ganz so freundlich. Er versetzte Nico einen heftigen Tritt, sodass dieser aus dem beginnenden Halbschlaf unsanft erwachte. Er widmete seinem Sergeant einen bösen Blick.
»Ich weiß, ihr seid müde«, versetzte Tian ungerührt. »Ich weiß, ihr denkt, ihr könnt nicht mehr. Aber in genau einem solchen Moment reaktivieren sich eure Kraftreserven, von denen euch gar nicht bewusst ist, dass ihr sie überhaupt besitzt.« Tian deutete auf die ringsum trainierenden Legionäre. »Denkt ihr, es geht nur euch so? Hier sind alle erschöpft. Aber aufgeben ist keine Option. Aufgeben bedeutet, den Nefraltiri und ihren Speichelleckern Tür und Tor zu öffnen. Den Schaben und den Flohteppichen. Wollt ihr das? Wollt ihr, dass sie über den Boden Sultanets und anderer republikanischer Welten kriechen?«
»Nein, Sergeant«, antworteten die vier Legionäre halbherzig im Chor.
Tian baute sich breitbeinig vor ihnen auf. »Ich kann euch leider nicht hören.«
»Nein, Sergeant«, wiederholte sein Trupp, dieses Mal wesentlich lauter.
»Das war immer noch grauenhaft.« Er sah von einem zum anderen. »Also, wer will den Anfang machen? Wo lag bei der heutigen Übung der Fehler?«
Die Legionäre tauschten untereinander verständnislose Blicke. Es war Kara, die den Anfang machte. »Wir sind einfach nicht gut genug.«
Tian schenkte ihr ein kurzes Lächeln, eigentlich nicht mehr als das Aufblitzen seiner Zähne inmitten des Gesichts. »Ach, Kara, wenn es doch nur so einfach wäre!« Er wandte sich an Francine. »Hast du vielleicht eine Ahnung? Irgendeine?«
Seine Stellvertreterin begegnete Tians halb als Vorwurf gemeinter Bemerkung kauend. Sie zuckte die Achseln. »Nico hat mir nicht genügend Deckung gegeben. Und Antonio war zu langsam.«
»Hey!«, begehrten beide auf.
»Du warst zu schnell«, schoss Nico sofort zurück. »Du bist vorgeprescht, als hättest du Hummeln im Arsch. Deswegen kamen wir kaum hinterher.« Es entbrannte zwischen den dreien ein hitziges Streitgespräch, wer nun den größten Anteil an dem Debakel zu verantworten hatte.
Tian ließ sie eine Weile gewähren, bis er entschied, dass es genug war. »Ruhe!«, brüllte er. Die drei verstummten, schienen aber durchaus bereit, den Streit weiter eskalieren zu lassen. Das war eine Folge des Schlafentzugs. Die Reizbarkeit nahm zu und die Fähigkeit, klar zu denken, beinahe im selben Verhältnis ab.
»Ihr habt alle drei recht«, beschied er mit wesentlich ruhigerer Stimme als zuvor. Drei Augenpaare richteten sich auf ihn. »Francine, du warst viel zu schnell. Du musst deinem Team Zeit geben aufzuschließen. Du bist eine hervorragende Kämpferin, aber auch du kannst es nicht mit den Eingangswächtern eines Jackurynestes allein aufnehmen.« Sein Blick richtete sich auf Antonio. »Und du warst zu langsam. Ich weiß, welche Anforderungen es an dich stellt, den schweren Nadelwerfer mit dir herumzuschleppen, aber dennoch musst du noch wesentlich schneller werden. Die Jackury nutzen jede Schwäche aus.« Mit einem Finger deutete er auf Nico. »Und du musst dein Augenmerk unbedingt auf die Person richten, für deren Schutz du verantwortlich bist. Francine hatte Position eins der Formation inne. Deswegen hättest du ihr tatsächlich besseren Feuerschutz bieten müssen. Du lässt dich immer noch viel zu leicht ablenken.«
»Ich wurde von einem Dutzend Jackury angegriffen«, protestierte Nico. »Was hätte ich tun sollen? Ich musste mich selbst verteidigen.«
»Da wären wir wieder bei Antonio, der dich mit seinem Nadelwerfer hätte decken müssen.« Tians vorwurfsvoller Blick richtete sich erneut auf den schweren Truppler, der beschämt zur Seite sah.
Tian richtete sich auf. »Die Einzige, die halbwegs nicht versagt hat, war Kara. Und sie war auch noch die Einzige, die bereit war, Selbstkritik zu äußern. Sie war auf Position und hat Francines linke Flanke geschützt. Sie behielt ihre Position innerhalb der Formation sogar dann noch bei, als Francine zu eilig vorpreschte.« Er widmete Kara ein anerkennendes Nicken. »Gut gemacht.« Kara lächelte scheu.
In anderen Einheiten hätte seine Kritik und das anschließende Lob für Kara vielleicht für Eifersüchteleien oder Ressentiments innerhalb des Trupps geführt. Stattdessen gratulierten seine Leute ihrer Truppkameradin ehrlich. Dieser Zusammenhalt war etwas, worauf er bei Feuertrupp Blutiger Dolch zu Recht stolz war.
Jemand näherte sich Tian in dessen Rücken. Francine und die anderen sprangen auf und standen augenblicklich stramm. Daher wusste er auch, um wen es sich handelte, ohne sich umdrehen zu müssen.
»Major?«, grüßte er den Offizier.
Major Andreas Rinaldi, Tians Kohortenkommandeur, stellte sich neben ihn. Seine Mundwinkel hoben sich leicht in der Andeutung eines Lächelns. Ansonsten blieb seine Miene ernst. »Und? Wie machen sie sich heute?«
Tian zuckte die Achseln. »Für eine kampferprobte Fronteinheit könnte es wesentlich besser sein. Aber ich kriege das schon in ihre Köpfe rein. Und wenn ich dazu einen Hammer benutzen muss.«
»Könnte auch am Schlafentzug liegen«, meinte Rinaldi. »Zu Beginn des Manövers war Blutiger Dolch wesentlich besser. Eine Entwicklung, die nicht nur Ihre Einheit betrifft, Sarge. Wir beobachten das auf dem ganzen Gelände.« Er seufzte. »Ich denke, wir beenden das hier vorerst und schicken die Legionäre zurück in die Kasernen, um etwas Kraft zu tanken. Es warten schon vier weitere Legionen darauf, die nächsten Tage das Manövergelände zu nutzen.«
Tian nickte. »Das halte ich für eine gute Idee.« Er bedachte seine Leute mit einem vielsagenden Blick. »Sie sollen sich etwas ausruhen.« Die Erleichterung unter den Truppmitgliedern war auf der Stelle fast körperlich spürbar.
Tian fühlte sich in Rinaldis Nähe ein wenig unbehaglich. Er wusste nicht zu sagen, ob der Major ihm seine Entscheidung immer noch übel nahm. Rinaldi hatte ihm nach der Schlacht im Solsystem zweimal eine Beförderung in den Offiziersrang eines Lieutenants angeboten. Aber Tian hatte beide Male abgelehnt. Er fühlte sich nicht geschaffen für ein Leben als Offizier. Nach seinem Dafürhalten war er immer noch einer von den Jungs. Damit wäre es vorbei, sobald er sich für die Beförderung entschied. Dazu war er nicht bereit.
Ein Landungsschiff zog im Tiefflug über sie hinweg. Alle Augen richteten sich nach oben. Unter dem Rumpf hingen mehrere Legionäre in Rüstungen verankert.
Tians Mund blieb offen stehen. »Heiliger Strohsack!«, murmelte jemand.
Rinaldis Mund öffnete sich zu einem breiten Grinsen. »Ach ja, ich vergaß. Die kennen sie ja noch gar nicht.« Er deutete nach oben. »Das sind unsere neuen Artillerierüstungen.«
Das Landungsschiff ging in Schwebemodus über und verharrte fünf Meter über dem Übungsgelände. Die Artillerierüstungen klinkten sich eine nach der anderen aus.
Die Dinger fielen natürlich wie ein Stein zur Erde, kamen aber verblüffend geschmeidig auf. Sie gingen sogar bei der Landung leicht in die Knie, um den Sturz abzufedern – etwas, das die älteren Modelle nicht konnten. Damit waren die neuen Rüstungen in der Lage, aus größerer Höhe abgeworfen zu werden.
Der Anblick der neuen Artillerierüstungen war in der Tat Ehrfurcht gebietend. Sie waren gut und gerne zwei Meter fünfzig hoch und von klobigem Äußeren. Der Legionär befand sich wie üblich im Zentrum und war umgeben von vier Zentimetern Stahl.
Die Arme endeten wie beim Vorgängermodell in Abschussrohren. Und wie beim früheren Typ handelte es sich um Module, die man je nach Bedrohungs- und Gefechtslage auswechseln und durch verschiedene Waffensysteme ersetzen konnte. Aber die Auswahl der verschiedenen Waffen war wesentlich ausgereifter. Unter anderem konnte ein Arm jetzt mit einem schweren Nadelwerfer ausgerüstet werden, der viel zu unhandlich war, um von regulären Kampflegionären getragen zu werden. Damit waren die Artilleristen nicht länger auf andere Einheiten angewiesen und konnten selbst für ihre Eigensicherung sorgen. Damit wurden sie auf dem Schlachtfeld flexibler einsetzbar und stellten reguläre Kampftruppen für andere Aufgaben frei.
Auf einer Schulter befand sich ein klobiger Raketenwerfer und auf der anderen ein leistungsfähiger Scheinwerfer, der auch als Zielerfassungs- und Verfolgungssystem diente. Die Angriffsjäger der Hinrady würden ihre liebe Not mit den neuen Artilleristen haben. Zur Luftabwehr eingesetzt, waren die Dinger tödlich. Tian war zutiefst beeindruckt.
»Die erste größere Anzahl wurde bereits ausgeliefert«, meinte Rinaldi stolz. »Die Siebte bekommt auch einige. Ich kann kaum erwarten, sie im Einsatz zu erleben.«
In der Nähe der trainierenden Artillerielegionäre tauchten zwei Trupps Sturmlegionäre auf. Auch bei denen handelte es sich um neue Modelle. Sie waren fast ebenso groß wie die neuen Artillerierüstungen der Serie Mark II und genauso dick gepanzert. Der schwere Nadelwerfer war fest in ihren Gliedmaßen verankert und musste von beiden Händen geführt werden. Der Munitionsgurt zog sich von der Waffe zu einem Tornister auf dem Rücken.
Allerdings blieb der Munitionsbedarf ein Problem. Bei vollautomatischem Feuer hielt die mitgeführte Munition eine knappe Minute lang. Der Sturmlegionär musste den Verbrauch also sehr genau im Auge behalten.
Der Major entfernte sich in Richtung der über das Feld marschierenden Artilleristen und der ihnen folgenden Sturmlegionäre. Tian sah ihm unschlüssig hinterher. Einerseits konnte er Rinaldis Emotionen gut nachempfinden. Diese Monster im Gefecht zu erleben, musste ein erhebendes Gefühl sein. Andererseits bedeutete das auch ein erneutes Aufflammen des Krieges. Und das war nichts, worauf man sich freuen sollte.
Master Sergeant Marcus Dunlevy zupfte immer wieder an seiner makellosen Ausgehuniform. Bereits über eine Stunde wartete er vor dem Büro seines Vorgesetzten.
Da ihm nichts anderes übrig blieb, stellte er sich vor das nächste Fenster und sah ins Freie. Die helle Sonne dieses Systems ließ die Stadt Laroth erstrahlen, als besäße sie einen Heiligenschein. Sie war die größte Ansiedlung auf dem Planeten Credo und gleichzeitig die Hauptstadt.
Die Stadt befand sich in einem Talkessel, umgeben von majestätischen Bergen, die allesamt von weißen Schneekronen dominiert wurden. Die kühle Bergluft wehte durch das Fenster herein. Eigentlich müsste er frösteln, aber Marcus war durch die Aufregung dermaßen erhitzt, dass er die kalte Luft kaum spürte.
Der Planet Credo befand sich in Sektor acht, also weitab der Front. Hier saß das Hauptquartier der Schattenlegionen, gut geschützt hinter dem Bollwerk, das andere Legionen stellten, um die Barbaren vor den Toren auf Abstand zu halten.
Das Hauptquartier weit hinter der Frontlinie zu etablieren, war einerseits ein kluger Schachzug. Es war zumindest im Moment uneinnehmbar. Dennoch fragte sich Marcus insgeheim, ob es nicht das falsche Signal an den Rest der Streitkräfte sendete.
Es gab mehrere Hauptquartiere regulärer Kampflegionen und sogar einiger Korps, die befanden sich in unmittelbarer Nähe der Front und waren damit der ständigen Gefahr eines drohenden Angriffes ausgesetzt. Es gab ohnehin schon viele, die meinten, die Schattenlegionäre hielten sich für etwas Besseres. Die Entscheidung, ihr Hauptquartier auf Credo zu etablieren, würde diesem Ruf nicht unbedingt guttun.
Hinter ihm öffnete sich die Tür. Er wandte sich schwungvoll um. Ein weiblicher Adjutant im Rang eines Lieutenants stand im Türrahmen und lächelte ihn freundlich, aber nichtssagend zu. »Sergeant Dunlevy, würden Sie mir bitte folgen?«
Marcus atmete tief durch und nickte. Der Lieutenant drehte sich ohne weiteren Kommentar um in dem Wissen, dass der Schattenlegionär ihr im Kielwasser nacheilen würde.
Heute würde es sich entscheiden. Seit dem Verlust seines ersten Teams vor so vielen Jahren auf Dentano und später auch noch seines zweiten Teams während der Invasion der Nefraltiri war er von Einheit zu Einheit weitergereicht worden. Hinter vorgehaltener Hand sprach man bereits vom Dunlevy-Fluch. Ein Ruf, den er einfach nicht mehr loswurde, sosehr er sich auch bemühte. Heute fiel die Entscheidung, ob er je wieder einen Feuertrupp im Gefecht kommandieren würde. Er war jetzt fast fünfzig Jahre alt. Seine Zeit lief ab. Wenn seine Karriere nicht mehr in Gang kam, konnte er genauso gut auch gleich den Abschied einreichen. Er war überzeugt, einigen seiner Vorgesetzten würde dies in die Karten spielen. Sie hätten damit ein Problem weniger. Marcus hob den Kopf. Aber derart leicht würde er es ihnen nicht machen.
In den letzten Jahren hatte er es sich mehr als einmal gewünscht, gemeinsam mit seinen Leuten in den Tod gegangen zu sein. Es war hart, nicht nur einmal, sondern gleich zweimal der einzige Überlebende eines ganzen Trupps zu sein. Falls man wirklich entschied, ihn aufs Abstellgleis zu schieben, dann wusste er wirklich nicht, was er mit seinem Leben noch anfangen sollte.
Der Lieutenant kam vor einer weiteren Tür zum Stehen, öffnete sie und trat beiseite. Mit einer auffordernden Handbewegung bedeutete sie Marcus, den Raum zu betreten. Der Sergeant atmete noch ein weiteres Mal tief ein, bevor er dem Wink folgte.
Die Tür schloss sich hinter ihm nahezu geräuschlos, aber das bekam Marcus bereits nicht mehr mit. Er wurde von zwei hohen Offizieren erwartet.
Bei dem einen handelte es sich um Lieutenant Colonel Georgious Balthasar, den Kommandeur der 2. Schattenlegion. Mit ihm hatte Marcus gerechnet, nicht aber mit dem Mann, der neben ihm stand. Lieutenant General Finn Delgado betrachtete ihn mit undeutbarer neutraler Miene.
Der Oberbefehlshaber der Schattenlegionen deutete auf den leeren Stuhl gegenüber von Balthasars Schreibtisch. »Bitte, Sergeant. Nehmen Sie doch Platz«, forderte er ihn auf.
Marcus schluckte und trat näher. Die Anwesenheit Delgados deutete darauf hin, dass es bei dieser Besprechung um wesentlich mehr ging als nur darum, ob ein alternder, in Ungnade gefallener Legionär noch einmal eine Chance erhalten sollte.
Er setzte sich und wartete gespannt darauf, was die beiden Offiziere für ihn in petto hatten. Delgado und Balthasar wechselten einen seltsamen Blick, bevor auch sie Platz nahmen.
Delgado musterte ihn einen langen Augenblick, bevor er begann. »Wissen Sie, warum Sie hier sind?«
Marcus räusperte sich unbehaglich. »Ich stellte bereits vor geraumer Zeit einen Antrag auf Zuteilung eines neuen Trupps, Sir.« Der Schattenlegionär zögerte. »Mehrmals.«
Die abschließende Bemerkung war eigentlich unnötig, aber Marcus verspürte den Drang, seinem Trotz über die Behandlung in den letzten Jahren Ausdruck zu verleihen.
Balthasar verzog ungehalten die Miene, während Delgados Mundwinkel leicht zuckten. »Das trifft es ungefähr«, erwiderte der Oberbefehlshaber schließlich. Sein Lächeln schwand so schnell, wie es erschienen war. »Sergeant, ich will ganz ehrlich sein. Wir haben lange darüber nachgedacht, was aus Ihnen werden soll. Es ist nicht leicht, gleich zweimal der einzige Überlebende eines Feuertrupps zu sein. Auch auf andere Einheiten wirkt dies … nicht gerade motivierend.« Damit sprach er unbewusst Marcus’ eigene Gedanken aus.
Marcus senkte den Kopf. Das war es also. Sein Ticket für das Abstellgleis. Seine Miene versteinerte. Er hob stolz das Kinn, auch wenn ihm bewusst war, wie kindisch das wirken musste. »Ich verstehe. Dann bringen Sie es einfach hinter sich … Sir.«
Die Ehrenbezeugung kam mit einiger Verzögerung und wurde von beiden Offizieren negativ aufgenommen. Sie wechselten erneut einen kurzen Blick.
»Sie sind nicht hier, um abgeschossen zu werden, Sergeant«, gab Delgado bekannt.
»Auch wenn die Entscheidung nicht einstimmig war«, versetzte Balthasar.
Marcus runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht.«
Delgado kratzte sich leicht am Kinn. »Dunlevy, wir haben ein Problem.« Er betätigte einen versteckten Knopf und das Hologramm eines Schiffes wurde über den Tisch projiziert.
»Das ist das Forschungsschiffes Charlotte. Es befindet sich im Akiron-System. Ich bezweifle, dass Sie schon einmal davon gehört haben. Es liegt im Niemandsland.«
»Ich kenne das Akiron-System«, widersprach Marcus. »Dort existiert nichts von Interesse.«
»Deswegen wurde die Charlotte dorthin geschickt. Niemand kümmert sich um Akiron. Es ist der perfekte Ort für die Wissenschaftler an Bord, um ihrer Arbeit nachzugehen.«
»Und diese Arbeit besteht worin …?«, wollte Marcus wissen.
»Diese Information liegt weit oberhalb ihrer Soldstufe«, entgegnete Balthasar.
»Für die Aufgabe, mit der wir Sie betrauen wollen, müssen Sie das auch nicht wissen«, beschwichtigte Delgado. Er leckte sich über die Lippen. »Wir befördern Sie in den Rang eines Lieutenants und betrauen Sie mit dem Kommando über drei Feuertrupps der 2. Schattenlegion.«
Marcus’ Augen wurden groß. Er richtete sich unwillkürlich kerzengerade auf.
Delgado musterte ihn immer noch eindringlich. »Aber nur, wenn Sie auch bereit sind, diese Mission zu übernehmen.«
Marcus überlegte angestrengt. »Das … kommt ehrlich gesagt ein wenig überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet.« Er runzelte die Stirn. »Warum ich?«
Delgado lehnte sich mit seinem ganzen Gewicht zurück, sodass die Stuhllehne etwas quietschte. »Sie sind ein guter Soldat, Marcus«, sprach er seinen Gegenüber ungewohnt vertraulich an. »Das waren Sie immer. Auf Dentano haben Sie tapfer gekämpft. Und auf all den weiteren Schlachtfeldern ebenso. Ich glaube nicht an den Dunlevy-Fluch.«
»Aber werden meine zukünftigen Untergebenen das genauso sehen?«
Balthasar wandte den Blick ab. Der Mann war immer noch dagegen, Marcus mit diesem Auftrag zu betrauen. Delgado blieb davon jedoch unberührt. »Falls Sie der Meinung sind, dem nicht gewachsen zu sein, dann sagen Sie es besser jetzt sofort.«
Marcus neigte den Kopf zur Seite. »Sie haben mir immer noch nicht gesagt, warum Sie ausgerechnet mich dafür ausgewählt haben.«
»War meine Antwort nicht genug?«, wollte Delgado wissen.
»Eigentlich sagte sie bemerkenswert wenig aus.«
Delgado schnaubte. »Dann begnügen Sie sich damit, dass ich meine Gründe habe. Also, wollen Sie die Mission? Ja oder nein. Ich befürchte, ich benötige auf der Stelle eine Antwort.«
»Dann sage ich Ja.«
Delgado lächelte geheimnisvoll, beugte sich vor und schob einen versiegelten Umschlag in Marcus’ Richtung, in dem sich ein Datenträger mit den Missionsparametern befand. »Ausgezeichnet.«
2
Major Andreas Rinaldi betrat den Bunker mit einiger Verwirrung. Er war es nicht gewohnt, dass hochkarätige Besprechungen in einer solchen Umgebung abgehalten wurden, jedenfalls nicht auf heimischem Boden. Etwas Derartiges kannte er bisher lediglich von der Front und auch von dort nur, wenn man gerade nichts anderes parat hatte.
Der Bunker bot kaum Platz, um all die Offiziere aufzunehmen, die man eingeladen hatte. Andreas musste sich auf die Zehen stellen, um über die Köpfe seiner Offizierskollegen hinwegsehen zu können. In einer der vorderen Reihen glaubte er Lieutenant Colonel Daniel Richter zu sehen, den Kommandeur der 7. Legion.
Eine Frau trat an den Holotank, der die Stirnseite des Bunkers bildete, und fesselte damit von der ersten Sekunde an die Aufmerksamkeit aller. Die Frau trug die Insignien eines Major Generals am Revers und auf der linken Brustseite eine beeindruckende Ansammlung von Feldzugsabzeichen.
Mit knapp fünfzig schien die Offizierin noch recht jung für einen derartigen Rang zu sein. Er hatte bisher nur von einer Legionärin gehört, die dieses Kunststück zustande gebracht hatte. Die Frau erhob das Wort und bestätigte damit seinen Verdacht.
»Für alle, die nicht wissen, wer ich bin«, eröffnete die Offizierin die Besprechung. »Mein Name ist Major General Ayumi Yoshida von der 199. Gefechtslegion.« Ein Raunen zog durch die versammelte Menge. Das war tatsächlich die Ayumi Yoshida, die Befehlshaberin der Drachenlegion. Sowohl Einheit als auch Kommandantin waren Legende. Sie hatten in den letzten dreißig Jahren an jeder größeren Schlacht und auch an vielen der kleineren teilgenommen, angefangen beim Drizil-Krieg über den Kampf gegen die Dornhill-Allianz auf Dentano bis hin zur Schlacht um die Erde. Man munkelte sogar, dass die Drachenlegion die letzte Einheit gewesen war, die sich aus der Schlacht um Berlin zurückgezogen hatte, und auch das erst nach mehrmaliger Aufforderung durch den damaligen Oberbefehlshaber. Die Einheit wäre am liebsten vor Ort geblieben, um den Jackury kräftig in den Arsch zu treten.
Die Drachenlegion war ein Unikum. Von diesen Elitesoldaten war bekannt, dass sie nur äußerst ungern auf die Armklingen zurückgriffen. Stattdessen bevorzugten sie Bajonette. Sie stellten die einzige Legion dar, die diese Stichwaffe noch verwendete.
Yoshida sprach weiter und Rinaldi spitzte die Ohren. »Ich entschuldige mich für die Art und Weise, wie diese Besprechung heute abgehalten wird, aber die Zeit drängt und dies war die naheliegendste Möglichkeit.«
Die Generalin ließ den Blick über die vor ihr angetretenen Offiziere wandern. Ihr brennender Blick schien jedem Einzelnen bis hinab in die Seele zu dringen, nur um anschließend sämtliche Geheimnisse ans Tageslicht zu zerren. Ein erschreckender, aber auch irgendwie erregender Gedanke.
»Meine Damen und Herren, ich mache es kurz«, polterte Yoshida weiter. »Die Verschnaufpause, die uns der Feind die letzten sieben Jahre gegönnt hat, ist nun leider vorbei.« Abermals brandete Raunen auf, das dieses Mal nicht erstaunt klang, sondern mit einem Unterton der Vorfreude versehen war. Yoshida hob die Hand und die Menge verfiel in angespanntes Schweigen.
Andreas bemerkte die zwei Soldaten, die Yoshida wie eine Ehrenwache flankierten. Beide waren in voller Rüstung.
Was ihn aber wirklich fesselte, war die farbenfrohe Darstellung eines feuerspeienden asiatischen Drachens, der die Panzeranzüge schmückte. Die beiden Legionäre rührten keinen Muskel. Sie hätten genauso gut Statuen sein können.
»Unsere Fernaufklärungslegionen«, fuhr Yoshida fort, »haben in den letzten Wochen und Monaten verstärkt Aktivitäten der Hinrady entlang des Niemandslands gemeldet.«
Andreas rümpfte die Nase. Mit diesem Begriff wurden mehrere Systeme bezeichnet, die während der letzten Invasionsphase von den Menschen aufgegeben, aber von den Nefraltiri oder den Hinrady weder besetzt noch annektiert worden waren. Sie dienten nun beiden Seiten als Pufferzone.
»Auf bisher eher ruhigen Welten wurde eine Zunahme des Transport- sowie Funkverkehrs gemeldet. Wir haben inzwischen die Bestätigung erhalten, dass sie als Durchgangsbasen genutzt wurden, um eine große Anzahl feindlicher Einheiten hindurchzuschleusen, damit diese ihre finalen Angriffspositionen erreichen konnten.«
»Konnte man herausfinden, wo die sich befinden?« Andreas glaubte, Richters Stimme zu erkennen, war sich aber nicht sicher.
Yoshida lächelte. »Sehr gute Frage.« Der Holotank erwachte zum Leben und zeigte das Grenzgebiet zwischen den von den Hinrady besetzten Welten, der Kooperative, der KdS sowie der Republik, einschließlich des Niemandslandes. Drei Systeme leuchteten hellblau auf.
»Während der letzten Angriffswelle vor sieben Jahren gelang es den Hinrady, einen Keil in die Front zu treiben. Kooperative und Konföderation demokratischer Systeme wurden dadurch voneinander getrennt. Außerdem steht der Feind nur noch wenige Lichtjahre vor dem Raum der Republik, wodurch wir im Fokus ihrer nächsten Angriffe stehen werden.« Yoshida deutete auf die drei hervorgehobenen Welten. »Das sind Celeste, Garispar und Geraldine. Wir sind überzeugt, dass es sich bei ihnen um das feindliche Aufmarschgebiet handelt. Es gibt dort keine menschliche Population mehr. Daher haben wir auch keine Augen vor Ort. Sämtliche Versuche, mit Aufklärungsdrohnen einzudringen, schlugen fehl. Wir verzichteten darauf, Schiffe zu schicken. Es war zu gefährlich und wir wollten keine Besatzungen sinnlos verheizen. Außerdem ist es für uns unumgänglich, nicht allzu viel Interesse an den betreffenden Systemen zu zeigen.«
»Den Hinrady muss doch bereits bewusst sein, dass wir Bescheid wissen.« Diesmal war Andreas sicher, dass Richter das Wort ergriffen hatte.
Yoshida nickte. »Davon gehen wir in der Tat aus. Sie können aber nicht wissen, wie weit unsere Vorbereitungen bereits gediehen sind. Das Oberkommando vermutet, dass auf diesen drei Welten eine Streitmacht unbekannter Größe versammelt wird. Nur so viel: Sie wird ohne Zweifel erheblich sein.«
Yoshida trat vor und ignorierte dabei den Holotank. Das Bild flackerte leicht, als ihr Ellbogen das Hologramm streifte. »Der Feind hat vor, einen vernichtenden Angriff zu führen.« Die Generalin schüttelte den Kopf. »Das werde ich nicht gestatten.« Sie verzog die Miene. »Wir führen einen Präventivschlag.« Diese Ankündigung rief Jubel unter den Soldaten hervor. Yoshida ließ sie eine Weile gewähren und hob dann abermals Einhalt gebietend die Hand. Es kehrte nur langsam Ruhe ein. Zu verlockend war die Aussicht, nach sieben Jahren Untätigkeit endlich in die Offensive gehen zu können.
»In diesem Augenblick sammelt die Republik eine Streitmacht von fünfzig Legionen. Sowohl Kooperative als auch KdS beteiligen sich mit jeweils weiteren dreißig Legionen. Das entspricht einer Größenordnung von sechshundertfünftausend Mann. Mit dieser Armee im Rücken stoßen wir ins Niemandsland vor und zerschlagen den Gegner, bevor es diesem gelingt, seine Truppen zu verlegen. Jeweils eine weitere Million Soldaten wird die Frontlinie sichern und eine zweite Verteidigungslinie zwischen Front und Niemandsland etablieren, falls dem Gegner wider Erwarten der Durchbruch durch unsere Offensivlinien gelingen sollte.«
Yoshida sprach weiter und begann damit, den Angriffsplan zu erläutern. Andreas hörte nur mit einem Ohr zu. Die Euphorie hatte auch ihn gepackt. Der Krieg ging wieder los und er war überzeugt, dass dieses Mal die Menschen es sein würden, die den Hinrady und ihren Herren das Fürchten lehrten.
Der Dreadnought Beowulf hing scheinbar schwerfällig über dem Nordpol von Vector Prime. Vizeadmiral Elias Garner stand auf dem Kommandodeck seiner Brücke und sah durch das gepanzerte Kuppelglas hinaus ins All.
In nicht einmal hunderttausend Kilometern Entfernung befand sich der kleinste der Monde von Vector Prime. Die Werftanlagen, die sich rings um den Mond befanden, waren mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Das war auch gar nicht nötig. Garner wusste genau, was er zu Gesicht bekommen würde, sollte er sich dem stellaren Objekt nähern.
Alle drei Monde des Hauptplaneten von Vector Prime waren zu gigantischen Werften ausgebaut worden. Allein auf dem kleinsten waren achtzehn Dreadnoughts auf Kiel gelegt und befanden sich in unterschiedlichen Stadien der Fertigstellung. In den Werften von Equuro und Cosa Tauri wurden zwölf weitere gefertigt. Hinzu kamen Dutzende von kleineren Kriegsschiffen, angefangen bei Korvetten bis hin zu Trägern und Angriffskreuzern.
Von den kleineren Schiffen verließen alle neun Monate etwa zwanzig oder dreißig die Werften, nur damit gleich darauf weitere auf Kiel gelegt werden konnten. Die Produktionsstätten der Republik standen niemals still. Die Ausbildungseinrichtungen konnten sich vor Freiwilligen kaum retten, die unbedingt an diesem Kampf teilnehmen wollten, um Heim und Familien zu beschützen. Sie bereiteten sich auf den Krieg vor, von dem jeder wusste, dass er sich mit Riesenschritten näherte. Und dieses Mal waren die Menschen entschlossen, ihn zu einem Ende zu bringen.
Garner seufzte. Er wünschte, die Arbeit an den Dreadnoughts wäre genauso schnell vonstattengegangen, wie es bei einem Angriffs- oder Begleitkreuzer der Fall war. Sie brauchten die Feuerkraft dringend. Aber die Arbeit an einem Dreadnought war wesentlich zeit- und ressourcenintensiver. Es dauerte fast fünf Jahre, einen fertigzustellen.
Die unaufdringliche Gestalt Commander Harald Kesslers stellte sich hinter ihn. Sein neuer XO war ihm vor vier Jahren zugeteilt worden, drei ganze Jahre nach dem Tod MacGregors. Eigentlich eine Zumutung, aber Personal war damals so kurz nach der Solschlacht Mangelware gewesen und daher hatte er sich notgedrungen gedulden müssen.
Kessler war in vielerlei Hinsicht MacGregor sehr ähnlich. Aber Garner hatte den Mann noch nie im Gefecht erlebt. Nun, das würde sich wohl demnächst ändern. Erst dann konnte er sich ein endgültiges Urteil erlauben. In administrativen Dingen war Kessler nicht unbegabt. Er neigte auch nicht zum Plappern, wie das bei vielen XO der Fall war, die er im Lauf seiner Karriere kennengelernt hatte. Und doch hielt er sich mit der abschließenden Beurteilung zurück. Es ging nichts über eine Feuertaufe, um sich eine Meinung über einen Offizier zu bilden.
Garner winkte den Mann näher und dieser reichte ihm noch beim ersten Vorwärtsschritt das Pad, das er bislang unter dem Arm getragen hatte. »Die neusten Manöverberichte.«
Garner nickte, nahm das Pad an, rief die Berichte aber nicht ab. Er schätzte das persönliche Gespräch mehr als nackte Daten und Fakten. »Geben Sie mir die Kurzfassung, Harald.«
Sein XO nickte. »Die Einheiten der Kooperative und der KdS machen sich recht gut. Die Befehlshaber der Schiffe lernen schnell aus ihren Fehlern.«
Garner maß seinen XO mit festem Blick. »Aber?«
»Aber es gibt Probleme, wenn sie ihre Befehle von einem republikanischen Vorgesetzten entgegennehmen sollen.«
»Von allen?«
Kessler schüttelte den Kopf. »Nicht von allen, aber von zu vielen, als dass wir das ignorieren dürften.« Der XO