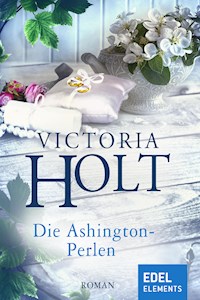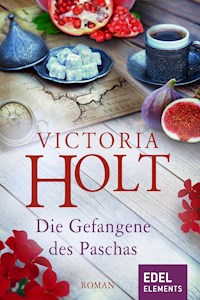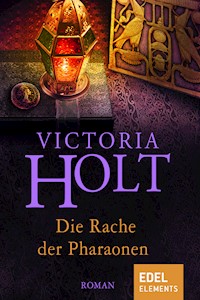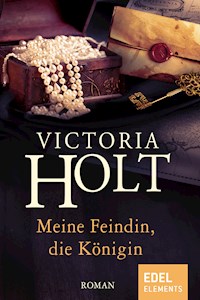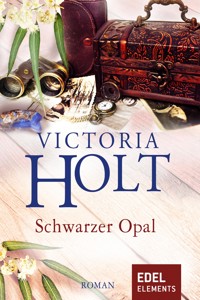4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eine starke Frau auf der Suche nach der Wahrheit und dem Mann, den sie liebt 19. Jahrhundert: Die junge Helena Trent wächst als Tochter eines Buchhändlers in Oxford auf, doch für ihre Ausbildung schicken ihre Eltern sie nach Deutschland, die Heimat ihrer Mutter. Von Anfang an ist Helena fasziniert von der verzaubernden Einsamkeit des Schwarzwaldes – und als sie hier schließlich auf den Adeligen Maximilian trifft, ist es um ihr Herz bald geschehen. In einer geheimen Zeremonie heiraten die beiden – aber nach zwei Tagen ist Maximilian plötzlich verschwunden … Jahre später tritt Helena eine Stelle auf einem abgelegenen Schloss an: Als Englischlehrerin soll sie die illegitimen Kinder eines Grafen unterrichten. Doch weshalb erinnert dieser sie so sehr an ihren geliebten Maximilian? Während Helena versucht, hinter das Geheimnis des mysteriösen Anwesens zu kommen, spürt sie, wie die traumhafte Landschaft des Schwarzwaldes sich nach und nach in einen Albtraum verwandeln … Der mitreißende historische Roman »Das Geheimnis der Engländerin« von Victoria Holt wird alle Fans von Katherine Webb und Felicity Whitmore begeistern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Ähnliche
Über dieses Buch:
19. Jahrhundert: Die junge Helena Trent wächst als Tochter eines Buchhändlers in Oxford auf, doch für ihre Ausbildung schicken ihre Eltern sie nach Deutschland, die Heimat ihrer Mutter. Von Anfang an ist Helena fasziniert von der verzaubernden Einsamkeit des Schwarzwaldes – und als sie hier schließlich auf den Adeligen Maximilian trifft, ist es um ihr Herz bald geschehen. In einer geheimen Zeremonie heiraten die beiden – aber nach zwei Tagen ist Maximilian plötzlich verschwunden … Jahre später tritt Helena eine Stelle auf einem abgelegenen Schloss an: Als Englischlehrerin soll sie die illegitimen Kinder eines Grafen unterrichten. Doch weshalb erinnert dieser sie so sehr an ihren geliebten Maximilian? Während Helena versucht, hinter das Geheimnis des mysteriösen Anwesens zu kommen, spürt sie, wie die traumhafte Landschaft des Schwarzwaldes sich nach und nach in einen Albtraum verwandelt …
Über die Autorin:
Victoria Holt – wie auch Philippa Carr und Jean Paidy – ist ein Pseudonym der britischen Autorin Eleanor Alice Burford (1906–1993). Schon in ihrer Jugend begann sie, sich für Geschichte zu begeistern: »Ich besuchte Hampton Court Palace mit seiner beeindruckenden Atmosphäre, ging durch dasselbe Tor wie Anne Boleyn und sah die Räume, durch die Katherine Howard gelaufen war. Das hat mich inspiriert, damit begann für mich alles.« 1941 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, dem in den nächsten 50 Jahren zahlreiche folgten, die sich schon zu ihren Lebzeiten über 90 Millionen Mal verkauften. 1989 wurde Eleanor Alice Burford mit dem »Golden Treasure Award« der Romance Writers of America ausgezeichnet.
Victoria Holf veröffentlichte bei dotbooks bereits ihren Roman »Das Geheimnis der Engländerin«.
***
eBook-Neuausgabe September 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1972 unter dem Originaltitel »On the Night of the Seventh Moon« bei Random House, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1974 unter dem Titel »In der Nacht des siebenten Mondes« bei Lübbe.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1972 by Victoria Holt
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1974 Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motivs von © Adobe Stock / ana sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-233-6
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Victoria Holt
Das Geheimnis der Engländerin
Roman
Aus dem Englischen von Ursula Dotzler
dotbooks.
l. Teil Die Waldromanze1859-1860
Kapitel 1
Wenn ich heute – im reifen Alter von siebenundzwanzig Jahren – auf das fantastische Abenteuer meiner Jugend zurückblicke, halte ich selbst kaum mehr für möglich, was ich damals so fest glaubte. Doch manchmal erwache ich noch jetzt mitten in der Nacht, weil eine Stimme im Traum nach mir ruft: Die Stimme meines Kindes. Die Leute in diesem Kirchspiel halten mich für eine alte Jungfer. Ich aber weiß im tiefsten Herzen, dass ich eine Frau bin, obwohl ich mir immer wieder die gleiche Frage stelle: Litt ich damals an einer Geistesverwirrung? Stimmte das, was sie mir einzureden versuchten – dass ich, ein romantisches und ziemlich schwaches Mädchen, wie so viele andere verführt worden war und mir eine wilde Geschichte ausgedacht hatte, weil ich der Wahrheit nicht ins Auge sehen konnte – eine Geschichte, die keinem außer mir glaubhaft erschien?
Es ist von größter Wichtigkeit für mich, zu begreifen, was in der Nacht des siebenten Vollmondes wirklich geschah. Deshalb habe ich mich entschlossen, die Ereignisse bis in alle Einzelheiten niederzuschreiben; so, wie sie mir im Gedächtnis geblieben sind.
Schwester Maria, die freundlichste der Nonnen, sagte oft kopfschüttelnd: »Helena, mein Kind, du wirst dich in Acht nehmen müssen. Es ist nicht gut, so unbekümmert und leidenschaftlich zu sein, wie du es bist.«
Schwester Gudrun, die bei weitem nicht so wohlwollend war, pflegte ihre Augen zu einem Spalt zu verengen und bedeutungsvoll zu nicken, wenn sie mich betrachtete. »Eines Tages wirst du zu weit gehen, Helena Trant!«, prophezeite sie.
Mit vierzehn wurde ich zur Ausbildung in das Damenstift geschickt und blieb vier Jahre dort. Während dieser Zeit war ich nur einmal zu Hause in England, als meine Mutter starb. Meine beiden Tanten kamen damals, um für meinen Vater zu sorgen. Ich konnte sie vom ersten Augenblick an nicht ausstehen, weil sie so ganz anders als meine Mutter waren. Tante Caroline hielt ich für die unangenehmere von den beiden. Sie schien kein anderes Vergnügen zu kennen, als auf die Fehler ihrer Mitmenschen hinzuweisen.
Wir lebten in Oxford, im Schatten der Akademie, die mein Vater einst besucht hatte, bis sein ungestümes, leichtsinniges Betragen ihn zwang, sein Studium aufzugeben. Vielleicht bin ich nach ihm geraten; ich glaube es jedenfalls. Unsere Abenteuer ähnelten sich in gewisser Weise, obwohl man die seinen nie anders als achtbar nennen konnte.
Er war der einzige Sohn, und seine Eltern hatten beschlossen, ihn zur Universität zu schicken. Seine Familie hatte große Opfer dafür gebracht, was Tante Caroline weder vergeben noch vergessen konnte. Während seiner Studienzeit unternahm er zusammen mit einem Freund eine Wanderung durch den Schwarzwald, und dort lernte er ein wunderschönes Mädchen kennen, in das er sich unsterblich verliebte. Von nun an gab es für die beiden kein anderes Ziel mehr, als zu heiraten. Ihre Geschichte glich fast einem der Märchen, die ihren Ursprung in jenem Teil der Welt haben. Meine Mutter war von adliger Herkunft; dieses Land war reich an kleinen Herzog- und Fürstentümern. Natürlich stieß ihre Liebe bei beiden Familien auf Widerstand. Mutters Eltern wünschten nicht, dass sie einen mittellosen englischen Studenten heiratete; seine Eltern hatten sich abgearbeitet, um ihm eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Man hoffte, dass mein Vater auf der Universität Karriere machen würde, denn trotz seiner romantischen Natur hatte er das Zeug zu einem Gelehrten, und seine Tutoren setzten große Hoffnungen in ihn. Aber für das junge Paar gab es nun nichts Wichtigeres auf der Welt als ihre Liebe. So heirateten sie, mein Vater verließ die Universität und sah sich nach einer Möglichkeit um, seine Frau zu ernähren.
Er hatte sich mit dem alten Thomas Trebling angefreundet, dem der kleine, aber gutgehende Buchladen droben in der High Street gehörte. Thomas gab ihm eine Anstellung und überließ ihm die Wohnung über dem Laden. Das jung verheiratete Paar strafte alle düsteren Prophezeiungen der sarkastischen Tante Caroline und der kassandragleichen Tante Mathilda Lügen und war strahlend glücklich. Armut war jedoch nicht die einzige Belastung; meine Mutter hatte eine sehr zarte Gesundheit. Schon damals, als sie meinen Vater kennenlernte, weilte sie zur Erholung auf einem der Jagdsitze ihrer Familie. Sie litt an der Schwindsucht.
»Sie darf keine Kinder bekommen«, verkündete Tante Mathilda, die sich selbst für eine Sachverständige hielt, wenn es um Krankheiten ging. Und so brachte ich sie natürlich alle aus der Fassung, als ich meine Existenz schon bald nach der Heirat meiner Eltern ankündigte und genau zehn Monate später zur Welt kam.
Man verübelte es ihnen wohl, dass sie trotz allem glücklich wurden; aber so war es, und ihr Glück hielt bis zum Tod meiner Mutter an.
Ich weiß, dass meine Tanten dem Schicksal grollten, weil es eine derartige Verantwortungslosigkeit noch belohnte, statt sie zu bestrafen. Der mürrische alte Thomas Trebling, von dem nicht einmal seine Kunden ein freundliches Wort zu hören bekamen, wurde ihr guter Geist. Er starb sogar zum passenden Zeitpunkt und hinterließ meinen Eltern neben dem Laden auch noch das kleine Nachbarhaus.
Als ich sechs Jahre alt war, besaß mein Vater also eine eigene Buchhandlung. Sie war zwar nicht gerade ein schwunghaftes Unternehmen, ermöglichte uns aber doch ein angemessenes Leben. So lebte er glücklich an der Seite einer Frau, die er bis zuletzt anbetete, und die seine Hingabe erwiderte. Dazu hatte er eine Tochter, deren Lebhaftigkeit nicht immer leicht zu zügeln war. Doch sie liebten mich beide auf eine zurückhaltende Weise, wenn sie auch zu sehr ineinander aufgingen, um noch starke Gefühle für andere zu erübrigen. Mein Vater war kein Geschäftsmann, doch er hatte eine Schwäche für Bücher, besonders für antiquarische; deshalb befriedigte ihn sein Beruf. Er hatte viele Freunde an der Universität, und in unserem kleinen Speisezimmer fanden häufig Einladungen statt, bei denen geistvolle und manchmal auch sarkastische Gespräche geführt wurden.
Die Tanten besuchten uns von Zeit zu Zeit. Meine Mutter nannte sie »die Spürhunde«, weil sie stets das ganze Haus durchschnüffelten, um festzustellen, ob auch alles sauber genug war. Ich erinnere mich, dass ich sie mit drei Jahren zum ersten Mal sah; damals brach ich in Tränen aus und protestierte laut, dass sie gar keine wirklichen Spürhunde wären, sondern nur zwei alte Frauen. Das war natürlich schwer zu erklären und nahm die beiden nicht gerade für mich ein. Typisch für Tante Caroline war, dass sie es meiner Mutter nie verzieh. Mir vergab sie es ebenfalls nicht, und das war wohl weniger vernünftig.
So verlebte ich meine Kindheit in jener aufregenden Stadt, in der ich mich zu Hause fühlte. Ich erinnere mich noch, wie ich mit meinem Vater am Fluss entlang spazieren ging, und wie er mir von den Römern erzählte, die hier eine Stadt gebaut hatten, die später von den Dänen niedergebrannt wurde. Ich fand es herrlich, das Leben und Treiben auf den Straßen zu beobachten: die Gelehrten in scharlachroten Talaren und die Studenten mit ihren weißen Halstüchern. Nachts hörte ich, wie die Pedelle die Straßen durchstreiften, begleitet von ihren Bulldoggen. An die Hand meines Vaters geklammert, wanderte ich oft mit ihm in südliche Richtung über den Kornmarkt direkt zur Stadtmitte. Manchmal durfte ich auch mit meinen Eltern draußen auf den Wiesen ein Picknick machen, doch am liebsten war ich mit einem von beiden zusammen, denn dann wandten sie mir ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu. Wenn Vater und ich allein waren, sprach er über Oxford und zeigte mir Tom Tower, die große Glocke und den Turm der Kathedrale, den er stolz als einen der ältesten in England bezeichnete.
Anders meine Mutter. Sie erzählte mir von den Tannenwäldern und dem kleinen Schloss, in dem sie ihre Kindheit verbracht hatte. Sie erinnerte sich daran, wie sie vor Weihnachten in den Wald gegangen waren, um ihre eigenen Christbäume zu holen und damit die Räume zu schmücken. Im Rittersaal, den es in fast jedem kleineren oder größeren Schloss gab, hatte man am Heiligen Abend getanzt und Weihnachtslieder gesungen. Ich liebte es, wenn meine Mutter mir »Stille Nacht, Heilige Nacht« vorsang. Ihr einstiges Heim im Wald wurde in meiner Fantasie zu einem märchenhaften Ort. Ich wunderte mich, dass sie nie Heimweh hatte; doch als ich sie einmal danach fragte und das Lächeln in ihrem Gesicht sah, begriff ich, wie tief ihre Liebe zu meinem Vater war. Damals begann ich wohl zu glauben, dass es auch in meinem Leben einst einen Mann geben würde, der mir so viel bedeutete wie ihr mein Vater. Ich dachte, diese tiefe, unerschütterliche Zuneigung wäre jedem beschieden. Vielleicht war ich deshalb eine so leichte Beute. Meine Entschuldigung ist, dass ich das Schicksal meiner Eltern vor Augen hatte und erwartete, im Wald eine ebenso märchenhafte Begegnung zu erleben. Ich glaubte, andere Männer wären ebenso zärtlich und gut wie mein Vater. Aber mein Geliebter war nicht wie er. Ich hätte das erkennen müssen. Ungestüm, überwältigend, unwiderstehlich – ja. Zärtlich, aufopfernd – nein.
Nur die Besuche meiner Tanten warfen gelegentlich einen Schatten auf meine glückliche Kindheit, und später die Tatsache, dass ich mein Heim verlassen und zur Schule gehen musste. Doch in den Ferien durfte ich in unsere faszinierende Stadt zurückkehren, die sich nie zu verändern schien. Mein Vater behauptete, sie wäre Hunderte von Jahren hindurch dieselbe geblieben, und das mache eben ihren Reiz aus.
Aus dieser Zeit ist mir vor allem das wundervolle Gefühl von Sicherheit in Erinnerung geblieben. Es kam mir nie in den Sinn, dass sich alles mit einem Schlag ändern könnte. Ich würde immer mit meinem Vater spazieren gehen, und er würde mir von seiner Studienzeit erzählen. Es war ein solches Vergnügen, ihm zuzuhören, denn er sprach nur mit Stolz, aber nie mit Bedauern davon. Es gefiel mir, wenn er voll Ehrfurcht von seinen Tagen in Balliol berichtete, und bald fühlte ich mich mit der Universität ebenso vertraut wie er. Und ich konnte sein Interesse an allem, was diese Stadt betraf, seine starke Verbundenheit mit ihr gut verstehen, denn er beabsichtigte ja, den Rest seines Lebens hier zu verbringen. Von ihm wusste ich die Namen vieler berühmter Leute, die in Oxford studiert hatten.
Meine Mutter dagegen erzählte mir vom Schwarzwald. Sie sang mir Lieder vor und dachte sich zu den Melodien von Schubert und Schumann, die ich so gern hörte, selbst Texte aus. Manchmal zeichnete sie kleine Skizzen vom Wald, die eine märchenhafte Ausstrahlung besaßen und mich auf eigenartige Weise bezauberten, weil ich sie mit ihren Geschichten von Trollen und Holzfällern in Verbindung brachte. Am liebsten aber hörte ich die uralten Sagen, die noch aus vorchristlicher Zeit überliefert waren, als die Menschen an nordische Gottheiten glaubten wie den Allvater Odin, Thor mit seinem Hammer und die schöne Göttin Freyja, nach der der Freitag benannt ist. Ich war wie gebannt von diesen Geschichten.
Manchmal erwähnte sie auch das Damenstift im Wald, wo sie von Nonnen erzogen worden war. Oft redete sie dabei deutsch, sodass ich mit dieser Sprache bald einigermaßen vertraut wurde, wenn ich auch nicht zweisprachig aufwuchs.
Es war ihr Herzenswunsch, dass auch ich in jenem Kloster erzogen werden sollte, in dem sie selbst einst so glücklich gewesen war. »Dort wird es dir bestimmt sehr gefallen«, sagte sie. »Die Luft hoch oben in den bewaldeten Bergen wird dich stark und gesund machen; im Sommer gibt es draußen im Freien Frühstück mit frischer Milch und Roggenbrot. Die Nonnen werden dich gut behandeln. Du wirst bei ihnen lernen, glücklich zu sein und tüchtig zu arbeiten. Das habe ich mir immer für dich gewünscht.«
Da mein Vater stets dasselbe wollte wie sie, besuchte ich also das Damenstift, und als ich mein Heimweh überwunden hatte, gefiel es mir dort bald sehr gut. Der Wald zog mich in seinen Bann – doch das war eigentlich schon der Fall gewesen, ehe ich ihn noch mit eigenen Augen sah. Und weil ich damals ein sehr unkompliziertes Mädchen war, fügte ich mich in das neue Leben mit den anderen Schülerinnen ohne große Schwierigkeiten ein. Meine Mutter hatte mich ja auf alles vorbereitet, und so war mir nichts sonderlich fremd. Mädchen aus ganz Europa wurden dort erzogen. Sechs von ihnen, mich eingerechnet, stammten aus England; dann gab es noch mehr als ein Dutzend Französinnen, und der Rest kam aus verschiedenen kleinen deutschen Staaten.
Wir verstanden uns ausgezeichnet. Wir sprachen Englisch, Französisch und Deutsch; das einfache Leben tat uns allen gut. Eigentlich sollten wir mit strenger Disziplin erzogen werden, aber natürlich gab es auch nachsichtige Nonnen, die sich leicht an der Nase herumführen ließen, und wir fanden ihre Schwächen schnell heraus.
Bald fühlte ich mich im Kloster glücklich und verbrachte zwei zufriedene Jahre dort. Auch in den Ferien fuhr ich nicht nach Hause, da die Reise zu weit und zu teuer war. Es blieben stets sechs oder sieben Schülerinnen während der Ferien im Kloster.
Besonders schön war es, wenn die anderen abreisten und wir den Saal mit Tannengrün aus dem Wald schmückten und Weihnachtslieder sangen, die Kapelle für das Osterfest dekorierten oder während der Sommerferien Picknicks im Wald abhielten.
Dies war ein neues Leben für mich, und ich gewöhnte mich völlig daran. Oxford mit seinen Kirchen und Türmen schien mir sehr fern zu sein – bis eines Tages die Nachricht kam, dass meine Mutter gefährlich erkrankt sei und ich nach Hause zurückkehren müsste. Das war im Sommer, und Mr. und Mrs. Greville – Freunde meines Vaters, die gerade Europa bereisten –, holten mich ab und nahmen mich mit nach Oxford. Meine Mutter war bereits tot, als ich dort eintraf.
Welche Veränderung erwartete mich! Mein Vater war um zehn Jahre gealtert; er schien sich nicht von der seligen Vergangenheit losreißen und der unerträglichen Gegenwart ins Auge sehen zu können. Die Tanten hatten sich unseres Haushalts bemächtigt. Tante Caroline gab mir zu verstehen, dass sie ein großes Opfer gebracht hatten, als sie ihr komfortables Haus in Somerset verließen, um für uns zu sorgen. Ich wäre jetzt sechzehn; zu alt, um meine Zeit noch länger mit dem Studium fremder Sprachen und Sitten zu vertrödeln, das mir nichts einbringen würde. Ich sollte mich im Haus nützlich machen; dort gäbe es eine Menge für mich zu tun. Junge Mädchen müssten kochen und nähen können, eine Vorratskammer halten und anderen häuslichen Pflichten nachkommen, die man ihrer Meinung nach kaum in ausländischen Klostern lernte.
Doch da erwachte Vater aus seiner Apathie. Es war der Wunsch meiner Mutter gewesen, dass ich meine Ausbildung im Damenstift vollenden und dort bleiben sollte, bis ich achtzehn Jahre alt war. So kehrte ich also zurück. Ich habe oft daran gedacht, dass jenes seltsame Abenteuer nie stattgefunden hätte, wenn die Tanten ihren Willen durchgesetzt hätten. Es geschah zwei Jahre nach dem Tod meiner Mutter. Ich hatte so vieles von meinem früheren Leben in Oxford vergessen und dachte nur noch selten daran, wie wir über den Kornmarkt gingen, hinunter zur Folly Bridge und St. Aldate; weder an die schlossartigen Mauern der Universitätsgebäude noch an die hohle Stille der Kathedrale und den Zauber des bunten Glasfensters an der Ostseite, das die Ermordung Thomas Beckets zeigte. Meine Wirklichkeit war nun das Klosterleben; die Geheimnisse, die ich mit den anderen Mädchen teilte, während wir im Schlafsaal lagen, wo dicke steinerne Pfeiler ein Bett vom anderen trennten.
Und so kam jener frühe Herbst, der mein ganzes Leben verändern sollte.
Ich war beinahe achtzehn – noch recht unreif für meine Jahre; leichtfertig und auch in gewisser Weise verträumt und romantisch. Ich muss mir selbst die Schuld an dem geben, was geschah.
Die mildeste der Nonnen war Schwester Maria. Sie hätte selbst Kinder haben sollen; vielleicht hätte sie sie zu sehr verwöhnt, aber wie glücklich wäre sie dabei gewesen! Doch sie war eine jungfräuliche Nonne und musste sich mit uns begnügen.
Sie zeigte mehr Verständnis für mich als alle anderen. Ja, sie wusste, dass ich nicht ungehorsam sein wollte. Ich war stolz und impulsiv; wenn ich einen Fehler beging, geschah es eher aus Gedankenlosigkeit als aus Eigensinn. Ich weiß, dass Schwester Maria der Mutter Oberin das immer wieder zu erklären versuchte.
Es war Oktober, und wir freuten uns über den Altweibersommer, denn der Herbst blieb in diesem Jahr lange im Land. Schwester Maria meinte, es wäre eine Schande, die goldenen Tage zu verschwenden; so machte sie sich daran, zwölf Mädchen auszuwählen, die es verdienten, sie zu einem Picknick zu begleiten. Wir konnten den offenen Wagen nehmen und auf die Hochebene fahren. Dort würden wir ein Feuer machen und Kaffee kochen. Schwester Gretchen hatte versprochen, uns als besonderen Leckerbissen ein paar von ihren Gewürzkuchen zu backen.
Ich war unter den zwölf Auserwählten – wohl eher, weil man hoffte, dass ich mich bessern würde, denn meine bisherige Führung rechtfertigte diesen Vorzug kaum. Doch was auch immer der Grund gewesen sein mag, ich war jedenfalls an jenem schicksalshaften Tag mit von der Partie. Schwester Maria kutschierte wie schon so oft den Wagen. Sie wirkte in ihren flatternden Gewändern wie eine große schwarze Krähe, während sie das Pferd auf eine meisterhafte Art lenkte, die mich immer wieder überraschte. Armes, altes Pferd, es hätte die Straße mit verbundenen Augen gefunden. Eigentlich gehörte also nicht sehr viel Geschicklichkeit dazu, es zu dirigieren. Es hatte wohl schon sehr oft in seinem Leben eine Wagenladung Mädchen zur Hochebene hinaufbefördert.
Wir kamen an, machten ein Lagerfeuer (wirklich nützlich für die Mädchen, solche Arbeiten zu lernen!), brachten das Wasser zum Kochen, brauten den Kaffee und aßen die Gewürzkuchen. Später wuschen wir das Geschirr am nahen Fluss und packten es wieder ein. Dann spazierten wir herum, bis Schwester Maria in die Hände klatschte, um uns zusammenzurufen. Sie sagte, wir würden in einer halben Stunde zurückfahren und sollten uns zu diesem Zeitpunkt wieder sammeln.
Was das bedeutete, wussten wir schon: Schwester Maria würde sich jetzt an den Baum lehnen, unter dem sie saß, und eine halbe Stunde lang ein wohlverdientes Schläfchen halten.
Und genau das tat sie auch, während wir uns zerstreuten. Ich spürte auch nun wieder die Erregung, die mich immer überkam, wenn ich in den Wäldern war. In einer solchen Umgebung verirrten sich Hänsel und Gretel und kamen zum Pfefferkuchenhaus; durch einen Wald wie diesen waren Brüderchen und Schwesterchen gewandert, hatten sich schlafen gelegt und mit Blättern zugedeckt. Am Saum des Hügels, der zum Fluss hin abfiel, entstanden in meiner Fantasie plötzlich Schlösser wie jenes, in dem Dornröschen hundert Jahre lang schlief, ehe ein Prinz sie mit seinem Kuss weckte. Dies war ein Zauberwald, voll von Trollen, verwunschenen Prinzen und Prinzessinnen, die auf ihre Erlösung warteten; hier gab es Riesen und Zwerge.
Bald hatte ich mich von den anderen entfernt; niemand war mehr zu sehen. Ich musste auf die Zeit achten. An meiner Bluse steckte eine kleine Uhr, die mit blauem Emaille verziert war und einst meiner Mutter gehört hatte. Es wäre nicht recht gewesen, zu spät zu kommen und die gutmütige, freundliche Schwester Maria in Unruhe zu versetzen.
Dann begann ich darüber nachzugrübeln, was ich bei meinem letzten Besuch daheim vorgefunden hatte – die Tanten, die sich in unserem Haus breitmachten, und mein Vater, dem es gleichgültig war, was um ihn her vorging. Dabei fiel mir ein, dass ich bald zurückkehren musste, denn man konnte nur bis neunzehn im Damenstift bleiben.
Der Nebel kommt in den Gebirgswäldern sehr plötzlich. Wir befanden uns hoch über dem Meeresspiegel. Fuhr man in die kleine Stadt Leichenkin, die dem Damenstift am nächsten war, so führte der Weg dauernd bergab. Und als ich so dasaß und mich fragte, was die Zukunft mir bringen würde, senkte sich der Nebel. Als ich aufstand, konnte ich nur mehr wenige Meter weit sehen.
Ich schaute auf meine Uhr. Es war Zeit, aufzubrechen. Schwester Maria würde nun schon aus ihrem Schlummer aufgewacht sein, in die Hände klatschen und nach uns Ausschau halten. Ich war ein wenig bergauf gestiegen; vielleicht war der Nebel bei ihr weniger dicht. Doch er würde sie in jedem Fall beunruhigen und sie veranlassen, sofort zurückzufahren.
Ich schlug die Richtung ein, aus der ich meiner Ansicht nach gekommen war, doch ich musste mich geirrt haben, denn ich konnte den Pfad nicht mehr finden. Trotzdem war ich nicht besonders beunruhigt, denn ich hatte noch ungefähr fünf Minuten Zeit, und glücklicherweise war ich nicht sehr weit vom Lagerplatz weggewandert. Doch meine Besorgnis nahm zu, als ich nach einiger Zeit den Weg noch nicht gefunden hatte. Wahrscheinlich ging ich im Kreis, aber ich sagte mir dauernd vor, dass ich sicher bald auf der kleinen Lichtung eintreffen würde, wo wir unser Picknick abgehalten hatten. Gleich würde ich die Stimmen der Mädchen hören. Doch kein Laut durchdrang den Nebel um mich her.
Ich rief: »Heeeo!«, wie wir es immer taten, wenn wir uns miteinander verständigen wollten. Es kam keine Antwort.
Ich war nicht sicher, wohin ich gehen sollte; dagegen wusste ich genug über den Wald, um zu begreifen, dass man sich bei derartigem Nebel leicht in der Richtung irren kann. Furcht überkam mich. Der Nebel mochte noch dichter werden und vielleicht auch die Nacht hindurch anhalten. Wie sollte ich dann zur Lichtung zurückfinden? Wieder rief ich, aber niemand antwortete mir.
Ich sah auf die Uhr. Es war schon fünf Minuten über der festgesetzten Zeit. Ich konnte mir Schwester Maria vorstellen, wie sie aufgeregt hin und herlief. »Schon wieder Helena Trant!«, würde sie sagen. »Aber sie hat es bestimmt nicht mit Absicht getan. Sie hat eben nicht überlegt ... «
Wie recht sie hatte! Ich musste zurückfinden. Ich konnte die arme Schwester Maria nicht so in Angst versetzen.
Wieder ging ich weiter und rief: »Heeeo! Ich bin’s, Helena! Hier!«
Doch aus dem grauen, unerbittlichen Nebel kam keine Erwiderung. Die Berge und Wälder sind wunderbar, aber sie sind auch grausam, und deshalb ist immer eine Andeutung von Grausamkeit in den Märchen, die im Wald spielen. Die böse Hexe lauert jeden Augenblick auf ihr Opfer; die verzauberten Bäume warten nur darauf, sich in Drachen zu verwandeln, wenn die Dunkelheit anbricht.
Doch ich verlor nicht die Fassung, obwohl ich wusste, dass ich mich verirrt hatte. Am besten war es wohl, wenn ich blieb, wo ich war, und nach den anderen rief.
Wieder sah ich auf die Uhr; eine halbe Stunde war vergangen. Ich war entsetzt, versuchte mich jedoch mit dem Gedanken zu beruhigen, dass sie nach mir suchten.
Ich wartete und rief. Schließlich gab ich meinen Vorsatz auf, mich nicht vom Platz zu rühren, und begann kopflos in verschiedene Richtungen zu laufen. Nun war schon eine Stunde seit dem vereinbarten Zeitpunkt verstrichen.
Ich rief, bis ich heiser war. Eine weitere halbe Stunde mochte vergangen sein, als ich vom Poltern eines Steines hochschreckte, der sich gelöst hatte, und das Knacken des Unterholzes mir verriet, dass sich jemand in meiner Nähe befand.
»Heeeo!«, rief ich hoffnungsvoll. »Hier bin ich!«
Er tauchte auf seinem großen weißen Pferd wie ein Held aus dem Nebel auf. Ich ging auf ihn zu. Eine Sekunde lang saß er ruhig da und betrachtete mich; dann sagte er auf Englisch: »Sie haben gerufen. Das bedeutet wohl, dass Sie sich verirrt haben.«
Ich war zu erleichtert, um Überraschung zu empfinden, dass er englisch sprach. Schnell erwiderte ich: »Haben Sie unseren Wagen gesehen? Und Schwester Maria und die Mädchen?«
Er lächelte leicht. »Sie gehören also zum Damenstift.«
»Ja, natürlich.«
Er sprang vom Pferd. Er war groß und breitschultrig, und sofort spürte ich, dass etwas von ihm ausging, was ich nur als Autorität bezeichnen kann. Ich war entzückt, denn ich brauchte jemanden, der mich rasch zu Schwester Maria zurückbrachte, und dieser Mann machte den Eindruck von Unbesiegbarkeit.
»Wir waren auf einem Ausflug, und ich bin vom Weg abgekommen«, sagte ich.
»Ach, Sie haben sich von der Herde abgesondert.« Seine Augen glänzten. Ich hatte den Eindruck, als wären sie von sehr heller Topasfarbe, aber vielleicht kam es vom seltsamen Licht, das der Nebel verursachte. Sein wohl geformter Mund verriet Entschlossenheit, und die Mundwinkel waren etwas nach oben gebogen; er wandte die Augen nicht von mir. Ich war ein wenig verwirrt, weil er mich so eindringlich musterte.
»Schafe, die ihre Herde verlassen, verdienen es, sich zu verirren«, sagte er.
»Ja, wahrscheinlich, aber ich habe mich nicht sehr weit entfernt. Wenn der Nebel nicht gewesen wäre, hätte ich sie leicht wiedergefunden.«
»In diesen Höhen muss man immer mit Nebel rechnen«, tadelte er.
»Ja, sicher, aber würden Sie mich vielleicht zurückbringen? Ganz bestimmt suchen sie noch alle nach mir.«
»Wenn Sie mir sagen können, wo die anderen sind, tue ich es natürlich. Aber wenn Ihnen diese wichtige Tatsache bekannt wäre, hätten Sie meine Hilfe gar nicht nötig.«
»Könnten wir nicht versuchen sie zu finden? Sie sind sicher nicht weit von hier.«
»Wie sollen wir in diesem Nebel irgendjemanden finden?«
»Es ist schon mehr als eine Stunde vergangen, seit ich mich auf der Lichtung einfinden sollte.«
»Sie sind zum Damenstift zurückgekehrt, verlassen Sie sich darauf.«
Ich warf einen Blick auf sein Pferd. »Es ist etwa fünf Meilen von hier. Könnten Sie mich hinbringen?«
Ich war ziemlich überrascht, als ich prompt hochgehoben und seitlich aufs Pferd gesetzt wurde. Er schwang sich in den Sattel. »Vorwärts, Sehlem«, sagte er auf Deutsch.
Das Pferd setzte sich vorsichtig in Bewegung, während der Fremde mich mit einem Arm umfasste; in der anderen Hand hielt er die Zügel. Ich fühlte, wie mein Herz schneller schlug. Ich war so aufgeregt, dass ich fast vergaß, mir wegen Schwester Maria Sorgen zu machen.
Ich sagte: »In diesem Nebel kann sich jeder verirren.«
»Jeder«, stimmte er mir zu.
»Ich nehme an, Sie haben sich auch verirrt?«, fragte ich.
»Gewissermaßen«, erwiderte er. »Aber Sehlem würde mich immer sicher zurückbringen.« Und er streichelte den Hals seines Pferdes.
»Sie sind kein Engländer«, sagte ich plötzlich.
»Ich bin durchschaut«, gestand er. »Woran haben Sie es denn so rasch gemerkt?«
»Ihr Akzent. Er ist zwar schwach, aber doch nicht zu überhören.«
»Ich wurde in Oxford erzogen.«
»Ach, wie herrlich! Dort bin ich zu Hause.«
»Dann haben Sie wohl jetzt eine etwas bessere Meinung von mir, nicht wahr?«
»Oh, ich hatte mir noch keine Meinung über Sie gebildet.«
»Wie weise! Nach einer so kurzen Bekanntschaft sollte man das niemals tun.«
»Ich bin Helena Trant und werde im Damenstift in der Nähe von Leichenkin ausgebildet.«
Natürlich wartete ich darauf, dass er sich jetzt ebenfalls vorstellte, doch er sagte nur: »Wie interessant.«
Ich lachte. »Als Sie aus dem Nebel auftauchten, hielt ich Sie für Siegfried oder etwas Ähnliches.«
»Sie schmeicheln mir.«
»Es war Ihr Pferd, Sehlem. Es ist prächtig. Und Sie wirkten darauf so groß und heldenhaft; genauso muss er ausgesehen haben – Siegfried, meine ich.«
»Mir scheint, Sie sind recht vertraut mit unseren alten Sagengestalten.«
»Ach, meine Mutter stammt von hier. Sie war früher sogar im gleichen Damenstift. Deshalb bin ich hierhergekommen.«
»Was für ein Glück!«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, wäre Ihre Mutter nicht in ebendiesem Damenstift erzogen worden, dann wären Sie nie hierhergekommen und hätten sich nicht im Nebel verirrt. Und ich hätte nie das Vergnügen gehabt, Sie zu retten.«
Ich lachte. »Es ist Ihnen also ein Vergnügen?«
»Ein großes Vergnügen.«
»Das Pferd geht so zielbewusst weiter. Wohin bringt es uns?«
»Es kennt seinen Weg.«
»Wirklich? Zum Damenstift?«
»Ich bezweifle, dass es je dort war. Aber es wird uns zu einem Obdach bringen, wo wir uns überlegen können, was zu tun ist.« Ich war beruhigt. Wahrscheinlich gab mir seine Ausstrahlung von Sicherheit das Gefühl, dass es ihm nicht schwerfallen wurde, eine Lösung zu finden, wie sie auch immer aussehen mochte.
»Sie haben mir Ihren Namen nicht gesagt«, mahnte ich.
Er erwiderte: »Sie haben mir doch schon einen Namen gegeben: Siegfried.«
Ich brach in Lachen aus. »Heißen Sie tatsächlich so? Oh, was für ein Zufall! Wie lustig, dass ich Ihren Namen richtig getroffen habe. Aber ich nehme doch an, Sie sind Wirklichkeit, kein Trugbild. Sie werden sich nicht plötzlich in Luft auflösen.«
»Warten Sie’s ab«, sagte er. Er hielt mich eng an sich gedrückt, was ein wunderliches Gefühl in mir hervorrief, das ich bisher nie empfunden hatte. Es hätte mich warnen sollen.
Wir waren ein wenig bergan geritten, und plötzlich änderte das Pferd seine Richtung. Die Umrisse eines Hauses tauchten im Nebel auf.
»Hier sind wir«, sagte Siegfried.
Er sprang vom Pferd und hob mich herunter.
»Wo bin ich?«, fragte ich. »Das ist nicht das Damenstift.«
»Keine Sorge, hier sind wir in Sicherheit. Der Nebel ist kalt.« Dann rief er: »Hans!«, und ein Mann kam aus den Stallungen an der einen Seite des Hauses. Er schien nicht im Geringsten überrascht, mich zu sehen; ruhig ergriff er die Zügel, die Siegfried ihm zuwarf, und führte das Pferd fort.
Siegfried schob seinen Arm unter den meinen und zog mich zu den Steinstufen, die zum Portal hinaufführten. Wir standen vor einer schweren, eisenbeschlagenen Tür, die er aufstieß; dann betraten wir eine Halle. Hinter dem Kamingitter loderte ein gewaltiges Feuer. Auf den polierten Dielenbrettern lagen Tierfelle als Teppiche.
»Ist das Ihr Zuhause?«, fragte ich.
»Es ist mein Jagdsitz.«
Eine Frau kam in die Halle. »Junger Herr!«, rief sie, und ich bemerkte die Bestürzung in ihrem Gesicht, als sie mich erblickte. Er erklärte ihr schnell in deutscher Sprache, dass ich eine Schülerin des Damenstifts sei und mich im Wald verirrt hätte.
Die Frau wirkte nun sogar noch beunruhigter. »Mein Gott! Mein Gott!«, murmelte sie immer wieder.
»Sei doch nicht so aufgeregt, Hilde«, beruhigte er sie. »Bring uns etwas zu essen. Das Kind ist ganz durchgefroren. Suche einen Mantel oder etwas Ähnliches für sie, damit sie aus ihren feuchten Kleidern herauskommt.«
Ich redete sie in ihrer eigenen Sprache an, und sie erwiderte mit scheltender Stimme: »Wir müssen Sie möglichst rasch zum Damenstift zurückbringen!«
»Könnten wir vielleicht eine Botschaft schicken, dass ich in Sicherheit bin?«, fragte ich zögernd, denn ich verspürte keine Sehnsucht, mein Abenteuer so schnell zu beenden.
»Der Nebel ist zu dicht«, meinte Siegfried. »Wart noch ein wenig, Hilde. Sobald wir sie zurückbringen können, tun wir es.«
Die Frau sah ihn vorwurfsvoll an, und ich fragte mich, was dieser Blick zu bedeuten hätte. Dann schob sie mich energisch die Holztreppe hinauf und brachte mich in ein Zimmer mit einem großen weißen Bett und vielen Schränken. Einen davon öffnete sie und holte daraus einen blauen Samtmantel hervor, der mit Pelz besetzt war. Ich stieß einen entzückten Schrei aus, als ich ihn erblickte. »Legen Sie Ihre Bluse ab«, sagte sie. »Sie ist feucht. Dann können Sie den Mantel umlegen.«
Ich tat es, und als ich einen flüchtigen Blick in den Spiegel warf, kam ich mir völlig verwandelt vor. Der blaue Samt war herrlich – ich hatte noch nie etwas Derartiges gesehen.
Ich fragte Hildegard, ob ich mein Gesicht und meine Hände waschen könnte. Zuerst sah sie mich beinahe furchtsam an; dann nickte sie. Nach einer Weile kam sie mit heißem Wasser zurück. »Kommen Sie nach unten, wenn Sie fertig sind«, sagte sie.
Ich hörte, wie eine Uhr siebenmal schlug. Sieben Uhr! Was mochte im Damenstift vor sich gehen? Der Gedanke machte mich fast krank vor Besorgnis, doch nicht einmal das konnte die wilde Erregung zügeln, die mich erfüllte. Nachdenklich wusch ich mich. Meine Wangen waren gerötet, meine Augen leuchteten. Ich löste mein Haar, das ich wie alle anderen auf Befehl der Mutter Oberin in Zöpfen trug, und es fiel mir über die Schultern – dunkel, glatt und schwer. Dann zog ich den blauen Samtmantel enger um mich und wünschte mir brennend, dass die Mädchen im Kloster mich so sehen könnten.
Ich hörte, wie an die Tür geklopft wurde, und Hildegard trat ins Zimmer. Sie holte tief Luft, als sie mich sah. Es war, als wollte sie eine Bemerkung machen; sie unterließ es jedoch. Das berührte mich ein wenig merkwürdig, doch ich war zu überwältigt von meinem Abenteuer, um länger darüber nachzudenken.
Sie brachte mich wieder über die Treppe nach unten in einen kleinen Raum. Dort war ein Tisch gedeckt; ich sah Wein und kaltes Huhn mit Früchten, Käse und ein großes Roggenbrot mit knuspriger Rinde.
Siegfried stand vor dem Feuer.
Seine Augen glitzerten, als er mich betrachtete. Ich war entzückt, denn ich wusste, was sein Blick bedeutete: Der Mantel kleidete mich, wie er jeden zum Vorteil verändern musste, der ihn trug. Und natürlich wirkte mein Haar gelöst schmeichelnder als in Flechten.
»Gefalle ich Ihnen so verwandelt?«, fragte ich. Ich sprach immer zu viel, wenn ich aufgeregt war. Überschwänglich fuhr ich fort: »Jetzt sehe ich wohl eher wie eine passende Gefährtin für Siegfried aus als mit der Schulbluse und den Zöpfen.«
»Eine sehr passende Gefährtin«, erwiderte er. »Sind Sie hungrig?«
»Ach, ich bin am Verhungern!«
»Dann wollen wir keine Zeit verlieren.«
Er führte mich zum Tisch und wartete sehr höflich hinter meinem Stuhl, während ich mich setzte. Ich war an solche Aufmerksamkeiten nicht gewöhnt. Er füllte mein Glas mit Wein.
»Heute Abend werde ich Sie bedienen«, sagte er.
Einen Augenblick lang überlegte ich, was er damit meinte, und erwiderte dann: »Ach – die Diener.«
»Sie wären bei einem solchen Anlass ein wenig überflüssig.«
»Und eigentlich unnötig, denn wir können ja selbst zugreifen.«
»Dieser Wein«, erklärte er, »stammt aus unserem Moseltal.«
»Wir trinken im Damenstift keinen Wein – nur Wasser.«
»Wie enthaltsam!«
»Und was sie sagen würden, wenn sie mich jetzt mit offenen Haaren hier sitzen sehen könnten, kann ich mir gar nicht vorstellen.«
»Es ist also verboten, das Haar offen zu tragen?«
»Man hält es für sündig oder so etwas.«
Er stand noch immer hinter mir, umfasste plötzlich mein Haar mit den Händen und zog es zu sich hin, sodass ich meinen Kopf mit einem Ruck zurücklegen und ihm voll ins Gesicht sehen musste. Er beugte sich über mich, und ich war gespannt, was nun geschehen würde.
»Sie tun merkwürdige Dinge«, sagte ich. »Warum ziehen Sie mich an den Haaren?«
Er lächelte, gab mich frei und ging zu dem Stuhl auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches. Dann setzte er sich.
»Wahrscheinlich fürchten die Schwestern, es könnte gewissenlose Leute in Versuchung führen. So würden sie es wohl mit Recht begründen.«
»Das Haar, meinen Sie?«
Er nickte. »Sie sollten es in Zöpfen tragen; es sei denn, Sie befinden sich in verlässlicher Gesellschaft.«
»Daran habe ich nicht gedacht.«
»Nein. Sie sind manchmal etwas gedankenlos, nicht wahr? Sie haben sich von der Herde abgesondert. Wissen Sie nicht, dass es im Wald wilde Eber und ebenso wilde Barone gibt? Der eine könnte ihnen nach dem Leben trachten, der andere Ihre Tugend rauben. Und jetzt verraten Sie mir, was von bei- dem Ihnen wertvoller erscheint.«
»Die Nonnen würden bestimmt sagen, die Tugend.«
»Aber ich hätte gern Ihre Meinung gehört.«
»Nachdem ich bisher weder das eine noch das andere verloren habe, kann ich es nur schwer beurteilen.«
»Die Nonnen vermutlich auch nicht, aber sie sind trotzdem zu einer Entscheidung gekommen.«
»Ach, sie sind schon so viel älter als ich. Wollen Sie damit sagen, dass Sie einer von den wilden Baronen sind? Wie wäre das möglich? Sie sind doch Siegfried. Kein Mann mit einem solchen Namen könnte jemals einem Mädchen die Tugend rauben. Viel eher würde ein Siegfried es vor wilden Ebern retten, oder vielleicht auch vor wilden Baronen.
»Nun, das Letztere klang nicht so ganz überzeugt. Ich nehme an, Sie hegen ein paar schlimme Befürchtungen, stimmt’s?«
»Ach ja, schon. Aber das macht die Sache erst zum Abenteuer, nicht wahr? Wenn mich eine Nonne gefunden hätte, wäre das sehr langweilig.«
»Aber sicher würden Sie doch Siegfried nichts Böses zutrauen?«
»Wenn er es wirklich wäre, nicht.«
»Sie misstrauen mir also?«
»Vielleicht sind Sie in Wirklichkeit ein ganz anderer als Sie sich den Anschein geben.«
»In welcher Beziehung?«
»Das müsste man erst herausfinden.«
Er war belustigt und sagte: »Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen ein Stück von diesem Fleisch auf den Teller lege.«
Er tat es, und ich nahm mir ein Stück Roggenbrot, das heiß und knusprig und köstlich war. Es gab noch eine Mischung aus gewürzten Essigfrüchten und Sauerkraut, wie ich es noch nie gekostet hatte. Das war so ganz anders als der übliche eingesalzene Weißkohl; es schmeckte herrlich.
Eine Zeitlang aß ich voll Heißhunger, und er beobachtete mich mit dem echten Vergnügen eines guten Gastgebers.
»Sie waren also wirklich hungrig«, sagte er.
Ich runzelte die Stirn. »Ja, und Sie denken bestimmt, dass ich mir eigentlich Sorgen machen sollte, was jetzt im Damenstift passieren mag, statt es mir hier wohl sein zu lassen.«
»Nein. Ich bin froh, dass Sie den Augenblick zu genießen verstehen.«
»Sie meinen also, ich soll vergessen, dass ich zurückkehren und den Nonnen gegenübertreten muss?«
»Ja, genau das meine ich. So sollte man leben. Wir sind einander im Nebel begegnet; Sie sind hier bei mir, und wir können uns unterhalten, solange der Nebel anhält. Weiter wollen wir nicht denken.«
»Ich will es versuchen«, erwiderte ich. »Ehrlich gesagt finde ich es nämlich sehr bedrückend, mir all die Unannehmlichkeiten vorzustellen, die mich im Damenstift erwarten.«
»Sie sehen also, dass ich recht habe.« Er erhob sein Glas. »Auf heute Abend«, sagte er. »Und der Teufel hole den morgigen Tag!«
Ich trank mit ihm. Der Wein wärmte meine Kehle, und ich spürte, wie Farbe in meine Wangen stieg.
»Obwohl das keine Lebensanschauung ist, die die Nonnen billigen würden«, fügte ich ernsthaft hinzu.
»Die Nonnen sparen wir uns für morgen auf. Heute Abend sollen sie uns nicht stören.«
»Ich muss einfach an die arme Schwester Maria denken. Die Mutter Oberin wird ihr Vorwürfe machen. ›Sie hätten diese Helena Trant nicht mitnehmen dürfen‹, wird sie sagen. ›Wo sie ist, gibt es immer Schwierigkeiten‹«
»Und stimmt das?«, fragte er.
»Es hat jedenfalls immer den Anschein.«
Er lachte. »Aber ich bin sicher, dass Sie anders sind als die übrigen Mädchen. Sie haben mir erzählt, dass auch Ihre Mutter hier war?«
»Ja, es war einst eine wunderbare Geschichte, aber nun hat sie ein trauriges Ende genommen. Meine Eltern lernten sich hier im Wald kennen, verliebten sich ineinander und lebten von da an froh und glücklich – das heißt, bis meine Mutter starb. Sie hatten viele Hindernisse zu überwinden, ehe sie heiraten konnten, aber sie schafften es, und alles wurde gut. Doch jetzt ist sie tot, und mein Vater ist allein.«
»Er hat Sie, wenn Sie nicht gerade weit fort im Damenstift leben oder im Nebel den Wald durchstreifen.«
Ich schnitt eine Grimasse. »Sie waren immer mehr ein Liebespaar als meine Eltern. Verliebte mögen keine Störenfriede, auch wenn es sich dabei um ihre eigenen Kinder handelt.«
»Unsere Unterhaltung beginnt ein wenig traurig zu werden«, sagte er. »Dabei sollten wir heute Abend doch fröhlich sein.«
»Fröhlich – obwohl ich mich verirrt habe und die Nonnen wahrscheinlich vor Aufregung außer sich sind? Sie werden sich fragen, wie sie es meinem Vater beibringen sollen, dass ich im Wald verschwunden bin.«
»Sie werden wieder im Kloster sein, ehe die Nonnen Zeit gefunden haben, ihm eine Nachricht zu senden.«
»Aber ich glaube nicht, dass wir vergnügt sein sollten, wenn sie so in Sorge sind.«
»Da wir es nicht ändern können, indem wir uns ebenfalls beunruhigen, wollen wir den Abend genießen. Das ist wahre Weisheit.«
»Sie sind wohl sehr weise, Siegfried.«
»Nun – Siegfried war weise, oder nicht?«
»Ich bin nicht so sicher. Es hätte mit Brunhild alles viel besser enden können, wenn er ein wenig klüger gewesen wäre.«
»Ihre Mutter scheint Sie gut mit unseren alten Sagen vertraut gemacht zu haben.«
»Manchmal, wenn wir beisammensaßen, hat sie mir einige davon erzählt. Am liebsten hatte ich die Geschichten von Thor und seinem Hammer. Kennen Sie die Sage, in der Thor sich schlafen legte, seinen Hammer neben sich, und einer der Riesen kam, um ihm den Hammer zu rauben? Die Riesen wollten den Hammer erst zurückgeben, wenn die Göttin Freyja die Braut des Riesenprinzen würde. Da verkleidete sich Thor als Freyja, und als die Riesen ihm den Hammer in den Schoß legten, warf er seine Verkleidung ab und erschlug sie alle. Dann kehrte er mit seinem Hammer ins Reich der Götter zurück.«
Wir lachten beide. »Besonders ehrlich war das nicht, finde ich«, fuhr ich fort. »Und diese Riesen müssen ziemlich kurzsichtig gewesen sein, weil sie den gewaltigen Thor für eine schöne Göttin hielten.«
»Verkleidungen können täuschen.«
»Doch nicht in solchem Maß!«
»Nehmen Sie hiervon noch etwas. Dieses Sauerkraut ist nach Hildegards Geheimrezept zubereitet worden. Schmeckt es Ihnen?«
»Köstlich«, versicherte ich.
»Ich bin begeistert, dass Sie so viel gesunden Appetit entwickeln.«
»Erzählen Sie mir etwas von sich. Sie wissen nun schon eine ganze Menge über mich.«
Er spreizte die Finger. »Sie wissen, dass ich im Wald war, um Wildschweine zu jagen.«
»Ja, aber ist das hier Ihr Zuhause?«
»Es ist mein Jagdsitz.«
»Sie leben also nicht wirklich hier?«
»Wenn ich in dieser Gegend auf der Jagd bin, schon.«
»Aber wo wohnen Sie?«
»Einige Meilen von hier.«
»Und was tun Sie?«
»Ich kümmere mich um die Ländereien meines Vaters.«
»Ach, ich weiß. Dann ist er wohl eine Art Gutsbesitzer.« Er fragte nach meinem Leben in Oxford, und bald erzählte ich ihm von Tante Caroline und Tante Mathilda.
Siegfried nannte sie »die Ungeheuer« und amüsierte sich sehr über die Spürhund-Geschichte. Dann sprach er vom Wald, und ich fühlte, dass er ebenso fasziniert von ihm war wie ich. Auch er fand, dass der Wald einen Zauber ausstrahlte, der sich in den Märchen so deutlich widerspiegelt. Seit meiner Kindheit war ich durch die Erzählungen meiner Mutter mit dem Wald vertraut, und Siegfried hatte in seinem Schatten gelebt. Es war herrlich, mit jemandem beisammen zu sein, der meine Empfindungen so offenkundig teilte.
Zweifellos gefiel es ihm, dass ich die Geschichten der Götter und Helden kannte, die uralter Sage zufolge in den Wäldern gelebt und die Nordländer regiert hatten, als sie noch ungeteilt waren. Als Christus geboren wurde und der Welt das Christentum brachte, starben die Helden der nordischen Sage – Männer wie Siegfried, Balder und Beowulf. Doch fast schien es, als lebte ihr starker Geist noch immer im Herzen des Waldes.
Ich hörte begeistert zu, als Siegfried die Sage vom schönen Balder erzählte, der so gut war, dass seine Mutter, die Göttin Freyja, jedem Tier und jeder Pflanze des Waldes den Schwur abnahm, ihm kein Leid zuzufügen. Es gab nur eine Ausnahme – die immergrüne Pflanze mit den gelbgrünen Blüten und weißen Beeren. Die Mistel war ärgerlich und verletzt, weil die Götter sie verurteilt hatten, ein Parasit zu sein. Loki, der Gott des Unheils, machte sich das zunutze. Er schleuderte einen Zweig dieser Mistel, der so scharf wie ein Pfeil war, gegen Balder. Dieser Zweig durchbohrte sein Herz und tötete ihn. Gewaltig war das Wehklagen der Götter.
Ich saß da und hing an seinen Lippen, glühend von dem Reiz dieses Abenteuers, den Kopf ein wenig benommen vom ungewohnten Wein. Ich war aufgeregter als je zuvor in meinem Leben.
»Loki stiftete eine Menge Unheil«, erklärte er mir. »Der Göttervater musste ihn oft bestrafen. Odin war gütig, aber furchtbar in seinem Zorn. Haben Sie den Odenwald schon besucht? Nein? Eines Tages müssen Sie das unbedingt tun. Es ist Odins Wald; hier in dieser Gegend haben wir übrigens einen Lokenwald, von dem es heißt, er sei Lokis Revier. Und nur wir feiern die Nacht des siebenten Vollmondes, wenn das Unheil die Herrschaft übernimmt und erst von der Morgendämmerung wieder vertrieben wird. Das schien den Menschen dieser Gegend Grund genug, ein Fest zu feiern. – Sie werden schläfrig.«
»Nein, nein, ich will nicht müde sein. Ich genieße diesen Abend viel zu sehr!«
»Wie ich sehe, haben Sie also glücklicherweise aufgehört, sich wegen morgen Gedanken zu machen.«
»Jetzt haben Sie mich wieder daran erinnert.«
»Tut mir leid. Wir wollen schnell das Thema wechseln. Wussten Sie, dass Ihre Queen vor kurzem den Schwarzwald besucht hat?«
»Ja, natürlich. Ich glaube, der Wald hat sie sehr beeindruckt. Dies ist ja die Heimat ihres Gatten. Sie liebt den Prinzen ebenso sehr wie mein Vater meine Mutter liebte.«
»Wie können Sie das wissen – ein junges und unerfahrenes Mädchen wie Sie?«
»Es gibt Dinge, die man instinktiv weiß.«
»Sie meinen Hingabe?«
»Liebe«, sagte ich. »Die große Liebe von Tristan und Isolde, von Abelard und Heloïse, von Siegfried und Brunhild.«
»Das sind Sagen. Das wirkliche Leben könnte anders sein.«
»Und meine Eltern«, fuhr ich fort, ohne ihn zu beachten. »Und die Queen und ihr Prinzgemahl.«
»Ich nehme an, wir sollten uns geehrt fühlen, dass Ihre große Königin einen unserer deutschen Prinzen geheiratet hat.«
»Ich glaube eher, sie war es, die sich geehrt fühlte.«
»Nicht von seiner Stellung, sondern von ihm als Mann.«
»Ja, es gibt so viele deutsche Prinzen und Herzöge und kleine Königreiche.«
»Eines Tages wird alles ein mächtiges, einiges Reich sein. Die Preußen sind entschlossen, das zu erreichen«, bemerkte er. »Aber jetzt wollen wir von persönlicheren Dingen sprechen.«
»Ich habe den Wunschknochen!«, rief ich. »Jetzt dürfen wir uns etwas wünschen.«
Ich war begeistert, dass er noch nichts von diesem Brauch wusste, und erklärte es ihm: »Jeder umfasst mit dem kleinen Finger ein Ende des Brustbeines und zieht daran. Dabei wünscht man sich etwas. Wer das größere Stück des Knochens erwischt, dessen Wunsch geht in Erfüllung.«
»Wollen wir’s versuchen?«
Wir versuchten es. »Jetzt wünschen Sie sich etwas!«, mahnte ich. Und ich dachte mir, dass es immer so bleiben müsste wie an diesem Abend. Aber das war ein dummer Wunsch. Natürlich konnte es nicht so bleiben. Die Nacht würde vorübergehen, und ich musste ins Kloster zurück. Doch ich wollte mir wenigstens wünschen, dass wir uns wiedersehen würden.
Er bekam das größere Stück. »Ich hab’ es!«, rief er triumphierend. Dann streckte er seine Hände über den Tisch und ergriff die meinen; seine Augen glänzten stark im Kerzenlicht.
»Wissen Sie, was ich mir gewünscht habe?«, fragte er.
»Sagen Sie es mir nicht!«, warnte ich. »Wenn Sie das tun, geht der Wunsch nicht in Erfüllung.«
Plötzlich beugte er sich vor und küsste meine Hände – nicht sacht, sondern wild und ungestüm. Mir war, als würde er sie nie wieder freigeben.
»Es muss in Erfüllung gehen!«, sagte er.
Ich erwiderte: »Ich kann Ihnen verraten, was ich mir gewünscht habe. Weil ich der Verlierer bin, zählt mein Wunsch wohl nicht.«
»Ja, bitte, sagen Sie es mir!«
»Ich wünschte mir, dass wir uns wiedersehen würden, dass wir wieder an diesem Tisch sitzen und miteinander sprechen könnten, und dass ich mein Haar offen hätte wie jetzt und den blauen Samtmantel tragen würde.«
Er sagte sehr zärtlich: »Lenchen – kleines Lenchen!«
»Lenchen?«, wiederholte ich. »Wer ist das?«
»Es ist mein Name für Sie. Helena klingt zu kühl, zu abweisend. Für mich sind Sie Lenchen – mein kleines Lenchen.«
»Das gefällt mir«, sagte ich. »Es gefällt mir sehr.«
Auf dem Tisch lagen Äpfel und Nüsse. Er schälte einen Apfel für mich und knackte einige von den Nüssen. Die Kerzen flackerten; Siegfried beobachtete mich über den Tisch hinweg. Plötzlich sagte er: »Sie sind heute Abend erwachsen geworden, Lenchen.«
»Ich fühle mich auch erwachsen«, versicherte ich. »Nun komme ich mir nicht länger wie ein Schulmädchen vor.«
»Nach diesem Abend werden Sie nie wieder ein Schulmädchen sein.«
»Ich muss aber zurück ins Damenstift, und dort bin ich wieder eine Schülerin unter vielen anderen.«
»Ein Damenstift macht noch kein Schulmädchen. Sie sind wirklich schläfrig.«
»Das kommt vom Wein«, erwiderte ich.
»Es ist Zeit für Sie, sich zurückzuziehen.«
»Ob es draußen wohl noch neblig ist?«
»Wenn es so wäre, würde Sie das beruhigen?«
»Ja, denn dann wüssten sie im Kloster, dass ich nicht zurückkehren kann, und es wäre dumm, sich zu sorgen, weil es sich ja nicht ändern lässt.«
Er ging zum Fenster und schob den schweren Samtvorhang zur Seite. Dann spähte er hinaus. »Es ist noch schlimmer geworden«, sagte er.
»Können Sie denn überhaupt etwas sehen?«
»Seit Sie in dem blauen Mantel herunterkamen, habe ich nur Sie gesehen.«
Meine Erregung wurde fast unerträglich, doch ich lachte ziemlich albern und erwiderte: »Das ist sicherlich eine Übertreibung. Als Sie den Wein einschenkten und das Hühnchen servierten, haben Sie beides bestimmt gesehen.«
»Genau, mein pedantisches Lenchen«, bestätigte er. »Kommen Sie, ich bringe Sie auf Ihr Zimmer. Es ist Zeit.«
Er nahm meine Hand und führte mich zur Tür.
Zu meiner Überraschung erwartete uns Hildegard dort.
»Ich werde der jungen Dame den Weg zeigen, Herr«, sagte sie.
Ich hörte ihn lachen und brummen, sie sei eine unverschämte alte Frau, die ihre Nase in Dinge stecke, die sie nichts angingen. Doch er ließ mich mit ihr gehen. Hildegard ging voraus, die Treppe zu dem Zimmer hinauf, in dem ich die Kleider gewechselt hatte. Im Kamin brannte jetzt ein Feuer.
»Die Nächte sind kühl, wenn es draußen neblig ist«, erklärte sie. Dann stellte sie ihre Kerze ab und entzündete jene, die in den Leuchtern über der Frisierkommode steckten. »Halten Sie die Fenster vor dem Nebel geschlossen«, mahnte sie.
Sie warf mir einen ernsten Blick zu, führte mich zur Tür und zeigte mir den Riegel. »Verriegeln Sie die Tür, wenn ich das Zimmer verlassen habe«, sagte sie. »Es ist hier mitten im Wald nicht immer ganz ungefährlich.«
Ich nickte.
»Vergewissern Sie sich, dass die Tür wirklich verschlossen ist«, fuhr sie eindringlich fort. »Ich wäre beunruhigt und könnte nicht einschlafen, wenn ich mich nicht darauf verlassen könnte.«
»Ich verspreche es Ihnen«, sagte ich.
»Dann gute Nacht, und schlafen Sie gut. Morgen Früh hat sich der Nebel sicher gelöst, und Sie werden zurückgebracht.«
Sie ging hinaus und wartete draußen, während ich den Riegel vorschob.
»Gute Nacht!«, rief sie noch einmal.
Ich stand mit klopfendem Herzen an die Tür gelehnt. Da hörte ich Schritte auf der Holztreppe.
Hildegard sagte: »Nein, junger Herr. Ich lasse es nicht zu. Sie können mich hinauswerfen. Meinetwegen lassen Sie mich auspeitschen, aber ich gestatte es nicht.«
»Du lästige alte Hexe«, versetzte er, doch seine Stimme klang nachsichtig.
»Eine junge Engländerin – ein Schulmädchen aus dem Damenstift ... Nein, ich lasse es nicht zu.«
»Du lässt es nicht zu, Hilde?«
»Nein. Ihre anderen Frauenzimmer, wenn es sein muss, aber kein junges und unschuldiges Mädchen vom Damenstift.«
»Du sorgst dich wegen der alten Nonnen.«
»Nein, ich sorge mich um die Unschuld.«
Es wurde still. Ich war ängstlich und zugleich voll Erwartung. Einerseits wollte ich von hier weglaufen; andererseits wünschte ich mir, zu bleiben. Nun verstand ich alles. Er war einer von den verruchten Baronen, kein Siegfried. Er hatte mir seinen richtigen Namen verschwiegen. Dies war sein Jagdsitz. Vielleicht lebte er für gewöhnlich auf einem jener Schlösser, die ich hoch über dem Fluss gesehen hatte. ›Eines Ihrer Frauenzimmer, wenn es sein muss‹, hatte Hildegard gesagt. Er hatte also Frauen hierhergebracht, und als er mich im Nebel fand, nahm er mich mit, als wäre ich eine von ihrer Sorte.
Ich zitterte. Gesetzt den Fall, Hildegard wäre nicht hier gewesen? In den Märchen hielten die Riesen die Prinzessinnen gefangen, ohne ihnen ein Leid zuzufügen, bis sie gerettet wurden. Doch dies war kein Schloss, sondern ein Jagdsitz; und der Herr dieses Hauses war kein Riese, sondern ein leidenschaftlicher Mann.
Ich legte den Samtmantel ab und sah nun wieder mehr wie ich selbst aus. Dann entkleidete ich mich und streifte das seidene Nachthemd über. Es war weich und schmiegsam, ganz anders als das Flanellzeug, das wir im Damenstift trugen. Ich ging zu Bett, konnte aber nicht schlafen. Nach einer Weile kam es mir vor, als hätte ich Schritte auf der Treppe gehört. Ich erhob mich, ging zur Tür und lauschte. Plötzlich sah ich, wie die Türklinke langsam niedergedrückt wurde. Wenn Hildegard nicht darauf bestanden hätte, dass ich den Riegel vorschob, wäre die Tür jetzt geöffnet worden.
Wie gebannt starrte ich auf den Griff und hörte, wie jemand hinter der Tür atmete. Eine Stimme – seine Stimme – flüsterte: »Lenchen ... Lenchen, bist du da?«
Verwirrt stand ich da; mein Herz klopfte so heftig, dass ich fürchtete, er könnte es hören. Dabei kämpfte ich gegen den unerklärlichen Wunsch an, den Riegel zurückzuziehen.
Aber ich tat es nicht. Hildegards Stimme klang mir noch in den Ohren: ›Ihre Frauenzimmer, wenn es sein muss.‹ Und ich wusste, dass ich die Tür nicht aufschließen durfte.
Bebend verharrte ich auf der Stelle, bis sich seine Schritte wieder entfernten. Dann ging ich zu Bett. Ich versuchte einzuschlafen, aber es gelang mir erst viel später.
Ein Hämmern an der Tür weckte mich. Hildegard rief: »Guten Morgen!«
Langsam öffnete ich die Augen und sah, dass das Sonnenlicht ins Zimmer flutete. Als ich die Tür aufmachte, stand Hildegard vor mir. Sie trug ein Tablett mit Kaffee und Roggenbrot.
»Essen Sie das und ziehen Sie sich sofort an«, befahl sie. »Sie müssen unverzüglich ins Damenstift zurückkehren.«
Ich trank den heißen Kaffee und aß das Brot; dann wusch ich mich und kleidete mich an.
Hildegard wartete bereits in Hut und Umhang, und draußen stand ein Einspänner, vor den ein Rotschimmel gespannt war.
»Wir müssen gehen«, sagte sie. »Ich habe Hans schon bei Tagesanbruch mit einer Botschaft zum Damenstift geschickt, dass Sie in Sicherheit sind.«
»Sie sind so freundlich«, erwiderte ich. Dabei dachte ich an das Gespräch, das ich letzte Nacht belauscht hatte, und wie sie mich vor dem verruchten Siegfried gerettet hatte – obwohl ich gar nicht so sicher war, ob ich wirklich gerettet werden wollte.
»Sie sind noch sehr jung«, sagte sie streng. »Und Sie sollten gut aufpassen, damit Sie sich nicht wieder verirren.«
Ich sah mich nach Siegfried um, doch er war nicht da. Ärger stieg in mir auf. Warum kam er nicht, um mir Lebewohl zu sagen?
Zögernd kletterte ich in die Kutsche.
Hildegard berührte das Pferd mit der Peitsche, und wir fuhren auf die Straße. Da der Weg oft steil war und die Straße manchmal holprig, kamen wir nur langsam vorwärts. Sie sprach nicht viel mit mir, doch wenn sie es tat, merkte ich ihre Besorgnis, ich könnte mein Abenteuer preisgeben. Sie schaffte es, mir taktvoll beizubringen, dass ich Siegfried nicht erwähnen sollte. Hans hatte schon eine Botschaft überbracht. Es musste so aussehen, als hätte Hildegards Mann mich im Nebel gefunden und in sein Haus gebracht. Er und Hildegard hatten sich dann um mich gekümmert, bis ich ins Damenstift zurückfahren konnte.
Ich verstand ihre Andeutungen gut: Die Nonnen durften nicht erfahren, dass einer der verruchten Barone mich gefunden und in seine Jagdhütte gelockt hatte, um mich zu verführen. Ja; nun sah ich die Wahrheit klar vor mir. Offenkundig hatte Siegfried genau das beabsichtigt. Doch Hildegard hatte mich beschützt.
Obwohl sie sein Verhalten missbilligte, bestand kein Zweifel, dass sie ihm sehr zugetan war. Auch das konnte ich nur zu gut verstehen. Ich stimmte ihr zu, dass es klüger war, mein Abenteuer etwas vereinfacht zu schildern.
So erreichten wir das Damenstift. Welche Aufregung erwartete mich! Schwester Maria schien die ganze Nacht geweint zu haben. Schwester Gudrun triumphierte insgeheim. »Ich habe ja schon immer gesagt, dass es keinen Sinn hat, von Helena Trant gutes Benehmen zu erwarten.«
Hildegard wurde mit Dank und Segenswünschen überschüttet, und ich verbrachte lange Zeit im Privatzimmer der Mutter Oberin, ohne recht zu hören, was sie zu mir sagte. So viele Gedanken und Eindrücke schwirrten mir im Kopf herum, dass ich für nichts anderes mehr Platz hatte.
Ich konnte nicht aufhören, an ihn zu denken. Ich wusste, dass ich ihn nie vergessen würde, und sagte mir: Eines Tages werde ich in den Wald gehen, und er wird mich erwarten.
Doch nichts dergleichen geschah.
Drei öde Wochen folgten, nur von der Hoffnung erhellt, ich könnte ihn wiedersehen, doch immer wieder verdüstert von der Tatsache, dass sich meine Erwartung nicht erfüllte. Dann kamen Neuigkeiten von zu Hause. Mein Vater war ernstlich erkrankt. Ich musste sofort nach England. Aber ehe ich noch abreisen konnte, kam die Nachricht, er sei tot.
Nun musste ich das Damenstift für immer verlassen und heimreisen. Mr. und Mrs. Greville, die mich schon einmal begleitet hatten, erklärten sich freundlicherweise bereit, mich auch diesmal abzuholen und zurückzubringen.
In Oxford warteten Tante Caroline und Tante Mathilde auf mich.
Kapitel 2
Anfang Dezember war ich wieder zu Hause in England; das Weihnachtsfest stand vor der Tür. In den Fleischerläden schmückten kleine Stechpalmenzweige die Platten mit den Leberpasteten, und den Schweinen hatte man Orangenscheiben ins Maul gesteckt, sodass sie recht munter wirkten, obwohl sie tot waren. In der Dämmerung zeigten die Budenbesitzer auf dem Markt unter dem flackernden Licht der Naphthalinlampen ihre Waren, und an den Fenstern einiger Geschäfte hing an Fäden aufgezogene Baumwolle, die wie Schneeflocken aussehen sollte. Der Maronihändler stand mit seiner glühenden Kohlenpfanne an der Straßenecke. Ich erinnerte mich daran, wie meine Mutter nie widerstehen konnte, eine oder zwei Tüten voll heißer Kastanien zu kaufen, die unsere Hände wärmten, während wir sie nach Hause trugen. Doch am liebsten hatte sie uns am Weihnachtsabend selbst Kastanien auf dem Rost gebraten. Wir feierten das Weihnachtsfest so, wie meine Mutter es von ihrer Kindheit her gewöhnt war. Oft erzählte sie uns, wie jedes Familienmitglied einen eigenen Baum mit brennenden Kerzen bekommen hatte, und der größte Christbaum stand mitten im Rittersaal; darunter lag für jeden ein Geschenk. So hatte man das Weihnachtsfest alljährlich in ihrer Familie gefeiert, sagte sie. Wir in England schmückten ebenfalls Tannenbäume, seit dieser Brauch durch die Königinmutter aus Deutschland übernommen wurde und sich später durch die starke Verbindung der Queen mit der Heimat ihres Gatten noch vertiefte.
Früher hatte ich mich auf das Weihnachtsfest gefreut, doch in diesem Jahr hatte es keinen Reiz mehr für mich. Ich vermisste meine Eltern weit mehr, als ich es je für möglich gehalten hatte. Natürlich war ich jahrelang von ihnen getrennt gewesen, doch ich hatte immer in dem Bewusstsein gelebt, dass sie dort in dem kleinen Haus neben der Buchhandlung wohnten, das mein Heim war.