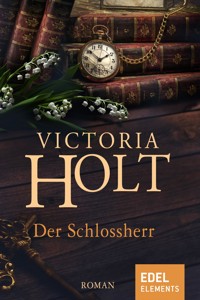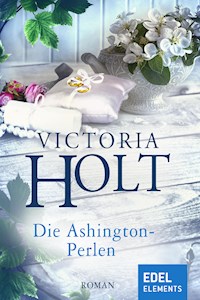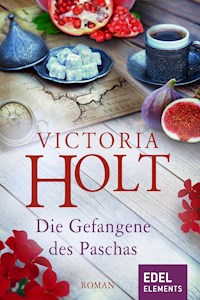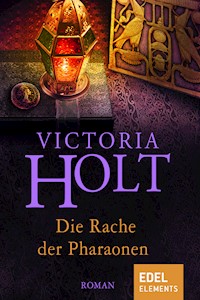4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kate, Tochter eines englischen Malers, hat das Talent ihres Vaters geerbt und feiert in Frankreich künstlerische Erfolge. Als ihr Förderer, ein französischer Baron, aus selbstsüchtigen Gründen ihre Liebesheirat verhindert, lernt Kate die rauen und wenig erfreulichen Seiten des Lebens kennen. In den Wirren der preußischen Belagerung von Paris fasst sie den Entschluß, ihr Schicksal noch einmal mutig herauszufordern ... Virtuos mixt Victoria Holt die Zutaten für diesen großangelegten Spannungsroman im historischen Gewand: Romantik und Spannung, Liebe und Hass, Leben und Tod bilden die Pole dieses aufregenden Romans von der unbeirrbaren Liebe einer jungen Künstlerin!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Victoria Holt
Die Lady und der Dämon
Roman
Ins Deutsche übertragen von Margarete Längsfeld
Edel eBooks
Inhalt
Einladung ins Schloß
Das Schloß
Die Straßen von Paris
Der Dämon
Nicole
Der geflammte Drachen
Die Belagerung von Paris
Das kleine Haus
Der Ausweg
Sterben um der Liebe willen
Impressum
Einladung ins Schloß
An einem heißen Junitag gestand mir mein Vater das Geheimnis, das unser beider Leben gänzlich verändern sollte. Nie werde ich mein Entsetzen darüber vergessen. Die Sonne brannte an dem Tag unbarmherzig. Mein Vater schien innerhalb weniger Minuten um Jahre gealtert, und als er mir seinen Blick zuwandte, las ich in seinen Augen Verzweiflung. Jetzt gab es keine Heimlichtuerei mehr. Er wußte, daß er seine Tragödie nicht länger vor mir verbergen konnte.
Selbstverständlich war ich diejenige, die es als erste erfuhr. Ich stand ihm näher als sonst ein Mensch – näher selbst als meine Mutter zu ihren Lebzeiten. Ich war mit allen seinen Stimmungen vertraut: Ich kannte den Triumph des schaffenden Künstlers, sein Ringen, seine Enttäuschungen; denn im Atelier verwandelte sich der sanfte, umgängliche Mann in einen anderen Menschen. Dort verbrachte er die meiste Zeit. Hier spielte sich sein Leben ab. Schon als Fünfjähriger hatte er in diesem Haus, das den Collisons seit hundert Jahren als Wohnsitz diente, seinem Vater bei der Arbeit im Atelier zugesehen. In der Familie erzählte man sich, daß man ihn als vierjährigen Knirps einmal vermißte, bis ihn sein Kindermädchen hier gefunden hatte, wo er mit einem der feinsten Haarpinsel seines Vaters auf einem Stück Pergament malte.
Die Collisons hatten in der Welt der Kunst einen guten Namen. Ihre Miniaturen waren in ganz Europa berühmt, und es gab keine Sammlung von Rang, die nicht wenigstens einen Collison enthielt.
Die Miniaturmalerei war Tradition in unserer Familie. Mein Vater behauptete, das Talent habe sich durch die Generationen vererbt, und um ein großer Maler zu werden, müsse man in der Wiege beginnen. So war es jedenfalls bei den Collisons. Seit dem 17. Jahrhundert malten sie Miniaturen. Ein Vorfahre war Schüler von Isaac Oliver gewesen, der wiederum Schüler keines Geringeren als des berühmten elisabethanischen Miniaturmalers Nicolas Hilliard war.
Bis hin zu meiner Generation hatte stets ein Sohn die Nachfolge seines Vaters angetreten und so nicht nur die Tradition, sondern auch den Namen fortgeführt. Mein Vater aber hatte lediglich eine Tochter – mich.
Das mußte für ihn eine große Enttäuschung gewesen sein, wenngleich er es niemals aussprach. Außerhalb des Ateliers war er ein sehr sanfter Mensch, der stets Rücksicht auf die Gefühle anderer nahm; er sprach ziemlich langsam und wägte seine Worte ab, stets ihrer Wirkung auf andere bedacht. Wenn er arbeitete, war das allerdings anders. Dann schien er völlig besessen: Er vergaß Mahlzeiten, Verabredungen, Verpflichtungen. Zuweilen hatte ich den Eindruck, daß er nur deshalb so fieberhaft arbeitete, weil er sich als den letzten Collison sah. Allmählich erkannte er jedoch, daß dies nicht unbedingt der Fall sein müßte, denn auch ich hatte die Faszination des Pinsels, des Pergaments und des Elfenbeins entdeckt. Ich war entschlossen, die Familientradition fortzuführen, und wollte meinem Vater beweisen, daß eine Tochter nicht minderwertig, sondern ebenso fähig war wie ein Sohn. Das war einer der Gründe, weshalb ich mich mit Begeisterung der Malerei verschrieb. Der andere, weit wichtigere Grund war der, daß ich – ungeachtet meines Geschlechts – das Talent für die subtile Portraitmalerei geerbt hatte. Ich besaß den inneren Antrieb – und war so vermessen anzunehmen, auch die Begabung –, um mit jedem meiner Vorfahren zu wetteifern.
Mein Vater war damals Ende Vierzig, doch seine klaren blauen Augen und sein stets zerzaustes Haar ließen ihn jünger erscheinen. Er war groß – ich hatte gehört, daß man ihn als aufgeschossen bezeichnete – und sehr schlank, wodurch er eine Spur linkisch wirkte. Ich glaube, die Leute waren überrascht, daß dieser recht unbeholfene Mann so delikate Miniaturen schaffen konnte.
Sein Vorname war Kendal; das war Familientradition. Vor langer Zeit hatte ein Mädchen aus dem Seengebiet in die Familie eingeheiratet, und dieser Name war der ihres Geburtsorts. Ferner war es Tradition, daß die Vornamen aller Männer mit Kanfingen, und die Initialen K. C. – so klein in eine Ecke geritzt, daß sie kaum sichtbar waren – waren das Kennzeichen der berühmten Miniaturen. Es hatte oftmals Verwirrung gegeben, welcher der Collisons ein Bild gemalt hatte, und häufig hatte man das Entstehungsdatum erst aus der Wirkungsperiode des Dargestellten herleiten können.
Bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr war mein Vater unverheiratet. Er gehörte zu den Menschen, die alles beiseite schieben, was sie von ihrer Arbeit ablenken könnte. Das galt auch für die Ehe, obwohl er sich, einem Monarchen ähnlich, seiner Pflicht bewußt war, den Erben zu zeugen, der die Familientradition fortführte.
Erst als er zum Wohnsitz des Grafen von Langston in Gloucestershire kam, fühlte er den Wunsch zu heiraten, und das nicht nur als bloßes Pflichtbewußtsein gegenüber der Familie. Der Graf hatte ihn beauftragt, Miniaturen von der Gräfin nebst ihren beiden Töchtern Lady Jane und Lady Katherine – genannt Lady Kitty – zu malen, und Vaters Meinung nach war die Miniatur von Lady Kitty das beste Bildnis, das er je geschaffen hatte. »Ich habe es mit Liebe gemalt«, bemerkte er in seiner sentimentalen Art.
Es war Liebe mit einem romantischen Ausgang obwohl der Graf mit seiner Tochter natürlich anderes im Sinn gehabt hatte. Er war kein sonderlicher Kunstkenner; er wollte lediglich eine Collison – Miniatur, weil er gehört hatte, daß »dieser Collison gut war«.
Mein Vater hatte ihn einen »Banausen« genannt, der glaubte, Künstler seien Bedienstete, die von wohlhabenden Männern gefördert würden. Schließlich hatte er sich für seine Tochter mindestens einen Herzog erhofft.
Das Mädchen Kitty jedoch zeigte sich entschlossen, seinen Willen durchzusetzen, und sie hatte sich ebenso heftig in den Künstler verliebt wie dieser in sie. Sie brannten durch, und Kitty wurde von ihrem erzürnten Vater unterrichtet, daß die Pforten von Schloß Langston ihr auf immer verschlossen seien. Da sie die Torheit besaß, Kitty Collison zu werden, war ihr fortan jegliche Verbindung mit der Familie Langston untersagt.
Lady Kitty schnippte nur mit den Fingern und machte sich für das nach ihren Maßstäben gewiß bescheidene Leben im Hause Collison bereit.
Ein Jahr nach der Hochzeit kam ich auf dramatische Weise zur Welt; ich machte eine Menge Mühe, was Lady Kitty ihre ohnehin nicht sehr robuste Gesundheit kostete. Als halbe Invalidin war sie seither außerstande, noch mehr Kinder zu gebären, und man mußte sich der unangenehmen Wahrheit stellen: Das einzige Kind war ein Mädchen, und das bedeutete anscheinend das Ende des Geschlechts der Collisons.
Man ließ mich freilich niemals fühlen, daß ich eine Enttäuschung war, doch ich kam von selbst dahinter, als ich von den Familientraditionen erfuhr und in das große Atelier hineinwuchs, dessen riesige Fenster so angelegt waren, daß sie das helle Nordlicht einfingen.
Ich erfuhr eine Menge aus dem Dienstbotenklatsch, denn ich lernte schon früh, daß ich durch das Personal mehr erfahren konnte als durch Fragen an meine Eltern.
»Den Langstons ist es immer gelungen, Söhne zu kriegen. Meine Nichte ist bei ’nem Vetter von denen in Stellung. Sie sagt, es is’n feudales Haus. Fünfzig Dienstboten ... mindestens, und das bloß auf’m Land. Die Gnädige ist für das hiesige Leben nicht geschaffen.«
»Meinst du, daß sie’s bedauert?«
»O ja, gewiß. Muß sie doch. All die Bälle und Titel und so ... Sie hätte ‘nen Herzog heiraten können.«
»Aber er ist ein echter Gentleman ... das kann man nicht anders sagen.«
»O ja, da geb’ ich dir recht. Aber er ist eben bloß so ‘ne Art Händler ... verkauft Waren. Oh, ich weiß, es sind Bilder, und das soll ja was anderes sein ... aber es sind nun mal Waren ... und er verkauft sie. Das geht nie gut ... wenn man aus der Reihe tanzt. Klasse und so. Und kein Sohn da, nicht wahr. Sie haben bloß diese Miss Kate.«
»Sie hat Geist, daran ist nicht zu rütteln. Hat was von ’ner Madam.«
»Schlägt eigentlich keinem von beiden nach.«
»Weißt du, was ich meine? Er hätte eine kräftige junge Frau heiraten sollen ... eine von seinem Stand ... natürlich, eine Dame ... Tochter eines Gutsherrn oder so ... Er wollte zu hoch hinaus. Dann hätte seine Frau jedes Jahr ein Baby haben können, bis der Sohn gekommen wäre, der alles über die Malerei lernen könnte. So hätte es sich gehört. Das kommt davon, wenn man außerhalb seiner eigenen Klasse heiratet.«
»Glaubst du, das macht ihm was aus?«
»Klar macht ihm das was aus. Er wollte einen Sohn. Und unter uns gesagt, die Gnädige hält nicht allzuviel von dieser Malerei. Aber wenn die Malerei nicht wäre, hätte er sie nicht kennengelernt, oder? Und wer weiß, ob das nicht das Beste gewesen wäre?«
So lernte ich begreifen.
Als ich von dem Geheimnis erfuhr, war seit dem Tod meiner Mutter ein Jahr vergangen. Das war ein schwerer Schlag für uns gewesen. Sie war sehr schön, und das hatte meinem Vater und mir genügt. Sie hatte gern Blau getragen, das zu ihren Augen paßte, und ihre Nachmittagskleider waren mit Spitzen und Bändern reich verziert. Da sie seit meiner Geburt eine halbe Invalidin war, fühlte ich mich in gewisser Weise dafür verantwortlich, aber ich tröstete mich damit, daß sie es im Grunde genoß, auf ihrem Sofa zu liegen und Leute zu empfangen, wie eine Königin auf ihrem Diwan. Wenn sie ihre sogenannten »guten Tage« hatte, spielte sie Klavier oder arrangierte Blumen, und manchmal lud sie auch Gäste ein – vornehmlich aus der Nachbarschaft.
Die Farringdons wohnten im nächstgelegenen Gutshaus, und das meiste Land in der Umgebung gehörte ihnen. Dann waren da noch der Pfarrer und der Arzt mit ihren Familien. Alle fühlten sich durch eine Einladung von Lady Kitty geehrt, sogar Lady Farringdon. Waren die Farringdons auch reich, so war Sir Frederick doch lediglich ein Ritter der zweiten Generation, und Lady Farringdon war von der Tochter eines Grafen ziemlich beeindruckt.
Meine Mutter gab sich keine große Mühe, das Hauswesen zu bestellen. Das besorgte Evie, ohne die unser Dasein weit weniger angenehm verlaufen wäre. Evie war erst siebzehn, als sie zu uns kam. Ich war damals ungefähr ein Jahr alt, und meine Mutter hatte sich damit abgefunden, daß sie stets kränkeln würde. Evie war eine entfernte Cousine meiner Mutter – eine aus der Masse armer Verwandter, wie sie im Umkreis wohlhabender Familien häufig anzutreffen sind. Ein entferntes weibliches Mitglied dieser Familie hatte unter ihrem Stand, das heißt, entgegen den Wünschen ihrer Angehörigen, geheiratet und somit den eigenen Abstieg eingeleitet. Evie war ein Sproß aus diesem Zweig, aber aus irgendeinem Grund hatte sie Verbindung mit der Familie gehalten und war in Notfällen zu Hilfe gerufen worden.
Evie und meine Mutter waren einander sehr zugetan, und als die schöne Lady Kitty merkte, daß sie eine beträchtliche Zeit ihres Lebens auf Sofas liegend verbringen mußte, kam es ihr in den Sinn, daß Evie genau die Richtige war, um sich um alles zu kümmern.
So kam Evie zu uns; sie hat es nie bereut, und wir ebensowenig. Außerdem waren wir auf Evie angewiesen: Sie verwaltete das Hauswesen und befehligte die Dienstboten, sie war meiner Mutter Gefährtin und Zofe, eine tüchtige Haushälterin, mir eine Mutter – und bei alledem sorgte sie dafür, daß mein Vater ungestört arbeiten konnte.
Sie arrangierte kleine Gesellschaften für meine Mutter und kümmerte sich darum, daß alles reibungslos ablief, wenn Besucher ins Haus kamen, um meinem Vater eine Arbeit in Auftrag zu geben. Wenn er verreisen mußte – was ziemlich häufig der Fall war –, konnte er in dem Bewußtsein fortgehen, daß gut für uns gesorgt war.
Wenn er dann nach Hause zurückkehrte, ließ sich meine Mutter gern von seinen Abenteuern berichten. Sie stellte ihn sich mit Vorliebe als berühmten, sehr gefragten Maler vor, wenngleich sein Schaffen sie eigentlich nicht weiter interessierte. Ich hatte bemerkt, wie ihre Augen sich gelangweilt verschleierten, wenn er in Begeisterung über die Malerei geriet – ich aber wußte, wovon er sprach, denn ich hatte Collisonsches Blut in den Adern, und nie war ich glücklicher, als wenn ich einen feinen Haarpinsel in Händen hielt und dünne, aber feste Striche auf ein Stück Elfenbein oder Pergament zeichnen durfte.
Auch ich hieß Katherine, wurde aber Kate genannt, um mich von Kitty zu unterscheiden, und ähnelte weder meinem Vater noch meiner Mutter. Ich war wesentlich dunkler als die beiden.
»Ein Rückfall ins sechzehnte Jahrhundert«, meinte mein Vater, der natürlich viel von äußeren Erscheinungsbildern verstand. »Eine Ahnin der Collisons muß genauso ausgesehen haben wie du, Kate: diese hohen Wangenknochen, der rötliche Schimmer in deinem Haar und deine gelblichbraunen Augen. Diese Tönung ist schwer wiederzugeben. Man müßte dazu die Farben sehr sorgfältig mischen. Eine solch knifflige Arbeit liegt mir gar nicht ... Das Ergebnis kann verheerend sein.« – und ich mußte wieder einmal darüber lachen, wie er in Gesprächen immer wieder auf seine Arbeit kam.
Ich muß ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein, als ich einen Schwur tat, nachdem ich die Dienstboten hatte darüber reden hören, daß ich ein Mädchen und eine Enttäuschung war.
Ich ging ins Atelier, und im Glanz des Lichtes stehend, das durch das hohe Fenster hereinfiel, sagte ich: »Ich werde eine große Malerin. Meine Miniaturen werden die besten sein, die man je sah.«
Und da ich ein sehr ernsthaftes Kind, voll von inniger Zuneigung zu meinem Vater war und eine innere Stimme mir sagte, daß ich hierfür geboren sei, begann ich augenblicklich, meinen Vorsatz auszuführen. Anfangs machte mein Vater sich darüber lustig, aber er brachte mir bei, wie man das Pergament auf steifen weißen Karton spannte und unter einem Gewicht zwischen Papier preßte.
»Haut ist fettig«, sagte er zu mir, »deshalb müssen wir sie ein wenig abreiben. Weißt du, wie das geht?« – und ich lernte, wie man die Oberfläche mit einer Mischung aus Saponit und pulverisiertem Bimsstein abrieb.
Dann lehrte er mich, mit Öl, Tempera und Gouache umzugehen. »Doch Wasserfarben sind für Kleinstformate das Beste«, erklärte er.
Ich war überglücklich, als ich meinen ersten Pinsel bekam, und Jubel erfüllte mich, als ich die Miene meines Vaters sah, nachdem ich meine erste Miniatur gemalt hatte.
Er legte seine Arme um mich und drückte mich fest an sich, damit ich die Tränen in seinen Augen nicht sähe. Mein Vater war ein sehr rührseliger Mensch.
»Du hast es in dir, Kate. Du bist eine von uns«, rief er aus. Ich zeigte meiner Mutter mein erstes Werk. »Es ist sehr gut«, sagte sie. »O Kate, auch du bist ein Genie. Und ich ... ich bin ganz gewiß keins!«
»Das brauchst du auch nicht«, beruhigte ich sie. »Du brauchst nur schön zu sein.«
Es waren glückliche Zeiten. Mein Vater und ich kamen uns durch unsere Arbeit noch näher, und ich verbrachte Stunden im Atelier. Eine Gouvernante kümmerte sich um mich, bis ich siebzehn war, denn mein Vater wünschte nicht, daß ich eine Schule besuchte, weil dadurch die Zeit, die ich im Atelier verbrachte, verkürzt würde.
»Um eine große Malerin zu werden, mußt du jeden Tag arbeiten«, sagte er. »Du mußt nicht warten, bis du in Stimmung bist oder bis du für die Inspiration bereit bist. Du mußt darauf warten, daß die Inspiration zu dir kommt.«
Ich verstand vollkommen. Mein Leben sollte die Malerei werden. Nach wie vor war ich entschlossen, so groß – nein größer zu werden als meine Vorfahren. Ich wußte, daß ich gut war. Mein Vater war bei seinen häufigen Reisen zuweilen einen oder zwei Monate abwesend. Er hatte sogar etliche der europäischen Höfe besucht und Miniaturen für Königshäuser gemalt.
»Ich würde dich gern mitnehmen, Kate«, sagte er oft. »Du bist genauso begabt wie ich. Aber ich weiß nicht, was sie von einer Frau als Malerin denken würden. Sie würden die Arbeit von vornherein nicht für gut befinden ... wenn sie von einem Mitglied des weiblichen Geschlechts ausgeführt würde.«
»Aber sie könnten es doch sehen.«
»Die Menschen sehen nicht immer das, was ihre Augen ihnen sagen. Sie sehen, was sie sich einbilden, und ich fürchte, sie bilden sich ein, daß etwas von einer Frau Geschaffenes unmöglich so gut sein kann wie das Werk eines Mannes.«
»So ein Unsinn! Da könnte ich wütend werden«, rief ich. »Das müssen Dummköpfe sein.«
»Viele Menschen sind es auch«, seufzte mein Vater.
Wir malten Miniaturen für Juweliere, die sie überall im Land verkauften. Viele davon waren von mir. Sie waren mit den Initialen K. C. signiert und jedermann sagte: »Das ist ein Collison.« Sie wußten freilich nicht, daß es das Werk von Kate und nicht von Kendal Collison war.
Als Kind hatte ich zuweilen den Eindruck, daß meine Mutter und mein Vater in verschiedenen Welten lebten. Mein Vater war der entrückte Künstler, dessen Arbeit sein Leben war, und meine Mutter war die schöne und zierliche Gastgeberin, die gern Menschen um sich hatte. Zu ihren größten Vergnügungen gehörte es, Hof zu halten, von Bewunderern umgeben, die entzückt waren, von der Tochter eines Grafen eingeladen zu werden, auch wenn sie nur die Gattin eines Künstlers war. Wenn der Tee serviert wurde, half ich ihr oft, ihre Gäste zu bewirten. Abends gab sie zuweilen kleine Essenseinladungen, und anschließend wurde Whist gespielt oder musiziert. Kitty spielte selbst vortrefflich Klavier.
Manchmal wurde sie auch mitteilsam und erzählte dann von ihrem früheren Leben auf Schloß Langston. Ob es ihr etwas ausgemacht hatte, es zu verlassen und in ein im Vergleich dazu sehr kleines Haus zu ziehen? fragte ich sie einmal.
»Nein, Kate«, antwortete sie. »Hier bin ich Königin. Dort war ich nur eine von den Prinzessinnen – ohne eigentliche Bedeutung. Ich war nur da, um standesgemäß zu heiraten ... eine Ehe einzugehen, die meine Familie wünschte, ich aber nicht.«
»Du mußt sehr glücklich sein«, sagte ich. »Du hast den besten Ehemann, den man sich vorstellen kann.«
Sie sah mich mit einem merkwürdigen Blick an und sagte: »Du hast deinen Vater sehr gern, nicht wahr?«
»Ich hab’ euch beide lieb«, erwiderte ich wahrheitsgemäß – und gab ihr einen Kuß, worauf sie sagte: »Zerzause mir nicht mein Haar, Liebes.« Dann ergriff sie meine Hand und drückte sie. »Ich bin froh, daß du ihn so lieb hast. Er hat es mehr verdient als ich.«
Sie war mir ein Rätsel. Aber stets war sie liebevoll und zärtlich zu mir, und es freute sie wirklich, daß ich so viel Zeit mit meinem Vater verbrachte. O ja, es war ein überaus glückliches Heim, bis zu dem Tag, als Evie meiner Mutter ihre Morgenschokolade ins Schlafzimmer brachte und sie tot im Bett liegend vorfand.
Sie hatte eine Erkältung gehabt, die Schlimmeres nach sich gezogen hatte. Mein ganzes Leben hatte ich zu hören bekommen, daß wir auf die Gesundheit meiner Mutter achtgeben müßten. Sie war selten ausgegangen, und wenn, dann war sie in der Kutsche gefahren, und nicht weiter als bis zu den Farringdons. Dort hatte der Lakai der Farringdons ihr herausgeholfen und sie fast ins Haus getragen.
Doch da sie immer zart war und der Tod stets lauerte und weil dies jahrelang so gewesen war, so daß der Tod beinahe ein Mitglied der Familie wurde, hatten wir geglaubt, er würde weiterhin lauern. Statt dessen aber war er einfach gekommen und hatte sie fortgeholt.
Wir vermißten sie sehr, und da erst wurde mir klar, wieviel die Malerei meinem Vater und mir bedeutete, denn obgleich wir in unserem Kummer untröstlich waren, konnten wir ihn im Atelier für eine Weile vergessen, da es dort für uns beide nichts weiter gab als unsere Malerei.
Evie trauerte sehr um meine Mutter, denn sie waren gute Freundinnen geworden. Sie war damals schon dreiunddreißig Jahre alt, und sechzehn von diesen Jahren hatte sie uns gewidmet.
Zwei Jahre zuvor hatte Evie sich verlobt. Wir waren darüber sehr erschrocken und schwankten zwischen unserer Freude über Evies Glück und unserer Bestürzung bei dem Gedanken, was ohne sie aus uns werden würde.
Es drohte jedoch keine Gefahr, denn Evies Verlobter war James Callum, der Kurat unserer Pfarrgemeinde. Er war im gleichen Alter wie Evie, und sie wollten heiraten, sobald er eine Stellung fand, in der er seinen Lebensunterhalt selbständig verdiente.
Meine Mutter pflegte zu sagen: »Ich flehe zu Gott, daß es nie soweit kommt.« Und rasch fügte sie hinzu: »Was bin ich doch für ein selbstsüchtiges Geschöpf, Kate. Hoffentlich wirst du nicht so wie ich. Aber keine Bange. Du nicht. Du bist robust. Aber was sollen wir ... was sollte ich ohne Evie anfangen?«
Sie brauchte sich dem Problem nicht zu stellen. Als sie starb, verdiente der Kurat seinen Unterhalt noch immer nicht; ihre Gebete waren in gewisser Weise erhört worden.
Evie versuchte mich zu trösten. »Du wirst erwachsen, Kate«, sagte sie. »Du wirst jemand anderen finden.«
»Eine wie dich gibt es nicht, Evie. Du bist unersetzlich.« Sie lächelte, hin und her gerissen zwischen ihrer Sorge um uns und ihrem Wunsch, zu heiraten.
Im Grunde meines Herzens wußte ich, daß Evie uns eines Tages verlassen würde. Veränderung lag in der Luft – aber ich wollte keine Veränderung.
Die Monate vergingen, und James Callum fand noch immer keine Stellung. Evie hatte seit dem Tod meiner Mutter weniger zu tun, und sie verbrachte Stunden mit Obst einkochen und dem Trocknen von Kräutern, wie um Vorräte anzulegen für die Zeit, da sie nicht mehr bei uns sein würde.
Währenddessen gingen wir unserem üblichen Tagewerk nach. Mein Vater wollte nicht über Evies Fortgehen nachdenken. Er lebte von einem Tag zum anderen und gemahnte mich an einen Drahtseilakrobaten, der den Gang über das Seil nur schafft, weil er niemals zu der lauernden Gefahr nach unten blickt. Doch es kann der Moment eintreten, wo er zum Halten gezwungen und sich der Gefahr bewußt wird.
An den Tagen, wenn wir das richtige Licht hatten, arbeiteten wir in vollkommener Eintracht im Atelier. Wir waren auf ein bestimmtes Licht angewiesen, denn unsere Arbeit bestand zum großen Teil in der Restaurierung alter Handschriften. Ich hielt mich mittlerweile für eine voll ausgebildete Malerin und hatte meinen Vater sogar in ein oder zwei Häuser begleitet, wo Restaurierungsarbeiten ausgeführt werden mußten. Er erklärte meine Gegenwart jedesmal mit den Worten: »Meine Tochter hilft mir bei der Arbeit.« Das wurde so verstanden, daß ich ihm das Werkzeug bereitlegte, die Pinsel auswusch und für sein leibliches Wohl sorgte. Das grämte mich etwas, denn ich war stolz auf meine Arbeit, und mein Vater ließ mir mehr und mehr freie Hand.
Eines Tages im Atelier sah ich ihn mit einem Vergrößerungsglas in der einen und seinem Pinsel in der anderen Hand.
Ich war überrascht, denn er sagte immer: »Es ist nicht gut, ein Vergrößerungsglas zu benutzen. Wenn du deine Augen schulst, werden sie die Arbeit für dich tun. Ein Portraitmaler hat besondere Augen. Wenn er die nicht hätte, wäre er kein Portraitmaler.«
Als er merkte, daß ich ihn erstaunt betrachtete, legte er das Glas hin und sagte: »Ein sehr kostbares Stück. Ich wollte mich vergewissern, daß ich mich nicht verschätzt habe.«
Doch der Schicksalsschlag kam ein paar Wochen später. Ein Ordenshaus im Norden Englands hatte uns eine Handschrift gesandt. Einige der feinen Zeichnungen waren verblaßt und beschädigt. Waren solche Handschriften sehr kostbar, zum Beispiel wenn sie aus dem elften Jahrhundert stammten, so mußte mein Vater zu den Klöstern reisen und die Arbeit an Ort und Stelle verrichten. Aber es kam auch vor, daß nicht ganz so wertvolle Stücke uns ins Haus gesandt wurden. Ich hatte in jüngster Zeit sehr viel an Handschriften gearbeitet, womit mir mein Vater auf seine Weise zu verstehen gab, daß ich eine befähigte und zuverlässige Malerin sei, denn nur eine sichere Hand durfte diese unschätzbaren Werke berühren.
An jenem Junitag hatte mein Vater die Handschrift vor sich und versuchte, die benötigte rote Schattierung zu treffen. Das war nicht einfach, denn sie mußte mit dem Zinnoberrot jener Tage übereinstimmen, das Minium genannt wurde und von dem das Wort Miniatur hergeleitet ist.
Ich beobachtete ihn. Er hielt den Pinsel zögernd über der kleinen Palette. Dann ließ er ihn hilflos sinken.
Ich trat zu ihm und fragte verwundert: »Stimmt etwas nicht?« Er gab keine Antwort, sondern beugte sich vor und bedeckte sein Gesicht mit den Händen.
Das war ein beängstigender Anblick – draußen die blendende Sonne, deren grelles Licht auf die alte Handschrift fiel, und die plötzliche Ahnung, daß sich etwas Entsetzliches ereignen würde.
Ich beugte mich über ihn und legte ihm meine Hand auf die Schulter. »Was fehlt dir, Vater?« fragte ich.
Er ließ die Hände sinken und blickte mich mit seinen blauen Augen unendlich traurig an.
»Es hat keinen Sinn, Kate«, sagte er. »Einmal muß ich es dir sagen. Ich werde blind.«
Ich starrte ihn an. Es konnte nicht wahr sein. Seine kostbaren Augen ... sie waren das Tor zu seiner Kunst, zu seinem Glück. Wie könnte er leben ohne seine Arbeit, für die er mehr als alles andere seine Augen benötigte! Seine Kunst bedeutete seine ganze Existenz.
»Nein«, flüsterte ich. »Das ... kann nicht wahr sein.«
»Es ist aber wahr«, erwiderte er.
»Aber ... « stammelte ich. »Es geht dir doch gut. Du kannst doch sehen.«
Er schüttelte den Kopf. »Nicht so gut wie früher. Und es wird immer schlimmer. Nicht plötzlich ... Allmählich. Ich weiß es. Ich habe schon einen Spezialisten aufgesucht. Auf meiner letzten Reise. Es war in London. Er hat es mir gesagt.«
»Wann war das?«
»Vor drei Wochen.«
»Und du hast es so lange für dich behalten?«
»Ich wollte es einfach nicht glauben. Anfangs dachte ich ... ich wußte nicht recht, was ich denken sollte. Ich konnte einfach nicht mehr so deutlich sehen ... nicht deutlich genug ... Du hast doch gemerkt, daß ich dir immer die Feinheiten überließ.«
»Ich dachte, das tatest du, um mich zu ermutigen ... um mir Selbstvertrauen zu geben.«
»Liebe Kate, das hast du nicht nötig. Du kannst alles, was du brauchst. Du bist eine Künstlerin. Du bist so gut wie deine Vorfahren.«
»Erzähl mirvon dem Arzt ... Was hat er gesagt? Erzähl mir alles.«
»Ich habe den sogenannten Grauen Star auf beiden Augen. Der Doktor sagt, das seien kleine weiße Flecken auf der Linsenkapsel in der Mitte der Pupillen. Sie sind noch winzig, aber sie werden größer.«
»Man kann doch gewiß etwas dagegen tun?«
»Ja, eine Operation. Aber die ist ein Wagnis, und selbst wenn sie erfolgreich wäre, würden meine Augen nie wieder gut genug für meine Arbeit sein. Du weißt, welche Sehkraft wir benötigen ... als ob wir eine besondere Macht besäßen. Du weißt es, Kate. Du hast sie. Aber dies ... Erblindung ... Oh, siehst du nicht ... alles ist so ... «
Ich war von der Tragik überwältigt. Sein Leben war seine Arbeit. Und die sollte ihm jetzt verwehrt sein? Das Schicksal ging hart mit ihm um.
Ich wußte nicht, wie ich ihn trösten sollte, und doch gelang es mir.
Zumindest sagte er so. Ich tadelte ihn mild, weil er es mir nicht früher erzählt hatte.
»Ich möchte jetzt noch nicht, daß es jemand erfährt, Kate. Es bleibt unser Geheimnis, ja?«
»Ja«, versprach ich, »wenn das dein Wunsch ist. Es ist unser Geheimnis.«
Dann legte ich meinen Arm um ihn und drückte ihn an mich, dabei hörte ich ihn flüstern: »Du bist mein Trost, Kate.«
* * *
Man kann nicht in einem andauernden Schockzustand leben. Anfangs war ich von der Neuigkeit wie erschlagen, und das Unheil schien unabwendbar zu sein; doch nach einigem Nachdenken kam mir mein angeborener Optimismus zu Hilfe, und ich erkannte, daß dies noch nicht das Ende war. Zum einen war die Krankheit ein allmählicher Prozeß. Mein Vater konnte im Moment einfach nicht mehr so gut sehen wie früher. Er war nur nicht fähig, die Feinarbeiten auszuführen. Aber er konnte noch malen. Er müßte bloß seinen Stil ändern. Zwar schien es unmöglich, daß ein Collison keine Miniaturen malen konnte, aber warum sollte er nicht in größerem Format arbeiten? Warum sollte eine Leinwand nicht Elfenbein und Metall ersetzen?
Diese Erwägungen schienen seinen Kummer zu erleichtern. Wir führten lange Gespräche im Atelier. »Du mußt meine Augen sein, Kate«, sagte er. »Du mußt meine Arbeit kontrollieren. Manchmal denke ich, ich sehe gut genug ... aber ich bin nicht sicher. Du weißt, ein einziger falscher Strich kann verhängnisvoll sein.«
Ich erwiderte: »Du hast es mir jetzt gesagt, aber du hättest es nicht so lange für dich behalten sollen. Es ist ja nicht, als ob du plötzlich mit Blindheit geschlagen wärest. Du bist gewarnt und hast genug Zeit, dich darauf vorzubereiten.«
Er hörte mir zu, fast wie ein Kind. Er hing an meinen Lippen, und eine tiefe Zärtlichkeit für ihn stieg in mir auf.
»Vergiß nicht«, ermahnte er mich. »Vorläufig ... zu niemandem ein Wort.«
Ich versprach es. Ich hegte die lächerliche, unsinnige Hoffnung, daß er genesen und daß die Behinderung verschwinden könnte.
»Du bist ein Segen, Kate«, sagte er. »Ich danke Gott, daß ich dich habe. Deine Arbeit ist so gut wie alles, was ich je geschaffen habe ... und sie wird immer besser. Es würde mich nicht wundern, wenn du alle Collisons eines Tages übertreffen würdest. Das würde mich trösten.«
So redeten wir, und wir arbeiteten gemeinsam. Ich verrichtete die Feinheiten bei den Handschriften, damit er seine Augen nicht überanstrengte, und es bestand kein Zweifel, daß das mich zusätzlich anspornte und mein Pinselstrich noch sicherer wurde als zuvor.
Mehrere Tage vergingen. Die Zeit wirkte Wunder, und ich glaubte, daß sein Naturell ihm helfen würde, sich allmählich in sein Schicksal zu fügen. Er würde stets alles mit den Augen eines Künstlers sehen, und er würde immer malen. Die Arbeit, die er am meisten liebte, würde ihm allerdings versagt sein ... aber er würde nicht alles verlieren ... jedenfalls jetzt noch nicht. Das sagte ich ihm.
Ungefähr eine Woche später erfuhr ich die große Neuigkeit. Wir waren von einem Abendessen im Hause des Arztes zurückgekehrt. Evie war bei derartigen Einladungen stets dabei, denn sie galt in der ganzen Nachbarschaft als Mitglied der Familie. Selbst die auf Stand so bedachte Lady Farringdon lud sie ein, denn Evie war immerhin eine Verwandte einer Familie, zu der ein Graf zählte!
Es war ein Abend wie alle anderen. Die Pfarrersfamilie war im Hause des Doktors gewesen; Hochwürden John Meadow mit seinen zwei erwachsenen Kindern Dick und Frances. Dick studierte Theologie, und Frances führte seit dem Tod ihrer Mutter dem Vater den Haushalt. Ich kannte die Familie gut. Bevor ich eine Gouvernante hatte, war ich täglich ins Pfarrhaus gegangen, um von dem Kuraten unterrichtet zu werden – nicht von Evies, sondern seinem Vorgänger, einem ernsthaften alten Herrn, der ein Beispiel dafür war, daß Kuraten zuweilen während ihrer ganzen Laufbahn in diesem niederen Rang verbleiben mußten.
Wir waren von Dr. und Mrs. Camborne sowie ihren Zwillingstöchtern herzlich begrüßt worden. Die Zwillinge sahen sich so ähnlich, daß ich sie kaum unterscheiden konnte. Sie faszinierten mich. Wenn ich mit ihnen zusammen war, fragte ich mich jedesmal, wie einem zumute sein mochte, wenn man stets eine andere Person in der Nähe hatte, die genauso aussah wie man selbst. Man hatte sie, nach meiner Meinung mit einer gewissen Ironie, Faith (Glaube) und Hope (Hoffnung) genannt. Mein Vater sagte immer: »Schade, daß es keine Drillinge sind, sonst wäre die ›Liebe‹ auch noch dabei.«
Hope war die aufgewecktere von beiden. Sie antwortete, wenn man das Wort an die zwei richtete. Faith verließ sich völlig auf sie. Sie blickte jedesmal hilfesuchend zu ihrer Schwester, bevor sie etwas sagte. Sie war ängstlich, während Hope beherzter war. Oft hatte ich den Eindruck, als seien sämtliche menschlichen Tugenden und Schwächen säuberlich zwischen diesen beiden aufgeteilt worden.
Hope war eine gute Schülerin und half Faith immer, die viel langsamer begriff und große Schwierigkeiten beim Lernen hatte. Faith war reinlich und ordentlich und räumte stets hinter Hope auf, wie ihre Mutter mir erzählte. Faith war geschickt mit den Händen. Hope war in dieser Beziehung unbeholfen. »Ich bin so froh, daß sie sich gern haben«, gestand ihre Mutter meinem Vater.
Es bestand ohne Zweifel ein geheimnisvolles Einverständnis zwischen ihnen, wie man es oft bei eineiigen Zwillingen findet. Sie sahen völlig gleich aus und waren doch so verschieden. Ich meinte, es müsse interessant sein, sie zu malen und zu sehen, was dabei herauskäme, denn wenn man mit einer Miniatur beschäftigt war, offenbarten sich häufig wie durch ein Wunder die Charakterzüge des Modells.
Dick Meadows erzählte an diesem Abend eine Menge von sich. Er hatte seine Ausbildung fast beendet und wollte sich bald nach einer Stellung umsehen. Ein gescheiter junger Mann, dachte ich; den würde man bestimmt eher nehmen als Evies James.
Frances Meadows war gutherzig wie immer – anscheinend war sie es zufrieden, ihr Leben kirchlichen Belangen und der sorgfältigen Führung des Pfarrhaushalts zu widmen.
Es war ein Abend wie viele andere davor. Auf dem Heimweg überlegte ich, wie eintönig doch mein Leben sei ... unser aller Leben. Ich konnte mir vorstellen, wie Frances den Pfarrhaushalt führte, bis sie eine Frau im mittleren Alter war. Das war ihr Leben – es lag offen vor ihr ausgebreitet. Und ich? Würde ich mein Dasein in einem kleinen Dorf verbringen – würde mein geselliges Leben sich mehr oder weniger auf Abendeinladungen wie diese beschränken? Gewiß, es war recht angenehm, und ich teilte es mit Menschen, die ich gern hatte – aber würde es so weiter gehen, bis ich in die Jahre kam?
Ich wurde sehr nachdenklich. So im nachhinein frage ich mich manchmal, ob ich damals im Unterbewußtsein etwas von den Ereignissen ahnte, die über mich hereinbrechen und mein Leben von Grund auf verändern sollten.
Jedenfalls wurde ich allmählich rastlos. Wenn mein Vater von seinen Auslandsreisen zurückkehrte, fragte ich ihn begierig aus, was er alles gesehen hatte. Er war am preußischen und am dänischen Hof gewesen – am feudalsten aber war – nach den Erzählungen – der Hof Napoleons III. und seiner mondänen Gemahlin, Kaiserin Eugénie. Mein Vater schilderte mir die Pracht dieser Höfe und die Sitten und Gebräuche der Menschen, die dort lebten. Er beschrieb alles in den prächtigsten Farben und ließ das satte Purpur und das Gold der königlichen Gewänder vor mir erstehen, die sanften Pastelltöne der französischen Häuser und die kraftvolleren der deutschen Höfe.
Schon immer hatte ich mich danach gesehnt, dies alles selbst zu sehen, und es war einer von meinen geheimen Träumen, daß ich als meines Vaters ebenbürtige Malerin anerkannt und selbst einmal persönlich eingeladen würde. Wäre ich als Mann geboren, hätte ich fest damit rechnen können. Doch ich war eingeschlossen – regelrecht eingekerkert in meinem Geschlecht – in eine Welt, welche die Männer sich geschaffen hatten. Die Frauen erfüllten ihren eigenen Zweck in dieser Welt. Sie waren notwendig zur Fortpflanzung der Rasse, und während sie diese wichtigste aller Aufgaben erfüllten, boten sie außerdem noch einen angenehmen Zeitvertreib. Sie konnten Haus und Tafel eines Mannes zieren, sie konnten ihn sogar bei seiner Laufbahn unterstützen, ihm zur Seite stehen – aber stets ein wenig im Hintergrund, allzeit sorgsam darauf bedacht, daß er im Rampenlicht stand.
Mir war es um die Kunst zu tun, und als ich erkannte, daß meine Miniaturen ebensoviel wert waren wie die meines Vaters – allerdings nur, weil man sie für seine hielt –, war ich regelrecht empört über die Ungerechtigkeit und Dummheit der Welt, und ich konnte verstehen, warum manche Frauen sich nicht der männlichen Überlegenheit unterwerfen wollten.
Als wir an diesem Abend nach Hause kamen, trafen wir dort James Callum an.
»Sie müssen mir vergeben, daß ich zu dieser Stunde vorspreche, Mr. Collison«, sagte er. »Aber ich muß unbedingt zu Evie.«
Er war so aufgeregt, daß er kaum sprechen konnte. Evie trat zu ihm und legte beruhigend ihre Hand auf seinen Arm.
»Was gibt’s, James. Doch nicht etwa ... eine Stellung!«
»Nein, das nicht gerade. Es ist ein ... ein Angebot. Es hängt davon ab, was Evie sagt ... «
»Es wäre vielleicht eine gute Idee, mir erst einmal davon zu erzählen«, schlug Evie in ihrer praktischen Art vor.
»Es ist so, Evie: Man hat mich gebeten, nach Afrika zu gehen ... als Missionar.«
»James!«
»Ja, und sie halten es für das beste, wenn ich heirate und meine Frau mitnehme.«
Ich sah die Freude in Evies Gesicht, blickte dabei aber meinen Vater nicht an. Ich wußte, daß er mit seinen Gefühlen kämpfte.
Ich hörte ihn sagen: »Evie, wie wundervoll. Du wirst fabelhaft sein ... «
»Evie«, stammelte James, »du sagst ja gar nichts.«
Evie lächelte nur. »Wann brechen wir auf?« fragte sie.
»Ich fürchte, uns bleibt nicht viel Zeit. Wenn möglich, in einem Monat, haben sie vorgeschlagen.«
»Ihr müßt sofort das Aufgebot bestellen«, warf mein Vater ein. »Ich glaube, das dauert drei Wochen.«
Ich trat zu Evie und umarmte sie. »Es wird für uns schrecklich sein ohne dich, aber du wirst bestimmt glücklich werden. Es ist genau das Richtige für dich. O Evie, du hast das Allerbeste verdient.«
Wir klammerten uns aneinander. Dies war einer der seltenen Momente, da Evie sich erlaubte, ihre echten Gefühle zu zeigen.
* * *
Sie wäre nicht Evie gewesen, wenn sie nicht auch für unsere Zukunft gesorgt hätte. Inmitten ihres Glücks und der Hetze, innerhalb einer so kurzen Frist reisefertig zu werden, ließ sie uns nicht im Stich.
So aufgeregt wie in dieser Zeit hatte ich sie noch nie gesehen. Sie las eine Menge über Afrika und war entschlossen, das Beste aus diesem Posten für sich und James zu machen.
»Weißt du, er tritt die Stelle von einem anderen an. Sein Vorgänger hat’s im Urlaub auf der Brust gekriegt. Auf diese Weise bekam James seine Chance.«
»Er verdient sie – und du auch.«
»Alles ist bestens geregelt. Dick Meadows kann seinem Vater vorläufig zur Hand gehen. Ist das nicht großartig? Das einzige, was mir Sorgen macht, seid ihr ... aber ich habe nachgedacht, und dabei ist mir Clare eingefallen.«
»Wer ist Clare?«
»Clare Massie. Soll ich ihr schreiben? Weißt du, ich glaube, das ist die Lösung. Ich habe sie seit ein paar Jahren nicht gesehen, aber wir sind immer in Verbindung geblieben. Wir schreiben uns jedes Jahr zu Weihnachten.«
»Erzähl mir von ihr.«
»Also, ich dachte, sie könnte statt meiner kommen. Letztes Jahr Weihnachten schrieb sie mir, daß ihre Mutter gestorben sei. Sie hatte sie jahrelang gepflegt. Du kennst das ja ... die jüngste Tochter ... es wird von ihr erwartet. Die anderen leben ihr eigenes Leben, und ihr bleibt nichts übrig, als für die alternden Eltern zu sorgen. Ihre Schwester hat geheiratet und ist weggezogen. Clare hört kaum etwas von ihr. Aber letztes Jahr Weihnachten meinte sie, sie müßte sich möglicherweise nach einer Stellung umsehen.«
»Wenn sie eine Freundin von dir ist ... «
»Sie ist eine entfernte Verwandte ... eine Cousine um so viele Ecken, daß wir’s nicht mehr zählen können. Sie muß ungefähr vierzehn gewesen sein, als ich sie das letzte Mal sah. Das war bei der Beerdigung einer Großtante. Sie war ein so gutmütiges Mädchen und hat sich schon damals rührend um ihre Mutter gekümmert. Soll ich ihr schreiben?«
»O ja, bitte.«
»Wenn sie herkommen kann, ehe ich gehe, könnte ich sie noch ein bißchen einweisen.«
»Evie, du bist fabelhaft. Mitten in all der Aufregung kannst du noch an andere denken. Bitte schreib ihr. Wenn sie mit dir verwandt ist, werden wir sie gewiß gern haben.«
»Ich schreibe ihr sofort. Es kann natürlich sein, daß sie inzwischen etwas gefunden hat.«
»Hoffen wir das Beste«, sagte ich.
* * *
Schon zwei Wochen nach dieser Unterhaltung traf Clare Massie bei uns ein. Sie hatte das Angebot gern angenommen, und Evie freute sich darüber.
»Es ist genau das Richtige für euch und auch für Clare«, sagte sie. Sie war rundum glücklich. Sie heiratete nicht nur ihren lieben James, sondern sie hatte gleichzeitig für uns und für ihre Verwandte Clare gesorgt.
Ich fuhr mit Evie im Einspänner zum Bahnhof, um Clare abzuholen. Wie sie so zwischen ihrem Gepäck auf dem Bahnsteig stand, wirkte sie ziemlich verlassen, und ich hatte Mitleid mit ihr. Wie würde mir zumute sein, wenn mir ein neues Leben bei fremden Leuten bevorstünde und nur eine entfernte Cousine da wäre, um mir über die ersten Tage hinwegzuhelfen? Und auch dieser Halt würde bald verschwinden.
Evie stürzte auf Clare zu. Sie umarmten sich.
»Kate, das ist Clare Massie. Clare, Kate Collison.«
Wir schüttelten uns die Hände, und ich blickte in ein Paar große braune Augen in einem ziemlich blassen, herzförmigen Gesicht. Das hellbraune Haar war zu beiden Seiten des Kopfes nach hinten gekämmt und in einem ordentlichen Knoten zusammengehalten. An ihrem braunen Strohhut steckte ein gelbes Maßliebchen, und ihr Mantel war ebenfalls braun. Sie wirkte nervös ... ängstlich bedacht, keinen schlechten Eindruck zu machen. Sie war ungefähr achtundzwanzig bis dreißig Jahre alt.
Um ihre Nervosität zu mindern, beteuerte ich, wie froh wir wären, daß sie gekommen sei. Evie habe uns viel von ihr erzählt.
»Ach ja«, sagte sie. »Evie war sehr lieb.«
»Wir könnten das Gepäck nachkommen lassen«, meinte Evie, praktisch wie immer. »Dann haben wir alle bequem in der Kutsche Platz. Nimm nur eine kleine Tasche mit. Hast du eine? Bloß die Sachen, die du sofort brauchst.«
»Ich hoffe, daß Sie hier glücklich werden«, sagte ich.
»Das wird sie bestimmt«, bestätigte Evie.
»Ich hoffe nur, ich kann ... «
Evie beschwichtigte sie. »Alles wird gut«, sagte sie fest.
Wir sprachen über Evies Hochzeit und die bevorstehende Abreise.
»Ich bin froh, daß Sie schon hier sind«, versicherte ich.
So kam Clare in unser Haus; und kurz darauf heiratete Evie. Mein Vater führte sie zum Altar, der Pfarrer vollzog die Trauung, und anschließend gaben wir bei uns einen Empfang für ein paar Freunde und Nachbarn. Noch am gleichen Tag begaben sich Braut und Bräutigam auf ihre Reise nach Afrika.
* * *
Clare lebte sich rasch ein. Sie widmete sich uns mit Hingabe und war entschlossen, uns stets zufriedenzustellen, so daß sie, wenn sie auch Evie nicht ersetzte – und wir waren überzeugt, daß das niemand konnte –, doch eine gute Hilfe war.
Sie war äußerst liebenswürdig, und es war leicht mit ihr auszukommen. Vielleicht war das Haus nicht ganz so gut bestellt wie bei Evie. Vielleicht erschienen die Dienstboten nicht ganz so prompt, wenn wir sie riefen, und auch die Disziplin hatte merklich nachgelassen; aber wir hatten Clare bald sehr gern und waren froh, daß sie gekommen war.
Mein Vater und ich stimmten überein, daß wir uns zu der neuen Behaglichkeit, die an die Stelle vollendeter Tüchtigkeit getreten war, beglückwünschen konnten.
Clare schloß rasch Freundschaften und schien sich besonders gut mit den Camborne-Zwillingen zu verstehen. Das amüsierte meinen Vater sehr. Er sagte, Faith blicke nun schon fast ebenso zu Clare auf wie zu Hope.
»Jetzt hat sie zwei Felsen, an die sie sich klammern kann«, bemerkte er.
Clare zeigte große Achtung vor unserer Arbeit. Sie bat meinen Vater, ihr seine Miniaturensammlung zu zeigen, was ihn sichtlich freute. Es war eine beachtliche Sammlung. Es waren hauptsächlich Collisons, aber er hatte auch einen Hilliard und zwei Isaac Olivers, die ich sogar für noch besser hielt als den Hilliard – wenn sie auch möglicherweise nicht den gleichen Marktwert besaßen. Einer seiner größten Schätze war eine Miniatur des französischen Künstlers Jean Pucelle, der im 14. Jahrhundert ein führendes Mitglied einer Gruppe von Miniaturmalern am Burgunderhof in Paris war. Mein Vater pflegte zu sagen, diese Sammlung sei unser Vermögen. Allerdings dachte er nie daran, auch nur ein einziges Stück davon zu verkaufen. Sie waren seit Generationen in Familienbesitz, und dort sollten sie auch bleiben.
Clares braune Augen leuchteten vor Entzücken, als sie diese kleinen Meisterwerke betrachtete und mein Vater ihr den Unterschied zwischen Tempera und Gouache erklärte. Evie hatte nichts von Malerei verstanden, und ich glaube, insgeheim hegte sie eine leichte Verachtung dafür. Hätte mein Vater nicht damit seinen Lebensunterhalt verdient, so hätte sie diese Arbeit gewiß als eine recht oberflächliche Beschäftigung abgetan.
Clare aber hatte wirklich ein Gefühl für Malerei und gestand, daß sie sich einmal an einem kleinen Ölgemälde versucht hatte.
Sie war eindeutig ein Gewinn für unser Hauswesen. Die Dienstboten hatten sie gern; sie war nicht so energisch wie Evie und war weder belehrend noch herrisch. Clare hatte etwas weiblich Hilfloses an sich, das ihrer Umgebung das Gefühl gab, sanft mit ihr umgehen zu müssen. Die Dienstboten spürten das, und während sie sich gegen eine andere Haushälterin womöglich gewehrt hätten, halfen sie Clare, in Evies Fußstapfen zu treten.
Und sie arbeitete sich allmählich ein. Sie war zwar anders, sanfter; und mangelte es ihr auch an der Tüchtigkeit, die wir bei Evie gewohnt waren, so waren wir doch gern bereit, uns mit weniger zu begnügen, da Clare sich so bemühte, uns zufriedenzustellen.
Nach einer Weile faßte sie auch Vertrauen zu mir und erzählte von ihrer Mutter.
»Ich habe sie innig geliebt«, sagte sie. »Sie war mein Leben. Nicht umsonst habe ich sie bis zu ihrem Tode gepflegt. Ach Kate, ich hoffe, Sie müssen nie einen geliebten Menschen leiden sehen. Es ist zu schmerzlich. Es zog sich Jahre hin ...«
Ich wußte, daß ihre ältere Schwester geheiratet hatte und fortgezogen war und daß ihr Vater starb, als Clare noch ein Kind war. Ihre Mutter hatte offenbar ihr Leben bestimmt, und es mußte ein schweres Leben gewesen sein. Clare hatte selbst ein wenig gemalt, deshalb freute es sie besonders, in einem Hauswesen wie dem unseren zu sein.
»Meine Mutter hielt meine Malerei für reine Zeitverschwendung«, sagte sie.
Ich vermutete, daß sie es mit ihrer Mutter nicht leicht gehabt hatte, wenngleich Clare das niemals erwähnte und stets mit größter Zuneigung von ihr sprach.
Sie wirkte wie jemand, der endlich in die Freiheit entlassen worden war.
* * *
Und dann kam der Auftrag.
Er versetzte meinen Vater in eine Euphorie, in der Panik, Jubel, Spannung, Erregung und Unsicherheit mitschwangen.
Es war für ihn der Augenblick der Entscheidung. Es handelte sich um einen der bedeutendsten Aufträge seines Lebens. Konnte er ihn in seinem gegenwärtigen gesundheitlichen Zustand annehmen?
Sobald wir allein im Atelier waren, klärte er mich auf. Er hielt ein Schreiben auf Büttenpapier in der Hand.
»Es ist vom Haushofmeister des Barons de Centeville. Das liegt in der Normandie, nicht weit von Paris. Es handelt sich um einen Auftrag des Barons, wenn er auch von seinem Haushofmeister kommt. Der Baron hat offenbar vor zu heiraten und wünscht eine Miniatur von sich für seine Verlobte, die Princesse de Créspigny. Und wenn das Bildnis fertig ist und gefällt, soll ich die Dame aufsuchen und sie portraitieren, auf daß, dem Brauch gemäß, die Miniaturen zwischen dem glücklichen Paar ausgetauscht werden können. Kate, das ist die Chance meines Lebens. Wenn der Baron zufrieden ist ... wenn man meine Miniaturen in diesen Kreisen zu sehen bekommt ... dann könnte ich über kurz oder lang die Kaiserin Eugénie persönlich malen.« Seine Augen leuchteten. In diesem Moment hatte er sein Leiden vergessen. Ich beobachtete mit schmerzlichem Mitleid und Kummer im Herzen, wie er sich dessen plötzlich bewußt wurde und die Freude aus seinen Zügen wich. Noch nie hatte ich ihn so verzweifelt gesehen.
Doch plötzlich änderte sich sein Ausdruck. »Wir könnten es trotzdem machen, Kate«, strahlte er. »Du wirst die Miniatur malen.«
Ich glaubte, an meinen Herzschlägen zu ersticken. Das war es, was ich ersehnt hatte: Ein Auftrag von einer großen Persönlichkeit ... zu reisen, fort aus unserer kleinen Welt ... quer durch einen Kontinent, fremde Höfe besuchen, unter Leuten leben, die Geschichte gemacht hatten.
Von allen Höfen Europas war der französische der glanzvollste. Der Hof unserer Königin war düster dagegen. Sie betrauerte noch immer den Tod ihres Gemahls, der vor einigen Jahren an Typhus gestorben war. Seither hatte die Königin sich zurückgezogen und sich kaum sehen lassen. Der Prince of Wales schien zwar ein recht munteres Leben zu führen, aber das war nicht dasselbe. Charles Louis Napoleon Bonaparte, Sohn von Louis Bonaparte, dem Bruder des großen Napoleon, dem es beinahe gelungen wäre, die Welt zu erobern, hatte die schöne Eugénie Marie de Guzman geheiratet, und die beiden hatten ihren Hof zum Mittelpunkt Europas gemacht.
Wie sehnte ich mich danach, ihn zu sehen! Aber die Einladung war freilich nicht an mich ergangen. Sie galt meinem Vater. Und als er sagte: »Wir könnten es machen ... «, hatte er mir einen Schimmer von dem vermittelt, was in seinem Kopf Gestalt annahm.
Ich sagte ruhig: »Du wirst absagen müssen.«
»Ja«, erwiderte er, aber ich spürte, daß die Angelegenheit damit noch nicht abgetan war.
Ich fuhr fort: »Du wirst es jetzt bekanntgeben müssen. Dies wäre der richtige Anlaß.«
»Aber du könntest mich doch vertreten, Kate.«
»Niemals würden sie eine Frau akzeptieren.«
»Nein«, stimmte er zu, »natürlich nicht.«
Er blickte mich eindringlich an. Dann sagte er langsam: »Ich werde den Auftrag annehmen ... «
»Deine Augen könnten versagen. Das wäre höchst verhängnisvoll.«
»Ich würde mit deinen Augen sehen, Kate.«
»Du meinst, ich soll mit dir gehen?«
Er nickte langsam.
»Man wird mir gestatten, dich mitzunehmen. Ich brauche eine Reisebegleitung, denn ich bin nicht mehr jung. Du würdest mir helfen. Sie würden annehmen ... vielleicht, um die Farben zu mischen ... meine Pinsel zu reinigen, meine Paletten ... Und du müßtest auf mich aufpassen, Kate.«
»Ja«, sagte ich. »Das könnte ich tun.«
»Ich wollte, ich könnte zu ihnen sagen: ›Meine Tochter ist eine große Malerin. Sie wird die Miniaturen für Sie anfertigen.‹ Aber das ließen sie niemals gelten.«
»Die Welt ist ungerecht gegen Frauen«, rief ich zornig aus.
»Die Welt ist zuweilen ungerecht gegen alle. Nein, Kate, wir können nur zusammen gehen. Ich, weil ich dich als meine Augen brauche. Du, weil du eine Frau bist. Wenn die Miniaturen fertig, wenn sie gelungen sind, dann werde ich zu dem Baron sagen: ›Dies ist das Werk meiner Tochter. Sie haben es bewundert ... es angenommen ... Nun akzeptieren Sie sie als die Malerin, die sie ist.‹ Kate, das könnte unsere Chance sein. Vielleicht ist es ein Wink des Schicksals.«
Ich strahlte, und doch konnte ich ihn dabei nicht ansehen.
»Ja«, sagte ich. »Wir werden gehen.«
Ich lebte wie in einem Rausch; heftige Erregung und wilder Jubel hatten mich ergriffen. Noch nie war ich so beschwingt gewesen. Ich wußte, daß ich Miniaturen malen konnte, die dem Vergleich mit den größten Künstlern standhielten. Mir kribbelten die Finger, und ich wünschte sehnlichst, beginnen zu können.
Dann schämte ich mich wieder meines Glücks, weil es mir nur durch meines Vaters Unglück beschieden war.
Doch er verstand mich, ich hörte ihn leise und liebevoll lachen.
»Verleugne deine Kunst nicht, Kate«, sagte er. »Du bist in erster Linie Künstlerin. Wärst du das nicht, dann wärst du keine große Künstlerin. Dies kann deine Chance sein. Du brichst eine Lanze für Kunst und Weiblichkeit zur gleichen Zeit. Hör mir zu. Ich werde diesen Auftrag annehmen. Wir reisen zusammen zu diesem Château in der Normandie. Du wirst malen wie noch nie. Ich sehe alles ganz deutlich vor mir.«
»Bei den Sitzungen ... wird das Modell es erfahren.«
»Das ist kein Problem. Du wirst bei den Sitzungen zugegen sein, wirst zusehen und dann deine Miniatur anfertigen, wenn das Modell abwesend ist. Du lernst den Baron kennen und hast meine Zeichnung, nach der du arbeiten kannst. Ich kann ja lediglich die ganz feinen Pinselstriche nicht ausführen. Zusammen werden wir es schaffen, Kate. Oh, es wird ein aufregendes Abenteuer werden.«
»Zeig mir den Brief.«
Ich hielt ihn in Händen. Er war wie ein Talisman, ein Schlüssel zum Ruhm. Später habe ich mich oft gefragt, warum uns das Schicksal keinen Hinweis gibt ... um uns zu warnen ... uns zu führen ... Aber nein, die bedeutendsten Augenblicke in unserem Leben vergehen ohne besonderes Gewicht.
»Wirst du antworten?« fragte ich.
»Ich schreibe noch heute«, erwiderte mein Vater.
»Solltest du nicht lieber ein Weilchen warten ... nachdenken ...«
»Ich habe nachgedacht. Du nicht?«
»Doch, ich auch.«
»Es wird gelingen, Kate. Wir werden es schaffen.«
* * *
Ich hatte meinen Vater lange Zeit nicht so glücklich gesehen. Wir waren wie zwei Kinder, als wir uns auf das große Ereignis unseres Lebens vorbereiteten. Wir weigerten uns, die Schwierigkeiten zu sehen. Wir lebten lieber in unserem euphorischen Traum, überzeugt, daß alles so gelingen würde, wie wir es geplant hatten.
»Wenn du eines Tages als Malerin anerkannt würdest«, sagte mein Vater, »könnte mich das mit meinem Schicksal versöhnen.«
Wir sprachen mit Clare. Fühlte sie sich imstande, nach so kurzer Zeit die Verantwortung für das Hauswesen zu übernehmen?
Sie beteuerte, daß sie alles in ihrer Macht Stehende tun werde, um unser Vertrauen in sie zu rechtfertigen.
»Ich habe inzwischen viele Freunde hier«, sagte sie. »Sie sind alle so nett: im Gutshaus und im Pfarrhaus, und ich habe die Camborne-Zwillinge. Falls es während Ihrer Abwesenheit irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte – womit ich jedoch nicht rechne –, werden sie mir sicher helfen.«
»Wir wissen nicht genau, wie lange wir zur Ausführung dieses Auftrags brauchen werden. Das kommt auf das Modell an. Und wenn wir in der Normandie fertig sind, müssen wir vielleicht noch nach Paris.«
»Sie dürfen gewiß sein, daß hier alles in besten Händen ist«, versicherte uns Clare.
So machten mein Vater und ich, nicht ganz zwei Wochen nach Erhalt der Einladung, uns auf den Weg zum Château de Centeville in der Normandie.
Das Schloß
Die Reise hätte recht anstrengend sein können, wäre nicht alles, was ich zu sehen bekam, für mich so faszinierend gewesen. Ich hatte mein Land noch nie verlassen und wollte auf keinen Fall etwas versäumen. Die Überfahrt verlief glatt, und nach einer endlos scheinenden Eisenbahnfahrt kamen wir nach Rouen. Dort stiegen wir nach Centeville um.
Wir kamen am Nachmittag an. Wir waren seit dem frühen Morgen des Vortages unterwegs, und war die Reise auch interessant gewesen, so war ich doch froh, als wir endlich da waren.
Als wir aus dem Zug stiegen, näherte sich uns ein Mann in Livree. Ungläubig betrachtete er uns – er war wohl überrascht, statt eines Mannes auch noch eine Frau zu empfangen. Mein Vater ergriff als erster das Wort. Sein Französisch war recht gut, und meins nicht minder, so daß wir kaum Schwierigkeiten mit der Sprache hatten.
»Ich bin Kendal Collison«, stellte sich mein Vater vor. »Warten Sie auf uns? Man hat uns unterrichtet, daß wir am Bahnhof abgeholt würden.«
Der Mann verbeugte sich. Ja, sagte er, er sei im Auftrag von Monsieur de Marnier, Haushofmeister des Château de Centeville, gekommen, um Monsieur Collison abzuholen.
»Der bin ich«, sagte mein Vater. »Und dies ist meine Tochter, ohne die ich nicht mehr verreise.«
Mir wurde dieselbe höfliche Verbeugung zuteil, die ich mit einem Neigen meines Kopfes erwiderte. Der Mann geleitete uns zu einer prächtigen dunkelblauen Kutsche, die mit einem Wappen, vermutlich dem unseres erlauchten Auftraggebers, verziert war.
Man war uns beim Einsteigen behilflich und erklärte uns, daß unsere Koffer zum Château gebracht würden. Ich war darüber recht erleichtert, denn sie machten einem solchen Gefährt absolut keine Ehre. Ich blickte meinen Vater an und lächelte nervös. Die Förmlichkeit, mit der man uns empfing, gebot uns durchzustehen, worauf wir uns eingelassen hatten.
Die Pferde wurden angetrieben, und wir rollten durch eine bezaubernde bewaldete und hügelige Landschaft. Plötzlich sah ich das Schloß über der Stadt – eine finstere normannische Zwingburg aus grauem Stein mit gewaltigen zylindrischen Säulen, hohen schmalen Fensterschlitzen, Rundbögen und pechnasenbewehrten Türmen.
Es wirkte bedrohlich – wahrhaftig eher wie eine Festung als ein Wohnsitz, und mich durchlief ein ahnungsvolles Frösteln. Wir fuhren den sanft ansteigenden Hügel hinauf, und je näher wir dem Schloß kamen, um so bedrohlicher wirkte es. Wir hätten alles erklären sollen, sagte ich mir. Wir sind unter falschen Vorspiegelungen hierhergekommen. Was werden sie tun, wenn sie es entdecken? Nun ja, sie können uns lediglich fortschicken.
Ich sah meinen Vater an. Ich konnte seiner Miene nicht entnehmen, ob er die drohende Macht dieser Stätte ebenso spürte wie ich.
Wir fuhren über einen Graben und unter einem Fallgitter hindurch und gelangten in einen Innenhof. Die Karosse hielt an, und unser prachtvoll livrierter Kutscher sprang vom Bock und hielt uns die Tür auf.
Ich kam mir plötzlich ganz klein vor, als ich zwischen den gewaltigen steinernen Mauern stand. Ich blickte hinauf zu dem Bergfried mit dem Wachtturm, von dem man gewiß eine meilenweite Sicht rund um das Schloß hatte.
»Hier entlang«, bat der Kutscher.
Wir standen vor einem beschlagenen Tor. Der Kutscher klopfte fest dagegen, und augenblicklich wurde es von einem Mann in ähnlicher Livree geöffnet.
»Monsieur und Mademoiselle Collison«, sagte der Kutscher, als verkündete er unsere Ankunft bei einem zeremoniellen Empfang. Dann verbeugte er sich vor uns und entfernte sich, uns der Obhut unseres nächsten Führers überlassend.
Der Diener verbeugte sich auf dieselbe förmliche Art und bedeutete uns, ihm zu folgen.
Wir wurden in eine große Halle geführt. Die gewölbte Decke wurde von dicken runden Steinsäulen gestützt. Durch die schmalen Fenster fiel nicht viel Licht herein; in die Mauern waren steinerne Bänke eingelassen, und in der Mitte stand ein kostbar geschnitzter Tisch – ein Zugeständnis an eine spätere Periode; denn ich nahm an, daß die Halle selbst rein normannisch war. Auch das Glas in den Fenstern war ein Zugeständnis an die neuere Zeit.
»Entschuldigen Sie mich einen Augenblick«, sagte der Diener. »Ich werde Monsieur de Marnier Ihre Ankunft melden.«
Als wir allein waren, sahen mein Vater und ich uns in hilfloser Ehrfurcht an.
»So weit, so gut«, flüsterte er.
Ich stimmte ihm zu, unter dem Vorbehalt, daß wir noch nicht sehr weit gediehen waren.
Kurz darauf machten wir die Bekanntschaft von Monsieur de Marnier, der uns sogleich wissen ließ, daß er den sehr verantwortungsvollen Posten des Majordomus bekleidete. Er war der Haushofmeister des Château de Centeville und eine sehr eindrucksvolle Erscheinung in seinem blauen Rock mit goldenen Tressen und großen Knöpfen, auf die irgend etwas geprägt war. Soweit ich erkennen konnte, handelte es sich um eine Art Schiff. Monsieur de Marnier war gleichzeitig liebenswürdig und verstört. Man hatte ihn falsch unterrichtet. Ihm war lediglich ein Herr angekündigt worden.
»Dies ist meine Tochter«, erklärte mein Vater. »Ich dachte, man sei verständigt. Ohne sie reise ich nicht. Ich benötige sie für meine Arbeit.«
»Selbstverständlich, Monsieur Collison. Selbstverständlich. Ein Versehen. Ich werde sogleich ... Man muß ein Zimmer herrichten. Ich werde dafür sorgen. Es ist eine Kleinigkeit ... nicht von Belang. Wenn Sie solange mit zu dem Zimmer kommen wollen, das für Monsieur vorbereitet ist, werde ich eines für Mademoiselle herrichten lassen. Wir speisen um acht Uhr. Möchten Sie inzwischen eine Erfrischung in Ihrem Zimmer zu sich nehmen?«
Ich erwiderte, ein wenig Kaffee sei vorzüglich.
Er verbeugte sich. »Kaffee und ein kleines goûter. Sehr wohl. Bitte folgen Sie mir. Monsieur de Mortemer wird Sie beim Diner begrüßen. Er wird Ihnen alles Nähere erklären.«
Er ging vor uns eine breite Treppe hoch und eine Galerie entlang. Dann gelangten wir zu einer steinernen Wendeltreppe – eindeutig normannisch, ein weiterer Hinweis auf das Alter des Schlosses. Ich war ein wenig besorgt um meinen Vater; seine Augen könnten ihn bei dem plötzlichen Lichtwechsel auf dieser recht gefährlichen Treppe täuschen. Ich bestand darauf, daß er voranging, und ich folgte dicht hinter ihm für den Fall, daß er stolperte.
Schließlich kamen wir in eine andere Halle. Wir waren sehr hoch gestiegen. Hier oben würden wir gutes, helles Licht haben. Von der Halle aus bogen wir in einen Flur. Der Diener öffnete die Tür zu dem Zimmer, das man meinem Vater zugedacht hatte. Es war ein großer Raum und enthielt ein Bett sowie etliche schwere Möbelstücke aus einer frühen Periode. Die in die Mauer eingelassenen Fenster waren hoch und schmal und schlossen das Licht aus. Die Wände waren mit alten Waffen und Gobelins geschmückt.
Rund um mich spürte ich die Vergangenheit, doch auch hier gab es etliche Zugeständnisse an modernen Komfort. Hinter dem Bett hatte man einen Alkoven eingerichtet, in dem man sich waschen und anziehen konnte – eine Art Ankleidekammer, die in einer normannischen Festung gewiß nicht vorhanden war.
»Man wird Ihnen Bescheid geben, wenn Ihr Zimmer fertig ist, Mademoiselle.«
Dann waren wir allein.
Die Jahre schienen von meinem Vater abgefallen zu sein. Er war wie ein übermütiger Knabe.
»Altertum überall!« rief er aus. »Ich könnte mich um achthundert Jahre zurückversetzen und mir vorstellen, daß Herzog Wilhelm plötzlich erschiene und erklärte, daß er England zu erobern gedenkt.«
»Mir geht es genauso. Es ist ausgesprochen feudal hier. Wer mag dieser Monsieur de Mortemer sein?«
»Der Name wurde mit solcher Hochachtung ausgesprochen; möglicherweise handelt es sich um den Sohn des Hauses.«
»Der Baron, der demnächst heiraten wird, hat gewiß keinen Sohn ... jedenfalls keinen, der alt genug wäre, uns zu empfangen.«
»Es könnte seine zweite Ehe sein. Aber das will ich nicht hoffen. Ich wünschte ihn mir jung, ohne Falten ... jung und schön.«
»Ältere Gesichter sind meistens interessanter«, gab ich zu bedenken.
»Wenn die Leute das einsehen würden, dann schon. Aber jeder wünscht sich jugendliches Aussehen, unbeschattete Augen, zarten Teint. Für eine interessante Miniatur würde ich die weniger jungen vorziehen. Aber von diesem Auftrag hängt so vieles ab. Wenn wir unser Modell hübsch darstellen ... dann bekommen wir viele weitere Aufträge. Und die brauchen wir, mein Kind.«