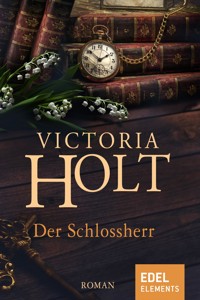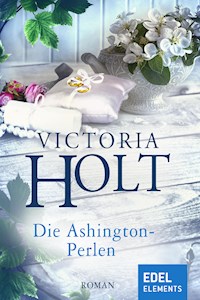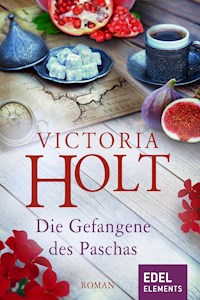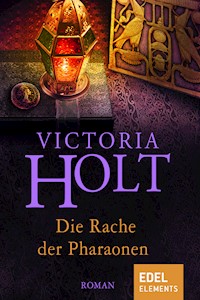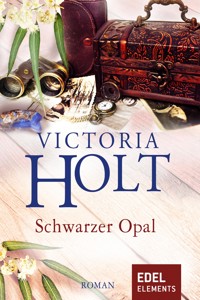
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die englischen Grafschaft Kent gegen Ende des 19. Jahrhunderts. In einem Dorf wird unter einem Azaleenbusch das Findelkind Carmel entdeckt, das bei einer Pflegemutter aufwächst. Nach deren Tod holt ein Verwandter die junge Carmel zu sich nach Australien. Hier erfährt sie die wahre Identität des Onkels – und sie lernt die gefährliche Faszination kennen, die Gold und Opale auf die Einwanderer ausüben. Nach Jahren zieht es Carmel wieder heim nach England. Sie möchte den Geheimnissen ihrer Kindheit auf die Spur kommen ... Ein romantischer Spannungsroman von Victoria Holt, der Meistererzählerin des Unheimlichen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Victoria Holt
Schwarzer Opal
Roman
Ins Deutsche übertragen von Margarete Längsfeld
Edel eBooks
Inhalt
Entdeckung im Garten
Die Gouvernante
Eine Reise übers Meer
Der Landstreicher
Tückische See
Echo der Vergangenheit
Die Warnung
Castle Folly
Begegnung im Park
Geständnis
Zu guter Letzt
Impressum
Entdeckung im Garten
Als Tom Yardley an einem frühen Märzmorgen durch den Garten streifte, um nachzusehen, wie die neugepflanzten Rosen gediehen, machte er eine erstaunliche Entdeckung. Tom, der Gärtner von Dr. Marline im Haus Commonwood, brauchte, wie er selbst sagte, nicht viel Schlaf. Oft stand er auf, sobald es tagte, und ging hinaus in den Garten, der seinen Lebensinhalt darstellte.
Er traute seinen Augen nicht, aber da lag es. Er hatte zuerst ein Weinen gehört, und als er unter dem Azaleenstrauch nachschaute – jenem, der ihm letztes Jahr einigen Kummer bereitet hatte –, was fand er da – ein in einen Wollschal gewickeltes Baby.
Das Baby war ich.
Der Doktor lebte im Haus Commonwood, seit er die Praxis von seinem Vorgänger, dem alten Dr. Freeman, übernommen hatte. Er habe das Haus mit dem Geld seiner Frau erworben, hieß es, denn in einer kleinen Landgemeinde waren die Leute stets über solche Einzelheiten im Bilde. Der Doktor und Mrs. Marline ließen es sich in dem Haus gutgehen – selbstverständlich mit dem Geld der Gattin –, und Mrs. Marline war sowohl Herr als auch Herrin des Hauses.
Als ich dort auftauchte, lebten drei Kinder in der Familie. Adeline war zehn Jahre alt und von schlichtem Wesen. Die Dienstboten tuschelten über sie, und ich erfuhr, daß ihre Geburt »schwierig« gewesen sei. Adeline, hieß es, sei nicht ganz »richtig im Kopf«. Mrs. Marline, die nicht glauben konnte, daß irgend etwas, das sie hervorgebracht hatte, nicht vollkommen war, schien äußerst bestürzt gewesen zu sein, und erst nach langer Zeit wurde Henry geboren. Er war, als ich gefunden wurde, vier Jahre alt, und an ihm war so wenig ein Makel wie an der zwei Jahre jüngeren Estella. Nanny Gilroy hatte die Aufsicht über die Kinderstube, und Sally Green, damals dreizehn Jahre alt, war gerade ins Haus gekommen, um von Nanny unterwiesen zu werden. Das war ein Glück für mich, denn als ich in ein verständiges Alter kam, erzählte sie mir von meinem Auftauchen und dessen Auswirkungen im Hause.
»Es wär’ gut möglich gewesen, daß dich überhaupt niemand gefunden hätte«, sagte sie. »Du hättest unter dem Strauch liegen bleiben können, bis du gestorben wärst du armes Würmchen. Aber ich schätze, irgendwann hättest du dich schon bemerkbar gemacht. Ein richtiger kleiner Schreihals warst du. Tom Yardley kam die Treppe zum Kinderzimmer hoch und hielt dich, als hätte er Angst, du könntest ihn beißen. Nanny war noch nicht auf. Sie kam in ihrem alten Flanellmorgenrock und mit Lockenwicklern aus ihrem Schlafzimmer. Ich hatte auch was gehört, drum war ich schon draußen. Tom Yardley sagte: ›Guckt mal, was ich gefunden habe ... unter dem Azaleenstrauch, der mir letztes Jahr so viel Kummer gemacht hat‹ Nanny Gilroy starrte ihn an. Dann sagte sie: ›Ach du liebes bißchen! Das ist ja eine schöne Bescherung, ich muß schon sagen.‹ Ich hab’ dich auf der Stelle ins Herz geschlossen. Ich liebe Babys, besonders bevor sie anfangen, überall rumzukrabbeln, wenn sie so winzig und hilflos sind. Nanny meinte: ›Es kommt von den Zigeunern, darauf geh’ ich jede Wette ein. Kommen einfach daher, machen einem zu schaffen und verschwinden wieder. Die anderen dürfen sich dann um ihren Kram kümmern.‹«
Es paßte mir nicht, als »Kram« bezeichnet zu werden, aber ich hatte die Geschichte sehr gern und schwieg still. Die Zigeuner hatten damals anscheinend im Wald nicht weit von Haus Commonwood ihr Lager aufgeschlagen. Man konnte den Wald von den rückwärtigen Fenstern aus sehen.
Sally erzählte mir weiter, Nanny Gilroy habe gemeint, es sei das Vernünftigste, mich in einem Waisenhaus oder im Armenhaus abzuliefern, wohin man gewöhnlich Findelkinder brachte.
»Es gab einen regelrechten Aufstand«, erklärte sie. »Mrs. Marline kam rauf ins Kinderzimmer, um dich in Augenschein zu nehmen. Was sie sah, hat ihr nicht sonderlich gefallen. Sie guckte dich mit diesem typischen Blick an, die Mundwinkel nach unten verzogen und die Augen halb zu, und sagte, die Decke müsse auf dem Abfallhaufen verbrannt und du müßtest saubergemacht werden. Anschließend solle man die Behörden verständigen, damit sie dich abholten. Dann kam der Doktor nach oben. Er hat dich eine Weile angeschaut, ohne was zu sagen. Ein richtiger Arzt eben. Er sagte: ›Das Kind hat Hunger. Gib ihm Milch, Nanny, und mach es sauber!‹ Du hattest so ein Ding am Hals hängen.«
Ich sagte: »Ich weiß. Ich habe es immer aufbewahrt Ein Anhänger an einer Kette, mit einer Inschrift.«
»Der Doktor hat ihn angesehen und gesagt: ›Das sind Romani-Zeichen oder so was. Sie muß von den Zigeunern kommen.‹ Nanny war hocherfreut, weil sie genau dasselbe gedacht hatte. ›Ich hab’s gewußt‹, sagte sie. ›Kommen einfach in den Wald. Also wirklich!‹ Der Doktor hielt seine Hand hoch – du weißt ja, wie er ist –, als wollte er nichts mehr davon hören, aber du kennst Nanny. Sie dachte, sie wär’ im Recht, und sie sagte, je eher das Baby auf dem Weg ins Waisenhaus wäre, desto besser. Der Doktor erwiderte: ›Findest du wirklich, Nanny?‹ – ›Aber ja doch‹, sagte Nanny. ›Sie ist ’ne richtige kleine Zigeunerin, Sir, und da ist sie im Armenhaus oder Waisenhaus am besten aufgehoben.‹ – ›Bist du ganz sicher, Nanny?‹ Seine Stimme war eiskalt, und Nanny hätte es merken müssen, aber sie war ja so überzeugt, daß sie recht hatte, und sagte: ›Ohne jeden Zweifel.‹ – ›Da bist du ja sehr scharfsichtig‹ sagte er. ›Aber für mich ist die Herkunft des Kindes nicht so eindeutig.‹ Du fingst aus Leibeskräften an zu schreien, und ich wollte dir so gerne sagen, daß du aufhören sollst, denn mit dem knallroten schrumpeligen Gesicht sahst du nicht besonders niedlich aus, und ich dachte: Die schaffen dich weg, du dummes Baby, wenn du so weiterbrüllst, und wie wird es dir wohl im Waisenhaus gefallen? ›Ich denke, Sir‹, fing Nanny an, aber der Doktor unterbrach sie: ›Spar dir die Mühe, Nanny!‹ sagte er, was eine höfliche Form für ›Halt’s Maul!‹ war. ›Mrs. Marline und ich werden entscheiden, was zu tun ist.‹
Ich dachte: Entscheiden wird sie. Er wird dabei nicht viel zu sagen haben, und das Baby kommt ins Waisenhaus. Ich hatte mich geirrt. Noch heute habe ich keine Ahnung, was Mrs. Marline umgestimmt hat. Sie war unbedingt dafür gewesen, dich, so schnell es ging, aus dem Haus zu schaffen. Ich frage mich immer noch, was geschehen ist. Nanny mußte natürlich tun, was der Doktor anordnete, also hat sie dich gewaschen und in Sachen von Miß Estella gesteckt, und nun warst du ein adrettes Baby. Wir hörten, du solltest eine Weile in Commonwood bleiben, weil es sein könnte, daß jemand Ansprüche auf dich erhebt – was unwahrscheinlich war, weil derjenige, der es hätte tun können, dich ja eben erst unter dem Azaleenstrauch ausgesetzt hatte. Nanny sagte: ›Der Doktor hat ein weiches Herz, aber das letzte Wort, das hat er nicht. Das hat die Herrin. Er sieht nicht, daß es besser für das Baby ist, wenn es jetzt gleich weggegeben wird, bevor es sich an das Leben bei feinen Herrschaften gewöhnt.‹ Auch Nanny hat sich geirrt. Sie hätte schwören können, daß die Herrin das Baby in kürzester Zeit aus dem Haus schaffen würde. Aber aus irgendeinem Grund mußte sich Mrs. Marline dem Doktor fügen.«
So blieb ich in Haus Commonwood, und das Erstaunlichste war, daß ich die Kinderstube mit den Marline-Kindern teilte.
* * *
»Du warst vor allem mein kleines Baby, nicht das der anderen«, sagte Sally. »Ich hing an dir, und du hingst an mir. Nanny konnte nicht vergessen, wie du ins Haus gekommen warst. Du gehörtest nicht hierher, sagte sie. Sie konnte sich nie und nimmer daran gewöhnen, dich zu behandeln wie die anderen Kinder.«
Das wußte ich nur zu gut. Was Mrs. Marline anging, so würdigte sie mich kaum eines Blickes; die wenigen Male aber, wenn sie es dennoch tat und ich sie ertappte, sah sie ganz schnell weg. Der Doktor war bei den seltenen Gelegenheiten, wenn wir uns begegneten, reserviert, doch schenkte er mir jedesmal ein flüchtiges Lächeln, und manchmal tätschelte er mir den Kopf und fragte: »Na, geht’s gut?« worauf ich befangen nickte, was er wiederum mit einem Nicken quittierte; dann ging er rasch weiter, als sei er bestrebt, von mir wegzukommen.
Adeline war stets sanftmütig. Sie liebte Babys und kümmerte sich um mich, als ich klein war. Sie hielt mich an der Hand, als ich laufen lernte; sie zeigte mir Bilder in den Kinderbüchern und schien daran ebensoviel Freude zu haben wie ich. Estella war abwechselnd freundlich und feindselig. Manchmal schien sie sich auf Nannys Verachtung für mich zu besinnen und sie nachzuahmen. Dann wieder war sie wie eine Schwester zu mir.
Henry beachtete mich kaum, aber da er anscheinend keine Zeit für Mädchen oder irgendwelche Personen hatte, die jünger waren als er – seine Schwester eingeschlossen –, war das nicht im mindesten kränkend.
Es verging eine Weile, bis man befand, daß ich einen Namen haben müsse. Ich war immer als »das Kind« und von Nanny nur als »diese Zigeunerin« bezeichnet worden. Sally erzählte mir, wie ich zu meinem Namen kam. Sally interessierte sich für Namen und ihre Bedeutungen. »Seit ich hörte, daß meiner ›Prinzessin‹ bedeutet. Ich heiße nämlich eigentlich Sarah, verstehst du? Also, dich wollten sie Rose nennen. Tom Yardley erzählte dauernd, wie er rausgegangen war, um nach den Rosen zu sehen, die er kürzlich gepflanzt hatte. Und da hat er dich unter dem Azaleenstrauch gefunden. Darum dachten sie, Rose wäre der passende Name für dich. Mir hat er nicht gefallen. Für mich warst du keine Rose. Rose heißen so viele. Du warst irgendwie anders. Ich fand, du sahst ein bißchen wie eine kleine Zigeunerin aus. Ich hatte mal von einer Zigeunerin gehört, die Carmen hieß... nein, Carmel, glaub’ ich. Und weißt du was, als ich rauskriegte, daß Carmel ›Garten‹ bedeutet – also, das paßte doch gut, oder nicht? Du konntest nur Carmel heißen. Hatte man dich nicht im Garten gefunden? ›Carmel‹, sagte ich, ›das ist ihr Name. Der und kein anderer.‹ Niemand hatte was dagegen, und von da an riefen sie dich Carmel. Und als zweiten Namen gaben sie dir March, denn im März hatte Tom Yardley dich gefunden. Aber deinen Rufnamen, muß man sagen, habe ich dir gegeben.«
»Danke schön, Sally«, sagte ich. »Rose heißen wirklich viel zu viele.«
Da war ich also: Carmel March, Herkunft unbekannt, wohnhaft in Haus Commonwood dank der Güte von Dr. Marline und etwas weniger gütevoll geduldet von seiner herrischen Gattin sowie Nanny Gilroy.
* * *
Es war gar nicht so überraschend, daß ich zu einer »vorlauten« Person heranwuchs, wie Nanny sagte. In diesem Haus, in dem ich mich mehr oder weniger selbst zu behaupten hatte, mußte ich den Leuten ständig begreiflich machen, daß ich mich nicht wie eine unbedeutende Person behandeln lassen wollte. Ich mußte allen begreiflich machen, daß ich, lag meine Herkunft auch im dunkeln, ebensoviel taugte wie irgend jemand von ihnen.
In jenen frühen Tagen war mein Reich zumeist die Kinderstube, wo Nanny Gilroy einen deutlichen Unterschied machte zwischen mir und den anderen. Ich war die Außenseiterin, und mußte ich dies auch als Tatsache erkennen, so wollte ich doch gleichzeitig zeigen, daß an einer geheimnisumwitterten Person etwas Besonderes war. Ich wurde dort geduldet, weil der Doktor offensichtlich eine seltsame Vorstellung von Waisenkindern hegte, und aus dem noch befremdlicheren Grunde, daß Mrs. Marline ihm nicht widersprochen hatte, und so wurde ich aufsässig. Ich sagte mir, daß ich so gut war wie irgendwer anderer. Das ließ mich anmaßend werden.
»Zigeunerblut!« bemerkte Nanny. »Sind sie nicht immer aufdringlich, wenn sie einem Wäscheklammern andrehen und ein Silberstück abluchsen wollen dafür, daß sie einem die Zukunft voraussagen, die sie sich aus den Fingern saugen?«
Ich war sehr neugierig, was die Zigeuner betraf, und suchte über sie zu erfahren, was ich konnte. Ich entdeckte, daß sie in Wohnwagen lebten und von einem Ort zum anderen zogen. Für mich waren sie geheimnisvolle, romantische Leute, und ich war so gut wie sicher, daß ich eine von ihnen war.
Um uns zu unterrichten, kam Miß Mary Harley ins Haus. Sie war die Tochter des Pastors: sehr groß, linkisch, mit unordentlichen, dünnen Haaren, die dauernd aus den zu ihrer Bändigung gedachten Nadeln rutschten. Sie war nervös und schüchtern und, was ich heute weiß, nicht sehr tüchtig. Aber sie war gütig, und da ich dankbar war für jede Art von Güte, die mir widerfuhr, hatte ich sie gern.
Sie kam, weil Mrs. Marline gemeint hatte, die Kinder seien noch zu klein, um ins Internat geschickt zu werden, und bis es soweit sei, genüge Miß Harley durchaus.
Miß Harley kam mit Freuden. Ich hatte Nanny Gilroy zu Mrs. Barton, der Köchin, sagen hören, die Hauslehrerin sei gewiß froh über das Geld. Davon bleibe im Pfarrhaus nicht viel übrig, was kein Wunder sei angesichts dieses Schuppens von Haus, das in Schuß gehalten werden müsse, und dreier Töchter, die es zu verheiraten gelte und von denen keine besonders ansehnlich sei. Es hieß allgemein, die Pastorenfamilie sei arm wie eine Kirchenmaus, und das Geld komme sehr gelegen.
Miß Harley lehrte mich schreiben und lesen. Ich wurde zusammen mit Adeline unterrichtet, die ich aber bald überflügelte. Während der Schulstunden war ich sehr zufrieden.
Meine lebhafteste Kindheitserinnerung ist die erste Begegnung mit Onkel Toby.
Ich ging gerne allein in den Garten, und oft führten mich meine Schritte zu dem Azaleenstrauch. Ich stellte mir den Märzmorgen vor, als ich dort ausgesetzt wurde. Ich sah im Geiste eine verschwommene Gestalt, die sich in den Garten schlich, leise, um nur ja nicht gehört zu werden. Und da war ich, in einen Schal gewickelt. Vorsichtig, liebevoll wurde ich unter den Strauch gelegt, und wer immer mich dort zurückließ, küßte mich zärtlich, denn sie – es mußte eine Sie gewesen sein, weil es immer Frauen sind, die sich mit Babys befassen – war gewiß sehr unglücklich darüber, daß sie mich verlassen mußte.
Wer war »sie«? Eine Zigeunerin, hatte Nanny gesagt. Sie trug bestimmt große Ohrringe und hatte schwarze, lockige Haare, die ihr bis über die Schultern hingen.
Und als ich wieder einmal dort stand, trat jemand ganz dicht zu mir. Er sagte: »Guten Tag! Wie heißt du denn?«
Ich fuhr herum. Er wirkte riesig. Er war tatsächlich sehr groß. Seine Haare waren blond – von der Sonne gebleicht, wie ich später entdeckte –, und seine Haut war goldbraun. Er hatte die blauesten Augen, die ich je gesehen hatte, und er lächelte.
»Ich heiße Carmel«, sagte ich mit jener Würde, die ich gelernt hatte an den Tag zu legen.
»Ein schöner Name«, sagte er. »Ich wußte doch gleich, daß du etwas Besonderes an dir hast. Was tust du hier?«
»Ich schau mir den Azaleenstrauch an.«
»Der ist sehr schön.«
»Er hat Tom Yardley einmal viel Kummer gemacht.«
»Tatsächlich? Aber du hast ihn gern?«
»Man hat mich unter ihm gefunden.«
»Ach, unter diesem Strauch, ja? Kommst du ihn dir oft anschauen?«
Ich nickte.
»Ja, das kann ich mir vorstellen. Es wird ja schließlich nicht jeder unter einem Azaleenstrauch gefunden, nicht wahr?«
Ich zog die Schultern hoch und lachte. Er stimmte mit ein.
»Wie alt bist du, Carmel?«
Ich hielt vier Finger in die Höhe.
Er zählte sie ernsthaft.
»Vier Jahre? Meiner Treu! Was für ein schönes Alter! Wann bist du vier geworden?«
»Ich bin im März gekommen. Drum heiße ich Carmel March.«
»Ich bin Onkel Toby.«
»Von wem bist du der Onkel?«
»Von Henry, Estella und Adeline. Von dir auch, wenn du mich haben magst.«
Ich lachte wieder. Ich konnte ohne einen bestimmten Grund lachen, wenn ich glücklich war, und von ihm ging etwas aus, das mich glücklich machte.
»Magst du?« fuhr er fort.
Ich nickte. »Du wohnst nicht hier«, sagte ich.
»Ich bin zu Besuch. Ich bin gestern abend angekommen.«
»Bleibst du hier?«
»Eine Weile. Dann reise ich wieder ab.«
»Wohin?«
»Aufs Meer ... ich lebe auf dem Meer.«
»Dort draußen gibt’s nur Fische«, sagte ich ungläubig.
»Und Seeleute«, fügte er hinzu.
»Onkel Toby! Onkel Toby!« Estella kam angelaufen und stürzte sich auf ihn.
»Hallo! Hallo!« Er hob sie in die Luft und hielt sie hoch, und sie lachten zusammen. Ich war eifersüchtig.
Dann kam Henry hinzu: »Onkel Toby!«
Der Mann setzte Estella ab und begann, sich mit Henry zu unterhalten.
»Wann bist du angekommen? Wie lange bleibst du? Wo bist du gewesen?« wollte Henry wissen.
»Mal hübsch der Reihe nach«, sagte er. »Ich bin gestern abend angekommen, als ihr schon im Bett wart. Ich habe alles über euch gehört, was ihr getrieben habt, als ich fort war. Und ich habe die Bekanntschaft von Carmel gemacht.«
Estella sah spöttisch zu mir herüber, aber Onkel Tobys Lächeln war herzlich.
»Laßt uns hineingehen!« sagte er. »Ich habe euch viel zu erzählen und viel zu zeigen.«
»Ja, ja«, rief Estella.
»Gehen wir!« sagte Henry.
Estella umklammerte Onkel Tobys Hand und zog ihn zum Haus. Ich fühlte mich plötzlich alleingelassen, doch da drehte sich Onkel Toby zu mir um und streckte seine Hand aus.
»Komm, Carmel!« sagte er.
Und ich war wieder glücklich.
* * *
Onkel Tobys Besuche sind die glücklichsten Erinnerungen an meine Kindheit. Sie waren nicht sehr häufig, aber dafür um so kostbarer. Er war Mrs. Marlines Bruder, was mich immer wieder erstaunte. Zwei verschiedenere Menschen konnte es nicht geben. Er hatte nichts von ihrer herben Strenge. Man hatte den Eindruck, daß nichts auf der Welt ihn je verdrießen könne. Was immer daherkäme, er würde es überwinden, und er gab einem das Gefühl, daß man es selbst genauso machen konnte. Vielleicht war das das Geheimnis seines Charmes.
Wenn er da war, ging es im Haus ganz anders zu. Sogar Nanny Gilroy wurde sanfter. Er sagte allen lauter Sachen, die er so nicht meinen konnte. Lügen? dachte ich. Das war gewiß nicht gut. Aber was Onkel Toby auch tat, es war stets richtig in meinen Augen.
»Nanny«, sagte er etwa, »du wirst mit jedem Mal, das ich dich sehe, schöner.«
»Nun machen Sie aber mal ’nen Punkt, Captain Sinclair!« sagte sie dann und schürzte die Lippen. Aber ich denke, sie hat es tatsächlich geglaubt.
Selbst Mrs. Marline war wie verwandelt Ihr Gesicht wurde weich, wenn sie ihn ansah, und ich wunderte mich abermals, daß das ihr Bruder sein sollte. Auch der Doktor war verändert. Er lachte öfter. Und Estella und Henry hielten sich immer in seiner Nähe auf. Er war gütig, und zu Adeline war er besonders liebevoll. Sie saß dann da und lächelte ihn an, so daß sie auf seltsame Weise richtig schön aussah.
Mich bezauberte, daß er mich immer mit einbezog. Ich bildete mir ein, daß er mich lieber hatte als die anderen – aber vielleicht wollte ich das nur glauben.
Zuweilen sagte er: »Komm mit, Carmel!« Und er drückte meine Hand. »Bleib schön bei Onkel Toby!« Als ob er mich dazu hätte auffordern müssen!
»Das ist mein Onkel Toby«, reklamierte Estella, »nicht deiner.«
»Er hat gesagt, er ist mein Onkel, wenn ich ihn mag, und ich mag ihn.«
»Zigeunerkinder haben keine Onkels wie Onkel Toby.«
Das stimmte mich traurig, weil ich wußte, daß es wahr war. Doch ich weigerte mich, es hinzunehmen. Er machte nie einen Unterschied zwischen mir und den anderen, vielmehr zeigte er sogar ganz deutlich, daß er mein Onkel sein wollte.
Wenn er im Haus Commonwood war, verbrachte er stets viel Zeit mit den Kindern. Estella und Henry bekamen Reitstunden, und er sagte, ich müsse auch reiten lernen. Er setzte mich auf ein Pony mit einem Leitzügel und führte es mit mir auf einem Feld im Kreis herum. Das war für mich die höchste Seligkeit.
Er erzählte uns Geschichten von seinem Leben auf See. Er kam mit seinem Schiff in alle Länder der Welt. Er erzählte von Orten, von denen ich nie gehört hatte: dem geheimnisvollen Fernen Osten, den Wundern Ägyptens, dem farbenfrohen Indien, Frankreich, Italien und Spanien.
Dann stand ich in der Schulstube vor dem Globus, drehte ihn herum und fragte Miß Harley: »Wo liegt Indien? Wo liegt Ägypten?« Ich wollte mehr über die wundervollen Gegenden wissen, die der noch wundervollere Onkel Toby besucht hatte.
Er brachte den Kindern und – o Wunder über Wunder – auch mir Geschenke mit. Es nützte nichts, daß Estella sagte, er sei nicht mein Onkel Toby. Er gehörte mir ... mehr als ihnen.
Das Geschenk für mich war eine Schatulle aus Sandelholz, auf der drei Äffchen hockten. Er sagte mir, was ihre Haltung bedeutete: »Nichts Böses sehen, nichts Böses sagen, nichts Böses hören«, und wenn man den Deckel der Schatulle aufmachte, erklang »God Save the Queen«. Etwas so Schönes hatte ich noch nie besessen. Ich wollte die Schatulle nicht aus den Augen lassen. Ich stellte sie an mein Bett, so daß ich nachts die Hand nach ihr ausstrecken und sie fühlen konnte, und wenn ich aufwachte, spielte ich als erstes die Melodie.
Haus Commonwood war verzaubert, wenn er da war, und wenn er fortging, wurde es wieder glanzlos und gewöhnlich. Doch zurück blieb die Hoffnung, daß er wiederkommen würde.
Wenn er Lebewohl sagte, klammerte ich mich an ihn; das schien ihm zu gefallen.
»Kommst du bald wieder?« fragte ich jedesmal.
Und seine Antwort lautete immer gleich: »Sobald es mir möglich ist.«
»Ganz bestimmt?« fragte ich ernst, da ich die Angewohnheit der Erwachsenen kannte, Versprechungen zu machen, die sie nicht zu halten beabsichtigten.
Und zu meiner geradezu unerträglichen Freude antwortete er: »Nichts kann mich fernhalten, seit ich die Bekanntschaft von Miß Carmel March gemacht habe.«
Ich lauschte auf das Klappern der Pferdehufe und das Räderrattern der Kutsche, die ihn forttrug. Wenn wir dann ins Haus gingen, sagte Estella: »Das ist nicht dein Onkel Toby.«
Aber nichts vermochte mich davon zu überzeugen, daß er nicht mein Onkel war.
* * *
Eines Tages im Frühling, nicht lange nach einem Besuch Onkel Tobys, verkündete Henry: »Die Zigeuner sind im Wald. Ich hab’ ihre Wohnwagen gesehen, als ich vorbeiging.«
Ich bekam Herzklopfen. Sie waren viele Jahre nicht in der Gegend gewesen – seit meiner Geburt nicht mehr.
»Ach, du liebes bißchen«, stöhnte Nanny Gilroy. »Da muß man doch was tun! Müssen die denn hierherkommen und anständige Leute belästigen?« Dabei sah sie mich an, als sei ich dafür verantwortlich.
Ich sagte: »Das ist ihr gutes Recht. Der Wald ist für alle da.«
»Komm mir nicht mit deinen Frechheiten, Fräuleinchen, wenn ich bitten darf«, sagte Nanny. »Du magst ja deine Gründe haben, solche Leute zu mögen. Ich – und es gibt Tausende wie mich – fühle da anders. Wenn sie mit ihren Wäscheklammern und Heidesträußen hierherkommen, sag ihnen ruhig grob die Meinung, Sally! Von mir kriegen sie dasselbe zu hören.«
Sally sagte klugerweise nichts, und ich setzte meine aufsässige Miene auf, was dumm von mir war, weil es nichts half.
Es wurde viel über die Zigeuner geredet. Die Leute mißtrauten ihnen. Sie seien lästig, hieß es, und sie würden listig andeuten, daß es Unglück brächte, wenn man ihnen ihre Waren nicht abkaufte oder sich nicht wahrsagen ließ.
Nachts machten sie im Wald Feuer und saßen dann singend drumherum. Wir konnten sie vom Garten aus hören. Ich fand ihren Gesang sehr melodisch. Einige junge Mädchen aus der Nachbarschaft ließen sich wahrsagen.
Nanny ermahnte Estella, auf der Hut zu sein. »Die haben alle möglichen Tricks auf Lager. Sie entführen Kinder, lassen sie hungern und zwingen sie, Wäscheklammern verkaufen zu gehen. Die Leute haben Mitleid mit ausgehungerten Kindern.«
Ich sagte zu Estella: »Das ist nicht wahr! Sie stehlen keine Kinder.«
»Nein«, pflichtete Estella mir bei. »Sie legen sie unter Sträuchern ab, damit andere sich um sie kümmern. Ist doch klar, daß du sie verteidigst.«
Sie ist eben eifersüchtig auf dich, sagte ich mir. Sie war zwar zwei Jahre älter, aber ich konnte ebenso gut lesen wie sie. Außerdem hatte Onkel Toby mich besonders gern.
Sie sang:
»Mutter sagt, sieh dich nur vor,
Öffne Zigeunern nicht Tür und Tor!
Und warum nicht?« fuhr sie fort. »Weil sie dich entführen, dir Schuhe und Strümpfe wegnehmen und dich Wäscheklammern verkaufen schicken.«
Ich ging weg und versuchte, ein hochmütiges Gesicht zu machen, aber ich war verstört. Schade, daß Onkel Toby nicht da war. Ich hätte gerne mit ihm über die Zigeuner gesprochen. Ich interessierte mich sehr für sie, und es fiel mir schwer, ihrem Lager fernzubleiben.
Ich war damals sechs Jahre alt, aber ich glaube, man hätte mich für älter halten können. Ich war so groß wie Estella, und mein Bedürfnis, mich zu behaupten, war stärker denn je. Obwohl ich gekleidet und ernährt wurde wie sie und Unterricht wie Kinderstube mit den Kindern des Hauses teilte, wurde mir ständig vorgehalten, daß ich meine Anwesenheit einzig der Barmherzigkeit des Doktors und seiner Gattin zu verdanken hätte. Deshalb also mußte ich ihnen ständig beweisen, daß ich genauso war wie die übrigen, wenn nicht sogar besser.
Ich liebte Sally, ich mochte Adeline und Miß Harley. Ich hatte eben alle gern, die freundlich zu mir waren, und natürlich betete ich Onkel Toby an. Ich stürzte mich auf jegliche Zuneigung, die mir entgegengebracht wurde, weil ich sie bei anderen so sehr entbehrte.
Es war leicht für mich, fortzuschleichen, und unweigerlich führten mich meine Schritte zum Lager. Aus dem Schutz der Bäume konnte ich die Wohnwagen betrachten, ohne daß jemand meine Anwesenheit bemerkte.
Mehrere dunkle Kinder spielten barfuß miteinander. Junge Frauen hockten im Kreis und flochten Weidenkörbe oder schnitzten Holz. Sie sangen leise und plauderten bei der Arbeit.
Eine Frau interessierte mich besonders. Sie war allerdings nicht jung. Sie hatte dichtes, schwarzes Haar mit grauen Strähnen. Sie saß immer auf den Stufen eines bestimmten Wohnwagens, wenn sie mit den anderen arbeitete. Sie redete sehr viel. Ich war zu weit entfernt, um zu verstehen, was sie sagte, aber ich hörte sie hin und wieder singen. Sie war mollig und lachte viel. Ich wünschte, ich hätte gewußt, worum es bei alledem ging.
Ich fragte mich oft, was aus mir geworden wäre, wenn man mich nicht unter den Azaleenstrauch gelegt hätte. Wäre ich dann eines von diesen barfüßigen Kindern? Ich schauderte bei dem Gedanken. Obwohl ich nicht eigentlich erwünscht war, war ich doch froh, daß man mich im Haus Commonwood aufgenommen hatte. Ich war dem Doktor doppelt dankbar, daß er darauf bestanden hatte, mich dazubehalten. Ihm lag zwar offensichtlich nichts an mir, aber vielleicht hatte er es für eine gute Idee gehalten und gedacht, er komme nicht in den Himmel, wenn er mich fortschickte. Auf alle Fälle war ich froh, daß sie mich behalten hatten, aus welchem Grund auch immer.
Es war ein heißer Nachmittag. Ich saß unter den Bäumen und beobachtete die Zigeuner. Die Kinder unterhielten sich laut. Die mollige Frau saß wie immer auf den Wohnwagenstufen. Der Korb, den sie flocht, lag in ihrem Schoß, und sie sah aus, als würde sie jeden Moment einnicken.
Ich dachte, bei dieser Hitze sei weniger Vorsicht angebracht als sonst, und ich könne mich vielleicht etwas näher heranwagen. Ich stand abrupt auf, übersah aber den Stein, der aus dem Erdboden ragte. Ich stolperte und fiel der Länge nach ins Gras der Lichtung.
Es geschah so geschwind, daß ich einen Aufschrei nicht unterdrücken konnte. Mein Fuß tat auf einmal sehr weh, und ich sah Blut an meinem Strumpf.
Die Kinder hatten mich natürlich entdeckt, und ich versuchte, mich hochzurappeln. Ich stieß einen Schmerzensschrei aus, denn mein linker Fuß wollte mich nicht tragen, und ich fiel nochmals hin.
Die mollige Frau stieg die Wohnwagenstufen herab. »Was gibt’s?« rief sie. »Nanu! Ein kleines Mädchen! O je! Was hast du denn da gemacht? Du hast dir weh getan?«
Ich sah auf das Blut an meinem Strumpf. Schon kniete sie neben mir, während die Kinder um uns standen und zusahen.
»Tut’s da weh, Schätzchen?«
Sie betastete meinen Knöchel, und ich nickte.
Sie brummte und wandte sich an die Kinder. »Geht, holt Onkel Jake! Sagt ihm, er soll herkommen ... und zwar schnell!«
Zwei Jungen liefen davon.
»Hast dich verletzt, Herzchen. Dein Knöchel. Nichts Schlimmes. Aber wir wollen die Blutung stillen. Jake wird jede Minute hier sein. Er ist da drüben, Holz fällen.«
Trotz der Schmerzen in meinem Fuß, und obwohl ich nicht gehen konnte, war ich ganz aufgeregt Es hatte mir immer Spaß gemacht, dem faden Einerlei der Onkel-Toby-losen Tage zu entfliehen, und ich war froh über jede Art von Ablenkung. Diese war besonders fesselnd, weil sie mich den Zigeunern näherbrachte.
Die zwei Jungen kamen wieder angelaufen, gefolgt von einem großen Mann mit dunklen, lockigen Haaren und goldenen Ohrringen. Er hatte ein stark gebräuntes Gesicht, und sein freundliches Lächeln ließ seine weißen Zähne sehen.
»O Jake«, sagte die mollige Frau. »Das Fräuleinchen hatte ein kleines Mißgeschick.« Sie lachte stumm, man sah es nur am Zucken ihrer Schultern. Sie hatte sich nicht ungeschickt ausgedrückt, und ich quittierte ihre Wortwahl mit einem Lächeln.
»Schaff sie am besten in den Wagen, Jake! Ich werde die Wunde verarzten.«
Jake hob mich auf und trug mich über die Lichtung. Er stieg die Stufen des Wohnwagens hinauf, auf denen die Frau gesessen hatte, und ging hinein. Auf einer Seite des Wohnwagens stand eine Bank, auf der anderen ein Diwan. Auf diesen legte er mich. Ich sah mich um. Es war wie in einem kleinen Zimmer, sehr unordentlich, und auf der Bank standen Becher und Flaschen.
»So, da wären wir«, sagte die Frau. »Ich tu’ dir schnell etwas auf das Bein. Dann sehen wir zu, daß wir dich nach Hause bringen. Woher kommst du, Schätzchen?«
»Ich wohne in Haus Commonwood bei Dr. Marline und seiner Familie.«
»Oh«, sagte sie. »Na so was!« Sie schüttelte sich, als ob sie insgeheim lachte. »Sie werden sich Sorgen um dich machen, Schätzchen. Wir schicken ihnen am besten eine Nachricht.«
»Sie machen sich keine Sorgen um mich ... noch nicht.«
»Oh ... na gut. Wir ziehen jetzt den Strumpfaus. Kannst du?«
»Alles in Ordnung?« fragte Jake.
Die Frau nickte. »Wir rufen dich, wenn wir dich brauchen.«
»Ist recht«, sagte Jake und lächelte mir freundlich zu.
»So«, sagte die Frau. Ich hatte inzwischen meinen Strumpf ausgezogen und sah bekümmert auf das Blut, das aus der Schürfwunde sickerte.
»Zuerst waschen«, sagte die Frau. »Du«, sie zeigte auf eines der Kinder, die uns in den Wohnwagen gefolgt waren, »bring mir eine Schüssel mit Wasser!«
Das Kind füllte folgsam eine Schüssel, die auf der überladenen Bank stand, halbvoll mit Wasser aus einem ebenfalls dort stehenden Emaillekrug.
Die Frau hatte einen Lappen in der Hand und begann, mein Bein abzuwaschen. Ich blickte entsetzt auf den blutdurchtränkten Lumpen und das sich rot färbende Wasser in der Schüssel.
»Ist halb so schlimm, Schätzchen«, sagte sie. »Das ist bald wieder heil. Ich tu’ dir was drauf. Hab’ ich selbst gemacht. Wir Zigeuner kennen uns da aus. Hab nur Vertrauen zu der Zigeunerin!«
»Oh, das habe ich«, sagte ich.
Sie lächelte mich an, daß ihre prachtvollen Zähne blitzten.
»Paß auf, das kann zuerst ein bißchen weh tun. Aber je mehr es weh tut, um so schneller wird es wieder gut. Verstehst du?«
Ich nickte.
»Achtung!«
Ich zuckte zusammen.
»Schon geschehen. Du bist die Kleine vom Doktor, nicht?«
»Nein. Nicht richtig. Ich bin bloß da.«
»Zu Besuch?«
»Nein. Ich wohne da. Ich bin Carmel March.«
»Das ist aber ein hübscher Name, Schätzchen.«
»Carmel bedeutet Garten, und in einem solchen haben sie mich gefunden, und weil’s im März war, haben sie mich March genannt.«
»In einem Garten!«
»Das wissen alle hier in der Gegend. Ich lag unter dem Azaleenstrauch, der Tom Yardley einmal so viel Kummer gemacht hat.«
Die Frau starrte mich erstaunt an und nickte langsam mit dem Kopf.
»Und du lebst jetzt dort?«
»Ja.«
»Und sind sie gut zu dir?«
Ich zögerte. »Sally ist lieb und Miß Harley und Adeline ... und Onkel Toby natürlich. Aber ...«
»Der Doktor und seine Frau nicht?«
»Ich weiß nicht. Sie beachten mich kaum. Aber Nanny Gilroy sagt immer, ich gehöre nicht dorthin.«
»Sie ist nicht sehr nett, nein?«
»Sie denkt bloß, ich sollte da nicht sein.«
»Das hört sich für mich nicht sehr nett an, Herzchen. So, jetzt verbinde ich dich.«
»Das ist sehr nett von Ihnen.«
»Wir sind brave Leute, wir Zigeuner. Du darfst nicht alles glauben, was man über uns erzählt.«
»Tu ich auch nicht.«
»Das sehe ich. Du hast kein bißchen Angst vor mir, was?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Bist ein tapferes kleines Mädchen. Jetzt bringen wir dich nach Hause. Jake wird dich tragen, weil du nicht laufen kannst. Aber vorher gebe ich dir was Heißes zu trinken, und wir können ein Weilchen schwätzen, während du dich ein bißchen ausruhst. Dein Knöchel wird bald wieder gut sein. Ist nur verstaucht. Tut ein bißchen weh, aber bald ist er wieder heil. Du darfst nur noch nicht auftreten. Hier, das ist ein Kräutertrank, der beruhigt nach einem Schock ... und den hattest du, Schätzchen.«
Das Gebräu tat sehr gut. Sie beobachtete mich, während ich trank.
»Schön«, sagte sie. »Jetzt wollen wir ein bißchen plaudern, wir zwei. Erzähl mir vom Doktor und seiner Frau, und von Nanny und allen anderen! Sie geben dir doch genug zu essen?«
»O ja.«
»Das ist gut.«
Sie hörte mit großem Interesse zu, während ich ihr von Haus Commonwood erzählte.
»Was ich da von dieser Nanny höre, will mir gar nicht gefallen«, sagte sie.
»Sie ist eigentlich ein gutes Kindermädchen. Sie denkt bloß, ich bin nicht gut genug, um mit den anderen aufzuwachsen.«
»Und du beweist ihr das Gegenteil, darauf möchte ich wetten.«
Ihre Schultern zuckten vor Lachen, und ich stimmte in ihr Gelächter ein. Dann fragte sie ernst: »Bist du traurig wegen dieser Nanny?«
»Na ja, ein bißchen ... manchmal.«
Darauf erzählte ich ihr von Onkel Toby, und ihre Augen blitzten vor Heiterkeit.
»Und er hat dir die Schatulle mit den Affen geschenkt. Meiner Treu, der scheint mir ein netter Mensch zu sein.«
»O ja, das ist er.«
»Und du hast ihn gern und er dich auch?«
»Ich glaube, er mag mich mehr als die anderen.«
Sie nickte, und wieder bebten ihre Schultern.
»Soso, Schätzchen«, sagte sie. »Das wundert mich kein bißchen.«
Es war ein wunderbares Erlebnis. Sie gefiel mir. Ihr Name sei Rosie, sagte sie, Rosie Perrin. Da erzählte ich ihr, daß ich beinahe Rose getauft worden wäre und warum.
»Na so was!« sagte sie. »Wir hätten zwei blühende Röschen abgegeben, wir zwei, was?«
Ich war ganz betrübt, als ich nach Haus Commonwood zurückgebracht wurde. Dort war man ziemlich bestürzt, als Jake mit mir ankam.
»Das kleine Fräulein ist hingefallen«, erklärte er Janet, dem Hausmädchen, das ihm öffnete.
Janet wußte nicht recht, was sie tun sollte, und Jake trat in die Diele. »Sie kann nicht laufen«, sagte er. »Ich bringe sie am besten in ihr Bett.«
Er folgte Janet die Treppe hinauf, wo die Kinderzimmer lagen.
Nanny war entsetzt. »Ach, du liebes bißchen!« sagte sie.
»Und was jetzt?«
»Die Kleine ist im Wald gestürzt«, erklärte Jake. »Sie darf mit einem Bein nicht auftreten. Ich leg’ sie auf ihr Bett.«
Sally sah mit großen Augen neugierig zu, wie ich aufs Bett gelegt wurde. Dann führte Janet Jake nach unten, und das Donnerwetter ging los.
»Was hast du dir bloß dabei gedacht, Zigeuner ins Haus zu bringen!« schimpfte Nanny.
»Sie kann nicht laufen«, sagte Sally. »Er mußte sie tragen.«
»Hat man so was schon gehört! Was hattest du da zu suchen, im Wald, bei den Zigeunern?«
Ich sagte: »Sie haben mich gefunden, nachdem ich hingefallen bin. Sie waren sehr nett zu mir.«
»Nett, daß ich nicht lache! Sie sind immer bloß darauf aus, anständige Leute auszunehmen.«
»Sie haben überhaupt nichts genommen. Sie haben mir einen Kräutertrank gegeben.«
»Und jetzt? Und jetzt? Ich geh’ sofort zur Herrin und sag’ ihr, was passiert ist.«
Das hatte einen Besuch des Doktors zur Folge. Nanny stand dabei, mit verkniffenen Lippen, die Augen vorwurfsvoll auf mich gerichtet. Der Doktor sprach kaum mit ihr. Ich hatte den Eindruck, daß er Nanny nicht besonders leiden konnte. Er lächelte mich recht liebenswürdig an.
»Na«, sagte er, »was hast du angestellt?«
»Ich bin im Wald hingefallen. Die Zigeuner haben mich gefunden. Eine Frau hat mir was zu trinken gegeben und mein Bein eingerieben und verbunden.«
»Schön, das wollen wir uns mal ansehen, ja? Tut es weh?«
»Jetzt nicht mehr. Vorhin hat’s weh getan.«
Er betastete meinen Knöchel. »Du hast ihn dir verstaucht«, sagte er. »Ein bißchen aufgeschürft und verrenkt. Ist nicht weiter schlimm. Du mußt nur ein paar Tage ruhen.« Er nahm den Verband ab. »Hm. Gut so. Den Verband lassen wir eine Weile drauf. Das genügt fürs erste.« Er wickelte ihn stramm und schenkte mir wieder dieses nette Lächeln. »Ist wirklich nicht weiter schlimm«, fügte er beruhigend hinzu.
»Sie hatte im Wald nichts zu suchen«, sagte Nanny. »Bringt uns diese Leute ins Haus!«
Er bedachte Nanny mit einem kühlen Blick, der mich in meinem Verdacht bestätigte, daß er sie nicht leiden konnte. Er sagte: »Carmel hätte nicht alleine laufen können. Es war nett von ihnen, sich ihrer anzunehmen. Ich bin sicher, Mrs. Marline möchte sich mit einem Briefchen für diese Freundlichkeit bedanken.«
Er wandte sich an mich und lächelte wieder gütig. »Ich nehme nicht an, daß sie ihre Namen genannt haben?«
»Doch, doch«, rief ich. »Die Frau, die mir den Trank gegeben und mich verbunden hat. Ihr Name war Rosie Perrin.«
»Den merke ich mir«, sagte er, dann nickte er und ging.
Nanny murmelte: »Zigeunern schreiben! Daß ich nicht lache! Und jetzt? Die Herrin wird sich hüten. Da hast du ja was Schönes angerichtet! Stürzt im Wald, und bringst uns diese Leute ins Haus!«
Sally wollte alles über mein Abenteuer hören, und ich glaube, Estella wünschte, es wäre ihr passiert Sally sagte, es sei sehr hilfreich gewesen von den Zigeunern, sich um mich zu kümmern.
Der Doktor kam jeden Tag, um nach meinem verletzten Bein zu sehen und meinen Knöchel zu betasten. Er war immer freundlich zu mir und kühl zu Nanny. Ich mochte ihn dafür um so lieber. Mrs. Marline kam nicht. Ich hätte gerne gewußt, ob sie Rosie Perrin geschrieben hat.
Dieser Vorfall bedeutete einen Wendepunkt in meinem Verhältnis zum Doktor. Von nun an nahm er hin und wieder Notiz von mir, und dann sagte er: »Knöchel wieder in Ordnung?« Und nach einer Weile bloß: »Alles in Ordnung?«
Ich gewann ihn richtig lieb. Er machte auf mich den Eindruck, als liege ihm wirklich etwas daran, daß mit mir »alles in Ordnung« war, obwohl man mich unter dem Azaleenstrauch ausgesetzt und ich Zigeuner ins Haus gebracht hatte.
* * *
Das Herrschaftshaus in der Nachbarschaft hieß The Grange. Der Besitzer war Sir Grant Crompton, der allgemein als Gutsherr bezeichnet wurde. Sir Grant und Lady Crompton waren die Wohltäter der Gemeinde und beschäftigten eine erkleckliche Anzahl der Bewohner, sie verpachteten ihren Grund an Bauern und schickten den Armen jedes Jahr zu Weihnachten eine Gans.
Alles ging sehr traditionell zu. Lady Crompton führte den Vorsitz bei Festlichkeiten, Basaren und Veranstaltungen, deren Einkünfte einem guten Zweck zuflossen. Die Cromptons erschienen, wenn sie am Ort waren, stets in der Kirche und nahmen auf den Bänken Platz, die seit hundert Jahren der Familie vorbehalten waren. Das Personal saß unmittelbar hinter ihnen. Sir Grant spendete großzügig für kirchliche Belange, und er wurde von allen sehr verehrt.
Die Cromptons hatten zwei Kinder: Lucian und Camilla. Ich sah sie öfters mit einem Stallburschen ausreiten. Die Geschwister waren ein sehr hübsches und vornehm wirkendes Pärchen, und sie würdigten uns kaum eines Blickes, wenn wir uns auf den Feldwegen begegneten – die beiden auf prächtigen Rössern, wir zu Fuß. Estella seufzte dann und wünschte, sie würde auf The Grange leben und auf einem weißen Pferd reiten, ihren Bruder auf einem ebenso herrlichen Reitpferd neben sich. Lucian war allerdings viel größer und stattlicher als Henry.
Sie waren eben »die Leute von The Grange«, der Doktor hingegen, in gesellschaftlichen Kreisen nicht gerade verachtet, wurde zwar hin und wieder nach The Grange eingeladen, doch mutmaßte man, daß dies nur geschah, um die Zahl voll zu machen oder weil ein würdigerer Gast in letzter Minute abgesagt hatte.
Mrs. Marline war darüber ein wenig verstimmt, und man hatte sie fragen hören, was sich die Cromptons eigentlich einbildeten. Sobald sich aber die Gelegenheit bot, die Verbindung zwischen The Grange und Haus Commonwood zu festigen, war sie hocherfreut.
Mrs. Marline war anläßlich eines bestimmten wohltätigen Werkes zu Besuch in The Grange, wo sie von Lady Crompton freundlich empfangen wurde. Und während ihres Gesprächs hatte sich ergeben, daß beide Damen sich Gedanken über die Ausbildung ihrer Söhne machten.
Lady Crompton erwog, einen Hauslehrer für Lucian einzustellen, weil sie meinte, es sei noch zu früh für ihn, ein Internat zu besuchen, und da Mrs. Marline vor demselben Problem stand, hatten die beiden Damen eine Menge zu besprechen. Am Ende machte Lady Crompton den Vorschlag, daß die zwei Knaben gemeinsam von einem Hauslehrer unterrichtet werden könnten, der nach The Grange kommen sollte.
Mrs. Marline war von der Idee begeistert.
Ich nahm an, daß sie sich die Kosten für den Hauslehrer teilen würden, denn ich hörte Nanny Gilroy sagen, daß die Cromptons ungeachtet ihrer Hochherrschaftlichkeit »nicht mit Geld um sich warfen« und vermutlich ziemlich »knickerig« seien. Und natürlich wußten wir alle, daß Mrs. Marline Geld hatte und sicher bereit war, für ein solches Privileg, das dies in ihren Augen darstellte, zu bezahlen.
So wurde man sich also einig, und jeden Morgen außer sonntags begab sich Henry nach The Grange, von wo er dann am Nachmittag mit Büchern und Hausaufgaben für den folgenden Tag zurückkehrte.
Es war in Mrs. Marlines Augen eine äußerst zufriedenstellende Übereinkunft, bedeutete sie doch, daß die Familien häufiger miteinander Kontakt bekamen als vorher. So wurden Estella, Henry und Adeline zum Tee mit Lucian und Camilla nach The Grange eingeladen, was Estella entzückte, sie aber auch sehr unzufrieden mit Haus Commonwood machte, das sich im Vergleich zu The Grange recht bescheiden ausnahm.
Ich wurde nie gebeten mitzukommen. Ich glaube, Nanny Gilroy hatte dabei die Hand im Spiel, und Mrs. Marline hat ihr selbstverständlich beigepflichtet Aber ich war überzeugt, der Doktor hätte ihnen nicht zugestimmt, wenn er in der Sache gefragt worden wäre.
Dann aber kam es anders.
Onkel Toby besuchte uns, während sein Schiff wegen kleinerer Instandsetzungsarbeiten im Hafen lag. Es war wie immer ein wunderbarer Besuch. Onkel Toby brachte mir ein Geschenk aus Hongkong mit: einen Jadeanhänger an einer schmalen Goldkette. Der Anhänger war mit chinesischen Schriftzeichen verziert, die, so sagte er mir, »viel Glück« bedeuteten.
Ich hatte ja noch den anderen Anhänger, den ich um den Hals getragen hatte, als man mich unter dem Azaleenstrauch fand. Den betrachtete ich oft, trug ihn aber nie, wohl aus dem Gefühl heraus, daß er die Leute an mein Auftauchen erinnern würde und daran, daß ich eigentlich nicht hierher gehörte.
Onkel Tobys Geschenk war etwas anderes. Ich war entzückt – nicht nur wegen der Glücksverheißung, sondern weil es von Onkel Toby war. Nanny Gilroy hätte bestimmt gesagt, es schicke sich nicht für ein Kind in meinem Alter, Schmuck zu tragen, und mir befohlen, ihn abzunehmen, weswegen ich ihn, wenn sie zugegen war, unter meinem Kleid verborgen trug. Ich trennte mich nie von ihm, auch nicht während der Nacht, und beim Aufwachen berührte ich ihn als erstes und murmelte: »viel Glück«, indes ich die andere Hand nach der Spieldose ausstreckte und mir »God Save the Queen« anhörte.
Estella war ganz aufgeregt, weil sie und Henry zum Tee nach The Grange eingeladen waren. Bei schönem Wetter –und wir befanden uns mitten in einer Hitzewelle – sollte der Tee auf dem Rasen vor dem Haus eingenommen werden. Nanny hatte Sally beauftragt, Estellas blaues Kleid mit der Satinschärpe und den Puffärmeln aufzubügeln. Estella müsse ebenso fein gekleidet sein wie Camilla – »und noch hübscher aussehen«, fügte Nanny hinzu.
Ich sah Sally zu, die sorgfältig das Kleid bügelte. »Schade, daß sie dich nicht eingeladen haben«, sagte sie. »Du würdest doch gerne hingehen, nicht? Du siehst nicht weniger hübsch aus als die anderen.«
»Ich mag nicht hingehen«, log ich. »Ich bleib’ lieber hier.«
»Es wäre aber schön für dich«, beharrte Sally. »Und eigentlich sollten sie dich einladen. Schätze, das würden sie auch ... wenn Nanny nicht wäre, darauf möchte ich glatt wetten. Und dann ist natürlich sie noch da.«
Mit »sie« meinte sie Mrs. Marline. Und ich war sicher, daß sie mit ihrer Vermutung recht hatte.
Als Estella das Kleid schließlich anhatte, mußte ich, wenngleich widerwillig, zugeben, daß sie sehr hübsch darin aussah.
Ich beobachtete vom Fenster aus, wie sie nach The Grange aufbrachen, und da kam mir eine verrückte Idee. Ich war zwar nicht eingeladen, aber das war kein Grund, nicht hinzugehen.
Ich war schon einmal auf dem Gelände von The Grange gewesen. Die Neugierde hatte mich damals getrieben. Es war an einem Nachmittag gewesen, als das Haus sehr ruhig dalag. Hätte man mich entdeckt, hätte ich gesagt, daß ich mich verlaufen habe. Man konnte durch eine Hecke, die die Koppel umgab, auf das Grundstück gelangen, und hinter den Koppeln war das Gebüsch, das den Rasen vor dem Haus säumte. Ich war durch die Hecke gekrochen und über die Koppel zu dem Gebüsch geflitzt, von wo ich einen guten Blick auf den Rasen und das Haus hatte.
Es war ein sehr elegantes Haus: aus grauem Stein, sehr alt, mit einem Türmchen an jedem Ende und einem großen Torbogen, der zu einem Innenhof führte. Von dem Gebüsch aus würde ich einen guten Blick auf die Teegesellschaft haben, ohne daß jemand meine Anwesenheit bemerkte.
Wenn ich auch kein Gast war, so sah ich doch nicht ein, weshalb ich mir die Gesellschaft nicht ansehen sollte. Als die anderen also fort waren, schlich ich mich aus dem Haus und befühlte meinen Glücksanhänger, um mich zu vergewissern, daß ich ihn bei mir hatte und ich trotz meines waghalsigen Unterfangens beschützt sein würde. Ich gelangte unentdeckt zu dem Gebüsch und hatte eine gute Sicht auf den Rasen. Einen weißen Tisch mit weißen Stühlen hatte man für das Beisammensein im Freien aufgestellt. Estella und Henry waren eingetroffen und zunächst ins Haus gebeten worden. Ich nahm an, daß sie bald herauskommen würden, begleitet von Lucian nebst Camilla und vielleicht dem blassen Hauslehrer.
Ich verkroch mich unter den Büschen. Ich durfte unter keinen Umständen gesehen werden und mußte den richtigen Augenblick abpassen, um zu verschwinden. Ich wollte durch das Gebüsch kriechen und dann den gefährlichen Abschnitt wagen, den Lauf über die Koppel zur Hecke. War ich erst durch diese geschlüpft, war ich in Sicherheit.
Und alles würde gutgehen, weil ich meinen Glücksanhänger bei mir trug. Ich hob beide Hände, um ihn zu berühren, und wurde von Entsetzen gepackt. Er war nicht da.
Einige Sekunden war ich vor Schreck wie gelähmt, so daß ich mich nicht rühren konnte. Ganz kurz zuvor hatte ich ihn noch gefühlt. Er mußte dasein. Ich träumte wohl. Es war ein Alptraum. Ich erhob mich, obwohl ich damit riskierte, gesehen zu werden. Wieder griff ich mir an den Hals. Kein Anhänger. Keine Kette. Wie konnte das passiert sein? Ich hatte den Verschluß fest zugemacht; darauf achtete ich immer. Ich schüttelte mein Kleid. Ich starrte auf die braune Erde. Von dem Anhänger keine Spur.
Er kann nicht weit sein, tröstete ich mich. Noch vor wenigen Minuten hast du ihn umgehabt. Ich kroch auf allen vieren und suchte. Er mußte heruntergefallen sein. Ich hatte mein kostbares Geschenk – Onkel Tobys Geschenk – und all mein Glück verloren.
Ich war untröstlich. Meine Wangen waren naß von Tränen.
Ich mußte ihn finden. Ich mußte. Ich kroch herum, suchte und suchte. Ich mußte den Weg zurückverfolgen, den ich gekommen war. Wußte ich genau, auf welchem Pfad ich die Koppel überquert hatte? Verzweiflung überkam mich. Ich setzte mich, schlug die Hände vors Gesicht und weinte.
Plötzlich spürte ich, daß jemand bei mir war.
»Was hast du?« fragte Lucian Crompton.
Ich vergaß, daß ich kein Recht hatte, in The Grange zu sein. Ich hatte keinen anderen Gedanken im Kopf als den, meinen kostbarsten Besitz verloren zu haben.
Ich stammelte: »Ich hab’ meinen Glücksanhänger verloren.«
»Deinen was?« rief er. »Wer bist du? Was machst du hier?« Ich beantwortete die Fragen der Reihe nach. »Den Anhänger, den mir Onkel Toby aus Hongkong mitgebracht hat. Auf dem steht ›viel Glück‹. Ich bin Carmel, und sie haben mich nicht zum Tee eingeladen, drum bin ich hergekommen, um zuzugucken.«
»Woher kommst du?«
»Vom Haus Commonwood.«
»Die sind heute hier.«
»Ja, aber ich nicht. Ich wollte bloß zugucken.«
»Oh, jetzt weiß ich. Du bist die Kleine, die ...«
Ich nickte. »Man hat mich unter dem Azaleenstrauch gefunden, der Tom Yardley mal ganz viel Kummer gemacht hat. Ich bin Carmel, das bedeutet Garten. Weil ich nämlich dort gefunden wurde.«
»Und du hast den Anhänger verloren?«
»Er hing noch um meinen Hals, als ich unter der Hecke durchgekrochen bin.«
»Welcher Hecke?«
Ich deutete über die Koppel.
»Auf diesem Weg bist du hierhergekommen?«
Ich nickte.
»Und da hast du ihn noch gehabt. Dann kann er ja nicht weit sein, oder? Er muß hier irgendwo sein.«
Ich fühlte mich ein bißchen getröstet. Er sprach so zuversichtlich.
»Schön, dann suchen wir ihn! Welchen Weg bist du gekommen?«
Ich zeigte in die Richtung.
»Gut, gehen wir. Du zeigst mir, wo du warst. Vier Augen sehen mehr als zwei. Halt du deine offen! Hier entlang! Paß auf, wo du hintrittst! Du willst ihn doch nicht zertreten, oder? Wie sieht er denn aus?«
»Er ist grün, und es steht ›viel Glück‹ drauf, in chinesischen Buchstaben.«
»Schön. Der dürfte nicht schwer zu finden sein.«
Wir kamen an den Rand des Gebüschs. Ohne Erfolg.
»So«, sagte er, »du bist über die Koppel gelaufen. Ich sehe, wo du durch die Hecke gekrochen bist. Die kleine Öffnung da drüben, nicht? Dort war es.«
Ich nickte.
»Dann müssen wir zu der Lücke. Halt die Augen offen, wenn wir über die Koppel gehen! Versuch, dich genau an den Weg zu erinnern, den du gekommen bist!«
Wir gingen in einigem Abstand bis zu der Hecke. Er kniete sich nieder und stieß einen Triumphschrei aus.
»Ist er das?«
Ich hätte vor Freude weinen können.
Er hielt den Anhänger mit der Kette in die Höhe und sagte: »Ah, ich sehe. Schau, der Verschluß ist kaputt! Deswegen hast du ihn verloren.«
»Kaputt«, sagte ich bestürzt, und meine Freude verflog. Er betrachtete den Verschluß genau. »Aha. Ein Glied ist aufgegangen. Das muß bloß wieder befestigt werden. Dem Verschluß selbst fehlt nichts. Aber das muß ein Juwelier machen. Higgs in der High Street repariert das im Nu. Dann ist die Kette wieder in Ordnung.«
Er gab mir den Anhänger an der Kette. Ich nahm ihn in die Hand, halb erfreut, halb betrübt. Ich hatte ihn nicht verloren, aber ich mußte ihn zu Higgs in der High Street bringen. Nanny würde es nicht erlauben. Ich mußte Estella oder Henry bitten, mir zu helfen. Vielleicht konnte Sally es tun.
Er beobachtete mich. Dann lächelte er. »Ich sag’ dir, was wir machen«, sagte er. »Nach dem Tee bring’ ich ihn zu Higgs, und er erledigt das gleich.«
»Willst du das wirklich tun?« rief ich.
»Ich wüßte nicht, warum nicht.«
»Nach dem ...«
»Ja, erst müssen wir Tee trinken. Komm!«
»Aber ich kann nicht ...«
»Ich hab’ dich eingeladen. Eines Tages gehört dieses Haus mir, und ich kann einladen, wen ich mag.«
»Nanny ...«
»Welche Nanny?«
»Nanny Gilroy. Sie wird sagen, es war nicht recht von dir, mich einzuladen. Wo man mich doch unter dem Azaleenstrauch gefunden hat. Nanny wird sagen, ich gehöre nicht ...«
»Wenn ich sage, du gehörst dazu, dann gehörst du dazu«, sagte er mit einer Großspurigkeit, die mich zum Lachen brachte.
Ich drückte meinen Anhänger an mich. Das Glück war wiedergekehrt.
So ging ich denn mit Lucian zum Rasen hinüber. Estella war baß erstaunt, Henry ebenso. Lucian berichtete ihnen von dem Anhänger, und Camilla wollte ihn sehen und etwas über die chinesischen Buchstaben hören, die »viel Glück« bedeuteten.
»Ist der hübsch!« sagte sie. »So einen hätte ich auch gerne.«
Ich strahlte vor Freude und war sehr glücklich.
Estella machte ein bestürztes Gesicht. Sie sagte: »Wißt ihr, Carmel, sie ... sie gehört nicht richtig zu uns.«
»O ja«, sagte Lucian. »Man hat sie unter dem Strauch gefunden. Sie hat es mir erzählt. Warum wurde sie nicht eingeladen?«
»Hm, ja ... Sie ist ein Findelkind«, sagte Estella.
»Wie lustig!« rief Camilla. »Klingt richtig aufregend. Wie bei Shakespeare oder im Märchen ...«
»Sie wurde unter einem Azaleenstrauch ausgesetzt.«
»Ja!« sagte Lucian. »Der dem armen Tom Yardley mal so viel Kummer gemacht hat.«
Er und Camilla sahen sich an und lachten.
Die beiden gefielen mir. Sie waren sehr freundlich. Ich vermutete, das kam daher, weil sie reich und bedeutend waren und es nicht nötig hatten, anderen klarzumachen, daß sie mehr waren, als sie schienen. Sie benahmen sich mir gegenüber, als sei ich ein weiterer Gast. Der Kuchen war delikat. Er war mit Kokosnußsplittern bestreut, und ich aß zwei Stück.
»Schmeckt er dir?« fragte Lucian und lächelte mich an, als ich mir das zweite Stück nahm.
»Köstlich.«
»Besser, als im Gebüsch herumzukriechen, was?«
Er und Camilla lachten, und ich sagte: »Viel besser.«
Sie schienen mich beide zu mögen, und sobald wir den Tee getrunken hatten, ging Lucian in den Stall und sagte dem Stallknecht, daß er mit dem Einspänner in die Stadt fahren und uns alle mitnehmen wolle. Lucian schien ungeheuer bedeutend zu sein, denn alle taten unverzüglich, was er sagte. Wir quetschten uns in den Einspänner, was sehr spaßig war. Lucian kutschierte, und ich saß neben ihm.
Dann betraten wir Mr. Higgs’ Geschäft, und Mr. Higgs bediente uns persönlich und sagte: »Guten Tag, Mr. Lucian! Womit kann ich dienen?«
»Bloß eine Kleinigkeit«, sagte Lucian. »Ein Glied an dieser Kette. Es muß nur befestigt werden, nehme ich an.«
Mr. Higgs sah sich die Kette an und nickte. »Jim wird das erledigen«, sagte er. »Dauert höchstens zwei Minuten. Muß nur am Ring befestigt werden. Jim! Mr. Lucian möchte das repariert haben. Siehst du, was fehlt?«
Jim nickte und verschwand.
»Gehört wohl dem kleinen Fräulein, der Anhänger?« fragte Mr. Higgs.
»Ja, ihr Onkel hat ihn ihr aus Hongkong mitgebracht.«
»Chinesisch, ja. Gute Handarbeit. Die machen interessante Sachen. Und wie ist das werte Befinden in The Grange?«
Lucian versicherte Mr. Higgs, daß alle bei bester Gesundheit seien, und ich bewunderte seine leichte Art, Konversation zu machen, während ich ungeduldig darauf wartete, meinen Anhänger wiederzubekommen.
Und da war er, genau wie vorher, und niemand würde ihm ansehen, daß ein Glied beschädigt gewesen war.
Lucian wollte bezahlen, doch Mr. Higgs sagte: »Oh, das kostet nichts, Mr. Lucian. Mußte doch bloß festgemacht werden. War Ihnen gerne gefällig.«
Lucian legte mir die Kette mit dem Anhänger um den Hals und machte die Schließe zu. »So«, sagte er, »der sitzt wieder fest.«
Und von jenem Augenblick an liebte ich ihn.
* * *
Nanny Gilroy war durchaus nicht erbaut, als sie von Estella hörte, daß ich an der Teegesellschaft teilgenommen hatte.
»Vorlaut«, bemerkte sie. »Hab’ ich’s nicht immer gesagt?«
Estella sagte: »Lucian hat sie mitgebracht. Er sah sie im Gebüsch, wo sie ihren Anhänger verloren hatte.«
»Anhänger! Was tut ein Kind in ihrem Alter mit einem Anhänger?«
»Onkel Toby hat ihn ihr geschenkt.«
Sie lächelte, wie sie es immer tat, wenn Onkel Tobys Name erwähnt wurde, und schnalzte mit der Zunge. Es war eindeutig, daß sie dachte, wenn er dafür verantwortlich war, könne es nicht so schlimm sein.
Als Estella und Henry das nächste Mal zum Tee eingeladen wurden, bat man auch mich dazu. Und allmählich wurde es mir zur Gewohnheit, nach The Grange zu gehen. Ich hatte Camilla gern. Sie gab mir niemals zu verstehen, daß sie mich den anderen für nicht ebenbürtig hielt. Und was Lucian betraf, so hatte ich das Gefühl, daß uns aufgrund des Erlebnisses mit dem Anhänger eine besondere Freundschaft verband.
So gedieh die Freundschaft zwischen Commonwood und The Grange. Der gemeinsame Hauslehrer hatte den Anfang gemacht. Dann kam Mrs. Marlines Entschluß, jene Geselligkeiten wieder aufleben zu lassen, deren sie sich erfreut hatte, bevor sie unter ihrem Stand geheiratet hatte. Sie tat alles, um Lady Cromptons Beifall zu finden, und widmete sich wohltätigen Werken, zumal solchen, an denen die Lady beteiligt war. Infolgedessen war auch Mrs. Marline in The Grange ein häufiger Gast.
So konnte Henry sich mit Lucian anfreunden und Estella mit Camilla. Wie gut, daß Töchter und Söhne der beiden Familien altersmäßig so gut zusammenpaßten! Ich wurde nicht ausgeschlossen, Lucian hatte stets ein besonders nettes Lächeln für mich. Zumindest bildete ich mir ein, daß es ein besonders nettes war. Wenn er einen Blick auf meinen Anhänger warf, den ich, sobald Nanny Gilroy außer Reichweite war, immer über dem Kleid trug, so wußte ich, daß er leicht amüsiert an unsere erste Begegnung zurückdachte. Das Leben war sehr vergnüglich.
Mrs. Marline war von jeher eine gute Reiterin gewesen, und wir erhielten alle Reitunterricht. Estella und Henry hatten ihre Ponys, mir hatte Onkel Toby eines besorgt, damit ich an den Stunden teilnehmen konnte. Was war er doch für ein wunderbarer Onkel! Und daß sich mein Schicksal so zum Guten verändert hatte, schrieb ich ihm zu.
Mir war allmählich klargeworden, welche Rolle Mrs. Marline im Hause spielte. Sogar Nanny Gilroy wurde in ihrer Gegenwart still und fügsam. Alle hatten großen Respekt vor ihr, auch der Doktor. Vielleicht müßte es richtiger heißen: besonders der Doktor.
Ich hörte Nanny Gilroy mit Mrs. Barton, der Köchin, über die Herrin reden.
»Sie ist ein rechter Drachen«, sagte Nanny. »Nie läßt sie den Doktor vergessen, mit wessen Geld die meisten Rechnungen bezahlt werden. Sie hat im Haus die Hosen an.«
»Er ist ein guter Mensch, der Doktor«, erwiderte Mrs. Barton. »Seine Patienten halten große Stücke auf ihn. Mrs. Gardiner sagt, sie hat Qualen gelitten mit ihrem Bein, bis sie zu ihm kam. Er ist wirklich ein feiner Herr ... auf seine Art.«
»Viel zu sanftmütig, wenn Sie mich fragen. Kann sich anscheinend nicht durchsetzen. Na ja, sie hat eben das Geld, und Geld hat das Sagen.«
»Da haben Sie recht«, sagte Mrs. Barton. »Der arme Doktor! Schätze, der hat nicht viel vom Leben.«
Mrs. Marline nahm nach wie vor kaum Notiz von mir. Es war, als wollte sie nichts davon wissen, daß ich da war. Mir machte das nichts aus, eigentlich war ich sogar ganz froh darüber. Ich hatte Onkel Toby und Sally, dazu jetzt auch noch Lucian und Camilla. Estella und Henry waren nicht übel, und Adeline hatte mich immer gern gehabt.
Am Ende des Sommers war das Zigeunerlager nicht mehr im Wald.
»Heute hier, morgen da«, sagte Nanny. »Gut, daß wir sie wieder los sind.«
Ich hätte die Zigeuner gerne verteidigt und Nanny daran erinnert, daß Rosie Perrin mein Bein verbunden und Jake mich nach Hause getragen hatte. Aber natürlich sagte ich nichts.
Dann wurde darüber geredet, daß Henry ins Internat kommen sollte: »Lucian von The Grange geht, da muß Master Henry auch gehen. Dieselbe vornehme Schule wird es wohl sein, schätze ich. Wo Lucian von The Grange hingeht, dahin geht auch Henry, verlaßt euch drauf! Ich kenne doch unsere Madam.«
»Wer sonst, wenn nicht Sie?« schmeichelte Mrs. Barton der Kinderfrau. Sie war sehr darauf erpicht, sich mit Nanny gut zu stellen, die im Haus als Autorität galt – an zweiter Stelle gleich nach Mrs. Marline.
Ich fand es sehr betrüblich, daß Lucian fortging. Er und Camilla kamen hin und wieder nach Commonwood zum Tee. Das waren ganz besondere Anlässe, und doch genoß ich sie nicht so wie die Einladungen nach The Grange. Mrs. Marline war beim Tee nicht direkt zugegen, hielt sich aber stets in der Nähe auf, ängstlich darauf bedacht, daß alles in bester Ordnung ablief und der Tee in Commonwood in jeder Beziehung jenem in The Grange gleichkam. Mich, glaube ich, hätte sie am liebsten ausgeschlossen, aber da Lucian darauf bestanden hatte, daß ich ihnen in The Grange Gesellschaft leistete, konnte sie mich kaum fernhalten.
Ihre Anwesenheit wurde mir immer bewußter. Sie hatte eine schrille, durchdringende Stimme und ein sehr herrisches Wesen, und sie klagte ständig über etwas, das getan oder nicht getan worden war. Sie stellte einen krassen Gegensatz zu dem sanftmütigen Doktor dar. Ich fragte mich, ob er deswegen so geworden war – so resigniert. Ich konnte mir vorstellen, daß sie auf jemanden wie den Doktor, dem daran gelegen schien, Schwierigkeiten um jeden Preis aus dem Weg zu gehen, eine solche Wirkung ausübte.
Es hat mich immer aufs neue erstaunt, wie unser Leben lange Zeit nach einer Art Schablone ablaufen kann, und dann ändert ein Ereignis alles, und was hernach geschieht, ist die Folge dieser einzigen Kleinigkeit, ohne die nichts, was später folgt, stattfinden würde.
Genauso geschah es in Haus Commonwood.
Mrs. Marline nahm mit Feuereifer an der Fuchsjagd teil, eine Leidenschaft, die sie mit den Cromptons teilte.