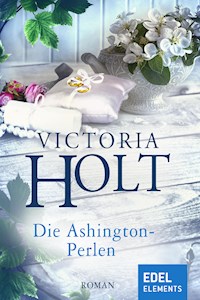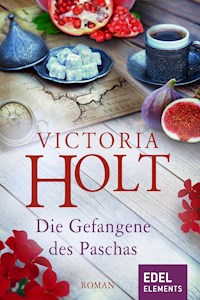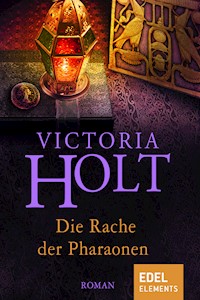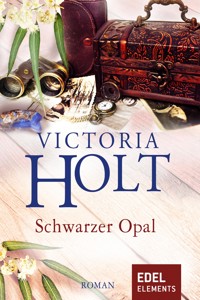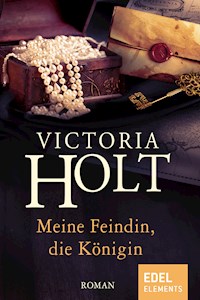
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Zwei Männer spielten im Leben Elisabeths I. von England als Günstlinge eine entscheidende Rolle. Und beide Männer waren aufs Engste mir Lettice, der berückend schönen Cousine der Königin, verbunden ... Victoria Holt erweckt die verführerische Pracht des Elisabethanischen Zeitalters zu neuem Leben. Der Kampf zwischen der Regentin und Ihrer attraktiven Rivalin enthüllt auch die Schattenseiten des höfischen Lebens, in dem Ehrgeiz und Intrigen eine dominierende Rolle spielten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 666
Ähnliche
Victoria Holt
Meine Feindin, die Königin
Roman
Ins Deutsche übertragen von Margarete Längsfeld
Edel eBooks
Inhalt
Die alte Dame in Drayton Basset
Im Exil
Ein königlicher Skandal
Die erste Begegnung
Die Jahre der Verbannung
Kenilworth
Die Offenbarung
Die Gräfin von Leicester
Verrat
Der Froschkönig
»Leicesters Commonwealth«
Abenteuer im Ausland
Siegreiches England
Leicesters Ende
Essex
Der Weg zum Schafott
Die alte Dame in Drayton Basset
Impressum
Die alte Dame in Drayton Basset
Tadle die Laute nicht!
Muß sie doch dies und jenes singen,
Was mir gefällt.
Ein geistlos Ding,
Muß sie sich meinen Weisen fügen.
Und klingt mein Lied auch fremd,
Und rühren seine Worte an deinen Wankelmut,
Tadle die Laute nicht!
Sir Thomas Wyatt, 1503–1542
Ich gehe jetzt nie mehr an den Hof. Ich bleibe zu Hause in Drayton Basset. Ich bin alt, und alten Damen ist es gestattet, dazusitzen und zu träumen. Die Leute sagen: »Mylady hält es lange aus. Wie alt mag sie sein? Kaum jemand wird so alt wie sie. Mylady wird, so scheint es, ewig leben.«
Manchmal glaube ich das selbst. Wer unter den Lebenden kann sich noch an jenen Novembertag des Jahres 1558 erinnern, als Königin Maria – die Leute nannten sie damals schon »die Blutige« – starb, ohne daß das Volk groß getrauert hätte, abgesehen von jenen Anhängern, die sich ängstlich fragten, was Marias Dahinscheiden für sie bedeuten mochte. Wie viele können sich noch daran erinnern, als Elisabeth, meine Verwandte, im ganzen Land zur Königin ausgerufen wurde? Ich jedenfalls weiß es noch ganz genau. Wir waren damals in Deutschland. Mein Vater hatte es für angebracht gehalten, aus dem Land zu fliehen, als Maria den Thron bestieg; denn für alle, die durch Geburt oder Religion mit der jungen Elisabeth verbunden waren, wurde das Leben damals gefährlich.
Er rief uns alle zusammen, und wir mußten niederknien und Gott danken; mein Vater war nämlich ein sehr frommer Mensch. Überdies war meine Mutter Elisabeths Cousine – die neue Königin würde also unserer Familie von Nutzen sein.
Ich war zu jener Zeit gerade siebzehn Jahre alt. Ich hatte viel von Elisabeth und von ihrer Mutter, der Königin Anna Boleyn, gehört. Die Mutter meiner Mutter war schließlich Annas Schwester, Mary, gewesen, und die Geschichten über die geistreiche, faszinierende Verwandte Anna machten einen großen Teil unserer Familienchronik aus. Als ich Elisabeth kennenlernte, wußte ich, was es mit dieser geistreichen Art auf sich hatte, denn auch Elisabeth war nicht geistlos – auf andere Weise zwar als ihre Mutter, aber sie besaß durchaus Geist. Sie hatte noch andere Vorzüge. Und ganz gewiß wäre sie niemals durch Henkershand gestorben, dafür war sie viel zu gescheit. Schon in frühester Jugend zeigte sich ihre natürliche Begabung, sich zu behaupten. Bei all ihrer Koketterie und ihrer blendenden Schönheit mangelte es ihr jedoch an der besonderen Ausstrahlung, die ihrer Mutter zu eigen gewesen sein muß, und die auch meine Großmutter Maria Boleyn – sie war so vernünftig, lediglich die Maitresse des Königs zu werden und nicht nach der Krone zu verlangen – in hohem Maße besessen hatte; und wenn ich bei der Wahrheit bleiben will, so muß ich ohne falsche Bescheidenheit sagen, daß ich diese Ausstrahlung von meiner Großmutter geerbt habe. Elisabeth hatte das bald entdeckt – es gab kaum etwas, das ihr verborgen blieb –, und deswegen haßte sie mich. Als sie auf den Thron gelangte, war sie voll guter Vorsätze, die einzuhalten, das muß ich zugeben, sie sich viel Mühe machte. Es gab in Elisabeths Leben nur eine große Liebe, und das war die Krone. Dennoch gestattete sie sich manches Liebesgetändel. Ihr gefiel das Spiel mit dem Feuer; doch im ersten Jahr ihrer Regierung verbrannte sie sich dabei so heftig, daß sie, wie ich glaubte, danach für immer entschlossen war, es nie wieder so weit kommen zu lassen. Niemals schien sie der großen Liebe ihres Lebens untreu werden zu wollen: dem glorreichen, funkelnden Symbol ihrer Macht – der Krone.
Ich konnte es mir nie versagen, Robert damit zu necken, selbst während unserer leidenschaftlichsten Begegnungen – und deren gab es viele. Dann wurde er schrecklich wütend auf mich, doch ich stellte mit Genugtuung fest, daß ich ihm mehr bedeutete als sie, abgesehen von ihrer Krone.
Wir drei – das war eine Herausforderung an das Schicksal. Die beiden, die sich stolz auf der Bühne zur Schau stellten, waren die glänzendsten Gestalten ihrer Zeit, die jedermann Ehrfurcht einflößten. Ich, die dritte in diesem Terzett, mußte mich oft im Hintergrund halten, doch stets gelang es mir, meine Gegenwart bewußt zu machen. So sehr sich Elisabeth auch bemühte, es glückte ihr nie, mich ganz auszuschließen. Dafür gab es auch niemanden am Hof, den die Königin so sehr haßte wie mich, und keine andere Frau vermochte bei ihr solch ein Gefühl überwältigender Eifersucht auszulösen. Sie wollte Robert haben, und er wurde der meine – aus freien Stücken. Wir drei wußten: Auch wenn sie ihn an der Macht hätte teilhaben lassen, an der er ebenso leidenschaftlich hing wie sie – die Frau, die er begehrte, war ich. In meinen Träumen sehe ich mich oft in jene Zeiten zurückversetzt. Ich spüre, wie mich eine heitere Erregung überkommt, und dann vergesse ich, daß ich eine alte Frau bin, sehne mich nach der Vereinigung mit Robert, nach dem Streit mit Elisabeth.
Aber sie ruhen schon lange in ihren Gräbern, und ich allein weile noch auf Erden.
Ich tröste mich damit, bei der Vergangenheit anzuklopfen und alles noch einmal zu erleben, und zuweilen frage ich mich, wieviel davon ich geträumt habe und was Wirklichkeit war.
Heute bin ich geläutert – die Lady vom Gut. Manche gehen in ein Kloster, wenn sie ein Leben wie ich geführt haben, sie bereuen ihre Sünden und beten zwanzigmal am Tag um Vergebung, in der Hoffnung, diese Frömmigkeit in letzter Minute werde ihnen einen Platz im Himmel sichern. Ich habe mich guten Werken gewidmet; ich bin die gütige Lady. Meine Kinder sterben, doch ich lebe weiter. Und jetzt bin ich darauf verfallen, die Ereignisse aufzuschreiben, so wie sie sich abgespielt haben, und das ist die beste Art, alles noch einmal zu erleben.
Ich will versuchen, ehrlich zu sein. Nur so kann ich die Vergangenheit lebendig machen. Ich will versuchen, uns so zu sehen, wie wir wirklich waren; als helleuchtendes Dreieck. Denn vom Glanz dieser beiden schillernden Gestalten – so blendend, daß sich oft die Sicht verdunkelte – mußte auf jedermann ein Schimmer fallen, auch auf mich, die ich für sie ebenso wichtig war – trotz all ihrer Macht – wie sie für mich. Von welchen Gefühlsbewegungen dieses Dreieck erschüttert wurde: von Roberts Liebe zu mir, durch die ich zur Rivalin der Königin wurde; ihren Haß auf mich, aus Eifersucht geboren und aus dem Wissen, daß ich ihm zu Gefallen sein konnte, wie sie es nie vermochte; ihren Wutausbrüchen, bei denen sie sich jedoch nie so weit gehen ließ, daß sie ihren Vorteil aus den Augen verlor. Wie sie mich verabscheute! »Diese Wölfin« nannte sie mich. Und andere taten es ihr nach, um ihr zu gefallen, nicht weil sie mich verachteten. Doch mir allein unter all den Frauen in ihrem Leben war es gegeben, sie Eifersucht und Qual spüren zu lassen, nur sie tat wiederum mir so Schlimmes an. Wir lagen in Fehde, und sie war im Vorteil. Ihre Macht stand gegen meine Schönheit, und ein Mann wie Robert wurde zwischen uns beiden hin und her gerissen.
Vielleicht hat sie gesiegt – wer weiß. Manchmal weiß ich es selbst nicht genau. Ich habe ihn ihr weggenommen, doch dann nahm sie ihn mir weg – und der Tod hat uns alle betrogen.
Sie hat Rache an mir genommen, bitterböse Rache. Doch ich habe, bin ich auch alt, noch genug Feuer und Leidenschaft in mir, um unsere Geschichte zu erzählen. Ich möchte mir selbst darüber klar werden, wie es geschehen ist. Ich möchte die Wahrheit über mich erzählen ... über die Königin und die beiden Männer, die wir geliebt haben.
Im Exil
Während in der Stadt ein Galgen neben dem anderen aufragt und die öffentlichen Gebäude mit den abgeschlagenen Häuptern der tapfersten Männer des Königreiches verunziert sind, liegt Prinzessin Elisabeth, der kein glücklicheres Schicksal bestimmt scheint, sieben oder acht Meilen von hier krank darnieder, so aufgeschwollen und entstellt, daß ihr Ableben zu befürchten ist.
Antoine de Noailles, französischer Gesandter, über eine von Elisabeths »Lieblingskrankheiten« zur Zeit der Wyatt-Rebellion
Ich wurde im Jahre 1541 geboren, fünf Jahre, nachdem Elisabeths Mutter hingerichtet worden war. Elisabeth war zu jener Zeit acht Jahre alt. Ein Jahr zuvor hatte der König eine andere Verwandte von mir, Katharina Howard, geheiratet. Die Ärmste! Im folgenden Jahr ereilte sie ein ähnliches Schicksal, wie es Anna Boleyn beschieden war, denn auch Katharina wurde auf Befehl des Königs enthauptet.
Man hatte mich nach meiner Großmutter väterlicherseits auf den Namen Letitia getauft, doch wurde ich stets Lettice genannt. Wir waren eine große Familie; ich hatte sieben Brüder und drei Schwestern. Meine Eltern waren liebevoll, oftmals aber auch streng, dies jedoch nur zu unserem Besten, wie uns immer wieder vor Augen gehalten wurde.
Meine frühe Kindheit verbrachte ich auf dem Landgut Rotherfield Greys, das der König meinem Vater in Anerkennung seiner Dienste etwa drei Jahre vor meiner Geburt zugesprochen hatte. Mein Vater hatte den Besitz zwar von seinem Vater geerbt, doch der König hatte die Gewohnheit, jedes Herrenhaus, das ihm gefiel, für sich in Beschlag zu nehmen – Hampton Court war das Paradebeispiel für diese königliche Habgier –, so daß es beruhigend war zu wissen, daß er den Anspruch meines Vaters auf unser eigenes Hab und Gut anerkannte.
Mein Vater war im Auftrage des Königs häufig von zu Hause abwesend, meine Mutter jedoch ging selten an den Hof. Es mochte wohl sein, daß ihre nahe Verwandtschaft zu des Königs zweiter Gemahlin in Heinrich hätte Erinnerungen wecken können, ohne die er sich wohler fühlte. Man konnte auch kaum erwarten, daß ihm ein Mitglied der Familie Boleyn willkommen sein würde. So lebten wir zurückgezogen, und in den Tagen meiner Kindheit war ich’s zufrieden. Erst als ich heranwuchs, wurde ich rastlos und konnte es kaum erwarten fortzukommen. Die Unterrichtsstunden in dem Schulzimmer mit seinen bleigefaßten Scheiben, den Sitzbänken in den tiefen Fensternischen und dem langen Tisch, an dem wir über unsere Arbeit gebeugt saßen, kamen mir endlos vor. Meine Mutter besuchte uns und unsere Lehrer häufig im Schulzimmer, um sich unsere Bücher anzusehen und über unsere Fortschritte berichten zu lassen. Ließen diese zu wünschen übrig, so wurden wir ins Solarium gerufen – es lag im obersten Geschoß unseres Hauses und ließ die Sonne voll ein –, wo wir uns mit einer Handarbeit beschäftigen mußten, und dann einen Vortrag über die Bedeutung der Bildung bei Leuten unseres Standes zu hören bekamen. Unsere Brüder nahmen nicht am Unterricht teil. Wie es damals Sitte war, sollten sie in den Häusern anderer vornehmer Familien aufwachsen und dort erzogen werden, bis die Zeit da war, daß sie nach Oxford oder Cambridge gehen konnten. Henry war bereits von zu Hause fort, die anderen, William, Edward, Robert, Richard und Francis, waren noch zu jung, und Thomas war noch ein Säugling. Während dieser Unterrichtsstunden hörte ich mit meinen Schwestern Cecilia, Catherine und Anne erstmals von Elisabeth. »Meine Cousine ersten Grades«, so sprach meine Mutter stolz von ihr. Elisabeth, wurde uns vorgehalten, sei für uns alle ein Vorbild, dem wir nacheifern sollten. Schon im Alter von fünf Jahren, so schien es, war sie im Lateinischen fast so bewandert wie ein Gelehrter, mit dem Griechischen so vertraut wie mit dem Englischen, und selbstverständlich sprach sie fließend französisch und italienisch. Welch ein Unterschied zu ihren Cousinen, deren Gedanken bei diesen wichtigen Fächern abschweiften, die zum Fenster hinausblickten, statt ihre Augen auf die Bücher zu richten, so daß ihren armen Lehrern nichts anderes übrig blieb, als sich bei der Mutter über ihr Unvermögen und ihre Unaufmerksamkeit zu beschweren.
Ich war bekannt dafür, daß ich alles sofort aussprach, was mir durch den Kopf ging, und so erklärte ich: »Elisabeth ist bestimmt langweilig. Ich möchte wetten, wenn sie Latein kann und all die anderen Sprachen, dann kennt sie sonst gar nichts.«
»Ich verbiete dir, noch einmal so von Lady Elisabeth zu sprechen«, rief meine Mutter. »Weißt du überhaupt, wer sie ist?«
»Sie ist die Tochter des Königs und der Königin Anna Boleyn. Das hast du uns oft genug erzählt.«
»Begreifst du denn nicht, was das bedeutet? Sie ist von königlichem Blut, und es ist nicht undenkbar, daß sie eines Tages Königin wird.«
Wir hörten zu, weil sich unsere Mutter nur zu leicht verleiten ließ, den Zweck unserer Anwesenheit im Solarium zu vergessen und von den Tagen ihrer Kindheit zu erzählen. Das war für uns Mädchen dann freilich unterhaltsamer als ein Vortrag über die Notwendigkeit, unsere Gedanken im Unterricht beisammenzuhalten, und wenn sie von ihren eigenen Worten mitgerissen wurde, bemerkte sie nicht, daß unsere Hände müßig im Schloß lagen.
Wie jung waren wir doch! Wie unerfahren! Ich muß sechs Jahre alt gewesen sein, als ich anfing, die Welt wahrzunehmen. Zu der Zeit waren die Tage der Herrschaft des alten Königs bereits gezählt.
Meine Mutter sprach nicht von der Gegenwart, da dies hätte gefährlich sein können, sondern von der glorreichen Vergangenheit in Hever, als man sie als Kind aufs Schloß mitnahm, um ihre Großeltern zu besuchen. Das waren die ruhmreichen Zeiten, als sich das Vermögen der Boleyns rasch vermehrte, was kein Wunder war, da sie doch eine Königin in der Familie hatten. »Ich habe sie ein- oder zweimal gesehen«, sagte meine Mutter. »Ich werde sie nie vergessen. Sie wirkte damals irgendwie ungezähmt, wild. Es war nach Elisabeths Geburt; Anna hatte sich verzweifelt einen Sohn gewünscht. Nur ein männlicher Erbe hätte sie retten können. Mein Oheim George war dort in Hever – einer der ansehnlichsten Männer, die ich je gesehen habe ...« Trauer lag in ihrer Stimme; wir drangen nicht in sie, uns von Oheim George zu berichten. Wir wußten aus Erfahrung, daß eine solche Bitte der Erzählung ein Ende bereiten und meine Mutter daran erinnern konnte, daß sie zu uns von Dingen sprach, die jenseits des kindlichen Begriffsvermögens lagen. Zur rechten Zeit entdeckten wir, daß der stattliche Oheim George zur gleichen Zeit wie seine Schwester hingerichtet worden war – man hatte ihn des Inzests mit ihr bezichtigt. Die Anschuldigung war natürlich falsch; der König wollte sich Annas nur entledigen, um Jane Seymour heiraten zu können.
Ich habe oft zu Cecilia gesagt, es sei aufregend, zu einer Familie wie der unseren zu gehören. Der Tod war uns bereits in der Kinderstube vertraut, Kinder – vor allem Kinder unseres Standes – dachten ganz unbekümmert ans Sterben. Wenn wir die Familienportraits betrachteten, so hieß es: »Der hier verlor seinen Kopf: Er war uneins mit dem König.« Daß Köpfe dort, wo sie hingehörten, sehr gefährdet waren, war eine Tatsache, die man eben hinzunehmen hatte. Doch im Solarium ließ unsere Mutter Hever lebendig werden, mit seinem Burggraben und dem Fallgitter, dem Innenhof und der Halle, wo der König oft getafelt hatte, und mit der langen Galerie, wo er unserer berühmten Verwandten, der bezaubernden Anna, den Hof gemacht hatte. Meine Mutter sang uns die Lieder vor, welche die Spielleute dort vorgetragen hatten – einige hatte der König selbst komponiert –, und wenn sie auf ihrer Laute präludierte, strahlte aus ihren Augen die Erinnerung an den kurzen und blendenden Ruhm der Boleyns.
Großvater Thomas Boleyn lag nun in der Kirche von Hever begraben, doch unsere Großmutter Mary kam uns hin und wieder besuchen. Wir waren alle in unsere Großmutter vernarrt. Es fiel uns zuweilen schwer, uns vorzustellen, daß sie einst die Maitresse des alten Königs gewesen war. Sie war nicht eigentlich schön, doch besaß sie jene gewisse Eigenschaft, die ich zuvor erwähnte, und die ich von ihr geerbt habe. Ich merkte sehr bald, daß ich diesen Vorzug besaß, und das beglückte mich, wußte ich doch, daß mir dadurch vieles, was ich mir wünschte, geschenkt werden würde. Erklären ließ sich diese Eigenschaft kaum – es ist eine Ausstrahlung, welche das andere Geschlecht unwiderstehlich findet. Bei meiner Großmutter Mary war es Sanftheit, die Verheißung, sich leicht zu ergeben. Nicht so bei mir. Ich zeigte mich aber berechnend, auf meinen Vorteil bedacht. Gleichwohl verfügten wir beide über diese Eigenschaft. Nach und nach erfuhren wir von jenem traurigen Tag im Mai, als das Turnier in Greenwich stattfand und Anna mit ihrem Bruder und ihren Freunden im Tower gefangengesetzt wurde. Sie verließ ihn erst wieder, als man sie zum Schafott führte. Wir erfuhren, daß der König unmittelbar danach Jane Seymour heiratete und daß ihm sein einziger legitimer Sohn geboren wurde: Edward, der im Jahre 1547 den Thron bestieg.
Die arme Jane Symour starb bei der Geburt und konnte ihren Triumph nicht auskosten, doch der kleine Prinz blieb am Leben und war die Hoffnung des Landes. Danach folgte des Königs kurze Ehe mit Anna von Cleve und nach der plötzlichen Auflösung dieser Verbindung die unglückselige Vermählung mit Katharina Howard. Seine letzte Frau aber, Katharina Parr, überlebte ihn. Es hieß, sie hätte sicher dasselbe Schicksal erlitten wie Anna Boleyn und Katharina Howard, wäre sie nicht eine so gute Krankenschwester gewesen, hätte des Königs eiterndes Bein nicht so geschmerzt und wäre er nicht schon so betagt gewesen, daß er sich nicht mehr viel aus Frauen machte.
So begann denn die Regierungszeit eines neuen Königs: die Edwards VI. Als unser junger König die Thronfolge antrat, war er erst zehn Jahre alt – kaum älter als ich-, und Elisabeth, das leuchtende Vorbild, war vier Jahre älter als er. Ich entsinne mich, wie mein Vater, recht zufrieden mit dem Gang der Ereignisse, nach Rotherfield Greys kam. Edward Seymour, der Oheim des jungen Königs, hatte den Titel eines Herzogs von Somerset verliehen bekommen und war zum Lord Protector ernannt worden, und dieser nun äußerst einflußreiche Herr war Protestant und würde seinen jungen Neffen in diesem neuen Glauben unterweisen.
Mein Vater neigte mehr und mehr dem Protestantismus zu, und wie er meiner Mutter gegenüber bemerkte, wäre es das größte Unheil, das dem Lande – und besonders der Familie Knollys – widerfahren könnte, wenn die Katholiken Maria, des Königs älteste Tochter, die Katharina von Aragon ihm geboren hatte, den Thron besteigen würde.
»Dann«, so prophezeite mein Vater, »röten sich die Schafotte mit dem Blut der edelsten englischen Männer und Frauen, und die entsetzliche Inquisition, die in Spanien ihren Höhepunkt erreicht hat, wird auch in unserem Lande Einzug halten. Also laßt uns Gott für den jungen König danken und darum bitten, daß durch Seine Gnade und Güte Edward VI. lange über uns herrschen möge.«
So knieten wir nieder und beteten – eine Sitte, der man, wie ich bereits damals fand, in unserer Familie allzu eifrig huldigte –, während mein Vater Gott für Seine Güte gegenüber England dankte und Ihn bat, auch weiterhin für das Land zu sorgen und besonders über die Familie Knollys zu wachen.
Das gewohnte Dasein ging noch einige Jahre unverändert weiter; wir lebten, wie es beim Landadel üblich war, und unsere Erziehung machte Fortschritte. In unserer Familie war es Tradition, daß auch den Töchtern eine gute Bildung zuteil wurde, wobei man auf Musik und Tanz besonderen Wert legte. Man lehrte uns, Laute und Harfe zu spielen, und wenn bei Hofe ein neuer Tanz eingeführt wurde, so mußten wir ihn erlernen. Unsere Eltern wollten unbedingt, daß wir vorbereitet waren, falls wir plötzlich an den Hof berufen würden. In der Galerie sangen wir Madrigale, oder wir spielten dort auf unseren Instrumenten.
Um elf Uhr aßen wir in der großen Halle zu Mittag, und wenn wir Gäste hatten, pflegten wir bis drei Uhr nachmittags beim Mahl zu sitzen, um der Unterhaltung zu lauschen. Diese Gespräche fesselten mich, denn während der Regierungszeit des jungen Edward wuchs ich heran und nahm regen Anteil an allem, was außerhalb von Rotherfield Greys vorging. Um sechs nahmen wir das Abendessen ein. Die Tafel war stets reichlich gedeckt, und es herrschte jedesmal eine gewisse Spannung, weil wir nie genau wußten, wer uns diesmal Gesellschaft leisten würde. Wie die meisten Familien unseres Standes führten wir ein offenes Haus, denn mein Vater wollte nicht, daß man dachte, wir könnten uns Gastfreundschaft nicht leisten. Es gab Rinder- und Hammelbraten, alle Arten von Fleischpasteten, Wild und Fisch mit Sauce, dazu eingemachte Früchte, Marzipan, Ingwer- und Zuckerbrot. Blieb etwas übrig, so aßen es die Dienstboten, und den Rest erhielten die Bettler an den Toren, die – wie meine Mutter ständig bemerkte – sich tausendfach vermehrt hatten, seit König Heinrich die Klöster aufgelöst hatte.
Am Weihnachtsfest vergnügten wir Kinder uns, indem wir uns verkleideten und Spiele aufführten. Es herrschte große Aufregung, wer von uns den silbernen Penny in dem großen Kuchen, der zum Dreikönigsfest gebacken wurde, finden und König oder Königin des Tages werden würde. Und in aller Unschuld glaubten wir, es würde ewig so weitergehen.
Hätten wir schon mehr Verstand besessen, die bösen Anzeichen wären uns natürlich nicht entgangen. Meinen Eltern blieben sie nicht verborgen, und das Gesicht meines Vaters war deshalb oftmals sehr ernst. Der König kränkelte, und sollte ihm etwas zustoßen, war diese Maria, die wir – und nicht wir allein – so sehr fürchteten, die Thronerbin. John Dudley, Herzog von Northumberland, der sich zum eigentlichen Herrscher Englands aufgeschwungen hatte und der mächtige Mann im Staate war, teilte die Besorgnis meines Vaters. Wenn Maria auf den Thron kam, so bedeutete das Dudleys Ende, und da dieser keinen Wert darauflegte, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen oder gar sein Haupt auf den Richtblock zu legen, schmiedete er verschwörerische Pläne.
Ich hörte, wie meine Eltern sich darüber unterhielten, und mir war klar, daß ihnen sehr beklommen zumute war. Mein Vater war ein äußerst gesetzestreuer Mann, und er konnte nicht umhin, die Tatsache anzuerkennen, daß die Mehrheit des Volkes in Maria die wahre Thronfolgerin sah. Dies war eine heikle Situation. War nämlich Maria legitim, so konnte es Elisabeth nicht sein. Marias Mutter war verstoßen worden, als der König, da er Anna Boleyn zu ehelichen begehrte, seine Ehe mit Katharina von Aragon, die länger als zwanzig Jahre gewährt hatte, für ungültig hatte erklären lassen. War aber seine Ehe mit Katharina dennoch gültig, so konnte es folgerichtig die Verbindung mit Anna Boleyn nicht sein, und dann war Annas Tochter Elisabeth ein Bastard. Aus Loyalität gegenüber den Boleyns und in dem Wunsch, es zu etwas zu bringen, mußte meine Familie natürlich dafür sein, daß die erste Ehe des Königs ungültig war; da mein Vater aber in den meisten Angelegenheiten sehr folgerichtig dachte, fiel es ihm vermutlich einigermaßen schwer, seinen Glauben an Elisabeths Legitimität aufrechtzuerhalten. Meiner Mutter gegenüber äußerte er, daß seiner Meinung nach der Herzog von Northumberland versuchte, Lady Jane Grey auf den Thron zu bringen. Diese hatte freilich durch ihre Großmutter, die Schwester Heinrichs VIII., einen gewissen Anspruch, doch den würden die wenigsten akzeptieren. Die streng katholischen Cliquen im ganzen Land würden fest zu Maria stehen. So nahm es kaum Wunder, daß die Krankheit des jungen Königs Edward meinen Vater mit höchster Besorgnis erfüllte.
Dessenungeachtet stellte er sich nicht auf Northumberlands Seite. Wie sollte er, der mit einer Boleyn verheiratet war, jemand anderen als die Prinzessin Elisabeth unterstützen? Und alsToch-ter des Königs rangierte Elisabeth gewiß vor Lady Jane Grey. Unglücklicherweise war da eben noch diese Maria, Tochter einer spanischen Prinzessin, strenggläubige Katholikin und des Königs älteste Tochter.
Damals hieß es also auf der Hut sein. Der Herzog von Northumberland hatte völlig auf Jane Grey gesetzt, indem er sie mit seinem Sohn, Lord Guildford Dudley, vermählte.
So standen die Dinge im letzten Jahr der Regierung des jungen Königs. Ich war damals zwölf Jahre alt. Meine Schwestern und ich interessierten uns sehr für den Klatsch, der uns von den Dienstboten zugetragen wurde, vor allem für jedwedes Gerede, das unsere erhabene Cousine Elisabeth betraf. Dies vermittelte uns ein ganz anderes Bild von ihr als jenes, das unsere Mutter entwarf mit der Schilderung der gelehrigen Griechisch- und Lateinschülerin, jenem strahlenden Vorbild für ihre weniger tugendhaften und weniger lerneifrigen Cousinen der Familie Knollys.
Nach dem Tode König Heinrichs VIII. lebte sie bei ihrer Stiefmutter Katharina Parr in deren Witwensitz in Chelsea; Katharina Parr heiratete später Thomas Seymour, einen der stattlichsten und anziehendsten Männer in ganz England.
»Man sagt«, erzählte uns jemand von den Dienstboten, »daß er eine Vorliebe für Prinzessin Elisabeth hat.«
Ich war stets begierig auf das, was »man« sagte. Eine Menge davon beruhte natürlich auf Vermutungen und dürfte als bloßes Geschwätz abgetan werden, doch ich glaube, daß oftmals ein Körnchen Wahrheit darin steckte. »Man« sprach also von aufregenden »Vorgängen« im Witwensitz, von einer gewissen Beziehung zwischen Elisabeth und dem Ehemann ihrer Stiefmutter, einer Beziehung, die weder ihrer Stellung noch ihrer Würde angemessen war. Er kam zu ihr ins Schlafzimmer geschlichen und kitzelte sie, wenn sie im Bett lag. Sie rannte schreiend und lachend vor ihm davon, doch dies Schreien war zugleich eine Aufforderung. Als Elisabeth einmal mit einem neuen seidenen Kleid im Garten erschien, ergriff er, von seiner Gattin dazu ermuntert, eine Schere und zerschnitt ausgelassen das Kleid in lauter Fetzen.
»Arme Katharina Parr«, sagte »man«. Ob sie die wahre Natur dieser Person begriff? Natürlich wußte sie Bescheid, und um dem Ganzen einen Anschein von Schicklichkeit zu verleihen und die Ungehörigkeit zu überdecken, beteiligte sie sich daran. Ich ergötzte mich an der Vorstellung, wie die gelehrte Elisabeth in ihrem Schlafzimmer herumgejagt wurde oder wie man ihr das Kleid in Stücke schnitt, wie Seymour sie fröhlich mit glitzernden Augen kitzelte, während seine schwangere Gattin vorzugeben versuchte, dies sei ein heiterer Familienscherz.
Schließlich aber erwischte Katharina Parr ihren liebestollen Gatten, als er die junge Prinzessin alles andere als verwandtschaftlich küßte, und nun konnte auch sie den Anschein der Harmlosigkeit nicht mehr aufrechterhalten. Elisabeth mußte daraufhin den Witwensitz verlassen. Der Skandal war natürlich unvermeidlich. »Man« ließ nicht locker, und es ging das Gerücht, die Prinzessin sei von einem kleinen Mädchen edlen Geblüts entbunden worden: Thomas Seymours Tochter.
Dies wurde entschieden in Abrede gestellt und es war ja auch wirklich höchst unwahrscheinlich. Doch wie interessant war es für uns Mädchen, die wir all die Jahre im Schatten von Elisabeths Tugenden gelebt hatten.
Nicht lange danach wurde Thomas Seymour, der sich in ehrgeizige politische Machenschaften verstrickt hatte, vor Gericht gestellt und enthauptet. Unterdessen verschlimmerte sich der Gesundheitszustand des armen kleinen Königs mehr und mehr. Dudley veranlaßte den sterbenden Knaben, ein Testament zu machen, in dem sowohl Maria wie Elisabeth übergangen wurden und Lady Jane Grey als alleinige Thronerbin eingesetzt wurde. Diese war ja inzwischen mit Lord Guildford Dudley vermählt. Ich dachte in der folgenden Zeit oftmals darüber nach, wie leicht Guildfords Bruder Robert Lady Janes Bräutigam hätte werden können. Robert freilich hatte bereits die Torheit begangen – falls man angesichts dessen, was später geschah, überhaupt von einer Torheit sprechen konnte –, im Alter von siebzehn Jahren die Tochter von Sir John Robsart zu ehelichen. Er wurde ihrer natürlich bald überdrüssig, doch das ist eine andere Geschichte. Später wurde mir oft mit Entsetzen bewußt, daß ohne Roberts Ehe mein Leben – und das von Elisabeth Tudor – entschieden anders verlaufen wäre. Robert hätte auch gewiß als der bei weitem Angemessenere gegolten, denn Guildford war schwach und sah auch nicht so gut aus. Robert dagegen muß schon in seiner Jugend außergewöhnlich gewesen sein. Später wurde er bei Hofe rasch der strahlendste Stern im Gefolge der Königin und das blieb er bis zu seinem Tode. Das Schicksal aber hatte es wie so oft gut mit Robert gemeint, und so war es der arme Guildford, sein jüngerer Bruder, welcher der Gatte der unglücklichen Lady Jane Grey wurde.
Wie jedermann weiß, brachte Northumberland nach dem Tode des Königs Lady Jane auf den Thron, doch die Ärmste regierte nur neun Tage, dann siegten Marias katholische Anhänger.
Mein Vater mischte sich in den Konflikt nicht ein. Wie sollte er auch? Marias Thronbesteigung, mochte sie legitim sein oder nicht, mußte sich für ihn unheilvoll auswirkten, doch andererseits konnte er auch nicht die protestantische Jane unterstützen. Es gab nur eine einzige, die er auf dem Thron sehen wollte. So tat er das, was kluge Männer in solchen Zeiten zu tun pflegten: Er zog sich vom Hofe zurück und ergriff für keine Seite Partei. Als uns klar wurde, daß Janes kurze Herrschaft vorüber war, und als sie mit Guildford Dudley, seinem Vater und seinem Bruder Robert im Tower eingekerkert wurde, rief mein Vater uns in der großen Halle zusammen, um uns zu eröffnen, daß wir in England nicht mehr sicher seien. Für Protestanten würden keine guten Zeiten kommen; Prinzessin Elisabeth befinde sich in seiner wahrhaft bedenklichen Lage, und da wir bekanntermaßen ihre Verwandten seien, sei er zu dem Schluß gekommen, die klügsten Schritte, die man unternehmen könne, seien diejenigen, die uns aus England hinaus führten.
Innerhalb weniger Tage waren wir auf dem Weg nach Deutschland.
Wir blieben fünf Jahre in Deutschland. Als ich vom Kind zur Frau wurde, erfaßte mich eine große Unruhe und Unzufriedenheit. Es ist ein hartes Los, aus der Heimat verbannt zu sein. Wir alle litten darunter, am meisten meine Eltern, doch sie schienen in der Religion Zuflucht zu finden. Mein Vater, der schon immer stark zum Protestantismus geneigt hatte, war am Ende seines Aufenthaltes in Deutschland einer der überzeugtesten Anhänger dieses Bekenntnisses. Die Nachrichten aus England bestärkten ihn in seinem Glauben. Die Vermählung von Königin Maria mit König Phillip von Spanien löste tiefe Verzweiflung bei ihm aus.
»Jetzt«, sagte er, »wird die Inquisition nach England kommen.« Glücklicherweise kam es nicht soweit.
»Eines steht fest«, pflegte er zu uns zu sagen – wir bekamen ihn natürlich häufiger zu sehen als in England, wo er ständig mit den Angelegenheiten des Hofes beschäftigt war –, »in seiner Unzufriedenheit mit der Königin wird sich das Volk Elisabeth zuwenden. Doch inzwischen steht zu befürchten, daß Maria ein Kind bekommt.«
Wir beteten, sie möge unfruchtbar bleiben, und ich fand es eine Ironie des Schicksals, daß sie ebenso inbrünstig um das Gegenteil flehte.
»Ich bin gespannt«, sagte ich leichthin zu meiner Schwester Cecilia, »wessen Bitte bevorzugt behandelt wird. Man sagt, Maria sei sehr fromm, aber das ist unser Vater auch. Ich möchte wissen, auf wessen Seite Gott steht, auf der katholischen oder der protestantischen.«
Meine Schwestern waren über meine Worte entsetzt und meine Eltern erst recht.
Mein Vater sagte immer: »Lettice, du mußt deine Zunge im Zaum halten.«
Ich dachte aber gar nicht daran. Diese Bemerkungen machten mir Spaß, und sie taten gewiß ihre Wirkung auf andere Menschen. Sie waren bezeichnend für mich und gehörten zu mir – wie meine glatte Haut mit den zarten Farben. Das unterschied mich von anderen Mädchen und machte mich besonders anziehend.
Mein Vater wurde nicht müde, sich zu seiner Klugheit zu beglückwünschen, die ihn aus dem Lande hatte fliehen lassen, solange es noch möglich war, obschon Maria nach ihrer Thronbesteigung zunächst schien Milde walten zu lassen. Lady Janes Vater, den Herzog von Suffolk, entließ sie aus der Haft, und das Todesurteil für Northumberland, den Puppenspieler, der die arme Jane und den bedauernswerten Guilford an seinen Fäden tanzen und ganze neun Tage lang Königin und Prinzgemahl hatte sein lassen, unterzeichnete sie erst nach längerem Zögern. Wäre die Wyatt-Rebellion nicht gewesen, so hätte Maria vielleicht auch Jane verschont, denn sie wußte sehr wohl, daß es bestimmt nicht der Wunsch des jungen Mädchens gewesen war, die Krone zu tragen.
Als uns die Nachricht von Wyatts unseligem Aufstand in Deutschland erreichte, wurde unsere Familie von tiefer Niedergeschlagenheit ergriffen. Prinzessin Elisabeth selbst schien in die Sache verwickelt zu sein.
»Das ist das Ende«, stöhnte mein Vater.
Er kannte Elisabeth nicht. Jung wie sie war, verstand sie sich bereits auf die Kunst des Überlebens. Jene Possen mit Seymour, die für ihn unterm Henkersbeil endeten, hatten ihr einen guten Anschauungsunterricht verschafft. Als man sie des Verrats beschuldigte, erwies sie sich als listig, und es war ihren Richtern unmöglich, sie zu überführen. Sie parierte die Anklagen mit diplomatischem Geschick, so daß ihr niemand etwas beweisen konnte.
Wyatt starb auf dem Schafott, doch Elisabeth entrann der Verurteilung. Eine Weile war sie gleichzeitig mit Robert Dudley im Londoner Tower gefangen. Welch eine Bindung das zwischen ihnen schuf, sollte ich noch entdecken. Später hörten wir, daß sie nach vielen Monaten aus dem fürchterlichen Tower entlassen und nach Richmond gebracht wurde, wo man sie ihrer Stiefschwester, der Königin, vorführte und von deren Plan unterrichtete, sie mit Philibert Emanuel, dem Herzog von Savoyen, zu vermählen.
»Man will sie aus England vertreiben«, rief mein Vater aus. »Das ist, bei Gott, völlig klar.«
Gewitzt wie immer, schlug die junge Prinzessin die Partie aus. Sie besaß die Verwegenheit, ihrer Stiefschwester zu verstehen zu geben, daß sie nicht heiraten könne. Elisabeth wußte stets, wie weit sie gehen durfte, und irgendwie gelang es ihr, Maria davon zu überzeugen, daß ihr die Ehe mit welchem Mann auch immer zuwider war.
Als sie in der Obhut des der Königin treu ergebenen Sir Henry Bedingfield nach Woodstock geschickt wurde, atmete die Familie Knollys auf, zumal ständig Gerüchte über Marias schlechten Gesundheitszustand aufs Festland drangen.
Es erreichten uns aber auch schlimme Nachrichten über die unerbittliche Verfolgung der Protestanten in England. Cranner, Ridley und Latimer wurden mit dreihundert anderen Opfern auf dem Scheiterhaufen verbrannt, und man erzählte sich, daß der Rauch der Feuer von Smithfield wie ein schwarzes Leichentuch über London hing.
Wie priesen wir unseres Vaters Weisheit! Wer weiß – wären wir geblieben, so wäre auch uns möglicherweise ein solches Schicksal zuteil geworden.
Es könne nicht so weitergehen, sagte mein Vater. Das Volk habe genug von Tod und Verfolgung. Das ganze Volk sei zum Aufstand gegen die Königin und ihre spanischen Anhänger bereit. Doch dann hörten wir, daß Maria schwanger sei, und wir waren verzweifelt. Ihre Hoffnung – »Gott sei Lob und Dank«, sagte mein Vater – erwies sich jedoch bald als unbegründet. Die arme, kranke Maria! Sie wünschte sich so sehr ein Kind, daß sie alle Anzeichen einer Schwangerschaft bei sich hervorrufen konnte, ohne empfangen zu haben.
Doch wir, die wir so schamlos ihren Tod herbeisehnten, brachten wenig Mitleid mit ihr auf.
Ich erinnere mich noch gut an den nebligen Novembertag, als der Bote mit der Nachricht kam. Auf diesen Tag hatten wir gewartet. Ich war damals siebzehn Jahre alt. Nie zuvor hatte ich meinen Vater so aufgeregt gesehen.
In der Halle rief er aus: »Gepriesen sei der Tag! Königin Maria ist tot. Elisabeth ist durch des Volkes Willen zur Königin von England ausgerufen worden. Lang lebe unsere Königin Elisabeth!«
Wir knieten nieder und dankten Gott. Dann machten wir uns eiligst an die Vorbereitungen für unsere Rückkehr.
Ein königlicher Skandal
Man verdächtigt mich, doch wird man mir nichts nachweisen können. Dies sagt Elisabeth, eine Gefangene.
Von Elisabeth mit einem Diamanten in eine Fensterscheibe in Woodstock geritzt, bevor sie Königin wurde.
Wir kamen rechtzeitig zu ihrer Krönung zurück. Das war ein Tag! Die Leute jubelten und versicherten sich gegenseitig, daß sie guten Zeiten entgegengingen. Der Geruch nach dem Rauch der Scheiterhaufen von Smithfield schien zwar noch immer in der Luft zu hängen, doch das erhöhte den Freudentaumel eher. Die blutige Maria war tot, und Elisabeth die Gute regierte unser Land.
An jenem Tag im Januar, um zwei Uhr nachmittags, sah ich sie zum Tower ziehen. Sie trug die Prachtrobe der Königin und sah in ihrer mit karmesinrotem Samt ausgeschlagenen Karosse, über die ihre Ritter einen Baldachin hielten, wahrhaft königlich aus. Einer dieser Ritter war Sir John Perrot, ein Mann von stattlicher Leibesfülle, der behauptete, ein unehelicher Sohn Heinrichs VIII. und daher der Bruder der Königin zu sein.
Ich konnte die Augen nicht von ihr abwenden. Sie trug eine karmesinrote Samtrobe, einen Hermelinumhang und eine zum Kleid passende Kappe, unter welcher ihr blondes Haar hervorsah, das in der klirrend kalten Luft rötlich glitzerte. Ihre goldbraunen Augen waren klar, ihr Blick lebhaft, die Haut war von blendender Reinheit. In diesem Augenblick hielt ich sie für schön. Sie war genauso, wie unsere Mutter sie uns geschildert hatte – überwältigend.
Mehr als mittelgroß und sehr schlank, schien sie jünger als sie wirklich war. Damals war sie fünfundzwanzig, und einem Mädchen von siebzehn kam das bereits ziemlich alt vor. Mir fielen ihre Hände auf, denn sie stellte sie bei jeder Gelegenheit zur Schau und lenkte so die Aufmerksamkeit auf sie. Weiß und wohlgeformt waren sie, mit langen, spitzen Fingern. Elisabeths Gesicht war länglich oval, ihre Brauen so hell, daß man sie kaum sah. Ihre Augen waren, wie schon gesagt, goldbraun, doch später fand ich oft, daß sie auch sehr dunkel aussehen konnten. Sie war ein wenig kurzsichtig, und wenn sie angestrengt schaute, machte sie oft den Eindruck, als dringe sie in die Gedanken der Menschen ihrer Umgebung ein, was diese sehr befangen machte. Sie hatte etwas an sich, das ich bereits damals trotz meiner Jugend und der außergewöhnlichen Situation zu bemerken imstande war, und ich beobachtete sie mit schaudernder Erregung.
Doch so überaus anziehend sie auch war – ein anderer nahm meine Aufmerksamkeit noch stärker gefangen: Robert Dudley, ihr Oberstallmeister, der neben ihr ritt. Solch einen Mann hatte ich noch nie gesehen. In dieser Gesellschaft fiel er genauso auf wie die Königin selbst. Er war sehr groß und breitschultrig und hatte das fesselndste Gesicht, das ich je erblickt hatte. Dazu war er imponierend und vornehm, und seine Würde konnte sich mit jener der Königin durchaus messen. Sein Gesichtsausdruck war in keiner Weise hochmütig, sondern ernst, und er wirkte auf eine zurückhaltende Art äußerst vertrauenerweckend.
Meine neugierigen Blicke wanderten zwischen ihm und der jungen Königin hin und her.
Ich bemerkte, daß die Königin immer wieder anhielt, um mit den einfachsten Leuten zu sprechen, lächelnd und aufmerksam ihnen zugewandt, auch wenn es nur kurz sein konnte. Ich erfuhr beizeiten, daß es ihr Grundsatz war, niemals das Volk zu kränken. Ihre Höflinge bekamen ihren Unwillen oft heftig zu spüren, doch für das Volk war sie stets die wohlwollende Königin. Riefen die Leute: »Gott schütze Euer Gnaden!«, so antwortete sie: »Gott schütze euch alle!«, um ihnen zu verstehen zu geben, daß ihr das Wohl des Volkes ebenso am Herzen lag wie dem Volk das ihre. Man reichte ihr Blumensträuße, und war der Spender auch noch so ärmlich, sie nahm sie huldvoll entgegen, als handle es sich um kostbare Gaben. Man erzählte sich, daß ein Bettler ihr auf der Fleet-Brücke einen Rosmarinzweig übergeben hatte und daß dieser immer noch in ihrer Karosse lag, als sie in Westminster eintraf.
Wir fuhren mit im Festzug – immerhin waren wir ja mit der Königin verwandt –, und so sahen wir das Schaugepränge in Cornhill und Chepe, wo alles mit fröhlichen Fahnen und Wimpeln geschmückt war, die zu jedem Fenster heraushingen.
Am nächsten Tag waren wir bei ihrer Krönung zugegen; wir sahen sie auf dem purpurroten Tuch, das für sie ausgebreitet worden war, in die Abtei schreiten.
Ich war viel zu verwirrt, um der Zeremonie aufmerksam zu folgen, aber Elisabeth sah schön aus, als man ihr zuerst die schwere St.-Edward-Krone und danach die kleinere aus Perlen und Diamanten aufs Haupt setzte, Pfeifen, Trommeln und Trompeten erschallten, als Elisabeth zur Königin von England gekrönt wurde.
»Jetzt wird sich unser Leben verändern«, sagte mein Vater. Und er hatte recht.
Es dauerte nicht lange, bis die Königin ihn kommen ließ. Nach der Audienz kam er voller Begeisterung und Hoffnung zu uns zurück.
»Sie ist wunderbar«, erzählte er. »Sie ist eine Königin, wie sie sein soll. Das Volk verehrt sie, und sie ist dem Volk sehr zugetan. Ich danke Gott, daß er mich ausersehen hat, einer solchen Königin dienen zu dürfen, und so will ich ihr mein Leben zu Füßen legen.«
Sie berief ihn in ihren Rat und gab zu verstehen, daß sie sich ihre liebe Cousine Catherine – meine Mutter – als Kammerfrau wünsche.
Wir Mädchen waren außer uns vor Freude. Das bedeutete, daß auch wir endlich bei Hofe empfangen würden. Die ganzen Musikstunden – Madrigale, Laute und Harfe –, die ganze Tanzerei mit Verbeugungen und Knicksen, alles, was wir über uns hatten ergehen lassen, um uns graziös benehmen zu können, war schließlich der Mühe wert gewesen. Wir plauderten endlos; nachts lagen wir wach und redeten über unsere Zukunft. Wir konnten nicht schlafen, so aufgeregt waren wir. Es war fast, als hätte ich eine Vorahnung gehabt, daß ich nun meinem Schicksal entgegenging, so sehr war ich von wilder Erregung besessen.
Die Königin äußerte den Wunsch, uns zu sehen – nicht alle zusammen, sondern einzeln.
»Ihr werdet alle eine Stellung bekommen«, meinte meine Mutter frohlockend. »Und es werden sich euch wahrlich Gelegenheiten bieten.«
Eine »Gelegenheit« bedeutete eine gute Heirat, ein Thema, das unsere Eltern während unseres Exils außerordentlich beschäftigt hatte.
Und dann kam der Tag, an dem ich Ihrer Majestät vorgestellt werden sollte. Bis zum heutigen Tage kann ich mich lebhaft an jede Einzelheit des Kleides, das ich trug, erinnern. Es war aus tiefblauer Seide, reich verziert, mit einem weiten, glockenförmigen Rock, geschlitzten Ärmeln und einem enganliegenden Mieder. Und meine Mutter gab mit einen Gürtel, dem sie wahre Wunderdinge zuschrieb und den ich um die Taille tragen sollte. Er war mit kleinen kostbaren Steinen in verschiedenen Farben besetzt, und meine Mutter sagte, er würde mir Glück bringen. Bald danach fand ich, daß sie recht hatte. Ich hätte mein Haar gern unbedeckt gelassen, denn ich war offen gestanden besonders stolz darauf – doch meine Mutter meinte, daß eine der französischen Hauben, wie sie neuerdings Mode waren, passender sei. Ich lehnte mich ein wenig dagegen auf, denn der herabfließende Schleier verbarg mein Haar; doch diesmal mußte ich nachgeben, da meine Mutter sehr besorgt war, ob ich auch einen guten Eindruck auf die Königin machte. Sie betonte, daß ich, falls ich das Mißfallen der Königin erregte, nicht nur mein Glück, sondern auch das der anderen zunichte machen könnte. Was mich bei dieser ersten Begegnung am stärksten betroffen machte, war die Hoheit, die Elisabeth ausstrahlte, und in diesem Augenblick – auch wenn es keine von uns wußte – verband sich unser beider Leben. Sie sollte eine wichtigere Rolle in meinem Leben spielen als irgend jemand sonst – ausgenommen vielleicht Robert –, und meine Rolle in ihrem Leben war ungeachtet der folgenschweren Ereignisse unter ihrer Regierung auch nicht unbedeutend.
Wenngleich ich mir den Anschein von Weitläufigkeit zu geben trachtete, war ich zur damaligen Zeit zweifelsohne ein wenig naiv. Während der in Deutschland verbrachten Jahre war ich nicht viel klüger geworden. Dennoch erkannte ich sogleich, daß Elisabeth eine Eigenart besaß, die ich bisher an keinem anderen Menschen entdeckt hatte. Ich wußte: Was sie mit ihren fünfundzwanzig Jahren an Entsetzlichem erlebt hatte, wäre genug gewesen, um die meisten Menschen endgültig zu zerbrechen. Sie hatte als Gefangene im Londoner Tower wahrhaft im Schatten des Todes gelebt, als ihr täglich der Tod von Henkershand drohte. Noch nicht ganz drei Jahre als war sie gewesen, als ihre Mutter hingerichtet wurde. Ob sie sich daran erinnern konnte? Etwas in diesen großen goldbraunen Augen ließ vermuten, daß sie sich durchaus entsann, daß sie schnell lernte und alles, was sie lernte, behielt. Sie war offenkundig frühreif gewesen – eine Gelehrte in der Kinderstube. O ja, sie erinnerte sich! Vielleicht hatte sie deshalb der Tod, der ihr während der vergangenen gefahrvollen Jahre so dicht auf den Fersen gewesen war, nie einholen können. Sie war hoheitsvoll – obwohl erst seit so kurzer Zeit Königin –, und doch genügte eine Minute in ihrer Gesellschaft, um zu erkennen, daß sie ihre Königswürde mit einer Selbstverständlichkeit trug, als habe sie sich ihr Leben lang darauf vorbereitet – was sie möglicherweise auch getan hatte. Sie war sehr schlank und hielt sich kerzengerade; sie hatte die helle Haut ihres Vaters geerbt. Ihre schöne Mutter hatte dunkles Haar und olivfarbene Haut gehabt. Ich, nicht Elisabeth, hatte die dunklen Augen geerbt, die, wie man sagte, auch denen meiner Großmutter Maria Boleyn glichen, doch mein Haar – üppig und gelockt – hatte die Farbe von lichtem Honig. Es wäre töricht, leugnen zu wollen, daß die dunklen Augen zum hellen Haar ungemein anziehend waren, und ich hatte das rasch erkannt. Nach den Boleyn-Portraits zu urteilen, die ich gesehen habe, hatte Elisabeth nichts von ihrer Mutter geerbt, ausgenommen vielleicht jenen schwer zu beschreibenden Zauber, den ihre Mutter, dessen war ich sicher, besessen haben mußte, und mit dem sie den König so behext hatte, daß er sich ihretwegen seiner spanischen Gemahlin von königlichem Blut entledigte und sogar mit Rom entzweite.
Elisabeths Haar glich einem goldenen, rötlich schimmernden Heiligenschein. Ich hatte gehört, ihr Vater habe eine magnetische Kraft besessen, dank der sich die Menschen trotz seiner Grausamkeit zu ihm hingezogen fühlten; und Elisabeth besaß diese Kraft ebenfalls, doch war sie bei ihr mit weiblichem Zauber gepaart, den sie von ihrer Mutter haben mußte.
In diesen ersten Augenblicken erkannte ich, daß sie genauso war, wie ich sie mir vorgestellt hatte, und ich spürte sofort, daß sie Gefallen an mir fand. Wegen meiner ungewöhnlich zarten Farben und meiner Munterkeit galt ich stets als die Schönheit unserer Familie, und nun hatte mein Aussehen sogar die Köchin gefesselt.
»Du hast viel von deiner Großmutter«, hatte meine Mutter einmal gesagt. »Du wirst auf der Hut sein müssen.«
Ich wußte, wie sie das meinte. Die Männer würden mich anziehend finden, wie sie auch Mary Boleyn anziehend gefunden hatten, und ich sollte auf der Hut sein, damit ich keine Gunst gewährte, die mir zum Unglück ausschlagen konnte. Diese Vorstellung ergötzte mich, und dies war auch ein Grund, weshalb ich so froh darüber war, daß ich bei Hofe vorgestellt wurde. Die Königin saß auf einem hohen geschnitzten Stuhl wie auf einem Thron, und meine Mutter führte mich ihr zu.
»Eure Majestät, meine Tochter Letitia. In unserer Familie nennen wir sie Lettice.«
Ich machte einen tiefen Hofknicks und hielt dabei die Augen gesenkt, wie man es mich als schicklich gelehrt hatte, um auszudrücken, daß ich den Blick angesichts des blendenden königlichen Glanzes nicht zu erheben wagte.
»Dann werde ich sie auch so nennen«, sagte die Königin. »Lettice, sieh auf und komm näher, damit ich dich besser sehen kann!«
Wegen ihrer Kurzsichtigkeit wirkten ihre Pupillen sehr groß. Ich staunte über die Weiße und Zartheit ihrer Haut; die hellen Brauen und Wimpern gaben ihrem Blick etwas Überraschtes.
»Nun, Cat«, sagte sie zu meiner Mutter – denn sie hatte die Gewohnheit, allen Leuten Spitznamen zu geben, und da meine Mutter Catherine hieß, lag es nahe, sie Cat zu nennen –, »du hast aber eine hübsche Tochter.«
Damals fand sie Gefallen an meinem Äußeren. Sie hatte für Schönheit stets viel übrig – besonders natürlich bei Männern, doch sie mochte auch hübsche Frauen ... bis der Mann, in den sie verliebt war, diese ebenfalls bewunderte.
»Vielen Dank, Majestät.«
Die Königin lachte. »Du bist eine fruchtbare Frau, Cousine«, sagte sie. »Sieben Söhne und vier Töchter, nicht wahr? Ich liebe große Familien. Komm, Lettice, gib mir deine Hand. Wir sind doch Cousinen. Wie gefällt dir England, nun, da du wieder zurück bist?«
»England ist wundervoll, seit Eure Majestät seine Königin sind.«
»Ha!« lachte sie. »Ich sehe, ihr habt sie richtig erzogen. Ich möchte schwören, das war Francis.«
»Francis hat sich stets um seine Söhne und Töchter gekümmert, als wir fern der Heimat waren«, sagte meine Mutter. »Wenn Eure Majestät sich in Gefahr befanden, so war er verzweifelt ... und wir alle mit ihm.«
Elisabeth nickte ernsthaft. »Nun, ihr seid ja wieder daheim, und es soll euch gutgehen. Du wirst Ehemänner für deine Mädchen suchen müssen, Cat. Wenn alle deine Töchter so hübsch sind wie Lettice, dürfte das nicht schwierig sein.«
»Es ist ja solch eine Freude, wieder zu Hause zu sein, Madam«, sagte meine Mutter. »Ich glaube sicher, daß Francis und ich eine Weile an nichts anderes denken werden.«
»Wir wollen sehen, was sich machen läßt«, sagte die Königin und ließ ihre Augen auf mir ruhen. »Deine Lettice hat aber nicht gerade viel zu sagen«, bemerkte sie.
»Ich glaubte, es gezieme sich, zu warten, bis Eure Majestät mir zu sprechen gestatteten«, sagte ich schnell.
»Du kannst also doch reden. Das freut mich. Ich habe Menschen, die sich nicht bemerkbar zu machen wissen, noch nie leiden können. Ein gefälliger Schurke ist amüsanter als ein schweigender Heiliger. Was willst du mir über dich berichten?«
»Ich möchte sagen, ich teile die Freude meiner Eltern, hier zu sein und meine königliche Verwandte an dem Platz zu sehen, an den sie, wie wir stets unerschütterlich glaubten, gehört.«
»Das ist wohlgesprochen. Ich sehe, du hast sie gelehrt, ihre Zunge zu gebrauchen, Cousine.«
»Das habe ich mir selbst beigebracht, Madam«, gab ich rasch zurück.
Meine Mutter erschrak über meine Verwegenheit, doch daran, wie die Königin die Lippen verzog, zeigte sich, daß sie keineswegs ungehalten war.
»Was hast du dir sonst noch beigebracht?« fragte sie.
»Zuzuhören, wenn ich nicht imstande war, an einem Gespräch teilzunehmen, mich aber mitten hineinzustürzen, wenn ich konnte.«
Die Königin lachte. »Dann hast du dir viel Klugheit angeeignet. Die wirst du brauchen, wenn du an den Hof kommst. Viele schwätzen über die Kunst des Zuhörens, ohne sie je zu erlernen, aber wer sie beherrscht, zählt zu den weisen Männern und Frauen. Und du ... erst siebzehn, nicht wahr? ... verstehst dich bereits darauf. Komm, setz dich neben mich! Ich möchte mich eine Weile mit dir unterhalten.«
Meine Mutter blickte hocherfreut, doch gleichzeitig warnten mich ihre Augen, ich möge mir diesen anfänglichen Erfolg nicht zu Kopfe steigen lassen. Sie hatte recht; ich konnte sehr impulsiv sein. Ein Gefühl warnte mich: Die Stimmung der Königin konnte gewiß plötzlich umschlagen.
Ich erhielt keine Gelegenheit, länger auf diesem gefährlichen Boden zu wandeln, denn in diesem Augenblick wurde die Tür ohne jedes Zeremoniell geöffnet, und ein Mann kam herein. Meine Mutter wirkte bestürzt und mir wurde klar, daß er durch sein unangekündigtes Eindringen gegen eine strenge Regel höfischer Etikette verstoßen haben mußte.
Er war anders als alle Männer, die ich je gesehen hatte. Ich wurde mir sofort der ungewöhnlichen Wirkung bewußt, die von ihm ausging. Ihn als Mann von stattlichem Äußeren zu beschreiben – der er zweifellos war –, besagt zu wenig. Stattliche Männer gibt es viele, doch nie sah ich einen, der diese eigentümliche Ausstrahlung besaß. Er war mir bereits zuvor bei der Krönung aufgefallen. Man könnte annehmen, daß es die Liebe war, die mir Robert Dudley in solchem Licht erscheinen ließ; möglicherweise hat er mich verwirrt und bezaubert wie so viele Frauen – sogar Elisabeth –, doch ich habe ihn immer geliebt, und wenn ich weit zurückdenke und mich dessen erinnere, was in unseren letzten gemeinsamen Tagen geschah, so schaudere ich noch heute. Ob man Robert Dudley aber liebte oder haßte, man mußte ihm diese besondere Ausstrahlung zugestehen, dieses Charisma, das als besondere Begnadigung erklärt wird, und mir fällt kein treffenderer Ausdruck ein, um ihn zu beschreiben. Er wurde mit dieser Begnadigung geboren, und er war sich dessen wohl bewußt.
Zunächst einmal war er so hochgewachsen wie kein anderer Mann, den ich je gesehen hatte, und Macht ging von ihm aus. Ich glaube, daß es in erster Linie Macht ist, welche einen Mann anziehend erscheinen läßt. Das galt jedenfalls für mich ... bis ich älter wurde. Wenn ich mit meinen Schwestern über Liebhaber sprach – was ich häufig tat, da ich wußte, daß diese in meinem Leben eine große Rolle spielen würden –, so sagte ich, mein Liebhaber müsse ein Mann sein, der über andere zu gebieten habe; er werde reich sein, und andere würden seinen Zorn fürchten – alle, außer mir. Er aber werde den meinen fürchten. Heute weiß ich, daß die Beschreibung des Liebhabers, den ich mir wünschte, eine Beschreibung meiner selbst war. Ich war immer ehrgeizig, doch ich strebte nicht nach weltlicher Macht. Nie habe ich Elisabeth um ihre Krone beneidet, und wenn die Rivalität zwischen uns am heftigsten war, dann war ich froh, daß sie die Krone trug, konnte ich doch so beweisen, daß ich auch ohne diese Macht über sie triumphierte. Ich wollte, daß sich alle Aufmerksamkeit auf mich konzentrierte. Ich wollte für die, welche mir gefielen, unwiderstehlich sein. In dieser Zeit fing ich an zu begreifen, daß ich eine Frau von starker Sinnlichkeit war, und daß mein Verlangen unbedingt befriedigt werden mußte.
Robert Dudley war also der bei weitem anziehendste Mann, der mir je begegnet war. Er war von sehr dunkler Hautfarbe, sein dichtes Haar war fast schwarz, seine dunklen, lebhaften Augen schienen alles wahrzunehmen, seine Nase war leicht gebogen; er hatte eine athletische Figur, und seine Haltung war die eines Königs in Gegenwart einer Königin.
Ich spürte, wie sich Elisabeth veränderte, als er eintrat. Ihre blasse Haut war mit einem rosigen Schimmer überzogen.
»Ihr seid es, Rob«, sagte sie, »das hätten wir uns ja denken können. Ihr kommt also einfach unangemeldet zu uns herein.«
Die Zärtlichkeit in ihrer Stimme strafte den Tadel in ihren Worten Lügen, und es war klar, daß ihr die Unterbrechung keineswegs unwillkommen war; ebenso klar war es, daß Elisabeth meine Mutter und mich vergessen hatte.
Sie streckte ihre schöne weiße Hand aus. Er verneigte sich, während er sie ergriff und küßte und hielt sie fest, während seine Augen Elisabeths Gesicht suchten. So wie sie sich anlächelten, hätte ich schwören können, sie seien ein Liebespaar.
»Verehrte Lady«, sagte er, »ich habe mich beeilt, zu Euch zu kommen.«
»Irgendein Unglück?« gab sie zurück. »Kommt, erzählt es mir!«
»Nein«, erwiderte er, »es war nur der Wunsch, Euch zu sehen, der keinen Aufschub duldete.«
Meine Mutter legte mir die Hand auf die Schulter und schob mich in Richtung der Tür. Ich blickte zur Königin hin in der Meinung, ich müsse ihre Erlaubnis abwarten, mich zurückzuziehen.
Kopfschüttelnd wies meine Mutter zur Tür. Wir gingen zusammen hinaus. Die Königin hatte uns vergessen und Robert Dudley natürlich auch.
Als sich die Tür hinter uns geschlossen hatte, sagte meine Mutter: »Es heißt, sie würden heiraten, wenn er nicht bereits eine Frau hätte.«
Ich mußte ständig an die beiden denken. Ich konnte den stattlichen, vornehmen Robert Dudley nicht vergessen. Wie er die Königin angesehen hatte! Es ärgerte mich, daß er mich nicht eines einzigen Blickes gewürdigt hatte, und ich war überzeugt, hätte er es getan, so hätte ich ihn zu einem zweiten Blick veranlaßt. Ich sah ihn ständig vor mir mit seiner weißen, gestärkten Halskrause, den gepolsterten Hüften, seinem Wams, den verzierten Kniehosen und dem Diamanten in einem Ohr. Ich dachte an die vollendet geformten Schenkel in den enganliegenden Hosen; weil seine Beine vollkommen ebenmäßig waren, trug er keine Strumpfbänder; er konnte auf Beiwerk verzichten, das für weniger wohlgestaltete Männer unerläßlich war.
Die Erinnerung an die erste Begegnung blieb in meinem Gedächtnis haften als ein Ereignis, das es zu rächen galt, weil bei dieser Gelegenheit, als das Dreieck entstand, keiner von ihnen einen Gedanken an Lettice Knollys verschwendet hatte, die kurz zuvor von ihrer Mutter in aller Demut der Königin vorgestellt worden war.
Das war der Anfang. Danach war ich oft bei Hofe. Die Königin empfand eine starke Zuneigung zur Familie ihrer Mutter, wenn auch der Name Anna Boleyn kaum erwähnt wurde. Das war für Elisabeth charakteristisch. Es gab gewiß eine Menge Leute im Lande, die ihre Legitimität bezweifelten. Natürlich würde niemand es auszusprechen wagen, riskierte er doch damit die Todesstrafe, doch sie war viel zu klug, um sich nicht der Tatsache bewußt zu sein, daß dergleichen in den Köpfen mancher Leute umherspukte. Fiel auch Anna Boleyns Name nur selten, so lenkte die Königin dagegen ständig die Aufmerksamkeit auf ihre Ähnlichkeit mit ihrem Vater Heinrich VIII., und sie unterstrich die Gemeinsamkeiten, wann immer es möglich war. Da sie ihm zweifellos glich, war dies nicht schwierig. Gleichzeitig aber war sie stets bereit, die Verwandtschaft ihrer Mutter zu begünstigen, als wolle sie auf diese Weise jener Bedauernswerten Abbitte leisten. So wurden meine Schwester Cecilia und ich Ehrenjungfrauen der Königin, und innerhalb weniger Wochen waren wir zu Hofdamen aufgerückt. Anne und Catherine waren noch zu jung, aber zu gegebener Zeit sollten auch sie an die Reihe kommen.
Das Leben war höchst aufregend. Während all der trüben Jahre in Deutschland hatten wir davon geträumt, und ich war jetzt genau im richtigen Alter, um Vergnügen daran zu finden. Der Hof war der Mittelpunkt des Landes: ein Magnet, der die Reichen und Ehrgeizigen anzog. Sämtliche großen Familien des Landes suchten die Nähe der Königin, und jede wetteiferte mit der anderen in Glanz und Pracht. Im Grunde ihres Herzens liebte Elisabeth Prunk und Verschwendung – solange sie nichts dafür zu bezahlen brauchte. Sie hatte Gefallen an Festspielen, Fröhlichkeit, Bällen und Banketten, doch fiel mir auf, daß sie beim Essen und Trinken Enthaltsamkeit übte. Sie liebte Musik und war eine unermüdliche Tänzerin, und obgleich sie vorwiegend mit Robert Dudley tanzte, fand sie an jedem hübschen jungen Mann, der ein guter Tänzer war, flüchtig Gefallen. Am meisten fesselte mich ihr Charakter, der so widersprüchliche Züge aufwies. Wenn man sie in einem reichverzierten, glitzernden Gewand mit Robert Dudley tanzen – und oftmals kokettieren – sah, so daß man dem knisternden Vorspiel zu einem amourösen Höhepunkt beizuwohnen glaubte, gewann man den Eindruck, ein solcher Leichtsinn müsse sich nachteilig auf die Zukunft einer Königin auswirken. Dann aber konnte sie sich ganz plötzlich verändern, konnte herb und ernst sein und auf ihre Autorität pochen, und selbst so hochstehenden Männern wie William Cecil zeigte sie dann, daß sie es war, welche die Lage beherrschte und daß ihr Wille zu geschehen hatte. Da man nie genau wußte, wann ihre heitere Stimmung vorüber war, mußte jedermann Vorsicht walten lassen. Robert Dudley war der einzige, welcher die Grenze überschritt, doch öfter als einmal sah ich sie ihm einen spielerischen Klaps auf die Wange geben, vertraulich und liebevoll, aber doch gleichzeitig als Mahnung, daß sie die Königin war und er ihr Untertan. Dann sah ich Robert die strafende Hand ergreifen und küssen, und damit besänftigte er Elisabeth. Er war damals überaus selbstsicher.
Sehr bald merkte ich, daß sie Zuneigung zu mir gefaßt hatte. Ich tanzte ebensogut wie sie, obgleich niemand gewagt hätte, dies zuzugeben. Am Hofe tanzte niemand so gut wie die Königin; keine Frau trug ein so entzückendes Kleid wie die Königin; keine konnte ihre Schönheit mit Elisabeth vergleichen: Sie war in allen Dingen die Erste. Dennoch wußte ich recht gut, daß ich als eine der schönsten Frauen bei Hofe galt; die Königin hatte nichts dagegen und nannte mich »Cousine«. Ich besaß auch Verstand und maß ihn vorsichtig mit dem der Königin, was ihr keineswegs mißfiel. Sie entdeckte, daß sie ihre Verwandten aus der Familie Boleyn sowohl zu ihrem eigenen Vergnügen wie aus Pflichtgefühl ihrer verstorbenen Mutter gegenüber verwöhnen konnte, und sie wollte mich häufig in ihrer Nähe haben. In dieser ersten Zeit lachten wir, die wir uns in den folgenden Jahren mit soviel Bitterkeit und Haß begegnen sollten, oft miteinander, und Elisabeth zeigte deutlich, daß sie gern mit mir zusammen war. Doch weder mir noch irgendeiner anderen ihrer hübschen Hofdamen war es erlaubt, zugegen zu sein, wenn sie sich mit Robert in ihren privaten Gemächern aufhielt. Gerade weil man ihr ständig beteuerte, wie überaus schön sie sei – so dachte ich oft –, muß sie unsicher gewesen sein, ob man ihr auch die Wahrheit sagte. Wie stünde es wohl um ihre Anziehungskraft, wenn sie die Königswürde nicht besäße?, fragte ich mich. Doch es war unmöglich, sich das vorzustellen, denn die Königswürde gehörte untrennbar zu ihr. Ich betrachtete oft meine langen Wimpern, meine dichten Brauen, meine strahlenden dunklen Augen und mein schmales Gesicht unter dem üppigen honigfarbenen Haar, und innerlich jauchzend verglich ich mein Antlitz mit ihrem, das so farblos war mit seinen kaum sichtbaren Wimpern und Brauen, der mächtigen Nase, der hellen Haut, deren Weiße fast kränklich wirkte. Ich wußte, daß jeder unvoreingenommene Betrachter zugeben würde, daß ich die Schönheit war. Die Königswürde jedoch besaß sie, und damit das Bewußtsein, daß sie die Sonne war und wir übrigen nur die Planeten, die sie umkreisten und von ihr das Licht erhielten. Bevor sie Königin wurde, war sie von zarter Gesundheit gewesen. Während ihrer so vielen Gefährdungen ausgesetzten Jugend hatte sie mancherlei Krankheiten durchgemacht, wobei sie, wie wir gehört hatten, dem Tode sehr oft nahe gewesen war. Nun, als Königin, schien ihre Anfälligkeit verschwunden; das waren nur die Wachstumsschmerzen der Königswürde gewesen; doch selbst jetzt, nachdem sie alles überwunden hatte, wies die Blässe ihrer Haut noch den Anschein von Kränklichkeit auf. Wenn sie ihr Gesicht schminkte, was sie ausgesprochen gern tat, sah sie nicht mehr so zerbrechlich aus; die Königswürde aber blieb ihr in jedem Falle, und dies war etwas, mit dem keine Frau sich messen konnte.