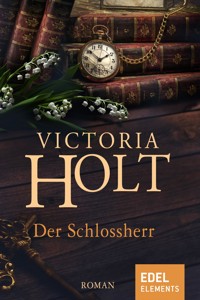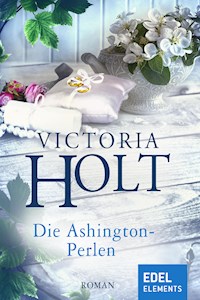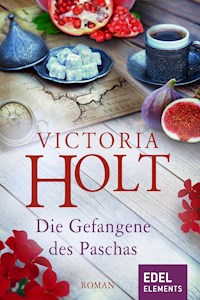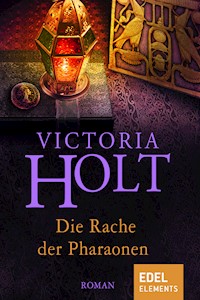4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist es ein Traum oder eine böse Vorahnung? Ein junges Mädchen gerät in eine schicksalhafte Verstrickung, deren Realität erschreckender ist als ihr geheimnisvoller Alptraum ... Seit Jahren träumt Ellen Kellaway von einem scheinbar ganz gewöhnlichen Zimmer – und erwacht mit entsetzlichen Angstgefühlen und Vorahnungen. Dabei scheint sie eine gesicherte und glückliche Zukunft an der Seite des reichen Philipp Carrington zu erwarten. Wird sie es zulassen, dass die bedrückende Last ihres Traums ihr Leben bestimmt? Victoria Holt, die Meistererzählerin des Unheimlichen, verbindet in diesem aufregenden Roman ein Höchstmaß an Spannung mit einer romantischen Handlung, die den Leser bis zur letzten Seite fesselt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Victoria Holt
Das Zimmer des roten Traums
Roman
Ins Deutsche übertragen von Irene Aue
Edel eBooks
Der Heiratsantrag
1
In der Nacht vor Esmeraldas erstem Ball störte wieder einmal dieser Traum meinen Schlaf. In meinen neunzehn Lebensjahren hatte ich ihn immer wieder erlitten. Dieser stets wiederkehrende Traum war beunruhigend und schien von einer gewissen Bedeutsamkeit zu sein, die ich enträtseln mußte. Nach dem Erwachen schüttelte ich mich jedesmal vor Angst und Schrecken und wußte eigentlich nie genau, warum. Es lag gar nicht so sehr an dem Traum selbst, sondern eher daran, daß er Fürchterliches vorauszusagen schien.
Ich befand mich stets in einem Zimmer. Einem Zimmer, das ich nun bereits sehr gut kannte, denn es war in jedem Traum das gleiche. Ein ganz gewöhnliches Zimmer. Mit einem gemauerten Kamin, zu dessen beiden Seiten Sitzgelegenheiten, ein roter Teppich und schwere rote Vorhänge. Über dem Kamin hing ein Bild: »Stürmische See«. Ein paar Stühle standen drin und ein altmodischer Klapptisch. Stimmen erklangen und verstummten wieder. Ich hatte stets den Eindruck, daß irgend etwas vor mir verborgen wurde. Und dann kam plötzlich dieses übermächtige Gefühl böser Vorahnung, aus dem ich mit Entsetzen erwachte. Das war alles. Manchmal kam der Traum ein ganzes Jahr lang nicht wieder, und ich vergaß ihn, und dann suchte er mich plötzlich wieder heim. Jedesmal bemerkte ich ein paar Einzelheiten mehr in dem Zimmer, etwa die dicken Schnüre, mit denen die roten Vorhänge gerafft waren, oder den Schaukelstuhl in der Ecke. Und mit jedem neuen Detail schien mir dieses Gefühl der Angst näher zu rücken.
Nach dem Erwachen lag ich in meinem Bett und fragte mich, was der Traum wohl bedeutete. Warum nur suchte mich dieses Zimmer in meinem Schlaf heim? Warum war es jedesmal das gleiche Zimmer? Warum empfand ich immer diese schleichende Angst? Meine Phantasie hatte das Zimmer heraufbeschworen, aber warum träumte ich jahrelang davon? Ich erzählte es niemandem. Tagsüber kam mir die ganze Sache immer so lächerlich vor, denn je lebhafter ein Traum dem Träumer erscheint, um so langweiliger klingt er wohl in der Nacherzählung. Irgendwo tief drinnen war ich jedoch fest davon überzeugt, daß dieser Traum etwas bedeutete. Daß eine merkwürdige, mir noch unverständliche Kraft mich vor einer Gefahr warnte und daß ich wohl eines Tages entdecken würde, was mich da bedrohte.
Wilden Phantasien nachzuhängen lag mir eigentlich gar nicht. Dafür war mein Leben zu bitter und ernst gewesen. Seit ich von Kusine Agathas Wohlwollen abhängig war, hatte man mich ständig daran erinnert, in welcher Lage ich mich befand. Daß ich am gleichen Tisch mit ihrer Tochter Esmeralda sitzen durfte, von ihrer Gouvernante mit unterrichtet wurde und unter der Aufsicht ihres Kindermädchens im Park spazierengehen durfte, waren offensichtlich Gnadenbeweise, für die ich ewig dankbar zu sein hatte. Ich durfte nie vergessen, welch elendeste aller elenden Kreaturen ich war, eine arme Verwandte, die nur deshalb in den Herrschaftsräumen zugelassen war, weil sie zur Familie gehörte. Und selbst diese Zugehörigkeit hing an einem schwachen Fädchen, denn Agatha war nur eine Kusine zweiten Grades von meiner Mutter.
An Agatha war alles überdimensional: ihr Körper, die Stimme, ihr ganzes Wesen. Sie beherrschte ihre Familie, das heißt, ihren kleinen Mann – aber vielleicht war er gar nicht so klein und wirkte nur so neben ihr – und ihre Tochter Esmeralda. Cousin William, wie ich ihn nannte, hatte weitverzweigte Geschäfte und war sehr wohlhabend. Außerhalb seines Hauses sicher ein mächtiger Mann, drinnen jedoch seiner kraftvollen Frau völlig ergeben und unterlegen. Ein ruhiger Mensch, der mich oft geistesabwesend anlächelte, als könne er sich nicht genau besinnen, wer ich war und was ich in seinem Haus tat. Wäre er imstande gewesen, seiner Frau energisch entgegenzutreten, hätte er sicher viel Gutes getan. Sie war bekannt für ihre guten Werke. Bestimmte Tage der Woche waren ihren Komitees gewidmet. Damen, die große Ähnlichkeit mit ihr hatten, kamen dann zu uns ins Haus, und ich mußte immer Tee und Kuchen servieren. Sie sah es gerne, wenn ich bei solchen Gelegenheiten anwesend war. »Das ist Ellen, die Tochter meiner Kusine zweiten Grades«, erklärte sie dann. »Eine schreckliche Tragödie! Man mußte doch dem Kind einfach wieder ein Zuhause geben.« Manchmal half mir Esmeralda beim Servieren. Arme Esmeralda! Niemand hätte sie je für die Tochter des Hauses gehalten. Sie ließ den Tee in den Tassen überschwappen und kippte einmal eine voll in den Schoß einer wohltätigen Dame.
Kusine Agatha nahm es stets sehr übel, wenn die Leute Esmeralda für die arme Verwandte und mich für die Tochter des Hauses hielten. Dabei war Esmeraldas Schicksal nicht viel besser als meines. Ewig hieß es: »Schultern zurück, Esmeralda! Schleich nicht so krumm daher!« Oder: »Sprich doch endlich lauter! Nuschle nicht so!«
Arme Esmeralda! Welch glanzvoller Name, der ihr so gar nicht zu Gesicht stand. Ihre blaßblauen Augen waren oft ganz wäßrig, denn sie neigte zu Tränenausbrüchen, und das feine blonde Haar sah immer unordentlich und zerzaust aus. Ich machte ihre Rechenaufgaben und half ihr bei den Aufsätzen. Sie mochte mich recht gerne.
Kusine Agatha bedauerte sehr, nur eine Tochter zu haben. Sie hatte sich immer Söhne und Töchter gewünscht, die sie wie Schachfiguren dirigieren konnte. Daß diese einzige, ziemlich zart gebaute Tochter den ganzen Nachwuchs darstellte, schob sie einzig und allein ihrem Mann in die Schuhe. War es doch feststehende Regel des Hauses, daß Agathas Taten nur Gutes zeitigten, während alles Schlechte von anderen Leuten kam.
Sie war von der Königin empfangen und von dieser wegen ihrer Wohltaten für die Armen beglückwünscht worden. Sie organisierte Klubs, in denen diese Armen in den Pflichten gegenüber ihren »Wohltätern« unterwiesen werden konnten. Sie kümmerte sich um Hemdennäherei und um die Anfertigung von Kattungewändern. Sie war unermüdlich; immer umgab sie eine wahre Aura der Tugendhaftigkeit.
Kein Wunder also, daß sowohl Mann als auch Tochter sich ihr gegenüber im Nachteil fühlten. Ich selbst merkwürdigerweise nicht. Schon lange war mir klargeworden, daß Kusine Agathas gute Taten ihr mindestens soviel Befriedigung gaben wie irgend jemandem anderen, und so war ich sicher, daß damit Schluß sein würde, sowie sie ihr keine solche Befriedigung mehr brachten. Sie spürte natürlich diesen Mangel an Anerkennung in mir und bestrafte mich dafür. Sie mochte mich nicht. Nicht daß sie von irgend jemandem außer sich selbst übermäßig eingenommen gewesen wäre; im hintersten Winkel ihres Gehirns muß sie sich aber immerhin dessen bewußt geworden sein, daß ihr Mann das Geld brachte, das ihr diesen Lebensstil ermöglichte, und was Esmeralda betraf, so war sie ihr einziges Kind und mußte wohl umsorgt werden.
Ich dagegen war die Außenseiterin, und dazu nicht einmal demütig. Sicher bemerkte sie, daß ich mich nicht halten konnte, wenn sie von ihren neuen Taten sprach. Ohne Zweifel spürte sie in mir eine Abneigung davor, ihr prinzipiell beizustimmen. Natürlich versicherte sie sich dann, daß dies dem »schlechten Blut« zuzuschreiben war, das von meines Vaters Seite durch meine Adern floß, obwohl sie andererseits behauptete, von dieser Linie sonst nichts zu wissen.
Schon in den ersten Jahren meines Aufenthalts in diesem Haus wurde ihre Haltung mir gegenüber deutlich. Einmal, ich war etwa zehn Jahre alt, ließ sie nach mir schicken.
»Ich glaube, es ist an der Zeit, Ellen«, sagte sie, »daß wir beide uns einmal unterhalten.«
Da stand ich stämmige Kleine vor ihr. Mit kaum zu bändigendem schwarzem Haar, dunkelblauen Augen, etwas zu kurzer Nase und einem ziemlich langen, widerspenstigen Kinn.
Ich mußte auf den großen Perserteppich in ihrem sogenannten Arbeitszimmer stehenbleiben; in diesem Raum schrieb ihre Gesellschaftssekretärin die Briefe und bewältigte den Großteil der Komiteearbeit, für die sie soviel Lob einstrich.
»Also, meine Liebe«, sagte sie zu mir, »laß uns einmal klarkommen. Du weißt doch, welche Stellung man dir in diesem Hause eingeräumt hat, oder?«
Ohne auf meine Antwort zu warten, sprach sie weiter. »Zweifelsohne bist du mir und Cousin William Loring (das war ihr Mann) sehr dankbar, daß wir dich hier aufgenommen haben. Wir hätten dich natürlich beim Tod deiner Mutter in ein Waisenhaus bringen lassen können, aber du gehörst schließlich zur Familie – wenn der Verwandtschaftsgrad auch nicht gerade sehr eng ist –, und so haben wir beschlossen, dich unter unseren Schutz zu stellen. Wie du weißt, hat deine Mutter einen gewissen Charles Kellaway geheiratet. Du bist die Frucht dieser Ehe.« Ihre lange Nase zuckte bei diesen Worten, ein Zeichen dafür, wie sehr sie meine Eltern und deren Sprößling verachtete. »Eine höchst unpassende Heirat. Er war nicht der Mann, den man für sie auserwählt hatte.«
»Es muß eine Liebesehe gewesen sein«, sagte ich, denn so hatte ich es von unserem Kindermädchen gehört, dessen Tante Kusine Agathas Kindermädchen gewesen war und sich deshalb in der Vergangenheit der Familie recht gut auskannte.
»Würdest du mich bitte nicht unterbrechen!« setzte Kusine Agatha fort. »Wir reden hier über sehr ernste Dinge. Deine Mutter ist gegen den Willen der Familie auf und davon und heiratete diesen Menschen aus irgendeiner völlig unbekannten Gegend, von der noch niemand je etwas gehört hatte.« Sie sah mich streng an. »Nach knapp einem Jahr warst du da, und kurz danach verließ deine Mutter ihr neues Heim völlig verantwortungslos und kehrte mit dir zu ihrer Familie zurück.«
»Da war ich drei«, sagte ich, wie ich es vom Kindermädchen wußte. Sie zog die Augenbrauen hoch. »Ich bat dich bereits, mich nicht zu unterbrechen. Sie besaß nichts, gar nichts. Ihr beide kamt zu deiner Großmutter. Zwei Jahre darauf starb deine Mutter.«
Da war ich fünf Jahre alt gewesen. Ich erinnere mich vage an sie: die erstickenden Umarmungen, die ich so liebte, und das Gefühl der Sicherheit, dessen ich mir erst bewußt wurde, als ich es nicht mehr hatte. Ich sah mich selbst ganz verschwommen neben ihr im kühlen Gras sitzen, sie hatte ein Skizzenbuch in der Hand. Immer zeichnete sie und versteckte das Buch vor meiner Großmutter. Ich spürte natürlich, daß sie irgendwie in Ungnade geraten war, und es machte mich sehr glücklich, mich als ihre Beschützerin zu fühlen. »Du liebst mich doch, Ellen, nicht wahr?« sagte sie oft zu mir. »Trotz allem, was ich getan habe.« Diese Worte klangen mir in den Ohren, wenn ich an sie dachte, und ich war richtig böse auf mich selbst als ungeschickte Fünfjährige, die nicht begriff, was los war.
»Deine Großmutter war jedenfalls schon viel zu alt, um noch ein Kind aufzuziehen«, setzte Kusine Agatha fort.
Das allerdings, dachte ich bitter. Mit ihren schmalen Lippen, den kleinen Augen und der weißen Kappe, ohne die ich sie nie sah, war sie mir unglaublich alt erschienen – eine furchterregende alte Dame, die mir einen entsetzlichen Schrecken einjagte, als ich begriff, daß ich jetzt alleine dastand, ohne meine liebende, mitverschworene Gefährtin, und daß ich in Zukunft mich selbst aus dem Schlamassel ziehen mußte, in den ich ununterbrochen geriet. Glücklicherweise war ich nicht leicht kleinzukriegen, und es gelang mir, mit stoischem Gleichmut die Anschuldigungen und Anrufungen des lieben Gottes anzuhören, in denen dauernd gefragt wurde, was denn noch aus mir werden würde. Als Großmutter starb, spürte ich keinerlei Schmerz, und ich versuchte auch nicht, so zu tun, als ob.
»Auf ihrem Sterbebett bat mich deine Großmutter«, sagte Kusine Agatha jetzt, »für dich zu sorgen, und dies versprach ich ihr feierlich. Und bin auch fest entschlossen, mein Versprechen einzuhalten. Du mußt dir dennoch darüber klar sein, daß du nur deswegen nicht im Waisenhaus gelandet bist, wo man dich zum Hausmädchen oder bei einigen Kenntnissen und Fähigkeiten zur Gouvernante ausbilden würde. Nein, ich habe dich hierhergebracht, und du erhältst den gleichen Unterricht wie Esmeralda. Du lebst bei mir als Mitglied der Familie. Bitte denke immer daran. Ich verlange keine Dankbarkeit, aber ich erwarte sie. Glaube ja nicht, daß du die gleichen Vorteile wie meine Tochter genießen wirst. Das wäre schlecht für deinen Charakter. Wenn du erwachsen bist, wirst du vielleicht dein Geld selbst verdienen müssen. Ich rate dir daher gut, zu nützen, was dir hier geboten wird. Du wirst von einer Gouvernante unterrichtet, so daß du an deinem achtzehnten Geburtstag eine gebildete junge Dame sein wirst. Du wirst auch die Manieren und Gebräuche wohlsituierter Haushalte lernen. Es liegt an dir, Ellen, dir das zunutze zu machen. Lerne, was du lernen kannst, und denke immer daran, daß du es meiner Wohltätigkeit verdankst, dich dieser Möglichkeiten bedienen zu können. Tja, das wäre es dann.«
Und jetzt sollte ich wohl hinausgehen und über diese Dinge nachdenken, mich meines Glückes freuen und eine Demut mir aneignen, die in meiner Position die meisterwünschte Tugend war und an der es mir leider so sehr mangelte. Eine Zeitlang hatte ich mir eingebildet, Kusine Agathas Blicke wohlwollend auf mir ruhen zu sehen, merkte jedoch bald, daß sie nur ihre Befriedigung darüber zeigte, meine Wohltäterin zu sein, und daß dieser Blick mit meinen Fortschritten gar nichts zu tun hatte. Im Gegenteil, alle meine unerwünschten Mängel, an denen es mir offensichtlich nicht fehlte, bereiteten ihr offenbar Freude. Ich begriff, daß ich als größere Last ihr größere Tugend einbrachte.
Für Kusine Agatha empfand ich wenig Zuneigung. Wir waren genau entgegengesetzte Charaktere, und ich merkte bald, daß ich als einzige im ganzen Haushalt wagte, ihr zu widersprechen. Solange ich kleiner war, hing die Drohung mit dem Waisenhaus über mir. Bald wußte ich jedoch, daß man mich nie dorthin schicken würde, weil Kusine Agatha es sich nicht leisten konnte, ihre Freunde erfahren zu lassen, daß sie mich so abgeschoben hätte. Mein unangenehmer Charakter war ihr eine Quelle ständigen Vergnügens. Ich glaube, sie sprach vor ihren Freunden öfter von mir als von Esmeralda. Ihre eigene Tochter war ein Nichts, ich keineswegs. Oft hörte ich, wenn ich ein Zimmer verließ: »Nun ja, ihre Mutter ...« Oder: »Kaum zu glauben, daß die arme Frances eine Emdon war.« Die arme Frances war meine Mutter und die Emdons ihre hochedle Familie, der auch Kusine Agatha entstammte.
Natürlich wurde ich schlau – »listig wie eine Wagenladung Affen«, wie unser Kindermädchen meinte. »Wird irgendwo was angestellt, ist Miß Ellen immer dabei. Und Miß Esmé läßt sich natürlich immer von ihrer bösen Kusine verführen.« Ich glaube fast, auf meine Art war ich genauso mächtig im Haus wie Kusine Agatha.
Im Winter lebten wir in einem hohen Haus gegenüber dem Hyde Park. Ich liebte die Bäume, die bronzefarben und gold glänzend wurden, wenn wir vom sommerlichen Landaufenthalt zurückkehrten. Esmé und ich saßen oft an einem der oberen Fenster und zeigten einander die berühmten Gebäude. Die nördliche Aussicht ging genau auf den Park, von der Ostseite her konnten wir das Parlament, Big Ben und das Brompton-Oratoriumsgebäude sehen. Wir hörten den Muffin-Verkäufer seine süßen Brötchen mit der Glocke ankündigen und sahen die weißbemützten Hausmädchen mit ihren Gefäßen herauslaufen und seine Waren kaufen. Unser Kindermädchen ließ immer welche kommen, und wir saßen dann an ihrem Kamin zum Toasten und genossen selig die buttrig-sanfte Saftigkeit. Wir schauten den hin und her marschierenden Straßenfegern zu, barfüßigen Jungen, deren Anblick uns ganz unglücklich stimmte, sie sahen so entsetzlich arm aus; und vergossen beide Tränen über einen Mann, der hinter einer kofferbeladenen Kutsche auf dem Weg zum Bahnhof Paddington herrannte, weil er hoffte, als Gepäckträger ein paar Pfennige zu verdienen. Ich erfand eine herzzerreißende Geschichte dazu, die Esmeralda noch mehr bittere Tränen entlockte. Sie war sehr gutmütig und so leicht zu rühren, daß ich die Geschichte dann verändern und so erzählen mußte, wie es ihre Mutter wohl getan hätte. Er stamme aus einer guten Familie und habe sein väterliches Erbe für Gin und Bier ausgegeben. Seine Frau bekäme nur Schläge, und die Kinder hätten schreckliche Angst vor ihm. Arme kleine Esmeralda! So naiv war sie und so leicht abzulenken.
Nachmittags spazierten wir nach den Unterrichtsstunden mit dem Kindermädchen zu den Kensington Gardens. Unsere Beschützerin ließ sich am Blumenbeet nieder, während wir herumtollten. »Und bleibt ja in der Nähe, Miß Ellen, sonst kriegst du was von mir zu hören!« Darüber brauchte sie sich selten Sorgen zu machen, denn ich blieb gern in der Nähe, um zu hören, was sie den anderen Kindermädchen erzählte.
»Esmés Mutter, du meine Güte, was für ein Höllenweib, ich würde ja nicht bleiben, wenn nicht meine Tante schon ihr Mädchen gewesen wäre. Und man soll nun mal möglichst in der Familie bleiben. Kränkliches kleines Ding, unsere Miß Esme. Miß Ellen dagegen ist eine richtige kleine Dame. Meiner Seel’, man möchte meinen, daß sie die Tochter des Hauses ist und nicht die arme Verwandte. Paßt nur auf, eines Tages werden sie ihr noch was erzählen!«
Die anderen Mädchen erzählten auch von ihren Brotgebern und Schützlingen; ich hieß Esmeralda still zu sein, während wir lauschten. Unsere Spielgefährtinnen kreischten und wiegten ihre Puppen, während ich ganz nonchalant im Gras hinter den Bänken saß, auf denen sich unsere Kindermädchen niedergelassen hatten, und schamlos horchte. Ich war geradezu besessen auf alle Berichte über meine Mutter.
»Meine Tante sagt, sie sei sehr hübsch gewesen. Unsere kleine Dame hier ist vermutlich ihr genaues Ebenbild. Und mit der werden wir auch noch zu schaffen haben, da bin ich sicher. Na ja, hat ja noch Zeit. Zurückgekommen ist sie, sagt meine Tante, und in was für einem Zustand! Irgendwas ging schief, was, weiß man nicht genau, aber zurückgekommen ist sie. Zu ihrer Mutter, und hat das Kind mitgebracht. Du meine Güte, die ist wohl wirklich vom Regen in die Traufe gekommen. Sie haben sie immer spüren lassen, was sie gemacht hat. Und Miß Ellens Großmutter war ja genauso eine wie ihre Kusine Agatha. Um die Heiden hat sie sich gekümmert, aber ihrer eigenen Tochter das Leben zur Hölle gemacht ... Und dem kleinen Ding auch. Und dann stirbt unsere Miß Frances und läßt das kleine Würmchen zurück. Und dauernd erinnert man sie daran, daß sie nur eine Last ist. So eine alte Dame, wie Mrs. Emdon, und das kleine Kind ... das konnte ja nicht gutgehen! Und als die starb, nahm sie das Kleine. Mußte sie ja wohl. Und läßt das Kind bestimmt auch nie vergessen, was man alles für sie tut.«
So erlangte ich schon in früher Kindheit vage Kenntnis über meinen Lebenslauf.
Die Sache beschäftigte mich viel. Oft fragte ich mich, wer wohl mein Vater gewesen sei, aber ich konnte nichts über ihn entdecken. Wenn ich meine Vergangenheit überdachte, hatte ich das Gefühl, nie jemandem so recht lieb gewesen zu sein. Vielleicht schätzte mich Kusine Agatha in gewisser Weise, aber bestimmt nur als weiteren Pluspunkt auf ihrem Tugendkalender.
Groß herumzubrüten lag mir nicht. Aus irgendeinem Grund, und glücklicherweise, möchte ich sagen, hatte ich den festen Glauben, daß ich das Beste aus meinem Leben machen könnte, und Esmeralda schätzte mich jedenfalls als Ersatzschwester. Sie war ohne mich verloren. Es gelang mir nie, über längere Zeit alleine zu sein, immer suchte sie mich. Ihre eigene Gesellschaft lag ihr nicht. Vor ihrer Mutter hatte sie Angst, auch vor der Dunkelheit und vor ihrem Leben. Je mehr sie mir leid tat, um so glücklicher war ich über meine eigene Lebensart.
Den Sommer verbrachten wir immer in Cousin Williams Landhaus. War das eine Aufregung jedesmal! Tagelange Packerei, und wir Kinder wurden vor Aufregung ganz übermütig und planten, was wir alles auf dem Lande tun wollten. Mit dem zweisitzigen Wagen ging es dann zum Bahnhof, dort großes Gehaste und Gerenne zum Zug, und dann der Streit, ob wir in Fahrtrichtung sitzen sollten oder nicht. Allein das schon ein Abenteuer. Natürlich wurden wir von der Gouvernante begleitet, die dafür sorgte, daß wir aufrecht auf den Plüschbänken saßen und ich nicht zu laut wurde, damit Esmeralda in Ruhe die Landschaft ansehen konnte, durch die wir fuhren. Einige Leute von der Dienerschaft waren schon vorausgefahren, andere folgten nach. Kusine Agatha kam meist erst eine gute Woche später nach. Eine herrliche Zeit für uns. Und dann übertrug sie ihre guten Werke aus der Stadt- auf die Landbevölkerung. Der Besitz lag in Sussex – nahe genug bei London, so daß sie mühelos zurückfahren konnte, wenn eine entsprechende Gelegenheit dies erforderte. Auch Cousin William konnte so leicht seine Geschäftsinteressen verfolgen, ohne allzuoft die frische Landluft entbehren zu müssen. Esmeralda und ich lernten reiten, suchten die Armen auf, halfen beim Kirchweihfest und genossen die ländlichen Beschäftigungen wohlhabender Leute.
Einladungen gab es dort draußen genauso wie in der Stadt. Esmeralda und ich waren zwar noch nicht zugelassen, aber ich interessierte mich sehr dafür und zeichnete oft die Kleider der Besucherinnen und stellte mir vor, sie selbst zu tragen. Gemeinsam mit Esmeralda versteckte ich mich auf der Treppe, um ihre Ankunft zu beobachten. Ich sah sie in die Eingangshalle kommen, wo Kusine Agatha in all ihrer Stattlichkeit und Cousin William – im Vergleich zu ihr recht mickrig aussehend – zum Empfang bereitstanden.
Oft zog ich Esmeralda noch aus dem Bett heraus und zwang sie, mit mir durch die Geländerstäbe auf das glitzernde Gewirr da unten zu starren. Manchmal rannten wir zur Treppe vor; hätte einer von unten heraufgesehen, wären wir sofort entdeckt worden. Esmeralda zitterte daher immer vor Angst, aber ich lachte sie nur aus, denn ich wußte, daß man mich nie wegschicken würde, weil Kusine Agatha vor allem ihre Güte mir gegenüber beweisen mußte.
Ich tollte danach im Schlafzimmer herum und drängte Esmeralda, mit mir zu tanzen.
Auf dem Lande entdeckte ich auch, welch wichtige Position die Carringtons einnahmen. Selbst Kusine Agatha sprach diesen Namen mit einer gewissen Ehrfurcht aus. Ihr grandioses Haus, Trentham Towers, lag auf einem Hügel. Mr. Josiah Carrington war eine Art Landedelmann. Genau wie Cousin William betrieb er weitverzweigte Geschäfte und besaß auch in London ein Haus, in der Park Lane. Unser Kindermädchen hat es uns einmal gezeigt.
»Das Stadthaus der Carringtons«, flüsterte sie ehrerbietig, als sei es das Paradies selbst.
Den Carringtons gehörte der Großteil des Dörfchens und der umliegenden Farmen. Mr. Josiahs Frau war Lady Emily, die Tochter eines Earls. Natürlich war es einer der innigsten Wünsche der guten Agatha, mit den Carringtons auf vertraulichem Fuß zu verkehren. Und da sie zu den Frauen gehörte, die etwas nur zu wollen brauchten, um es tatsächlich zu bekommen, gelang ihr das auch. Cousin Williams Landhaus war in Georgianischem Stil gebaut, es hatte eine anmutige Säulenvorhalle und eine schwungvoll-elegante Fassade. Der Salon lag im ersten Stock. Ein großer luftiger Raum mit wunderschön verzierter Decke, ideal für Einladungen. Hier »empfing« Agatha an jedem Donnerstag, den sie draußen war, und zu ihren Abendessen und Bällen kamen viele Leute. Waren die Carringtons einmal nicht dabei, kränkte sie sich sehr.
Zu Lady Emily benahm sie sich sehr freundlich und tat, als interessiere sie alles, was diese Dame unternahm, während Cousin William und Mr. Carrington ebenso leidenschaftlich Geschäftsgespräche führten.
Philip Carrington war etwa ein Jahr älter als ich und zirka zwei Jahre älter als Esmeralda. Kusine Agatha lag sehr daran, daß er sich mit Esmeralda gut vertrug. Ich erinnere mich noch an jenen Frühsommer, in dem ich Philip zum erstenmal sah. Esmeralda war ihm im Salon vorgestellt worden, mich hatte man ausgeschlossen. Dann trug Kusine Agatha Esmeralda auf, Philip zu den Ställen zu begleiten und ihm ihr Pony zu zeigen.
Ich lauerte ihnen auf dem Weg auf und ging mit.
Philip war hellblond, hatte Sommersprossen auf der Nase und ganz hellblaue Augen; an Größe stand ich ihm nicht nach, denn ich war für mein Alter recht hochgeschossen. Er schien an mir interessiert zu sein, jedenfalls merkte ich, daß er nicht beabsichtigte, Esmeralda viel Beachtung zu schenken, und daß er sich außerdem ärgerte, mit einem Mädchen hinausgeschickt zu werden, noch dazu mit so einem kleinen.
»Du reitest wohl auch Pony?« spottete er.
»Und was reitest du?« fragte ich nur.
»Natürlich ein Pferd.«
»Pferde kriegen wir später auch«, sagte Esmeralda.
Er beachtete sie gar nicht.
»Wir könnten ebensogut Pferde reiten«, sagte ich. »Die sind ja auch nicht anders als Ponys.«
»Woher willst du denn das wissen?«
So ging es den ganzen Weg bis zu den Ställen hin.
Er verachtete unsere Ponys, und ich war böse auf ihn, weil ich mein Braunchen heiß liebte. Allerdings waren danach meine Gefühle für das arme Tier nie mehr so wie vorher. Er zeigte uns das Pferd, auf dem er herübergeritten war.
»Recht klein«, meinte ich.
»Trotzdem könntest du es sicher nicht reiten.«
»Doch, bestimmt.«
Eine Herausforderung! Esmeralda zitterte vor Angst und flüsterte mir warnend zu: »Nicht, Ellen, mach’s nicht!«, als ich sein Pferd bestieg. Dann ritt ich es wild innerhalb der Umzäunung. Ein wenig ängstlich war mir schon zumute, aber ich gönnte ihm keinen Sieg, und außerdem mußte ich die Beleidigung meines armen Braunchens wiedergutmachen.
Danach bestieg Philip sein Tier und zeigte uns einige Tricks, damit wir ihn bewunderten. Er gab richtiggehend an. Wir beide gingen andauernd wie Kampfhähne aufeinander los. Es machte uns aber offensichtlich beiden Spaß. Esmeralda waren diese Geplänkel zuwider, sie glaubte, wir haßten einander.
»Mama wäre es sicher nicht recht«, sagte sie. »Schließlich ist er ein Carrington.«
»Und ich bin eine Kellaway«, sagte ich. »Mindestens so viel wie eine Carrington.«
In jenem Sommer erhielt Philip Privatunterricht, und wir sahen ihn oft. Damals hörte ich zum erstenmal von Rollo.
»Dummer Name«, sagte ich, und Philip wurde rot vor Zorn. Rollo war zehn Jahre älter als sein kleiner Bruder. Philip sprach voller Stolz von ihm. Rollo muß also zweiundzwanzig gewesen sein. Er studierte in Oxford, und wenn man Philip glauben durfte, konnte er einfach alles.
»Schade, daß er seinen Namen nicht ändern kann«, sagte ich, nur um Philip zu ärgern.
»Ist sogar ein phantastischer Name, du blöde Gans! Ein Wikingername!«
»Die alten Piraten«, sagte ich verächtlich.
»Sie beherrschten die Meere. Wo immer sie hinkamen, siegten sie. Rollo war der große Anführer, der nach Frankreich fuhr, und der König dort hatte solche Angst, daß er ihm einen Riesenteil des Landes gab. Die heutige Normandie. Wir sind Normannen.« Er sah uns geringschätzig an. »Wir kamen dann hier herüber und haben euch besiegt.«
»Habt ihr nicht«, schrie ich. »Wir sind nämlich auch Normannen, nicht wahr, Esmeralda!«
Esmeralda war nicht sicher. Ich stupste sie. Sie hatte keine Ahnung, wie man mit Philip umgehen mußte. Nicht daß er oder ich ihre Meinung ernst genommen hätten.
»Wir waren aber bessere Normannen als ihr«, konterte Philip. »Wir waren die Herzöge und ihr nur das gewöhnliche Volk.«
»Stimmt überhaupt nicht ...«
Und so ging es weiter. Sehr zum Bedauern von Esmeralda, die diese Streitereien einfach nicht ausstehen konnte.
Mehr als einmal sagte Esmeralda zu mir: »Wenn Mama wüßte, daß du mit Philip so streitest, würde sie böse werden. Du weißt doch, daß er ein Carrington ist.«
Ich erinnere mich noch, wie Rollo von Oxford kam. Er ritt mit Philip aus, auf einem weißen Roß, und als die beiden vorüber waren, sagte ich zu Esmeralda, er müsse einen Helm mit Flügeln daran tragen, dann hätte er ganz das Aussehen eines Wikingers. Wir sprachen ihn nicht an. Philip grüßte im Vorüberreiten, machte aber gleichzeitig sehr deutlich, daß er keine Zeit für zwei Mädchen verschwenden konnte, wo so ein herrlicher Mann bei ihm war. Rollo sah uns kaum an.
Er wurde natürlich auch zu uns eingeladen, und man machte viel Theater um ihn; Kusine Agatha schmeichelte ihm geradezu kriecherisch. Unser Kindermädchen sagte nachher, man könnte meinen, er sei eine Gottheit. Die gnädige Frau habe schon die Krallen ausgestreckt, um ihn für Miß Esmeralda zu ergattern. »Sicher erbt er die ganzen Millionen«, sagte sie. »Natürlich wird der junge Herr auch seinen Teil abbekommen.«
Als wir in diesem Jahr nach London zurückgekehrt waren, sah ich Rollo öfter. In den Ferien besuchte er uns mit seinen Eltern. Ich fand es herrlich, wenn die Kutschen auf der Straße vor dem Tor anhielten. Die Besucher gingen unter einer rotgestreiften Markise ins Haus, Volk sammelte sich ringsum und sah dem Einzug zu. Ich beobachtete die Szene vom Kinderzimmerfenster aus.
Es waren wunderschöne Tage für mich. Oft wachte ich genußvoll mit einem Gefühl der Erwartung auf. Die Dienerschaft plauderte häufig über die Gäste, und es wurde dabei viel von den Carringtons gesprochen. Manchmal gingen Kusine Agatha und Cousin William zum Essen in die Park Lane. Wir sahen sie abfahren und bedauerten sehr, daß das Essen nicht in unserem Haus stattfand.
Wie schon gesagt, verbrachte ich viel Zeit bei der Dienerschaft; so oft wie möglich begab ich mich heimlich an deren Tisch und hörte den Gesprächen zu. War Esmeralda dabei, so wurden sie befangen. Meine Anwesenheit machte ihnen nicht so viel aus, wohl weil mein Schicksal einmal ihrem gleichen würde.
»Unsere Miß Ellen gehört weder hierhin noch dorthin«, hörte ich einmal jemanden sagen. »Wenn sie mal älter ist, wird sie sicher als Gouvernante vermittelt. Da bin ich lieber Häusmädchen. Da weiß man doch, wo man hingehört.«
Diese Gedanken erschreckten mich nur kurz. Ich war sicher, mich zur rechten Zeit selber um mein Schicksal kümmern zu können. Im Augenblick bot mir meine Stellung im Haus die herrliche Gelegenheit, auf beiden Seiten dabei zu sein. Die Dienerschaft unterhielt sich ganz ungezwungen vor mir. Bald wußte ich, daß er und sie Cousin William und Kusine Agatha waren, daß sie geizig war, jede Woche die Abrechnung der Küche durchsah, jedes einzelne Detail erbarmungslos abfragte, und daß er Angst hatte vor ihr und nicht wagte, seine Stimme gegen sie zu erheben. Sie wollte gesellschaftlich vorankommen. Wie sie doch diesen Carringtons nachlief! Einfach schamlos! Die hatten ein wunderbares Haus, sowohl in der Park Lane als auch in Sussex. Und die Köchin hatte etwas läuten gehört, daß sie ihn veranlaßt hatte, das Haus in Sussex zu kaufen, nur weil die Carringtons da draußen wohnten. All ihre kleinen Verschwörungen gingen darauf hinaus, gesellschaftlich weiterzukommen.
Mit Kopfnicken und Augenzwinkern (von dem sie annahmen, ich sei nicht schlau genug, es zu interpretieren) deuteten sie an, daß sie offenbar entschlossen war, ihre Familie mit den Söhnen der Carringtons zu verbinden, und da diese zwei Söhne und sie nur eine Tochter hatte, war die Methode leicht vorauszusehen.
Ich war erstaunt. Glaubte sie wirklich, Esmeralda mit Philip oder seinem Bruder verheiraten zu können? Beinahe hätte ich laut aufgelacht und überlegte, ob ich es Esmeralda erzählen oder vor ihr geheimhalten sollte. Es hatte keinen Sinn, sie völlig zu verschrecken. Es war ja so leicht, sie um ihr bißchen Geist und Mut nur mit ein paar Andeutungen zu bringen. Ich fand das Leben interessant. Ich beobachtete von hoch oben aus unserem Kinderzimmer die ankommenden Leute, die nach Kusine Agathas ständigem Ausspruch höher standen als ich, half unten in der Küche, wo ich gierig die Informationen aufnahm, wenn alle den Eintopf oder Hühnerauflauf mit dem guten Wein hinuntergespült hatten und müde geworden waren.
Daß mein Ursprung so geheimnisumwittert war, freute mich; ich hätte Kusine Agatha nicht zur Mutter haben wollen, was ich Esmeralda auch oft sagte, wenn ich böse mit ihr war. Cousin William war ja als Vater ganz angenehm, aber seine Ergebenheit gegenüber Agatha machte ihn nur verächtlich.
So kamen Herbst und Winter heran, hell lodernde Kaminfeuer, krachend platzende Maroni auf dem Herd. Der Muffin-Verkäufer, vorbeiklappernde Kutschen. Wir spähten hinaus zu den vorbeireitenden Leuten, und ich erfand alle möglichen Geschichten, denen Esmeralda andächtig lauschte. Manchmal fragte sie mich, woher ich denn wüßte, wer da unten war und wohin er ritt. Dann verengte ich meine Augen und pfiff vor mich hin. »Meine liebe Esmeralda, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als du dir in deinem Hirn ausdenken kannst.«
Sie erschauerte und sah mich ehrfürchtig an (was ich sehr genoß). Ich sprach oft in Zitaten zu ihr, und manchmal behauptete ich dann, die Worte selbst erfunden zu haben. Sie glaubte mir. Sie konnte nicht so schnell lernen wie ich. Schade eigentlich, denn ich hielt mich daher für um so schlauer. Kusine Agatha tat aber alles, um mir dies auszutreiben. Vielleicht war es also doch gar nicht so schlecht, denn wie ich aus den Gesprächen der Dienerschaft und Agathas Verhalten mir gegenüber entnahm, galt ich nicht viel im Haus. Und irgendwas brauchte ich ja, um mein Selbstvertrauen zu behalten.
Ich war sehr abenteuerlustig, und deshalb meinten manche, ich sei ein Tunichtgut. Märkte faszinierten mich über alles. In unserem Bezirk gab es keinen, aber einige Bedienstete gingen auf einen entfernt liegenden und erzählten gern davon. Ich beschwor unser Hausmädchen Rosie, mich einmal mitzunehmen. Sie war ein kleines Flittchen – nie ohne Liebhaber, auch immer noch ohne ernsthaften Verehrer. Von ihrer »untersten Schublade« wurde viel geredet, für die sie »dies und jenes« sammelte und jeweils in der Küche vorzeigte.
»Auf dem Markt gefunden«, rief sie dann mit glänzenden Augen, »und spottbillig dazu.«
Endlich nahm sie mich dann einmal mit, denn sie tat ganz gern mal was Verbotenes. Unterwegs erzählte sie mir von ihrem derzeitigen Liebhaber, dem Kutscher der Carringtons. Falls es mit dem doch was wurde, würde sie mit ihm in einem Häuschen über den Ställen wohnen.
Niemals werde ich den Naphtaqualm und die rauhen Stimmen der Marktfrauen und Ausrufer vergessen. An einigen Ständen hatte man Berge glänzend polierter Äpfel kunstvoll übereinander geschichtet, daneben lagen Orangen, Birnen und Nüsse. Es war ein Novembertag, man verkaufte bereits Stechpalmenzweige und Misteln. Ich bewunderte die Töpfe und das viele Geschirr, die gebrauchten Kleider. Beäugte die unzähligen Portionen von Aal in Aspik, den man dort essen oder mit heimnehmen konnte, und schnüffelte begeistert all die appetitlichen Dünste ein.
Vor allem gefielen mir die Leute, die mit den Verkäufern zu handeln und zu feilschen verstanden und dauernd von Stand zu Stand weitergingen. Für mich war so ein Markt einer der aufregendsten Orte, die ich mir denken konnte. Mit glänzenden Augen und geröteten Wangen kehrte ich heim und versuchte, Esmeralda mit dazu erfundenen Geschichten noch extra zu beeindrucken.
Unvorsichtigerweise versprach ich ihr, sie auch einmal dorthin mitzunehmen. Von da an fragte sie mich dauernd über den Markt aus, und ich dachte mir daher weiter die verrücktesten Vorfälle aus. Jede Geschichte begann so: »Als ich mit Rosie zum Markt ging ...«Was für phantastische Abenteuer wir dort angeblich erlebten! Esmeralda hielt den Atem an vor Erregung. Und dann ging ich wirklich eines Tages mit ihr hin und es passierte etwas, was Rollo auf mich aufmerksam machte. Der herrliche Rollo! Es war eine Woche vor Weihnachten, ein feuchter Tag, an dem der Nebel in den Parkbäumen hing. Solche Tage liebte ich – der Park sah dann aus wie ein verzauberter Wald, ganz in sanftestes Blau gehüllt. Ich sah zum Fenster hinaus und dachte: Heute nehme ich Esmeralda mit auf den Markt.
Und dieser Tag war außerdem sehr günstig, denn am selben Abend gab es bei uns ein großes Essen. Der ganze Haushalt drehte sich um nichts anderes mehr. »Die macht’s heute aber wild!« sagte die Köchin, womit sie Kusine Agatha meinte, deren Stimme man im ganzen Haus hörte: »Mrs. Hammer« – ihre seit langem an ihr leidende Gesellschaftssekretärin –, »haben Sie die Tischkarten bereit? Geben Sie ja acht, daß Lady Emily zur Rechten meines Mannes sitzt. Und Mr. Carrington zu meiner Rechten. Mr. Rollo sitzt in der Mitte des Tisches, natürlich auch rechts von seinem Vater. Sind die Blumen schon gekommen?« Sie stürmte durchs Haus wie ein Hurrikan. »Wilton« – der Butler -, »sorgen Sie dafür, daß der rote Teppich ausgerollt wird und die Markise an ihrem Platz ist. Und bitte rechtzeitig!« Dann zu ihrer Zofe Yvonne: »Lassen Sie mich nicht länger als bis fünf Uhr schlafen. Dann können Sie mein Bad bereiten.«
In der Küche ermahnte sie die Köchin (»als ob ich nicht selbst Bescheid wüßte«, sagte die). Ließ dreimal am Vormittag nach Wilton rufen, um ihm Instruktionen für die andere Dienerschaft zu geben.
So ein Tag war das. Als ich ihr auf der Treppe begegnete, ging sie an mir vorbei, ohne mich wahrzunehmen. Wieder dachte ich: »Heute ist der richtige Tag für den Markt.«
Unser Kindermädchen wurde zum Dienst am Büffet beordert. Wir waren also sans Gouvernante, sans Kindermädchen, sans Überwachung, sans alles, wie ich falsch zitierend zu Esmeralda sagte.
Dem Kindermädchen erklärte ich, daß wir beide uns schon selbst beschäftigen würden, und nach dem Tee, den wir heute schon um halb drei bekamen, marschierten wir los. Ich hatte mir vorsichtshalber die Nummer der Buslinie und die Haltestelle, an der wir aussteigen mußten, notiert, und wir erreichten den Markt ohne Zwischenfall. Inzwischen war es etwa fünf Uhr geworden.
Entzückt sah ich in Esmeraldas Augen tiefes Erstaunen sich ausbreiten. Wie ihr das alles gefiel! Die Geschäfte mit dem künstlichen Schnee, nichts als Watte an Fäden, die sich aber wunderhübsch machte, rund um das Spielzeug in den Schaufenstern! Ich zog sie zu den Fleischerläden, in denen die Schweine mit geöffnetem Bauch tot an den Haken hingen, neben riesigen Stücken Rindfleisch und Lammhälften, und davor der Fleischer in seiner Schürze, lange Messer schärfend, Kunden mit dem Ruf »Kauft Leute, kauft!« anlockend. Stände gab es mit hoch aufgetürmten Obstbergen und Nüssen, und dann die Altkleiderhändler und Leute, die Aal in Aspik aus blau-weißen Schüsseln aßen. Aus einem Geschäft drang der appetitanregende Duft frischer Erbsensuppe, wir blickten hinein, und drinnen saßen Leute auf Bänken und tranken die dampfend heiße Flüssigkeit. Einen Mann mit Drehorgel und Äffchen sahen wir, seine Kappe lag auf dem Boden, und die Leute warfen Geldstücke hinein.
Wie freute ich mich, daß Esmeralda der Meinung war, ich hätte den Zauber des Marktes kein bißchen übertrieben gehabt. Als die Frau des Drehorgelmannes mit ziemlich schriller Stimme zu singen begann, drängten sich die Leute um uns. Während wir noch zuhörten, wurde ein Wagen mit einer Menge klapperndem Eisengerät durch die Menge gefahren.
»Achtung, aufgepaßt!« rief eine fröhliche Stimme. »Platz da für den Lumpenheini! Aus dem Weg, bitte...«
Ich sprang aus dem Weg und wurde von der Menschenmasse bis zum Gehsteig mitgedrängt. Einige riefen den Altwarenhändler fröhlich an, und er antwortete freundlich und witzig. Ich schaute voller Interesse zu und überlegte, was das wohl für ein Mensch sei, und plötzlich merkte ich, daß Esmeralda nicht mehr neben mir stand.
Ich blickte mich rasch um. Kämpfte mich durch die Menge, rief ihren Namen, entdeckte sie aber nirgends.
Die Panik setzte nicht sofort ein. Irgendwo auf dem Markt mußte sie ja sein, weit konnte sie ja nicht sein. Ich hatte einfach angenommen, daß sie immer in meiner Nähe bleiben würde, hatte es ihr auch aufgetragen; sie war ja keine abenteuerlustige Natur. Überall hielt ich Ausschau nach ihr, aber sie war nirgends zu sehen. Nach zehn Minuten heftigster Suche fing ich an Angst zu bekommen. Ich hatte das Geld bei mir, das ich mit großer Mühe aus unseren Sparbüchsen geholt hatte. Wie leicht war es, Münzen in sie hineinzuwerfen, und wie schwer, sie wieder herauszukriegen. Das konnte man nur bewerkstelligen, indem man ein Messer in den Schlitz hineinsteckte, jeweils eine Münze darauffallen ließ und sie mit dem Messer herauszog. Wie konnte sie alleine ohne Geld heimkommen? Nach einer halben Stunde war ich schon sehr ängstlich. Ich hatte Esmeralda zum Markt mitgenommen und verloren.
Meine Phantasie – so aufregend lebendig zu Zeiten, da ich sie steuern konnte – zeigte sich jetzt als arglistiger Feind. Ich sah Esmeralda vor mir bei bösen Leuten, wie sie im Oliver Twist vorkamen, die ihr beibrachten, wie man Taschendieb wird.
Natürlich würde sie es lernen und sofort verhaftet und zu ihrer Familie zurückgebracht werden. Vielleicht nahmen sie Zigeuner mit. Auf dem Markt gab es einige. Mit Walnußsaft würde man ihre Haut dunkel machen und sie zum Körbeverkaufen abrichten. Vielleicht wurde sie als Geisel festgehalten und Lösegeld für sie verlangt. Und ich war schuld daran. Was konnte ich nur tun? Ich wußte es genau. Vor allem zurück nach Hause gehen. Gestehen, was ich getan hatte, damit man Suchtrupps nach ihr ausschickte.
Der Gedanke war mir entsetzlich, denn dies würde man mir nie vergessen und mich vielleicht doch noch in ein Waisenhaus schicken, denn wenn ich eine solche Sünde begangen hatte, war Kusine Agatha bestimmt berechtigt, mich wegzuschicken. Vermutlich wartete sie geradezu auf eine solche Gelegenheit. Es schien mir schwer, den Markt unter diesen Umständen zu verlassen. Nur noch einmal wollte ich mich umsehen, versprach ich mir selbst, und machte mich neuerlich auf die Suche nach Esmeralda. Aufmerksam sah ich mich überall um. Einmal meinte ich, sie erblickt zu haben, und lief dorthin, aber es war ein Irrtum.
Es wurde schon spät. Etwa eine halbe Stunde hatten wir wohl gebraucht, um herzukommen, und eine Stunde war bisher bestimmt schon vergangen. Jetzt hatte ich noch den Rückweg vor mir. Ich ging zur Bushaltestelle und wartete. Wurde immer verzweifelter. Dumme Esmeralda! dachte ich, und es tröstete mich ein wenig, ihr die Schuld zuzuschieben. Blödes kleines Ding! Warum war sie nicht bei mir geblieben? Endlich kam der Bus. Was sollte ich daheim sagen? Was würde es für Aufregung geben? Ob sie am Ende doch heimgefunden hatte? Mein Gott, was war bloß mit ihr passiert!
Ich stieg aus und wandte mich unserem Haus zu. Wollte heimlich beim Lieferanteneingang hineinschlüpfen. Schaudernd sah ich von weitem die rote Markise und den roten Teppich. Die Gäste kamen gerade an. Ich rannte zur Rückseite des Hauses. Mußte Rosie finden. Sie hatte bestimmt am meisten Verständnis. Vielleicht war sie bei den Pferdeställen, bei ihrem Kutscher, dessen Gegenwart sie sicher keinen Augenblick lang missen wollte.
Sie war aber nicht dort. Also mußte ich doch ins Haus und dem erstbesten, den ich traf, gestehen, was los war. Der Köchin? Die polterte bestimmt in der Küche herum und tat eilig noch die letzten Handgriffe. Unserem Kindermädchen? Sie wußte, daß ich leichtsinniges Blut in mir hatte, wie sie das nannte, und würde mich nicht gar so arg für meine Tat schelten. »So was liegt ihr eben im Blut«, würde sie dann sagen. Also marschierte ich erst mal beim Lieferanteneingang hinein. Unten traf ich niemanden an und ging die Treppe zur Eingangshalle hinauf. Dann erst hörte ich Stimmen.
Da stand ein Polizist, sehr ehrerbietig, überlegen und selbstsicher, und neben ihm, winzig und blaßgesichtig, Esmeralda.
»Auf der Straße aufgegriffen«, hörte ich den Polizisten sagen. »Sie hat sich verlaufen. Sobald sie uns sagte, wo sie hingehörte, haben wir sie hierhergebracht.«
Es war wie ein Tableau. Eines, das ich nicht so schnell vergessen würde.
Man hatte Kusine Agatha in ihrem tief ausgeschnittenen Glitzerkleid, behängt mit Diamanten und Smaragden und Rubinen, und William, im tadellosen Abendanzug, vom Treppenabsatz heruntergeholt, wo sie die Gäste empfangen hatten, um nun ihre vagabundierende Tochter von einem Polizisten in Empfang zu nehmen.
Einige Gäste standen an der Treppe. Eben kamen die Carringtons an. Mr. Carrington, Lady Emily und der einzigartige Rollo.
Ich sah, wie Kusine Agathas stattliche Gestalt vor Scham erstarrte. Nur die Smaragde und Ohrringe zeigten durch ihr Zittern Agathas tiefe Empörung an. Esmeralda fing zu weinen an.
»Ist ja schon gut, Fräuleinchen«, sagte der Polizist.
»Liebste«, sagte Lady Emily, »was ist denn bloß passiert?« Cousin William wollte erklären: »Unsere Tochter ist ...«, wurde aber sofort von Kusine Agatha zum Schweigen gebracht.
»Wo ist das Kindermädchen? Wie konnte das passieren? Esmeralda, du gehst sofort in dein Zimmer hinauf.«
Da sah mich Esmeralda durch ihren Tränenschleier und rief: »Ellen!«
Kusine Agatha wandte sich um. Ihr Blick durchbohrte mich.
»Ellen!« sagte sie mit einer Stimme, die nichts Gutes verhieß.
Ich trat vor. »Wir sind nur zum Markt gefahren«, begann ich zu erklären.
»Wilton!« Und da stand er schon. Geschniegelt, würdevoll, der diskrete, perfekte Butler.
»Sehr wohl, Madame«, sagte er, »ich lasse die jungen Damen in ihre Zimmer hinaufbringen.« Dann wandte er sich an den Polizisten. »Wenn Sie mir bitte folgen wollen, Sie hätten doch sicher gerne eine Erfrischung, und wir möchten Ihnen auch unsere Dankbarkeit zeigen. Madame, hier kommt eben das Kindermädchen.«
Ja, da kam sie und nahm Esmeralda und mich bei der Hand. Am harten Griff ihrer Finger erkannte ich, wie zornig sie war. Da gab es einiges zu klären, aber im Moment war ich-sehr froh, Esmeralda in Sicherheit zu wissen. Und noch etVas beeindruckte mich sehr. Der interessierte Blick meines einzigartigen Rollo. Kurze Zeit weilte er allein auf mir. Was dachte er wohl von mir, überlegte ich, als das Mädchen mich die Treppe hinaufscheuchte. Die Gäste hatten uns alle beobachtet, einige lächelten; und dann waren wir schon im zweiten Stock, in unserer Etage.
2
»Wir wollten doch nur mal den Markt sehen«, erklärte ich.
»Das kann mich leicht um meinen Posten bringen«, fauchte das Mädchen giftig. »Und ich weiß genau, wer das ausgeheckt hat, Miß Ellen. Versuchen Sie ja nicht, Miß Esmeralda die Schuld zuzuschieben. Die ist nur verführt worden.«
Esmeralda flüsterte: »Ich wollte aber so gerne hin.«
»Trotzdem, Sie wurden verführt!« sagte das Mädchen. »Ich kenne doch meine Ellen.«
»Schon gut, ja, es war meine Idee. Esmeralda trifft keine Schuld.«
»Ich möchte nicht wissen, was Madame Ihnen zu sagen hat. In Ihren Schuhen möchte ich nicht stecken!«
Ohne Essen wurden wir zu Bett geschickt, was uns allerdings nicht besonders störte, und ich lag dann noch lange wach, versuchte mir vorzustellen, wie es in einem Waisenhaus war.
Spätnachts, als die Gäste das Haus verließen, kam Rosie noch herein – mit blitzenden Augen, wie immer, wenn sie bei ihrem Kutscher gewesen war. Sie setzte sich auf den Bettrand und kicherte. »Sie sind mir aber eine! Miß Esmeralda hätten Sie nicht mitnehmen dürfen. War doch klar, daß die sich verlaufen würde oder sonst was.«
»Woher sollte ich wissen, daß sie so blöd sein würde!«
»Und einfach so loszumarschieren. Meine Güte, da wird es was abgeben.«
»Weiß ich.«
»Na ja, Kopf hoch, trotzdem. Auf dem Meer geht’s noch stürmischer zu, wie mein erster Verlobter immer zu sagen pflegte.«
»Wie ist das eigentlich in einem Waisenhaus?«
Rosies Gesicht wurde ganz weich. »Meine Nichte war im Waisenhaus. Eine richtige Dame heute. Ist als Gouvernante gegangen. Nicht bloß so ein Zimmermädchen. Ist richtig in der Gesellschaft. Es gibt viele Waisen in dieser Welt.« Sie beugte sich zu mir und gab mir einen Kuß. Ich wußte, daß sie mich trösten wollte. Ihr Kutscher hatte sie glücklich gemacht, und sie wollte, daß alle Welt so glücklich wurde. Vielleicht war es gar nicht so schlimm im Waisenhaus.
Am nächsten Tag ließ mich Kusine Agatha kommen. Sie sah aus, als habe sie eine schlaflose Nacht verbracht.
»Wie du dich aufgeführt hast«, begann sie. »Ich verzweifle wirklich an dir! Ich weiß, das überkommt dich immer, es liegt dir eben im Blut. Aber was sollen wir mit dir tun, habe ich auch meinen Mann gefragt. Die meisten Leute würden dich jetzt aus dem Haus weisen, schließlich müssen wir ja an unsere eigene Tochter denken. Aber Blut ist eben ein besonderer Saft, und du gehörst nun mal zur Familie. Du stellst unsere Geduld auf eine harte Probe. Meine und die meines Mannes. Ich warne dich: Wenn du in unserem Haus bleiben willst, wirst du dich ändern müssen.«
Ich sagte, ich hätte ja nicht wissen können, daß Esmeralda sich verlaufen würde, und wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, hätte keiner gemerkt, daß wir auf dem Markt gewesen waren.
»Betrug auch noch!« rief sie. »Es ist wirklich unerhört. Ich bin froh, daß Esmeralda sich verlaufen hatte, obwohl es mir den Abend verdarb. Wenigstens weiß man jetzt, was für eine bösartige Kreatur wir unter unserem Dach beherbergen.«
Sie hatte dem Kindermädchen aufgetragen, mich in meinem Zimmer zu halten, bis ich den Monolog der Portia über das Erbarmen aus dem Kaufmann von Venedig auswendig konnte. Vielleicht würde das helfen, mich denen gegenüber dankbar zu zeigen, die mir Erbarmen zeigten. Nur Brot und Wasser sollte ich bekommen, bis ich die Rede tadellos aufsagen konnte, und ich sollte meine Verdammung dazu nutzen, mir vor Augen zu führen, was ich Entsetzliches angestellt hatte. »Was die Carringtons von dir dachten, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie Philip nicht mehr mit dir zusammenkommen ließen.«
Damit wurde ich entlassen. Den Monolog lernte ich innerhalb kürzester Zeit. Später merkte Kusine Agatha, daß ich Gedichte liebte und es mir nicht schwerfiel, sie auswendig zu lernen. Daraufhin gab man mir Näharbeiten, und das war eine ganz andere Sache für mich. Schön klingende Worte und Sätze zu lesen, immer wieder zu lesen, machte mir Vergnügen. Einen Stoff zu besticken, war mir eine Qual. Das hatten sie damals allerdings noch nicht entdeckt.
Die arme Esmeralda konnte ihren Monolog nicht so schnell wie ich, und als sie ihn der Gouvernante aufsagen sollte, machte ich mich dicht an sie heran und half ihr weiter.
Um die Weihnachtszeit fing man an, die Sache mit dem Markt zu vergessen. Philip tauchte in den Schulferien wieder auf und durfte im Park mit uns spielen. Ich erzählte ihm vom Markt und wie Esmeralda sich dort verlaufen hatte; er fand das so verächtlich, daß er sie in den Serpentinenteich stieß. Esmeralda kreischte auf, und Philip lachte sie aus. Er blieb am Ufer stehen, während ich hineinrannte und sie an den Rand zog. Da kam schon das Mädchen angelaufen und jagte uns beide nach Hause zurück, wo wir uns umziehen mußten, damit wir uns nicht den Tod holten. »Das wird man mir in die Schuhe schieben«, rief ich Philip zu.
»Geschieht dir recht«, schrie er zurück. Ihm wäre es sicher ganz egal, ob Esmeralda sich den Tod holte oder nicht.
Als Esmeralda sich danach erkältete, erzählte das Kindermädchen einigen Mädchen vom Personal, was passiert war, und ich wußte, daß sie alle der Meinung waren, ich hätte Esmeralda ins Wasser gestoßen.
Arme Esmeralda! Ich glaube, wir waren alle rücksichtslos ihr gegenüber. Philip und ich, wir verbündeten uns zwar nicht gerade gegen sie, aber ihr fehlte einfach unsere Abenteuerlust, und wir waren zu jung, um zu erkennen, daß sie anders geartet war als wir. Ich erinnere mich noch, wie sehr sie sich vor dem »Toten Mann« fürchtete. Allein der Name dieses Ortes konnte einen ängstlichen Menschen erschrecken, und das traf zumindest bei Esmeralda zu. Die Stelle lag nicht weit von Trentham Towers. Man mußte ziemlich weit hinaufklettern. Von oben ging es dann ganz steil nach einer Seite hinunter. Es war recht gefährlich, denn der schmale Pfad lief den Steilhang entlang und war bei Regenwetter sehr schlüpfrig. Auf dem Weg dorthin standen viele Warnschilder: BETRETEN AUF EIGENE GEFAHR! Und genau das zog Menschen wie Philip und mich erst recht an.
Nicht nur gefährlich war es dort oben, sondern auch unheimlich, und man sagte, daß Gespenster umgingen, da sich viele Menschen von dort oben hinuntergestürzt hatten. In der Nachbarschaft sagte man zu melancholisch aussehenden Leuten: »Was ist denn los mit dir? Willst du vielleicht vom ›Toten Mann‹ hinunterspringen?«
Philip und ich liebten den Platz, und wir spotteten über Esmeralda, wenn sie zögerte, mitzukommen. Philip stand gerne am obersten Rand des Abgrunds, nur um zu zeigen, wie mutig er war, und ich mußte es ihm natürlich nachtun. Einmal wurden wir dort gesehen, und als Philips Hauslehrer davon erfuhr, verbot man uns, nochmals dort hinauf zu klettern. Dadurch wurde die Sache natürlich nur noch interessanter. Wir beide liebten das Verbotene.
Der »Tote Mann« wurde zu unserem Treffpunkt. »Also dann, beim ›TotenMann‹«, sagte Philip ganz nonchalant und hoffte insgeheim, daß ich Angst haben würde, alleine hinaufzugehen. Ich tat es aber jedesmal, obwohl es mir oben richtig unheimlich wurde, besonders wenn man alleine hinkam.
Die Zeit verrann immer rascher, und bald schon gab es einen neuen Vorfall, der Kusine Agatha wirklich Anlaß gegeben hätte, mich loszuwerden. Ich war vierzehn – in einem Alter also, da ich schon gescheiter hätte sein können. Es geschah während unseres Landaufenthaltes.
Philip wollte im Freien Tee trinken. Mit selbstgemachtem Feuer, Wasserkessel darüber und dazu ein Leben wie die Indianer oder Zigeuner (welche von beiden, wußte er noch nicht genau) – auf jeden Fall war das Großartige daran das Feuer. Wir brauchten einen Kessel, den sollte ich bringen.
»Habt ihr doch jede Menge davon in der Küche«, sagte Philip. »Ganz bestimmt. Bring Tee mit und Wasser und auch Kuchen. Dann machen wir ein Feuer.«
Esmeralda mußte den Kuchen aus der Küche besorgen, und ich kümmerte mich um den Kessel. Philip brachte Paraffin mit, damit ließ sich ein herrliches Feuer anfachen.
»Ich glaube, wir sind doch lieber Zigeuner«, sagte er. »Wir haben Esmeralda entführt. Sie ist aus ihrem Haus hinausgeschmuggelt worden, und wir binden sie fest und verlangen ein Lösegeld für sie.«
Sie jammerte: »Kann ich nicht auch eine Zigeunerin sein?«
»Nein, kannst du nicht«, sagte Philip barsch.
Arme Esmeralda. Immer mußte sie das Opfer sein.
Leider hatten wir bei diesem Abenteuer die Wirkung des Paraffins nicht einkalkuliert. Philip sammelte Reisig und goß jede Menge Öl darüber. Erst freuten wir uns an den hell auflodernden Flammen, dann erschraken wir. Wir konnten nicht mehr nahe daran kommen, Esmeralda lag aber mit zusammengebundenen Knöcheln und geknebelt in sehr unbequemer Lage nahe am Feuer.
Wir versuchten, der Flammen Herr zu werden, aber sie breiteten sich immer mehr aus. Ich hatte noch soviel Geistesgegenwart, Esmeralda loszubinden. Das ganze Feld schien inzwischen ein einziges Flammenmeer zu sein.
Es blieb uns nichts weiter übrig, als um Hilfe zu rufen. Alle Bedienten bemühten sich, das Feuer einzudämmen und zu verhindern, daß es auf die nahen Getreidefelder übergriff.
Wir bekamen einiges zu hören.
»Noch dazu bei den Carringtons«, sagte Kusine Agatha, als wäre deren Land geheiligt. Glücklicherweise war ein Carrington auch beteiligt, aber Kusine Agatha gab mir die meiste Schuld. Ich hörte sie zu Cousin William sagen: »Ellen ist einfach nicht zu bändigen. Ich zittere schon bei dem Gedanken, was sie Esmeralda das nächste Mal antun wird.«
Wieder bekam ich eine Vorlesung verpaßt.
»Du bist jetzt vierzehn Jahre alt. Viele mittellose Mädchen deines Alters verdienen sich da schon einige Jahre lang ihr Geld. Wir vergessen keineswegs, daß du mit uns verwandt bist, und haben deshalb versucht, gut zu dir zu sein. Aber die Zeit kommt immer näher, da du an deine Zukunft denken mußt. Weder mein Mann noch ich würden dich je auf die Straße setzen, und wir werden alles tun, um dir zu helfen, obwohl du es uns so oft mit Undank gelohnt hast. Aber diese letzte böse Eskapade scheint mir wieder einmal zu zeigen, daß all unsere Bemühungen umsonst waren. Du hast einfach keine Disziplin. Man muß dich bestrafen, und zwar am besten mit dem Stock. Ich habe meinem Mann gesagt, daß er dies übernehmen soll; er wird dich in deinem Zimmer aufsuchen und sich dieser schmerzlichen Pflicht entledigen. Außerdem wirst du ein neues Sticktuch beginnen, ich werde es jede Woche kontrollieren.«
Damit war sie aber noch nicht am Ende. Es kam viel schlimmer.
»Ich habe mit meinem Mann über deine Zukunft gesprochen, und wir sind beide der Meinung, daß du dein Geld einmal selbst verdienen mußt. Schließlich kannst du nicht erwarten, daß wir dich ewig unterhalten. Wir haben dich mit Esmeralda aufwachsen lassen – leider übst du keinen guten Einfluß auf sie aus, sie wäre oft ohne dich besser dran gewesen –, in wenigen Jahren wird man aber einen Ehegatten für sie finden, und sie braucht dich dann nicht mehr. Wir werden rechtzeitig den richtigen Posten für dich suchen, denn ein Mitglied unserer Familie kann wohl schlecht als Dienstbote arbeiten. Gouvernante oder Gesellschafterin käme allenfalls in Frage. Ganz so einfach, wie du dir das wohl denkst, wird es allerdings nicht sein, denn wir möchten dich nicht in einem Haushalt wissen, in dem wir manchmal zu Gast sind. Das wäre doch sehr peinlich. Wir müssen also den Posten mit größter Sorgfalt auswählen. Inzwischen solltest du dich auf diese Zeit vorbereiten. Viel lernen, noch mehr arbeiten, vor allem an deiner Näherei. Ich werde mit der Gouvernante darüber sprechen. Und wenn Esmeralda in die Gesellschaft eingeführt ist und heiratet, werden wir wohl schon wissen, wo wir dich unterbringen werden. Ich hoffe, du bereust wenigstens, was du getan hast. Nimm deine Strafe in Empfang, du verdienst sie wahrhaftig. Geh in dein Zimmer, mein Mann kommt dann zu dir.«
Armer Cousin William. Er tat mir leid. Ganz zaghaft trat er ein, den Rohrstock in der Hand, mit dem er mich züchtigen sollte. Seine Aufgabe war ihm sichtlich verhaßt. Ich mußte mich mit dem Gesicht nach unten auf mein Bett legen, und er strich leicht mit dem Stock über meine Schenkel. Am liebsten hätte ich hell aufgelacht.
Ganz rot war er im Gesicht und fühlte sich offenbar ganz elend. Plötzlich sagte er: »So, das hat dich hoffentlich eines Besseren belehrt« und verschwand.
Es war tröstlich für mich, über Cousin William lachen zu können, denn beim Gedanken an die Zukunft war mir nicht zum Lachen zumute.
In jener Nacht träumte ich wieder von dem Zimmer mit dem roten Teppich und wachte mit einem Gefühl übler Vorahnung auf.
3
Die Jahre vergingen immer schneller. Mein achtzehnter Geburtstag lag hinter mir. Die Zeit war nahe, da ich in die Welt hinaus und mein eigenes Geld verdienen mußte. Esmeralda tröstete mich: »Wenn ich erst einmal verheiratet bin, hast du bei mir immer ein Zuhause.«
Ich beneidete sie nicht. Sie war so gut. Etwas hübscher war sie geworden, aber wenn wir zusammen ausgingen, merkte ich jedesmal, daß die Leute mir nachschauten. Mein schwarzes Haar und die dunkelblauen Augen fielen auf. Und meine neugierige Nase – wie Philip sie nannte – wirkte stets so, als stelle ich eine Frage. Aber Esmeraldas Zukunft war wenigstens gesichert. Wir sahen es ja rings um uns geschehen. Mädchen wurden in die Gesellschaft eingeführt. Man arrangierte ihre Heirat, und über kurz oder lang waren sie junge Frauen mit Kindern. Alles wurde sehr sorgsam geplant.
Bei denen, die für sich selbst zu sorgen hatten, wie ich, sah es etwas anders aus.
Noch ein paarmal hatte ich durch Kleinigkeiten Kusine Agatha erzürnt, aber es waren keine so großen Sachen wie der Marktbesuch oder die Feuersbrunst. Auf dem Land mußten wir beiden Mädchen jetzt mehr an der wohltätigen Arbeit teilnehmen. Wir besuchten die Armen und brachten ihnen Delikatessen, wie Agatha das zu nennen pflegte – meistens Dinge, die sie für ihre eigene Tafel nie genommen hätte. Ehe wir nach London zurückkehrten, halfen wir die Kirche für das Erntedankfest zu schmücken. Gingen dann wieder zum Gymkhana und zu den Kirchenbasaren, bei denen wir selbst einen Stand hatten. Spielten die Rolle der Helfer der wohltätigen Dame, ritten in der Stadt im Park und reichten bei Agathas