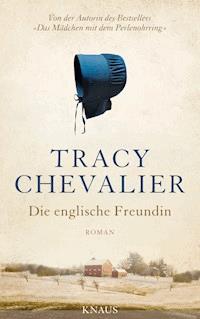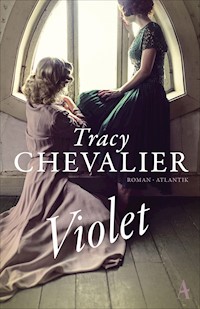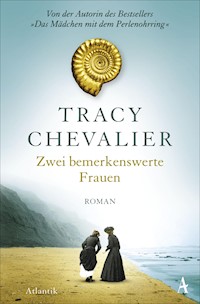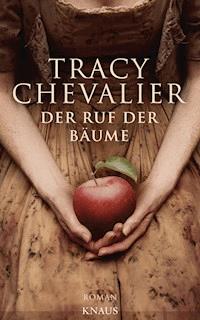Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Thalia Bücher GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Von der Autorin des Weltbestsellers »Das Mädchen mit dem Perlenohrring« Venedig, 1468. Auf Murano, Wiege der Glaskunst, fließt die Zeit sanft wie das Wasser in den Kanälen. Doch der tragische Tod des Glasvirtuosen Lorenzo Rosso, bringt die Welt zum Stillstand. In ihrer Verzweiflung nimmt Tochter Orsola das Schicksal der Familie in die Hand. Mutig kämpft sie gegen alle Konventionen und erlernt im Verborgenen das Handwerk des Vaters. Ihr gläsernes Geheimnis, zart wie die Perlen, die sie formt, trägt sie durch die Zeiten und das Leben der jungen Frau verschmilzt mit den Geheimnissen der Stadt. Orsolas Geschichte ist die Geschichte einer Frau, für die der Glaube an die Liebe und das Vertrauen auf sich selbst alles überdauern und zugleich eine Liebeserklärung an eine der romantischsten Städte der Welt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tracy Chevalier
Das Geheimnis der Glasmacherin
Roman
Claudia Feldmann
Für Ronna
Eine kurze Erläuterung der Zeit alla Veneziana
Die Stadt auf dem Wasser folgt ihrer eigenen Uhr. Venedig und seine Nachbarinseln schienen schon immer in der Zeit stehen geblieben zu sein – und vielleicht sind sie es wirklich. Es ist eine Stadt, die auf Holzpfählen über einer Lagune gebaut und von Kanälen durchzogen ist, und ihre Ästhetik und ein Großteil ihrer prachtvollen Architektur ist seit Jahrhunderten unverändert geblieben. Auch wenn die Boote mittlerweile motorbetrieben sind, scheint die Zeit dort noch immer in einem anderen Tempo zu vergehen als im Rest der Welt.
Einer von Venedigs funkelnden Schätzen ist seit Hunderten von Jahren das Glas von seiner Nachbarinsel Murano. Glas ist eine eigentümliche Substanz, es wird aus Sand hergestellt, der wie durch Zauberei durchscheinend oder sogar durchsichtig wird, wenn man ihn zum Schmelzen bringt. Bis heute herrscht Uneinigkeit darüber, ob Glas ein fester oder ein flüssiger Stoff ist. Lehrer der Naturwissenschaften haben ihren Schülern irrtümlich beigebracht, Glas fließe selbst lange nach dem Erkalten noch – wenn auch mit der Geschwindigkeit eines Gletschers –, und als Beweis dafür angeführt, dass sehr alte Glasscheiben bisweilen am unteren Ende dicker sind als am oberen. Tatsächlich jedoch fließt das Glas nicht äußerst langsam nach unten und sammelt sich an der Kante der Scheibe, sondern das dickere Ende resultiert aus der Art, wie Glasscheiben früher hergestellt wurden. Aber vielleicht wird dieser Mythos immer weitergegeben, weil wir gerne glauben möchten, dass Glas, wie die Insel, auf der es produziert wird, seinen eigenen Naturgesetzen folgt. Genau wie Venedig und Murano hat es sein eigenes Tempo.
Auch Menschen, die Dinge herstellen, haben ein zwiespältiges Verhältnis zur Zeit. Ob Maler, Schriftsteller, Schnitzer, Stricker, Weber oder Glasmacher – schöpferisch Tätige verfallen oft in einen versunkenen Zustand, den heutige Psychologen »Flow« nennen und in dem Stunden vergehen können, ohne dass sie es bemerken.
Leser ebenso.
Es ist erstaunlich schwer festzustellen, wie schnell die Zeit vergeht und ob sie für andere womöglich schneller vergeht als für Sie. Wie sollten Sie das auch wissen, wenn sämtliche Uhren an einem Ort in einem anderen Tempo ticken als anderswo? Oder wenn die Kunsthandwerker in der Stadt auf dem Wasser und auf der Insel des Glases langsamer zu altern scheinen als die im Rest der Welt?
Erster TeilKelche, Perlen und Delfine
1
Wenn Sie einen flachen Stein geschickt über das Wasser werfen, wird er viele Male in unterschiedlichen Abständen die Oberfläche berühren.
Ersetzen Sie, mit diesem Bild im Kopf, Wasser durch Zeit.
Beginnen Sie am Nordufer von Venedig, den Stein in der Hand, den Blick auf die Glasinsel Murano gerichtet, eine halbe Stunde mit der Gondel entfernt. Werfen Sie den Stein noch nicht. Es ist das Jahr 1486, der Höhepunkt der Renaissance, und Venedig genießt seine Stellung als Handelszentrum von Europa und einem Großteil der restlichen Welt. Es scheint, als würde die Stadt auf dem Wasser immer reich und mächtig sein.
Orsola Rosso ist neun Jahre alt. Sie lebt auf Murano, hat aber noch nicht mit Glas gearbeitet …
Der Kanal war nicht so tief, wie Orsola gedacht hatte. Als sie hineinfiel, versetzte ihr die Kälte des Wassers einen Schock, sie schlug wild um sich und sank hinab, bis ihr Fuß den schlammigen Grund berührte. In dem Moment verlor das, was ihr so tief und mächtig erschienen war, plötzlich sein Geheimnis. Sie hörte, wie ihre Mutter aufschrie, aber ihr Bruder Marco lachte, als Orsola hustend und spuckend wieder auftauchte, denn das Wasser reichte ihr nur bis zu den Schultern.
»Du hast mich geschubst!«, schimpfte sie. »Cretino!«
»Orsola, basta!«, ermahnte sie Laura Rosso. »Die Leute gucken schon.«
Das taten sie. In den Eingängen der Glaswerkstätten entlang der Fondamenta standen lauter Muraneser und lachten über das Mädchen im Kanal.
»Ich hab dich nicht geschubst«, gab Marco zurück. »Du hast nicht aufgepasst und bist reingefallen, bauca! Was hab ich bloß für eine dumme Schwester!«
Orsola, ihre Mutter und ihre Brüder kamen von einem Besuch bei ihrer Tante und ihrer Großmutter auf der anderen Seite der Insel zurück. Ihrer Nonna ging es nicht gut, und sie hatte darauf bestanden, sie zu sehen, weil sie überzeugt war, ihr Ende sei nah. Aber sie war munter genug gewesen, um aufzustehen und Orsola ein Säckchen mit Pinienkernen zu geben, das sie vor Kurzem auf dem Markt gekauft hatte, weil sie nicht wollte, dass sie ranzig wurden, falls sie tatsächlich starb. Zia Giovanna hatte nur mit den Augen gerollt, aber Orsola hatte das Säckchen sorgsam entgegengenommen und ihrer Großmutter versprochen, sie werde es Maddalena geben, ihrer Magd. Die Rossos waren gerade am Rio dei Vetrai entlanggegangen – dem Kanal der Glasmacher, der durch den Teil von Murano lief, wo viele der Glaswerkstätten lagen –, als Marco ihr einen kräftigen Stoß versetzt hatte, sodass sie ins Wasser gefallen war. Immerhin hatte sie die Geistesgegenwart besessen, das Säckchen mit den Pinienkernen im Fallen hinter sich zu werfen. Darauf wies die Familie später jedes Mal hin, wenn sie die Geschichte jemandem erzählte: dass die kleine Orsola so klug gewesen war, die kostbaren Pinienkerne nicht zu verschwenden.
Giacomo, schon immer der nettere Bruder und deshalb der weniger interessante, kletterte vorsichtig die algenbedeckten Stufen in der Nähe hinunter, kniete sich in den Schlamm und zog Orsola die glitschigen Stufen hinauf. Keuchend und spuckend landete sie auf der Fondamenta, wo sie von Scham erfüllt liegen blieb. Nur Betrunkene fielen in den Kanal, oder Leute, die sich im Dunkeln verlaufen hatten.
Laura Rosso half ihrer Tochter auf und begann sie mit ihrem Umhängetuch abzutrocknen. »Du bist ganz kalt und schmutzig«, brummte sie. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass die Leute nicht länger zu ihnen herüberstarrten, wies sie mit dem Kopf auf eine Tür in der Nähe. »Du solltest zu den Baroviers gehen und dich an ihrem Schmelzofen aufwärmen.«
»Das geht nicht«, widersprach Giacomo. »Die lassen sie doch niemals rein.«
»Sie werden aber nicht zulassen, dass ein Mädchen sich den Tod holt, selbst wenn es die Tochter eines Konkurrenten ist.« Mit berechnender Miene blickte Laura durch das elegante Gitterfenster in der Tür, dann öffnete sie sie und winkte ihre Tochter herbei. »Keinen Mucks. Halt die Augen offen und erzähl hinterher, was du gesehen hast.«
Orsola zögerte, aber mit ihrer Mutter debattierte man besser nicht. Außerdem war sie nass und fror, und der Ofen war verlockend; sie hörte sein gedämpftes Dröhnen. Vorsichtig schlich sie sich in den Durchgang. Ihre Mutter zog die Tür wieder zu und trennte sie damit von ihrer Familie. Als sie durch das kleine Fenster blickte, sah sie Marcos Grinsen, Giacomos besorgtes Gesicht und Laura, die sie mit einer Handbewegung vorwärts scheuchte.
Orsola folgte dem Gang in einen Hof, der menschenleer war, aber voller Kisten und Karren mit zerbrochenem Glas, Stapeln von Holzscheiten und langen Glasstäben in vielen verschiedenen Farben, die an der Wand lehnten. Der Boden glitzerte von winzigen Glassplittern, als wäre er mit buntem Raureif bedeckt. Der Hof wirkte ziemlich unordentlich. Drum herum lagen mehrere kleine Gebäude: ein Lager für Rohglas sowie Asche, Sand und Kalk, um es herzustellen; ein weiterer Lagerraum, dessen Tür einen Spalt offen stand, sodass sie Regale voller Schalen, Platten und Teller sehen konnte, Vasen in verschiedenen Größen, Formen und Farben, endlose Reihen von Gläsern und mehrere Kandelaber, ineinander verschlungen wie Tintenfische – und alles wartete darauf, verpackt und nach Amsterdam, Lissabon, London, Hamburg oder Konstantinopel geschickt zu werden, Städte, die ihr Vater manchmal erwähnte. Ein wenig abseits war ein kleiner Laden, in dem Besucher eine Auswahl fertiger Produkte kaufen konnten.
Die Anordnung bei den Baroviers ähnelte der in der Werkstatt von Orsolas Familie, allerdings war die kleiner, und Lorenzo Rosso legte größten Wert auf Ordnung und Sauberkeit. Seine Lehrlinge beschwerten sich, dass sie in den ersten Monaten nur Werkzeuge bereitlegen und Karren hin und her schieben durften und nie mit heißem Glas zu tun hatten. Jede Werkstatt hatte ihren eigenen Stil, gemäß dem Charakter des Maestro. Offenbar gehörte Maestro Giovanni Barovier zu den Unordentlichen.
Dennoch waren die Baroviers die berühmteste Familie der Glaswelt. Aus diesem Durcheinander hatte Giovannis Vater Angelo Barovier zahllose Erfindungen hervorgebracht, darunter auch das cristallo veneziano – Klarglas, das die Arbeit auf Murano grundlegend veränderte, als anderen Maestri gestattet wurde, es zu kopieren – und calcedonio, ein Glas, das aussah wie der Halbedelstein Chalzedon. Die Baroviers waren auch die Ersten, die Glas zu langen Stäben gezogen hatten, wie sie jetzt alle Glasmacher für die Dekoration ihrer Kelche, Kronleuchter und Teller verwendeten. Angelo war schon vor Jahren gestorben, aber Giovanni führte die sorgsam gehüteten Traditionen fort. Alle Glasfamilien hatten ihre Geheimrezepturen, die sie für sich behielten. Niemand wollte, dass Eindringlinge kamen und ihnen über die Schulter sahen.
Am Eingang zur Werkstatt zögerte Orsola. Sie konnte den Schmelzofen hören und Männerstimmen, die einander bei der Arbeit etwas zuriefen. Warum war sie hier? Bestimmt würde man sie entdecken und hinauswerfen wie eine kaputte Schale. Doch ihre Mutter war sehr entschieden gewesen, und so öffnete sie die Tür einen Spalt und schlüpfte mit einem Knoten im Magen hinein.
Die Werkstatt war voller Männer, die Hefteisen – lange Eisenstäbe – mit Kugeln aus geschmolzenem Glas am Ende in den Ofen schoben und wieder herauszogen, sie drehten, das Glas auf einer flachen Metallplatte hin und her bewegten, es in verschiedene Holzformen drückten und fertige Stücke in den Kühlofen legten, damit sie langsam erkalten konnten. Jungen kümmerten sich um das Feuer, fegten und trugen Eimer mit Wasser hin und her. Alle bewegten sich um den Maestro herum, der an seiner Werkbank saß. Orsola kannte diese eigentümliche Geschäftigkeit, obwohl die Werkstatt der Baroviers größer und lauter war als die von Lorenzo Rosso, mit mehr Gepfeife und Gebrüll. Sorgsam dem Getümmel aus dem Weg gehend, schlich sie näher an den Ofen heran. Doch einer der garzonetti bemerkte sie – einer der Jungen, die sich rund um den Schmelzofen nützlich machten, in der Hoffnung, eines Tages garzone zu werden, Lehrling des Glasmacherhandwerks. Er fegte den Boden und erstarrte, als er sie sah. Orsola hob den Finger an die Lippen. Sag nichts, flehte sie lautlos. Verrat mich nicht.
Dann entdeckte sie jemanden inmitten all der Männer, der sie den garzonetto vergessen ließ: eine Frau, die sich ein wenig abseits hielt, die Hände in die Hüften gestemmt. Alles an ihr wirkte eckig: die Schultern, die Stirn, sogar der Knoten ihres hochgesteckten grauen Haars. Während alles um sie herum in Bewegung war, stand sie nur da und rührte sich nicht.
Das war Maria Barovier, Tochter von Angelo und Schwester von Maestro Giovanni. Orsola wusste von dieser Frau, hatte sie aus der Entfernung gesehen, wie sie die Riva entlangstapfte oder den Campo Santo Stefano überquerte oder in der Heiligen Messe saß, die Augen geschlossen, als schliefe sie, das Kinn kantig wie ein Spaten. Maria Barovier war eine der ganz wenigen Frauen unter den Glasmachern, und sie war berüchtigt für ihre scharfe Zunge. Sie wurde Marietta genannt, aber Orsola fand, diese Koseform passte nicht zu einer so ehrfurchtgebietenden Frau.
Sie betrachtete einen dicken Glasstab, den ihr einer der garzoni hinhielt – ein Jüngling mit schmalem Gesicht, der ein oder zwei Jahre älter war als Orsolas Bruder Marco. »Nein. Das Rot muss mehr zu sehen sein, wegen der Ausgewogenheit, sonst wird die Perle vom Weiß und Blau dominiert. Hörst du denn nie zu?« Ihre Stimme klang tief und verärgert. »Wo ist die Holzform? Ich werde es dir noch mal zeigen müssen, und allmählich bin ich es leid.«
Der Junge wirkte so verängstigt wie die meisten neuen garzoni, wenn sie sich ihrer Anstellung noch nicht sicher waren. Als er sich von seiner Dienstherrin abwandte, fiel sein Blick auf Orsola. Seine Augen waren sehr dunkel, fast schwarz, und Orsola fühlte sich plötzlich wie gelähmt.
Maria Barovier folgte seinem Blick. Ihr Stirnrunzeln ließ nicht nach, nicht einmal als sie den Algenschleim auf Orsolas Kleid bemerkte. »Raus, Rosso«, herrschte sie sie an. »Spia.«
Orsola floh und bekam in ihrer Hast zunächst die Tür nicht auf. Die Männer, ganz mit ihrem Glas beschäftigt, drehten sich nicht einmal um; um das Drama sollten sich Frauen und Lehrlinge kümmern. Knirschend lief sie über die Splitter im Hof zum Tor und floh hinaus auf die Fondamenta dei Vetrai. Obwohl sie nur wenige Augenblicke fort gewesen war, kam es ihr vor, als wären es Stunden gewesen, als hätte sie eine neue Welt betreten und wieder verlassen. Ihre Familie war nicht mehr da. Sie würden zu Hause auf sie warten, und ihre Mutter würde einen ausführlichen Bericht hören wollen, dabei hatte Orsola kaum etwas gesehen. Glasfamilien waren nicht unfreundlich, aber ihre Werkstätten, ihre Arbeit, ihre Geheimnisse wurden nicht geteilt. Ab und zu tranken die Maestri zusammen, spielten Karten und schimpften über Zölle oder Kaufleute vom Rialto auf der anderen Seite der Lagune, die versuchten, sie übers Ohr zu hauen, oder über den launischen Rat der Zehn, der immerzu neue Vorschriften erließ, was sie produzieren durften und was nicht. Aber sie sprachen nie über das Glas, das sie herstellten. Es war typisch für die Muraneser, dass sie zusammenhielten, wenn es um ihre Insel und das gemeinsame Handwerk ging, aber die Arbeit der Konkurrenten hinter deren Rücken kritisierten: unsaubere Technik, abgekupferte oder langweilige Gestaltung. Ihre eigene war stets besser.
Orsola hatte nur ganz kurz am Ofen der Baroviers gestanden und war immer noch nass und fror. Sie lief über die Fondamenta und den Ponte di Mezzo nach Hause. Bruno, ein stämmiger junger Bootsführer, den jeder auf Murano kannte, ruderte den Kanal entlang und kam gerade auf die Brücke zu. Er zeigte mit dem Ruder auf die Algen, die sich über ihr Kleid zogen. »Na, du Schlammzwerg?«, rief er. »Dein Bruder hat mir erzählt, dass du in den Kanal gesprungen bist. Wolltest wohl Meerjungfrau spielen, was? Oder Delfin?«
»Ich bin nicht gesprungen! Er hat mich geschubst.«
Bruno lachte. »Welchem Rosso soll ich denn jetzt glauben?«
Sie warf ihm einen wütenden Blick zu und lief weiter, ohne auf die Bemerkungen der Nachbarn zu achten, wie schmutzig sie war und wie ungeschickt. Als sie beim Haus der Rossos ankam, stieß sie das Eisentor auf, das in den Werkstatthof führte. Auf der einen Seite befanden sich die Lagerräume, auf der anderen der Innenhof und das Wohnhaus der Familie. Am hinteren Ende lag die Werkstatt mit dem Schmelzofen, der Tag und Nacht brannte. Er durfte niemals ausgehen, außer im August, wenn es zu heiß für die Arbeit war und die Glasmacher ihre Sommerpause einlegten. Ein Durchgang neben der Werkstatt führte zu einem kleinen Anleger, wo Boote die fertigen Teile einluden, um sie zu den Kaufleuten nach Venedig zu bringen, oder Sand für die Glasherstellung und Holz für den Ofen anlieferten. Unentwegt kamen Boote mit Brennholz von der terraferma, dem Festland, wo es viel mehr Bäume gab als auf den Inseln.
Orsola wäre gerne in die Werkstatt gegangen, um sich am heißen Ofen aufzuwärmen und zu trocknen, aber ihre Mutter erwartete sicher, dass sie sofort vor ihr erschien. Und so bog sie stattdessen in den Innenhof ab und ging zur Küche, wo es ebenfalls einen Ofen gab, wenn auch kleiner, denn zum Kochen musste er nicht so heiß sein wie für das Schmelzen von Glas. Manchmal schob Maddalena, wenn sie eine besonders starke oder schwache Hitze brauchte, Töpfe in die verschiedenen Kammern des Werkstattofens, obwohl Lorenzo es nicht gerne sah, wenn sie in sein Reich eindrang.
In der Küche saß Marco an dem langen Tisch, wo die Familie die Mahlzeiten einnahm, wenn es im Innenhof nicht warm genug war, um draußen zu essen. Er knabberte genüsslich die Pinienkerne ihrer Großmutter, während Laura Rosso Zwiebeln hackte und Maddalena Sardinen für sarde in saor briet, das süßsaure Gericht, das sie oft aßen.
»Dein Kleid!«, rief Maddalena aus. »Was hast du bloß angestellt? Zieh es sofort aus!«
Laura blickte von ihren Zwiebeln auf. »Das hat ja nicht lange gedauert. Was hast du gesehen?«
Ihre Neugier, verbunden mit Marcos Unbekümmertheit – er warf jetzt die Pinienkerne in die Luft und fing sie mit dem Mund –, brachte Orsola auf den Gedanken, ob das Ganze geplant gewesen war; ob ihr Bruder sie absichtlich direkt vor der Werkstatt der Baroviers geschubst hatte, damit sie in den Kanal fiel und hineingehen musste.
»Es war viel Betrieb in der Werkstatt, lauter Männer«, begann sie.
»Woran haben sie gearbeitet?«
»Ich weiß nicht.« Sie hatte mehr auf Maria Barovier geachtet als auf den Maestro. »Kelche, glaub ich.« Die meisten Glasmacher fertigten Weingläser an, damit konnte sie also nicht viel falsch machen.
»Du hast nicht mal mitgekriegt, woran sie gearbeitet haben!«, höhnte Marco. »Bauca! Du hättest besser mich reingehen lassen, Madre.«
Also war es tatsächlich geplant gewesen. Ein bisschen freute sie sich, dass sie dafür ausgewählt worden war und nicht ihr Bruder.
Maddalena nahm ihm das Säckchen mit den Kernen weg. »Schluss jetzt, sonst sind nicht mehr genug für das saor übrig!«
»Maria Barovier war da«, fuhr Orsola fort.
»Marietta?« Laura Rosso ließ das Messer sinken. »Was hat sie gemacht?«
»Sie hat mit einem garzone gesprochen. Geschimpft, genauer gesagt, wegen eines Glasstabs.«
»Soso. Hast du den Stab gesehen?«
Orsola nickte.
»Wie dick?«
»Wie Papàs Daumen.«
»Welche Farbe hatte er?«
»Rot, weiß und blau.«
»Seltsame Mischung.«
»Sie hat gesagt, das Rot wäre wichtig, für die Ausgewogenheit.« Orsola stutzte. »Rosso«, wiederholte sie. Der Name ihrer Familie. Plötzlich fiel ihr auf, dass Maria Barovier gewusst hatte, dass sie eine Rosso war. Aber sie sagte ihrer Mutter nicht, dass die Glasmacherin sie eine Spionin genannt hatte. »Er war für Perlen gedacht. Sie hat von einer Holzform gesprochen.«
»Perlen! Rot-weiß-blaue Perlen. Und nicht nur aus einem Stab, sondern auch noch geformt«, sagte ihre Mutter nachdenklich. »Per favore, zieh das schmutzige Kleid und das Hemd aus und such dir etwas Trockenes. Und kein Wort über diese Perlen, zu niemandem. Ich muss mit deinem Vater sprechen.«
Orsola schlüpfte aus ihren nassen Sachen und warf sie auf den Haufen mit schmutziger Wäsche, der niemals kleiner zu werden schien. Die Männer und Jungen in der Werkstatt schwitzten wegen der Hitze des Ofens so sehr, dass sie jeden Tag ihre Kleider wechseln mussten, und sie und ihre Mutter waren unentwegt dabei, Wasser zu erhitzen, Wäsche in einem Fass mit Lauge umzurühren, die auf der Haut brannte, Hemden, Hosen und Unterwäsche zum Trocknen aufzuhängen oder nasse Laken zum Bleichen auf der Wiese hinter dem Kloster Santa Maria degli Angeli auszubreiten. Laura Rosso hasste das Waschen, und Orsola ahnte, dass ihre Mutter ihr die Aufgabe ganz übertragen würde, sobald sie alt genug war, um es allein zu schaffen.
An dem Abend saß Orsola mit Giacomo in einer Ecke der Küche und ließ eine Murmel hin und her rollen, die Paolo, der Geselle ihres Vaters, für sie gemacht hatte. Marco stocherte im Feuer herum. Lorenzo trank Wein, während Laura einen Flicken auf den Ärmel seines Hemds nähte, wo ein Stück heißes Glas ein Loch hineingebrannt hatte.
»Marietta Barovier macht etwas Neues«, sagte Laura zu ihrem Mann. »Ich habe Gerüchte von den Frauen einiger Maestri gehört. Jetzt weiß ich es. Sie macht Perlen.«
»Perlen?«, erwiderte Lorenzo Rosso. »Das ist nichts, weswegen wir uns sorgen müssten.«
»Es scheinen besondere Perlen zu sein. Aufwendige Perlen, die sich vielleicht gut verkaufen.«
»Aber wir stellen keine Perlen her, also ist es keine Konkurrenz für uns.«
»Vielleicht sollten wir.«
»Vielleicht sollten wir was?«
»Perlen herstellen«, sagte Laura gereizt, als wäre ihr Mann schwer von Begriff.
Er schüttelte den Kopf. »Wir können gut von Gläsern, Krügen und Schalen leben. Wenn wir damit anfangen wollten, müssten wir Stäbe ziehen, und das können meine Männer nicht.« Um einen Stab herzustellen – ob zur Perlenherstellung oder für andere Glasarbeiten –, mussten zwei Männer ein Stück geschmolzenes Glas zwischen sich auseinanderziehen, bis es einen langen, dünnen Zylinder bildete. Dazu brauchte man viel Platz und Fähigkeiten, die andere bereits perfektioniert hatten. Die Rossos kauften Stäbe von anderen Glasmachern, anstatt selbst welche anzufertigen. Außerdem beschränkte Lorenzo das Angebot seiner Werkstatt auf Gläser, Krüge und Schalen, weil er der Ansicht war, es sei besser, Dinge herzustellen, die die Leute immer brauchen würden, statt kunstvolle Kronleuchter und Kerzenständer. Es war eine traditionelle, bodenständige Werkstatt, die immer Aufträge haben, aber niemals reich werden würde.
»Willst du es nicht trotzdem mal durchrechnen?«, beharrte seine Frau. »Die Kosten für den Kauf eines Stabs durch die Anzahl der Perlen teilen, die du daraus herstellen könntest? Und schauen, wie viel sich damit verdienen ließe?«
Lorenzo Rosso warf ihr einen kurzen Blick zu, und Orsola wusste, was er bedeutete: Schluss mit den Fragen.
Einen Monat später präsentierten die Baroviers der Welt die rosetta, eine ovale Perle, so groß wie das oberste Daumenglied eines Mannes. Sie war aus roten, weißen und blauen Glasstäben gefertigt, die in eine Sternenform gepresst und dann zu einem langen Zylinder ausgezogen wurden. Dieser wurde, sobald er ausgehärtet war, in kleine Stücke geschnitten und dann an den Enden rundgeschliffen, sodass aus der blauen äußeren Schicht ein Stern mit zwölf weißen Spitzen und roter Mitte erschien. Sie sah aus wie eine gezackte Muschel, originell und faszinierend. Als Laura Rosso zum ersten Mal eine in der Hand hielt, erklärte sie, die Perle sei unglaublich hässlich, wer denn so etwas tragen wolle? Doch Orsola liebte sie; sie waren so überraschend, anders als alles, was bisher auf Murano hergestellt worden war. Nach und nach begannen sich die rosette zu verkaufen – anfangs nur in kleinen Mengen, da sie so fremdartig waren, aber nach einer Weile wurden sie vor allem bei afrikanischen Stammeshäuptlingen äußerst beliebt. Der Doge von Venedig gab Maria Barovier sogar die Erlaubnis, sich einen eigenen kleinen Ofen zu bauen, um diese besondere Perle herzustellen, die sie erschaffen hatte. Eine Frau mit einem eigenen Schmelzofen – das hatte es noch nie gegeben. Und es würde vermutlich auch nicht wieder vorkommen, solange sich die Welt nicht bedeutend veränderte.
Orsola begegnete Maria manchmal auf der Fondamenta dei Vetrai oder auf dem Markt am Campo Santo Stefano, wo sie um die Sardinen feilschte, als wäre jeder soldo ein ducato, obwohl die Baroviers so wohlhabend waren, dass sie sich um den Preis von Fisch keine Gedanken zu machen brauchten. Ab und an sah Orsola sie auch während der abendlichen passeggiata, wenn die Muraneser zum geselligen Austausch aus ihren Häusern kamen, allein am Rand des Campo San Bernardo entlangflanieren. Maria Barovier grüßte sie nie, aber manchmal warf sie ihr einen Blick aus den Augenwinkeln zu, als wollte sie sagen: »Du bist Orsola Rosso, und ich weiß, dass du da bist.«
Orsolas Leben war bestimmt von dem niemals kleiner werdenden Wäscheberg, dem Gemüsegarten und dem Putzen, doch sie nutzte jeden Vorwand, um in die Werkstatt zu gehen, gab Nachrichten weiter oder brachte den Arbeitern biscotti, die Maddalena gebacken hatte. Dann blieb sie noch ein wenig und sah zu, wie sie Vasen oder Gläser anfertigten oder einmal auch kunstvolle Kelche für einen der Palazzi, die die Venezianer am Canal Grande di Murano besaßen. Murano war nur eine halbe Stunde mit dem Boot von Venedig entfernt, aber die reichen Venezianer nutzten die Insel zur Erholung von dem Prunk und Trubel, in dem sie normalerweise lebten. Sie mischten sich nicht unter die Glasmacher und Fischer und tranken nicht in den Tavernen, sondern veranstalteten ihre eigenen Feste und brachten ihre eigenen Dienstboten und Gondolieri mit. Aber sie schauten sich gerne an, was in den Glaswerkstätten produziert wurde. Der größte Teil der Muraneser Glasarbeiten wurde ins Ausland verschickt, aber ein paar Stücke wurden stets zurückbehalten, um sie an Venezianer und andere Besucher zu verkaufen.
Wenn solche Leute in den kleinen Laden der Rossos kamen, sah Orsola, wie ihre Mutter hastig die Schürze abnahm, sich übers Haar fuhr, ihre perfekt gewölbten Augenbrauen glatt strich und hinübereilte, um ihnen zu zeigen, was Maestro Lorenzo Rosso in letzter Zeit geschaffen hatte. Oft sahen sich die reichen Venezianer nur um und gingen wieder, doch manchmal kauften sie Stücke vom Maestro oder zur allgemeinen Überraschung sogar einen Krug oder Kelch, den Paolo gemacht hatte. Der stille Paolo, kahlköpfig und mit mächtiger Brust und starken Armen, war Lorenzos servente – sein wichtigster Mitarbeiter, direkt dem Maestro unterstellt – und ein geschickter Glasmacher. Wenn eines von seinen Stücken im Laden verkauft wurde, sagte Laura Rosso es ihm, und dann lief er rot an und wandte sich mit einem kleinen Lächeln wieder zum Schmelzofen, während die anderen ihn gutmütig aufzogen. Er war ein sanfter Lehrer, brüllte und schimpfte nie, sondern korrigierte nur die Handhaltung, um ein Werkstück richtig zu formen, reichte ein anderes Werkzeug oder deutete mit dem Kopf auf den Schmelzofen, damit das Glas wieder erhitzt wurde.
In der Werkstatt der Rossos arbeiteten mehrere garzonetti, die den Ofen mit Holz versorgten, die Böden fegten, Werkzeuge wegräumten und Wasser holten, um den Durst der Arbeiter zu stillen. Wenn sie fünf Jahre durchhielten, wurden sie garzoni und absolvierten eine sechsjährige Lehre, um das Handwerk von Lorenzo und Paolo zu lernen. Orsola liebte es zuzuschauen, wie die garzoni in einer Art Tanz um ihren Vater herumwirbelten, sich hinknieten und durch das lange Eisenrohr, die sogenannte Glasmacherpfeife, bliesen, um das geschmolzene Glas aufzuwölben, während er die Pfeife drehte, ihm die Pfeife abnahmen, um das Glas erneut im Ofen zu erhitzen, ihm die hölzernen und metallenen Werkzeuge reichten – Paddel oder Pinzetten, Zangen oder Scheren –, wenn er sie brauchte, Blattgold bereitlegten, kleinere, auf die richtige Temperatur erhitzte Glasstücke brachten, damit er sie an das Werkstück, an dem er arbeitete, anfügen konnte, und schließlich das fertige Stück vom Hefteisen abbrachen und zum Kühlofen trugen. Der Maestro war der Mittelpunkt des Tanzes, der Dirigent, der alles leitete. Alles folgte einem bestimmten Rhythmus, und das musste auch so sein, denn sonst gelang das Stück nicht. Abgesehen von gelegentlichen kurzen Anweisungen sagte er kaum etwas. In manchen Werkstätten sangen die Männer, rissen Witze oder erzählten Geschichten über Frauen oder Boote, doch Lorenzo Rosso zog es vor, bei der Arbeit zu schweigen. Seine Arbeiter passten sich dem an; wenn es ihnen nicht gefiel, wechselten sie zu einer lauteren Werkstatt.
Marco und Giacomo hatten ebenfalls als garzonetti angefangen, denn ihr Vater weigerte sich, seine Söhne bevorzugt zu behandeln; sie mussten genau wie alle anderen ihre Zeit als Hilfsjungen absolvieren, bevor sie zu garzoni aufsteigen und das Handwerk von der Pike auf lernen konnten. Giacomo war ruhig wie sein Vater, tat, was man ihm sagte, und beobachtete jeden Vorgang aufmerksam. Er folgte Paolo auf Schritt und Tritt und war immer derjenige, der zerschelltes Glas rasch auffegte, das fehlende Paddel fand oder mit der Pinzette vorsichtig das Blattgold aufhob, das sein Bruder achtlos mit dem Ärmel von der Arbeitsplatte gewischt hatte. Selbst wenn er mit der Arbeit fertig war, blieb Giacomo in der Werkstatt und fertigte einen goto nach dem anderen an, einfache Trinkgläser, die Lehrlinge zu Übungszwecken herstellten.
Marco war anders. Er besaß Talent, mehr als Giacomo, vielleicht sogar mehr als sein Vater, worauf er sich nicht wenig einbildete, aber er war faul. Er machte nie goti. Wenn ihn eine neue Technik, Farbe oder Gestaltung interessierte, konnte er wie ein Besessener arbeiten. Wenn er auf Schwierigkeiten stieß, wenn er feststellte, dass die Arbeit komplizierter war als gedacht, wurde er wütend, zerbrach das halb fertige Stück und stürmte aus der Werkstatt. »Die Frau, die ihn mal heiratet, wird es nicht leicht haben«, bemerkte Laura nach einem seiner Wutanfälle, aber sie und ihr Mann schalten ihn nicht, wie sie es bei Orsola taten, wenn sie wütend wurde. Auch Paolo sagte nichts, denn er wusste, dass Marco eines Tages der Maestro sein würde. Giacomo versuchte, ihm die Stirn zu bieten, erntete dafür aber nur blaue Flecken.
Ein außerordentlich schönes Stück gelang Marco jedoch: ein kunstvoll verzierter Kelch aus klarem Fadenglas, dessen Griffe wie die geflügelten Löwen geformt waren, die man auf jeder Flagge in Venedig sah, und dessen Schale beinahe so flach war wie ein Teller. Er brachte Wochen damit zu, ihn zu entwerfen und die Herstellung aller Einzelteile zu üben, bis er sich schließlich an die endgültige Fertigung wagte. Er war so stolz auf das Ergebnis, dass er beschloss, den Kelch nicht an einen Venezianer zu verkaufen, wie er es ursprünglich vorgehabt hatte. Anstatt ihn im Laden zu präsentieren, baute er ein kleines Regal dafür in der Werkstatt. Eines Tages, als niemand da war, versuchte Orsola, ihn mit Wasser zu füllen, aber in die flache Schale ging kaum etwas hinein, und sobald sie den Kelch bewegte, schwappte das bisschen Wasser, das darin war, auf ihr Kleid.
Als Orsola siebzehn war, sah sie ihrer Mutter ähnlicher denn je, von den dunklen Haaren und Augen bis zu den gewölbten Brauen und der leisen Ungeduld in ihren Zügen, als warte sie unablässig darauf, dass etwas geschah.
Und dann geschah tatsächlich etwas.
Eines Tages sollte sie einen Tontopf mit gekochten Aalen zum Warmhalten in den Kühlofen stellen, blieb jedoch in der Tür zur Werkstatt stehen, um den Männern bei der Arbeit zuzusehen. Ihr Vater saß wie immer an der Werkbank, und sein servente und die garzoni bewegten sich mit ihren Hefteisen und Werkzeugen um ihn herum. Sie bearbeiteten gerade eine längliche Röhre aus Fadenglas, die wahrscheinlich der Griff eines Krugs werden sollte. Paolo zog das Eisen, an dem sie befestigt war, aus dem Ofen und brachte es Lorenzo Rosso, der das orange glühende Stück sanft mit einer Zange bog, mit einem Zirkel die Rundung überprüfte und nickte. »Perfetto«, sagte er mit Genugtuung in der Stimme. Ein garzone kam mit einem langen Metallhaken, den er um die geschwungene Glasröhre legte. Orsolas Vater schlug leicht gegen das Stück, um es vom Hefteisen zu lösen, und der garzone hob es mit dem Haken an, um es in den Kühlofen zu bringen. Aber er hatte den Haken unachtsam darumgelegt und ihn ein wenig zu schwungvoll bewegt, sodass der Glasgriff auf die Werkbank fiel und zersprang. Die Scherben flogen durch die ganze Werkstatt. Eine landete direkt vor Orsolas Füßen. Eine andere indes bohrte sich wie ein glühender Pfeil in den Hals von Lorenzo Rosso.
Der Lehrling erstarrte, den Metallhaken wie eine Waffe in der Hand haltend. Lorenzo griff sich an den Hals, ertastete die Scherbe und zog sie heraus. Es war, als hätte jemand den Korken aus einer Flasche entfernt: Ein Schwall Blut spritzte auf den Fußboden. Lorenzo starrte verwirrt auf die Glasscherbe in seiner Hand. Während ihm das Blut den Hals hinablief, wurde sein Gesicht grau, und er kippte von seinem Hocker.
Orsola ließ den Topf mit den Aalen im gleichen Moment fallen wie der garzone seinen Haken, und der Lärm schien ihre Brüder aus ihrer Erstarrung zu reißen. Marco und Giacomo stürzten zu ihrem Vater. Der Lehrling lief hinaus. »Hol den Arzt!«, rief Marco ihm nach. »Hol unsere Mutter!«, befahl er Orsola. »Bring Tücher mit!«
Sofort rannte sie zur Küche, packte ihre Mutter am Arm und stammelte: »Padre … ein Unfall … wir brauchen Tücher.«
Laura Rosso musterte das Gesicht ihrer Tochter, als könnte sie darin lesen, was passiert war. »Maddalena, hol den Stapel Laken aus dem Schrank«, befahl sie und lief, gefolgt von Orsola, zur Werkstatt.
Maddalena fing an zu schreien, als sie mit den Laken kam und das Durcheinander aus Scherben, Aalen und der großen roten Lache sah; die Aale schienen förmlich im Blut zu schwimmen. Laura kniete neben ihrem Mann in der Lache und presste ihren Rock auf die Wunde. Orsola starrte auf die nackten Knöchel ihrer Mutter, die voller Blut waren.
»Basta, Maddalena!«, rief Laura. »Wirf mir ein Laken zu.«
Maddalena stand wie gelähmt in der Tür, und Orsola musste ihr den Stapel abnehmen und ihrer Mutter ein Laken geben, damit sie es auf Lorenzo Rossos Hals drücken konnte. Das Laken färbte sich sofort rot. »Noch eins«, rief Laura. Orsola reichte ihr ein weiteres Laken, das sie mit viel Mühe gewaschen und in der Sonne gebleicht hatte. Jetzt war ihre ganze Arbeit umsonst gewesen, dachte sie, bekam aber sofort ein schlechtes Gewissen.
Giacomo kniete an der anderen Seite seines Vaters und drückte seine Hand. Paolo hatte die Arme um die beiden garzonetti gelegt; der eine hatte die Augen aufgerissen, der andere vergrub das Gesicht an der Seite des Gesellen. Währenddessen tobte Marco durch die Werkstatt. »Wo ist dieser kleine canagia von garzone?«, schimpfte er. »Ich werde ihm den Bauch aufschlitzen und seiner Mutter die Eingeweide bringen! Wo bleibt der Arzt? Ich wette, er ist nicht mal zu ihm gelaufen.«
Tatsächlich lief der Lehrling nicht zum Arzt, sondern stahl ein Boot und floh damit zur terraferma. Er wurde nie wieder gesehen. Und wenn später jemand seinen Namen erwähnte, spuckten die Rossos auf den Boden und verfluchten ihn.
»Madre, sollen wir … sollen wir den Priester holen?«, fragte Giacomo leise.
Ohne ein Wort ließ Paolo die garzonetti los und verschwand. Selbst wenn er zur nächsten Kirche lief – nach San Petro Martire am Zusammenfluss des Rio dei Vetrai und Muranos Canal Grande – und der Priester sofort mit ihm zurückeilte, würde es zu lange dauern. Orsola sah von der Blutlache zum Gesicht ihres Vaters. Er hatte die Augen geschlossen, und seine Haut war bleich wie ein Egerling. Sie wusste, dass es zu spät war, um ihm die Letzte Ölung zu geben.
Laura Rosso war zu demselben Schluss gekommen. Sie tastete nach dem Puls ihres Mannes, dann richtete sie sich auf und ließ das blutige Laken, das sie an seinen Hals gedrückt hatte, sinken. »Che Dio abia pietà della so anema, e de la nostra«, sagte sie und bekreuzigte sich.
Maria Barovier kam zu Lorenzo Rossos Beerdigung, ebenso all die anderen Glasmacher von Murano und sogar Gottfried Klingenberg, der venezianische Kaufmann, mit dem er den größten Teil seiner Geschäfte gemacht hatte. Orsolas Vater war ein beliebter Mann gewesen, nicht wegen seines einnehmenden Wesens – er hatte nie viel geredet, war ganz auf seine Familie und seine Arbeit konzentriert –, sondern weil er ehrlich und gerecht gewesen war und seine Arbeit schlicht, aber von guter Qualität. Er hatte keine Kandelaber oder andere kunstvolle Stücke hergestellt und war so auch niemandem ins Gehege gekommen. Seine Werkstatt war stets sauber, und die Männer, die für ihn arbeiteten, benahmen sich höflich und gesittet – außer Marco, aber man konnte sich seine Söhne nicht aussuchen. Sein plötzlicher Tod erschütterte die Glasmacher, auch diejenigen, die mit Lorenzo Rosso wenig zu tun gehabt hatten. Und so kamen sie zur Trauermesse in die Basilica di Santi Maria e Donato und geleiteten seinen Leichnam zum Boot der Rossos, einem flach gebauten sandolo, das ihn über den Kanal zum Friedhof im Nordosten von Murano bringen würde; Marco und Giacomo ruderten, und der Rest der Familie folgte ihnen entlang der Fondamenta. Maria Barovier war auch unter den Hunderten, und diesmal sah sie Orsola an, lange und mit unbewegter Miene, aber nicht unfreundlich.
Einige Wochen später, als Orsola von der Basilika kam, wo sie für ihren Vater gebetet hatte, saß Maria auf dem Campo San Donato auf einer Bank. »Hilf mir hoch, Orsola Rosso«, befahl sie. »Mit der Gicht ist es nicht so leicht.«
Orsola stützte sie am Arm und half ihr beim Aufstehen. Es war das erste und einzige Mal, dass die ältere Frau ihr gegenüber eine Schwäche zeigte.
»Hast du für deinen Vater gebetet?« Maria deutete auf Santi Maria e Donato mit ihrer schönen Backsteinfassade und der doppelten Arkadenreihe. Der Boden im Innern bestand aus prächtigen, jahrhundertealten Mosaiken, die Orsola während der Messe gerne betrachtete. Es war vom Haus der Rossos aus zwar nicht die nächstliegende Kirche, aber dafür die schönste der ganzen Insel.
Orsola nickte und kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen. Vor dieser Frau wollte sie nicht weinen.
Eine andere Frau hätte sich bekreuzigt, aber Maria tat es nicht. »Niemand hat verdient, was ihm zugestoßen ist.« Sie musterte Orsola eingehend. »Du bist groß geworden, Orsola Rosso. Eine richtige Frau. Du brauchst ein neues Kleid.«
Das stimmte. Orsolas Brüste waren gewachsen, und ihre Kleider waren dort und an den Armen zu eng geworden. Ihrer Mutter hatte sie nichts gesagt; Laura Rosso musste von einem Tag auf den anderen eine Glaswerkstatt leiten und starrte entweder in die Geschäftsbücher oder sah nach, ob noch genug Holz da war, oder zählte die Glasstäbe und die Kelche und versuchte zusammen mit Marco zu verstehen, wie das alles funktionierte. Orsola war klar, dass ein neues Kleid da warten musste.
»Ich rate zu Braun mit einem Hauch Rot darin«, fuhr Maria Barovier fort. »Das Rot würde gut zu deiner Haut und deinem Haar passen. Beides kann einen kräftigen Ton vertragen.«
Orsola schoss das Blut in die Wangen bei der Vorstellung, dass die Glasmacherin ihre olivenfarbene Haut, die dunklen Lippen und das kastanienbraune Haar bemerkt hatte. Sie nickte mit gesenktem Kopf und eilte davon.
Eine Woche darauf brachte ein Botenjunge ein Paket aus zusammengefaltetem Stoff – feines Leinen, braun mit einem leichten Rotton. Es war keine Nachricht dabei. »Gute Qualität.« Laura Rosso strich über den Stoff. »Vielleicht bezahlt jemand auf diese Weise seine Rechnung. Aber wir brauchen Geld, kein Leinen. Sobald ich weiß, wer es ist, sorge ich dafür, dass er zahlt.«
Orsola räusperte sich. »Das ist für mich.«
»Und von wem?«, fragte ihre Mutter misstrauisch, wie es jede Mutter wäre, wenn ihre unverheiratete Tochter Geschenke bekam.
Orsola zögerte. Es wäre einfacher zu sagen, der Stoff wäre von einem Mann. Das würde niemanden überraschen. Ihre Mutter würde lachen, ihr das Kleid nähen lassen und den Mann fortschicken, falls er noch mal auftauchte. Aber …
»Von Maria Barovier. Es ist ein Geschenk.«
Laura schnaubte. »Wie bitte? Was hat Marietta mit dir zu tun, oder du mit ihr?«
»Nichts. Sie hat mir bloß gesagt, ich brauche ein Kleid.«
Sie rechnete damit, dass ihre Mutter den Stoff sofort zu Maria zurückbringen würde. Doch Laura befühlte das feine Leinen, musterte ihre Tochter von oben bis unten und sagte: »Ich nähe es dir morgen. Du ziehst es an, und dann gehst du zu ihr und bittest sie um Hilfe.«
Orsolas Mund wurde trocken. »Was meinst du damit? Was für Hilfe?«
Laura sah sie lange an. »Andiamo«, sagte sie und führte sie durch den Hof zur Werkstatt. »Sieh hin.« Sie stieß die Tür auf.
Orsola war seit dem Tod ihres Vaters nicht mehr in der Werkstatt gewesen. Es war nicht die Angst vor dem Blutfleck – sie und ihre Mutter und Maddalena hatten den Boden so sauber geschrubbt, wie es nur ging, Maddalena weinend, Laura und Orsola mit zusammengepressten Lippen. Dann hatten die garzonetti so umgeräumt, dass an der Stelle ein Holzstapel lag, der niemals aufgebraucht werden durfte, damit nicht auch nur eine Spur vom Blut ihres Maestro sichtbar wurde. Aber Lorenzo Rosso war das Zentrum des Tanzes gewesen, den er und seine Arbeiter jeden Tag aufgeführt hatten, und Orsola konnte es nicht ertragen, die Lücke zu sehen, die er hinterlassen hatte, und die zögernden Bewegungen der anderen Männer, die versuchten, die Lücke zu umgehen. Marco war eingesprungen, aber er hatte gerade erst seine prova bestanden, die Prüfung, die ihn zu einem servente machte. Er hatte noch lange nicht die Erfahrung, die nötig war, um die Werkstatt als Maestro zu leiten. Dennoch musste er es tun. Wenn ein Maestro starb, ging die Werkstatt an seinen ältesten Sohn über. Manchmal sah Orsola, wie überfordert Marco wirkte, ein Mann, der in Verantwortung ertrank. Dann tat er ihr leid, und sie hätte ihm gerne etwas Tröstendes gesagt, aber sie wusste, dass es ihn nur wütend machen würde, wenn man ihn bei einer Schwäche ertappte.
Jetzt sah sie sich in der Werkstatt um. Marco und Paolo waren nicht da. Zwei garzoni und ein garzonetto spielten spigoli, dass die Karten nur so auf den Tisch knallten, und ein weiterer garzonetto schlief – etwas, das sie sich in Lorenzo Rossos Gegenwart niemals erlaubt hätten. Nur Giacomo schien zu arbeiten; er sortierte Glasstücke nach Farben, was normalerweise die Aufgabe der garzonetti war. Betreten blickte er auf. Normalerweise würde er neues Glas herstellen, würde Sand, Asche und Kalk nach den Formeln der Rossos zusammenmischen, je nachdem welche Farbe gebraucht wurde. Doch offenbar brauchte die Werkstatt kein neues Glas, denn sie produzierte nichts.
»Siehst du?« Laura Rosso ließ ihren Blick durch den Raum schweifen. »Wir sind in Schwierigkeiten, und Marietta Barovier muss uns sagen, was wir tun sollen.« Sie hob einen Brocken klares Glas auf, der nichts auf dem Boden zu suchen hatte, und warf ihn in eine Schubkarre mit Resten.
Orsola lehnte im Türrahmen und betrachtete ihre Mutter aufmerksam. Seit dem Tod ihres Vaters hatte sich ihre Mutter verändert. Nicht nur äußerlich – das Grau in ihrem Haar hatte sich verstärkt, und sie wirkte hagerer denn je. Etwas war in ihrem Innern vor sich gegangen. Laura war immer eine vorbildliche Ehefrau gewesen. Sie stolzierte nicht bei der abendlichen passeggiata an den Kanälen entlang, um ihren Pelzmantel vorzuzeigen, wie es einige andere Maestro-Frauen taten, und sie überließ auch nicht den Dienstboten die ganze Arbeit. Sie kümmerte sich um den Haushalt, und sie hatte sich stets für die Werkstatt interessiert und mit ihrem Mann über das Geschäft gesprochen, wenn sie auch nie die Entscheidungen getroffen hatte. Sie konnte lesen und ein wenig rechnen, genug jedenfalls, um bei der Buchhaltung zu helfen. Sie schimpfte und nörgelte nicht, aber sie war entschieden gegenüber Orsola und Maddalena, den Lehrlingen und Gesellen und gegenüber dem Fleischer und den Fischern und den Gemüsehändlern, bei denen sie einkaufte. Ihr Haus war stets sauber, und sie trank nie zu viel Wein. Ihre einzige Schwäche waren biscotti und Trockenfrüchte.
In den ersten Tagen war sie wie erstarrt gewesen und hatte nicht geweint, weder bei der Totenmesse noch auf dem Weg zum Friedhof noch an seinem Grab. Orsola wusste, dass ihre Mutter nicht gefühllos war, aber ihr Blick schien auf die fernen Berge der terraferma gerichtet, die an klaren Tagen zu sehen waren.
Gegenüber Orsola und Giacomo sagte ihre Mutter mit einem tiefen Seufzer, dass Marco nicht den kühlen Kopf besaß, der nötig war, um an einem Ort wie Murano, wo viele Werkstätten um dieselben Kunden kämpften – Engländer, Franzosen, Deutsche, Niederländer und Türken, die über venezianische Zwischenhändler kauften –, ein Glasgeschäft zu führen. Marco konnte einen Kelch blasen und verzieren, aber er wusste nicht, wie er die Lehrlinge dazu anleiten sollte, Dutzende davon herzustellen, die alle genau gleich aussahen, oder jedenfalls so ähnlich, dass nur ein scharfes Auge die Unterschiede erkennen konnte. Er hatte noch nie mit den Kaufleuten am Rialto zu tun gehabt, die einen gnadenlos ausnahmen, ohne dass man es überhaupt bemerkte. In ihren schwarzen Samtumhängen, mit den perfekt gestutzten Bärten umschmeichelten sie die Maestri mit vielen Worten und so manchem gut gefüllten Kelch. Lorenzo Rosso hatte es geschafft, anständige Bedingungen auszuhandeln, weil er hartnäckig geblieben und weder ihrem Wein noch ihren Schmeicheleien verfallen war. Marco jedoch liebte den Wein, und er liebte Schmeicheleien. Er würde das Familienunternehmen in den Ruin treiben, wenn ihm nicht jemand zur Seite stand, der ihm zur rechten Zeit einen Riegel vorschob und bei Verhandlungen einen kühlen Kopf bewahrte. Orsola wusste, dass ihre Mutter das konnte.
Ein paar Wochen zuvor hatten Laura Rosso und Marco sich von einem traghetto – einem der Fährboote, die regelmäßig zwischen Murano und Venedig hin und her fuhren – hinüberbringen lassen, um Gottfried Klingenberg im Fondaco dei Tedeschi aufzusuchen, wo die deutschen Kaufleute wohnten und arbeiteten. Bei ihrer Rückkehr hatte Orsolas Mutter kaum etwas von dem Zusammentreffen berichtet, nur dass es bei der letzten Bestellung von Kelchen und Schalen wie abgesprochen blieb. Und sie hatten die Kelche und Schalen angefertigt, wobei Paolo kommentarlos so viele von Marcos Fehlern wie nur möglich korrigiert hatte. Aber Klingenberg hatte nichts nachbestellt. Und so stand die Werkstatt nun still.
»Frag Marietta Barovier, was wir tun sollen«, wiederholte Laura jetzt.
Orsola nickte.
»Da ist noch etwas«, fügte ihre Mutter hinzu. »Es wird bald nicht mehr zu übersehen sein.« Sie zog ihr Kleid eng um den Bauch, und Orsola starrte überrascht darauf: Es war der einzige Körperteil ihrer Mutter, der gewachsen war, während alles andere vor Trauer geschrumpft zu sein schien. Ihre Mutter tätschelte nicht ihren Bauch, wie andere Frauen es in dieser Situation getan hätten, denn Laura Rosso war ein zurückhaltender Mensch.
»Dann musst du mehr essen, Madre, damit du dieses nicht auch verlierst, so wie die anderen«, sagte Orsola, auf das Praktische konzentriert, um ihren Schreck zu verbergen. Ihre Mutter war zu alt, um noch ein Kind zu bekommen, und obendrein ohne einen Ehemann, der für den Lebensunterhalt sorgte.
»Sag Marietta das mit dem Kind«, wies Laura sie an. »Aber sonst niemandem. Vielleicht stimmt es sie ein wenig milder.«
Bevor Orsola zu Maria Barovier ging, nähte ihre Mutter ihr ein Kleid aus dem Stoff, den die Glasmacherin Orsola geschenkt hatte. Orsola sollte es viele Jahre lang tragen, selbst als die Mode sich veränderte, und sie bekam oft Komplimente für den zeitlosen Schnitt, den guten Stoff und die Farbe, die die Leute nicht recht einordnen konnten: das Braun der einfachen Leute, vermischt mit dem Rot des Adels.
Als Orsola die Werkstatt der Baroviers zum zweiten Mal betrat, nun eine junge Frau in einem schönen neuen Kleid, nicht mehr ein nasses und schmutziges kleines Mädchen, sah der Innenhof genauso chaotisch aus, wie sie ihn in Erinnerung hatte. Eher schien noch mehr zerbrochenes Glas auf dem Boden herumzuliegen. Der Hof der Rossos würde womöglich bald genauso aussehen. Diesmal klopfte sie an die Tür der Werkstatt, anstatt sich hineinzuschleichen. Der junge Mann, der ihr öffnete, war derselbe, den Maria Barovier damals wegen des Stabs für die rosetta zurechtgewiesen hatte. Er war nicht länger ein schmächtiger garzone, sondern besaß die starken Arme eines servente, und seine Augen waren so dunkel, dass man die Pupillen nicht sehen konnte.
»Sì?«
»Ich möchte Signora Maria sprechen. Sag ihr, es ist Orsola Rosso.«
»Sie empfängt niemanden.« Der Geselle wollte die Tür wieder schließen, doch sie griff in den Rahmen, um ihn daran zu hindern. Er sah auf ihre Hand.
»Sag ihr, es ist Orsola Rosso«, wiederholte sie. »Wenn du es ihr nicht sagst, und sie findet später heraus, dass du mich weggeschickt hast, wird sie dich für den Rest deines Lebens goti machen lassen.«
Der Geselle starrte sie an, dann verschwand er, um Maria zu holen. Orsola folgte ihm nicht, sondern wartete im Hof. Die Versuchung war groß, sich die verschiedenen Farben der Glasstäbe anzuschauen, durch das Ladenfenster zu spähen, um zu sehen, was sie verkauften, und die Scherben am Boden genauer zu mustern. Aber sie war diesmal nicht als Spionin hier, und so blieb sie, wo sie war, die Arme um den Körper geschlungen.
Maria Barovier ließ sie nicht warten; solche Spielchen zur Demonstration ihrer höheren Stellung hatte sie nicht nötig. Sie kam sogleich heraus. Zu dem Gesellen, der ihr gefolgt war, sagte sie, ohne ihn anzusehen: »Stefano, geh wieder rein und behalte das Blau im Auge.«
Er nickte, warf Orsola noch einen letzten Blick zu und ging zurück in die Werkstatt.
»Komm.« Maria führte Orsola in einen privaten Innenhof, ganz ähnlich dem der Rossos, mit einem kunstvoll verzierten steinernen Brunnen in der Mitte. Drum herum scharrten Hühner im Sand, die empört gackerten, als ihre Herrin sie mit dem Fuß verscheuchte, um sich an die Brunnenmauer lehnen zu können. Es duftete nach dem Basilikum, das in Töpfen in der Sonne stand. Obwohl die Baroviers sehr wohlhabend waren, gaben sie mit ihrem Reichtum nicht an.
Maria Barovier verschränkte die Arme. »Was willst du?«
Orsola erklärte es ihr in kurzen, knappen Worten, beschränkte sich auf die schlichten Fakten, um die Geduld der älteren Frau nicht unnötig zu strapazieren. Maria hörte aufmerksam zu und hob nur die Brauen, als sie von Laura Rossos Schwangerschaft erfuhr.
»Gottfried Klingenberg ist euer Händler am Rialto, nicht wahr?«, fragte sie. »Ich habe ihn bei der Beerdigung deines Vaters gesehen. Sein Kommen war eine große Ehre. Was genau hat er gesagt, als er keine neue Bestellung aufgegeben hat?«
»Er sagte, er sei dankbar, dass wir es geschafft hätten, die Bestellung rechtzeitig zu liefern, und er werde sehen, wie diese Stücke bei den Stammkunden ankämen.«
»›Diese Stücke‹? Waren das seine Worte?«
»Sì.«
»Das bedeutet, dass sie anders waren als die früheren. Er vergleicht sie mit denen eures Vaters, und sie sind nicht so gut. Klingenberg kennt sich mit Glas aus. Das Glas der ganzen Welt geht durch Venedig, und das meiste davon hat er gesehen. Ich werde mit ihm sprechen und herausfinden, wo die Fehler liegen. Ich kenne ihn schon sehr lange. Deiner Mutter oder deinem Bruder wird er es vielleicht nicht sagen, aber mir ganz bestimmt. Sobald ihr die Fehler kennt, könnt ihr überlegen, wie ihr sie behebt. Komm in drei Tagen noch mal her.« Damit stieß die ältere Frau sich vom Brunnen ab, ein klares Zeichen, dass das Gespräch beendet war. Sie begleitete Orsola zurück durch den Werkstatthof und bis zur Tür, die nach draußen führte. Als sie sie öffnete, musterte sie Orsola von oben bis unten und nickte leicht, das einzige Zeichen, dass sie das neue Kleid bemerkt hatte und dass es ihr gefiel.
Drei Tage später öffnete ihr Stefano die Werkstatttür und trat beiseite, ohne sie aus den Augen zu lassen; Orsola konnte seinen Blick in ihrem Rücken spüren wie die Spitze eines Stocks.
»Die Kelche sind nicht einheitlich«, verkündete Maria Barovier, als sie wieder am Brunnen standen. Eine Katze lag zusammengerollt neben den Basilikumtöpfen in der Sonne. »Die Füße sind zu dick, die Schalen sind unregelmäßig geformt, und im Glas sind Blasen. Dein Bruder und seine Leute haben die Kontrolle über das Glas verloren. Aus Respekt für deinen Vater hat Klingenberg die Ware trotzdem angenommen, aber er musste sie mit Verlust verkaufen. Eine solche Sentimentalität wird er sich nicht noch einmal erlauben.«
Orsola schwieg. Das alles kam nicht überraschend, aber es schmerzte dennoch. »Und was sollen wir jetzt tun?«, fragte sie schließlich.
»Erweitert euer Sortiment«, schlug Maria vor. »Dein Vater hat sich hauptsächlich auf Gläser, Krüge und Schalen beschränkt, richtig?«
Orsola nickte.
»Wie wäre es mit einer größeren Auswahl an Gläsern? Nicht nur Kelche, sondern auch Alltagsgläser? Hübsche goti, die die garzoni herstellen können. Teller. Servierplatten. Einfache Dinge, nicht zu stark verziert. Vielleicht liegt so etwas Marco eher. Oder Giacomo, der es bisher nur nie zeigen konnte. Sie müssen sich die Zeit nehmen herauszufinden, was sie selbst gut können, anstatt weiter das nachzuahmen, was euer Vater gemacht hat. Jeder Glasmacher ist anders, so wie jeder Sänger anders klingt und die Pasta jeder Frau anders schmeckt. Paolo, der Geselle eures Vaters, ist ein ausgezeichneter Glasmacher. Er wird ihnen alles zeigen, auch wenn er die Werkstatt am Ende nicht leiten wird, weil er kein Rosso ist. Aber ihr müsst euch schnell etwas überlegen, bevor ihr Klingenbergs Wohlwollen verliert. Wenn es zu lange dauert, bestellt er bei jemand anderem.«
Es war ein vernünftiger Rat, auch wenn ihnen das im Grunde jeder hätte sagen können, und auch Laura und sogar Marco wären irgendwann darauf gekommen.
»Und noch etwas. Perlen!«
»Perlen?« Die Rossos hatten noch nie Perlen hergestellt. Sie waren billig und unspektakulär, und man konnte damit kaum etwas verdienen. Perlen produzierten Arbeiter nur zwischendurch, wenn gerade nichts anderes zu tun war. Nur die rosetta der Baroviers war eine recht kostbare Glasperle geworden.
»Perlen, die du machen kannst.«
»Ich?« Orsola hatte noch nie mit heißem Glas zu tun gehabt. Sie machte die Wäsche und half Maddalena beim Kochen und Putzen, außerdem arbeitete sie im Garten und passte auf jüngere Cousins und Cousinen auf. Ab und an fasste sie beim Verpacken mit an, aber sie half nicht einmal im Laden aus; das überließ sie ihrer Mutter. Maria Barovier war, soweit sie wusste, die einzige Glasmacherin, und sie hatte keine Ahnung, wie es dazu gekommen war. Maria hatte nie geheiratet – vielleicht, weil sie mit Glas arbeitete? Oder arbeitete sie mit Glas, weil sie nicht verheiratet war?
»Perlen füllen die Lücken«, erklärte Maria. »Sie stören nicht. Sie sind unbedeutend, und deshalb können Frauen sie herstellen. Kein Mann wird sich dadurch bedroht fühlen, dass du Perlen herstellst. Aber sie sind mittlerweile gefragt. Perlen werden auf Reisen mitgenommen und zum Handeln verwendet. Der König von Spanien hat Perlen für seine Schiffe bestellt, die von dort aus nach Westen aufbrechen.«
»Nach Westen?« Orsola wusste, dass Schiffe nach Osten fuhren, nach Konstantinopel, Alexandria oder Akkon, oder wenn nach Westen, dann bis Spanien. Aber westlich von Spanien war nichts mehr.
»Sie suchen eine neue Route nach Asien. Meine rosette begleiten sie.« Es war nicht zu überhören, dass Maria stolz war auf diesen Triumph.
»Werden Sie mir beibringen, wie man rosette macht?«
»Nein, mein Kind. Wenn du meine Tochter wärst, würde ich es tun. Aber die Arbeit der Baroviers bleibt bei den Baroviers. Doch du kannst lernen, andere Perlen zu machen, einfachere. Einfache Perlen lassen sich sehr gut verkaufen. Sie sind nicht die einzige Lösung für die Probleme deiner Familie, aber immerhin eine.«
»Mein Bruder wird das niemals erlauben. Ein Mädchen in der Werkstatt. Das gibt es doch nirgends.« Orsola wurde rot, denn die Baroviers waren ja das beste Gegenbeispiel.
Maria lachte. »Mach sie in der Küche, nicht in der Werkstatt. Marco braucht davon nichts zu erfahren, bis du es wirklich kannst. Wenn du geschickt genug bist, wird er den Wert erkennen. Hast du schon mal Lampenperlen gesehen?«
Orsola schüttelte den Kopf.
»Es gibt zwei Arten, wie man Perlen herstellen kann. Indem man Glasstäbe zieht, in Stücke zerteilt und poliert – oder mit einer Zinnlampe. Du schmilzt ein Stück Glas in einer Flamme und wickelst es um einen dünnen Metalldorn, dann rollst du es oder formst es mit Werkzeugen. Ich bin nicht gut darin, aber ich habe eine Cousine, die es dir beibringen kann. Geh morgen Abend zu Elena Barovier, hinter San Pietro Martire, und frag sie, ob sie es dir zeigt. Sie hat eine zweite Lampe. Ich bitte sie, sie dir zu leihen, bis du eine eigene hast.«
Was konnten ein paar Perlen gegen die Schulden ausrichten, die Orsolas Familie vielleicht bald haben würde? »Grazie, Signora Maria«, sagte sie trotzdem. »Ich werde Ihren Rat befolgen.«
Maria Barovier seufzte. »Ich habe mir immer eine Tochter gewünscht, einen Beistand gegen all die Männer.«
Elena war eine von vielen Baroviers auf Murano, und sie lebte in einem Haus mit lauter Glasmachern und ihren Frauen und Kindern. Elena war mindestens zwanzig Jahre älter als Orsola, und mit ihrer breiten Stirn, dem kantigen Kinn und der schroffen Art erinnerte sie an Maria Barovier. Sie war ebenfalls unverheiratet. Statt ins Kloster zu gehen, hatte sie sich einem ihrer Brüder angeschlossen und sich so in den Haushalt eingefügt, dass sie zwischen den Ehefrauen und Müttern kaum auffiel. Sie war nicht besonders freundlich, als Orsola bei ihr vor der Tür stand, war jedoch offensichtlich von Maria vorgewarnt worden und hatte zu viel Respekt vor ihrer Cousine, um sich ihr zu widersetzen. Die Zinnlampe stand auf dem Tisch, an dem die Familie kurz zuvor zu Abend gegessen hatte. Die Frauen und Kinder, die vorbeikamen, warfen Orsola einen kurzen Blick zu, fragten aber nicht, was eine Rosso am Tisch der Baroviers zu suchen hatte.
»Du hast noch nie mit Glas gearbeitet, richtig?«, fragte Elena ein wenig herablassend.
Orsola schüttelte den Kopf.
»Dann fangen wir ganz von vorne an. Zunächst musst du lernen, eine einfache Perle zu machen, einfarbig, ohne Verzierungen. Als Erstes bauen wir die Lampe auf.« Sie griff nach dem birnenförmigen, etwa eine Elle langen Metallbehälter und klappte den Deckel auf. »Wir tun etwas Talg hinein – das kriegst du beim Fleischer – und bringen ihn zum Schmelzen.« Sie hielt die Lampe kurz über das Feuer, bis sich das Tierfett verflüssigte. Bei dem Gestank nach ranzigem Fett rümpfte Orsola die Nase, und sie kämpfte mit Übelkeit. »Daran gewöhnst du dich«, bemerkte Elena. »Die Arbeit an der Lampe stinkt nun mal.«
Als der Talg geschmolzen war, legte sie einen Metallzylinder mit einem Stoffstreifen so hinein, dass das eine Ende im Talg lag und das andere aus einer Mulde am Rand der Lampe herausschaute. Sie stellte die Lampe auf den Tisch, zündete den Stoffstreifen an und setzte sich davor. Dann nahm sie einen dünnen Metalldorn, ähnlich einem Bratenspieß, in die linke Hand und einen kurzen grünen Glasstab in die rechte. »Wenn ich den Glasstab in die Flamme halte, passiert nichts – sie ist nicht heiß genug. Aber jetzt pass auf …« Sie zeigte unter den Tisch, wo sich ein großer Blasebalg mit einem Schlauch daran befand, dessen Ende durch ein Loch in der Tischplatte hervorkam und auf die Flamme gerichtet war. Elena begann, mit dem Fuß den Blasebalg zu betätigen, und die Luft, die durch den Schlauch kam, nährte die Flamme, die dadurch heller und größer wurde. »Durch die zusätzliche Luft wird die Flamme heiß genug, um das Glas zu schmelzen. Wenn ich den Stab jetzt hineinhalte … Siehst du?« Die Spitze des grünen Glasstabs färbte sich orange und sank herab wie eine welke Blume.
Sie nahm das Glas aus der Flamme und wickelte ein kleines Stück davon um den dünnen Metalldorn, den sie zwischen ihren Fingern hin und her drehte. »Du drehst ihn anderthalbmal in die eine Richtung und dann anderthalbmal in die andere, immer im Wechsel«, erklärte sie. »So wird das Glas gleichmäßig verteilt, damit es symmetrisch ist. Das ist bei Perlen sehr wichtig, wie bei fast allen Sachen aus Glas. Aber du als eine Rosso weißt das sicher.«
Orsola nickte, ohne den Blick von der Perle zu nehmen, die sich scheinbar mühelos an der Spitze von Elenas Stab bildete. Die Perlenmacherin hielt sie erneut in die Flamme, um sie wieder zu erhitzen, dann nahm sie einen schmalen Metallspatel und fuhr damit über das Glas, das sie weiter drehte, sodass es erst zylinderförmig wurde, dann oval und dann wieder rund. »Canella, ulivetta, paternostro«, kommentierte sie die jeweilige Veränderung.
Angeberin, dachte Orsola. Trotzdem war sie beeindruckt von der Leichtigkeit, mit der Elena das Glas bearbeitete.
Elena musterte den runden paternostro, der unter anderem für Rosenkränze verwendet wurde, und drehte ihn immer wieder hin und her. Als sie schließlich zufrieden war, steckte sie den Dorn mit der Perle nach unten in einen mit Asche gefüllten Metallkasten, so tief, dass die Perle ganz bedeckt war. »Da bleibt sie über Nacht zum Auskühlen.« Sie stand auf. »Jetzt bist du dran.«
Obwohl sie begierig darauf war zu lernen, setzte Orsola sich nur zögernd vor die Lampe. Sie hatte schon lange nichts mehr lernen müssen wie eine Schülerin, und erst recht nicht von einer Lehrerin wie Elena Barovier, die ihr argwöhnisch auf die Finger schaute.
»Such dir eine Farbe aus.« Elena deutete auf das Bündel Glasstäbe, das auf dem Tisch lag.
Orsola griff nach einem blutroten. Rosso für eine Rosso.
Doch Elena schüttelte den Kopf. »Zu schwierig für eine Anfängerin. Rotes Glas hasst die Hitze, es verbrennt zu leicht.«
Orsola legte den roten Stab hin und nahm einen grünen.
»Nein, kein Opakglas. Das kühlt zu schnell ab, da musst du dich bei der Bearbeitung zu sehr beeilen. Hier, nimm das.« Sie gab Orsola den langweiligsten Stab – farbloses Klarglas. »Damit geht es leichter.«
Während der nächsten Stunde kämpfte Orsola mit dem Glas, verbrannte es und sich selbst, ließ es fallen und fabrizierte eine misslungene Perle nach der anderen, voller Beulen und Dellen, hässlich und unförmig. Es gelang ihr einfach nicht, den Metalldorn gleichmäßig zu drehen, während sie mit der anderen Hand versuchte, das Glas mit einem Spatel zu formen, und obendrein musste sie die ganze Zeit noch mit dem Fuß den Blasebalg betätigen. Es war, als würde sie mit drei vollkommen unterschiedlich großen und schweren Objekten jonglieren.
»Mariavergine«, brummte Elena nach mehreren missglückten Perlen. »Wie kommt Maria nur darauf, dass du dafür geeignet wärst?«
Orsola wurde so rot wie der Glasstab, den sie als Erstes gewählt hatte. Dass Elena es nicht gewohnt war zu unterrichten, machte es nicht einfacher. Sie erklärte wichtige Dinge nicht, setzte Wissen voraus und wurde schnell ungeduldig. Wenn man etwas bereits beherrscht, ist es schwer, sich in jemanden hineinzuversetzen, der es nicht kann. Orsola musste an Maddalena denken – als die kleine Orsola nicht sofort verstanden hatte, wie man Bohnen abzog, hatte Maddalena die Augen verdreht und ihr das Messer wieder weggenommen, und wenn Orsola die eingeweichte Wäsche nicht schnell genug bearbeitete, hatte sie ihre Hände über Orsolas auf den Griff des Stampfers gelegt.
Während Orsola sich abmühte und Elena sie kritisierte und gelegentlich den Dorn ergriff, um ein Unglück zu verhindern, kamen und gingen andere Mitglieder der Familie Barovier, holten Wasser, Zitronen, Brot oder Oliven, jagten hinter einem Ball her oder spielten Fangen. Manche beachteten sie gar nicht, andere schauten Orsola über die Schulter, um zu sehen, was sie da machte. Ein Kind hörte, wie Orsola leise fluchte, als ihr die perfekte Form, in die sie das Glas mühsam gebracht hatte, wieder verrutschte, und rannte lachend in den Innenhof. »Maledizione! Das Rosso-Mädchen hat maledizione gesagt!«
Schließlich schaffte es Orsola, eine brauchbare ulivetta spoletta herzustellen, deren ovale Form asymmetrische Wölbungen eher verzieh als der runde paternostro