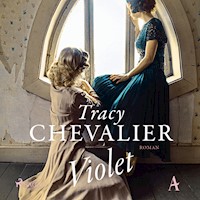9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was es bedeutet, Außenseiter zu sein – ein atmosphärischer Roman, der in das Amerika der 1970er Jahre führt
Osei will an seiner neuen Schule vor allem eines: nicht auffallen. Für den afrikanischen Diplomatensohn ist es der vierte Wechsel innerhalb von sechs Jahren, und aus Erfahrung weiß er, dass er gleich am ersten Tag Freundschaften schließen muss. Doch bereits seine Anwesenheit scheint einige seiner weißen Mitschüler und Lehrer zu provozieren. Im Amerika der 1970er Jahre sind gemischte Klassen immer noch selten. Als sich ausgerechnet die beliebte Dee mit Osei anfreundet, sieht Ian, der Tyrann auf dem Pausenhof, rot.
Tracy Chevalier lässt Shakespeares Othello, jenes klassische Stück über Eifersucht und Diskriminierung, in einer Schule spielen, wo das Wort Mobbing kein Fremdwort ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über das Buch:
Was es bedeutet, Außenseiter zu sein – ein atmosphärischer Roman, der in das Amerika der 1970er Jahre führt.
Osei will an seiner neuen Schule vor allem eines: nicht auffallen. Für den afrikanischen Diplomatensohn ist es der vierte Wechsel innerhalb von sechs Jahren, und aus Erfahrung weiß er, dass er gleich am ersten Tag Freundschaften schließen muss. Doch bereits seine Anwesenheit scheint einige seiner weißen Mitschüler und Lehrer zu provozieren. Im Amerika der 1970er Jahre sind gemischte Klassen immer noch selten. Als sich ausgerechnet die beliebte Dee mit Osei anfreundet, sieht Ian, der Tyrann auf dem Pausenhof, rot.
Tracy Chevalier lässt Shakespeares Othello, jenes klassische Stück über Eifersucht und Diskriminierung, in einer Schule spielen, wo das Wort Mobbing kein Fremdwort ist.
Über die Autorin:
Tracy Chevalier, geboren 1962, wuchs in einem multikulturellen Viertel in Washington D. C. auf und besuchte dort eine Schule mit überwiegend farbigen Kindern. Diese Erfahrung inspirierte sie zur Neuerzählung von Othello. »Das Stück kreist um die Frage, was es bedeutet, Außenseiter zu sein. Dieses Gefühl kennen wir alle. Jeder von uns hat schon mal am Rand einer Gruppe gestanden und sich nichts sehnlicher gewünscht, als endlich dazuzugehören.«
Tracy Chevalier, Autorin des Weltbestsellers Das Mädchen mit dem Perlenohrring, lebt heute mit ihrer Familie in London.
TRACY CHEVALIER
DER NEUE
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Schwenk
Knaus
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »New Boy« bei Hogarth, einem Imprint der Penguin Random House Group, LondonDer Roman ist Teil der Reihe Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2017 by Tracy Chevalier
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 beim Albrecht Knaus Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: Sabine Kwauka
Umschlagabbildung: Krasimira Petrova Shishkova/Trevillon Images sowie Verwendung von shutterstock-Motiven
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-16144-6V002www.knaus-verlag.de
EINS
Vor der Schule
Götterspeise, Kinderbier,
Wer ist dein Liebster, sag es mir!
Dee sah ihn als Erste und war glücklich darüber. Es gab ihr das Gefühl, etwas Besonderes zu sein: ihn ein paar Sekunden lang ganz für sich zu haben, bis auch die Herzen der anderen einen Schlag aussetzten und sich an diesem Tag nicht mehr davon erholten.
Auf dem Schulhof war vor dem Unterricht einiges los. Viele Kinder waren früh gekommen, um vor dem Klingeln noch Himmel und Hölle oder Kickball zu spielen. Dee war allerdings nicht früh dran – ihre Mutter hatte sie wieder hochgeschickt. Sie sollte sich ein weniger enges Oberteil anziehen, weil sie sich angeblich mit Eigelb bekleckert hatte, dabei war von Eigelb nichts zu sehen. Deshalb hatte Dee so schnell rennen müssen, dass ihr die geflochtenen Zöpfe gegen den Rücken schlugen. Erst, als sie den Strom von Kindern sah, die in dieselbe Richtung gingen, wusste sie, dass sie noch genug Zeit hatte. Eine Minute vor dem ersten Klingeln hatte sie den Schulhof erreicht.
Weil es zu spät war, um ihre beste Freundin Mimi zu begrüßen, die mit den anderen Mädchen seilsprang, ging Dee gleich weiter zum Eingang des Schulgebäudes. Mr Brabant und die Lehrerin der anderen sechsten Klasse warteten schon darauf, dass die Schüler sich aufstellten. Dank seines kurzen, kantigen Haarschnitts hatte Mr Brabant einen quadratischen Kopf und dazu eine stramme Haltung. Anscheinend hatte er in Vietnam gekämpft. Dee war zwar nicht die Klassenbeste – das durfte die brave Patty für sich beanspruchen –, doch sie gab sich Mühe, Mr Brabant jederzeit zu gefallen, auch wenn sie wusste, dass sie deshalb hin und wieder als Streberin galt.
Dee war die Erste, die sich aufstellte. Sie drehte sich zu den Mädchen um, die gar nicht daran dachten, mit dem Seilspringen aufzuhören. Und in diesem Moment sah sie ihn, seine reglose Gestalt am Karussell, auf dem sich vier Jungen – Ian, Rod und zwei Viertklässler – rasant im Kreis drehten. Dee war sich sicher, dass jeden Moment einer der Lehrer einschreiten würde. Einmal war ein Junge herausgeschleudert worden und hatte sich den Arm gebrochen. Die beiden Viertklässler schienen Angst zu haben, konnten das Karussell aber nicht stoppen, weil Ian es mit routinierten Fußtritten kräftig antrieb.
Der Junge, der in der Nähe des wild kreiselnden Karussells stand, war nicht so gekleidet wie die anderen in ihren Jeans, T-Shirts und Turnschuhen. Er trug eine graue Schlaghose, ein weißes, kurzärmeliges Hemd und dazu schwarze Schuhe; wie die Uniform einer Privatschule. Mehr noch stach aber seine Hautfarbe hervor: Sie erinnerte Dee an die Bären, die sie vor einigen Monaten bei einem Schulausflug im Zoo gesehen hatte. Sie hießen zwar Schwarzbären, doch ihr Fell war eigentlich dunkelbraun mit rötlichen Spitzen. In erster Linie hatten sie geschlafen oder die Futterberge beschnüffelt, die ihnen der Wärter ins Gehege kippte. Erst, als Rod einen Stock nach den Tieren warf, um Dee damit zu imponieren, hatte ein Bär gebrummt und die gelben Zähne gefletscht, worauf die Kinder anfingen zu kreischen. Nicht so Dee: Sie hatte Rod nur einen wütenden Blick zugeworfen und sich abgewandt.
Der Neue schaute nicht zum Karussell, sondern betrachtete das L-förmige Gebäude, Prototyp einer vorstädtischen Schule, vor acht Jahren erbaut, zwei fantasielos aneinandergeklebte Schuhkartons aus rotem Backstein. In Dees erstem Jahr roch hier noch alles nach Neubau, doch inzwischen hatte das Gebäude etwas von einem abgetragenen Kleid, mit seinen Flecken, Rissen und den Spuren des ausgelassenen Saums. Sie kannte jedes Klassenzimmer, jeden Treppenaufgang, jedes Geländer, jede Toilette. Sie kannte jeden Quadratzentimeter Schulhof wie auch den Schulhof der Kleinen auf der anderen Seite des Gebäudes. Sie war von den Schaukeln gefallen, hatte sich auf der Rutsche die Strumpfhose zerrissen, hatte oben auf dem Klettergerüst festgesessen, weil die Angst vor dem Herunterklettern plötzlich zu groß war. Und einmal hatte sie den halben Schulhof zur Mädchenzone erklärt: Gemeinsam mit Mimi, Blanca und Jennifer hatte sie alle Jungen davongejagt, die es wagten, die Grenze zu überschreiten. Mit anderen hatte sie sich hinter der Turnhalle versteckt, wo die Pausenaufsicht sie nicht sehen konnte, um dort Lippenstift auszuprobieren, Comics zu lesen oder Flaschendrehen zu spielen. Auf dem Schulhof hatte sich ihr Leben abgespielt, hier hatte sie gelacht und geweint, sich verknallt, Freundschaften geschlossen und sich nur wenige Feinde gemacht. Dies war ihre vertraute Welt. Doch in einem Monat würde sie alles hinter sich lassen und auf die Junior High gehen.
Und nun hatte ein Neuer das Terrain betreten, jemand, der so anders war, dass auch Dee ihre Welt plötzlich mit anderen Augen sah: Auf einmal kam sie ihr schäbig vor, und sie fühlte sich fremd darin. So fremd wie er.
Inzwischen hatte er sich in Bewegung gesetzt. Nicht wie ein Bär, nicht dieser tapsige, schwerfällige Gang. Eher wie ein Wolf oder – Dee versuchte, an dunkle Tiere zu denken – wie ein Panther oder eine schwarze, überdimensionale Hauskatze. Was auch immer er in diesem Moment dachte (wahrscheinlich, dass er auf einem von weißen Menschen wimmelnden Schulhof der einzige Schwarze und der einzige Neue war), als er auf die an der Tür zum Schulgebäude wartenden Lehrer zuschlenderte, strahlte er das Selbstbewusstsein eines Menschen aus, der seinen Körper kennt und sich darin wohlfühlt. Dee spürte ein Ziehen in der Brust. Sie holte Luft.
»Oha«, bemerkte Mr Brabant. »Mir ist so, als hörte ich Trommeln.«
Miss Lode, die andere Lehrerin, kicherte. »Was hat Mrs Duke gesagt, wo kommt er her?«
»Guinea, glaube ich. Oder war’s Nigeria? Jedenfalls Afrika.«
»Er ist doch in Ihrer Klasse, nicht wahr? Ist mir auch lieber so.« Miss Lode strich ihren Rock glatt und betastete ihre Ohrringe, als müsste sie sich vergewissern, dass sie noch da waren. Eine nervöse Angewohnheit. Bis auf ihren blonden, zerzausten Bubikopf pflegte sie ein adrettes Äußeres. Heute trug sie einen lindgrünen Rock, eine gelbe Bluse und grüne, scheibenförmige Ohrclips. Auch ihre Schuhe waren grün, mit niedrigen viereckigen Absätzen. Dee und ihre Freundinnen ließen sich oft über Miss Lodes Garderobe aus. Sie war zwar eine sehr junge Lehrerin, doch ihre Kleidung unterschied sich komplett von den weißen und rosa T-Shirts und den blumenbestickten Jeans-Schlaghosen ihrer Schülerinnen.
Mr Brabant zuckte die Achseln. »Ich rechne nicht mit Problemen.«
»Nein, natürlich nicht.« Miss Lode hielt ihre großen blauen Augen fest auf den Kollegen gerichtet, um jedes seiner klugen Worte aufzusaugen und so eine bessere Lehrerin zu werden. »Meinen Sie, wir sollten … also … vielleicht … mit den anderen Schülern sprechen? Darüber … ich weiß auch nicht … dass er anders ist? Sie ermuntern, ihn freundlich aufzunehmen?«
Mr Brabant schnaubte. »Jetzt ziehen Sie mal Ihre Samthandschuhe aus, Diane. Der braucht keine Sonderbehandlung, bloß weil er schw… neu hier ist.«
»Nein, aber … ich dachte nur … Ja, natürlich.« Miss Lodes Augen glänzten feucht. Mimi hatte Dee erzählt, dass ihre Lehrerin schon ein oder zwei Mal vor der Klasse in Tränen ausgebrochen war. Hinter ihrem Rücken bezeichneten die Schüler Miss Lode als Heulsuse.
Mr Brabants Blick blieb plötzlich an Dee hängen, die vor ihm wartete. »Geh mal rüber und trommel die Mädchen zusammen.« Er deutete auf die Seilspringerinnen. »Sag ihnen, dass ich ihnen die Seile wegnehme, wenn sie nicht sofort aufhören.«
Als einer der wenigen Männer im Kollegium war er für Dee ganz eindeutig jemand, dem man zu gehorchen hatte und den man, wenn es irgendwie ging, zu beeindrucken versuchte – genauso wie ihren Vater, dem sie es gern recht machte, wenn er von der Arbeit nach Hause kam.
Rasch ging sie über den Schulhof; die hüpfenden Mädchen bevorzugten die sportlichere Variante und benutzten zwei dicke Springseile gleichzeitig, die mit einem satten Geräusch auf den Betonboden schlugen; dazu sangen sie. Dee zögerte, weil Blanca gerade mit Springen an der Reihe war. Blanca war mit Abstand die beste Springerin der Schule, sie war so gut, dass sie minutenlang zwischen den beiden gegenläufig rotierenden Seilen hüpfen konnte, ohne einen Fehler zu machen. Bei ihr sangen die Mädchen am liebsten Lieder, die möglichst schnell darauf hinausliefen, dass Blanca eine andere Springerin zu sich rufen oder das Feld räumen musste. Während Blanca natürlich am liebsten so lange wie möglich und am allerliebsten allein sprang; an diesem Morgen hatte sie die anderen dazu gebracht, hierfür das passende Lied zu singen:
Götterspeise, Kinderbier,
Wer ist dein Liebster, sag es mir!
Ist es A, B, C, D …
Wenn die Springerin das ganze Alphabet schaffte, ohne hängen zu bleiben, ging es weiter mit den Zahlen bis zwanzig, dann kamen die Lieblingsfarben. Blanca war bereits bei den Farben angelangt und mit ihren langen, schwarzen Locken wunderbar leichtfüßig, obwohl sie Plateausandalen trug. Dee konnte in solchen Schuhen nicht springen; sie trug lieber ihre weißen Chucks, die sie so sauber wie möglich hielt.
Sie ging zu Mimi, die auf einer Seite die Seile drehte.
»Wir sind jetzt schon zum zweiten Mal bei den Farben«, murrte die Freundin leise. »Angeberin.«
»Mr B sagt, er nimmt euch die Seile weg, wenn ihr nicht sofort aufhört.«
»Gut.« Abrupt ließ Mimi die Arme sinken, und schon hingen ihre Seile schlaff auf den Boden, während das andere Mädchen noch ein paar Sekunden weitermachte. Blanca verhedderte sich.
»Warum hörst du einfach auf?«, protestierte sie. »Ich hätte stolpern können! Außerdem wollte ich bis zum Alphabet weitermachen, damit ich bei C aufhören kann!«
Dee und Mimi verdrehten die Augen und begannen, die Seile aufzuwickeln. Blanca war verrückt nach Casper, dem beliebtesten Jungen der beiden sechsten Klassen, und es schien durchaus auf Gegenseitigkeit zu beruhen, auch wenn die beiden fortwährend miteinander Schluss machten.
Dee konnte Casper gut leiden, schon immer. Mehr noch: Die beiden verband das Wissen, dass sie es leichter hatten als viele andere, dass sie weniger dafür tun mussten, Freunde zu finden und respektiert zu werden. Im letzten Jahr hatte Dee sogar kurzzeitig darüber nachgedacht, ob sie eigentlich für Casper schwärmte oder vielleicht sogar mit ihm gehen wollte. Casper hatte ein offenes, nettes Gesicht und leuchtend blaue, freundliche Augen. Es wäre ziemlich normal gewesen, solche Gefühle für ihn zu haben, doch Dee hatte sie nicht. Er war eher so etwas wie ein Bruder für sie; sie hatten ähnliche Interessen und schauten beide nach vorn, anstatt sich gegenseitig tief in die Augen zu blicken. Es ergab mehr Sinn, dass Casper mit einem chaotischen, energiegeladenen Mädchen wie Blanca zusammen war.
»Oh, mein Gott, wer ist denn das?« Blanca, die im Unterricht wenig sagte, war auf dem Schulhof umso lauter.
Dee wusste sofort, dass Blanca den Neuen entdeckt hatte. »Er ist aus Nigeria«, sagte sie in beiläufigem Ton, während sie weiter das Seil aufwickelte.
»Woher weißt du das«, fragte Mimi.
»Haben die Lehrer gesagt.«
»Ein schwarzer Junge an unserer Schule – ich fasse es nicht!«
»Pssst …« Dee hatte Sorge, dass der Junge sie hören konnte.
Die Seite unter dem Arm ging sie mit Mimi und Blanca auf die Schülerreihen zu. Die Springseile wurden in Mr Brabants Klassenzimmer aufbewahrt, und Dee trug die Verantwortung dafür, worauf Blanca neidisch war wie auch auf ihre Freundschaft zu Mimi; das wusste Dee.
»Die ist doch total komisch, was magst du eigentlich an der?«, hatte Blanca einmal gesagt.
»Mimi ist nicht komisch«, hatte Dee ihre Freundin verteidigt. »Sie ist … sensibel. Sie spürt viel.«
Blanca hatte achselzuckend begonnen, »Crocodile Rock« zu singen, und das Gespräch damit für beendet erklärt. Dreiecksgeschichten waren ein heikles Geschäft: Eine fühlte sich immer ausgeschlossen.
Offenbar hatte ein Lehrer dem Neuen gesagt, wo er hingehen sollte, denn er stand nun allein am Ende der Zweierreihe, die sich inzwischen vor Mr Brabant gebildet hatte. Blanca blieb so abrupt stehen, als wäre sie vor etwas Unsichtbarem zurückgeprallt. »Was machen wir denn jetzt?«
Dee zögerte, doch dann ging sie zügig weiter und stellte sich einfach hinter den Jungen. Blanca folgte ihr. »Ich glaub’s nicht! Der ist in unserer Klasse!«, flüsterte sie übertrieben laut. »Wetten, du traust dich nicht, den anzufassen.«
»Halt den Mund!«, zischte Dee in der Hoffnung, dass er es nicht gehört hatte. Sie betrachtete ihn von hinten. Der Neue hatte einen wohlgeformten Kopf, so glatt und ebenmäßig wie auf einer Töpferscheibe gedreht. Gern hätte sie ihn berührt. Sein kurz geschnittenes Haar war wie ein Blätterdach, das sich flach an die Hänge eines Bergs schmiegte, ganz anders als die kugelrunden Afro-Frisuren, die im Moment so beliebt waren. Nicht, dass es hier bei ihnen Afros gegeben hätte. In Dees Schule gab es keine schwarzen Schüler und in ihrem Vorort keine schwarzen Einwohner, obwohl 1974 so viele Schwarze in Washington lebten, dass die Stadt den Spitznamen Chocolate City hatte. Aber wenn Dee mit ihrer Familie ins Zentrum fuhr, sah sie manchmal schwarze Männer und Frauen mit riesigen aufgeplusterten Afros – oder im Fernsehen, in der Sendung Soul Train, die sie hin und wieder bei Mimi schauen konnte und bei der sie dann mit ihrer Freundin vor dem Fernseher zu Earth, Wind and Fire oder den Jackson Five tanzte. Zu Hause sah sie die Sendung nie: Ihre Mutter erlaubte ihr nicht, sich im Fernsehen singende, tanzende Schwarze anzusehen. Dee schwärmte für Jermaine Jackson, wobei ihr an ihm weniger der Afro als das schlitzohrige Grinsen gefiel. Ihre Freundinnen mochten den jüngeren Michael lieber, doch das fand Dee zu naheliegend. Als würde man sich in den süßesten Jungen der Schule verknallen, Stichwort Casper. Blanca wollte immer das Naheliegende.
»Dee, du wirst dich heute um unseren neuen Schüler kümmern.« Mr Brabant hatte ihr ein Zeichen gegeben. »Zeig ihm die Kantine, den Musikraum, die Toilette. Und erklär ihm, was er im Unterricht nicht versteht. In Ordnung?«
Blanca schnappte nach Luft und stupste Dee an, die rot geworden war und nickte. Warum hatte Mr Brabant ausgerechnet sie ausgewählt? Sollte das irgendeine Form von Strafe sein? Aber Dee musste nicht bestraft werden, nie. Dafür sorgte ihre Mutter.
Um sie herum wurde geflüstert und gekichert.
»Wo kommt der denn her?«
»Aus dem Dschungel!«
»Ouu-ouu-ouu … Autsch, das hat wehgetan!«
»Stell dich nicht so an.«
»Arme Dee, jetzt muss die sich um den kümmern!«
»Warum denn Dee? Das müsste doch eigentlich ein Junge machen.«
»Vielleicht wäre ja von den Jungs keiner dazu bereit. Ich würde es zum Beispiel nicht machen.«
»Ich auch nicht!«
»Genau, aber Dee ist ja auch der Liebling von Mr B. Der weiß, dass sie nie im Leben Nein sagen würde.«
»Schlaumeier.«
»Moment mal – heißt das, der gehört zu unserer Tischgruppe?«
»Haha! Armer Duncan, hat den Neuen an der Backe! Und Patty auch!«
»Ich setze mich um!«
»Darfst du nicht.«
»Tue ich aber.«
»Träum weiter, Mann.«
Der Neue blickte sich um. Seine Miene war weder argwöhnisch noch verhalten, sondern freundlich, offen. Damit hatte Dee nicht gerechnet. Seine Augen glänzten wie zwei schwarze Münzen, als er sie neugierig ansah. Er zog die Brauen hoch, was die Augen noch größer machte, und Dee durchfuhr ein Gefühl, das sie an die Mutprobe mit dem elektrischen Zaun erinnerte.
Sie sagte nichts, nickte ihm nur kurz zu. Er erwiderte ihr Nicken, dann drehte er sich wieder um. Stumm und verlegen standen sie hintereinander. Dee schaute sich um; sie wollte wissen, ob sie noch beobachtet wurde. Alle beobachteten sie. Sie lenkte ihren Blick auf ein Haus gegenüber der Schule – zufälligerweise Caspers Elternhaus – und hoffte, den anderen damit zu signalisieren, dass sie über wichtige Dinge draußen in der Welt nachdachte und nicht über diesen Jungen vor ihr, der irgendwie elektrisch aufgeladen zu sein schien.
Dann bemerkte sie die schwarze Frau, die auf der anderen Seite des Zauns vor dem Schulhof stand, die Finger der rechten Hand im Maschendraht eingehakt. Sie war zierlich und hatte ein rot-gelb gemustertes Tuch um den Kopf geschlungen wie einen hohen Turban, der sie größer wirken ließ. Ihr langes Kleid war aus dem gleichen bunten Stoff. Darüber trug sie einen grauen Wintermantel, obwohl es Anfang Mai war und schon warm. Sie beobachtete ihren Sohn und Dee.
»Meine Mutter denkt immer, ich kann das nicht: der Neue sein.«
Überrascht, dass sich der Junge noch einmal umgedreht hatte, sah Dee ihn an. An seiner Stelle hätte sie kein Wort gesagt. »Warst du denn schon mal der Neue?«
»Ja. Drei Mal in sechs Jahren. Das ist jetzt meine vierte Schule.«
Dee hatte ihr Leben lang im selben Haus gewohnt, dieselbe Schule besucht, dieselben Freunde gehabt; sie war es gewohnt, dass alles, was sie tat, mit einem angenehmen Gefühl der Vertrautheit einherging. Sie konnte sich gar nicht vorstellen, irgendwo die Neue zu sein, inmitten von Fremden – wobei sie ja auf der Junior High nur noch ein Viertel ihrer Mitschüler kennen würde. Inzwischen hatte Dee ihre alte Schule zwar innerlich schon ein gutes Stück hinter sich gelassen und war bereit für den Wechsel, doch die Vorstellung, plötzlich so viele unbekannte Menschen um sich zu haben, bereitete ihr nach wie vor Bauchschmerzen.
Von der anderen Sechstklässler-Reihe aus verfolgte Mimi das Geschehen mit großen Augen. Bisher waren die beiden Mädchen fast immer in einer Klasse gewesen, und es schmerzte Dee, dass sie in ihrem letzten Jahr unterschiedlichen Lehrern zugeteilt worden waren. Nun konnte sie nur noch in den Pausen mit ihrer besten Freundin zusammen sein. Eine weitere Folge war, dass Blanca, die in derselben Klasse wie Dee gelandet war, ziemlich penetrant ihre Nähe suchte, so auch jetzt: Sie klebte buchstäblich an Dee und starrte dabei den Neuen an. Blanca hatte es sehr mit körperlicher Nähe, fiel anderen oft um den Hals, spielte mit den Haaren ihrer Freundinnen, und bei Jungen, die sie mochte, kam es vor, dass sie genauso an ihnen klebte wie jetzt an Dee.
Dee schüttelte sie ab, um sich besser auf den schwarzen Jungen konzentrieren zu können. »Bist du aus Nigeria?« Sie brannte darauf, ihm zu zeigen, dass sie schon ein bisschen über ihn Bescheid wusste. Du hast vielleicht eine andere Hautfarbe, dachte sie, aber ich kenne dich.
Der Junge schüttelte den Kopf. »Ich komme aus Ghana.«
»Oh.« Dee hatte keine Ahnung, wo Ghana war, nur dass es in Afrika sein musste. Die Antwort des Jungen hatte immer noch freundlich geklungen, aber ein Schatten hatte sich über sein Gesicht gelegt, und er wirkte nicht mehr ganz so offen. Dee war entschlossen, ihm zu beweisen, dass ihr die afrikanische Kultur nicht völlig fremd war. Sie deutete mit einem Nicken auf die Frau am Zaun. »Trägt deine Mom ein Dashiki?« Sie kannte das Wort, weil sie zu Weihnachten von ihrer Hippie-Tante eine Hose mit einem Dashiki-Muster bekommen hatte. Um ihr eine Freude zu machen, hatte Dee die Hose beim Weihnachtsessen angezogen und nicht nur die missbilligenden Blicke ihrer Mutter ertragen müssen, sondern auch die Hänseleien ihres älteren Bruders: Warum sie denn eine Tischdecke angezogen habe, wo doch schon eine auf dem Tisch lag? Anschließend hatte sie die Hose in den hintersten Winkel ihres Schranks verbannt und seitdem keines Blickes mehr gewürdigt.
»Dashikis sind Hemden, die von afrikanischen Männern getragen werden«, erklärte der Junge. Er hätte verächtlich reagieren oder sich lustig machen können, blieb jedoch ganz sachlich. »Manchmal auch von schwarzen Amerikanern, wenn sie damit etwas sagen wollen.«
Dee nickte und fragte sich, was man mit einem Hemd wohl sagen konnte. »Ich glaube, die Jackson Five tragen Dashikis, das habe ich mal im Fernsehen gesehen.«
Der Junge lächelte. »Ich dachte da eher an Malcolm X – er hatte auch einmal ein Dashiki-Hemd an.« Jetzt schien er sie ein bisschen aufzuziehen. Das störte Dee nicht, Hauptsache, der Schatten über seinem Gesicht war weg.
»Meine Mutter trägt ein Kleid aus Kente-Stoff«, fuhr er fort. »Dieser Stoff kommt aus meinem Land.«
»Warum hat sie einen Wintermantel an?«
»Wenn wir nicht in Ghana sind, ist ihr kalt, sogar im Sommer.«
»Ist dir auch kalt?«
»Nein, mir ist nicht kalt.« Der Junge antwortete immer in ganzen, förmlichen Sätzen, ein bisschen so wie Dee und ihre Mitschüler im Französischunterricht. Er hatte keinen amerikanischen, eher einen Anflug von britischem Akzent. Dees Mutter verpasste im Fernsehen keine Folge von Das Haus am Eaton Place, und so ähnlich klang er, nur nicht so hochnäsig und barsch, sondern mit einem singenden Tonfall, der wahrscheinlich aus Afrika kam. Seine Sätze waren immer korrekt, er verschluckte nicht die kleinste Silbe, sondern gab jedem Vokal einen so satten, melodischen Klang, dass Dee beinahe gegrinst hätte; aber sie wollte nicht unhöflich sein.
»Holt sie dich auch wieder ab?«, fragte sie. Dees Mutter kam außer zu den Elternsprechtagen nie in die Schule. Sie verließ nur ungern das Haus.
Der Junge lächelte wieder. »Sie musste mir versprechen, nicht zu kommen. Ich kenne den Heimweg.«
Dee lächelte zurück. »Ist wahrscheinlich auch besser so. Hier werden nämlich nur die Kleinen, die auf dem hinteren Schulhof sind, von den Eltern gebracht und abgeholt.« Es klingelte zum zweiten Mal. Die Lehrer der vierten Klassen setzten sich in Bewegung, und ihre Schüler folgten ihnen in Reih und Glied ins Gebäude. Als nächste würden die fünften Klassen gehen, dann die sechsten.
»Möchtest du, dass ich die Springseile für dich trage?«, fragte der Junge.
»Oh! Nein, danke, die sind nicht schwer.« Waren sie eigentlich schon. Noch nie hatte ihr ein Junge so ein Angebot gemacht.
»Das tue ich gern.« Der Junge streckte auffordernd die Hände aus, und sie gab ihm die Seile.
»Wie heißt du?«, fragte sie, als auch ihre Klasse losging.
»Osei.«
Verdutzt sah sie ihn an. Der Name klang fremd; da war nichts Vertrautes, woran man sich hätte festhalten können. Wie ein glatter Felsblock, der schwer zu erklimmen war.
Er lächelte über ihre Verwirrung; offenbar kannte er das. »Es ist leichter, mich einfach O zu nennen«, sagte er. »Wie der Buchstabe. Das macht mir nichts aus, wirklich. Sogar meine Schwester nennt mich manchmal O.«
»Nein, nein, warte, ich kriege das schon hin: O … sei. Ist das ein Wort aus deiner Sprache?«
»Ja, genau. Es bedeutet ›von edler Geburt‹. Und du, wie heißt du, bitte?«
»Dee. Eigentlich Daniela, aber alle nennen mich Dee.«
»Dee? Einfach so?«
Sie nickte. »Genauso wie O, einfach so.« Die beiden sahen sich an, und dann mussten sie lachen. Osei hatte schöne, gleichmäßige Zähne, die in seinem dunklen Gesicht weiß funkelten und etwas bei Dee entfachten.
*
Obwohl Ian damit beschäftigt war, das Karussell übertrieben schnell anzuschieben, um die Viertklässler zum Schreien zu bringen, hatte er den Jungen sofort gesehen. Ian sah jeden, der neu war in seinem Revier. Denn der Schulhof gehörte ihm. Jedenfalls seit er in der Sechsten war und es keine älteren Jungen mehr gab, die das Sagen hatten. Seit Monaten gefiel er sich schon in dieser Machtposition. Da stellte jeder Neue natürlich eine gewisse Herausforderung dar. Und dieser Neue, nun ja …
Ian war weder der größte noch der schnellste Junge seines Jahrgangs. Er konnte Bälle nicht am weitesten schießen, am Basketballkorb nicht am höchsten springen, am Klettergerüst nicht die meisten Klimmzüge machen. Im Unterricht sagte er nicht viel; nie bekam er zur Belohnung Sticker unter seine Kunstwerke geklebt, und er gewann am Ende des Schuljahrs auch keine Preise als schnellster Kopfrechner, für die beste Handschrift und schon gar nicht für das beste Sozialverhalten. Auch war er nicht derjenige, der bei den Mädchen am besten ankam – diesen Status hatte Casper.
Dafür war Ian von allen Schülern der durchtriebenste. Der berechnendste. Der schnellste, wenn es darum ging, auf neue Situationen zu reagieren und sie zu seinem Vorteil zu nutzen. Wenn sich eine Prügelei anbahnte, nahm er Wetten entgegen und sorgte dafür, dass die Streithähne nicht den Schwanz einzogen. Er war gut darin, den Sieger vorherzusagen. Manchmal ließ er auch darauf wetten, wie lange eine Prügelei dauern und welcher Lehrer sie beenden würde. Als Wetteinsatz nahm er Süßigkeiten entgegen, die er anschließend weiterverkaufte – er selbst machte sich nichts aus Süßem. Oder er knöpfte anderen ihr Essensgeld ab, wobei es auch vorkam, dass er jüngere Mitschüler beschützte, wenn andere ihnen ihr Geld abnehmen wollten; anschließend bediente er sich natürlich selbst. Es machte ihm Spaß, Verwirrung zu stiften und andere im Ungewissen zu lassen. Vor Kurzem hatte er seine Eltern dazu überredet, ein Bankkonto für ihn zu eröffnen. Sie fragten ihn nicht, woher das viele Geld kam. Seine Brüder waren in dem Alter nicht anders gewesen.
Als seine Klasse einmal im Sportunterricht um den Block joggen musste, erbot sich Ian umzukehren und die langsameren Schüler einzusammeln; für ihn eine hervorragende Gelegenheit, sich einmal genau anzuschauen, was tagsüber in der Nachbarschaft so los war – wer die Post austrug, wer sein Auto wusch, wer beim Rosenschneiden die Haustür offen stehen ließ. Ians Blickwinkel war stets der eines möglichen Nutzens.
Immer klappte das nicht.
Vor ein paar Tagen zum Beispiel hatte sich aus heiterem Himmel ein Gewitter angekündigt. Miss Lode versuchte gerade, ihren Schülern zu erklären, was ein gleichschenkeliges Dreieck war, da meldete sich Ian. Der orange Hosenanzug seiner Lehrerin war längst mit Kreide verschmiert und ihre Miene so ratlos, als wäre die Geometrie etwas, das sich auch ihrem Verständnis entzog. Überrascht hatte sie innegehalten, denn Ian meldete sich nur selten. »Ja, Ian?«
»Miss Lode, es fängt gleich an zu regnen, und die Flagge hängt noch. Soll ich sie vielleicht einholen?«
Miss Lode blickte aus dem Fenster auf das dunkle Wolkengebirge und die amerikanische Fahne, die draußen vor der Schule im Wind flatterte. »Dafür sind die Mädchen aus Mr Brabants Klasse zuständig. Das weißt du.«
»Aber die sind nie schnell genug. Und heute ist Mr Brabant nicht da, um sie daran zu erinnern. Wenn ich jetzt loslaufe, wird sie nicht nass.«
Miss Lode zögerte, dann deutete sie mit einer Kopfbewegung zur Tür. »Also gut, aber beeil dich. Und nimm jemanden fürs Falten mit.«
Der Umgang mit der amerikanischen Flagge war einer Reihe von Regeln unterworfen: Nachts und bei Regen wurde sie eingeholt, sie durfte nie, auf gar keinen Fall den Boden berühren, und sie verlangte Ehrfurcht. Schon oft hatte Ian zu Beginn und am Ende des Schultags aus dem Fenster geschaut, wenn Dee und Blanca mit demonstrativem Stolz auf ihr besonderes Privileg zum Fahnenmast marschierten. In der Regel erledigten sie ihre Aufgabe mit Sorgfalt, doch er hatte auch schon erlebt, dass sie die Flagge nachlässig falteten oder sogar ein Ende über den Boden schleifen ließen. Manchmal sangen sie auch – patriotische Lieder, aber häufiger Popsongs aus dem Radio. Sie ließen sich gern Zeit, quatschten, trödelten, lachten.
Er entschied sich für Mimi als Begleiterin, was alle erstaunte, nicht nur Miss Lode, sondern auch die meisten anderen Jungen und alle Mädchen, die hinter vorgehaltener Hand kicherten. Auch Mimi schien überrascht, aufgeregt und sogar ein bisschen ängstlich. Bis zum Ende der vierten Klasse hatten die Mädchen und Jungen noch zusammen gespielt und sogar Freundschaften gepflegt. Doch in den letzten beiden Schuljahren war eine strikte Geschlechtertrennung vollzogen worden: Jetzt kam es nur noch außer Sichtweite der Lehrer, hinter der Turnhalle oder – an sonnigen Tagen – im Schatten der Bäume zu verstohlenen Begegnungen. Letzte Woche hatte Ian an der Rückwand der Turnhalle sogar einen Arm um Mimi gelegt und seine Hand vor ihren kleinen, knospenden Brüsten baumeln lassen. Doch zu mehr war er nicht gekommen, weil Rod plötzlich vorgeschlagen hatte, seine Jeans samt Unterhose herunterzulassen und den Mädchen mal zu zeigen, was er da unten so hatte. Natürlich hatten alle aufgeschrien, auch Mimi, die sofort unter Ians Arm weggeschlüpft war – aber schweren Herzens, das hatte Ian schon gemerkt.
Als sie ihm nun nach draußen folgte, begann es bereits zu tröpfeln, doch das meiste hing noch in den Wolken. Am Fahnenmast gab sich Ian Mühe, Mimi nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, und konzentrierte sich darauf, das Seil von der in Taillenhöhe an den Mast geschraubten Halterung zu wickeln. Dann holte er die Flagge ein. »Nimm das Ende«, befahl er.
Gehorsam nahm Mimi die Fahne an ihren losen Zipfeln entgegen. Ian löste sie auf seiner Seite vom Seil, und dann hielten sie die große Flagge wie ein Bettlaken straff gespannt zwischen sich. Er sah Mimi eine Sekunde länger an als eigentlich nötig, und sie ließ es still, mit aufgerissenen Augen geschehen. Mimis Augen waren kristallblau, und die dunklen Sprenkel darin erzeugten ein Funkeln, das ihn verwirrte. Sie hatte sommersprossige Haut, rote Haare – wahrscheinlich waren ihre Vorfahren Iren – und einen breiten Mund, in dem Zahnspangen glänzten. Mit ihren unregelmäßigen Gesichtszügen – die Augen zu weit auseinander, der Mund zu groß, die Stirn zu breit –, konnte sie eigentlich nicht als hübsch gelten. Dennoch hatte Mimi etwas. Sie waren jetzt im siebten Jahr auf derselben Schule. In der dritten Klasse hatte Ian sie einmal umgeschubst, einfach so, weil er es konnte, doch ansonsten hatte er ihr bis vor Kurzem keine besondere Beachtung geschenkt. Seine Wahl war nun deshalb auf Mimi gefallen, weil sie genauso war wie er und auf dem Schulhof immer ein bisschen Abstand zu den anderen hielt. Obwohl Mimi zwei Schwestern hatte, eine ältere und eine jüngere, die beide ganz normal wirkten, und außerdem die beliebte Dee als beste Freundin, schien sie häufig allein mit sich und ihren Gedanken zu sein, sogar beim Seilspringen oder wenn sie Himmel und Hölle spielte. Sie hatte den Ruf, ein bisschen neben der Spur zu sein, wenig zu reden und viel zu beobachten. Vielleicht fand Ian gerade das attraktiv: Er wollte ja gar nicht, dass sie viel redete.
Nun hatte er begonnen, die Fahne der Länge nach in der Mitte zu falten, und bedeutete ihr, ihm dabei zu helfen; dann falteten sie den Stoff abermals der Länge nach, sodass die zwischen ihnen gespannte Fahne schließlich nur noch ein Viertel ihrer ursprünglichen Breite hatte. Wieder schaute er Mimi zu lange an, und sie wurde rot. »Mach weiter«, sagte er. »Weißt du wie?«
Mimi nickte und legte an ihrem Ende die untere Ecke der Flagge nach oben, so, dass ein Dreieck entstand, das sie wieder umklappte, dann das nächste Dreieck faltete, umklappte und so weiter; dabei kam sie unweigerlich langsam auf Ian zu. Er hielt sein Fahnenende an die Brust gedrückt, sodass Mimi, beim letzten Dreieck angelangt, nur noch einen Schritt von ihm entfernt war. Für ihn der ideale Moment, mit einem so kräftigen Ruck an dem Stoff zu ziehen, dass sie gegen ihn prallte, und dann nach ihrem Mund zu schnappen. Die gefaltete Flagge eingeklemmt zwischen seinem und ihrem Oberkörper, schlugen ihre Zähne gegeneinander, und Mimi wollte zurückweichen, doch sie konnte nicht, weil dann die Fahne auf den Boden gefallen wäre.
Mimis Zahnspange pikste, doch Ian presste entschlossen seinen Mund an ihre Lippen und begann zu saugen. Nach einer Weile reagierte Mimi und saugte zurück, nur dass sie den Mund nicht weit genug öffnete und seine Zunge nicht reinließ. Sie hat das schon mal gemacht, schoss es ihm durch den Kopf – ein Gedanke, der ihm missfiel. Abrupt zog er sich von Mimi zurück, obwohl es ihm Spaß gemacht und er sogar gespürt hatte, dass sich etwas bei ihm regte, was auch ihr wahrscheinlich nicht entgangen war. Wortlos nahm er ihr die Flagge aus der Hand, faltete selbst das letzte Dreieck und klemmte den überschüssigen Stoff fest. »Mit anderen solltest du so was aber nicht machen«, sagte er schließlich.
Mimi sah ein bisschen verwirrt aus, ja sogar eingeschüchtert. »Habe ich nicht.«
»Lügen steht dir nicht. Hast du wohl – mit Philip, Charlie, Duncan und sogar Casper.« Es waren reine Vermutungen, von Ian geschickt ausgewählt, und er hatte ganz offensichtlich mindestens einen Treffer gelandet, wusste nur nicht, mit wem. Denn Mimi ließ den Kopf hängen. Der Regen hatte jetzt zugenommen und lief ihr übers Gesicht; es sah fast so aus, als weinte sie.
»Wenn du mit mir gehen willst, guckst du diese Jungen besser nicht mal an. Willst du mit mir gehen?«
Mimi nickte.
»Dann mach den Mund auf, wenn wir uns küssen, damit ich meine Zunge reinstecken kann.«
»Aber die Mädchen kommen jeden Moment aus Mr Brabants Klasse – dann sehen die uns. Außerdem sieht uns hier sowieso jeder.«
»Ach was! Und außerdem habe ich das schon oft genug beobachtet: Die Mädchen brauchen immer ewig, bis sie rauskommen. Die Flagge wird jedes Mal nass, und dann muss Dee sie mit nach Hause nehmen und in den Trockner stecken. Los, komm schon.«
Er presste seinen Mund wieder an ihren. Als sie ihre Lippen öffnete, schob Ian die Zunge tief hinein, drängte Mimi gegen den Fahnenmast und erkundete mit kräftigen, pumpenden Bewegungen das Innere ihres Mundes. Auch seine Hüften presste er gegen ihre, um sicher zu sein, dass sie ihn dieses Mal spürte.