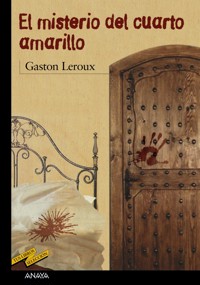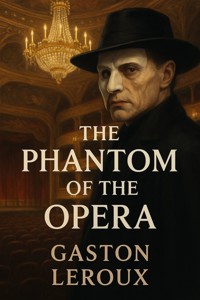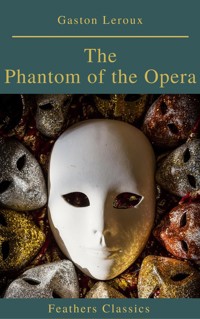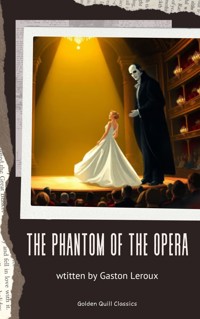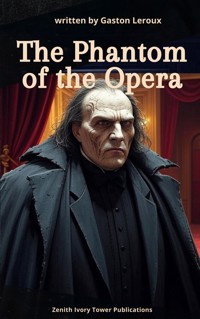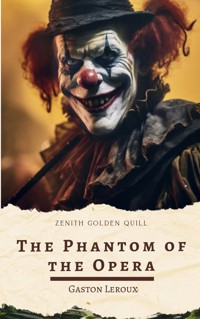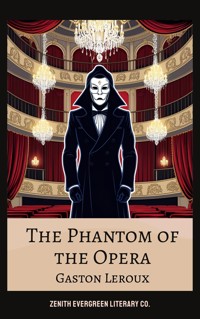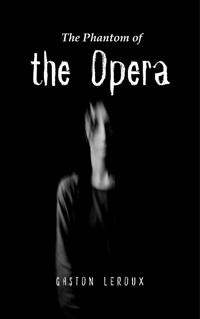Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Krimis bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Die französische Presse berichtet von einem unfassbaren Mordversuch: Die Tochter des Wissenschaftlers Stangerson wäre beinahe in ihrem Zimmer ermordet worden. Wie kam der Täter in das Zimmer, und vor allem: Wie konnte er unbemerkt fliehen? Alle Zeichen deuten darauf hin, dass der Täter plant, seine Tat zu Ende zu bringen. Das Schloss des Professors entpuppt sich als ein wahres Labyrinth aus Liebesaffären und Doppelleben. Einer der Schlossbewohner muss der Täter sein. Es beginnt eine spannende Mörderhatz, die mit einem für alle überraschenden Finale aufwartet. In diesem Roman treten erstmalig der rätselhafte Ermittler Frédéric Larsan und der Reporter Joseph Rouletabille aufeinander. Die Verfilmung von 2003 war in Frankreich ein großer Erfolg. Gaston Louis Alfred Leroux war ein französischer Journalist und Schriftsteller. Weltbekannt ist er vor allem durch seinen Roman "Das Phantom der Oper". Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gaston Leroux
Das Geheimnis des gelben Zimmers
Le Mystère de la chambre jaune
Gaston Leroux
Das Geheimnis des gelben Zimmers
Le Mystère de la chambre jaune
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung und Fußnoten: Jürgen SchulzeÜbersetzung: M. Douhin-Hirschberg 2. Auflage, ISBN 978-3-962814-93-9
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel – in dem man anfängt, nichts zu begreifen
Zweites Kapitel – Erstes Auftreten Joseph Rouletabilles
Drittes Kapitel – Ein Mensch huscht wie ein Schatten durch die Fensterläden
Viertes Kapitel – Das Schloss »Le Glandier« – Rouletabille sagt Herrn Darzac einen Satz, der seine Wirkung tut
Fünftes Kapitel – Im Schloss
Sechstes Kapitel – Ein blondes Frauenhaar
Siebentes Kapitel – Der Untersuchungsrichter vernimmt Fräulein Stangerson
Achtes Kapitel – Reporter und Detektiv
Neuntes Kapitel – »Heute gibt’s nur Fleisch vom Schlächter«
Zehntes Kapitel – Frédéric Larsan erklärt, auf welche Weise der Mörder das Gelbe Zimmer verlassen konnte
Elftes Kapitel – Der Stock Frédéric Larsans
Zwölftes Kapitel – Und nochmals der geheimnisvolle Vers
Dreizehntes Kapitel – »Heute Abend erwarte ich den Mörder«
Vierzehntes Kapitel – In der Falle – Auszug aus dem Tagebuche Joseph Rouletabilles
Fünfzehntes Kapitel – Die Wundergalerie
Sechzehntes Kapitel – Ein Frühstück im Wirtshaus »Zum Wartturm«
Siebzehntes Kapitel – Auf der Lauer
Achtzehntes Kapitel – Ein rätselhafter Toter
Neunzehntes Kapitel – Rouletabille kennt die beiden Hälften des Mörders
Zwangzigstes Kapitel – Rouletabille geht auf Reisen
Einundzwangzigstes Kapitel – Joseph Rouletabille steht in vollem Ruhme da
Zweiundzwangzigstes Kapitel – Des Rätsels Lösung
Dreiundzwangzigstes Kapitel – Das Geheimnis Fräulein Stangersons
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Krimis bei Null Papier
Der Frauenmörder
Eine Detektivin
Hemmungslos
Der Mann, der zu viel wusste
Noch mehr Detektivgeschichten
Sherlock Holmes – Sammlung
Eine Kriminalgeschichte & Das graue Haus in der Rue Richelieu
Der Doppelmord in der Rue Morgue
Indische Kriminalerzählungen
Kriminalgeschichten
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erstes Kapitel – in dem man anfängt, nichts zu begreifen
Nicht ohne eine gewisse Erregung beginne ich die seltsamen Abenteuer Joseph Rouletabilles hier zu erzählen. Er hatte sich das bisher so dringend verbeten, dass ich schon gänzlich daran verzweifelte, jemals eine der merkwürdigsten Detektivgeschichten veröffentlichen zu können. Ich glaube auch, die Öffentlichkeit hätte nie die ganze Wahrheit über den erstaunlichen Fall des Gelben Zimmers erfahren, wenn nicht kürzlich ein Abendblatt einen von Unwissenheit strotzenden oder vermessen hinterlistigen Artikel gebracht hätte, als Professor Stangerson zum Ritter der Ehrenlegion ernannt und dadurch wieder »aktuell« wurde. Durch diesen Artikel ist die schreckliche Geschichte wieder aufgerührt worden, die Joseph Rouletabille so gern vergessen hätte.
Das Gelbe Zimmer! Wer erinnert sich heute noch dieser Affäre, um die vor vielen Jahren so viel Tinte floss! Man vergisst so schnell in Paris. Die ganze Welt beschäftigte sich monatelang mit jenem düsteren Problem – das düsterste, meines Wissens, das jemals den Scharfsinn unserer Polizei, das Gewissen unserer Richter auf die Probe gestellt hat.
Was niemand entdecken konnte, hat der junge, erst achtzehnjährige Rouletabille, damals ein kleiner Reporter an einer großen Zeitung, gefunden. Doch als er dem Gerichtshof den Schlüssel zu diesem Geheimnis gab, sagte er noch nicht die ganze Wahrheit. Er brachte nur vor, was das scheinbar Unerklärliche erklären, was einen Unschuldigen retten konnte. Über alles andere schwieg er. Heute erst sollen die Freunde, die sich für Joseph Rouletabille interessieren, mehr erfahren, zum Teil aus seinem eigenen Munde. Ich beginne ohne weitere Vorrede mit der Darstellung der Tatsachen, wie sie am Tage nach dem Drama des Schlosses Le Glandier die Welt kennenlernte.
*
Am 25. Oktober erschien unter den »Letzten Nachrichten« die folgende Notiz im »Temps«:
Ein furchtbares Verbrechen ist in Glandier, an der Grenze des Sainte-Geneviève-Waldes oberhalb Epinay-sur-Orge, im Hause des Professors Stangerson verübt worden. Heute Nacht, während der Hausherr in seinem Laboratorium arbeitete, hat man versucht, Fräulein Stangerson, die in einem Zimmer neben dem Laboratorium schlief, zu ermorden. Die Ärzte können nicht dafür einstehen, Fräulein Stangerson am Leben zu erhalten.
Man stelle sich die Aufregung vor. Die gebildete Welt nahm bereits zu dieser Zeit ein bedeutendes Interesse an den Arbeiten des Professors Stangerson und seiner Tochter. Diese Arbeiten waren die ersten Versuche in der Strahlungslehre, die später das Ehepaar Curie zur Entdeckung des Radiums führten. Auch die Theorie Stangersons über die »Struktur der Materie« wurde viel diskutiert. Seine Denkschrift war noch nicht in der Akademie verlesen; das kam erst später. Aber schon zu jener Zeit war der Name Stangerson weltberühmt. Das erklärt den Eifer, mit dem sich die Zeitungen der Angelegenheit annahmen. Folgender Artikel mit der Überschrift: »Ein übernatürliches Verbrechen« erschien im Matin.
»Hier die einzigen Details«, so schreibt der anonyme Redakteur des Matin, »die wir über das Verbrechen im Schlosse Le Glandier erfahren konnten. Die Verzweiflung, in der sich Professor Stangerson befindet, die Unmöglichkeit, irgendeine Auskunft aus dem Munde des Opfers zu erhalten, haben unsere Forschungen ebenso erschwert wie die gerichtliche Untersuchung. Bisher kann man sich nicht die geringste Vorstellung von den Vorgängen im Gelben Zimmer machen, wo Fräulein Stangerson im Nachtgewande, röchelnd, auf dem Fußboden ausgestreckt, gefunden wurde. Es ist uns aber gelungen, Vater Jacques, einen alten Diener der Familie Stangerson, zu interviewen. Vater Jacques, wie man ihn in der ganzen Gegend nennt, hat gleichzeitig mit dem Professor das Gelbe Zimmer betreten. Dieses Zimmer grenzt an das Laboratorium. Das Laboratorium und das Gelbe Zimmer befinden sich in einem Pavillon im Hintergrunde des Parks, ungefähr dreihundert Meter von dem Schlosse entfernt.
›Es war halb eins‹, so erzählte er uns; ›ich war im Laboratorium, wo Herr Stangerson noch arbeitete, als das Unglück geschah. Ich hatte den ganzen Abend aufgeräumt und Instrumente gereinigt und wartete nun darauf, dass Herr Professor das Laboratorium verlassen möchte, damit auch ich zu Bett gehen konnte. Fräulein Mathilde hatte mit ihrem Vater bis Mitternacht gearbeitet; als die Kuckucksuhr im Laboratorium Mitternacht schlug, ist sie aufgestanden, hat Herrn Stangerson geküsst und ihm gute Nacht gewünscht. Zu mir hat sie gesagt: Gute Nacht, Vater Jacques! und dann hat sie die Tür des Gelben Zimmers geöffnet. Wir hörten, wie sie die Tür zuschloss und den Riegel vorschob; ich musste ordentlich lachen und sagte zum Herrn: Das Fräulein schließt sich ein. Gewiss hat sie Angst vor dem Tier Gottes! Der Herr hat mich gar nicht gehört, so vertieft war er in seine Arbeit. Aber wie eine Antwort kam von draußen ein grässliches Miauen, in dem ich das Geschrei dieser Teufelsbestie erkannte, die man bei uns das Tier Gottes nennt; es war so schauerlich, dass mir eine Gänsehaut über den Rücken lief. Wird es uns heute Nacht wieder stören, dachte ich; denn ich muss Ihnen sagen, dass ich bis Ende Oktober oben auf dem Boden des Pavillons über dem Gelben Zimmer schlafe, bloß damit das Fräulein nicht die ganze Nacht allein hier hinten im Park bleibt. Es ist so eine Idee vom Fräulein, solange die schöne Jahreszeit dauert, im Pavillon zu wohnen; da gefällt es ihr gewiss besser als im Schloss. Die ganzen vier Jahre, seit der Pavillon steht, richtet sie sich jedes Mal hier ein, wenn es Frühling wird. Wenn es dann wieder Winter wird, zieht das Fräulein ins Schloss zurück, denn im Gelben Zimmer ist kein Kamin.‹
Wir waren also im Pavillon, Herr Stangerson und ich. Wir machten gar kein Geräusch. Er war an seinem Schreibtisch beschäftigt. Ich saß auf einem Stuhl, da ich mit meiner Arbeit fertig war. Ich lege dem Umstande große Bedeutung bei, dass wir kein Geräusch machten, denn deshalb hat der Mörder sicher geglaubt, wir wären fort. Plötzlich, während der Kuckuck halb eins rief, drang ein verzweifeltes Geschrei aus dem Gelben Zimmer. Es war die Stimme des Fräuleins: Mörder! Mörder! Hilfe! Im gleichen Augenblicke knallten Revolverschüsse; ein wilder Lärm erhob sich, als wenn Tische und Möbel im Kampfe umgestürzt würden; und wieder erscholl die schreiende Stimme: Mörder, Hilfe … Vater! Vater! Sie können sich denken, wie wir aufgesprungen sind, und wie wir, Herr Stangerson und ich, auf die Tür zustürzten. Aber ach! Sie war verschlossen, von innen fest verschlossen; wir hatten ja eben erst den Riegel gehört. Wir versuchten die Tür einzuschlagen, aber sie gab nicht nach. Herr Stangerson war wie wahnsinnig. Er schlug mit aller Gewalt gegen die Tür; dabei weinte er vor Wut und schluchzte in ohnmächtiger Verzweiflung.
Da hatte ich eine Eingebung. Der Mörder wird durch das Fenster eingedrungen sein, rief ich aus. Ich gehe ans Fenster! Und ich stürzte wie ein Besessener aus dem Pavillon.
Unglücklicherweise geht das Fenster des Gelben Zimmers auf das freie Feld hinaus, sodass die Mauer des Parks, der sich bis zum Pavillon erstreckt, mich daran hinderte, sofort an dieses Fenster zu gelangen. Nur durch den Park konnte man es erreichen. Ich lief in der Richtung des Gitters, und unterwegs traf ich Bernier und seine Frau, die Torhüter, die auf das Schießen und Schreien herbeigeeilt kamen. Ich setzte ihnen in zwei Worten die Lage auseinander, sagte dem Pförtner, sich sofort zu Herrn Stangerson zu begeben, und befahl seiner Frau, mit mir zu kommen und mir die Gittertür des Parks zu öffnen. Fünf Minuten darauf waren wir beide, die Frau des Pförtners und ich, vor dem Fenster des Gelben Zimmers. Der Mond schien hell; ich sah deutlich, dass das Fenster unberührt war. Nicht nur die Gitterstäbe waren unversehrt, auch die Fensterläden hinter dem Gitter waren noch verschlossen, wie ich sie selbst am Abend geschlossen hatte; ich tue das jeden Abend, obgleich Fräulein Stangerson mir gesagt hatte, ich sollte es nur lassen, sie würde selbst die Läden schließen. Nun, die Läden waren zu, genau so, wie ich sie sorgsam mit einer eisernen Klinke von innen befestigt hatte. Der Mörder war also auf diesem Wege weder hineingelangt noch hinausgesprungen; wir konnten auch nicht durch das Fenster ins Zimmer. Das war das Unglück! Es war zum Verrücktwerden. Die Tür des Zimmers von innen verschlossen, die Läden des einzigen Fensters ebenso und über den Läden das Gitter unversehrt, ein Gitter, durch das man nicht einmal den Arm stecken kann. Und das Fräulein, das um Hilfe rief … Oder vielmehr nein, man hörte sie nicht mehr. Sie war vielleicht tot. Aber ich hörte noch immer hinten im Pavillon den Herrn, der versuchte, die Tür aufzubrechen.
Die Frau des Pförtners und ich machten uns wieder auf den Weg, und kamen zum Pavillon zurück. Die Tür hielt noch immer stand, trotzdem Herr Stangerson und Bernier mit wütenden Schlägen auf sie einhieben. Endlich gab sie unter unsern heftigen Anstrengungen nach, und – was bekamen wir zu sehen?
Ich muss bemerken, dass die Frau des Pförtners die Lampe aus dem Laboratorium in der Hand hielt, eine mächtig große Lampe, die das ganze Zimmer beleuchtete. Auch muss ich Ihnen sagen, mein Herr, dass das Gelbe Zimmer sehr klein ist. Das Fräulein hatte es mit einem ziemlich großen eisernen Bett, einem Tisch, einem Nachttisch und zwei Stühlen möbliert. Alles das konnten wir auch beim Schein der großen Lampe mit einem Blick übersehen. Das Fräulein im Nachthemd lag auf der Erde, inmitten einer unglaublichen Verwüstung. Gewiss hatte man das Fräulein aus dem Bett gerissen; sie war ganz voll Blut und trug schreckliche Nagelspuren am Hals. Das Fleisch des Halses war fast zerfetzt von Nägeln, und in der rechten Schläfe war ein Loch, aus dem Blut sickerte. Am Boden war schon eine kleine Blutlache entstanden. Als Herr Stangerson seine Tochter in solchem Zustande sah, warf er sich über sie und stieß einen Schrei der Verzweiflung aus, der einem tief zu Herzen ging. Er erkannte, dass die Unglückliche noch atmete, und beschäftigte sich nur mit ihr. Wir anderen suchten den Mörder, den Elenden, der unsere Herrin hatte töten wollen, und ich schwöre Ihnen, mein Herr, wenn wir ihn gefunden hätten, so wäre es ihm übel bekommen! Aber, so unerklärlich es ist: er war fort, entflohen! Wie? Das geht über meine Begriffe! Niemand unter dem Bett, niemand hinter den Möbeln, kein Mensch!
Wir fanden nur seine Spuren: den blutigen Abdruck einer großen Männerhand an den Wänden und an der Tür ein großes, von Blut gerötetes Taschentuch ohne Namenszeichen, eine alte Mütze, und auf dem Fußboden eine Menge frischer Abdrücke von Männerfüßen. Der Mann, der hier gegangen war, hatte einen großen Fuß, und er war in Ruß oder so etwas Ähnliches getreten, das konnten wir sehen. Aber das war auch alles! Wie war der Mann aus dem Zimmer gelangt? Vergessen Sie nicht, mein Herr, dass das Gelbe Zimmer keinen Kamin hat. Er konnte nicht durch die schmale Tür entwischt sein, deren Schwelle die Frau des Pförtners mit der Lampe betreten hat, während ihr Mann und ich den Mörder in diesem kleinen Quadrat von Zimmer suchten, in dem es unmöglich ist, sich zu verstecken, und wo wir niemand fanden. Die eingeschlagene, aus den Angeln gerissene Tür konnte nichts verbergen, wir haben uns davon überzeugt. Durch das verschlossene Fenster mit seinen festen Läden und Eisengittern war er auch nicht hinausgekommen. Also? Mussten wir da nicht an den Teufel glauben?
Aber was entdeckten wir da auf der Erde? Meinen Revolver. Ja, Herr, meinen eigenen Revolver. Das hat mich wieder zur Wirklichkeit zurückgebracht! Der Teufel hätte nicht nötig gehabt, mir meinen Revolver zu stehlen, um das Fräulein zu töten. Der Mensch, der in der Nacht hier gewesen war, ist vorher in meiner Bodenkammer gewesen, hat meinen Revolver aus der Schublade genommen und sich seiner für seine bösen Absichten bedient. Zwei Schüsse hat er abgefeuert, das haben wir festgestellt. Nun, und dabei habe ich bei allem Unglück noch Glück gehabt, weil Herr Stangerson drüben in seinem Laboratorium war, als die Tat geschehen ist, und sich mit seinen Augen überzeugt hat, dass ich mich auch dort befand. Sonst – wer weiß, was aus dieser Revolvergeschichte geworden wäre! Ich säße wohl schon längst hinter Schloss und Riegel. Das Gericht braucht nicht viel mehr, um einen Menschen aufs Schafott zu bringen!«
Der Redakteur fügte diesem Interview folgende Zeilen hinzu:
»Wir ließen uns vom Vater Jacques, ohne ihn zu unterbrechen, in seiner schlichten Art erzählen, was er von dem Verbrechen des Gelben Zimmers weiß. Wir haben sogar seine Ausdrucksweise nach Möglichkeit beibehalten. Wir haben dem Leser nur das fortwährende Gejammer geschenkt, mit dem er seine Erzählung ausschmückte. Wir haben Vater Jacques – Jacques Louis Moustier – noch weiter vernehmen wollen, aber da hat ihn der Untersuchungsrichter holen lassen, der seine Untersuchung in dem großen Saale des Schlosses fortsetzte. In das Schloss selbst konnten wir nicht eindringen, und der Park, das sogenannte Wäldchen, wird im weiten Umkreis von Polizisten bewacht, die eifrig allen Spuren folgen, die zum Pavillon und zur Entdeckung des Mörders führen könnten.
Wir haben auch das Torhüterpaar vernehmen wollen, aber die Leute sind unsichtbar. Endlich haben wir in einem Wirtshause, nicht weit von dem Gitter des Schlosses, gewartet, bis Herr de Marquet, der Untersuchungsrichter von Corbeil, fortging. Um halb sechs sahen wir ihn mit seinem Schreiber herauskommen. Ehe er in den Wagen stieg, konnten wir ihm noch die folgende Frage stellen:
›Herr de Marquet, können Sie uns auf einige Fragen Antwort geben, ohne dass Ihre Untersuchung gestört wird?‹
›Unmöglich!‹ sagte Herr de Marquet. ›Übrigens ist es die seltsamste Geschichte, die mir jemals vorgekommen ist! Je mehr wir zu wissen glauben, desto weniger wissen wir.‹
Wir baten Herrn de Marquet, uns diese letzten Worte gefälligst zu erklären. Was er sagte, geben wir unverändert wieder, weil es uns zur Beurteilung der Sachlage sehr wichtig erscheint:
›Wenn weiter nichts herauskommt, als was wir bisher festgestellt haben, dann wird das Geheimnis dieses Verbrechens schwerlich aufgeklärt werden. Aber wir wollen im Interesse der Gerechtigkeit und aus Gründen der Logik hoffen, dass die Untersuchung der Zimmerwände uns Klarheit bringt. Ich will sie morgen vornehmen, zusammen mit dem Baumeister, der vor vier Jahren den Pavillon gebaut hat. Denn das Problem ist folgendes: Wir wissen, wie der Mörder ins Zimmer gekommen ist, aber wir wissen nicht, wie er wieder hinausgelangte. In das Zimmer kam er durch die Tür, und er versteckte sich unter dem Bett. Aber wie entfloh er? Ich bin entschlossen – und Herr Professor Stangerson ist damit einverstanden –, die Wände zu zerstören und den Pavillon niederzureißen, wenn sich das Geheimnis nicht auf andere Art ergründen lässt. Aber wenn wir dann keine Geheimtür, kein Versteck, keinen Ausweg finden, wenn die Decke kein Loch hat und der Fußboden keine Falltür, dann fange ich auch an, wie der Vater Jacques, an den Teufel zu glauben.‹«
Der Redakteur bemerkte in diesem Artikel, dass der Untersuchungsrichter einen gewissen Nachdruck auf den letzten Satz legte: »Dann muss man schon an den Teufel glauben, wie Vater Jacques sagt.«
Der Artikel schließt: »Wir wollten wissen, was der Vater Jacques unter dem Tiere Gottes verstand, das auf ihn so unheimlich wirkte. Das Tier Gottes ist, wie uns der Wirt erzählte, nichts anderes als eine große Katze, die einer alten Frau der Gegend gehört. Diese Alte gilt als eine Art Heilige; sie lebt als Einsiedlerin im Walde, nicht weit von der Grotte der heiligen Genoveva, und der Volksmund nennt sie ›die kniende Mutter‹.
Das Gelbe Zimmer, das Tier Gottes, die kniende Mutter, der Teufel, die heilige Genoveva, Vater Jacques – steckt dahinter nicht ein ganz verwickeltes Verbrechen, das uns morgen ein Hieb mit dem Beil in die Mauern des Gelben Zimmers entwirren wird? Leider fürchtet man, dass Fräulein Stangerson, die noch immer fantasiert und nur deutlich das Wort ›Mörder, Mörder, Mörder‹ ausspricht, die Nacht nicht überleben wird.«
Endlich wusste das gleiche Blatt noch mitzuteilen, dass der berühmte Polizeidetektiv Frédéric Larsan, der in der Angelegenheit eines großen Diebstahls nach London geschickt worden war, von dem Chef der Sicherheitspolizei telegrafisch nach Paris zurückberufen worden sei.
Zweites Kapitel – Erstes Auftreten Joseph Rouletabilles
Ich erinnere mich, als wäre es heute geschehen, wie der junge Rouletabille an jenem Morgen in mein Zimmer trat. Es war gegen acht Uhr, ich lag noch im Bett und las den Artikel des Matin, der sich auf das Verbrechen in Le Glandier bezog.
Doch vor allen Dingen muss ich meinen Freund vorstellen.
Ich habe Joseph Rouletabille kennengelernt, als er noch ein kleiner Reporter war. Zu jener Zeit fing meine Tätigkeit am Gericht an, und hier hatte ich oft Gelegenheit, ihm auf den Korridoren der Untersuchungsrichter zu begegnen. Sein Kopf mit den frischen Augen war kugelrund, und aus diesem Grunde, denke ich, hatten ihm seine Kollegen von der Presse jenen Beinamen gegeben, den er immer behalten sollte: »Rouletabille«, nämlich Rollkugel. Hast du Rouletabille gesehen? – Seht, da ist dieser »verfluchte kleine Kerl« Rouletabille! – Oft war er rot wie eine Tomate, manchmal froh wie eine Lerche, manchmal ernst wie ein Heiliger. So jung! – Er war, als ich ihn zum ersten Mal sah, sechzehn und ein halbes Jahr alt. Und verdiente schon sein Brot bei der Presse. Wie das zuging? Das hätte man sich fragen müssen, wenn nicht alle, die mit ihm in Berührung kamen, von seinen ersten Erfolgen gehört hätten. Zur Zeit der Affäre der »Zerstückelten Frau in der Rue Oberkampf« – auch eine lang vergessene Geschichte – hatte er dem Chefredakteur der »Epoque«, einer Zeitung, deren Informationen damals mit denen des Matin wetteiferten, den noch fehlenden linken Fuß der Leiche gebracht. Man hatte ihn in dem Korbe vermisst, in dem die traurigen Überreste entdeckt wurden. Acht Tage lang suchte die Polizei diesen linken Fuß vergeblich, bis ihn der junge Rouletabille in einem Abflusskanal auffand. Kein Mensch war darauf gekommen, ihn dort zu suchen. Rouletabille hatte sich zu diesem Zweck bei den Reinigungswerken der städtischen Kanalanlagen verdingt, als die Verwaltung infolge ungewöhnlichen Hochwassers der Seine dringend nach Hilfskräften verlangte. Sobald der Chefredakteur im Besitze des kostbaren Fußes war und vernommen hatte, durch welche Reihenfolge kluger Schlüsse es dem jungen Manne gelungen war, ihn zu entdecken, waren seine Gefühle geteilt zwischen der Bewunderung so großen Detektivspürsinns in einem Hirn von sechzehn Jahren und der Genugtuung, den »linken Fuß der Rue Oberkampf« der Polizei übergeben zu können.
»Über diesen Fuß«, rief er aus, »werde ich einen Leitartikel schreiben!«
Nachdem er sodann das unheimliche Paket dem Redaktionsarzt der »Epoque« anvertraut hatte, wandte er sich zu unserm zukünftigen »Rouletabille« mit der Frage, wie viel Gehalt er beanspruche, um als kleiner Reporter für Lokalnachrichten angestellt zu werden.
»Zweihundert Franken monatlich«, erwiderte bescheiden der junge Mann, dem vor Überraschung das Wort in der Kehle stecken blieb.
»Sie sollen zweihundertfünfzig haben«, versetzte der Chefredakteur; »nur müssen Sie aller Welt erklären, dass Sie schon seit einem Monat Mitarbeiter der Redaktion sind. Selbstverständlich haben nicht Sie ›den linken Fuß der Rue Oberkampf‹ entdeckt, sondern die Zeitung L’Epoque. Der einzelne, junger Freund, gilt in solchen Fällen nichts, die Zeitung alles!«
Damit entließ er den frisch gebackenen jungen Redakteur, rief ihn aber auf der Schwelle nochmals zurück und fragte ihn nach seinem Namen.
»Joseph Josephin.«
»Das klingt nach gar nichts; aber da Sie nicht zeichnen, hat es weiter keine Bedeutung.«
Es dauerte nicht lange, so war der neue Mitarbeiter mit dem bartlosen Kindergesicht bei der ganzen Redaktion ungemein beliebt geworden, denn er war gegen jedermann gefällig und mit einem gesunden Humor begabt, der selbst den Griesgrämigsten erheiterte und alle Neider entwaffnete. Im Advokatencafé, wo die Tagesreporter damals zusammenzukommen pflegten, ehe sie sich aufs Gericht oder zur Polizeipräfektur begaben, um ihr tägliches Verbrechen zu holen, kam er bald in den Ruf eines Allerweltskerls, der es fertig kriegte, sogar bis ins Allerheiligste des obersten Polizeichefs einzudringen. Wenn sich ein Fall der Mühe lohnte, und Rouletabille – er war schon im Besitz dieses Spitznamens – von seinem Chefredakteur auf die Kriegsfährte losgelassen war, so geschah es nicht selten, dass er sich geschickter zeigte als der gewiegteste Polizist.
Hier im Advokatencafé machte ich seine nähere Bekanntschaft. Schon bei unserer ersten Unterhaltung empfand ich große Sympathie für diesen wackeren kleinen Rouletabille. Er hatte eine so rege und so originelle Intelligenz, und nie habe ich wieder bei jemandem eine solche Denkart gefunden.
Nicht lange darauf wurde ich mit der Gerichtschronik für den »Cri du Boulevard« betraut. Mein Eintritt in den Zeitungsdienst konnte die Freundschaft, die mich mit Rouletabille verband, nur noch fester knüpfen. Dazu kam, dass mein neuer Freund kleine juristische Plaudereien für seine Zeitung, die »Epoque«, zu schreiben hatte und ich des öfteren in die Lage kam, ihm hierfür allerhand Auskünfte über Rechtssachen zu erteilen.
So vergingen über zwei Jahre, und je mehr ich mit ihm verkehrte, umso lieber gewann ich ihn, denn unter seinem ausgelassenen Wesen verbarg sich ein für seine Jahre seltener Ernst. Ja mehrmals fand ich ihn, den ich gewohnt war stets heiter, oft sogar zu heiter zu sehen, in tiefe Traurigkeit versunken. Fragte ich aber nach dem Grunde dieser veränderten Stimmung, so lachte er gleich wieder und gab darauf keine Antwort. Als ich mich einmal nach seinen Eltern, von denen er nie sprach, erkundigte, ließ er mich einfach stehen und tat, als hätte er meine Frage gar nicht gehört.
Mittlerweile ereignete sich die berühmte »Affäre des geheimnisvollen Zimmers«, die ihn zu einem der ersten Reporter machen sollte. Rouletabille trat an jenem Morgen zu mir ins Zimmer. Sein Gesicht war noch röter als gewöhnlich; die Augen quollen ihm förmlich aus dem Kopf, und er schien von einer tiefen Erregung ergriffen zu sein. Mit fieberheißer Hand, in der er den Matin hielt, fuchtelte er in der Luft herum.
»Was sagen Sie dazu, mein lieber Sainclair?« rief er mir entgegen. »Haben Sie gelesen?«
»Das Verbrechen in Glandier?«
»Freilich, die Geschichte vom Gelben Zimmer!«
»Alle Wetter! Ich denke, der Teufel oder das Tier Gottes wird wohl den Mord begangen haben.«
»Bitte, reden Sie ernsthaft!«
»Nun, dann will ich Ihnen sagen, ich glaube nicht recht an Mörder, die durch die Wände entfliehen. Vater Jacques, meine ich, hätte die Mordwaffe nicht liegen lassen sollen. Da er gerade über dem Zimmer des Fräuleins Stangerson wohnt, wird die Untersuchung des Gebäudes, die der Richter noch heute vornimmt, uns gewiss den Schlüssel zu dem Geheimnis liefern, und wir werden bald genug erfahren, durch welches natürliche Schlupfloch oder durch welche geheime Tür der Kerl hatte entweichen können, um gleich nach vollbrachter Tat in das Laboratorium des Herrn Stangerson zurückzugelangen, ohne dass natürlich dieser von allem das geringste bemerkte. Was soll ich Ihnen weiter sagen? Es ist eine Hypothese, nichts weiter!«
Rouletabille warf sich in einen Lehnstuhl, steckte seine Pfeife an, die ihn niemals verließ, tat schweigend einige Züge, wohl um die Unruhe, die ihn sichtlich erfasst hatte, zu beschwichtigen und sprach endlich mit verächtlichem Lachen: »Junger Mann!« – und in seinem Tone lag viel mitleidiger Spott – »Junger Mann, Sie sind Advokat, und ich zweifle nicht an Ihrem Talent, die Schuldigen loszueisen; aber sollten Sie einmal den Untersuchungsrichter spielen müssen, dann könnte es sehr leicht passieren, dass Sie einen Unschuldigen aufs Schafott bringen. – Sie haben wirklich Talent, junger Mann.«
Nach einigen kräftigen Zügen aus seiner Pfeife fuhr er fort: »Man wird keine Falltür finden, und das Geheimnis des Gelben Zimmers scheint immer undurchdringlicher zu werden. Aus diesem Grunde eben interessiert es mich so sehr. Der Untersuchungsrichter hat ganz recht: nie hat man etwas Seltsameres erlebt als dieses Verbrechen.«
»Haben Sie irgendeine Idee, auf welchem Wege der Mörder wohl entflohen sein könnte?« fragte ich.
»Keine Ahnung«, antwortete mir Rouletabille, »für den Augenblick wenigstens nicht. Aber ich habe bereits meine bestimmte Ansicht über den Revolver. Der Mörder hat sich des Revolvers nicht bedient.«
»Ja, aber wer denn sonst, mein Gott?«
»Nun, vielleicht war es Fräulein Stangerson.«
»Ich begreife nicht mehr«, rief ich aus, »oder richtiger, ich habe überhaupt noch nichts begriffen.«
Rouletabille zuckte mit den Achseln: »Ist Ihnen an dem Artikel des Matin denn nichts Besonderes aufgefallen?«
»Nicht dass ich wüsste! Alles, was darin steht, habe ich höchst seltsam gefunden.«
»Ja aber – und die verschlossene Tür?«
»Das schien mir das einzige Natürliche an der Geschichte.«
»Wirklich? – Und der Riegel?«
»Der Riegel?«
»Der von innen vorgeschobene Riegel? Fräulein Stangerson hat sich gut vorgesehen. Ich meine, Fräulein Stangerson wusste, dass sie jemand zu fürchten hatte; sie hatte ihre Vorsichtsmaßregeln getroffen; sie hat sogar den Revolver des Vater Jacques an sich genommen, ohne ihm etwas davon zu sagen. Kein Zweifel, sie wollte niemanden erschrecken; vor allem wollte sie ihren Vater nicht erschrecken. – Was Fräulein Stangerson befürchtete, ist eingetroffen. Und sie hat sich verteidigt. Es hat einen Kampf gegeben, wobei sie sich ziemlich geschickt ihres Revolvers bediente, indem sie den Mörder an der Hand verwundete – so erklärt sich der Abdruck der großen blutigen Männerhand an der Wand und an der Tür, die wohl umhertastend einen Ausgang zur Flucht suchte – aber Fräulein Stangerson hatte nicht schnell genug geschossen, um dem furchtbaren Schlage zu entgehen, der sie an der Schläfe traf.«
»Die Wunde an Fräulein Stangersons Schläfe rührt also nicht vom Revolver her?«
»Das sagt das Blatt nicht, und ich für meine Person glaube es auch nicht, denn ich halte an der logischen Voraussetzung fest, dass der Revolver Fräulein Stangerson zum Schutze gegen den Mörder gedient haben müsse. Jetzt ist die Frage: Welches war die Waffe des Mörders? Der Schlag gegen die Schläfe scheint zu bezeugen, dass der Angreifer das Fräulein totschlagen wollte, nachdem er vergebens versucht hatte, sie zu erwürgen. Der Mörder musste wissen, dass die Dachstube von Vater Jacques bewohnt wurde, und dies ist einer der Gründe, weshalb er meines Erachtens vorzog, sein Verbrechen mit einer geräuschlosen Waffe zu verüben, vielleicht mit einem Beil oder Hammer.«
»Alles das aber«, warf ich ein, »erklärt uns noch immer nicht, wie unser Mörder aus dem Gelben Zimmer entkommen ist!«
»Das stimmt allerdings«, erwiderte Rouletabille und stand auf; »da die Sache aufgeklärt werden muss, gehe ich nach dem Schloss Le Glandier, und ich bin hergekommen, um Sie abzuholen. Begleiten Sie mich dahin!«
»Ich?!«
»Ja, Sie, lieber Freund, ich brauche Sie. Die Epoque hat mir den Fall übergeben, und ich muss daher so rasch als möglich Klarheit gewinnen.«
»Aber inwiefern kann ich Ihnen dabei behilflich sein?«
»Herr Robert Darzac befindet sich auf Schloss Le Glandier.«
»In der Tat – seine Verzweiflung muss grenzenlos sein!«
»Ich muss ihn sprechen.«
Rouletabille sagte diese Worte in einem Tone, der mich überraschte.
»Wie? Glauben Sie von dieser Seite etwas Interessantes zu erfahren?« fragte ich.
»Ja.«
Mehr wollte er mir nicht sagen.
Ich kannte Herrn Robert Darzac, denn in einem Zivilprozess hatte ich ihm einst einen großen Dienst geleistet. Dies geschah zu der Zeit, als ich noch Referendar beim Notar Barbet-Delatour war. Robert Darzac, der damals in den vierziger Jahren stehen mochte, war Professor der Physik an der Sorbonne. Er stand mit den Stangersons in überaus freundschaftlichem Verkehr, zumal da er nach sieben Jahren andauernden Werbens endlich nahe daran war, sich mit Fräulein Stangerson zu vermählen, einer nicht mehr ganz jungen Dame – sie mochte ungefähr sechsunddreißig Jahre alt sein –, die aber noch immer von auffallender Schönheit war.
Während ich mich ankleidete, rief ich meinem Freunde Rouletabille, der im Salon schon ungeduldig wurde, die Frage zu:
»Haben Sie eine Ahnung, welcher Gesellschaftsklasse der Mörder angehören mag?«
»Jawohl«, versetzte er, »ich vermute in ihm, wenn nicht einen Mann von Stande, so doch jemanden, der aus besseren Kreisen stammt. Das ist aber nur so ein Eindruck.«
»Und worauf gründet sich dieser Eindruck?«
»Ei nun! Ich meine«, versetzte der junge Mann, »die schmutzige Mütze, das grobe Taschentuch und die Spuren der plumpen Stiefel auf dem Fußboden –«
»Ich verstehe«, sagte ich; »man lässt nicht so zahlreiche Spuren hinter sich, wenn sie wirklich die Wahrheit verraten!«
»Bravo! Aus Ihnen kann noch etwas werden«, schloss Rouletabille das Gespräch.
Drittes Kapitel – Ein Mensch huscht wie ein Schatten durch die Fensterläden
Eine halbe Stunde später waren Rouletabille und ich auf dem Orléans-Bahnhof und warteten auf die Abfahrt des Zuges, der uns nach Epinay-sur-Orge führen sollte. Unter den Reisenden bemerkten wir den Untersuchungsrichter von Corbeil, Herrn de Marquet, mit seinem Schreiber.
Herr de Marquet hatte mit seinem Schreiber die Nacht in Paris zugebracht, um im Scala-Theater der Generalprobe einer kleinen Revue, deren Verfasser er war, beizuwohnen. Das Stück war allerdings nur »Castigat Ridendo« gezeichnet. Herr de Marquet war im gewöhnlichen Leben die Höflichkeit und Liebenswürdigkeit selbst, und zeit seines Lebens hatte er nur eine Leidenschaft gehabt, nämlich die, Theaterstücke zu schreiben. Im Laufe seiner Amtstätigkeit hatte er sich eigentlich stets nur für solche Fälle interessiert, die geeignet waren, ihm den Stoff zu mindestens einem Akt zu liefern. Obwohl er Aussicht auf die höchsten Richterposten hatte, war sein Bestreben in Wirklichkeit stets nur darauf gerichtet gewesen, beim Theater anzukommen. Mit all seinen Idealen hatte er es denn schließlich auch nicht weiter gebracht als bis zum Untersuchungsrichter in Corbeil und zu einem kleinen frivolen Einakter, der unter dem Pseudonym »Castigat Ridendo« soeben an der Scala zur Aufführung gelangt war.
Das Drama des Gelben Zimmers mit allem Geheimnisvollen und Unerklärlichen musste einen solchen Schöngeist natürlich mächtig anziehen. Der Fall interessierte ihn ungeheuer, und Herr de Marquet stürzte darüber her, weniger wie ein Vertreter der Gerichtsbehörde, den danach dürstet, die Wahrheit zu ergründen, als vielmehr wie ein Liebhaber dramatischer Verwicklungen, dessen ganzes Sinnen darauf gerichtet ist, das Dunkel der Intrige aufzuhellen, und der gleichwohl nichts so sehr fürchtet wie den immer näher rückenden Schluss des letzten Aktes, worin alles sich aufklärt.
So hörte ich, just in dem Augenblick, als wir uns begegneten, Herrn de Marquet seufzend zu seinem Schreiber sagen:
»Ach, mein lieber Herr Maleine, wenn uns nur nicht der Baumeister mit seiner Hacke das ganze schöne Geheimnis zerstört!«
»Seien Sie außer Sorge«, gab ihm Herr Maleine zur Antwort, »seine Hacke wird den Pavillon vielleicht einreißen, unser Geheimnis aber bleibt unversehrt. Ich habe alle Wände betastet, habe den Fußboden genau untersucht, und ich verstehe mich darauf. Ich lasse mich nicht täuschen. Wir können ruhig sein: wir werden nichts finden.«
Nachdem Herr Maleine seinen Vorgesetzten auf diese Weise beruhigt hatte, machte er ihn durch eine diskrete Kopfbewegung auf uns aufmerksam. Herr de Marquet runzelte die Stirn, und als er Rouletabille auf sich zukommen sah, eilte er rasch auf eine offene Wagentür zu und sprang in den Zug, während er seinem Schreiber halblaut zuraunte: »Nur keine Journalisten!«
Maleine erwiderte: »Das versteht sich von selbst!« Damit stellte er sich Rouletabille, der spornstreichs hinterherkam, in den Weg und hatte die Unverschämtheit, ihn nicht in das Abteil des Untersuchungsrichters einsteigen zu lassen.
»Erlauben Sie, meine Herren, dieses Abteil ist reserviert!«
»Ich bin Journalist, mein Herr, der Redakteur der Epoque«, erklärte mein junger Freund mit großem Aufwand von Verbeugungen und höflichen Phrasen. »Ich habe mit Herrn de Marquet ein paar Worte zu sprechen.«
»Herr de Marquet ist aber sehr beschäftigt mit seiner Untersuchungssache.«
»Oh! Seine Untersuchungssache ist mir durchaus gleichgültig! Ich bin kein Winkelreporter, der über totgefahrene Hunde und ähnliche Dinge berichtet; ich bin Theaterkritiker, und da ich noch heute Abend einen kleinen Bericht über die Revue der Scala zu machen habe …«
»Steigen Sie ein, verehrtester Herr, bitte, steigen Sie ein!« rief der Schreiber wie umgewandelt und trat höflich zur Seite.
Rouletabille war schon im Abteil. Ich folgte und setzte mich neben ihn; auch der Schreiber stieg hinter mir ein.
Herr de Marquet warf seinem Schreiber einen fragenden Blick zu.
»O bitte, mein Herr«, ergriff Rouletabille das Wort, »nicht mit Herrn de Marquet möchte ich die Ehre haben zu sprechen, sondern mit Herrn Castigat Ridendo! … Erlauben Sie mir Ihnen zu gratulieren, und zwar in der Eigenschaft des Theaterberichterstatters der Epoque.«
Und Rouletabille stellte erst mich, dann sich selbst vor. Herr de Marquet streichelte nervös sein Kinn. Er versicherte Rouletabille in einigen Worten, dass er ein viel zu bescheidener Autor sei, um den Schleier seines Pseudonyms öffentlich gehoben zu wünschen; er wolle hoffen, dass der Enthusiasmus des Journalisten für das Werk des Dramatikers nicht so weit gehen werde, das Publikum wissen zu lassen, dass Herr »Castigat Ridendo« kein anderer sei als der Untersuchungsrichter von Corbeil.
»Das Werk des dramatischen Dichters«, fügte er nach einem leichten Zögern hinzu, »könnte dem Werke des Beamten schaden, besonders in der Provinz, wo man ein wenig konservativ ist.«
»Verlassen Sie sich auf meine Diskretion!« rief Rouletabille mit erhobenen Händen, als wenn er den Himmel zum Zeugen anrufen wollte.
Der Zug setzte sich in Bewegung.
»Wir fahren ab«, sagte der Untersuchungsrichter, sehr erstaunt, dass wir mit ihm reisten.
»Ja, mein Herr, die Wahrheit ist auf – dem Wege«, erwiderte der Reporter mit liebenswürdigem Lächeln, »sie macht sich auf nach dem Schlosse Le Glandier. Schöne Geschichte das, Herr de Marquet, eine schöne Geschichte!«
»Eine dunkle Affäre! Eine unglaubliche, unergründliche, unerklärliche Affäre. Und ich fürchte nur eins, Herr Rouletabille, nämlich, dass die Journalisten sich hineinmengen werden – um sie aufzuklären.«
Der Hieb saß.
»Ja«, sagte mein Freund ruhig, »das muss man fürchten. Sie mengen sich in alles. Was mich betrifft, so spreche ich freilich nur zu Ihnen, weil der Zufall, Herr Untersuchungsrichter, der reine Zufall mich Ihnen in den Weg geführt hat, und ich wie durch eine Fügung in Ihr Abteil geraten bin.«
»Wohin reisen Sie denn?« fragte Herr de Marquet.
»Nach dem Schlosse Le Glandier«, erwiderte Rouletabille.
Herr de Marquet fuhr auf: »Sie werden nicht hineingehen, Herr Rouletabille!«
»Sie wollen es verhindern?« rief mein Freund, sofort kampfbereit.
»Das nicht! Ich liebe die Journalisten viel zu sehr, um ihnen irgendwelche Unannehmlichkeiten zu bereiten; aber ich weiß, dass Herr Stangerson jeden an seiner Tür abweisen lässt. Und diese Tür ist streng bewacht. Gestern durfte kein Journalist das Tor des Schlosses durchschreiten.«
»Umso besser«, bemerkte Rouletabille, »so komme ich gerade recht.«
Herr de Marquet biss sich auf die Lippen und schien geneigt, ein hartnäckiges Stillschweigen zu bewahren. Er gab es erst ein wenig auf, als Rouletabille ihn nicht länger in Unwissenheit darüber ließ, dass wir uns nach Glandier begaben, um dort einen »alten intimen Freund« zu begrüßen, wie er mit Bezug auf Robert Darzac erklärte, den er vielleicht einmal in seinem Leben gesehen hatte.
»Der arme Robert«, fuhr der junge Reporter fort. »Er wird es kaum überleben. Er hat Fräulein Stangerson so sehr geliebt! Doch wir wollen hoffen, dass Fräulein Stangerson am Leben erhalten bleibt.«
»Hoffen wir es! Ihr Vater sagte mir gestern, wenn sie stürbe, würde er ihr ins Grab folgen. Welch unberechenbarer Verlust für die Wissenschaft!«
»Die Wunde an der Schläfe ist sehr schlimm, nicht wahr?«
»Allerdings – aber ein unerhörtes Glück, dass sie nicht tödlich gewesen ist. Der Schlag ist mit solcher Kraft geführt worden …«
»So war es nicht der Revolver, der Fräulein Stangerson verwundet hat?« fragte Rouletabille, indem er mir einen triumphierenden Blick zuwarf.
Herr de Marquet schien sehr verlegen: »Ich habe nichts gesagt, und ich werde nichts sagen!«
Damit wandte er sich an seinen Schreiber und tat, als ob er uns nicht mehr kenne.
Aber so schnell wird man einen Rouletabille nicht los. Er zog den Matin aus der Tasche und sagte zu ihm: »Herr Untersuchungsrichter, ich möchte eine Frage an Sie richten, doch kann ich das nicht, ohne eine Indiskretion zu begehen. Sie haben den Bericht des Matin gelesen? Ist er nicht blödsinnig?«
»Ganz und gar nicht, mein Herr.«
»Ei was! Das Gelbe Zimmer hat nur ein vergittertes Fenster, dessen Stäbe nicht gelockert worden sind, und eine Tür, die man einschlagen muss – und man findet den Mörder nicht darin!«
»Es ist so, mein Herr, es ist so! Da liegt das Rätsel!«
Rouletabille sagte nichts mehr und überließ sich seinen eigenen Gedanken. So verfloss eine Viertelstunde. Endlich sagte er beiläufig:
»Wie trug Fräulein Stangerson an jenem Abend ihr Haar?«
»Ich verstehe nicht«, sagte Herr de Marquet.
»Das ist von äußerster Wichtigkeit«, entgegnete Rouletabille. »Das Haar war gescheitelt, nicht wahr? Ich bin sicher, dass sie an jenem Abend, dem Abend des Dramas, das Haar gescheitelt trug.«
»Sehen Sie, Herr Rouletabille, da sind Sie im Irrtum«, antwortete der Untersuchungsrichter; »Fräulein Stangerson trug an jenem Abend das Haar zurückgekämmt, in einem über der Stirn gewundenen Knoten. Das ist, so scheint mir, ihre gewöhnliche Haartracht, die Stirn gänzlich frei – ich kann es Ihnen bestätigen; denn wir haben die Wunde lange untersucht und fanden kein Blut an den Haaren; dabei hatte man die Frisur seit dem Attentate nicht berührt.«
»Sie sind Ihrer Sache sicher? Sie sind sicher, dass Fräulein Stangerson in der Mordnacht keinen Scheitel getragen hat?«