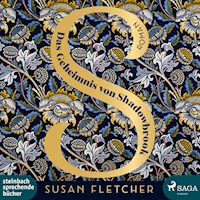
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Botanikerin Clara Waterfield wird 1914 aus London auf ein Anwesen nach Gloucestershire gerufen, um dort ein Palmenhaus einzurichten. Sie findet einen üppigen, verwunschenen Garten vor – doch das clematisbewachsene Haus wirkt seltsam abweisend, die meisten Räume sind verschlossen und der Besitzer, Mr. Fox, ist nur selten anzutreffen –, und nachts scheint es zu spuken. Doch Clara macht sich unerschrocken daran, die Geheimnisse von Shadowbrooks zu ergründen und macht dabei eine ungeheuerliche Entdeckung, die ihr weiteres Leben verändern wird …
Ein fesselnder Roman um eine mutige Frau, die ihrer Zeit weit voraus ist. Ein atmosphärischer, bildreicher Pageturner am Vorabend des Ersten Weltkriegs – aber auch ein Roman über das, was von uns bleibt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susan Fletcher
Das Geheimnis von Shadowbrook
Roman
Aus dem Englischen von Marieke Heimburger
Insel Verlag
Für Olli
I
Mit meinem Gerüst stimmt etwas nicht. Also mit meinem Skelett – dem Teil von mir, über den alles andere gespannt, an dem alles befestigt ist. Ich habe Knochenmark und Hohlräume, ich habe die glatten, runden Enden, die sich in Gelenke fügen – es fehlt kein einziges Teil. Aber meine Knochen sind zerbrechlich. Sie knacken bei jeder Bewegung. Als Kind habe ich mir durch die kleinste Geste, wenn ich nur den Kopf hob, Knochenbrüche zugezogen. So leicht, dass selbst die Ärzte erschrocken zurückzuckten und den Kopf schüttelten: völlig marode Knochen.
Die lateinische Bezeichnung meines Leidens ist zu lang, als dass man sie beiläufig erwähnen könnte. Osteogenesis imperfecta. Zweiundzwanzig Buchstaben, die den Kiefer knirschen lassen und die wir anfangs langsam üben mussten. Meine Mutter flüsterte die beiden Worte wie ein Gebet oder eine Beschwörungsformel. Auch ich sprach sie, wenn ich allein war, manchmal vor mich hin. Aber wir verwarfen sie schon bald und ersetzten sie durch Claras Knochen. Das hatte ich in den Zimmern und auf den Fluren des Krankenhauses aufgeschnappt – und diese wesentlich greifbareren, vertrauteren Worte trugen in sich, dass dieses Leiden mein eigenes war. Dass es in ganz London oder sonst wo niemand anderen gab, dessen Rippen brachen, wenn er nieste. Dessen Zähne abbrachen, wenn er mit einem Löffel dagegenstieß.
Inzwischen hat die Krankheit mich weniger fest im Griff. Ich bin immer noch von seltsamer Gestalt. Das Weiße meiner Augen schimmert immer noch bläulich – so wie Milch im Glas. Und meine Haut ist an manchen Stellen blasser – nämlich da, wo sie sich über verheilte Knochenbrüche strecken muss: eine hervorstehende Rippe, mein eingedrücktes Schlüsselbein. Darum werde ich diese lateinische Bezeichnung und ihre Bedeutung nie ganz loswerden. Doch jetzt bin ich wenigstens ausgewachsen. Meine Knochen sind stärker geworden, sie haben sich gefestigt.
Aber als Kind brach ich sie mir oft. Ich lebte in einer Welt aus Ärzten und Schienen, aus Tinkturen, die mir seltsame Knochenträume bescherten. Immer wieder schwoll ich irgendwo an, Blutergüsse wanderten über meinen Körper wie Stürme oder Fluten – sanft, in sämtlichen dunklen Schattierungen. Der erste Bruch, an den ich mich erinnern kann, widerfuhr mir im Winter: Ich stand auf der Treppe vor der Haustür und bestaunte den Schnee, und das hörbare Knacken in meinem Arm wurde nicht durch einen Sturz verursacht, sondern durch meine Mutter, die mich plötzlich packte und festhielt, um mich vor einem Sturz zu bewahren. Sie war ganz richtig ihrem Instinkt gefolgt, doch ihr Griff brach mir den Oberarmknochen – und ihr fast das Herz. Untröstlich saß sie an meinem Bett, wiegte sich und murmelte vor sich hin.
Mal brach ich mir auf der Regent Street den Kiefer. Mal stieß ich mit einem Passanten zusammen und brach mir die Rippen, worauf ich jäh den Atem ausstieß und auf dem Boden zusammensank, als hätte man die Luft aus mir herausgelassen. Mal kugelte ich mir auf dem Trafalgar Square die Schulter aus, als ich die Hand nach einem vorbeiflatternden Vogel ausstreckte – und mein Aufschrei ließ alle anderen Vögel auffliegen, so viele, dass ich ihren Luftzug spürte. Danach verfügten die Ärzte, dass mein Leben von nun an ausschließlich drinnen stattfinden müsse. Bis ich ganz ausgewachsen wäre, sollte ich zu meiner eigenen Sicherheit das Haus nicht mehr verlassen. Als meine Mutter protestierte – Aber sie ist doch ein Kind! –, verwiesen sie auf die anderen, kleineren Knochen in meinem Nacken. Die Halswirbel und ihre Funktion. »Begreifen Sie, was das für Ihre Tochter bedeuten könnte, Mrs Waterfield?« Und dann erwähnten sie noch den sehr fragilen Teil meines Schädels, der aufbrechen könnte wie ein Ei.
Zu Hause wurde alles gepolstert. Mit Samt und Daunen, bestickten Kissen, Perserteppichen und Seide. Wir hatten einen Globus. Und ein Schaukelpferd, das ich zwar anfassen, auf dem ich aber nicht reiten durfte. Meine Eltern brachten mir aus der turbulenten Welt draußen Dinge mit, von denen sie glaubten, dass sie mir vielleicht fehlen könnten: Tannenzapfen und Taubenfedern; den Pferdegeruch an den roten Handschuhen meiner Mutter, den ich mit geschlossenen Augen einsog. Sie erzählten mir, wie der Fluss in der Dämmerung ausgesehen hatte. Wie die Weihnachtssänger gesungen hatten, trotz des Regens. Als Mr Jamrachs Menagerie einen Bären erwarb, streckte meine Mutter die Arme weit empor und sagte: »Der Bär ist so groß, Clara! Und so breit!«
In jedem Zimmer standen Blumen. An den Wänden hingen Karten ferner Länder. Einmal im Herbst bat ich um echtes Laub von den Bäumen, über die ich in Büchern gelesen hatte – Bergahorn, Buche, Kastanie, Eiche –, und meine Mutter streifte durch sämtliche Londoner Parks. Jeden Tag beschrieb sie mir, was sie gesehen hatte: einen wunderhübschen Hut oder einen eleganten Schnurrbart oder ein Pferd mit einem sternförmigen Abzeichen auf der Stirn. Sie berichtete von Schornsteinfegern und Fuchsstolen – und wenn sie mal nicht aus dem Haus ging, erzählte sie mir eine ihrer Geschichten aus Indien und gab mir das Gefühl, selbst weitgereist und weltgewandt zu sein. Möbelecken waren mit Stoff abgepolstert. Glaswaren wurden außerhalb meiner Reichweite aufbewahrt. Um meine Zähne zu schonen, dünstete Millicent – unser Dienstmädchen – das Obst, bis es jegliche Form und jeden Geschmack verloren hatte. Sie buk extra weichen Lebkuchen.
Vor allem aber gab es bei uns zu Hause Bücher. Bücher waren mein Trost. Denn wenn ich schon nicht in der strahlenden, fabelhaften Welt da draußen herumlaufen konnte, so konnte ich wenigstens drinnen von ihr lesen. In Büchern, so sagte man mir, stünde das alles drin. Und so wurde das Esszimmer zu meinem siebten Geburtstag in eine Bibliothek verwandelt, ein Zimmer voller Regale und Karten und Gobelins, mit einer Leselampe mit Fransen am Schirm und einem Konzertflügel, auf dem ich wegen meiner Finger und Handgelenke nicht spielen konnte – dafür spielte meine Mutter, und zwar sehr gut. Es gab eine Chaiselongue, die zunächst moosfarben war. Doch je mehr ich las, je mehr Karten ich studierte, desto mehr verwandelte sich das tiefe, samtige Grün in die Farbe von Kolibriflügeln oder von Othellos Neid oder von Edelsteinen, die am Äquator im Boden schlummerten. Das Grün eines winzigen Ochsenfroschs.
Meine Mutter unterrichtete mich. Sie hatte betont, dass sie mehr als genug Bildung besitze, um die Hauslehrerin ihres einzigen Kindes zu sein – und stimmte das etwa nicht? Chemie und Multiplikation, Sternbilder und französische Verben. Und natürlich kannte sie das menschliche Skelett, seit meiner Geburt hatte sie alles über sämtliche Knochen gelernt – wo sie sich befanden, was ihre Funktion war, wie sie auf Lateinisch hießen. Welches Geräusch sie machten, wenn sie brachen. Sie konnte Knochen aufsagen wie die Kontinente.
Wir hatten Bücher über die arktische Tundra. Über Muscheln. Über Dinosaurier. Darüber, wie Bienen Honig machen. Über den Krimkrieg. Bis in den Abend redeten wir über die höchsten Berge der Welt und Magellans Route und die Eigenschaften von Quecksilber und über Eulenreviere und die Suffragette Emmeline Pankhurst – »Verstehst du mich, Clara?« –, über die griechischen Göttinnen und Götter und ihre späteren römischen Namen. Manchmal klopfte ich an Patricks Tür, er sah vom Schreibtisch auf und ließ den Füller sinken. »Was hast du heute gelernt?« Und freudestrahlend gab ich Auskunft: Saturn ist der Planet mit den Ringen. König Richard hat die ersten Kreuzzüge angeführt. Und er sagte Du meine Güte!, als hätte er das alles nicht gewusst.
In unserer Bibliothek gab es auch Romane. Die las meine Mutter. Sie verschlang sie förmlich: Milton und Brontë und aus dem Russischen übersetzte Bücher, so dick, dass sie mir leicht einen Knochen hätten brechen können. Ich aber las lieber vom wirklichen Leben. Ich wollte Fakten – niedergeschrieben von Menschen, die tatsächlich geklettert oder geschwommen waren, die tatsächlich getanzt oder sonst wie getan hatten, worüber sie schrieben, Menschen, die sich das alles nicht nur ausgedacht hatten. Zum Geburtstag wünschte ich mir immer wieder Almanache. Ich mochte Kalender, ihrer geordneten Form wegen, wo alles seinen Platz hatte. Und seither frage ich mich, ob ich damit etwas kompensieren wollte. Ob ich, weil ich meinem eigenen Gerüst nicht trauen konnte, nach anderen Dingen suchte, auf die Verlass war: Wörterbücher, Tabellen, Fachliteratur. Botanische Zeichnungen. Vogel-Enzyklopädien. Das in Leder gebundene, duftende Buch zur Anatomie des Menschen gab mir so viel mehr als Knochen: Organe und Gefäße, Muskeln und Wörter wie »Herzkammer«.
Mein Stiefvater war es, der all das beschaffte. Wenn er abends mit Büchern beladen nach Hause kam, trampelte Patrick sich im Flur so nachdrücklich den Regen von den Schuhen, dass ich fürchtete, er könnte dabei zerbrechen. Patrick war so hager. So blass, fast blutleer. Ein scheuer, wortkarger Brillenträger, der nur selten mit den Augen lächelte. Er las auch nur selten Bücher – und er war noch nie irgendwo anders als in London gewesen. Es mutete seltsam an, dass ein Mann wie er für die knackende Tochter seiner Frau eine Bibliothek einrichtete und ein Schaukelpferd kaufte. Vielleicht war es Mitleid. Denn auch Patrick wusste, was es hieß, sich stets drinnen aufzuhalten.
Tagsüber arbeitete er in einer Bank in der Nähe von Charing Cross, die Nächte und Wochenenden verbrachte er in seinem Arbeitszimmer, in dem die Vorhänge stets halb zugezogen waren. Umgeben von Mahagonimöbeln und einer Wagenuhr, die zu jeder vollen Stunde schlug, saß er Pfeife rauchend da und las Zeitung. Ab und zu spielte er mit meiner Mutter Schach – dann war die Tür nur angelehnt, damit ich ihnen zusehen konnte –, eine stille, gemächliche Angelegenheit, während der sie nur wenig sprachen, sie kommentierten höchstens das Spiel oder wechselten Bemerkungen zu meinen Knochen. Doch sie schienen zufrieden zu sein – mit ihrer Ehe, die so viele große Wüstenflecken aufwies. Manchmal spielte Patrick auch eine Partie mit einem Freund – einem zurückhaltenden, nach Pomade duftenden Mann. Bei diesen Spielen konnte ich nicht zusehen, weil sie hinter verschlossener Tür stattfanden – und das Schlüsselloch war zu klein, als dass ich dadurch etwas hätte sehen können. Ich lungerte derweil im Flur herum und beäugte den an der Garderobe hängenden Filzhut.
Meine Mutter – Charlotte – war völlig anders. Sie strahlte, gestikulierte und war abenteuerlustig. Sie war auch viel lieber draußen als drinnen, oft stand sie ohne jeglichen für mich ersichtlichen Grund barfuß im Garten. Sie war nicht groß – aber robust. Charlotte konnte kämpfen, sich wehren; sie ging für die Rechte der Frauen auf die Straße, und wenn sie wiederkam, legte sie sich auf die grüne Chaiselongue, ganz außer Atem vor Zorn oder Stolz oder Erschöpfung. Sie erzählte mir seltsame, exotische Geschichten aus ihrer Kindheit, über die ich oft noch tagelang nachdachte: Sorbets im Hotel Peliti oder nachtblühende Blumen, die bei Sonnenaufgang aufhörten zu duften. Leoparden, die auf Bäumen schliefen und dabei alle vier Tatzen und den Schwanz herunterhängen ließen.
Ein seltsames Paar, sagte Millicent einmal, als sie die Rinde von meinem Brot abschnitt. Wie hätte ich ihr nicht zustimmen sollen? Sie waren so unterschiedlich wie Sonne und Mond. Der eine zog sich in ein verdunkeltes Zimmer zurück. Die andere liebte die frühen Morgenstunden und wirkte wie aus Licht gemacht.
Meine kleine, tapezierte Welt. Ich war fleißig, man kümmerte sich um mich – und an guten Tagen konnte ich zwitschern wie ein Vögelchen. Aber ich hatte auch eine dunkle Seite. Manchmal verkroch ich mich wochenlang hinter meinen Büchern und aß nichts, manchmal schimpfte ich über mein Eingesperrtsein, als sei es die größtmögliche Grausamkeit. Dann versuchte ich, Fenster zu öffnen, oder schleuderte Bücher quer durch das Zimmer – was meine Mutter jeweils mit bösen Blicken quittierte. »Deine Knochen, Clara! Schon vergessen?« Einmal entgegnete ich, meinen Knochen gehe es ganz hervorragend, eine ständige Überwachung meines Lebens sei nicht mehr nötig – und kleidete mich an, als wollte ich hinaus auf die Straße gehen: Ausgerüstet mit Millicents Schal und Hut bat ich meine Mutter, mich vorbeizulassen, aber sie weigerte sich. Sie stand vor der Haustür, den Zeigefinger mahnend erhoben. Mit wütender Miene erinnerte sie mich an ausgekugelte Gelenke.
Renitent nannte Millicent mich. Sie raunte das Wort einem Huhn zu, während sie es rupfte – ich hatte es vorher noch nie gehört. Ich schlug es im Wörterbuch nach: aufmüpfig. Ein Neuzugang auf meiner persönlichen über die Jahre gesammelten Liste von Adjektiven: dickköpfig, verwöhnt, bedauernswert, ungezogen. Traurig. Zu anspruchsvoll. Armes kleines Ding. Auch müde – eine Begleiterscheinung meiner Krankheit war bleierne Müdigkeit, die mir abends wie feuchte Luft in die Knochen kroch. Aber ich war auch des Lebens müde, des Lebens, das ich führte – der langen, immer gleichen Tage, an denen ich den Wind nur als ein Rauschen im Schornstein kannte und das echte Leben nur aus Büchern. Meine Mutter wusste, wann es mir so ging. Sie wusste, wann ich in den Arm genommen werden musste. Und abends, wenn sie mich zudeckte, sprach sie davon, wie alles werden würde, wenn ich erst erwachsen wäre – stark, behände und unversehrt. »Eines Tages wirst auch du reiten.«
Und dennoch brach ich mir die Knochen. Sämtliche Kissen und Vorsichtsmaßnahmen konnten nicht verhindern, dass mir hin und wieder ein Zahn abbrach oder ich mir den Zeh an einem Möbelbein stieß und zertrümmerte. Meine Knie knickten unter mir weg. Ich brach mir die Rippen, wenn ich schlecht träumte oder im Winter mal zu kräftig nieste – und eines Nachmittags, ich war schon kein Kind mehr, stieß ich mit der Hüfte gegen das Treppengeländer. Der Bruch war deutlich zu hören, die Schmerzen so unmittelbar und heftig, dass sich mein Mund mit bitterem Speichel füllte und die Welt um mich herum kurz schwarz wurde. Ich hatte mir den Oberschenkel gebrochen: Drei Monate lang war ich anschließend von Medikamenten benommen auf einem Brett festgebunden, würdelos. Ich nahm ab. Wenn ich konnte, weinte ich – still, zur Wand gewandt. Mein einziger Trost waren die Fürsorge meiner Mutter und ihre Geschichten – Geschichten aus dem Land, in dem sie gelebt hatte, bevor sie mich bekam, einem Land, in dem es zu jeder vollen Stunde regnete. Wo Männer auf den Märkten mit Eis handelten.
Damals hieß sie noch Charlotte Pugh. Sie war die Tochter eines Colonels der britischen Armee und seiner pflichtbewussten Ehefrau, die Kalkutta gehasst hatte. Die Hitze und die Märkte. Den Hafengeruch und die Geckos, die über die Anrichten flitzten und ihre Exkremente auf Tellern hinterließen. Und so verbrachten sie die heißen Monate immer wieder im Norden, in Simla. Im Land des High Tea. Wo Rasentennis und Whist gespielt wurde.
»Hat es dir dort gefallen?«
Ein Schrein für einen Affengott auf dem Jakku Hill. Streunende Hunde, die unter dem Kasuarinenbaum schliefen. »Ja, das hat es.«
»Und warum bist du dann fortgegangen?«
Sie erzählte von einem Vogel, von einem Hirtenmaina, der mit einem Stock geschlagen und dann freigelassen wurde, nachdem er ein sündiges Wort ausgesprochen hatte – und ich ahnte, dass Charlotte weggeschickt worden war. Aber warum? Sie antwortete nicht direkt. Sagte nur, dass sie zu kühn und ihr Gefieder zu schwarz gewesen sei für ihre Eltern, die Wert auf Glauben und Disziplin legten und die ihr nicht verzeihen konnten – aber was machte das schon? »Jetzt bin ich rundherum glücklich.«
Sie lächelte – aber ich war nicht überzeugt. »Was konnten sie dir nicht verzeihen?«
Doch sie antwortete nicht. Meine Mutter deckte mich ordentlich zu, meinte, Millicent rufen gehört zu haben, und verließ das Zimmer. Ich betrachtete ihren Stuhl und spürte die Lüge.
Ich fragte sie wieder. Ich wollte mich nicht abwimmeln lassen. Und so sagte ich eines stickigen Abends im Spätsommer – ich lag auf meinem Holzbrett, meine Mutter saß neben mir, ein Bein untergeschlagen, und las –: »War mein Vater schuld?«
Sie sah von ihren Gedichten auf, Wachsamkeit im Blick.
»Daran, dass sie dich weggeschickt haben. Weil du so ein schwarzes Gefieder hattest. War es seine Schuld?«
Charlotte wirkte wie in die Enge getrieben. Langsam schlug sie das Buch zu und legte es beiseite. Dann betrachtete sie die Wand. Dann antwortete sie auf meine Frage – teilweise zumindest. »Ich war neunzehn, Clara. Ich war noch jung – aber ich hielt mich für viel älter. Und klüger. Aber ich war nicht klüger. Und hinterher stand ich an Deck eines Schiffs namens Persia und sah Kalkutta immer kleiner werden.«
Stundenlang habe sie sich an der Reling festgehalten. Ihr sei übel gewesen, aber nicht nur vom Seegang. Und ich verstand einen Teil ihrer Geschichte – aber nicht alles. »Sie haben dich wegen mir weggeschickt? Weil ich in deinem Bauch war?«
»Wegen dir? Oh, nein, nicht wegen dir. Wie sollte das denn gehen? Du bist doch das Beste, was ich habe, schon vergessen? Nein – ich trug keinen Ehering.«
»Warum?«
»Darum.«
»Wer war er? Mein richtiger Vater?« Eine unschuldige, unbedeutende Frage.
Aber die Frage war nicht unbedeutend. Sie veranlasste meine Mutter, sich zu verschließen – wie ein Luftzug eine Tür schloss. Sie erhob sich, das Buch in der Hand. »Dein Vater«, sagte sie, »ist Patrick. Dein Familienname ist Waterfield. Brauchst du noch etwas Wasser, Clara?«
In jener Nacht verstand ich es. Das war doch ein seltsamer Tausch gewesen: Indische Sommer, der Duft von Jasmin und ihre Familie – gegen was? Gegen London. Gegen ewiges Grau. Gegen ein Leben mit einem Mann, der sie kaum je anrührte, der keine Bücher las und den Monsun nicht kannte. Und warum? Um den Anstand zu wahren, vermutete ich. Eine Frau mit einem Kind konnte nicht allein leben, sie brauchte einen Ehemann. Ein Kind brauchte einen Vater. Und ich dachte, kein Wunder, dass sie auf die Straße geht. Kein Wunder, dass sie mir erklärt, dass die Stärke eines Menschen nicht in seinen Knochen liegt.
Der Morgen graute, und mir wurde bewusst, wie sehr meine Frage sie verletzt hatte. Und dass ich meine Mutter zu sehr liebte, als dass ich sie jemals wieder so etwas fragen würde. Wozu auch? Ich war eine Waterfield. Patrick erzählte Anekdoten aus meinen ersten Lebenswochen – wie es Väter nun mal tun. Nie wieder würde ich Fragen zu dem schwarz gefiederten Vogel oder Eheringen stellen. Ich ließ die Persia weiter gen Süden segeln.
Der Bruch in meinem Oberschenkel heilte nicht. Jedenfalls nicht so, wie er sollte. Mein linkes Bein war hinterher kürzer. Ich hatte Unglück im Glück.
»Vielleicht würde es helfen, wenn du ein bisschen herumläufst«, schlug meine Mutter vor. »Ein bisschen mehr als sonst.« Denn in unseren tapezierten Räumen waren keine längeren Spaziergänge möglich.
Die Ärzte pflichteten ihr bei: Es wurde Zeit. Und so hieß es an einem strahlenden, kalten Donnerstagmorgen Ende Oktober – drei Tage nach meinem achtzehnten Geburtstag – endlich, ich sei stark genug, zusammen mit meiner Mutter das Haus zu verlassen. Ich stand extra früh auf. Meine Mutter steckte mir die Haare hoch und tupfte etwas Rosenwasser auf meine Handgelenke. Sie bewunderte mich im Spiegel im Flur, stand mit den Händen auf meinen Schultern hinter mir, und in dem Augenblick sahen wir uns sehr ähnlich. »Bist du bereit, Clara?«
Ich betrat eine Welt aus Laubgeruch und Pfeifenrauch, aus dem Rufen der Gänse über uns. Aus sich über die Themse reckenden Brücken und Omnibussen und Leierkästen und einer Luft, die sich anfühlte, als würde ich kaltes Wasser trinken, immer wieder – und eine Zeitlang vergaß ich mein Unglück im Glück. Aber dann erinnerte ich mich wieder daran. Ich sah mein Spiegelbild in einem Schaufenster. Ich lief weiter – energisch, damit mein Humpeln nachließ oder ganz verschwand. Aber es blieb. Es ließ mich nicht in Ruhe: ein ausgeprägtes, drehendes Schleifen, das es mir unmöglich machte, mich schnell fortzubewegen. Ich wogte wie Wellen auf See, schraubte mich durch die Gegend wie ein Stößel durch einen Mörser.
Krüppel. Da war es plötzlich, als neuer Teil meines Lebens. Hast du das Mädchen gesehen …? Als meine Mutter das hörte, versuchte sie, mich abzulenken, indem sie auf die kunstvollen Tore zum Richmond Park und ein Werbeplakat für einen Zirkus hinwies. Aber ich hatte es gehört, und ich vergaß es nicht.
Am Abend sagte ich kaum etwas. Meine Knochen schmerzten vom vielen Gehen. Ich war erschöpft und roch nach Kohlenfeuer. Vor allem aber war ich traurig. Die Vorstellung, den Rest meines Lebens zu humpeln, fand ich unerträglich. Von jetzt an würde ich für immer ein Krüppel und nie wie die anderen sein. Und was war mit dem eines Tages, das meine Mutter mir immer zugeflüstert hatte, um mich zu trösten? Was war mit jenem Tag in der Zukunft, an dem ich auf einem echten Pferd reiten würde? Ich würde nie auf einem echten Pferd reiten.
Ich musste mich auf einen Stock stützen. Patrick kaufte ihn mir – und in gewisser Weise war er richtig schön. Walnussholz mit einer silbernen Spitze. Ein runder, silberner Griff, der sich so fest in meine Handfläche drückte, dass ich anfangs Blutergüsse bekam. Beim Gehen machte mein Stock leise, klickende Geräusche.
Ich schwor mir, mich nicht in dämmrige Räume zurückzuziehen. Ich würde mich vor dem Krüppel nicht verstecken und abends nicht heimlich weinen wie ein Kind – weil Entdeckungsreisende und Königinnen das nicht taten. Ich wollte lieber vorwärts gehen. Ich sah mir die Kunst, die Straßen und die Sehenswürdigkeiten an, von denen ich gehört hatte, ich erforschte London Straßenzug um Straßenzug. Meine Mutter begleitete mich. Sie ging zwischen mir und der Bordsteinkante, sie funkelte alle an, die uns zu nah kamen oder sich zu schnell bewegten – und bei feuchter Witterung winkte sie eine Droschke herbei, damit ich nicht irgendwo ausrutschte. Aber vor allem benannte sie alles, was wir passierten, damit ich es kennenlernte, damit ich alles begriff. Die Hansom-Kutsche. Der Humpelrock. Das Alhambra Theater am Leicester Square. Die Veilchenverkäufer und die Baptistenprediger und die kleinen Pasteten, die an den Straßenecken von Jungs verkauft wurden, die halb so alt und groß waren wie ich. Sie brachte mir den Umgang mit Geld bei. Benannte jede Frucht auf dem Markt. Und in der National Gallery zeigte sie mir Kunstwerke, die die knienden Weisen aus dem Morgenland darstellten oder eine ruhende Venus oder wie Samson das Haar abgeschnitten wurde, und auf einmal kamen mir Bücher so unwichtig und klein vor.
Hinterher nahm sie mich mit zum Tee im The Strand. »Wie haben dir die Gemälde gefallen, Clara?« Die Spitze an den Servietten war hauchzart, die Küchlein zierten rosa Zuckerrosen. Und während meine Mutter den Tee einschenkte, wurde mir klar, dass in der Vollkommenheit eine große Schönheit lag. Sie lag in dem komplexen Muster auf den Teelöffeln. Sie hatte in der erröteten, nackten Venus gelegen und in jeder entblößten Schulter, in jedem runden Oberschenkel. Ganz gleich, was Bücher mir bisher beigebracht hatten: Schönheit war dunkelhaarig und dunkelmündig, Schönheit lag in Rundungen, die mir vollkommen abgingen. Und als meine Mutter die Zuckerzange zur Hand nahm, ging mir auf, dass meine Knochen nicht meine einzige Merkwürdigkeit waren. Ich war auch viel zu dünn. Und zu klein – ich war kleiner als Mutter, die ihrerseits bereits nicht als groß galt. Und ich war viel zu blass: milchfarbene Brauen und Wimpern sowie Haare, die meine Mutter einmal mit dem Mond verglichen hatte. Als ich jünger war, hatten mir diese Geschichten gefallen. Aber jetzt fragte ich mich, welcher Teil von mir überhaupt akzeptabel und irgendetwas wert war. Krüppel. Blass. Renitent. Während meine Mutter ihren Tee umrührte, erkannte ich mich selbst.
Abends, im Badezimmer, betrachtete ich die Finger, die ich nicht ganz ausstrecken konnte, das glatte Zahnfleisch an den Stellen, wo mal Backenzähne gesessen hatten. Im Spiegel beäugte ich meine Durchsichtigkeit. Meine kleine, knotige Gestalt. Das Blau der Adern an meinen Handgelenken, das so gar keinem anderen Blau ähnelte.
Ich war in jenen Tagen und Wochen so mit meiner eigenen Erscheinung beschäftigt, dass mir entging, wie sich die meiner Mutter veränderte. Mir entging, dass sie abnahm und immer langsamer lief. Doch die Jahreszeiten änderten sich, und auf einmal ertappte ich meine Mutter dabei, wie sie im Sitzen einschlief. Wenn sie sich von ihrem Stuhl erhob, wirkte sie unsicher, sie stützte sich an der Wand oder an Möbeln ab, das kannten wir von ihr nicht und es passte überhaupt nicht zu ihr.
Da stimmte etwas nicht. Mir war klar, dass eine Frau, die schwimmend indische Flüsse durchquert hatte, nicht so schwach sein sollte, dass sie zum Aufklappen des Klavierdeckels zwei Hände brauchte. Sie sollte sich nicht grundlos krümmen. Anfang September, als die Schwalben sich verabschiedeten, ging ich mit meiner Mutter an die nächstgelegene Stelle am Fluss. Dort vertraute sie sich mir an. Redete vom Uterus. Von Fibromen. »Die Ärzte sagen, ich habe vielleicht noch ein paar Monate.« Sie lächelte, als sei das ein Trost, und ich nickte, als verstünde ich, und richtete den Blick über die Themse zu den Bäumen, die langsam ihr Grün verloren.
Meine Mutter hatte noch ein paar Monate – aber nicht viele. Ihr Haar ergraute, ihre Wangen fielen ein. Die Ärzte schlossen ihre Koffer behutsam, als sei es das letzte Mal. Und ich dachte, aber ich bin es doch, wegen der ihr hier seid. Ich bin die mit den maroden Knochen.
Patrick kauerte auf dem Treppenabsatz. Millicent pflegte und umsorgte die Kranke – wechselte die Bettwäsche, ließ Bäder ein. Und ich verzichtete auf mein Leben draußen an der frischen Luft und setzte mich auf einen Stuhl an Mutters Bett – jetzt war ich an der Reihe, zu trösten oder Wasser zu holen. Wenige Tage vor ihrem Tod bat meine Mutter mich, ihr vorzulesen – aus einem Buch, das sie bereits als Kind geliebt hatte. Geschichten aus Indien, eine blaues, in Leinen gebundenes, abgenutztes Buch mit rotem Lesebändchen und Stockflecken. Auf der ersten Seite entdeckte ich ihren Namen – Miss Charlotte Pugh – in ihrer jugendlichen Handschrift. Und auf den weiteren Seiten entdeckte ich Geschichten von einem Prinzen mit jasminduftendem Lachen und von sprechenden Tigern. Kinder werden erwachsen, und Erwachsene, so wurde mir klar, werden am Ende wieder zu Kindern.
Sie verblasste wie Tuch. Sie schwand, als löste sie sich in Wasser auf.
Einmal drehte sie sich um und lächelte, sodass ich dachte, sie sei mit mir in den Straßen Londons. Doch dann sagte sie: »Die Mango, Clara. Sie hängt zu hoch im Baum.« Und ich wusste, meine Mutter war nicht bei mir, sie war in einem Land, in dem Weiß die Farbe der Trauer war, wo Affen sich zu Meisterdieben entwickelt hatten. Und ich dachte, wie soll ich durch mein Leben finden, wenn sie weg ist? Sie war mein Herzschlag gewesen. Sie war alles gewesen.
»Ich bin während des Monsuns geboren«, sagte sie. »Hatte ich dir das schon erzählt?«
»Erzähl es mir noch einmal.«
Doch sie schloss die Augen.
In den ersten Stunden des Jahres 1914 zuckte meine Mutter und wurde dann ganz weich. Ich dachte, sie würde träumen, und streichelte beruhigend ihre Hand. Doch sie war gestorben.
Etwas später ging ich zu Patrick hinaus in den Garten. Es war kurz vor Sonnenaufgang, die Luft klar, der Himmel über uns leicht rosa. Den Blick nach oben gerichtet, standen wir eine ganze Weile neben dem Birnbaum und schwiegen.
»Du darfst nicht glauben, dass ich sie nicht geliebt habe«, sagte er.
Und damit ging er zurück ins Haus. Millicent betete. Ich stand da mit meinem Stock, beobachtete, wie das Licht sich veränderte, wie Dächer und Äste immer klarer hervortraten – und dachte über ihren Tod nach. Sie war eine Weile hier gewesen. Sie war warm gewesen, hatte geduftet. Sie hatte Klavier gespielt, für das Frauenwahlrecht demonstriert und so laut pfeifen können, dass Pferde die Köpfe nach ihr drehten. Wo war sie jetzt?
Ich hörte, wie die Stadt erwachte. Vögel begannen zu singen. Ich wusste, was die Wörterbücher und Grafiken mir liefern würden. Tatsachen: dass ihr Herz aufgehört hatte zu schlagen. Dass ihre Lungen nicht mehr atmeten. Sie war tot – und ich würde sie nie wiedersehen.
Die folgenden Tage verbrachte ich damit, sämtliche Bücher aus der Bibliothek zu entfernen. Ich nahm die Bände aus den Regalen, packte sie in Kisten und strich einmal mit der Hand durch jedes Fach, um sicherzugehen, dass kein einziges Exemplar übriggeblieben war. Einmal kam Millicent hinzu. Entsetzt blieb sie in der Tür stehen. »Was machst du da?«
»Wir brauchen jetzt keine Bücher mehr.« Ich hatte sie alle gelesen, wozu sollten wir sie aufbewahren? Wozu überhaupt eine Bibliothek? »Außer mir liest hier ja niemand.« Ich schob die Notenblätter meiner Mutter zusammen. Nahm Karten von den Wänden.
Millicent hielt sich an dem Nachmittag von mir fern. Sie hatte mich und meine Launen nun schon fast zwei Jahrzehnte lang ertragen, aber das hier war in ihren Augen Neuland. Sie wusste, dass ich trauerte, und wollte mir nicht zu nah kommen. Als sie Patricks Schlüssel in der Tür hörte, stürzte sie sofort zu ihm. »Clara ist …« Außer sich. Ja, verrückt. Patrick betrat die Bibliothek, als befände sich ein wildes Tier darin – den Hut vor der Brust, betrachtete er unverwandt die leeren Regale. »Was ist los, Clara? Was machst du? Hör auf damit. Hörst du?« Aber derlei Anweisungen passten nicht zu Patrick, er war zu schmal und unsicher. Es fehlte ihm an Autorität – und darum packte ich weiter Bücher in Kisten. Ich hängte ein Tuch über den Globus. Ich bin mir sicher, dass Patrick mich am liebsten aufgehalten hätte, schließlich waren es seine Bücher. Aber er konnte mich nicht bei den Handgelenken packen, und auch nicht bei den Oberarmen. Er konnte nur Anweisungen geben, die ich nicht befolgte – bis er wieder hinausging und die Tür hinter sich schloss.
Hin und wieder betrachtete ich die Klaviertasten. Entdeckte Mutters Abdruck auf Stuhlkissen. Aber die meiste Zeit war ich unterwegs. Ich war unterwegs, weil es nichts anderes zu tun gab, weil ich wegwollte von den Kissen und Wasserhähnen und Löffeln, die mich alle an sie erinnerten. Weg von den Treppen, die ich sie herunterstürmen hörte. Und weg von der Trauer der anderen, denn die konnte ich nicht ertragen. Wenn ich nicht weinte, wieso sollten sie es tun? War mein Verlust nicht viel größer als der ihre? Patrick sah oft zum Fenster hinaus. Millicent wanderte betend durch das Haus oder weinte in ihre bemehlten Hände.
Also war ich unterwegs – in Parks, über Brücken. Zu Fuß. Ich sah die Treppe hinunter, die in die warme, erleuchtete Höhle der Untergrundbahn führte. Ich stand in den polierten Sälen der Warenhäuser und Galerien. Ich humpelte Gassen hinunter, so schmal, dass meine Hände auf beiden Seiten die Hausmauern berührten, und die in kleine Plätze mündeten. Ich kam an Kirchen und Brunnen vorbei, an Monumenten und Kundgebungen und Festnahmen und Marktständen – und eines Nachmittags entdeckte ich eine dunkle, verkommene Treppe, die zur Themse hinunterführte. Ich stand am Ufer, bei Ebbe. Der Boden war glitschig von Seegras und Modder. Unter den Brücken saßen Männer an Lagerfeuern. Ich stand dort am Fluss und vermisste meine Mutter so sehr. Am meisten fehlten mir ihr Gesang, ihr Klavierspiel und ihre Erklärungen, und mit schmutzigem Rocksaum kehrte ich in der Dämmerung zurück nach Hause. Erschöpft und zitternd vor Kälte.
Millicent warf die Hände in die Luft. »Wie siehst du denn aus!«
Patrick erschien wie ein Gespenst aus seinem Zimmer und fragte: »Wo warst du denn? Wo treibst du dich den ganzen Tag herum? Was denkst du dir bloß dabei, Clara?«
Im Hyde Park, antwortete ich. Piccadilly. Am Themseufer.
»Am Themseufer? Und wenn du gestürzt wärest? Und die Leute da?«
»Was für Leute?«
An jenem Abend redeten wir bis Mitternacht. Patrick erklärte, dass ich nur sehr wenig über die Welt da draußen wüsste. Dass ich natürlich durchaus in der Lage sei, sämtliche Herrscher des Hauses Plantagenet aufzulisten und die Brechung des Lichts zu erklären – aber wie es um andere Dinge stünde? Wie zum Beispiel darum, heil über die Oxford Street zu kommen? »Weißt du überhaupt, wie man einen Omnibus benutzt?«, fragte er. »Beherrschst du die Kunst der gepflegten Konversation? Die Welt da draußen ist gefährlich, Clara.«
Die Kunst der gepflegten Konversation? Ich konnte es kaum glauben – wie vielen Menschen begegnete Patrick denn, mit denen er sich gepflegt unterhielt? Wohl nur seinem Freund mit dem Filzhut, der ähnlich einsilbig war. »Und du bist also ein Meister dieser Kunst?«, hielt ich dagegen. Die Schnelligkeit und Schärfe dieser Worte überraschte mich selbst – aber ich war wütend, fühlte mich allein und trauerte. Ich vermisste meine Mutter so sehr, dass mir die Worte fehlten. Und ich war unbeschreiblich müde – darum wünschte ich ihm eine gute Nacht, erklomm steif die Treppe und bat um eine Schüssel warmes Wasser für ein Fußbad. Hinter mir hörte ich ihn brummen. Undankbar.
Aber ich wusste, dass Patrick recht hatte. Ich konnte in einer Galerie vor einem Porträt stehen und aus dem Stand sagen, wer darauf dargestellt war – aber ich hatte keine echten Freunde. Konversation war nicht meine Stärke. Und ich war noch nie mit dem Omnibus gefahren. Also ging ich an einem schneestürmischen Tag zur Regent Street und beobachtete andere Menschen beim Ein- und Aussteigen. Beobachtete, bei wem sie bezahlten und wie – und lauschte, was sie dabei sagten. Dann umklammerte ich meinen Stock und stieg selbst ein – und sah zum ersten Mal einen Omnibus von innen. Ich sah die schönen Messingknöpfe an der Uniform der Konduktoren, spürte die Nähe anderer Menschen, ihren Atem, ihre Wärme, die unterschiedlichen Gerüche. Mit dem Ärmel wischte ich das beschlagene Fenster frei. Das Geruckel machte mich schläfrig.
Ich fuhr täglich mit dem Bus. Patrick gab mir das Geld dafür; ich erklärte, es handele sich um eine neue, gute Art von Schule für mich, da konnte er nicht widersprechen. Ich fand heraus, welche Plätze ich am liebsten mochte, wie man an der Schnur zog, wenn man an der nächsten Haltestelle aussteigen wollte. Auf diese Art und Weise lernte ich die Bezirke Clerkenwell und Lambeth genauso kennen wie die Sternwarte in Greenwich. Und eines Morgens im Februar stieg ich in Kew aus. Den Namen kannte ich. Hier gab es den berühmten botanischen Garten mit Rhododendren, Gewächshäusern und Pagoden. Ich hatte in Büchern davon gelesen.
Am zwölften Februar durchschritt ich die Tore von Kew Gardens. Meine Mutter war seit zweiundvierzig Tagen tot, seit neununddreißig Tagen lag sie auf dem Friedhof von Richmond – und Kew wirkte grau und desolat. Die Rasenflächen waren von überwinternden Gänsen abgefressen, das Wasser im See gefroren, und ich wunderte mich: Warum sind diese Gärten so berühmt? Warum wird so viel über sie geschrieben? Worin unterscheiden sie sich von anderen Parks?
Ich beschloss, nach Hause zu fahren. Doch als ich mich umdrehte, sah ich es: Eine ganz und gar außergewöhnliche Glaskuppel. Wie ein Tempel. Oder ein Palast. Ich betrat sie – und ließ den Februar hinter mir. Auch England war verschwunden. Denn im Tropenhaus von Kew gab es Baldachine und Farne und feuchte Holzbänke, Palmwedel strichen mir im Vorbeigehen übers Haar. Weinreben rankten an Metallgittern empor, auf den Balken sammelte sich Kondenswasser in kleinen Pfützen und tropfte von dort auf meine Schultern und Hände. Ein dicker Tropfen hing so perfekt an einer Blattspitze, dass ich stehen blieb und wartete, bis er sich löste. Auf kleinen, handgeschriebenen Schildern standen Wörter wie Indochina und Frangipani.
Ab sofort kannte ich nur noch ein Ziel. Ich war fertig mit Menschenmassen und Londons Straßen. Das hier war ein neuer Anfang: die gefiederten Blätter der Betelnuss. Der Sauersack- und der Kalebassenbaum. Ich studierte jeden einzelnen ihrer Namen. Ich fragte mich, wie diese Pflanzen wohl in ihrer Heimat ausgesehen hätten – ob bunt schillernde Vögel auf ihren Zweigen säßen, ob sie ihnen Schutz geboten hätten bei den ohne Vorwarnung einsetzenden Regenfällen. Ich begann, aufzuschreiben, was mir an jeder Pflanze gefiel: ihre kleinen, zarten Blüten etwa oder dass in ihrer Heimat Fledermäuse an ihnen saugen würden. Ihre lateinischen Namen: Crescentia cujete. Ficus benghalensis.
Manchmal döste ich dort ein. Die Hitze und meine eigene nie nachlassende Müdigkeit zwangen mich immer wieder auf eine der Holzbänke – und genau dort saß ich eines Nachmittags im März und war eingenickt, als ich ihm zum ersten Mal begegnete. Er trat auf mich zu. »Verzeihen Sie?«
Schnell und ungelenk erhob ich mich. Ich fuchtelte mit meinem Stock herum, um mich zu schützen, und der Mann trat einen Schritt zurück, die Hände erhoben, wie um zu sagen, er wolle mir nichts tun. Er trug eine Schiebermütze, ganz weich von der Wärme, hatte graues Haar und war unrasiert. »Verzeihen Sie. Ich wollte Sie nicht erschrecken … Sie sind öfter hier, nicht wahr?« Er hatte mich schon einige Male gesehen. Und wollte einfach nur fragen, ob ich Hilfe brauchte, weil ich doch so angestrengt und gebeugt ging. Später gestand er mir, er hätte mich zunächst für ein Kind gehalten.
Forbes. Der Obergärtner des Tropenhauses und des Hauses der gemäßigten Klimazonen, dessen Stiefel knarzten, als ich ihm folgte. »Diese Pflanzen«, erzählte er, »sind wie meine Kinder.« Er pries die Gewächse zu seiner Linken und Rechten. Er erzählte mir ihre Geschichte, ihren Nutzen, listete ihre Merkmale auf. »Dieser Palmfarn ist männlich … Sehen Sie?« Und als ich fast etwas unsanft, ja geradezu ungestüm verlangte, mehr zu hören, schien er nichts dagegen zu haben. Im Gegenteil, er wirkte erfreut, so frei reden zu können: Die Bengalische Feige konnte ganze Dynastien überleben, die Engelstrompete Halluzinationen verursachen. Er sagte, manche Samen schwämmen wie rundgeschliffene Boote über die Ozeane, um eine neue Heimat zu finden. »Über ganze Ozeane. Um neue Kontinente zu finden. Manche dieser Samen haben viele Jahre bei jedem Wetter im Wasser verbracht und dennoch überlebt. Ist das nicht erstaunlich?« Er nannte sie Treibsamen.
Er drückte die Blätter der Aloe zusammen, um mir zu zeigen, wie weich sie waren. Er zog eine Ranke des Jasmins zu sich heran, umschloss sie mit beiden Händen und ließ mich daran schnuppern. »Riechen Sie mal, Miss Waterfield. Dieser Duft …«
»Wo wächst diese Pflanze?«
»In China. In Indien. In ganz Asien.«
Ich hatte in Kew keine Gesellschaft gesucht. Und doch witterte ich nun eine Gelegenheit – zum einen, um gepflegte Konversation zu üben, wie Patrick es gewünscht hatte. (Forbes redete gern, reden war ihm lieber als schweigen, wenn ihm nichts einfiel, summte er.) Aber zum anderen wollte ich lernen, was nicht in den Büchern stand, von einem Mann, dessen Wissen der Botanik gut und gerne zwanzig Bände hätte füllen können. Darum begann ich nach ihm Ausschau zu halten – nach seiner Trittleiter, einer Bewegung im hohen Laub. Ich lauschte auf alles, was nicht das Geräusch von Wasser oder Luft war. Und wenn ich ihn gefunden hatte, war es sein Wissen, das ich in mich aufsog – alles über diese Pflanzen, ihre Lebensräume und ihre Anwendungsmöglichkeiten. Forbes fragte mich nie, wieso ich das alles wissen wollte. Er räusperte sich einfach nur und zeigte mir, wie man Farne beschnitt, erklärte, warum die Zitrusgewächse Magnesium brauchten und wieso Pelargonien so anfällig für Mehltau waren. Er erzählte, dass er im Haus der gemäßigten Klimazonen zweimal im Jahr ein großes Feuer aus Tabakpflanzen entzündete, um Milben, Fliegen und alle möglichen anderen Schädlinge auszuräuchern. »Und es funktioniert«, sagte Forbes. »Allerdings müssen wir alle danach ein bis zwei Tage lang husten.« Er lieh mir auch Bücher. Im Bus transportierte ich sie nach Hause – uralte Bände mit dicken, schiefen Seiten, in denen die Natur und die Bedürfnisse der Pflanzen geschildert wurden, als ginge es um Helden. Die in den Wüsten Deutsch-Südwestafrikas vorkommende Welwitschie, die aus lediglich zwei Blättern und einer Wurzel bestand und fünf Jahre lang ohne Wasser auskommen konnte. Der Süßklee, der machte, was er wollte. Der Affenbrotbaum, der so spärliches und seltsames Laub hervorbrachte, dass es hieß, er sei von einem rachsüchtigen Gott auf den Kopf gestellt worden.
»Du warst die ganz Nacht wach?« Patrick hatte das Licht in meinem Zimmer gesehen.
»Ja. Ich habe gelesen.«
»Bücher? Welche denn?« Er war verwirrt – schließlich gab es bei uns so gut wie keine mehr.
Linnaeus. Weiße Fliege. Konversation als eine Form des Austauschs. Doch auch über ihn lernte ich etwas: Edward Forbes. Dessen feiste, geschwärzte Hände erstaunlich geschickt Knoten in Schnüre binden oder welke Blüten auspflücken konnten. Der, wenn er sich konzentrierte, die Zunge in die Backe schob. Forbes hatte auch seine ganz eigene Ausdruckweise. Statt ja sagte er recht haben Sie – und mir ging auf, dass er einen anderen Akzent sprach als ich. Neben der Bengalischen Feige fragte ich ihn: »Woher kommen Sie?«
Schottland. Das hatte ich auf Landkarten gesehen. Ich hatte – vor langer Zeit – von Aufständen dort gelesen. Von Presbyterianern und Schnee. Aber bisher hatte ich noch nie den Klang einer schottischen Stimme gehört, und ich war hingerissen von ihrer Melodie. »Ich komme aus Auld Reekie«, sagte er und wischte sich die Erde von den Händen. Als er erklärte, dass das der Spitzname Edinburghs sei, ging mir einmal mehr auf, wie wenig ich wusste.
Meine Gegenleistung fiel mager aus. Ich hatte keine Geschichten zu erzählen. Und Forbes, der das ahnte, fragte auch gar nicht. Allein eines Nachmittags, er stand gerade auf seiner Leiter und stutzte den Bleiwurz, fragte er: »Miss Waterfield? Darf ich Sie fragen, ob sie eine Mutter haben, die sich um Sie kümmert? Blond und zierlich? Und auch sehr klein?« Er habe sie gesehen, sagte er. Sie sei hin und wieder da gewesen und habe das Ohr gegen den Stamm des Mangobaums gedrückt.
Ich nickte. »Das war sie.«
War. Er verstand. Vielleicht hatte er es bereits gewusst – dass ich einen Verlust erlitten hatte. Vielleicht hatte er den in mir verborgenen Zorn bemerkt. Forbes rückte seine Mütze zurecht. »Das wird bleiben«, sagte er. »Sie werden es überleben – ganz bestimmt. Aber das Leben wird nie mehr so sein wie vorher.«
Ein andermal fragte er: »Erzählen Sie mal. Was haben Sie vor?«
Wir standen nebeneinander vor dem Haus der gemäßigten Klimazonen. Es war Ende April, die Tulpen glänzten, wir bewunderten sie. Was meinte er? In der nächsten halben Stunde? Oder in den kommenden Wochen? Doch dann verstand ich: Er meinte die vor mir liegenden Jahre. Mir wurde flau. Diese Frage hatte ich mir noch nie gestellt – und als ich so das Tulpenbeet betrachtete, sah ich plötzlich meine gesamte Zukunft fertig ausbuchstabiert vor mir: Patrick würde einen Mann für mich finden. Einen wohlhabenden, angesehenen Ehemann. Er würde ihm eine Mitgift anbieten, die für meine Knochen, meine Eigensinnigkeit und die vermutlich ausbleibenden Kinder entschädigen sollte. Eine Ehefrau. Mit einem neuen Namen. Die gehorsam und dankbar zu sein hatte. Zurück zu einem Leben in tapezierten Räumen, in denen Reisen nur durch Bücher möglich war.
Ich ließ meinen Stock fallen.
Forbes hob ihn wieder auf. »Miss Waterfield?« Er geleitete mich zu einer Bank mit Blick auf eine Magnolie, und auf einmal brachen die Worte aus mir hervor, auf einmal wollte ich mich ihm mitteilen, ihm erzählen von gebrochenen Knochen und ausgekugelten Gelenken. Von Opiumträumen und gelblichen Blutergüssen. Davon, dass Osteogenesis imperfecta immer so merkwürdig auszusprechen gewesen war, dass es in meinen Ohren jetzt aber irgendwie botanisch klang: eine dunkel blühende Ranke, nicht besonders schön, die mich nie wieder loslassen würde. Ich erzählte ihm von unserem Globus. Von Tapeten. Davon, wie ich immer gehofft hatte, eines Tages auf einem richtigen Pferd zu reiten und zu tanzen oder von irgendetwas herunterzuspringen. Ich erzählte, dass Millicent für mich betete, dass sie noch viel inbrünstiger für meine Mutter gebetet hatte, die in den ersten Stunden des Jahres 1914 gestorben war – also was brachte Beten schon? Gar nichts. Ich war immer noch krumm und schief, sie war immer noch tot. Und ich erzählte ihm vom schwarzen Ufer. Vom Omnibus und den Galerien und den schwarzhaarigen Schönheiten mit ihren klugen, glänzenden Augen. Davon, dass meine Mutter weiter Pugh hätte heißen sollen, wie sie es sich gewünscht hatte, dass sie aber auf ein Schiff gezwungen wurde und einen Mann heiraten musste, dem sie vorher noch nie begegnet war – und ich sagte, dass ich das ungerecht fand. Eine Farce. Eine Verschwendung von Leben. »Warum können wir nicht einfach so leben, wie wir gerne möchten? Warum gibt es diese Regeln? Vor allem für Frauen?«
Forbes schwieg. So etwas wollte erst einmal verdaut werden, das wusste ich. Er schob die Zunge in die Wange, sah in die Ferne – und eine Weile saßen wir schweigend da. »Clara? Darf ich Clara sagen? Ich möchte Ihnen gerne etwas zeigen.«
Er stand auf, und ich folgte ihm.
Es war ein Brief. Ein gefalteter Bogen schneeweißen Papiers. Die Handschrift darauf so schräg und ausladend, dass ich mir vorstellte, der Schreiber hätte einmal über die Worte gepustet. Der Briefkopf in goldenen Lettern.
»Was ist das?«
»Eine Nachricht von einem Gentleman. Er möchte Pflanzen von uns kaufen. Um sein Gewächshaus in Gloucestershire mit Zitrusgewächsen und Sukkulenten zu füllen. Solche Briefe bekommen wir immer mal wieder.«
Ein Herr namens Mr Fox. Und in der Tat, in seinem Schreiben bat er um viele ausgesuchte Pflanzen – für ein kleines, privates Paradies in meinem Gewächshaus. Aber er bat auch um Personal. Darum, dass ein Mitarbeiter von Kew Gardens die Pflanzen begleitete, sie aus ihren Kisten nahm und ein Farben- und Duftspektakel unter Glas schuf. Ich möchte, dass man in anderen Landhäusern darüber redet. Ich sah Forbes an und schüttelte den Kopf.
»Dazu weiß ich nicht genug«, sagte ich.
»Doch. Es geht ja nicht um Vermehrung. Es geht um nichts, wobei Sie nicht bereits zugesehen oder worüber Sie noch nicht gelesen hätten. Es geht um ganz einfache Aufgaben, denen Sie durchaus gewachsen wären.«
»Wieso schicken Sie nicht jemand anderes? Was ist mit Ihnen?«
»Mit mir? Ich habe Mrs Forbes – und ich möchte sie nicht einen ganzen Monat allein lassen, wie Mr Fox es fordert. Aber Sie? Sie wünschen sich doch ein Leben in Unabhängigkeit? Dafür brauchen Sie Geld, Clara. Sehen Sie.« Er zeigte auf den Brief. Der Betrag stand da, war unterstrichen. »Für einen Monat. Das ist alles.«
Sein wettergegerbtes Gesicht. Ich spiegelte mich in seinen Augen. Ich wusste, dass seine Hände ruhelos waren und sich immer wieder öffnen und schlossen wie dem Wetter ausgesetzte Blüten. Und ich sagte: »Wer ist Ihnen gestorben, Mr Forbes?«, denn auf einmal wusste ich, dass jemand tot sein musste.
»Unser Kind. Es war neunzehn Monate alt. Das ist schon viele Jahre her. Wir haben sie im Winter begraben – und mit ihr einen Teil unserer selbst.«
Er betrachtete die Bodenfliesen. Ich begriff, dass auch Forbes versucht hatte, seinen Verlust mit Bleiwurz und Zitrus erträglicher zu machen; er hatte sich abgelenkt, indem er sich aufopferungsvoll um diese Pflanzen kümmerte. Wie alt seine Tochter jetzt wohl wäre? Ich fragte nicht. Aber ich überlegte, ob sie jetzt wohl zwanzig wäre. Und ob sie hellblond gewesen war.
»Clara. Als ich Sie auf der Bank sitzen sah, da dachte ich, Sie seien ein Kind – aber dann standen Sie auf, als wollten Sie mit mir kämpfen. Sie sind stark. Stärker als die meisten Männer, die ich kenne.«
Er drückte mir den Brief in die Hand und schloss meine Finger darum.
»Das Haus heißt Shadowbrook«, sagte er.
Wirkte der Name weniger düster, weil er in Gold geschrieben stand? Oder weil ich ihn im Licht der Nachmittagssonne sah?
Patrick blinzelte mich an, als hätte ich in einer neuen, fremden Sprache mit ihm gesprochen. »Gloucestershire?«
Man würde mich vom Bahnhof abholen, erzählte ich ihm. Im Haus gab es Dienstmädchen, eine Haushälterin und ein eigenes Zimmer für mich. Ich würde ein paar Tage vor den Pflanzen dort ankommen, um mich von der Reise zu erholen und mich ein wenig einzuleben. »Ich will dorthin«, sagte ich.
Patrick schob den Unterkiefer zur Seite. Würde er versuchen, es mir zu verbieten? Oder würde er es gerade nicht tun? Das hier war doch eine perfekte Gelegenheit für mich, die Welt kennenzulernen, genau, wie er es wollte. Versuchte er, sich vorzustellen, wie es wäre, einen Monat ohne meine unterdrückte Trauer oder Empörung zu sein, ohne meine dreckigen Stiefel im Flur? Schließlich seufzte er ausgiebig. Er nahm die Brille ab, schloss die Augen und massierte sich die Nasenwurzel. »Ja, Clara – wenn es denn sein muss. Ich weiß ja, dass du hier nicht glücklich bist.«
Ich glaube, ich hatte erwartet, innerlich zu triumphieren. Stattdessen erfasste mich Kummer. Schwoll in mir an, bis ich fast darin ertrank. Und als Patrick sich die Brille wieder aufsetzte, die Bügel sorgfältig um die Ohren legte, musste ich an jenes Weihnachten denken, an dem er das Schaukelpferd enthüllt hatte – indem er ein scharlachrotes Brokattuch beiseitezog. Ich sah ihn mit Büchern beladen nach Hause kommen. Ich hatte nie daran gedacht, ihn zu fragen, warum er Charlotte Pugh geheiratet hatte, es war mir einfach nicht eingefallen. Ich wusste keine Antwort. Was hatte er davon gehabt? Er war in seiner Freiheit eingeschränkt worden, lebte mit einer sehr willensstarken Frau zusammen – und musste sich zwanzig Jahre lang um ein Kind kümmern und sorgen, es versorgen, das gar nicht wirklich seins war. Noch dazu ein krummes, schiefes Kind.
Später bot Patrick mir an, mich auf der Zugreise zu begleiten. Er klopfte an meine Zimmertür. »Ich könnte doch so etwas wie deine Anstandsdame sein«, schlug er vor. Er könnte mir dabei helfen, das richtige Gleis zu finden, und meinen Koffer für mich tragen. Inzwischen war ich milder gestimmt, ich sah Patrick an, wie müde er war. Ich ahnte, dass ich tief in seiner Schuld stand – zu tief. Und vielleicht hätte ich genau deswegen ja sagen sollen, ja, bitte, begleite mich bis zum Bahnhof von Cheltenham Spa. Aber meine schwangere Mutter hatte es ganz alleine von Kalkutta nach London geschafft und überlebt. Den Kriegern und Abenteurern in den Büchern waren nicht von ihren Stiefvätern Türen geöffnet worden. Und ich verspürte das dringende Bedürfnis, allein zu reisen, mein Leben in Unabhängigkeit zu beginnen mit niemandem an meiner Seite, der mir helfen oder auf den ich mich verlassen konnte – denn wie sonst sollte ich je lernen, mich auf mich selbst zu verlassen? Ohne Hilfe zu leben? Ich schüttelte den Kopf und lehnte dankend ab.
20. Juni 1914. Einen Tag vor Mittsommer. Ich wusch mir die Haare und steckte sie hoch. Ich packte Kleider ein, meine Haarbürste – und legte drei Bücher in meinen Koffer: ein Pflanzenlexikon und ein Buch über die menschliche Anatomie – meine beiden verlässlichsten Fachbücher. Außerdem die Geschichten aus Indien.
Patrick lud meinen Koffer in die Droschke. Er schloss den Verschlag und sah durchs Wagenfenster herein. »Versprichst du mir, dass du nie ohne deinen Stock gehen wirst, Clara?«
Ich versprach es ihm. Dann trat er zurück. Klopfte zweimal gegen den Verschlag, der Kutscher trieb die Pferde an. Patrick blieb stehen und verschwand aus meinem Blickfeld.
Auch Forbes sorgte sich um mich. Am Bahnhof Paddington drehte er immer wieder seine Mütze in der Hand und listete auf, wie oft und wo der Zug halten würde. Er schärfte mir ein, nicht aufzustehen, bevor der Zug vollkommen zum Stillstand gekommen war. Und auf den Abstand zwischen Bahnsteig und Zugtür zu achten. »Cheltenham Spa«, rief er mir in Erinnerung. »Sein Name ist Fox.«
Ich öffnete das Zugfenster und sah zurück. Je kleiner Forbes am Bahnsteig wurde, desto klarer wurde mir, dass es für diesen Augenblick keine lateinischen Bezeichnungen und keine Maßangaben gab. Und auch nicht für den Geruch im Zugabteil oder dafür, wie die Sonne eine perfekte geometrische Form auf den Fußboden zeichnete. Dafür, wie Nervosität und Aufregung auf ganz ähnliche Weise für einen schnelleren Herzschlag sorgen. Paddington wurde immer kleiner, bis es ganz verschwunden war.
Der Zug bewegte sich immer weiter aufs Land, und plötzlich wollte ich mein Haar nicht mehr hochgesteckt tragen. Ich wollte es befreien. Mir schien das sehr passend – es war ungewohnt, neu. Und so entfernte ich eine Nadel nach der anderen.
Den ganzen Sommer über sollte ich meine Haare offen tragen. Es sollte nicht lange dauern, bis ich für meinen Stock bekannt sein sollte, für meine unverblümte Art, mich zu äußern – und für das schwere, milchweiße Haar, das mir über den Rücken fiel und sich in tiefhängenden Ästen verfing. Die Sonne sollte es noch weiter bleichen – sodass man mir im August sagen sollte, dass ich in der Dämmerung leuchtete und zu den Motten im weißen Garten gehörte. Er sollte sagen, mein Haar sei wie Phosphor.
All das wusste ich natürlich noch nicht. So wenig, wie ich wusste, wie es in Gloucestershire aussah oder klang. Aber ich hatte am dunklen Themseufer keine Angst gehabt und ich hatte auch jetzt, in diesem Zug, keine Angst. Denn was konnte schlimmer sein als der Verlust meiner Mutter? Diese Tatsache war so unumstößlich wie die Darwinfinken und die Mondphasen: Meine Mutter war weg. Und die zweiundvierzig Knochenbrüche in meinem Leben waren bedeutungslos, genau wie das bläuliche Weiß meiner Augen oder die Adjektivliste, die ich angelegt hatte, oder meine Größe. Von Bedeutung war nur, dass ich nichts mehr zu verlieren hatte. Und so richtete ich den Blick nach vorn, als der Zug unter Brücken hindurchraste und am Ende dunkler Tunnels wieder hinausfuhr ins Licht.
II
Der Zug erreichte Cheltenham Spa am frühen Abend. Ich tat, was Forbes mir gesagt hatte: Ich bat um Hilfe mit meinem Koffer, dankte dem Gentleman und trat auf dem Bahnsteig weit genug zurück von den Türen, bevor sie wieder zugeschlagen wurden. Der Zug stieß bei seiner Weiterfahrt so viel warmen, sandigen Dampf aus, dass ich zunächst nichts sehen konnte. Doch als der Nebel sich lichtete, erkannte ich eine Gestalt am anderen Ende des Bahnsteigs, mit Zigarette lässig an eine Mauer gelehnt.
Ich beschloss, zu bleiben, wo ich war: Ich konnte meinen Koffer nicht selber tragen, er musste mir helfen. Als der Mann das begriff, schnippte er die Zigarette weg, löste sich von der Mauer und schlenderte auf mich zu.
»Miss Waterfield?«
Schnurrbart. Tabakgeruch. »Ja. Guten Tag.«
»Es ist Abend. Ihr Zug hatte Verspätung. Ich warte schon seit über einer Stunde.«
Das war nicht der Empfang, den ich erwartet hatte. Ich versteifte mich – und war kurz versucht, ihm spitz zu antworten, schließlich konnte ich nichts dafür, dass der Zug verspätet war. Aber dann dachte ich, dass mir das nicht weiterhelfen würde. »Ich brauche Hilfe mit meinem Koffer, bitte.«
»Von mir?«
»Ja. Oder von jemand anderem. Ich kann ihn nicht tragen.«
Der Mann seufzte tief, ließ den Blick über den Bahnsteig wandern. Ich befürchtete bereits, er würde sich weigern oder wieder gehen, aber dann bückte er sich, hob den Koffer an einem der Griffe hoch und schleppte ihn mit einer Geschwindigkeit davon, bei der ich nicht mithalten konnte. Als ich sein Automobil erreichte – weinrot –, saß er bereits auf dem Fahrersitz und wartete auf mich, mit den Fingern auf das Lenkrad trommelnd.
»Bereit?«
Ich nickte. Stieg unbeholfen in den Wagen, stieß mir das Handgelenk, zuckte zusammen, hielt es mir. Er bemerkte das, sagte aber nichts. Er räusperte sich nur und wies mich an, die Tür zu schließen. Wir fuhren los, und ich dachte, ich bin schon an einem seltsamen Ufer gestrandet – voller Tabakflecken, Ungeduld und, wie es schien, noch schlechteren Manieren als meinen eigenen. Und zum ersten Mal in meinem Leben saß ich in einem Automobil.
»Sind Sie Mr Fox?«
»Nein.«
»Arbeiten Sie für ihn?«
Er hatte ein markantes Kinn. »Ja, hin und wieder.«
»Als Butler?«
Er schnaubte spöttisch. »Sehe ich aus wie ein Butler? Wenn er gefahren werden muss, fahre ich ihn. Wenn etwas für ihn geholt werden muss, tue ich ihm vielleicht den Gefallen.«
»Das klingt wie ein Butler.«
»Nein«, sagte er. »Kein Butler. Aber Sie klingen, als hätten Sie selbst Personal.«
Ich betrachtete ihn im Profil. Er war nicht gut auf mich zu sprechen. Gut, er hatte eine Stunde auf den Zug warten müssen, aber seine Abneigung schien mir profunder zu sein. Vielleicht war ich unhöflich gewesen. Oder vielleicht missfielen ihm meine Erscheinung oder mein Geschlecht oder meine schiefen Knochen oder mein offenes Haar. Der Umstand, dass ich ohne Anstandsdame reiste.
Die Hecken flogen vorbei. Stellenweise war das Gras so lang, dass es die Wagenseiten streifte – und ich hätte einfach schweigen können. Er wollte sich nicht unterhalten, so viel hatte ich verstanden. Aber ich wollte nicht schweigen, wenn ich doch so viele Fragen an ihn hatte. So viel Neues zu lernen. »Kommen Sie aus Gloucestershire?«
»London.«
»Wo in London?«
»East.«
»East? Ich komme aus Pimlico.«
Er schnaubte höhnisch.
»Und warum sind Sie in Gloucestershire? Wenn Sie doch aus London kommen?«
»Warum sind Sie hier? Arbeit. Geld. Mr Fox hat mich hergebeten.«
»Sie leben auf Shadowbrook?«
Er lachte kurz auf. Umfasste das Lenkrad fester, bis die Knöchel weiß hervortraten. Als er wieder sprach, klang seine Stimme weicher. »Nein. Da würde ich niemals wohnen.«
»Warum nicht?«
Er hielt inne, sah in den Außenspiegel. »Das werden andere Ihnen erzählen.«
»Andere? Aber ich frage Sie.«
Mein Ton schien ihn zu befremden – aber er antwortete dennoch. »Auf Shadowbrook hat es etwas Unruhe gegeben.«
»Welche Art von Unruhe?«
Ich dachte, er würde noch mehr erzählen, immerhin holte er Luft. Doch dann presste er demonstrativ die Lippen zusammen. »Nein.«
Ich versuchte es mit anderen Themen. Nannte den lateinischen Namen der Heckenrose. Kommentierte die Innenausstattung des Wagens und seine Geschwindigkeit, erkundigte mich nach dem Fabrikat. Ich dachte, Komplimente würden helfen. Aber es nützte nichts, zu der Unruhe sagte er kein Wort mehr. Ihn schien eine Müdigkeit überkommen zu haben, er wirkte geistesabwesend.
Die Dämmerung setzte ein. Die Scheinwerfer strahlten Motten an, Fahrspuren, Wegweiser nach Winchcombe und Stow und zu anderen fremden Orten. An einer Kreuzung holte er etwas aus der Tasche, das in Goldpapier gewickelt war, und steckte sich den Inhalt in den Mund: Ein hartes, glasähnliches Bonbon, das gegen seine Zähne klackte und mich an meine Kindheit mit gedünstetem Obst und krustenfreiem Brot denken ließ. Selbst heute hätte ich niemals so etwas Hartes essen können. Ich fragte, was das war, und ich lernte das Wort Butterscotch. Ich lauschte dem Geräusch des Grases, das die Unterseite des Wagens streifte; das Wort Unruhe war eine ganz eigene seltsame Motte.
Acht Uhr. Bäume und Felder immer dunkler, aber weiter sichtbar. Wir schaukelten über Unebenheiten.
»Da.«
Und auf einmal war Shadowbrook mehr als ein Name in Goldlettern. Es war ein Haus aus hellem Stein. Clematis wuchs die Mauern empor. Der Hof umwachsen von dunklen Laubsträuchern, in denen ich es rascheln hörte – nistende Vögel vielleicht oder huschende Mäuse. Das Haus hatte lediglich zwei Etagen. Einen kleinen, rechtwinklig ansetzenden Flügel. Beiderseits der Tür saßen steinerne Hunde auf einem Sockel, Kapuzinerkresse zu ihren Füßen.
»Die Mädchen tragen den Koffer für Sie rein.« Und damit wandte er sich zum Gehen.
»Nicht Sie? Ach, bitte, tragen Sie ihn doch für mich! Wie vorhin?«
»Nein. Es ist schon spät.«
»Warum ist das von Bedeutung?«
Er sagte nichts mehr. Er ging zurück zum Wagen, drehte am Lenkrad, dass die Reifen durch den Kies knirschten, und fuhr dann durch die Einfahrt und die Straße hinunter davon.
Ich sah und lauschte dem Wagen nach, bis er verschwunden war. Dann wandte ich mich wieder dem Haus zu.
Später sollte ich erfahren, dass nicht nur Shadowbrook aus diesem blassen, honiggoldenen Stein errichtet war. Es war das Gestein, das hier ganz natürlich vorkam – ich sollte es in den Blumenbeeten finden, in den Mauern des Gartenschuppens. Praktisch alles in den Cotswolds war aus diesem speziellen Stein erbaut: Versammlungshäuser und Brücken. Kirchen. Gehöfte und Wohnhäuser. Aber das wusste ich an jenem Abend noch nicht. Ich dachte, diese Färbung sei einzigartig für Shadowbrook: Ein Haus aus verdichtetem Staub, Herbstlaub und alter Sonne.
Unverwandt betrachtete ich die Hausmauern. Ließ den Blick über die bemoosten Dachziegel wandern, über die goldenen Steine, über die Fallrohre in ihren rostigen Halterungen und über die offenen Fenster im Obergeschoss, vor denen die Vorhänge halb zugezogen waren.
Ganz oben sah ich eine Wetterfahne. Ihre Umrisse zeichneten sich vor dem Abendhimmel ab: Ein Hase, die Ohren eng angelegt, Vorder- und Hinterläufe so weit ausgestreckt, dass er den Boden nicht berührte. Ein horizontales Wesen zwischen den Himmelsrichtungen. Ein Hase in vollem Lauf – ich war fasziniert von dieser Wetterfahne und bekam zunächst gar nicht mit, dass sich mir über den Hofplatz eine Gestalt näherte. Sie trug eine Laterne und rief meinen Namen.
»Miss Waterfield? Sind Sie das?« Sie hielt die Laterne hoch, um mich besser sehen zu können.
Ein kleines, neugieriges Gesicht. Es beäugte mich, wirkte aufgeweckt, verunsichert – es hatte etwas Jugendliches an sich. Doch sie war nicht mehr jung. Ihr Haar war grau – ein dunkles, metallisches Grau –, sie trug es in einem langen Zopf, der ihr über die Schulter hing und bis zur Taille reichte. Ihre Hände waren beschaffen wie die von Millicent. Und als sie lächelte, sah ich die Fältchen und Runzeln, die sich in fünfzig Jahren oder mehr ihrem Gesicht eingeschrieben hatten.
»Willkommen auf Shadowbrook. Wie haben uns sehr auf Sie gefreut, und ich hoffe noch viel mehr, dass Sie eine angenehme Reise hatten. Was für einen langen Weg Sie hinter sich haben. Aus London! Himmel! Sie sind bestimmt müde – und haben Sie Hunger? Ja? Es ist etwas Suppe da, wenn Sie möchten?«




























