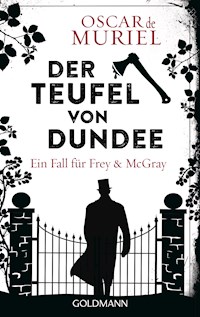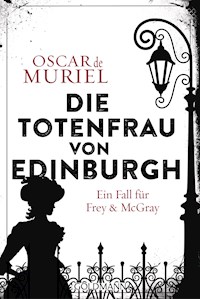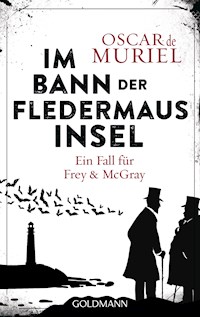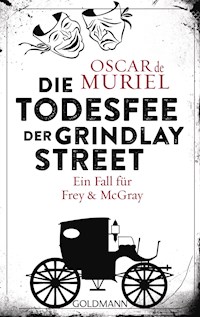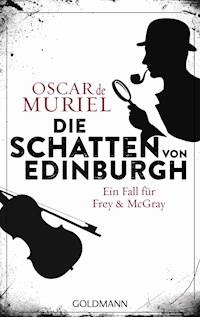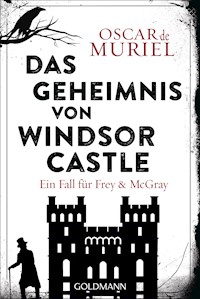
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Frey und McGray
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Edinburgh 1889. Frey und McGray haben schon einige ausweglose Situationen erlebt. Doch als sie mitten in der Nacht von Premierminister Salisbury zu einem Treffen geladen werden, stehen der feine Engländer und sein schottischer Vorgesetzter vor dem Ende. Denn niemand anders als Ihre Majestät Queen Victoria trachtet den Inspectors nach dem Leben. Die einzige Hoffnung auf Begnadigung: die Erfüllung einer Mission, die einem Todesurteil gleichkommt. Denn sie führt zurück zu den Hexen von Pendle Hill, zum tragischen Fall von McGrays wahnsinniger Schwester und zu einem Geheimnis, das das englische Königshaus in seinen Grundfesten erschüttert ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 679
Ähnliche
Buch
Edinburgh, Dezember 1889. Die geheime »Kommission zur Aufklärung ungelöster Fälle mit mutmaßlichem Bezug zu Sonderbarem und Geisterhaftem« der Edinburgher Polizei hat schon einige ausweglose Situationen erlebt. Doch als Frey und McGray mitten in der Nacht von Premierminister Salisbury höchstpersönlich zu einem Treffen geladen werden, stehen der feine Engländer und sein schottischer Vorgesetzter buchstäblich vor dem Ende. Denn Ihre Majestät Queen Victoria – die mächtigste Frau der Welt – trachtet den Inspectors nach dem Leben. Die einzige Hoffnung auf Begnadigung ist die Erfüllung einer gefährlichen Mission. Eine Mission, die einem Todesurteil gleichkommt – denn sie führt zurück zu Frey und McGrays niederträchtigen Feinden vom Pendle Hill, zum tragischen Fall von McGrays wahnsinniger Schwester und zu einem tödlichen Geheimnis, das das englische Königshaus in seinen Grundfesten erschüttert …
Weitere Informationen zu Oscar de Muriel sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Oscar de Muriel
Das Geheimnis von Windsor Castle
Ein Fall für Frey & McGray
Aus dem Englischen von Peter Beyer
Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel
»The Dance of the Serpents« bei Orion Fiction, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd., London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Dezember 2021
Copyright © der Originalausgabe 2020 by Oscar de Muriel
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: © FinePic®, München, © Chipstudio / getty images,
© Educester / getty images
Redaktion: Eva Wagner
MR · Herstellung: ik
Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-28331-5V001www.goldmann-verlag.de Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Das sechste ist zum Gedenken an meine liebe Tante Hilda.
Anmerkungen des Autors
Mag dieser Roman auch größtenteils auf freier Erfindung beruhen, so handelt es sich bei zentralen Elementen doch um Anlehnungen an gut dokumentierte historische Fakten.
So sind beispielsweise sämtliche »Tagebuch«-Einträge wörtlich zitiert aus einer Primärquelle aus dem echten Leben. Wie es um ihre Autorenschaft bestellt ist, wird zu gegebener Zeit enthüllt werden.
An indistinct and phantom band, They wheeled their ring-dance hand in hand, With gestures wild and dread; The Seer, who watched them ride the storm, Saw through their faint and shadowy form The lightning’s flash more red; And still their ghastly roundelay Was of the coming battle-fray And of the destined dead.
Sir Walter Scott »The Dance of Death«
1818
23. August, 23.45 Uhr
Das kleine Mädchen klammerte sich an die langen Rockfalten der Alten, obwohl die Frau ihr genauso viel Angst einjagte wie die sie einhüllende Dunkelheit.
Sie standen mitten auf der laubbedeckten Straße, während der eisige Wind die Flamme der Kerze flackern ließ. Die hässliche Alte hielt die Kerze fest in ihrer knochigen Hand, während sie mit der anderen die Flamme, das einzige Licht weit und breit, vor dem Wind schützte. Außerhalb des wenige Meter großen Lichtkegels war die ganze Welt nichts als eine geballte Masse Finsternis.
»Es dauert nicht mehr lange, Kind«, versicherte die Frau, die das Zittern der Kleinen offenbar bemerkt hatte. »Rühr dich nicht. Und lass das nicht fallen, sonst bekommst du es mit mir zu tun.«
Ihre gelblichen, geäderten Augen wiesen auf den kleinen Korb, den das Mädchen im Arm hielt. Das Kind stieß ein angstvolles Stöhnen aus und umklammerte ihn nur noch fester, worauf die Flaschen, die darin standen, klirrten.
Das Mädchen schaute nach vorn, geradewegs in die Dunkelheit hinein. Endlich vernahm es ein leises Geräusch und schauderte.
»Sind sie das?«, wollte die Frau von ihm wissen. Das Mädchen nickte. Die Zeit war gekommen.
Ganz langsam wurde das Geräusch lauter und deutlicher. Hufgetrappel. Selbst die Alte, deren Ohren nicht mehr die besten waren, konnte es nun hören. Ihre schmalen Lippen verzogen sich zu einem schiefen Grinsen, wobei ein schadhaftes Gebiss mit braunen Zähnen zum Vorschein kam.
In der Ferne leuchtete eine einzelne Fackel, und sobald die beiden sie auftauchen sahen, verblasste das Grinsen der Alten. Stattdessen zog sie ein jämmerliches Gesicht und hob die Arme.
»Halt!«, wehklagte sie mit schnarrender Stimme, wie das Elend in Person. »Halt! In Gottes Namen!«
Eine große, robuste Postkutsche, schimmernd und schwarz wie die Nacht, kam vor ihnen zum Stehen. Die muskelbepackten Pferde, deren Schnauben kleine Dampfwölkchen in der nächtlichen Luft erzeugten, wirkten erschöpft.
Der spindeldürre Kutscher hatte die Zügel mit aller Kraft angezogen und schaute die Alte nun mit verstörter Miene auf seinem geröteten Gesicht an. Er machte den Mund auf, kam jedoch nicht dazu, etwas zu sagen, da nun aus dem Inneren der Kutsche eine Männerstimme rief.
»Was zum Teufel …?«
»Da steht eine Lady auf der Straße, Sir«, erklärte der Kutscher.
»Eine was? Verdammt! Fahren Sie weiter!«
»Bitte! In Gottes Namen!«, beharrte die Alte, sank auf die Knie und hob ihre zitternden Hände. Prompt fiel ihre Kerze zu Boden, und die Flamme erlosch. »Helfen Sie mir. Ich habe ein Kind bei mir!«
Ihr Wehgeschrei hallte durch den einsamen Wald, während das Mädchen, in dessen Augen sich das Fackellicht der Kutsche glitzernd widerspiegelte, am ganzen Körper zitterte. Es war kurz davor, vor Angst in Tränen auszubrechen.
»Wenn Sie es mir gestatten, Sir«, erklärte der Kutscher mit bebenden Lippen. »Das hier sollten Sie sich ansehen.«
Sie vernahmen einen Laut des Unmuts, gefolgt von einem äußerst widerwilligen »Wenn es denn sein muss …«
Erst jetzt stieg der Kutscher ab, und im gleichen Moment sahen sie im Inneren der Kutsche ein weiteres Licht. Der Schlag ging auf, und ein junger Mann mit einer kleinen Petroleumlampe in der Hand sprang auf die Straße.
Er war nicht besonders groß gewachsen und hatte die glatten, rundlichen Wangen eines wohlhabenden Mannes von Adel. Auch seine Kleidung, ein zweireihiger Frack aus feinem grünem Samt sowie ein schneeweißes Hemd mit Krawatte, zeugte von Reichtum. Seine Augen waren zwar von Müdigkeit getrübt, doch von hellstem Blau. Offensichtlich hatte der Mann vor dem unerwarteten Halt tief geschlummert.
Er richtete den Lichtschein seiner Lampe auf das alte Weib und auf das Mädchen und musterte die beiden mit hochmütigen Blicken.
»Ist das deine Großmutter?«, fragte er gebieterisch.
»Aye, Sir.«
»Was tut ihr beiden hier?«
»Wir wurden ausgeraubt, Sir!«, stammelte die Alte. »Die haben uns den Karren weggenommen, unseren Wein, meinen Sohn, unser …«
»Langsam, langsam!«, sagte der Gentleman. »Douglas, gib ihnen Wasser.«
Der Kutscher kehrte auf seinen Bock zurück, zog einen Trinkschlauch hervor und reichte ihn der Alten. Diese gab ihn dem Mädchen, das zunächst verwirrt wirkte, dann aber, nachdem die Alte es verstohlen gezwickt hatte, ein paar Tropfen trank. Dann nahm die Alte, hustend und spuckend, ihrerseits einige große Schlucke, goss sich Wasser in die Hand und wusch sich ihr verdrecktes Gesicht. Schließlich reichte sie den Schlauch zurück.
»Also«, sagte der Gentleman. »Nun erzähl uns mal, was geschehen ist.«
Die Alte presste sich eine Hand auf die Brust und holte gequält mehrmals tief Luft.
»Wir waren … Wir waren mit meinem Sohn auf dem Weg nach Canterbury. Er arbeitet für einen Weinhändler, und morgen ist Markttag. Die Kleine wurde müde, deshalb legten wir uns hinten hin, um zwischen den Fässern ein wenig zu schlafen. Wir waren fest eingeschlafen, als wir mit einem Mal Rufe vernahmen. Mein Sohn hielt den Karren an, und da hörten wir diese schrecklichen Männer …«
Sie zitterte heftig, und das Mädchen vermochte einen Aufschrei nicht zu unterdrücken.
»Sie schlugen meinen Sohn, bis sie dessen überdrüssig wurden«, fuhr die Alte fort, während sie das verängstigte Kind an sich drückte und es fest in die Arme nahm. »Die Dinge, die wir hörten! Da …« Sie schluckte und strich besorgt über die goldbraunen Haare des Mädchens. »Es gab nichts, was wir hätten tun können. Wir hielten uns bloß versteckt und gaben keinen Mucks von uns.«
Ihre Augen flackerten hin und her, so als befiele sie allmählich der Wahnsinn.
»Dann hörten wir, wie etwas hinfiel. Der Körper meines Sohnes, glaube ich. Der Karren fuhr an … Und wir …«
Der Gentleman runzelte die Stirn, und die Petroleumlampe begann, in seinen kurzen, dicken Fingern zu zittern.
»Seid ihr beide auf dem Karren geblieben?«
Das Gesicht der hässlichen alten Frau verzog sich weiter und formte eine verstörende Fratze. Sie legte sich die Hand auf den Mund und sprach mit gedämpfter Stimme weiter.
»Es gab nichts, was wir hätten unternehmen können!«
Der Kutscher bot ihr erneut Wasser an, doch die Frau wirkte zu mitgenommen, um den Schlauch entgegenzunehmen.
»Wie ist es euch gelungen abzusteigen?«, hakte der Gentleman nach.
Erneut musste die Alte tief Luft holen. »Wer immer den Karren fuhr, musste anhalten, um zu pinkeln. Irgendwo hier in der Gegend. Da habe ich die Gelegenheit genutzt, mir mein kleines Mädchen geschnappt, bin abgesprungen und habe mich im Gebüsch versteckt. Wir sind schon seit Stunden hier, Sirs. Seit Stunden.«
Die Lippen des Gentlemans waren ein klein wenig weicher geworden. Dies genügte, um seinen Kutscher zu ermutigen, den Mund aufzumachen.
»Wenn ich es mir gestatten darf, Sir – es ist nicht mehr weit bis zum Gasthof. Wir könnten die beiden mitnehmen. Dort kann sich sicher jemand um sie kümmern.«
»Ja, ja bitte!«, flehte die Alte, die immer noch auf den Knien war. Sie streckte den Arm aus und versuchte, an den Mantelfalten des Gentlemans zu ziehen.
Rasch wich dieser einen Schritt zurück. »Also gut, also gut. Aber ihr werdet bei Douglas mitfahren.«
Er machte auf dem Absatz kehrt und ging zurück zur Kutsche, während der Kutscher der Alten aufhalf.
»Danke, Sirs. Danke!«
Als der Gentleman im Begriff war, wieder seinen Platz einzunehmen, streckte die Alte flehentlich eine Hand aus.
»Ähm, Sir?«
»Was denn noch?«, blaffte er.
»Bitte, nehmen Sie mein Mädchen mit hinein. Sie wird Ihnen nicht zur Last fallen, das schwöre ich.«
Der Gentleman schnaubte.
»Bitte«, beharrte die Alte. »Sie hat Dinge gehört, von denen Kinder nichts wissen sollten. Und schauen Sie sie nur an, das arme Ding friert ja wie ein Schneider.«
Der Gentleman sah nur die Hälfte des Gesichts des Mädchens, da der Rest hinter dem Rock der Alten verborgen war.
»Wir wissen nicht einmal, ob ihr Vater …« Die Alte legte sich die Hand auf den Mund, schaute beiseite und stieß leise Schluchzer aus.
Erneut schnaubte der Gentleman. Schließlich machte er den Schlag auf und deutete hinein.
»Rasch!«, wies er das Mädchen barsch an. Die Alte tätschelte ihr den Rücken.
»Nur zu, Marigold. Sei nett zu dem freundlichen Herrn. Verärgere ihn nicht.«
Das Kind zögerte, bis das alte Weib es unsanft stieß. In dem trüben Licht bemerkten dies weder der Kutscher noch der Gentleman.
Marigold eilte zum Schlag, wobei der Korb an ihrem Arm hin- und herschlenkerte. Sie stieg die Stufen hinauf und nahm rasch auf dem gepolsterten Sitz Platz. Auf rotem Samt hatte sie noch nie gesessen. Verglichen damit sah ihr verblichenes Kleid aus wie ein verschmutzter Küchenlumpen.
Der Gentleman folgte ihr und stellte die Petroleumlampe in einen Wandhalter. Sie vernahmen, wie das alte Weib sich mit Mühe auf den Kutschbock wuchtete, und bald darauf setzte sich das Gefährt wieder in Bewegung.
Während sie vollkommen still dasaß, den Korb auf ihrem Schoß, so wie das alte Weib sie geheißen hatte, starrte Marigold den Gentleman mit ihren großen grünen Augen an.
Er war erst Mitte zwanzig, doch in die Stirn seiner glatten Gesichtshaut hatten sich bereits tiefe Falten eingegraben. Auch seine Hände waren glatt und makellos, und seine rundlichen Wangen waren die eines gesunden, wenn auch leicht überernährten Mannes.
Die Gegenwart des Kindes schien ihm unangenehm zu sein. Er trommelte nervös mit den Fingern, rutschte auf dem Sitz herum und wusste nicht recht, worauf er den Blick richten sollte. Betreten tauschte er während einiger Minuten Blicke mit dem stummen Kind aus.
Als die Postkutsche durch ein Schlagloch fuhr, klirrten die Flaschen in dem Korb, und das zog die Aufmerksamkeit des Gentlemans auf sich. Wäre die Kutsche nicht ganz so schnell gefahren, dann hätten die Flaschen einander nicht berührt, und die Geschichte hätte womöglich einen völlig anderen Verlauf genommen.
»Was hast du da bei dir?«, fragte der Mann.
Das Mädchen räusperte sich. »Wein, Sir.«
»Wein?«
Marigold senkte den Blick. Sie war so nervös, dass die Anweisungen der Alten in ihrem Kopf durcheinandergerieten.
»Es ist …«, begann sie und merkte dabei, dass ihre Finger eiskalt wurden. Nicht weniger als ihr Leben hing davon ab, wie sie die nächsten Sätze formulierte. »Es ist der Wein, den mein Dad mir mitgab … zum Verkosten auf dem Markt. Mehr konnte ich vom Karren nicht herunterholen.«
Der Gentleman rollte mit den Augen und tat dann so, als schaute er aus dem Fenster, obwohl die Dunkelheit so undurchdringlich war wie zuvor.
Marigold zitterte. Sie spürte, dass ihre einzige Chance zu verrinnen drohte.
»Möchten Sie ein wenig kosten, Sir?«, zwang sie sich zu fragen.
Der Mann grinste spöttisch. »Ich trinke keinen billigen Fusel, Mädchen.«
Erneut schauderte Marigold und zog eine der Flaschen hervor. »Es ist guter Wein, Sir. Für die Herrschaften. Der Herr von meinem Dad holt ihn aus einem Ort namens Frankreich.«
Damit weckte sie ein gewisses Interesse, genau wie die Alte es vorhin gesagt hatte, doch es reichte noch nicht. Marigold war zumute, als balanciere sie über ein Seil, behielte nur dank puren Glücks ihr Gleichgewicht, stünde jedoch kurz davor, unwiederbringlich in eine tiefe Leere hinabzustürzen.
Da die Kluft zwischen ihnen beiden plötzlich wie ein Abgrund wirkte, hielt sie die Flasche ein wenig näher an den Mann heran. Sie konnte die spitzen Schreie der Alten in Gedanken bereits hören. »Du musstest ihn doch bloß zum Trinken bringen!«
»Kosten Sie ihn!«, stieß sie aus lauter Angst hervor und umklammerte die Flasche dabei so fest, dass sie schon fürchtete, sie könnte zwischen ihren Fingern zerbersten. Dann aber, wie durch ein Wunder, erinnerte sie sich an die Worte der Alten und gab sie perfekt wieder. »Mehr besitzen wir nicht, um Ihnen für Ihre Freundlichkeit zu danken.«
Der Mann starrte sie an. Marigold dachte schon, ihre Furcht habe alles ruiniert. Doch die Alte war gerissen. Sie wusste, dass das Kind zu Tode verschreckt sein würde, sie wusste, wie flehentlich die Kleine klingen und dass sie kurz davor stehen würde, in Tränen auszubrechen. Niemand, der auch nur ein wenig Herz hatte, würde ihr Angebot zurückweisen.
Mit einer raschen Bewegung schnappte sich der Gentleman die Flasche und entkorkte sie. Dann hielt er sie sich unter die Nase und schnupperte am Wein.
Marigold wartete stumm ab, während sie jede Bewegung und jede Veränderung im Gesicht des Mannes studierte.
Er lächelte nicht und zeigte auch keine Spur von Anerkennung.
Das Mädchen wrang die Hände, konnte es schier nicht mehr aushalten. Am liebsten hätte sie geschrien. Am liebsten hätte sie …
Dann trank der Gentleman.
Es war kein zurückhaltender Schluck, sondern ein anhaltendes, tiefes Gluck-gluck, als der Mann die Flasche hob und den Kopf in den Nacken legte. Er trank mehrere große Schlucke, während er sich den Flaschenhals an die Lippen presste.
Es war geschafft.
Marigold lächelte. Es war, als ließe der Rausch ihres ersten Triumphs in ihrem ganzen Körper Funken sprühen. An diesem Abend würde sie nicht verdroschen werden. Vielleicht nie wieder.
Und indem er den vorzüglichen französischen Wein hinunterkippte, besiegelte Sir Augustus sein Schicksal.
TAGEBUCH – 1822
Der Tod von Strowan.
Auswirkungen auf meine Augen.
Im Dezember 1822 unternahm ich eine Reise von Ramsgate in die schottischen Highlands, um einige Tage bei einem Verwandten zu verbringen, den ich liebte wie ein Sohn den Vater. Bei meiner Ankunft war er gerade verstorben. Ich nahm an seiner Beerdigung teil. Da zahlreiche Trauergäste zugegen waren, kämpfte ich mit aller Macht dagegen an zu weinen, sah mich letztendlich dazu jedoch außerstande. Kurz nach der Beerdigung war ich gezwungen, mir meine Briefe vorlesen und die Antworten schreiben zu lassen, da meine Augen dermaßen geplagt waren, dass ich, wenn ich versuchte, sehr kleine Gegenstände zu fokussieren, diese nur verschwommen wahrnehmen konnte. Dass ich überhaupt eine Sehstörung hatte, wurde mir nur bewusst, wenn ich versuchte, zu lesen oder meine Feder zu spitzen. Bald darauf reiste ich nach Irland, und ohne dass meine Augen in irgendeiner Form behandelt worden wären, erlangten sie wieder ihre volle Stärke und Sehkraft …
1889
3. Dezember
Windsor, kurz vor Mitternacht
Caroline Ardglass beugte sich an ihrem wurmzerfressenen Schreibtisch über das Buch über Hexenkunst. Sie war angewidert von den primitiven Illustrationen und mühte sich ab, die Handschrift ohne Kerzenlicht zu entziffern.
Ihre Augen brannten vor Erschöpfung, ihr Rücken tat weh, und ihre Knochen schmerzten auf dem feuchten, zugigen Dachboden, doch sie ignorierte diese Unannehmlichkeiten. Schließlich war dies hier kein Weihnachtsurlaub. Es war eine Jagd.
Sie beneidete die Elster, die mit unter die Flügel gestecktem Schnabel friedlich in dem kleinen Messingkäfig döste. Sein schwarz-weißes aufgeplustertes Federkleid schien den Vogel ausreichend warm zu halten. Trotz der dicken Decke, die sich Caroline um die Schultern geschlungen hatte, konnte sie Gleiches nicht von sich behaupten.
Der Dachboden war in einem schrecklichen Zustand und stank, und der Lärm aus der benachbarten Schankwirtschaft war alles andere als angenehm. Dennoch hatte sie für den Raum im Obergeschoss des schäbigen dreistöckigen Gebäudes teuer bezahlt.
Sie blickte auf und schaute durch das schmale Fenster auf den Ausblick, der sie so viel gekostet hatte.
Die schneebedeckten Felder glänzten unter dem Halbmond silbrig. Der Himmel war klar, und die Bäume entlang der Royal Mews trugen kein Laub, sodass die junge Caroline einen perfekten Blick auf den Ostflügel des Castle hatte. Auf die Fenster der Privatgemächer der Queen.
Sie hatte gesehen, wie hinter einem Fenster nach dem anderen Licht entfacht worden war, und stellte sich dabei vor, wie die Bediensteten ihre abendlichen Rundgänge machten. Normalerweise wurden in diesem im Dunkeln liegenden Flügel nur ein oder zwei Räume beleuchtet, doch heute Abend war dies anders. Hinter mindestens einem Dutzend Fenstern flackerte Kerzenlicht, ein Zeichen dafür, dass Queen Victoria eingetroffen war.
Caroline hob das kleine, aber leistungsstarke Fernglas, das neben ihrem Buch lag – jenes, das Lady Anne, ihre Großmutter, für gewöhnlich in die Oper mitnahm, um dort ihre Geschäftskonkurrenten auszuspionieren.
Geduldig nahm sie Fenster für Fenster unter die Lupe. Sie konnte lediglich die Rahmen ausmachen, manchmal auch noch die aufgebauschten schweren Vorhänge. Ihr Standort war zu weit entfernt, als dass sie Gesichter hätte identifizieren können, aber darauf war sie auch gar nicht aus. Sie richtete das Fernglas nach Osten, auf den wuchtigen Turm an der südöstlichen Ecke des Burghofs – den nach der Queen benannten Victoria Tower.
Wenn diese unheimlichen Schwestern die Wahrheit gesagt hatten, dann war es dort, wo …
Plötzlich knarrten die Holzdielen des Bodens. Caroline fuhr zusammen, schaute sich um und hob das Fernglas in die Höhe, bereit, es auf …
»Ganz ruhig, Kind!«, meldete sich Bertha. »Ich bin es doch bloß!«
Dort drüben in der Dunkelheit stand ihre kleine, mollige ehemalige Amme. Nur eine Hälfte ihres runzeligen Gesichts war zu erkennen, und das silberne Teeservice, das sie in den Händen hielt, schimmerte schwach im Mondlicht.
»Du meine Güte!«, sagte Caroline, während sie sich eine Hand auf die Brust legte. »Hast du mich vielleicht erschreckt!«
Die Elster in dem Käfig schlug mit den Flügeln und bedachte Caroline mit einem Blick, der missbilligend wirkte, bevor sie den Kopf drehte und ihren Schlaf fortsetzte.
»Ich dachte, du möchtest vielleicht einen Tee, mein Kind.« Bertha stellte das Tablett auf dem Tisch ab und klappte das Buch mit einem dumpfen Geräusch zu. »Ruh dich ein wenig aus. Du bist in letzter Zeit mit den Nerven herunter.«
Ohne auf Zustimmung zu warten, machte sich Bertha daran, den Tee einzuschenken. Derweil fläzte sich Caroline auf ihren Stuhl, hielt den Blick dabei allerdings auf das Schloss gerichtet.
»Wie lange müssen wir noch in dieser flohverseuchten Absteige hausen?«, klagte Bertha, während sie ihr eine Tasse reichte.
Caroline nippte am Tee, machte sich jedoch nicht die Mühe, eine Antwort zu geben. Sie hatte es Bertha schon so oft gesagt.
»Wenn man hier wenigstens Feuer machen könnte …«
»Wir dürfen kein Feuer machen, Bertha!«, zischte Caroline und wandte sich der Frau zu. Augenblicklich bereute sie ihre Schroffheit. Bertha kümmerte sich schon um sie, solange sie sich erinnern konnte. Obwohl Caroline ihr eine horrende Summe angeboten hatte, damit sie sich zur Ruhe setzen könnte, hatte sie sich ihr auf dieser wahnwitzigen Verfolgungsjagd angeschlossen. Niemand auf der Welt liebte sie so sehr wie diese in die Jahre gekommene Hausangestellte. Sicher, ihr verstorbener Vater hatte es ebenso getan, doch andererseits war gerade er der Grund dafür, dass sie sich in Windsor aufhielten und sich in einem schäbigen Dachstuhl verbargen.
Caroline zwang sich dazu, tief Luft zu holen.
»Wir dürfen nicht gesehen werden«, mahnte sie, nun in ruhigerem Ton. »Wir befinden uns hier an der höchsten Stelle in dieser gottverlassenen Straße. Schon mit einer einzigen Kerze, die nachts brennen würde, würden wir Verdacht erregen.«
Bertha begriff. Die dunklen, listig blickenden Augen von Miss Ardglass sagten ihr alles. Der Auftrag war erteilt worden, und die junge Frau konnte – und würde – nicht nachlassen.
Und doch – das Kind, das Bertha einst in ihren Armen in den Schlaf gewiegt hatte, das kleine Mädchen, das sie hatte aufwachsen sehen … Zu sehen, wie sie sich derart verzehrte, war herzzerreißend.
»Ich wünschte, du müsstest das hier nicht tun«, flüsterte Bertha. Sie konnte ihr nicht länger in die Augen sehen. »Ich wünschte, du …« Sie verstummte und richtete den Blick ihrer funkelnden Augen auf das Fenster.
»Was gibt es?«, wollte Caroline wissen.
»Schau nur!«
Auf dem Victoria Tower war ein neues Licht entzündet worden. Caroline hatte das Gebäude so lange angestarrt, dass sie es sofort bemerkte. Es drang jedoch nicht aus einem Fenster, sondern sah eher aus wie ein flackernder Funke ganz oben auf dem Gebäude.
Sie tastete nach dem Fernglas, das Bertha ihr schließlich reichte. Der vergrößerte Ausschnitt, den Caroline zu sehen bekam, ließ sie die Augen weit aufreißen.
Auf dem Dach glomm ein heller Feuerball, dessen Flammen sich kräuselten und nach oben ragten wie flehende Arme. Und dann, beinahe explosionsartig, nahm das Feuer ein leuchtend helles Grün an.
Das Zeichen der Hexen.
Caroline stieß einen Laut des Erschreckens aus und ließ das Fernglas fallen. Auch ohne seine Hilfe konnte sie den smaragdgrünen Farbton ausmachen. Einen Moment lang, während dem beide Frauen staunend zuschauten, waren nur ihre Atemzüge zu vernehmen. Schließlich kam Caroline wieder zur Besinnung.
»Es ist Zeit, Bertha«, sagte sie. »Mach die Elster fer…«
Doch sie war nicht die Einzige, die wachsame Augen hatte. Der Vogel hockte bereits auf seiner Stange und schaute aufgeregt herum. Plötzlich bekam er eine Panikattacke, schlug mit den Flügeln und flatterte dabei gegen die Käfigstangen.
Mit bebenden Lippen schaute Caroline ihn an.
»Was … was hat ihn so verängstigt?«
In diesem Augenblick vernahm sie schwere Schritte auf der Treppe. Es war der unverkennbare Gang des hünenhaften Jed.
Der breitschultrige Mann, dessen wettergegerbtes Gesicht Caroline während ihrer Kindheit gefürchtet hatte, stürmte auf den Dachboden. Er musste sich unter der Schräge ducken und wischte sich den Schweiß von der Stirn, während er hervorstieß: »Miss, die sind hinter Ihnen her!«
Bertha zog hörbar die Luft ein und bedeckte sich mit zitternden Händen den Mund.
Mit zwei großen Schritten durchquerte Caroline den Dachboden, um beide Hände gegen die Scheibe des gegenüberliegenden Mansardenfensters zu pressen.
Ihr Herz setzte einen Schlag aus.
Zwei Kutschen näherten sich, gezogen von muskelbepackten Percherons, die so dunkel waren wie die Nacht. Die Kutscher hielten Fackeln in den Händen, deren Flammen züngelten, während sie in rasender Fahrt voranschossen. Mit einem Mal blitzte anstelle des leuchtenden Gelbs ein intensives Blau auf.
Wie von einem elektrischen Schlag getroffen, machte Caroline einen Satz zurück.
»Wir müssen los!«, rief sie und rannte instinktiv zu dem alten Schrank. Hastig ergriff sie die Ledertasche ihres Vaters und warf Bücher, Werkzeug und Geldkatze hinein.
»Rasch, rasch!«, grunzte Jed, während er sich vergewisserte, dass seine Waffe geladen war. »Ihr wisst doch, was passiert, wenn sie ihre Opfer in die Enge treiben!«
»Lass das hier!«, rief Caroline, als Bertha mit einem Bündel Kleider auf sie zukam. »Nur die Bücher und das Geld.«
Von der Straße vernahmen sie das Gewieher von Pferden, gefolgt von Schreien aus dem Pub.
Eine Welle schauriger Gedanken kamen Caroline in den Sinn – Menschen, die ausgepeitscht wurden, bei lebendigem Leib verbrannt, denen man die Zunge herausschnitt oder Gift verabreichte, das bewirkte, dass sie sich so verrenkten, dass ihre Wirbelsäule brach …
»Wir müssen sofort los!«, zischte Jed und packte Caroline am Arm.
Sie ließ sich von ihm zur Tür zerren, während Bertha das Fernglas und ein Säckchen mit Münzen in die Ledertasche warf.
Dann wies Bertha auf den Käfig. »Der Vogel!«
Caroline eilte zurück und ergriff hastig den Käfig. Krächzend schlug darin die Elster mit den Flügeln, während sie nun alle hektisch zur Treppe hasteten.
Die schmalen Stufen knarzten so laut unter ihren Füßen, als wären sie im Begriff nachzugeben, und Caroline fürchtete schon, zu Boden zu stürzen. Der Gedanke ließ sie straucheln, doch Jed gelang es, sie festzuhalten. In diesem Moment hörten sie den ersten Schuss.
»Mein Gott!«, stieß Bertha hervor.
Sie gelangten ins Erdgeschoss und erblickten dort statt Dunkelheit das schwache Leuchten einer Kerze. Der Hausbesitzer, nur im Nachthemd und am ganzen Körper zitternd, hielt sie in die Höhe.
»In was habt ihr uns da hineingezogen?«, bellte er. Mit seinen zerzausten grauen Haaren und seinen entsetzt blickenden Augen sah er aus wie ein Gespenst.
Der Lärm auf der Straße wurde lauter, und ein zweiter Schuss krachte.
Caroline zog sich einen goldenen Ring vom Finger und drückte ihn dem Mann in die Hand.
»Für Ihre Unannehmlichkeiten.«
Eilig hielten sie auf die Hintertür zu. Jed trat sie auf, und der Knall ließ die Pferde schnauben.
Der eiskalte Windstoß, der durch den dunklen Hinterhof fegte, traf sie wie eine Wand. Drei marode Burgzinnen, alles, was von den ältesten Mauern der Burg übrig geblieben war, warfen ihre Schatten auf die Kutsche und die beiden Pferde. Jed hielt sie mittlerweile ständig angeschirrt und bereit.
Er rannte zum Schlag und machte ihn für Caroline auf. Sie warf erst die schwere Ledertasche hinein, um dann mit größerer Sorgfalt den Käfig abzustellen. Dann hörte sie mehrere Geräusche unmittelbar nacheinander – einen dumpfen Aufschlag auf dem Schnee, Bertha, die wimmerte, und, als Caroline sich gerade umschaute, das laute Zersplittern von Holz.
Bertha war gestolpert und auf die Knie gefallen, und während Caroline und Jed ihr aufhalfen, wurden die Splittergeräusche lauter. Dann vernahmen sie Geschrei aus dem Haus – die Hexen und ihre Spießgesellen waren eingedrungen.
»Lass mich, Kind!«, rief Bertha, während sie mehr oder weniger zur Kutsche geschleift wurde.
»Sei keine dumme Gans«, brummte Caroline, vermochte die alte Frau jedoch nur mit Mühe auf ihren Sitz zu hieven.
Das Geschrei wurde lauter, und dann hörten sie die erstickte Stimme des Gastwirts.
Jedes Feingefühl außer Acht lassend schob Jed sie beide hinein. Dann schloss er den Schlag und sprang auf den Kutschbock. Das Knarren der Kutsche fiel mit dem der Hintertüre zusammen. Diese ging genau in dem Moment auf, als Jed den Pferden zum ersten Mal die Peitsche gab.
»Zeit fürs Töten!«, brüllte eine hässliche Frauenstimme, deren Klang Caroline in Angst und Schrecken versetzte.
Sie schaute durch das Heckfenster und erblickte ein halbes Dutzend Wüstlinge, von denen zwei jeweils eine lodernde Fackel in der Hand hielten. Mit sich schleppten sie den Gastwirt, der sich verzweifelt wand und krümmte, während sie ihn in den Hof zerrten. Hinter ihnen schritt eine verhüllte, in tiefschwarzen Stoff gekleidete Frau, deren Kapuze mit goldener Stickerei verziert war.
Als die Kutsche sich in Bewegung setzte, sah Caroline, wie die groß gewachsenen Männer den Gastwirt zu Boden warfen. Der Mann fiel jammernd auf die Knie. Die verhüllte Frau packte ihn an den Haaren, zog seinen Kopf zurück und schnitt ihm mit einer einzigen raschen Bewegung die Kehle durch. Blut spritzte überall auf sein weißes Nachthemd, ein vom Lichtschein der Fackeln erhellter, fast perfekter Fächer aus scharlachroter Flüssigkeit, und Caroline konnte einen erschreckten Aufschrei nicht unterdrücken.
Während die Kutsche, die Jed zum Tor lenkte, heftig schaukelte, kauerte sich Caroline auf ihrem Sitz zusammen. Durch das reifbedeckte Fenster erhaschte sie einen schaurigen Blick auf die Männer, die in diesem Moment auf sie zugerannt kamen, am Schlag der Kutsche rissen und dagegenschlugen. Sie waren so nahe, dass Caroline einen Moment sogar ihre gelblichen Zähne und ihre wutverzerrten Gesichter erkennen konnte.
Die Kutsche bog rasch ab, doch Caroline konnte trotzdem noch erkennen, dass die Männer Schusswaffen auf sie richteten. Augenblicklich duckte sie sich und drückte auch Bertha nach unten, als auch schon wilde Salven abgefeuert wurden.
Als ihr Gefährt endlich abgebogen war, ging Caroline davon aus, dass sie gerade aus dem Hof heraus auf die Straße rasten. Sie vernahm das Gegröle Betrunkener – sie fuhren also am Wirtshaus vorbei –, und dann war nur noch das Rattern der Räder und das Gestampfe von Hufen zu vernehmen. Nach wie vor waren Schüsse zu hören, doch sie verklangen allmählich.
Caroline blieb noch einen Moment geduckt hocken, vernahm dabei Berthas hektische Atemzüge und spürte, wie ihr das Herz in der Brust hämmerte. Erst als die Schüsse immer spärlicher wurden, wagte Caroline es, sich aufzurichten.
Ihre Kutsche hatte ein vorderes Fenster, durch das sie Jeds Rücken und die galoppierenden Pferde sehen konnte. Doch die Scheibe war zersplittert.
»Mein Gott, sie haben Jed getroffen!«, rief Caroline. Sie ließ Bertha los und sprang auf die vordere Sitzbank. Hastig packte sie den Fenstergriff und war im Begriff, ihn hinabzudrücken, doch in diesem Augenblick krachte erneut ein Schuss, und augenblicklich breitete sich ein großer roter Spritzer auf der Scheibe aus.
Caroline und Bertha schrien auf und starrten auf Jeds breiten Oberkörper, der nun seitlich auf den Kutschbock fiel und dabei sein Blut auf die Fensterscheibe schmierte.
Caroline schossen vor Panik die Tränen aus den Augen, und alles um sie herum verschwamm. Sie sah, dass die Pferde weitergaloppierten, mittlerweile im Zickzackkurs auf der Straße; sie sah Jeds mottenzerfressenen Mantel, jetzt karmesinrot gefärbt; sie sah seinen Kopf, der hin- und herschlug, während seine Augen immer noch geöffnet waren. Und sie vernahm Berthas unverständliches Stammeln …
Die Schüsse hinter ihnen hörten nicht auf.
Als die Kutsche durch ein Schlagloch holperte, wurde Caroline in die Höhe katapultiert. Sie schlug mit dem Kopf gegen das Dach, und dieser Aufprall brachte sie wieder zur Besinnung.
Niemand würde ihnen zu Hilfe kommen. Niemand würde herbeieilen und sie retten. Sie war nun auf sich alleine gestellt.
Caroline zog die Fensterscheibe herunter, wobei sie ihre Hände mit Jeds noch warmem Blut verschmierte. Sie versuchte, sich auf den Kutschbock zu hieven, doch Jeds Körper versperrte ihr den Weg, ließ ihr praktisch keinen Raum, um sich zu bewegen.
Der Wind fegte an ihr vorbei und trug das Geschrei der Hexengehilfen mit sich. Sie sah, dass die Pferde ziellos vor sich hin galoppierten, und spürte, dass sich die Fahrt der Kutsche verlangsamte. Sie hatte keine Zeit für Zimperlichkeiten.
Ächzend und keuchend schob sie Jeds schweren Körper beiseite. Hände, Kleidung und Gesicht mit Blut beschmiert zwängte sie sich schaudernd über den Oberkörper des Toten.
Mit einem letzten Ruck fiel sie nach vorn und landete mit Gesicht und Händen auf dem Trittbrett. Unbeholfen drehte sie sich herum, ertastete die Zügel und ergriff sie, bevor sie sich taumelnd aufrichtete.
Jeds Leiche lag quer über dem Kutschbock. Caroline zog sie an den Schultern, um den leblosen Körper, unter der Last seines Gewichts keuchend, aufzurichten. Die glasigen Augen des Mannes waren dicht vor den ihren, und Caroline empfand gleichermaßen Kummer und Abscheu.
Plötzlich krachte ein weiterer Schuss, so nah, dass Carolines Ohren schmerzten. Als sie aufschaute, sah sie neben der Kutsche den Kopf eines Pferdes auftauchen, das schnell näher kam.
Sie stieß einen schrillen Schrei aus, als das wutverzerrte Gesicht eines Mannes in ihr Blickfeld rückte, der mit seiner Waffe direkt auf ihre Stirn zielte.
Ohne nachzudenken, ohne Zeit für irgendwelche Zweifel, stieß Caroline ein animalisches Fauchen hervor, schob Jeds Leiche mit aller Kraft von sich und ließ sie gegen den Reiter fallen.
Es war ein grausiger Anblick, als Jeds blutüberströmte Leiche auf den Schergen prallte und dabei den Lauf seiner Waffe ablenkte, um dann weiter hinabzustürzen, direkt vor die Hufe des Percherons. Das Tier stampfte über die Leiche – Caroline hörte, wie Knochen zermalmt wurden –, dann stürzte das Pferd auf seine Flanke, und im nächsten Augenblick waren weder Ross noch Reiter mehr zu sehen.
»Es tut mir leid, es tut mir leid!«, wehklagte Caroline in einem fort. Sie setzte sich auf den Kutschbock und konnte nun endlich die Zügel fest in die Hand nehmen. Sie lenkte die Pferde wieder zurück auf die Mitte der Straße und gab ihnen erbarmungslos die Peitsche, während sie hinter sich erneut Schüsse hörte.
Sie kauerte sich zusammen. Da sie es nicht wagte, sich umzuschauen, blieb ihr nichts anderes übrig. Ihre ganze Aufmerksamkeit, all ihre Sinne galten den Pferden und der Straße.
Irgendwann, womöglich bereits eine ganze Weile, nachdem es geschehen war, begriff Caroline, dass die Schüsse verebbt waren. Nichtsdestotrotz schlug ihr Herz nach wie vor schneller denn je. Erst als die Pferde erschöpft aneinanderstießen, verringerte sie das Tempo und ließ sie mehrere Meilen lang traben.
Sie durchquerten den dichten Windsor Forest, in dem die Äste der Bäume die Straße wie bedrohliche Klauen überwölbten. Schließlich wich der Wald einer breiten, gänzlich weiß überzogenen Graslandschaft.
Da ihr das offene Feld lieber war, auf dem sie es sehen konnte, falls ihre Feinde näher kamen, hielt Caroline nun an. Sie sprang vom Kutschbock herunter, wobei sie beinahe auf die Knie gefallen wäre, und wankte unbeholfen zum Straßenrand. Dort beugte sie sich vor und erbrach sich heftig.
Eine Weile hustete und würgte sie. Der schwere Atem der Pferde war das einzige andere Geräusch. Erst jetzt spürte sie, wie die kalte Luft ihr durch die dünne Kleidung kroch. Ihr war nicht einmal die Zeit geblieben, sich einen Mantel überzuwerfen.
Trotzdem empfand sie Dankbarkeit.
Caroline zwang sich dazu, mehrmals tief Luft zu holen, streckte den Rücken durch und schaute nach vorn. Ein Problem nach dem anderen, sagte sie zu sich selbst, was sie mittlerweile immer dann tat, wenn sie sich überfordert fühlte. Sie würden eine Zufluchtsstätte finden müssen, dies sollte nun ihre unmittelbare Sorge sein.
Sie trat an die Pferde heran und tätschelte ihnen den Kopf. Das größere der beiden, ein prächtiger pechschwarzer Kartäuser, stampfte mit den Hufen.
»Na, komm!«, sagte Caroline und lehnte die Stirn an den Hals des Pferdes. »Ich bin auch erschöpft, aber wir müssen weiter.«
Sie trat wieder neben den Kutschbock, vernahm dann jedoch ein vertrautes Wimmern.
»Bertha …«, murmelte sie und rannte zum Schlag. Die ganze Kutsche war von Einschusslöchern durchsiebt.
Caroline öffnete den Schlag und sprang hinein. Bertha saß immer noch an Ort und Stelle, kerzengerade, den Kopf ein wenig gesenkt. Man hätte glauben können, sie befände sich mitten auf einer friedlichen Reise, hätte die Frau sich nicht beide Hände fest auf den Magen gepresst. Blut lief an ihnen herab.
»Bertha!«, schrie Caroline auf und drückte die kleine Frau an sich.
Sie versuchte, ihr die Hände wegzuziehen, um die Wunde zu untersuchen, doch Bertha presste sie fest zusammen. Selbst in der Dunkelheit sah Caroline den dunklen Fleck, der sich über ihre Rockfalten ausbreitete.
»Warum hast du nicht laut gerufen?«, schluchzte Caroline, während sie hemmungslos Tränen vergoss. Wie lange musste Bertha schon geblutet haben!
Und doch gelang es ihr, das Gesicht zu heben und trotz ihres Schmerzes ein Lächeln aufzubringen. »Dann hätte ich gar nicht mehr aufgehört zu schreien!«
Viel mehr als ein Flüstern brachte Bertha nicht zustande. »Ich war vom ersten Moment an verloren …«
Nun heulte Caroline wie ein Kind. Wut, Schuldgefühle und Verzweiflung bemächtigten sich ihrer. Wie töricht war es von ihr gewesen, die Pferde zu trösten, bevor sie nach ihrem geliebten Kindermädchen schaute!
»Wir werden einen Arzt suchen«, versicherte sie. »Wir werden einen Arzt suchen, und dann …«
Bertha schüttelte den Kopf und schaute Caroline mit flehenden Augen an. »Ich will dich hier bei mir, Kind. Nicht dort draußen … wenn … es so weit ist.«
Caroline wiegte das Gesicht der Frau in ihren Händen. Sie hatte nicht einmal Wasser, das sie ihr hätte reichen können.
»Es tut mir so leid!« Ihre Stimme war nur noch ein schrilles Schluchzen. »Ich hätte dich nie mitnehmen …« Sie musste schmerzhaft schlucken und brachte kein weiteres Wort mehr hervor.
»Ich war dort, wo ich gebraucht wurde«, murmelte Bertha mit leiser werdender Stimme. Sie stieß einen Seufzer aus, und ihr Gesicht wirkte mit einem Mal entspannt. Offenbar spürte sie nicht mehr viel.
»Da gibt es so vieles, was ich dir sagen muss, mein Kind«, flüsterte sie und ließ den Kopf auf Carolines Schultern ruhen, so als wäre sie wieder ein kleines Mädchen. »Und es bleibt mir so wenig Zeit dafür …«
1
13. Dezember
Edinburgh
Der Himmel war ein grau-weißer Fleck, auf dem im abendlichen Wind dicke Wolken in Richtung Osten zogen.
Es war ein seltsamer Anblick, denn die letzten Sonnenstrahlen, die durch eine Lücke zwischen den Wolken drangen und die ich von meinem Fenster aus nicht sehen konnte, huschten über die Gebäude auf der anderen Straßenseite. Ihre Fassaden, massive Blöcke aus schottischem Granit, leuchteten in goldenen Tönen, geradezu strahlend inmitten der unter ihnen herrschenden Dunkelheit und des bedeckten Himmels darüber.
Oben auf dem georgianischen Stadthaus, das dem meinen direkt gegenüberstand, hockte ein großer Rabe in regelrecht herausfordernder Manier.
Der schwarze Vogel saß dort schon seit Tagen. Er war am Morgen dort gewesen, als ich das Haus verlassen hatte, er war ebenfalls zugegen gewesen, als ich am Abend heimkehrte, und er war immer noch dort, wenn nachts die Straßenlaternen entzündet wurden. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das verdammte Geschöpf jede meiner Bewegungen beobachtete.
»Tee, Master Frey?«
Eine Frage war das nicht wirklich, denn Layton, mein stocksteifer Hausdiener, hielt mir bereits Tasse und Untertasse entgegen, die ich zerstreut entgegennahm.
»Was hat mein Onkel unternommen, wenn er Vögel loswerden wollte?«, fragte ich ihn, bevor ich im Aroma meiner allerliebsten Darjeeling-Mischung schwelgte.
Layton zog die Stirn leicht in Falten und hob seine schmale Adlernase an, als gebe er sich Erinnerungen hin.
»Er hat sie für gewöhnlich abgeschossen, Sir.«
Ich gestattete mir ein verschmitztes Lächeln, stellte mir vor, wie mein verstorbener Onkel Maurice sein Gewehr jedes Mal abfeuerte, wenn eine Taube es wagte, ihre Gedärme auf den Marmorstatuen seines Anwesens zu entleeren.
»Hockt das schmutzige Vieh immer noch dort?«, fragte Layton und blickte aus dem Fenster.
»Allerdings. Schießen ist leider keine Option. Ich will keinesfalls die Büste der Pallas treffen.«
Layton schaute mich einen Moment verständnislos an, bevor er sich wieder praktischen Dingen zuwandte. »Ich kann morgen mit den McKees sprechen, Sir. Sie sind möglicherweise bereit, ihn zu vertr…«
»Nein«, unterbrach ich ihn. »Sie würden mich für kauzig halten.«
Das taten sie ohnehin schon, vermutete ich, während ich an meinem Tee nippte. Das taten die meisten Menschen in Edinburgh.
Verteidiger eines mordlustigen Mediums, Vollführer von Tricks schwarzer Magie dicht vor dem Galgen, Lakai des gestörtesten und berüchtigtsten Kriminalinspektors von ganz Schottland. Dafür war ich dieser Tage bekannt. Und mir blieb keine andere Wahl, als an Ort und Stelle in dieser grauen Stadt auszuharren und zuzuschauen, wie der Winter hereinbrach, während keiner meiner Vorgesetzten beim CID sich allzu viel darum scherte, ob ich bei der Arbeit erschien oder nicht. Sogar Nine-Nails McGray war in den vergangenen drei Wochen lethargisch geworden, ausgebrannt vom Fall Madame Katerina, seiner hellseherischen Zigeunerfreundin.
Uns beiden war, als trügen wir unsichtbare Ketten und wären einem unsichtbaren Willen ausgeliefert, der uns daran hinderte, Edinburgh zu verlassen.
Immerhin fand ich ein wenig Trost in meinem kleinen Arbeitszimmer mit seinen behaglichen Ledersesseln und seinem wärmenden Kaminofen. Es war vollgestopft mit meinen liebsten Annehmlichkeiten – Bücher, Whisky, Decken und Tabak –, und Layton servierte mir Tabletts mit Speisen, bevor ich überhaupt spürte, dass ich hungrig war. Hier konnte ich die Nachbarn ignorieren, die Zeitungen und sogar die fortwährende Korrespondenz von meiner Londoner Verwandtschaft. Ich genoss es wirklich von Herzen, meine Abende in diesem gemütlichen Zimmer zu verbringen und mich zu entspannen.
Hätte ich doch nur noch ein wenig länger in dieser zivilisierten Bequemlichkeit geschwelgt, denn noch bevor ich diese Tasse Tee ausgetrunken haben würde, sollte die Hölle losbrechen.
Ich genoss das heiße Getränk, als von beiden Seiten der Straße der Lärm von wildem Wiehern und stampfenden Hufen erklang. Zunächst glaubte ich, Echos würden mir einen Streich spielen, doch ich sollte mich täuschen. Nicht nur eine, sondern gleich zwei Kutschen tauchten auf, jeweils an einem Ende der Straße, und hielten wie wild aufeinander zu. Als ich schon glaubte, sie würden zusammenstoßen, zügelten die Kutscher die imposanten Pferde, und beide Gefährte hielten unmittelbar vor meiner Haustüre an.
Aus jeder der beiden Kutschen sprangen hünenhafte, breitschultrige Männer heraus. Sie eilten zur Haustür und hämmerten mit den Fäusten dagegen.
Augenblicklich stellte ich meine Tasse auf einem Tisch neben mir ab, verschätzte mich dabei jedoch, sodass sie auf den Teppich fiel. Während ich die Treppe hinabschritt, band ich mir meinen Hausrock ein weniger enger. Layton hatte schnell wie der Wind reagiert und befand sich bereits an der Tür, als ich die Eingangshalle erreichte. Ich wollte ihn anweisen, nicht zu öffnen, doch es war zu spät. Kaum hatte er die Tür entriegelt, drückten die Männer auch schon dagegen und rissen die Kette damit glatt aus der Wand.
Layton stolperte rücklings und wäre fast auf den Rücken gefallen, als die kräftigen Männer hereinstürmten. Sie trugen allesamt feine Anzüge und Jacketts, und einer von ihnen kaute auf einer Zigarre herum, die wie eine sündhaft teure kubanische roch. Ihre Gesichter hingegen waren rau und wirkten berechnend. Und sie stanken nach Schweiß.
»Ian Frey?«, bellte der Anführer mit südenglischem Akzent.
»Inspector Ian Frey«, korrigierte ich ihn.
Alle vier Männer grinsten höhnisch.
»Sie sollen mit uns kommen – Inspector.«
Ich reckte das Kinn. »Und wer zur Hölle sind Sie?«
Die vier kicherten. Der Anführer nahm seine Zigarre aus dem Mund, aber nur, um auf den Teppich meiner Vermieterin zu spucken.
Seine Stimme wurde noch tiefer. »Freunde.«
Das Wort schwebte in der Luft wie ein übler Gestank, doch ich sah keinen Grund, Widerstand zu leisten. Ich wusste ganz genau, was hier vor sich ging. Die Vorladung, die ich während der letzten Monate befürchtet hatte, war nun schlussendlich eingetroffen. Ich sollte froh darüber sein, dass es so lange gedauert und ich ein paar Wochen Ruhe gehabt hatte.
»Darf ich mich wenigstens noch anziehen?«, fragte ich, worauf Layton sofort zur Garderobe lief.
»Nein«, gab der Anführer zurück. Der Mann trug einen lächerlichen schwarzen, an den Spitzen gekräuselten Schnurrbart.
Ich holte tief Luft und trat dann einen ersten Schritt vor. Just in diesem Moment schloss Layton zu mir auf und warf mir einen schweren Mantel über die Schultern. Insgeheim dankte ich ihm dafür, denn der Wind draußen pfiff eiskalt.
Die Männer nahmen mich in ihre Mitte wie einen zu Zuchthaus verurteilten Gefangenen und geleiteten mich zu der Kutsche, die zu meiner Linken stand. Ich bemerkte, dass mich aus den umliegenden Fenstern zahlreiche neugierige Augenpaare beobachteten – wieder einmal wurde ich meinem rasch erworbenen Ruf gerecht.
Der Anführer stieg als Erster in die Kutsche, um mir den Weg zu versperren, falls ich versuchen sollte, durch den gegenüberliegenden Schlag zu entkommen. Die anderen schoben mich hinterher, und ein zweiter Mann kletterte nach mir hinein. Kaum hatte er den kleinen Schlag geschlossen, setzten wir uns in Bewegung.
Hinter der Kutsche hörte ich, wie der Rabe ein spöttisches Krächzen ausstieß.
2
Gleich an der nächsten Kreuzung trennten sich die beiden Kutschen. Im eindeutigen Bestreben, mögliche Verfolger abzuschütteln, bog die meine mehrfach unerwartet ab, meist ohne jede Logik. Während ein anhaltender Schneeregen auf die Stadt niederprasselte, begriff ich nach einer Weile, dass wir uns in südöstliche Richtung bewegten.
Wir fuhren durch die schmuddligen, engen Nebenstraßen der Old Town, von denen mir einige gänzlich unbekannt waren. Die Kutsche polterte derart über die kopfsteingepflasterten Straßen, dass das Wasser aus den Pfützen aufspritzte, während die Welt um uns herum in Dunkelheit versank. Die Fenster der hoch aufragenden Mietshäuser waren bereits erleuchtet, wodurch ein bernsteinfarbener Schimmer auf ihre nassen, heruntergekommenen Fassaden geworfen wurde.
Es war zwar noch nicht spät, doch angesichts des schmuddeligen Wetters und des zeitigen Sonnenuntergangs waren die Straßen so gut wie menschenleer, allerdings auch nicht in so einem Maße, dass die Durchfahrt unserer Kutsche aufgefallen wäre. Diese Männer hatten sich für ihre Aufgabe den perfekten Zeitpunkt ausgesucht.
Hinter einem mittelalterlich anmutenden Wohnhaus bogen wir ab, und nun sah ich vor uns die kompakte schwarze Silhouette der Salisbury Crags aufragen – recht passend, wenn man bedachte, wem ich gleich gegenüberstehen würde. Wir bogen nach links ab, fuhren weiter nach Osten, und gleich danach war klar, wohin die Reise ging.
Die spitzen Türme von Holyrood Palace kamen in Sicht, wie Dolche zum Himmel weisend. Sie waren nur aufgrund des Lichtscheins auszumachen, der aus ihren Fenstern drang, und ich musste die Augen zusammenkneifen, um die schmiedeeisernen Einfriedungen erkennen zu können, die Ausmaße des öden Vorplatzes und den majestätischen Natursteinbrunnen in seiner Mitte, dessen wasserspeiende Löwen jetzt untätig waren.
Statt den Haupteingang von der geschäftigeren High Street zu nehmen, fuhren wir am südlichen Ende in den Hof. Ich rechnete damit, dass die Kutsche nach rechts abbiegen würde, zum Palast selbst. Doch stattdessen brachte sie mich nach links, zu einem Bogengang, der kaum weniger beeindruckend war als jener der Residenz. Die kleine Festungsmauer führte zu einem lang gezogenen Innenhof mit den Stallungen der Queen.
Die Kutsche kam in der Nähe der nordöstlichen Ecke zum Stehen, vor einem offenen Tor. Von dort kam das einzige Licht, das zu sehen war.
Bevor diese Männer mich herumschubsen konnten, stieg ich aus, hinein in den gnadenlosen Schneeregen und den Gestank von Pferdemist. Sogar aus den Königlichen Stallungen konnte dieser Geruch nicht verbannt werden.
»Dorthin«, beschied mir der Mann mit dem Schnauzbart, obschon ich bereits auf das einzige offene Tor zuhielt. Ich ging eiligen Schrittes, während mir der Graupel in den Nacken prasselte. Dabei sah ich, dass der Boden des Stalls mit einer gleichmäßigen Schicht frischen Strohs bedeckt war. Als ich gerade die Schwelle überschritt, hörten wir eine weitere Kutsche von hinten heranpoltern, und aus dieser drangen alles andere als friedliche Geräusche.
Ihre Pferde tänzelten unruhig, stampften mit den Hufen auf die Steinplatten, und sie schnaubten weiße Dampfwölkchen aus, während der schweißüberströmte Kutscher wie wild die Zügel anzog.
In der Kutsche waren Poltern und Geschrei zu vernehmen, und sie schwankte dermaßen hin und her, als spränge in ihrem Inneren ein wildes Tier von einer Seite auf die andere.
»Oh«, sagte ich, als mir ein Licht aufgegangen war. »Nine-Nails habt ihr also auch geholt.«
Jemand trat den Kutschenschlag auf, und fast im gleichen Moment wurde ein Mann herauskatapultiert und landete auf allen vieren auf dem nassen Boden.
Einem zweiten Mann gelang es, einen Fuß auf den Boden zu setzen. Er zerrte so lange mit aller Kraft an der Person in der Kutsche, bis ihn ein langes Bein, das in unverkennbaren Schottenstoff gekleidet war, voll in den Magen trat. Der Mann fiel rücklings hin und landete auf seinem Gefährten, der gerade im Begriff gewesen war, sich wieder aufzurappeln.
Die beiden Männer, die mich hergebracht hatten, eilten ihnen zu Hilfe, während die zahlreichen Pferde um uns herum nervös zu wiehern begannen. Als die Männer die Kutsche erreichten und sich in das Gerangel einmischten, war ich versucht, mich leise davonzumachen und in der Dunkelheit der Nacht zu verschwinden. Doch dann kamen eine dritte und eine vierte Kutsche an und versperrten den einzigen Ausgang.
Resigniert stieß ich einen Seufzer aus, verschränkte die Arme und starrte auf die Szenerie.
Weitere vier Männer stiegen aus und stürzten zu der schwankenden Kutsche. Zwei öffneten den Schlag auf der anderen Seite, die anderen beiden traten an den mir zugewandten. Die Kutsche wackelte bedenklich, und ich hörte, wie Schläge klatschten, Räder und Achsen des Gefährts knarrten, Männer aufschrien, und schließlich vernahm ich die halb erstickte Stimme von Detective Adolphus »Nine-Nails« McGray.
»Och – ihr … Saftärsche!«
Schließlich sah ich zwei Männer aussteigen, von denen jeder ein zappelndes, in Karostoff gekleidetes Bein gepackt hatte, denen McGrays nicht dazu passendes kariertes Wams folgte. Er wand sich wie ein in einem Netz herumzappelnder Lachs, während drei weitere Männer alle Hände voll damit zu tun hatten, seinen Oberkörper festzuhalten. Obwohl seine Hände gefesselt waren, gelang es ihm, wahllos um sich zu schlagen. Mit einem seiner Hiebe traf er einen der Männer direkt auf die Nase, worauf das Blut in alle Richtungen spritzte.
»Hände immer auf den Rücken binden«, kommentierte ich in unerschütterlich englischem Tonfall. »Nie nach vorn. Ihr Idioten.«
Der schnauzbärtige Anführer – ich werde ihn fortan Boss nennen, da ich seinen Namen nie erfuhr – trat mit schnellen, entschlossenen Schritten auf Nine-Nails zu, zog einen Revolver und richtete den Lauf direkt auf seine Stirn.
»Nun reicht es, Bürschchen. Ich habe Anweisung, Sie zu erschießen, wenn es nötig ist.«
Da Nine-Nails Wut mächtiger war als der Anblick einer Waffe direkt vor seinen Augenbrauen, benötigte er einen Moment, um sich zu beruhigen. Nach wie vor zappelte er wütend und schnaubte herum, gestattete es den Männern jedoch zumindest, ihn auf den Boden zu stellen und in meine Richtung zu führen. Sein Kopf überragte den aller anderen deutlich, und auch mit seinen breiten Schultern hob er sich ab. Mir fiel auf, dass er nicht wie sonst seinen mottenzerfressenen Mantel trug, worauf ich mir vorstellte, dass die Männer in sein Haus eingedrungen sein und ihn aus seinem unaufgeräumten Bücherzimmer gezerrt haben mussten. Von seiner Stirn, an der ihm sein dunkles Haar klebte, tropften Schneeregen und Schweiß, und seine ungepflegten Bartstoppeln waren mit Dreck und Blut verschmiert – dem Blut der anderen Männer, wohlgemerkt, nicht sein eigenes.
Just in dem Moment, als seine Entführer das erste Mal erleichtert den Atem ausstießen, hob McGray beide Hände und brach mit einem raschen, präzise ausgeführten Schlag dem Mann zu seiner Rechten die Nase (bekäme ich doch bloß einen Schilling für jeden Knochen, den er in der relativ kurzen Zeit, in der ich für die schottische Polizei arbeitete, vor meinen Augen gebrochen hatte).
Wimmernd fiel der Mann rücklings hin, nur um sofort von einem seiner Gefährten ersetzt zu werden.
»Tun Sie das nur noch ein Mal …«, brüllte Boss und presste den Lauf der Waffe nun gegen McGrays Schläfe.
Sie führten uns in die Stallungen hinein, die von einer einzelnen Hängelampe beleuchtet wurden. Die Pferde standen in zwei Reihen, allesamt nervös in ihren Boxen tänzelnd und schnaubend. Die beiden blutenden Männer eilten ungelenk voraus und schoben mit den Füßen zwei schmutzige Holzkisten in unsere Richtung.
»Nehmen Sie Platz, Sirs«, sagte Boss, worauf seine Männer uns sofort nach unten drückten.
McGray spuckte Blut auf das Stroh, wischte sich den Mund mit den gefesselten Händen ab und warf mir einen höchst vorwurfsvollen Blick zu.
»Jetzt schau sich mal einer an, wie hübsch und geschniegelt Sie aussehen! Bestimmt haben Sie denen auch noch Tee und Kekse und eine Fußmassage angeboten.«
Ich verspürte einen Luftzug und schlug daher den Pelzkragen meines Mantels hoch.
»Dazu haben die mir keine Zeit gelassen«, erwiderte ich und wandte mich Boss zu. »Können wir Ihnen in irgendeiner Form behilflich sein, Gentlemen?«
»Sie können die Klappe halten!«, rief er herablassend und gab dann einem der beiden mit den gebrochenen Nasen ein Zeichen, worauf der Mann, so schnell er konnte, davonhumpelte.
Schweigend warteten wir. Das einzige Geräusch war das gelegentliche Wiehern oder Schnauben eines Pferdes, bis wir schließlich in der Ferne eine barsche Männerstimme vernahmen.
Wenig später betrat eine bekannte Gestalt die Stallungen. Der Mann war korpulent und nicht allzu groß und in einen schwarzen Mantel gehüllt. Ihm folgte ein junger Mitarbeiter, der sich damit abmühte, einen Stapel Akten zu tragen und gleichzeitig einen schwarzen Schirm über seinen Herrn zu halten.
Ich konnte mir durchaus zusammenreimen, warum wir hierhergeschleppt worden waren, war dann aber doch schockiert, als ich dieses Gesicht aus der Dunkelheit auftauchen sah.
Lord Salisbury. Der Premierminister.
Mit seinem drahtigen, buschigen Bart, seiner Glatze und seinen feinen, kaum existierenden Augenbrauen sah er noch genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Die Tränensäcke waren stärker angeschwollen, doch seine kleinen Augen blickten nach wie vor absolut durchdringend. Augen, die ich nur wenige Zentimeter vor den meinen gesehen hatte, vor einem guten Jahr, in London, bei etwas, das mir jetzt vorkam wie ein ferner Traum aus einem anderen Leben.
Er paffte an einem Zigarrenstumpen und starrte uns dabei mit einem leisen Anflug von Befriedigung an. Im nächsten Moment erfüllte seine dröhnende Stimme das Gebäude.
»Wann bietet ihr faulen Schwachköpfe mir endlich einen Sitzplatz an?«
Augenblicklich brachte ihm einer der Männer einen mit Schnitzwerk versehenen Stuhl aus der Dunkelheit.
Mit einem Grunzlaut nahm der Premierminister darauf Platz, reichte seinem dürren jungen Gehilfen seinen Gehstock und starrte uns zornig an, ohne auch nur zu blinzeln. Nach einer Weile machte ich Anstalten, ihn zu begrüßen, doch Nine-Nails kam mir zuvor.
»Machen Sie jetzt noch mal den Mund auf, oder haben Sie uns bloß herbringen lassen, damit wir Ihr Sackgesicht anstarren? Wer zum Teufel sind Sie überhaupt?«
Ich stieß einen Seufzer aus und legte mir eine Hand über die Augen. »Ich sollte wohl das Vorstellen übernehmen. Sir, das ist Adolphus McGray. McGray, das ist Robert Gascoyne-Cecil, dritter Marquis von Salisbury – und Premierminister des Vereinigten Königreichs.«
Lord Salisbury deutete ein Lächeln an, bei dem er die Zähne fletschte. Dabei kaute er weiter auf seinem Zigarrenstumpen herum.
McGray wirkte durchaus ein wenig betreten. Allerdings bloß einen Moment, bevor er mir zuflüsterte: »Er sieht wirklich aus wie ein Sack.«
»McGray!«
»Tut er aber!«
»Oh, nun halten Sie die Klappe!«, schnauzte ihn der Premierminister an, und als wäre es ihm aufgetragen worden, versetzte Boss McGray einen Hieb auf den Hinterkopf. »Ihr wisst doch, warum wir alle hier sind.«
Natürlich wussten wir es.
Auch wenn McGray eine Weile darum hatte kämpfen müssen, seine absurde Unterabteilung bei der Polizei ins Leben zu rufen – die Kommission zur Aufklärung ungelöster Fälle mit mutmaßlichem Bezug zu Sonderbarem und Geisterhaftem, die sich einzig und allein seinem lächerlichen Interesse am Übernatürlichen widmete –, war die Abteilung lediglich genehmigt worden, um als praktischer Vorwand zu dienen, damit der Premierminister einen äußerst heiklen Fall in Schottland ohne öffentliche Kontrolle untersuchen lassen konnte. Angeblich hatte Lord Salisbury unsere Unterabteilung für den Fall, dass er erneut eine solche Rückendeckung brauchen würde, nicht aufgelöst (und McGray und mich in Edinburgh postiert). Nine-Nails und ich wussten es besser und waren uns sicher, dass der Mann von Anfang an ein sehr spezielles Problem im Auge gehabt hatte.
McGray, dem mit Sicherheit das Gleiche durch den Kopf ging, gluckste. »Machen Ihnen die Hexen wieder Scherereien?«
»Nicht nur die«, erwiderte der Premierminister und spuckte aus, was von seiner Zigarre übrig geblieben war, worauf der Stummel im feuchten Stroh erlosch. Er zündete sich eine neue Zigarre an und paffte mehrmals daran, bevor er uns den entscheidenden Hieb versetzte. »Ihre Majestät die Königin will Ihren Tod. Ihrer beider Tod.«
3
Mir waren schon unverschämte, grausige, tragische und unglaubwürdige Nachrichten übermittelt worden. Diese nun aber traf bei mir einen Nerv, von dessen Existenz ich gar nichts gewusst hatte. Ich vernahm die Worte, ich begriff sie, doch es war trotzdem so, als wären sie mir in einer mir fremden Sprache übermittelt worden. Nine-Nails schien es ebenso zu gehen, und so saßen wir beide eine ganze Weile lang nur sprachlos und mit offenem Mund da.
Als wir die Sprache wiedergefunden hatten, kam uns gleichzeitig »Scheiße!« und »Sie machen wohl Witze!« über die Lippen.
McGray lehnte sich zurück und vergrub sein Gesicht in den Händen, während ich spürte, wie sich in mir eine Eiseskälte ausbreitete.
»Die Lancashire-Affäre …«, murmelte ich. »Bestimmt hat die Queen …«
»Ihre Majestät wünscht mit dem verstorbenen Prince Consort und ihren beiden toten Kindern zu sprechen«, unterbrach mich Lord Salisbury. »Sie behauptet, dies seit dem Tod ihres Mannes an jedem Weihnachtsabend getan zu haben. Sie hat sich diesbezüglich der Dienste von Hexen bedient, und Sie beide haben nun einmal die beiden Hexen getötet, die ihr am vertrautesten waren.«
Ich deutete mit dem Kopf auf McGray. »Er. Er hat sie getötet. Er hat beide innerhalb weniger Minuten umgebracht.«
Nine-Nails machte Anstalten, mir einen Hieb zu versetzen, doch ich konnte dem Schlag gerade noch ausweichen. »Was? Sie wären jetzt tot, wenn ich es nicht getan hätte, Sie undankbarer Kerl!«
»Bevor Sie sich hier weiter zanken wie ein altes Ehepaar«, sagte Lord Salisbury in einem solchen Tonfall, dass sogar die Pferde verstummten, »müssen Sie mir genau erzählen, was in Lancashire vorgefallen ist.« Er hob die Hand, worauf ihm sein verschreckter Gehilfe eine dicke Akte reichte. »Meinen Kontaktleuten ist es zwar gelungen, die wichtigsten Fakten zusammenzutragen, aber ich will die Details erfahren. Erzählen Sie mir absolut alles.«
McGray gluckste. »Bitten Sie diesen Dandy nicht, Ihnen Details zu liefern. Sonst erzählt er Ihnen noch, wie viele verfluchte Scones er jeden Tag zum Frühstück verdrückt.«
Lord Salisbury starrte ihn mit nackter, purer Wut an, während sein linkes Lid zuckte.
»Alles begann am Neujahrstag«, brachte ich hastig hervor. »Wir wurden zur städtischen Irrenanstalt gerufen, wo sich eine Pflegerin in Qualen wand.«
»In Qualen wand?«, wiederholte er.
»So ist es. Sie war vergiftet worden, ausgerechnet von dem Patienten, den sie betreut hatte. Wie sich zu unserem blanken Entsetzen herausstellte, war dieser Patient …«
McGray räusperte sich so laut, dass ich schon glaubte, er würde sich erbrechen. Ich erinnerte mich an die düsteren Details des Falles, bei dem einige seiner eigenen Verbindungen kompromittiert worden waren. Ich sollte wohl besser nur das Allernötigste preisgeben.
»Zu unserem blanken Entsetzen«, fuhr ich fort, »war dieser Patient von dieser Bande sogenannter Hexen in den Wahnsinn getrieben worden. Es stellte sich heraus, dass die Schwester, deren Tod wir mit ansahen – sie hieß Greenwood –, selbst eine Hexe war und dem Mann sorgsam dosiert Betäubungsmittel verabreicht hatte, damit er umnachtet blieb. Dabei half ihr eine weitere junge Frau – man könnte sie Hexen-Novizin nennen – namens Oakley. Wir folgten den Spuren des Patienten …«
»Wie hieß der Patient?«, erkundigte sich Lord Salisbury, während sein Gehilfe einen Schreibstift zückte, um den Namen zu notieren.
Während mir der Name Joel Ardglass laut im Kopf dröhnte, trieb mir der Gedanke an dessen Verbindung zu einer ganz besonderen Freundin und Feindin von McGray den Schweiß auf die Stirn. Die Verwicklung seiner Tochter Caroline … Ich konnte nicht lügen. Ich konnte nicht …
»Haben wir nie erfahren«, sprang McGray mit breitestem schottischem Akzent ein.
»Sie haben nie was?«, blaffte ihn der Premierminister an.
»Och, tut mir leid. Wir – ha-ben – es – nie – er-fah-ren. Er stammte aus einer dieser allmächtigen Inzuchtfamilien von Oberschichttrotteln. Wie Sie. Seine Verwandten haben ihn heimlich, still und leise dorthin abgeschoben.«
Bis dahin stimmte alles. Dann folgte die Lüge.
»Selbst der Anstaltsleiter kannte seinen echten Namen nicht.«
»Sie gaben ihm den Spitznamen Lord Bampot«, warf ich eilig ein, denn der Premierminister zog bereits skeptisch die Brauen hoch. »Wie gesagt, wir hefteten uns an seine Fersen und konnten ihn bis nach Lancaster verfolgen.«
»Wo Sie dann auf ein Nest des Hexenzirkels stießen«, vervollständigte Lord Salisbury, während er seine Akte durchblätterte. »Und auf ein Lagerhaus voller … wie sollen wir es nennen?«
»Hexerei-Artikel«, erwiderte McGray, ohne rot zu werden. »Zutaten für Tränke, Gifte, Kräuter, Amulette und dergleichen.«
»Wenige Wochen später stellten wir fest, dass das Lagerhaus leergeräumt worden war«, fügte ich hinzu. Der Premierminister starrte auf seine Akte und kniff dabei die Lippen zusammen.
»Ich weiß«, sagte er schließlich. »Ich musste das genehmigen.«
»Sie haben was?« schrie Nine-Nails mit peitschender Stimme. Der Premierminister zuckte nicht einmal mit der Wimper.
»Fahren Sie fort«, beschied er mir.
Ich räusperte mich. »Lord Bampot tötete einen in Lancaster Castle inhaftierten Mann, der früher einmal als Diener tätig gewesen war für die – sollen wir sie vielleicht anders nennen als …?« Sowohl Nine-Nails als auch der Premierminister warfen mir ungeduldige Blicke zu, worauf ich nur die Augen verdrehen konnte. »Also schön. Die überlebenden Hexen flohen ins südliche Lancashire, nach Pendle Hill, wo sich ihr Hauptunterschlupf befand. Wir gerieten in eine … Auseinandersetzung. Lord …« – fast wäre mir der Name Ardglass herausgerutscht – »Lord Bampot wurde ermordet, und bei dieser Gelegenheit hat Inspector McGray die beiden Oberhexen getötet – diejenigen, um die es hier geht, vermute ich –, sodass uns die Flucht gelang.«
»Haben Sie auf sich alleine gestellt gehandelt?«, erkundigte sich der Premierminister.
Als mir wieder einmal der Name Caroline Ardglass in den Sinn kam, verspürte ich ein Stechen in der Brust. Erneut beschloss ich, mich nur an die grundlegenden Fakten zu halten.