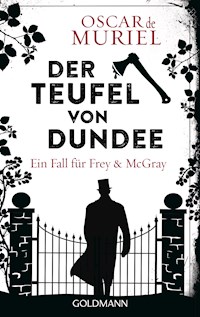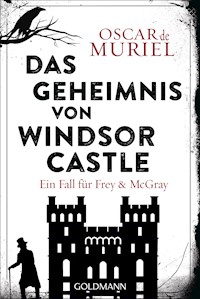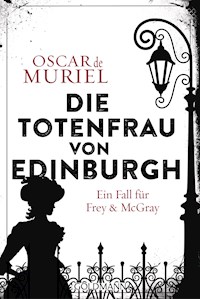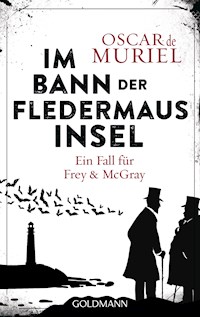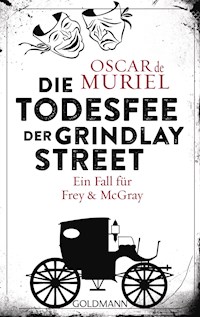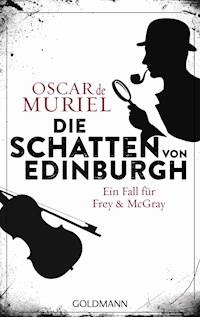
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Frey und McGray
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Edinburgh, 1888. Der begnadete Ermittler Ian Frey wird von London nach Schottland zwangsversetzt. Für den kultivierten Engländer eine wahre Strafe. Als er seinen neuen Vorgesetzten, Inspector McGray, kennenlernt, findet er all seine Vorurteile bestätigt: Ungehobelt, abergläubisch und bärbeißig, hat der Schotte seinen ganz eigenen Ehrenkodex. Doch dann bringt ein schier unlösbarer Fall die beiden grundverschiedenen Männer zusammen: Ein Violinist wird grausam in seinem Heim ermordet. Sein aufgelöstes Dienstmädchen schwört, dass es in der Nacht drei Geiger im Musikzimmer gehört hat. Doch in dem von innen verschlossenen, fensterlosen Raum liegt nur die Leiche des Hausherren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Ähnliche
Buch
London, 1888. Jack the Ripper fordert ein weiteres Opfer. Daraufhin wird der begnadete Inspector Ian Frey zusammen mit seinem Vorgesetzen aus dem Dienst des Scotland Yard entlassen. Doch als ein Violinist grausam in Edinburgh ermordet wird, die Kehle durchgeschnitten, der Bauch aufgeschlitzt, bittet Premierminister Lord Salisbury Frey, in Schottland zu ermitteln. Er befürchtet Ripper-Nachahmer, die im gesamten Königreich Panik auslösen könnten. Für den kultivierten Engländer ist diese Versetzung eine wahre Strafe – schließlich sind die Schotten ein ungehobeltes Pack. Als er seinen neuen Vorgesetzten, Inspector McGray, kennenlernt, findet er all seine Vorurteile bestätigt: Extrem abergläubisch und bärbeißig hat der Schotte seinen ganz eigenen Ermittlungsstil. Doch der schier unlösbare Fall bringt die beiden grundverschiedenen Männer zusammen: Denn das völlig aufgelöste Dienstmädchen des toten Geigers schwört, dass es in der Nacht drei Musiker im Musizierzimmer gehört hat. Doch in dem von innen verschlossenen, fensterlosen Raum fand man nur die Leiche des Hausherrn …
Autor
Oscar de Muriel wurde in Mexico City geboren und zog nach England, um seinen Doktor zu machen. Er ist Chemiker, Übersetzer und Violinist und lebt heute in Cheshire. Mit seiner viktorianischen Krimireihe um das brillante Ermittlerduo Frey und McGray feiert er in seiner neuen Heimat und darüber hinaus große Erfolge.Oscar de Muriel im Goldmann Verlag:Die Schatten von Edinburgh. Ein Fall für Frey & McGray (Band 1)Der Fluch von Pendle Hill. Ein Fall für Frey & McGray (Band 2)Die Todesfee der Grindlay Street. Ein Fall für Frey & McGray (Band 3)Im Bann der Fledermausinsel. Ein Fall für Frey & McGray (Band 4)Die Totenfrau von Edinburgh. Ein Fall für Frey & McGray (Band 5)Das Geheimnis von Windsor Castle. Ein Fall für Frey & McGray (Band 6)
OSCAR DE MURIEL
Die Schattenvon Edinburgh
Roman
Aus dem Englischenvon Peter Beyer
Die englische Originalausgabe erschien 2015unter dem Titel »The Strings of Murder«bei Penguin Books Ltd., England.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Februar 2017Copyright © der Originalausgabe 2015 by Oscar de MurielCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenCovergestaltung: UNO Werbeagentur, MünchenCovermotiv: FinePic®, MünchenRedaktion: Eva WagnerSatz: DTP Service Apel, HannoverISBN 978-3-641-18695-1V006
www.goldmann-verlag.de
Das Erste ist für die Picuitäubchen
Oh, könnte ich doch nur einen kurzen Tag teilhaben an den geheimen Künsten der Götter, ein Gott ich selbst, im Sehen und im Hören verzückten Menschseins; und dadurch, das Geheimnis von Orpheus’ Leier entschlüsselt oder eine Sirene in meiner Geige bergend, Sterbliche zu meinem eignen Ruhme fördern!
Madame Blavatsky, Unheimliche Geschichten
Prolog
23. Juni 1883
Dr. Clouston konnte sich kaum auf dem Sitz halten. Die Räder der Kutsche holperten ständig krachend über Unebenheiten und durch Pfützen, und das Gepolter durchbrach die Stille der Nacht, während sie wie wild gen Dundee fuhren.
Während der Fahrt war er mehrfach mit dem Kopf gegen das Dach der Kutsche geprallt. Doch die körperlichen Umstände waren eine Lappalie im Vergleich zu seiner Gemütsverfassung. Die Nachricht, die er erhalten hatte, war zu furchtbar, zu ungeheuerlich, als dass er sie hätte begreifen können, und Clouston bemühte sich mit aller Macht, den winzigen Hoffnungsfunken am Glimmen zu halten.
Immerhin, so redete er sich ein, hatte er lediglich ein überstürzt verfasstes Telegramm gelesen, das der Diener ihm geschickt hatte, und der alte George hatte immer schon einen Hang zur Übertreibung gehabt. Er fingerte in seiner Brusttasche nach dem zerknüllten Stück Papier. Es waren nur einige wenige, inzwischen verschmierte Zeilen, doch sie enthielten die Worte durchgedreht, plötzlich, tot und die Namen jedes einzelnen Mitglieds der Familie McGray. Wie konnte ein so kleines Stückchen Papier eine so grauenhafte Nachricht übermitteln?
Clouston schauderte erneut. Er versuchte, auf andere Gedanken zu kommen, indem er aus den Fenstern schaute. Doch vergebens – am Himmel hingen dichte Wolken und tauchten die Straße in abgrundtiefe Finsternis. In den letzten Stunden seiner Reise zog er es sogar vor, sich auf das Holpern der Kutsche und seine dadurch verursachte leichte Übelkeit zu konzentrieren.
Als er das Gefühl hatte, schon seit Ewigkeiten unterwegs zu sein, tauchte endlich das große Landhaus vor ihnen auf. Die sommerliche Morgenröte warf bereits einen ersten hellen Schimmer auf die Felder, doch war es immer noch so dunkel, dass Clouston durch eines der Fenster des Hauses das rötliche Glühen eines Feuers erkennen konnte.
Kaum war die Kutsche zum Stehen gekommen, machte Clouston selbst die Tür auf und sprang auf den schlammigen Boden. Die Pferde schnaubten und wieherten. Dies und das Geklapper der Hufe waren die einzigen Geräusche, die er vernahm.
»Welch fröhlicher Anblick«, murmelte er. Thomas Clouston war ein stämmiger Mann mittleren Alters. Seit zehn Jahren war er ärztlicher Leiter der Königlichen Irrenanstalt von Edinburgh, und diese Stellung war nichts für Zartbesaitete.
Entschlossen strebte er auf das Haus zu, und im gleichen Augenblick riss jemand die Eingangstür auf. Zwei Gestalten traten heraus, um ihn zu begrüßen. Er erkannte sofort die beiden einzigen Bediensteten, die die McGrays auf ihren Sommerreisen begleiteten – George und Betsy, beide schon betagt und von der Arbeit auf dem Land verhärmt.
Ihre Gesichter wurden von einer einzelnen Kerze beleuchtet, die die bucklige Betsy mit ruhiger Hand hielt. Als er näher trat, sah Clouston, dass ihr das heiße Wachs auf die Finger tropfte.
»Um Himmels willen, benutzen Sie doch einen Kerzenleuchter!«
»Ist schon gut, Sir«, erwiderte sie mit ihrem schweren schottischen Akzent.
»Wie gut, dass Sie gekommen sind, Sir!«, sagte George. Er hatte dunkle Ringe unter den Augen, und sein schütteres graues Haar stand ihm wirr vom Kopf ab. »So früh hatten wir gar nicht mit Ihnen gerechnet. Gott segne Sie! Bitte kommen Sie herein …«
Tatsächlich war Clouston gar nicht erst stehen geblieben, sondern hatte die Türschwelle bereits überschritten. »Wo sind sie?«, drängte er.
Der eiskalte dunkle Flur erinnerte ihn an eine Gruft. Aus dem angrenzenden Salon, jenem einzigen beleuchteten Zimmer, das Clouston von der Straße aus gesehen hatte, drang nur schwaches Licht. Die Tür stand einen Spaltbreit auf.
»Wir haben sie dort aufgebahrt«, erklärte George im Flüsterton, so als befürchtete er, sie aufzuwecken.
Als Betsy die knarrende Tür langsam aufschob und ihn eintreten ließ, schluckte Clouston. Er sah, dass nur ein armseliges Holzscheit im Kamin brannte und flackernde Schatten in alle Richtungen warf … Und dann setzte sein Herz einen Schlag aus.
Direkt vor dem Kamin standen zwei Holzsärge. Ihre Silhouetten zeichneten sich gegen das schwache Glühen des Feuers ab.
»Allmächtiger …«, stieß Clouston hervor. Mit zögernden Schritten trat er näher. Der kalte Hauch der Angst machte sich in seiner Brust breit.
Erst als er in die offenen Särge spähte, glaubte er das, was George ihm bereits mitgeteilt hatte. Der Anblick war dermaßen schockierend, dass sich Clouston unwillkürlich die Hand vor den Mund hielt und gegen einen plötzlichen Würgereiz ankämpfte. Einen Moment herrschte nur gähnende Leere in seinem Kopf. Verzweifelt bemühte er sich zu begreifen, was er vor Augen hatte.
»Und … wann … ist es passiert?«, stieß er schließlich mit einem dicken Kloß im Hals hervor.
»Gestern Abend«, stöhnte George geradezu. »Der Leichenbestatter hat sie vor zwei oder drei Stunden hergerichtet.«
Clouston nickte und holte dann tief Luft. Das half ihm immer. »Waren Sie es, der nach dem Leichenbestatter geschickt hat?«
»Nein. Das hat der junge Adolphus getan«, erwiderte George und wischte sich rasch die Tränen ab, die er nicht mehr zurückhalten konnte. »Herrjeh! Der arme Bursche … Weiß nicht, wo er die Kraft hernimmt; er hat den Bestatter geholt, den ganzen Papierkram geregelt … er hat sich sogar selbst die Wunde verbunden, nachdem …«
Sichtlich schaudernd verstummte George.
»Er ruht sich gerade aus«, fügte Betsy hinzu, »falls man das überhaupt ausruhen nennen kann …«
»Ich muss ihn sprechen«, sagte Clouston sofort, worauf George und Betsy ihn in ein nahe gelegenes Arbeitszimmer führten – jenes, das dem mittlerweile verstorbenen Vater gehört hatte, James McGray.
Behutsam öffnete George die Tür, bemüht, seinen jungen Herrn nicht zu stören. Betsy trat ein, in der Hand die Kerze, die sie gerade auf eine schmutzige Untertasse gesteckt hatte. Clouston entriss ihr das Licht und ging vorsichtig vorwärts.
Als er den unglückseligen jungen Mann auf einer zerschlissenen Couch liegen sah, wurde ihm das Herz noch schwerer. Der hoch aufgeschossene, kräftig gebaute Sohn der McGrays lag dort so, als sei auch er tot. Seine Wangen waren leichenblass, und die Ringe unter seinen Augen waren fast so rot wie eine offene Wunde. Der junge Adolphus atmete in tiefen, gequält klingenden Zügen, und seine Augäpfel bewegten sich wie wild unter den Lidern hin und her. Ab und zu mahlte sein Kinn, und seine Hände zuckten. Diese Art von Schlafstörung hatte Clouston zwar schon bei zahllosen Patienten gesehen, doch er hatte sich nicht einmal im Traum vorstellen können, McGrays Sohn, der sonst so stattlich und frohgemut war, einmal derart gebrochen zu erblicken.
»Ich glaube nicht, dass er jemals wieder gut schlafen kann«, flüsterte Clouston. »Hoffentlich irre ich mich …«
Adolphus’ Hand zuckte erneut. Erst jetzt sah Clouston den dicken Verband an der Hand. Als er die Kerze näher heranhielt, erkannte er, dass der Mull feucht und fleckig war und dass sich an den Rändern dunkle Stellen halb getrockneten Bluts befanden. Es sah so aus, als habe Adolphus beim Tragen der Särge mitgeholfen.
»Sie müssen ihm den Verband wechseln«, blaffte Clouston.
»Ach, lieber nicht, Sir«, sagte Betsy rasch. »Der arme Junge hat nicht geschlafen, seit es passiert ist. Erst als die Särge ankamen, ist er hier zusammengebrochen …«
»Gute Frau, er braucht einen frischen Verband! Das Letzte, was der Bursche jetzt braucht, ist eine infizierte Hand!«
Betsy knickste ungelenk und verließ das Zimmer, wobei sie umhertastete, um nicht in der Dunkelheit zu stolpern.
Clouston wandte sich George zu und stellte ihm die Frage, deren Antwort er am meisten fürchtete: »Wo ist das Mädchen?«
Aus dem Gesicht des Butlers wich die wenige Farbe, die ihm geblieben war. »Wir … wir mussten sie einsperren, Doktor. Sie ist vollkommen durchgedreht!«
Clouston klopfte dem Mann auf die Schulter. »Sie brauchen deswegen keine Schuldgefühle zu haben. Sie haben getan, was Sie tun mussten.«
»Aber, Sir …« George fing jämmerlich an zu weinen und zitterte nun am ganzen Körper. Der Kummer zerfurchte ihm das Gesicht. »Miss McGray! Unsere Miss McGray! Unser kleines Mädchen …«
In Tränen aufgelöst kehrte Betsy mit sauberen Verbänden zurück. Bemüht, ihre Trauer zu verbergen, eilte sie auf Adolphus zu.
Clouston war klar, dass er das Schlimmste noch nicht gesehen hatte. Er folgte George hinauf, wo die aufgehende, doch immer noch trübe Sonne durch eine gesprungene Fensterscheibe fiel und einen langgezogenen Flur beleuchtete. Sämtliche Zimmertüren waren zu, doch im Schloss der letzten Tür steckte ein Schlüssel.
»Wie haben Sie es geschafft, sie hier einzuschließen?«
»Ach Sir, das haben wir gar nicht! Selbst zwei Gärtner, der Constable und ich konnten sie nicht bändigen. Nein, sie ist selbst auf ihr Zimmer gerannt, und als sie einmal drinnen war, konnten wir sie einschließen. Niemand bekam sie in den Griff; Sie haben ja gesehen, was das Mädchen angerichtet hat!«
Allein der Gedanke an den blutigen Verband, den Betsy gerade wechselte, ließ Clouston schaudern. Schlussendlich war alles tatsächlich so schlimm, wie George es in seinem Telegramm geschildert hatte.
Als Clouston Anstalten machte, die Hand auszustrecken, um den Schlüssel umzudrehen, machte George einen Satz nach vorn und ergriff seinen Arm.
»Wollen Sie da einfach hineingehen? Einfach so? Ich sage Ihnen, Sir, das Mädchen ist …«
Hätte es sich um jemand anders gehandelt, hätte Clouston ihn schlicht beiseitegeschoben. Stattdessen klopfte er George beruhigend auf den Rücken und entzog ihm sanft seine Hand.
»Mein guter George, ich hatte es in meiner Laufbahn schon mit äußerst betrüblichen Dingen zu tun. Glauben Sie mir, ich kann mit dieser Angelegenheit umgehen.«
Einen Moment lang rührte sich George nicht. Als Clouston jedoch begann, den Schlüssel langsam zu drehen, trat der alte Butler sofort zurück.
Clouston öffnete die Tür gerade so weit, dass er hineingehen konnte. Plötzlich wehte es ihm eiskalt ins Gesicht. Als er eingetreten war, schloss er die Tür hinter sich. Kaum hatte er das Einklinken des Riegels vernommen, fühlte er sich sonderbar verletzlich. Im Schlafzimmer war es so ruhig, dass er das Sausen in seinen Ohren als anhaltenden Lärm vernahm.
Das nach Osten hinausgehende Fenster stand weit offen, und der düstere Himmel der Morgendämmerung war das Erste, was Clouston erblickte. Inmitten der Dunkelheit konnte er die schlanke Gestalt von Amy McGray ausmachen.
Sie saß zusammengekauert auf dem Bett und wiegte sich langsam vor und zurück. Ihr weißes Sommerkleid leuchtete in dem trüben Morgenlicht. Schon ein erster Blick verriet ihm, dass die arme Sechzehnjährige rettungslos verloren war. Der fließende helle Stoff, der Amys Brust, Bauch und Beine bedeckte, war blutverschmiert.
Clouston rang nach Luft. Im Glauben, sie sei verletzt, trat er auf sie zu. Doch als er bemerkte, dass sie ein Messer in der Hand hielt, dessen Klinge in der Sonne glänzte, blieb er augenblicklich stehen.
Clouston vermutete, es müsse sich um das Hackbeil handeln, das Betsy in der Küche zum Durchtrennen von Knochen verwendete. Das Mädchen strich mit seinen dünnen bleichen Fingern sanft über die Klinge. Ihre Hände waren verschmiert mit trockenem Blut, das nun allmählich abbröckelte.
Clouston hätte auf die Knie sinken und weinen können. Dies war das Mädchen, das letzte Weihnachten die schönsten Weihnachtslieder gespielt hatte, das Mädchen, dem Whisky-Fudge noch immer ein Lächeln auf das Gesicht zauberte, das Mädchen, das selbst seinem griesgrämigen Vater – Gott hab ihn selig – bloß mit einer verspielten Umarmung ein Lächeln entlocken konnte. Ihre Eltern und ihr Bruder nannten sie Pansy, Stiefmütterchen, weil ihre großen, fast schwarzen, von langen Wimpern umrahmten Augen sie den Lieblingsblumen ihrer Mutter ähneln ließ.
Gegenwärtig aber ähnelte sie eher einem Gespenst als einer Blume. Mit stechendem und doch irgendwie abwesendem Blick starrte sie das Hackmesser forschend an. Clouston musste unwillkürlich an eine unheimliche Porzellanpuppe denken und war gezwungen, alle Kraft aufzubringen, die ihm die Routine von mehr als zwanzig Jahren verlieh. Erneut holte er tief Luft und trat näher. Erst als er die Hand ausstreckte, fiel ihm auf, wie sehr er zitterte.
»Amy …«, sagte er, so liebevoll er konnte, »gib mir das Messer …« Sie gab keine Antwort. »Bitte, gibst du mir …«
Nun rührte sich Pansy, doch nur, um ihm den Rücken zuzudrehen. In ihren glasigen Augen spiegelte sich das Sonnenlicht, und Clouston bemerkte, dass sie dehydriert war; höchstwahrscheinlich hatte sie seit fast zwei Tagen weder gegessen noch getrunken. Immer wieder strich sie langsam über die Klinge … so sanft, dass sie sich nicht damit in ihre zarte Haut schnitt.
Mit pochendem Herzen trat Clouston noch einen Schritt näher. Er musste zweimal schlucken, bis ihm seine Stimme gehorchte.
»Pansy …«, flüsterte er, auf ihren familiären Spitznamen zurückgreifend. »Gib es mir, bitte. Betsy braucht es in der Küche.«
Das Hin- und Herwiegen hörte auf. Pansy drehte sich um, richtete sich auf dem Bett auf und schaute Clouston an. Ihr Blick war nun nicht mehr abwesend; ihre Augen, so dunkel wie ein tiefer Brunnen, brannten vor unerklärlicher Wut.
»Sie glauben, ich sei verrückt …«, fauchte sie. Dann hob sie langsam den Arm und schwang das Hackmesser. Ihre Pupillen weiteten sich, und der Wahn nahm Besitz von ihr.
Clouston wich nicht zurück – nicht einmal, als er sah, dass das Mädchen die Waden anspannte und im Begriff war, einen Satz nach vorn zu machen.
»Gib es mir«, beharrte er höflich, aber bestimmt. Bis zum heutigen Tag hatte sich noch nie ein Patient gegen ihn durchsetzen können. »Betsy wird dich zurechtmachen … und dann machen wir dir etwas zu essen …«
»Ich bin nicht verrückt!«, murmelte sie, während sich ihre Brust hob und senkte. »Was mir passiert ist, war viel schlimmer …«
Eine tiefe Stille trat ein, durchbrochen nur vom Rascheln der Vorhänge in der morgendlichen Brise. Und dann lachte sie. Es waren die bösartigsten Laute, die Clouston jemals von einem Menschen vernommen hatte – ein jenseitiges, schrilles Lachen, das immer lauter wurde und ihm durch Mark und Bein fuhr.
»Was ist denn?«, fragte Clouston, ohne von der Stelle zu weichen. »Ich kann dir helfen!«
Pansy holte tief Luft und gab die letzten Worte von sich, die die Welt jemals aus ihrem Mund vernehmen sollte.
»Es ist der Teufel …«
Dann stieß sie ein gequältes, durchdringendes Heulen aus und stürzte sich auf den erschrockenen Arzt.
1
Der vielleicht beste Moment, meine Erzählung zu beginnen, ist der Abend des 9. November 1888. Der Tag, an dem meine Welt Stück für Stück einstürzte.
Ich hatte soeben eine dringende Nachricht von Commissioner Sir Charles Warren erhalten, dem Leiter von Scotland Yard. Darin bat er mich, ihn in der ersten Bankreihe der St.-Pauls-Kathedrale zu treffen.
Ganz so überraschend kam diese Nachricht nicht, denn wir befanden uns in einer Phase des Umbruchs. London bereitete sich darauf vor, die Amtseinführung eines neuen Bürgermeisters zu zelebrieren, doch die festliche Stimmung sollte sich schon bald trüben. Mir war zu Ohren gekommen, dass Jack the Ripper am Morgen einen weiteren Mord verübt hatte, jedenfalls deuteten die letzten Berichte darauf hin. Ich ging davon aus, dass Warrens ungewöhnliche Vorladung damit zu tun haben musste – und sollte mich damit nur zum Teil täuschen.
Meine Kutsche brachte mich in einer mir ewig lang vorkommenden Fahrt vom Hauptquartier von Scotland Yard nach St. Paul’s. Es war ein verregneter Tag gewesen, sodass die Straßen verschlammt waren und die Kutscher nur ein schleppendes Tempo anschlagen konnten.
Durch die Fenster bemerkte ich, dass auf den Straßen trotz der späten Stunde und des Dauerregens reger Betrieb herrschte. Ein Meer von triefenden Regenschirmen wogte in beiden Richtungen die Straße entlang, und unter den gelben Lichtern der Gaslaternen sahen sie dabei aus wie schwarze schimmernde Muschelschalen.
Dies war nicht mehr die Stadt, in der ich während meiner Kindheit so gern den Winter verbracht hatte, dachte ich bitter. Mittlerweile lebte ich in einem London, das überlaufen war von geschundenen Arbeitern, Matrosen und Lumpensammlern, geschwärzt vom Qualm aus den kohlefressenden Fabriken … und heimgesucht vom Ripper und tausend weniger bedeutenden Schuften.
Die Kuppel der Kathedrale erhob sich wie ein unbeugsamer Wächter. Ihre einst weiße Oberfläche war durch die Dämpfe der Industrieanlagen geschwärzt und nun so dunkel wie der finstere Himmel. Wenig später hielt mein Kutscher vor der langgezogenen Vorhalle an. Ich ging an den weißen Säulen entlang, und als ich das Gotteshaus betrat, war es darin mucksmäuschenstill; meine eiligen Schritte hallten auf dem Marmorfußboden durch das gesamte Längsschiff.
Normalerweise war es in St. Paul’s hell und luftig, und seine imposante Kuppel erstreckte sich in perfekter Symmetrie in dem durch die Buntglasfenster hereinfallenden Licht. An diesem Tag jedoch ließ die armselige Novembersonne das Gotteshaus schummrig, ja sogar unheimlich wirken.
In der Kathedrale befanden sich lediglich zwei Menschen: ein junger Mesner, der die Kerzen auf dem Leuchter entzündete, und eine dunkle Gestalt, die direkt vor dem Altar saß. Letzterer war, natürlich, Sir Charles Warren. Er saß in sich zusammengekauert und hielt mit zittrigen Händen seinen Hut umklammert. Wer immer ihn sah, hätte ihn für einen einsamen Betenden gehalten.
Sein weißes schütteres Haar und sein buschiger Schnurrbart standen im Kontrast zu seinem rabenschwarzen Anzug. Ich erkannte den altmodischen Schnitt seines Jacketts, das so konservativ war wie der Kerl selbst. Es war ein offenes Geheimnis, dass Sir Charles Warren ein verschrobener Gentleman war, höchst eigenwillig und daher höchst umstritten. Sein größter Makel bestand darin, volle Kontrolle über den Polizeiapparat auszuüben und sowohl dem stellvertretenden Commissioner als auch den Superintendents jedwede Eigenständigkeit zu verwehren. Schlimmer noch: Er war nicht imstande, irgendeine Aufgabe, die er für unerlässlich hielt, zu delegieren. Kein Wunder also, dass er mich persönlich treffen wollte.
»Ich wusste gar nicht, dass Sie religiös sind«, sagte ich. Obwohl ich ihn leise angesprochen hatte, schreckte ich ihn auf.
Er schaute zu mir hoch, richtete sich sofort auf und warf mir einen kühlen Blick zu.
»Sie sind spät dran, Frey.«
»Die Straßen sind eine Katastrophe. Ich bitte mich zu entschuldigen.« Ich musste mit gleicher Förmlichkeit antworten, obschon Sir Charles und ich uns seit sieben Jahren gut kannten.
Etwas Unheilvolles ging von ihm aus. Er hatte eine beinahe fassbare Mauer um sich herum aufgebaut, die selbst unsere alte Freundschaft nicht zu durchbrechen vermochte.
Ich nahm in angemessener Entfernung Platz. »Was kann ich für Sie tun, Sir?«
Warren räusperte sich. »Zwei furchtbare Morde sind geschehen, Frey. Vom ersten haben Sie sicher gehört …«
»Allerdings. Mary Jane Kelly, wieder eine Frau aus Whitechapel.«
Sir Charles schüttelte den Kopf. »Dieser Mord war anders, Frey. Er war brutal – ich meine, auf schockierende Weise. Der vorläufige Bericht von Dr. Bond hat mir Übelkeit verursacht: Ihre Gedärme wurden überall verstreut. Der Tatort sah so furchtbar aus, dass sich einer unserer Officer an Ort und Stelle übergeben musste, und ein verfluchter Korrespondent der Times hat alles gesehen. Zurzeit versuchen einige meiner Mitarbeiter, ihn … dazu zu überreden, die Story nicht zu veröffentlichen.«
Ich nickte knapp. Die vom CID bevorzugten Überredungskünste kannte ich. »Haben Sie mich aus diesem Grund kommen lassen? Möchten Sie, dass ich Ihnen im Fall des Rippers unter die Arme greife?«
»Aber nein …« Warrens Miene verdüsterte sich. Er rieb sich die Augen und fuhr fort. »Diese Sache kommt zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt. Ich wusste, dass es irgendwann passieren würde, aber nicht so früh …«
»Was denn?«
Warren stieß einen tiefen Seufzer aus. »Ich habe Ihnen gesagt, dass es zwei Morde gab. Der eine an dieser Frau, Kelly … Der andere an einem alten Knaben, einem Musiker, wie ich erfahren habe. Offenbar ist er auf brutalste Art und Weise ermordet worden … in Schottland, glaube ich.«
Ich runzelte die Stirn. »Entschuldigen Sie, Sir, aber warum sagen Sie ›glaube ich‹? Ist der Bericht denn nicht vertrauenswürdig?«
»Ich habe keinen Bericht erhalten, Frey. Ich habe nur Gerüchte vernommen.«
Die Falten auf meiner Stirn gruben sich tiefer ein. »Wie ist das möglich? Sie sind der Leiter der Polizei …«
Plötzlich ging mir ein Licht auf.
Warren schluckte, und sein zerfurchtes Gesicht drehte sich verneinend hin und her. »Das bin ich nicht mehr, Frey. Ich wurde gezwungen, meinen Rücktritt einzureichen.«
»Von wem?«
Warren stieß müde den Atem aus. »Von Lord Salisbury persönlich.«
Der Premierminister von Großbritannien. Diese Angelegenheit musste wirklich schwerwiegend sein, und während der Momente des Schweigens, die nun folgten, schossen mir tausenderlei Dinge durch den Kopf.
Das durch Jack the Ripper angerichtete Chaos hatte seinen Höhepunkt erreicht. Angst und Schrecken währten nun schon unerträglich lange. Die Presse war so von ihm besessen, dass alles, was er tat, tausendfach übertrieben wurde und es in der Unterschicht Londons kein anderes Gesprächsthema mehr gab. Erst vor Kurzem hatten die Schlagzeilen einen gefälschten Brief ausgeschlachtet, der angeblich mit Theaterblut geschrieben worden war.
Ich konnte mir vorstellen, wie der Marquess, der Lage überdrüssig und Antworten einfordernd, in Warrens Büro gestürmt war, nur um festzustellen, dass Scotland Yard weit davon entfernt war, den Mörder dingfest zu machen. Lediglich eine Handvoll Personen war aufgespürt worden, einer als Täter so unverdächtig wie der andere.
Dann dachte ich an diesen mysteriösen neuen Mord in Schottland. Wenn selbst Sir Charles Warren keinen Zugang zu den Berichten hatte …
»Die Bruchstücke an Informationen, die ich einholen konnte«, sagte Warren, »lassen mich glauben, dass die Regierung befürchtet, in Schottland könne ein Nachahmungstäter des Rippers tätig sein … oder sogar viele von ihnen, überall im Land …«
»Was, meinen Sie, hat er vor …«
»Das ist nicht das dringendste Problem, Frey. Ich habe Sie kommen lassen, um Sie zu warnen.«
»Mich warnen?«
»Ja. Sobald ich endgültig abgelöst bin, werden sie Scotland Yard im Handumdrehen verändern.«
»Wird Monro die Leitung übernehmen?« Ich betonte den Namen mit Bitterkeit, denn ich kannte die Antwort bereits.
»Höchstwahrscheinlich.«
James Monro war der Stellvertretende Commissioner von Scotland Yard, nur einen Rang unter Warren stehend. In letzter Zeit war es den beiden nahezu unmöglich gewesen, miteinander zu arbeiten, und es hatte sich rasch herauskristallisiert, dass einer der beiden schlussendlich seinen Hut würde nehmen müssen.
»Nicht nur die Organisation des CID wird sich verändern, Frey. Es werden bald Köpfe rollen, und der Ihre könnte darunter sein.«
Einen Moment lang nickte ich lediglich stumm, über Warrens Worte nachsinnend. Seine lange Freundschaft mit meiner mittlerweile verstorbenen Mutter hatte bei meiner Einstellung eine entscheidende Rolle gespielt, und seine Beziehung zu meiner Familie war allseits bekannt. Es war nur natürlich, dass, wenn er fiel, all seine Peers und Protegés mit ihm stürzen würden. Zwar wurde in den Zeitungen nach wie vor mein Erfolg im Fall von Good Mary Brown erwähnt, einer kleinen Näherin, die ihre fünf Ehemänner mit Arsen vergiftet hatte, nachdem sie Lebensversicherungen auf ihre Namen abgeschlossen hatte. Doch wenn die Politik das Zepter übernahm, würden meine Einsatzbereitschaft und meine Fähigkeiten nicht von Bedeutung sein.
»Glauben Sie, ich sollte etwas dagegen unternehmen?«, fragte ich wagemutig.
»Ich würde Ihnen dringend dazu raten … dies nicht zu tun.«
Ich blinzelte verständnislos. Mit jeder anderen Antwort hatte ich gerechnet, nicht aber mit dieser.
»Habe ich Sie recht verstanden? Falls sie beschließen, ich sei überflüssig, soll ich beiseitetreten wie ein verzagter Schwachkopf? Nach mehr als sieben Jahren Dienst?«
Er schaute mich durchdringend an. »Ja, und das müssen Sie, wenn Sie das Beste für sich wollen!« Warren hatte die Stimme erhoben, und ihr Echo hallte wider. »Die Situation wird das Schlechteste bei diesen Leuten hervorbringen, Ian«, flüsterte er. »Sie sind gut beraten, denen nicht in die Quere zu kommen.«
Sir Charles nannte mich nur selten beim Vornamen. Tief im Inneren wusste ich, dass er recht hatte. Er, der jahrzehntelang gegenüber der Familie meiner Mutter loyal gewesen war, gab mir nun die besten Ratschläge, und die durfte ich nicht leichtfertig beiseiteschieben.
Dennoch rang ich mit mir. Diese Nachricht war nicht leicht zu verdauen.
»Dann sollte ich also damit rechnen, dass Commissioner Monro mich schon sehr bald zu sich zitiert und mir schlechte Nachrichten überbringt …« Ich seufzte, um dann ein spöttisches Grinsen aufzusetzen. »Ein Teil von mir freut sich darauf, muss ich zugeben. Mich ihm zu stellen wird amüsant werden …«
Mein bissiger Humor entlockte Warren einen Grunzlaut. Er erhob sich. »Wenn man Sie zum Rücktritt auffordert, müssen Sie tun, was man Ihnen sagt, verstehen Sie? Glauben Sie nicht, Ihr Name oder Ihr Scharfsinn würde Ihnen dieses Mal viel helfen. Es wird sich jetzt alles ändern, Frey. Denken Sie an meine Worte.«
Er warf mir einen letzten Blick zu. Ob der Mann kochte oder den Tränen nahe war, vermochte ich nicht zu sagen. Wie dem auch sein mochte – er zog es vor, seine Gefühle zu verbergen, wandte sich hastig ab und strebte dem Ausgang der Kathedrale zu.
Düsteren Gedanken nachhängend verließ ich St. Paul’s.
Wie gesagt, es waren familiäre Bindungen und eine gehörige Portion Glück gewesen, die mir die Stellung bei Scotland Yard verschafft hatten. Ich hatte meinen Dienst angetreten, nachdem ich kurz zuvor erst die Medizinische Fakultät in Oxford und dann die Juristische in Cambridge vorzeitig verlassen hatte. Mein Weg war nicht vorgezeichnet, und es gab nur wenige Ziele, die mich angespornt hätten. Ich hätte auch zu Hause bleiben und vom Vermögen meiner Familie leben können – meine beiden Großväter hatten mir gut gefüllte Bankkonten hinterlassen –, doch mein agiler Geist langweilte sich schnell. Darüber hinaus war ein Leben des Müßiggangs leer, was ich nicht akzeptieren konnte – der Gedanke an eine solche Existenz, daran, diese Welt wie eine unbemerkte Brise zu durchqueren, ein sinnloses Dasein zu führen, war manchmal so unerträglich, dass ich nicht schlafen konnte. Wie es mein Vater so kurz und bündig (und ziemlich herablassend) formulierte, musste ich »meinen Wert beweisen«.
In Anbetracht der Beziehung meines Onkels zu Commissioner Warren fand ich rasch eine Stelle als stellvertretender Inspector bei Scotland Yard. Eine recht bescheidene Position für einen ehemaligen Oxfordstudenten, doch das störte mich nicht, denn es sollte ja nur eine zeitweilige Ablenkung sein. Meine Kenntnisse der Anatomie und des Rechts, mochten sie auch nicht fundiert sein, konnten sich bei der Polizeiarbeit als nützlich erweisen, und die Stelle würde mir einen triftigen Grund dafür liefern, das Haus zu verlassen. Letzteres spielte alles andere als eine untergeordnete Rolle; noch eine weitere Woche den Klatsch und Tratsch meiner Stiefmutter oder das Violinenspiel meines jüngsten Bruders Elgie zu den sonderbarsten Zeiten hätten mir den Garaus bereitet.
Doch die Arbeit beim CID fesselte mich und ließ mich nicht wieder los.
Bevor ich michs versah, arbeitete ich jeden Abend bis weit nach Mitternacht, studierte Akten und löste Fälle, die sich nur als facettenreiche Puzzle beschreiben lassen. Ein Zeichen auf einer Wand, der Inhalt einer Brieftasche, die Haarlocke einer verlorenen Liebe, ein achtlos zurückgelassener Handschuh … diese kleinen alltäglichen Details, Dinge, über die sich ein gewöhnlicher Mensch keine Gedanken machen würde, das waren unsere Informationen; und sie reichten meist dafür aus, uns ein vollständiges Bild von Opfern und Tätern machen zu können. Ihr Leben und ihr Charakter, ihre Fehler, ihre Leidenschaften und Philosophien … kurz, ihre innersten, dunkelsten Geheimnisse waren greifbar, wenn man es nur verstand, die Welt um sie herum zu deuten.
Wie spannend, wie faszinierend dieses Spiel doch war. Endlich hatte ich meinen Platz gefunden. Meinen Wert bewiesen. Mein Enthusiasmus hatte Commissioner Warren natürlich beeindruckt, und im Laufe der Jahre waren wir enge Kollegen geworden.
Mittlerweile ging ein erbärmlicher, aus dicken schwarzen Wolken prasselnder Regen über London nieder, sodass das einzige Licht auf den Straßen von den Gaslaternen entlang der Strecke stammte. Als die Kutsche durch ein Schlagloch holperte, riss mich dies für einen Moment aus meinen Gedanken. Die Straßen in Central London waren in einem jämmerlichen Zustand – uneben, zerfurcht und für gewöhnlich überschwemmt –, und sie wurden schlimmer, je näher wir dem kleinen Haus an der Suffolk Street kamen, das ich angemietet hatte.
Es ist schon verwunderlich, dass ich diesen Ort mein Zuhause nenne. Wie mein Beruf hatte auch das Haus eigentlich nur ein Provisorium sein sollen. Ich hatte es vier Jahre zuvor angemietet, als mich Fälle bis spät in die Nacht an das Büro fesselten. Ich war mir der Verbrechensquote, die in London herrschte, nur allzu bewusst, und daher waren nächtliche Fußmärsche in der Stadt das Letzte, was ich unternehmen wollte. Daher beschloss ich, in der Nähe von Whitehall Place Räumlichkeiten anzumieten, um dort die Nacht verbringen zu können, falls die Arbeit mich bis in die späten Stunden bei Scotland Yard festhielt.
Außerdem fuhr ich dorthin, um nachzudenken und über meine Fälle zu sinnieren, denn ich weiß Privatsphäre zu schätzen, vor allem, wenn ich mich konzentrieren muss. Natürlich wagte ich es nicht, mich im Hauptquartier in ungebügelten Hemden zu präsentieren, sodass ich einen Teil meiner Habseligkeiten dorthin bringen ließ und natürlich eine Dienstmagd einstellen musste. So ging es weiter, immer weiter, und bevor ich michs versah, war das kleine Haus zu meinem ständigen Wohnsitz geworden. So bescheiden es war, so fühlte es sich manchmal doch viel heimischer an als die Villa meiner Familie am Hyde Park Gate.
Als ich ankam, stellte ich überrascht fest, dass aus dem Küchenfenster Licht drang. Ich fand dort Joan vor, meine Haushälterin, die sich Schinkenbrote geschmiert hatte.
Joan war eine stämmige Witwe von Mitte vierzig. Mit ihrem grauen Haar und ihrem üppigen Busen und Hintern erinnerte sie mich immer an eine füllige, zu groß geratene Taube. Von dem Moment an, als ich sie einstellte, wusste ich, dass sie dazu neigte, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, und später stellte ich fest, dass sie auch eine Schwäche für billigen Sherry hatte. Dennoch konnte ich mich nicht beklagen. Joan hielt die Räume in tadellosem Zustand, wusste genau, wie ich meine Kleider haben wollte, und kochte köstlichen schwarzen Kaffee. Ich sah bewusst über ihr Schandmaul hinweg, selbst wenn ich Besuch hatte, denn so war sichergestellt, dass kein anderer Arbeitgeber je versuchen würde, sie abzuwerben.
»Nanu, Joan? Sie sind noch hier? Ihre Pünktlichkeit beim Gehen gleicht doch für gewöhnlich Ihre Unpünktlichkeit beim Kommen aus.«
An jedem anderen Tag hätte Joan jetzt mit einem derben Scherz gekontert, doch zu meiner Verblüffung blieb sie stumm.
»Joan, was ist denn?«
»Briefe für Sie, Sir«, nuschelte sie in ihrem schweren Lancashire-Akzent. Ich sah, dass sie auf zwei kleine Umschläge wies, die auf dem Tisch lagen, doch sie rührte sich nicht.
Im Glauben, Warrens Vorhersage habe sich viel schneller bewahrheitet, als ich geglaubt hatte, schreckte ich zunächst davor zurück, auf die Briefe hinabzuschauen. Aber noch bevor ich sie in die Hand nahm, erkannte ich die Handschriften auf den Umschlägen.
»Eine Nachricht von Eugenia und eine von meinem Bruder …«, murmelte ich argwöhnisch. Wäre bei ihnen etwas nicht in Ordnung gewesen, hätten sie einen Diener geschickt, um mich zu holen. »Joan, das hier kann nicht so dringlich gewesen sein, dass Sie hier bis fast Mitternacht ausgeharrt haben. Erklären Sie mir, was los ist.«
Sie nahm einen riesigen Bissen von ihrem Schinkenbrot, als wollte sie Mut sammeln, und als sie ihn verdrückt hatte, sagte sie: »Sir, ist es wahr? Hat es wieder einen Mord gegeben?«
Ich stieß einen erschöpften Seufzer aus und riss den ersten Umschlag auf. Ich wusste, dass Joan keine Ruhe geben würde, bis ich ihr die Wahrheit erzählte. »Ich fürchte, ja, es gab gestern Abend einen Angriff.« Ich redete weiter, während ich begann, die Nachricht zu lesen. Es war alles andere als eine dringende Nachricht – sie stammte von Eugenia, meiner Verlobten. Sie hielt mich schlichtweg auf dem Laufenden mit unbedeutenden Banalitäten und fragte zum x-ten Mal, wann ich Zeit haben würde, sie zu besuchen. Wegen meiner Arbeit hatte ich sie vernachlässigt und musste das bald wiedergutmachen. Die zweite Nachricht stammte von Laurence, meinem ältesten Bruder. Er erinnerte mich an das Abendessen im Familienkreis am kommenden Abend.
Als ich zu Ende gelesen hatte, wandte ich meine Aufmerksamkeit wieder Joan zu. »Sie haben doch nicht hier die ganze Zeit gewartet, bloß um die Nachricht bestätigt zu bekommen, oder?«
Nun rückte sie endlich damit heraus. »Nein, Mr Frey. Ich … ich hatte ganz vergessen, dass die Tage kürzer werden, und ehe ich michs versah, war es dunkel.«
Ich zog eine Braue hoch. »Fahren Sie fort.«
»Ich weiß, dass Sie mich für einfältig halten, aber nachts nach Hause zu gehen, bei allem, was passiert ist … Ich dachte, dass im Vorratsraum vielleicht genug Platz ist, Sir. Ich dachte, vielleicht könnte ich dort übernachten, wenn es schon dunkel ist … bloß, bis die Polizei ihn geschnappt hat. Sie werden gar nicht mitbekommen, dass ich da bin, das verspreche ich.«
Ich konnte die Stimme meines Vaters hören, als wäre er hier im Raum – Du bist viel zu nachsichtig gegenüber den Bediensteten! –, doch wie hätte ich die flehentliche Bitte dieser armen Frau ablehnen können? Selbst ich, ein groß gewachsener bewaffneter Polizeiinspector von einunddreißig Jahren, fühlte mich nicht wohl, wenn ich allein durch die dunklen Straßen der Stadt ging.
»Bitte, Mr Frey. Ich bezahle auch für den Raum!«, bettelte sie. »Sie können es mir vom Lohn abziehen und …«
Sie klang mittlerweile so verzweifelt, dass ich ihr Einhalt gebieten musste.
»Joan, nun bewahren Sie doch um Himmels willen ein wenig Haltung! Kennen Sie mich denn überhaupt nicht? Ich hatte nicht vor, Sie Miete zahlen zu lassen. Und hören Sie auf damit, von diesem verdammten Vorratsraum zu sprechen. Es gibt doch ein Mädchenzimmer, das können Sie nach Belieben benutzen.« Ich schaute auf meine Taschenuhr. »Allerdings ist es schon sehr spät. Heute Abend können Sie im Gästezimmer schlafen – aber nur heute Abend.« Elgie hatte die Angewohnheit, unangemeldet zu kommen und dann Anspruch darauf zu erheben. Doch so spät wie jetzt würde er nicht mehr hereinschneien.
»Oh danke, Mr Frey … Ich …«
»Schon gut, schon gut«, beruhigte ich sie und eilte nach oben, bevor Joan sich unangemessenem Weinen hingab.
Als sie ihre Fassung wiedererlangt hatte, bereitete sie mir ein leichtes Abendessen zu, und ich wies sie an, meine vollkommen verdreckten Schuhe vor dem Frühstück zu polieren.
Als ich schlafen ging, dachte ich an die Worte von Commissioner Warren: »Es wird sich jetzt alles ändern …«
So aufgedreht ich auch gewesen war, schlief ich doch ein, kaum dass mein Kopf auf das Kissen gesunken war. Es sollte für lange Zeit der letzte tiefe Schlaf sein, den ich haben würde. Denn am nächsten Tag änderte sich in der Tat alles.
2
London an einem Novembermorgen roch nach Kloake und abgestandenem Alkohol aus den Pubs. Ich rümpfte ob des Gestanks die Nase, während ich zum Scotland Yard eilte und dabei immer wieder den angefrorenen Pferdeäpfeln auswich, die die Straßen übersäten.
Gestank und Pferdeäpfel waren nicht die einzigen schmutzigen Dinge, die mir im Kopf herumschwirrten. Während des Frühstücks hatte ich eine Nachricht von Wiggins erhalten, meinem Assistenten, in der er mich drängte, ins Hauptquartier zu kommen. James Monro, der neue Commissioner, forderte mein sofortiges Erscheinen. Augenblicklich war mir klar, dass meine Laufbahn bei der Londoner Polizei beendet war.
Häufig hatte ich zwar nicht mit ihm zu tun gehabt, doch die wenigen Male, bei denen ich mit Monro hatte zusammenarbeiten müssen, hatten gereicht, mir eine Meinung über ihn zu bilden. Kleinkariert, voreingenommen, religiös bis an die Schwelle zum Fanatismus … und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, war der Mann auch noch aus Edin-blöd-burgh, wie mein Vater es gerne nennt.
Dass jeder gescheite englische Gentleman alles Schottische ohne Wenn und Aber verabscheut, ist in Stein gemeißelt. Allerdings ist mein Vater ein Extremfall. Irgendein gescheitertes Geschäft in Aberdeenshire hatte ihn als jungen Mann eine so obszöne Stange Geld gekostet, dass er für den Rest seines Lebens niemals mehr den Namen einer schottischen Stadt, eines Dorfes oder einer Persönlichkeit aussprach, ohne dabei ein Schimpfwort einzufügen.
Im Falle meiner Entlassung würde ich daher dem alten Mr Frey wenigstens die Schande ersparen, dass einer seiner Erben Befehle von einem Schotten entgegennahm.
Wie immer war Scotland Yard einer der geschäftigsten Orte im Westminster-Viertel. Fortwährend kamen und fuhren Kutschen ab, und ein steter Strom von Beamten und Constables betrat oder verließ das rote Backsteingebäude. Auch innen herrschte Durcheinander – Menschen liefen kreuz und quer herum wie aufgescheuchte Hühner, und mein kleines Büro im zweiten Geschoss war da keine Ausnahme. Akten stapelten sich bis an die Decke; mehr als einmal war Wiggins unter einer Lawine von Dokumenten begraben worden. Neue, größere Büroräume wurden gerade am Embankment nahe der Westminster Bridge gebaut, und ich freute mich darauf, dorthin umzuziehen. Als ich mein Büro betrat, beugte sich Wiggins wie üblich über einen Stapel Akten.
»Guten Morgen, Sir«, sagte er mit zittriger Stimme. Den Grund für seine Schüchternheit habe ich nie ganz begriffen; der junge Mann war gebildet und zuverlässig und hatte eine vielversprechende Karriere vor sich, falls es ihm gelang, ein wenig Selbstvertrauen zu gewinnen.
»Der neue Commissioner will mich also sprechen«, sagte ich und warf meinen Mantel beiseite.
»Ja, Sir.«
»Soll ich in sein Büro oder in das von Warren kommen?«
»Weder – noch, Sir. Er möchte Sie im Großen Sitzungssaal sprechen …«
»Was?«
Wiggins ließ seinen Federhalter fallen, worauf das Tintenfässchen umkippte. »Der … der Commissioner hat für zehn Uhr eine Sitzung einberufen, Sir«, erklärte er, während ich ihm half, die Tinte aufzuwischen. »Aber er will Sie vorher unter vier Augen sprechen.«
»Mich gleich am frühen Morgen loswerden … Der alte Mann verschwendet keine verdammte Minute«, murrte ich und ging mit großen Schritten aus dem Büro.
Ich beeilte mich und fand den Sitzungssaal düster wie ein Grab vor. Er hatte zwar große Fenster, wurde aber von der halb hinter den Wolken verborgenen Sonne nur schwach beleuchtet, sodass es schien, als sei es spät am Abend.
In dem Raum befand sich nur ein Mensch: James Monro, ein kräftiger Mann von Mitte fünfzig mit vierschrötigem Gesicht, einem grauen Schnurrbart und abscheulichen weißen Koteletten. Er hatte es sich auf dem größten Stuhl bequem gemacht und wirkte so entspannt, als sei er schon seit Jahren Commissioner.
»Ich glaube, ich muss Ihnen gratulieren … Sir«, heuchelte ich, so gut ich konnte.
»Machen Sie sich nicht lächerlich, Frey«, erwiderte er. »Nehmen Sie Platz. Ich habe Ihnen einiges mitzuteilen und nur sehr wenig Zeit.«
Ich setzte mich, verschränkte die Finger, legte die Arme auf den langen Tisch und wartete. Doch Monro steckte die Nase tief in die unordentlich vor ihm liegenden Dokumente. Erst nach der Zeitspanne, die die Höflichkeit vorgab, erhob ich das Wort. »Entschuldigen Sie, Sir. Sie deuteten an, dass etwas Dringendes vorliegt …«
Monro hob lediglich den Zeigefinger, um mich verstummen zu lassen.
Wie sehr muss er es genießen!, dachte ich. Doch blieb mir nichts anderes übrig, als auf meinem Stuhl sitzen zu bleiben, die Zähne zusammenzubeißen und voller Abscheu seine borstigen Koteletten, seine Hakennase und seine dummen Kuhaugen zu betrachten.
Mit übertriebener Strenge schaute er mich dann endlich an und erhob die Stimme.
»Ich sage es einfach und geradeheraus. Wie Ihnen bekannt ist, ist Ihr Freund Sir Charles … zurückgetreten. Da ich nun die Leitung übernommen habe, habe ich vor, bedeutende Veränderungen vorzunehmen. Diese beginnen mit der Entlassung jedweder überflüssiger Elemente, die nur aufgrund Warrens Veranlagung zur Sentimentalität hier sind.«
So also endet es, dachte ich und zog die Hände zurück, um sie unter dem Tisch unbemerkt zu Fäusten zu ballen.
»Es ist kein Geheimnis, dass Ihre Position überbezahlt ist und es Ihnen schwerfällt, mit einigen Ihrer Kollegen zusammenzuarbeiten. So kam mir vor nicht langer Zeit zu Ohren, dass Sie Berry, den Fotografen, ein … wie war das noch? Stinkendes Stück ranzigen Hammels genannt haben?«
Wie hätte ich den Mann treffender beschreiben können? Fotografien waren sündhaft teuer und wurden nur bei außerordentlichen Fällen wie den Whitechapel-Morden eingesetzt. Doch dieser tollpatschige Höhlenbewohner behandelte die Ausrüstung mit aberwitziger Geringschätzung. Ständig zerbrach er die Dreibeinstative seiner Gandolfi-Kamera, und die Linsen und Platten seiner Ausrüstung waren immer mit den Schlieren seines fetttriefenden Lunchs verschmiert. Als er mir Fotografien eines Tatorts überreicht hatte, die mit angetrockneten Stücken halb zerkauter Wurst übersät waren, hatte ich die Beherrschung verloren.
Ich räusperte mich. »Mir ist bewusst, dass ich in den Augen anderer womöglich … überreagiert habe; gleichwohl habe ich nicht die Angewohnheit, andere schlecht zu behand…«
Monro warf mir einen solch vernichtenden Blick zu, dass ich es für besser hielt, mir meine Bemerkungen zu verkneifen.
»Kurz und gut«, sagte er, »ich kann Sie nicht im Dienst belassen.«
Genau, wie Sir Charles es vorhergesagt hatte …
Offenkundig hatte Monro vor, sämtliche hohen Beamten zu ersetzen, die Sir Charles Warren gegenüber loyal gewesen waren. Seine »bedeutenden Veränderungen« waren schlichtweg ein Schachzug, um sich mit Verbündeten zu umgeben und seine Autorität abzusichern. Es war alles nur Politik, ein erbärmliches Machtspiel; ein Spiel, das bedauerlicherweise meine Karriere den Bach hinuntergehen ließ.
»Ich verstehe Sie sehr gut«, brachte ich mit fester Stimme hervor.
»Wenn Sie weiter nichts zu sagen haben, muss ich Sie bitten zu gehen. Ich erwarte jeden Moment einen wichtigen Besucher und möchte nicht, dass er Sie hier sieht. Ich habe ihm weiß Gott düstere Nachrichten zu überbringen.«
Ich stand auf, konnte mir die Frage aber nicht verkneifen: »Geht es um den Musiker, der in Schottland abgeschlachtet worden ist?«
Ich sah förmlich, wie das Blut aus Monros Gesicht wich. »Was haben Sie … Wie können Sie …?« Dann wechselte seine Gesichtsfarbe von leichenblass zu zornesrot. »Wollen Sie mich erpressen, Sie erbärmlicher kleiner Wicht?«
»Ganz und gar nicht!«, antwortete ich gleichmütig. »Erpressung würde bedeuten, dass ich etwas von Ihnen brauche, und eher friert die Hölle ein, als dass ein Frey von Magdeburg die Hilfe eines gemeinen Bewohners von Lothian um etwas ersucht. Gott verdam…«
In diesem Augenblick schlug die Tür auf, und ein kleiner rundlicher Mann kam mit raschen Schritten herein. Er hatte sich in einen schweren Regenmantel gehüllt und wurde von vier Wachen und einem jungen Assistenten begleitet. Der Mann warf seinen Mantel beiseite, und nun erblickte ich seinen runden Bauch, seinen kahlen Kopf und seinen Rauschebart. Es schnürte mir die Brust ein, als ich begriff, dass dies kein anderer war als Lord Robert Cecil, 3. Marquess of Salisbury und Premierminister des Vereinigten Königreichs.
Monro stand automatisch auf und hätte dabei fast seinen großen Stuhl umgeworfen.
»Herr Premierminister«, sagte er unterwürfig. »Willkommen in unserer …«
»Behalten Sie Ihre Schmeicheleien für sich«, blaffte Salisbury, während er an mir vorbeischritt. Er warf mir einen irritierten Blick zu. »Wer ist das?«
Monro wirkte wie gelähmt. Zweimal machte er den Mund auf, doch es drang kein Laut über seine Lippen.
Da ich erkannte, dass er einen Kloß im Hals hatte, verbeugte ich mich respektvoll. »Inspector Ian Frey, Mylord.«
»Ich habe ihn soeben entlassen«, schaltete sich jetzt Monro ein. »Inspector Frey gehörte zum engsten Kreis von Warren. Es tut mir leid, dass Sie jetzt …«
»Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor«, sagte der Premierminister, Monro vollkommen ignorierend. »Sind Sie nicht der Detective, der diese Schwarze Witwe mit dem Arsen in den Kerker gebracht hat?«
»Good Mary Brown«, sagte ich wie aus der Pistole geschossen, und mir schwoll die Brust an wie ein Blasebalg. »Das bin ich tatsächlich, Sir.«
Lord Salisburys Gesichtsausdruck veränderte sich fast unmerklich – es wäre mir entgangen, hätte ich nicht so nahe bei ihm gestanden. Er fixierte mich einen Moment, zog langsam eine Braue hoch und musterte mich genauer. Ich spürte, dass ihm tausenderlei Gedanken durch den Kopf schwirrten – und das gefiel mir nicht.
»Lassen Sie uns allein, Mr Frey«, befahl er, doch in einem Ton, der deutlich milder war als bei seinem ersten Aufbrausen.
Ich verbeugte mich erneut und verließ den Raum augenblicklich. Der stechende Blick des Premierministers hatte sich mir eingebrannt.
Wenn ich an diesen Moment denke, schaudere ich nach wie vor ein wenig. Hätte Monro mich einfach als »Niemand« entlassen, oder hätte ich den Raum eine Minute früher verlassen, wäre der Rest meines Lebens sicher anders verlaufen.
3
Ich benötigte nur wenige Stunden, bis ich Inspector Swanson einen ausführlichen Bericht über die Fälle erstattet hatte, an denen ich gerade arbeitete. Mein ordentliches Ablagesystem erwies sich dabei als große Hilfe, und als ich das Büro verließ, vergrub sich der Mann zuversichtlich in einem Stapel von Dokumenten.
Wiggins, der mehr als drei Jahre lang mein Assistent gewesen war, konnte seinen Kummer nicht verbergen. Ich spürte, dass er seine Arbeit bei der Polizei fast genauso liebte wie ich, und es ärgerte mich, dass ich nicht erleben würde, wie er Karriere machte.
Als ich das Büro verließ, bemühte sich Wiggins stotternd um eine Abschiedsfloskel, schluckte dann jedoch lediglich heftig. Ich tätschelte ihm die Schulter und zwinkerte ihm zu.
»Ich komme zurück, Wiggins«, versicherte ich ihm, auch wenn ich selbst nicht die leiseste Hoffnung hegte.
Kaum draußen winkte ich die erste Droschke herbei, die ich sah.
Mit blankem Entsetzen wurde mir klar, dass ich plötzlich Zeit hatte, an der abendlichen Gesellschaft meiner Eltern teilzunehmen … und ihnen die düstere Nachricht zu überbringen. Mein Vater würde nicht erfreut darüber sein, und mein Bruder Laurence würde es mit Sicherheit zur Gänze auskosten. Ich schaute auf meine Taschenuhr und rechnete mir aus, dass mir genug Zeit blieb, zur Suffolk Street zu fahren, meine Kleidung herrichten zu lassen und den Barbier aufzusuchen, um die fällige Rasur nachzuholen. Ich mochte arbeitslos und von der Gesellschaft verstoßen sein, aber niemals verlottert.
*
Das Herrenhaus der Freys am Hyde Park Gate stand nicht weit von den Kensington Gardens. Das elegante Haus hatte eine in makellosem Weiß verputzte Fassade, die inmitten der Trübheit Londons leuchtete, als meine Kutsche auf die breite, tadellos gepflegte Auffahrt einbog. Die Ahornbäume verloren bereits ihre Blätter, doch hart arbeitende Straßenkehrer hielten die Zufahrt makellos sauber.
Die Kutsche hielt vor dem dreigeschossigen Haus, wo der Butler mich bereits erwartete und unverzüglich Mantel, Hut und Handschuhe entgegennahm.
Mich empfingen die dunkle Eichenvertäfelung, grüne Samtteppiche und der charakteristische Geruch der Villa, eine Mischung aus Rosenwasser und Pfeifentabak, was stets die wärmsten Kindheitserinnerungen in mir aufkommen ließ.
Ich ging durch einen langgezogenen Flur, in dem die prunkvollen Porträts der Frey’schen Ahnen aus zwölf Generationen hingen, zurückgehend bis zu dem protestantischen Bankier, der 1583 aus Magdeburg emigriert war. Bei allen Schwankungen in Sitten und Gebräuchen hatten die männlichen Familienmitglieder der Freys nie dazu geneigt, Gesichtsbehaarung zur Schau zu stellen; auf keinem einzigen Porträt waren Schnurrbärte, Bärte oder Koteletten zu sehen, und mein Vater sowie meine drei Brüder waren, wie ich auch, stets glatt rasiert.
Ich hätte diese Gemälde stundenlang anstarren können. Obwohl sie schon so lange an der Wand hingen, wie ich denken kann, ziehen sie mich auf seltsame Weise immer noch in ihren Bann. Ich komme nicht umhin, Stolz zu empfinden angesichts der Geschichte und der Erfolge meiner Familie. Auch wenn Letztere nicht die meinen genannt werden können, haben sie doch immer bewirkt, dass ich das Gefühl hatte, mein eigenes kurzes Leben sei Teil von etwas Bedeutenderem.
Plötzlich drangen die Klänge einer Geige an meine Ohren. Es war Elgie, mein jüngster Bruder, der im benachbarten Salon spielte.
Es war ein breiter, luftiger Raum mit großen Fenstern und einer hohen Decke. Ein ausnehmend schöner Wandteppich, auf dem die Figuren eines Drachen, eines Löwen und eines Einhorns dargestellt waren, schmückte eine Wand, während die anderen mit italienischen Ölgemälden dekoriert waren, die Mittelmeerlandschaften wiedergaben. Mahagonistühle und mit Samtstoff bezogene Polsterbänke standen gleichmäßig verteilt entlang am Rand eines Perserteppichs, und in dem großen offenen Kamin knisterte munter ein Feuer.
In der Mitte des Raums stand, mit dem Rücken zu mir, mein achtzehn Jahre alter Bruder. Trotz des Altersunterschieds war Elgie schon immer mein Lieblingsbruder. Er war mir stets zu dünn und zu schmalschultrig vorgekommen, und jetzt, da er sein Jackett abgelegt hatte, um freier spielen zu können, trat seine schmächtige Gestalt allzu offenkundig hervor.
Vor ihm saßen mein Vater und meine Stiefmutter. Hingerissen hörten sie zu, während ein Diener mit einem Tablett voller Pasteten und kaltem Braten bereitstand. Als sie Anstalten machten, mich zu begrüßen, hob ich eine Hand, sodass sie still blieben, bis Elgie sein Stück beendet hatte.
Während ich die lebhafte Musik genoss, inspizierte ich flüchtig den Raum. Erst jetzt bemerkte ich einen weiteren jungen Mann, der in der Nähe des Feuers saß – mein zweitjüngster Bruder Oliver.
Ich wünschte ehrlich, ich könnte mehr über ihn sagen, doch Oliver verkörpert fleischgewordene Langeweile. Ich weiß sogar noch, dass er schon als Baby ruhig in seiner Wiege lag, nicht weinte, nicht spielte, ja sich nicht einmal regte, sondern einzig und allein mit seinen großen blauen Augen ins Nichts starrte. Als Junge hatte er weder Freude am Herumlaufen noch am Jagen oder Reiten. Ich ging davon aus, er werde ein eher intellektuelles Interesse entwickeln, und schenkte ihm über lange Zeit hinweg Bücher, Musikinstrumente und Künstlerbedarf. Lange nachdem mein Vater ihn bereits aufgegeben hatte, nahm ich ihn immer noch mit in Museen, Theater und Opernhäuser. Doch er interessierte sich für nichts anderes, als herumzusitzen und an Keksen zu knabbern. Infolgedessen entwickelte er sich zu einem ziemlich pausbäckigen jungen Mann mit einem runden blassen Gesicht. An diesem Abend saß er ein wenig zu dicht am Kamin, und seine Wangen leuchteten feuerrot, so als wären sie mit kreisrunden Brandeisen markiert worden. Ihm stand das pure Unbehagen im Gesicht geschrieben, doch ich wusste, dass er niemals den Platz wechseln würde.
Wenn man Elgie betrachtete – der aufrecht dastand, hager und quicklebendig war und inbrünstig Violine spielte –, konnte man sich kaum vorstellen, dass sie Brüder waren.
Im Gegensatz zu mir haben Elgie und Oliver helles Haar und blassblaue Augen und eine eher schwächliche Konstitution. Unsere unterschiedliche Physis ist nur natürlich, denn sie sind meine Halbbrüder, Söhne meines Vaters mit seiner zweiten Frau.
Elgie schloss mit einem kraftvollen Triller ab, und die gesamte Familie applaudierte (Oliver naturgemäß eher träge). Mit dem Gehör eines Musikers vernahm er sofort unerwarteten Applaus hinter sich und drehte sich um, um mich zu begrüßen.
»Ian! Ich dachte, du wärst anderweitig beschäftigt!«
Ich grinste und tätschelte ihm die Schulter. »Nun, wie gewöhnlich liegst du falsch, Elgie. Dieses Stück war wunderschön. Was war das?«
»Paganinis Capriccio Nr. 24 in a-Moll. Mittlerweile solltest du es wiedererkennen.«
»Wie modern. Ich dachte, du spielst ausschließlich Barockmusik.«
Nachdem ich Oliver zur Begrüßung kurz zugenickt hatte, trat ich vor, um die Hand meiner Stiefmutter Catherine zu küssen.
»Was für eine Überraschung, Ian. Es ist ja so schön, dich zu sehen.«
»Gleichfalls, Catherine«, erwiderte ich mit größter Höflichkeit.
Es ist mir stets gelungen, die Verachtung zu verbergen, die ich gegenüber dieser Frau hege. Catherine White hatte meinen Vater geheiratet, als ich neun Jahre alt war, und selbst damals verzog ich lediglich den Mund und behandelte sie mit vorgetäuschtem Respekt.
Mit achtunddreißig sah sie immer noch recht gut aus. Ich hatte den Eindruck, dass ihr langer Hals durch das Gewicht ihrer extravaganten Zöpfe ein wenig nach hinten geneigt wirkte. Dieser gedehnte Hals verlieh ihr ein stolzes Aussehen, was durch ihren vollkommenen Mangel an Humor noch hervorgehoben wurde – sie saß stets kerzengerade da, die Hände sittsam auf dem Schoß gefaltet und mit ihrem forschenden Blick alles analysierend.
Mein Vater, mittlerweile ein alter Mann von fünfundsechzig (und somit siebenundzwanzig Jahre älter als seine zweite Frau), begrüßte mich mit geringer Zuneigung. Er war mir immer so fern gewesen wie die Porträts an den Wänden. Zwar trat er stets als äußerst kultivierter Gentleman auf, doch in jüngster Zeit vernachlässigte er seine Umgangsformen wie auch seine Gesundheit. Er hatte um die Hüfte herum angesetzt, und ich kann mich nicht erinnern, ihn jemals ohne ein Glas mit einem hochprozentigen Getränk in der Hand gesehen zu haben. An diesem Abend hielt er einen dicken Cognacschwenker in der Hand, und in seinen Mundwinkeln hingen Brotkrumen. Ich war froh, dass er sich auf größeren Gesellschaften nach wie vor zusammennahm.
»Du hättest uns darüber informieren können, dass du kommst«, murrte er.
»Es gab unvorhergesehene Probleme«, erwiderte ich und hoffte, dabei vor dem alten Mann respektvoll, jedoch nicht unterwürfig zu wirken. »Ich hoffe, ich bin nach wie vor willkommen.«
»Aber natürlich bist du das!«, rief Catherine, wie immer darum bemüht, die Wogen zu glätten. »Dein Vater ist nur ein wenig bekümmert, weil du schon so lange nicht mehr zum Essen zu uns gekommen bist.«
Sie mochte vermittelnd wirken, doch Catherine legte den Akzent auf genau die Worte, die die Stimmung meines Vaters verdüsterten.
»Er hat seine Familie und seine guten Beziehungen für diese lächerliche Anstellung links liegen lassen«, murrte er mit monotoner Stimme. »Dein Großvater würde sich im Grab umdrehen.«
Wie oft wir diese Unterhaltung schon geführt hatten, weiß ich nicht mehr. Ich schaute mich um, bemüht, das Thema zu wechseln.
»Und wo ist mein herzallerliebster Laurence?«, fragte ich mit beißendem Sarkasmus.
»Dein Bruder hat das Feingefühl aufgebracht, eine Nachricht zu schicken«, beschied mir Catherine. »Er wurde auf der Chancery Lane aufgehalten, versicherte uns jedoch, er werde rechtzeitig zum Abendessen hier sein.«
»Was bedeutet, dass er innerhalb der nächsten sieben Minuten hier eintreffen sollte«, erwiderte ich scharf. Fast so, als hätte ich ihn herbeigeredet, hörten wir prompt die Türglocke. Elgie trat ans Fenster.
»Wenn man vom Teufel spricht …«
Während ich einen Stich im Magen verspürte, sagte Catherine fröhlich: »Wie entzückend! Zum ersten Mal seit Monaten werden wir alle zusammen sein.«
Ich blies die Wangen auf und dachte dabei: Würde die Etikette es mir doch nur gestatten, einer Frau einen Tritt zu versetzen …
Kurz darauf betrat Laurence den Salon, mit seinem selbstsicheren Gang, in elegantester Kleidung und mit einem Spazierstock in der Hand, den er in keiner Weise benötigte.
Es hieß immer, wie ähnlich wir uns doch sähen. Laurence und ich hatten beide die dunklen Augen und das dunkle Haar unserer verstorbenen Mutter Cecilia, einer Lady französischer Abstammung, und unsere länglichen Gesichter mit schmalen Unterkiefern und hohen Wangenknochen stammten unbestreitbar vom verstorbenen Monsieur Plantard, unserem Großvater mütterlicherseits. Bis vor Kurzem hatten wir beide die gleiche hochgewachsene feingliedrige Figur gehabt, doch die zumeist sitzende Tätigkeit meines Bruders als Anwalt bescherte ihm nun eine kräftigere Taille. Es hieß, wir hätten beide den gleichen scharfen Blick, doch Laurence bedachte alles und jeden mit einer Prise Spott und Herablassung, die mir, so hoffe ich aufrichtig, fehlt.
»Guten Abend, Familie!«, sagte er mit seiner tiefen, durchdringenden Stimme.
»Wir dachten, du wärst aufgehalten worden«, sagte Vater und lächelte zum ersten Mal an diesem Abend. »Aber es ist schön, dich hier zu haben.«
Laurence schenkte sich ein Glas Cognac ein. »Fast wäre ich nicht gekommen, doch eine unglaubliche Neuigkeit zwang mich dazu, Vater.« Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem verächtlichen Grinsen. Ich sah seine Attacke kommen. »Ian«, sagte er und wandte sich mir zu, »ich habe von James Swanson erfahren, dass man dich aus Scotland Yard herausgeworfen hat … auf recht schockierende Art und Weise … Ist das wahr?«
Catherine rang nach Luft. Das war neben dem Prasseln des Feuers das einzige Geräusch im Raum. Ich spürte, wie mir die Farbe aus dem Gesicht wich.
»Warum fragst du, wenn du die Antwort schon kennst?«, blaffte ich ihn an.
»Ach, du lieber Gott!«, stieß Vater hervor und vergrub sein Gesicht in den Händen.
»Ian, das darf nicht wahr sein«, sagte Catherine. »Dein Vater wird so enttäuscht sein.«
»Ich sehe, dass er verdammt enttäuscht ist!«, schrie ich. »Er sitzt direkt neben dir!«
»Sprich nicht in diesem Ton mit deiner Stiefmutter!«, brüllte Vater. Aus den Augenwinkeln heraus sah ich, wie Oliver sich tief in seinem Sessel vergrub und Elgie mit zitternden Händen seine Violine umklammerte. »Welche Schande hast du über die Freys gebracht!«
»Allerdings«, schaltete sich Laurence wieder ein. »Und das Beste habt ihr noch gar nicht gehört. Es ist in aller Munde. Euer lieber Sohn wurde im Beisein von Lord Salisbury persönlich entlassen! Und als wenn das noch nicht genug wäre, hat er James Monro auch noch einen gemeinen Bewohner von Lothian genannt.«
Catherine umklammerte die Hand meines Vaters. »Oh Ian, bitte, bitte sag uns, dass das nicht wahr ist.«
»Ich wurde nicht direkt im Beisein des Premierministers entlassen …«, entgegnete ich vorsichtig. »Sondern ein paar Sekunden, bevor er den Raum betreten hat, und dann musste Monro ihn davon in Kenntnis setzen.«
»Wie kannst du auch noch Witze darüber machen?«, zischte Laurence. »Glaubst du, dass dich irgendeine respektable Institution … oder Person … nach dieser Sache noch einstellen wird? Du hättest nie zur Kriminalpolizei gehen dürfen, wenn du nicht den Mut hast …«
Mit vor Zorn funkelnden Augen stürzte ich mich auf Laurence und packte ihn am Kragen.
»Ian, nicht!«, rief Catherine.
»Hör auf damit, du Schwachkopf!«, flüsterte ich Laurence so leise zu, dass nur er es hören konnte. »Du wärst beim CID schon in deiner ersten Dienstwoche zusammengebrochen.«
»Ian, lass deinen Bruder los. Sofort!«, befahl Vater, worauf ich Laurence von mir stieß. »Was würden die Leute sagen, wenn sie wüssten, dass die Brüder Frey sich so gut verstehen wie Hund und Katze?«
Wir hörten, wie sich der Butler räusperte. Er war schon vor einer Weile eingetreten, um das Abendessen anzukündigen, und hatte die Szene mit stillem Amüsement mitverfolgt.
»Ausgezeichnet«, sagte mein Vater. »Wir können die Angelegenheit beim Essen besprechen.«
»Ich habe keinen Hunger«, erwiderte ich sofort und ging zur Tür.
»Oh, du solltest aber lieber noch bleiben«, schaltete sich Elgie ein. Er zog mich am Arm und flüsterte mir dann ins Ohr: »Auch ich habe große Neuigkeiten!«
Resigniert stieß ich einen Seufzer aus. Irgendwie konnte ich diesem Schlingel nichts abschlagen. »Na schön, ich werde bleiben. Aber ich werde mich neben dich setzen.«
Während des Essens herrschte betretenes Schweigen. Bemüht, die Stimmung am Tisch aufzuheitern, erzählte Elgie uns lustige Geschichten vom Lyceum Theatre, wo er als Musiker engagiert war.
»… und dann sagte Mr Sullivan, wir würden alle beeindruckt sein, wie sehr seine Nichte doch das Cembalo beherrsche – ich musste mir auf die Lippen beißen, um nicht zu sagen, dass sich das Cembalo anhört wie das Gejaule zweier rolliger Katzen!«
»Elgie!«, rief seine Mutter, »ich dulde solch unflätige Ausdrücke am Tisch nicht! Dein Vater auch nicht!«
Der alte Mann lachte allerdings hinter seiner Serviette. Dies wiederum erschien Elgie als perfekter Moment, um zuzuschlagen.
»Wo wir gerade von Mr Sullivan sprechen: Er hat eine fantastische Partitur für den neuen Macbeth komponiert. Mama hat sie gehört.«
»Oh, in der Tat. Mr Sullivan hat mich zu einer Probe eingeladen; wundervolle Musik. Mich stört nur, dass diese alte Trulle Ellen Terry die Rolle der Lady Macbeth übernimmt. Andererseits braucht es wohl einen Drachen für diese Rolle.«
»Da es ›Das Schottische Theaterstück‹ ist«, fuhr Elgie fort, »wollen sie damit im kommenden Sommer auf Tournee nach Edinburgh gehen …« Sein Blick fiel auf mich, und ich wusste sofort, worauf er hinauswollte. »Der Scottish Theatre Company mangelt es an Musikern, daher … nun, sie haben mir eine Stelle dort angeboten.«