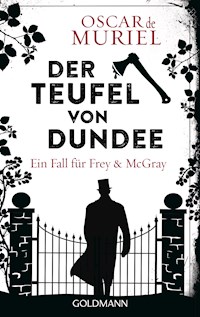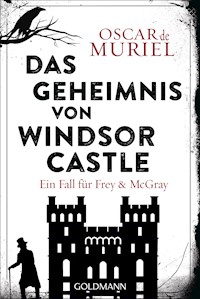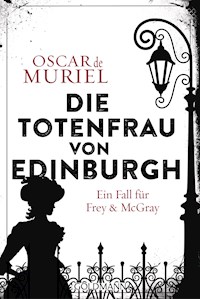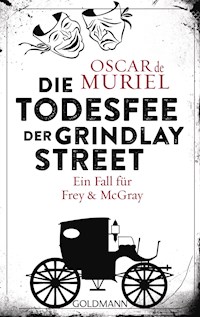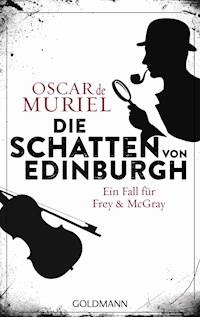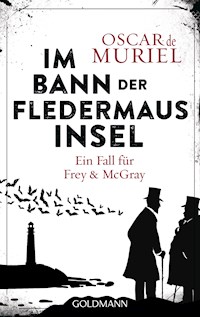
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Frey und McGray
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die Highlands 1889. Als der junge Erbe der betuchten Familie Koloman eine Todesdrohung erhält, reisen Inspector Frey und sein Kollege McGray unverzüglich zum nebelverhangenen nördlichen Zipfel des Landes. Dort, am abgelegenen Loch Maree, kommen sie im unheimlichen Herrenhaus der Kolomans unter. Die nahegelegene Insel ist von Fledermäusen befallen, und jeder der Bewohner scheint etwas zu verbergen. Als kurz darauf ein grausamer Mord im Wald geschieht, ist den Ermittlern klar: Um die Geheimnisse des mysteriösen Loch Maree zu wahren, geht jemand über Leichen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 636
Ähnliche
Buch
Schottische Highlands 1873. Die blutjunge Millie Fletcher, Hausangestellte bei der betuchten Familie Koloman am abgelegenen Loch Maree, legt ihren Säugling Benjamin in die Hände des Geistlichen Pater Thomas. So darf sie ihre Stellung im Herrenhaus der Kolomans behalten, und der Ruf des leiblichen Vaters Maximilian Koloman wird geschützt.
Highlands 1889. Über fünfzehn Jahre später bittet Millie die Inspectors Frey und McGray um Hilfe, denn sie hat eine anonyme Todesdrohung für Benjamin erhalten. Unverzüglich reisen die beiden Ermittler an den nebelverhangenen nördlichen Zipfel des Landes. Dort kommen sie im unheimlichen Herrenhaus der Kolomans unter. Die nahegelegene Insel ist von Fledermäusen befallen, und jeder der Bewohner scheint etwas zu verbergen. Als kurz darauf eine grausam ausgeblutete Leiche im Wald gefunden wird, ist den Ermittlern klar: Um die Geheimnisse des mysteriösen Loch Maree zu wahren, geht jemand über Leichen …
Weitere Informationen zu Oscar de Muriel sowie zu lieferbaren Titeln des Autors
Oscar de Muriel
Im Bann der Fledermausinsel
Die englische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel»Loch of the Dead« bei Penguin Books Ltd., London. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Januar 2020 Copyright © der Originalausgabe by Oscar de Muriel Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München Covermotiv: FinePic®, München Redaktion: Eva Wagner MR · Herstellung: kw Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
Das vierte ist für Doña Magda,
Und wer darin benetzt die Stirn mit Vorsicht oder glühend Wahn, spürt neu zurück sein frisches Hirn und gibt der inn’ren Eintracht Bahn.
(John Whittier, 1877,
1873
28. Mai
Ich habe das kleine Balg nie gewollt, dachte Millie, während sie auf das pausbäckige, liebliche Gesicht des Säuglings hinabschaute. Das Schwanken des Bootes hatte ihn in den Schlaf gewiegt. Sein kleiner Brustkorb hob und senkte sich im Rhythmus der Wellen, während der Kleine mit seinen dicken Fingerchen die zerlumpte Decke umklammert hielt.
Sogar den Kräutertee habe ich bei mir behalten, erinnerte sich Millie. Ich habe die Lippen gegen den Rand der Tasse gepresst und das Gift gerochen. Ich wollte dich aus meinem Körper vertreiben, so, als wärst du eine Krankheit.
Unvermittelt lief ihr eine Träne über die Wange und fiel auf die Decke.
Millie wischte sie sofort ab. Niemand hatte sie je weinen gesehen. Niemand, außer …
Das Kind regte sich in ihren Armen und stieß ein leises Wimmern aus, womöglich von der abrupten Bewegung aus dem Schlaf gerissen. Millie drückte den Kleinen noch fester an sich, wiegte ihn und flüsterte liebevoll: »Na, komm.«
Woher rührte das alles? Sie war nie zärtlich, sanft oder sentimental gewesen, hatte nie mit Puppen gespielt. Wie kam es, dass sie nun genau wusste, was zu tun war, wie sie ihn halten, wie sie ihn in den Schlaf wiegen musste? Warum verspürte sie diesen Schmerz in der Kehle und diesen beklemmenden Druck auf der Brust?
»Gewinn ihn nicht zu lieb, Mädchen«, riet ihr Mr Dailey, während er das Boot durch die Dunkelheit lenkte. »Gleich wird er nicht mehr da sein.«
»Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram, Sie alter Trottel.«
Er konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. »Aye, das ist unsere Millie …«
Mr Dailey ruderte weiter, orientierte sich dabei lediglich an der Position des verschwommen zu erkennenden Monds. Dichter Nebel war aufgezogen, und die Umrisse der uralten Begräbnisstätte tauchten erst auf, als sie kaum mehr als zehn Meter entfernt waren. Isle Maree war nicht mehr als eine gräuliche, fast perfekte Kuppel aus Eichenkronen und hob sich kaum von der nächtlichen Dunkelheit ab. Als sie näher kamen, erblickten sie einen blassen Schimmer, der bernsteinfarben und beständig aus dem Herzen der Insel zu ihnen drang – eine Laterne, mit der signalisiert wurde, dass ihr Treffen wie vereinbart stattfinden würde. Mit einem Mal wurde Millie von Schrecken gepackt.
Geschmeidig glitt das Boot ans Ufer. Mr Dailey stiefelte ins Wasser und zog am Tau, bis der Bug sicher auf dem Kiesstrand angelandet war. Dann reichte er Millie die Hand, doch sie nahm sie nicht an – das Mädchen erhob sich zu ihrer vollen, imposanten Größe und schritt trotz ihres wild hämmernden Herzens voran, auf die grüne Wand zu. Sie passierten die äußere Reihe der Eichen, deren dicke Stämme fast horizontal in Richtung Wasser wuchsen, wie die ausgestreckten Finger einer flehenden Hand.
Millie steuerte das schwache Licht an, und wenig später tauchten die uralten Grabsteine auf, die verstreut zwischen den knorrigen Eichen und den Stechpalmen standen, ihre Kanten von jahrhundertelangem rauem Wetter in Mitleidenschaft gezogen.
»Da kommen sie«, ließ in diesem Moment jemand verlauten. Es war eine Männerstimme, die Millie noch nie vernommen hatte, doch sie wusste, dass es die Stimme des Geistlichen sein musste, des Mannes also, der im Begriff war, ihr den Sohn für immer zu entreißen. Sie erkannte ihn sofort, da er neben den beiden vertrauten Gestalten stand: dem schmierigen Calcraft, der die Laterne hochhielt, und der eleganten Mrs Minerva Koloman, deren blasses Gesicht unter ihrer blutroten Kapuze wie Silber glänzte.
Als der Priester Millie erblickte, zog er die Brauen hoch und legte den Kopf ein wenig zurück. Natürlich. So reagierten alle, wenn sie gewahr wurden, dass Millie tatsächlich noch ein junges Mädchen war. Obschon sie sich daran gewöhnt hatte, ließ die Bewegung sie heute Abend zögern.
»Es ist alles in Ordnung, Kind«, beruhigte die Lady sie. »Tritt näher.«
Das tat Millie nun auch, stellte sich jedoch bewusst hinter einen ausladenden Grabstein, so als könne ihr der mit Moos überwucherte Granit, der ihr kaum bis an die Knie reichte, wie eine Festungsmauer Schutz bieten.
»Du bist also Millie«, sagte der Priester. Seine Stimme klang sanft und freundlich, doch war Millie alles an ihm zuwider: sein gütiges Lächeln, sein gewissenhaft gekämmtes Haar, seine Finger, die er entspannt vor der Brust verschränkt hatte … die Farbe seiner Augen, die sie so gut kannte.
»Auf wie viele Mädchen mit einem Bastard haben Sie denn gewartet?«
»Millie!«
»Schon gut, Minerva«, sagte der Geistliche und hob beschwichtigend die Hand. »Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht leicht für sie wird. Darf ich das Kind sehen, Millie?«
Instinktiv zuckte sie zurück, drückte das kleine Bündel noch dichter an sich. Calcraft kicherte, sodass die Laterne in seiner Hand wackelte und ringsum flüchtige Schatten warf.
Mrs Koloman kam näher. Sie war schlank und fast dreißig Zentimeter kleiner als Millie, bugsierte ihr junges Dienstmädchen jedoch ohne Schwierigkeiten um den Grabstein herum.
»Lass uns sein hübsches Gesicht sehen«, bat Mrs Koloman, als sie dicht vor dem Priester standen. Mit großer Behutsamkeit zog sie den Saum der Decke zurück, worauf sie allesamt neidvoll den ruhigen, sorglosen Schlaf des Babys beäugten. Mrs Koloman schaute auf die Gräber, die sie umgaben, und stieß einen Seufzer aus. »Es ist traurig, dass du ihn hier zum letzten Mal siehst, im Land der Toten.«
»Im Gegenteil«, widersprach der Priester, »ein Kind ist neues Leben.«
Er streckte die Arme aus, um den Kleinen in Empfang zu nehmen, doch Millie trat entschlossen einen Schritt zurück.
»Nein!«, rief sie, als hätte man sie aufgefordert, das Baby ins Feuer zu werfen.
»Was willst du …«
»Ich behalte ihn, verstehen Sie?«
Calcraft kicherte erneut, worauf Mr Dailey ihm eine schallende Ohrfeige versetzte. »Zeig Respekt, du Idiot.«
Mrs Koloman langte nach Millies Arm, doch das Mädchen entzog ihn ihr. »Millie, du weißt doch, dass es nicht anders geht.«
»Wer sagt das?«, blaffte sie, obwohl sie wusste, dass es sinnlos war, dagegen anzugehen.
Mrs Koloman hob die Hand und fasste Millie schließlich an die Schulter. »Man wird sich um ihn kümmern, wird ihn unterrichten, es wird ihm an nichts fehlen. Es ist das Beste für ihn … Denk nur, was sonst wäre.«
Millie spürte, wie ihr Tränen die Wangen herabrannen, hörte sich schluchzen. Es war ein schreckliches Geräusch, das klang, als käme es von jemand anderem.
»Schon gut«, sagte der Priester erkennbar eingeschüchtert, während er sachte die Hand unter das Baby gleiten ließ.
Millie spürte, wie ihr das Gewicht aus den Armen genommen wurde, und wollte erneut einen Schritt zurücktreten, doch Mrs Koloman hielt sie energisch fest.
»Millie, lass ihn los!«
Das Mädchen beugte sich vornüber, um die Stirn des Babys zu küssen, doch unmittelbar bevor ihre Lippen den Kleinen berührten, überlegte sie es sich anders. Denn dann hätte sie sich nicht mehr von ihm trennen können.
Ihr war, als risse man ihr das Herz heraus. Einen solchen Schmerz hatte sie noch nie verspürt. Nicht einmal damals, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war und die anderen Kinder sie mit faulem Obst beworfen und sie unflätig beschimpft hatten. All dies hätte sie jetzt hundertfach ertragen, wenn es bedeutet hätte, dass sie ihr Baby behalten konnte.
»Liebe tut weh, mein Kind«, flüsterte Mrs Koloman und strich ihr sanft über den Rücken, selbst dicht davor, in Tränen auszubrechen.
Der Priester wiegte das Kind mit geübten Bewegungen in seinen Armen. Die Art und Weise, wie er die Decke um den Kleinen schlug, ließ erkennen, dass er sich wahrscheinlich schon um Dutzende »Waisenkinder« gekümmert hatte.
Er schaute zu ihr auf. »Wie sollen wir ihn nennen?«
Die Frage linderte Millies Kummer ein wenig. Schniefend ging ihr auf, dass sie daran noch keinen Gedanken verschwendet hatte.
»Benjamin«, antwortete sie dann, »nach meinem verstorbenen Vater.«
Der Geistliche lächelte. »Er sieht auch aus wie ein Benjamin.«
An dieser Erinnerung klammerte sich Millie fest. Noch Jahre später führte sie sich immer dann, wenn sie Zweifel am Schicksal ihres Sohnes hegte, die Erinnerung an den lächelnden Priester und seine freundlichen Worte vor Augen.
»Mr Dailey«, sagte Mrs Koloman, »können Sie Father Thomas zu Ihrem Gasthof mitnehmen? Wir haben Vorkehrungen dafür getroffen, dass ihn morgen früh eine Kutsche abholen kommt. Schicken Sie uns die Rechnung, wie immer.«
»Das hier geht auf mich, Mrs Koloman«, erwiderte er. »Und was geschieht mit Millie?«
»Sie kommt mit uns. Es gibt jetzt nichts mehr, was verborgen werden müsste.«
Millie und Mr Dailey wechselten betrübte Blicke. Er hatte sie während der letzten Monate in seinem nahegelegenen Gasthof untergebracht und damit den Blicken entzogen, als ihr Zustand unübersehbar geworden war. Millie hatte der Ehegattin des Mannes bei den Arbeiten im Haushalt geholfen, zu denen sie imstande gewesen war, und sie hatten einander an vielen Abenden Geschichten am Kaminfeuer erzählt. Nun begriffen sie, wie sehr sie einander vermissen würden.
Mrs Koloman bemerkte es. »Wir werden Millie in unseren Diensten behalten«, erklärte sie. »Sie wird Sie und Mrs Dailey oft besuchen können.«
Mr Daileys Reaktion bestand lediglich aus einem tiefen Grunzlaut, doch als er dem Priester den Weg zu seinem Boot zeigte, blinzelte er dabei seine Tränen weg. Die beiden Männer verabschiedeten sich und brachen gleich danach auf, doch Millie brachte es nicht über sich zuzuschauen, wie sie in der Ferne verschwanden. Stattdessen schaute sie auf die beiden gesprungenen Grabplatten mit eingravierten Kreuzzeichen vor sich hinab. Darauf stand, dies sei die Ruhestätte eines alten Königs und seiner geliebten Königin, die nun auf ewig Seite an Seite ruhten.
»Calcraft«, sagte Mrs Koloman, »geh und mach das Boot bereit. Wir treffen uns dann dort.«
»Ma’am, da gibt es gar nichts vorzu…«
»Tu, was ich gesagt habe!«
So unverfroren er sein mochte, wagte es der achtzehnjährige Lakai jedoch nicht, sich Mr Kolomans Gattin zu widersetzen. Er nahm die Laterne und schlenderte zum nördlichen Ufer der Insel davon, wo das Boot der Kolomans lag.
Während das Licht immer schwächer wurde, starrte Millie ihre nun leeren Hände an. Mrs Koloman nahm eine in die ihren. Die Haut der Lady war weich und makellos, sie wurde sorgfältig vor Sonneneinwirkung geschützt. Millies Hände waren sommersprossig und von der Arbeit aufgeraut.
Langsam, so als gebe sie unter einem enormen Gewicht nach, beugte Millie den Rücken, ließ die Stirn auf die Schulter ihrer Herrin sinken und weinte stumm.
»Ich weiß, mein Kind, ich weiß. Ich bin selbst Mutter.«
Sie ließ Millie weinen und wartete geduldig, bis sich das Mädchen wieder aufrichtete und sich mit ihrem bereits schmutzigen Ärmel die Nase putzte.
»Hier«, sagte Mrs Koloman und reichte ihr ein besticktes Taschentuch. »Millie, da ist noch etwas, um das ich dich bitten muss.«
Das Mädchen nickte nur, zu erschöpft, um denken oder Einwände erheben zu können. Die Lady holte tief Luft.
»Es gibt da jemanden, der deine Milch braucht.«
1889
17. August, 5 Uhr morgens
Adolphus McGray trat die Haustür ein. Das Splittern des Holzes hallte in der Diele wider wie ein Donnerschlag. Dann herrschte Stille. Das Bauernhaus lag dunkel und verwaist wie ein Grab da.
Erst jetzt wurde Adolphus gewahr, dass sein Herz hämmerte und ihm kalter Schweiß von der Stirn troff.
»Vater?«, rief er. »Pansy?«
Keine Antwort.
Nach dem Ritt im gestreckten Galopp wirkte die Stille an diesem Ort schreiend. Mit unsicheren Schritten trat Adolphus ein. Hier war wirklich etwas ganz und gar nicht in Ordnung.
»Wo seid ihr al– …«
Aus der Bibliothek drang ein gellender Schrei, das qualvollste Geheul, das er je vernommen hatte. Es war die Stimme seiner Schwester.
»Pansy!«, schrie er und rannte den Flur entlang, den lauter werdenden Schreien entgegen. Es war eine vom Wahnsinn gepackte Stimme, die sich wie ein Dolch in seine Ohren bohrte.
Als Adolphus die Bibliothek erreicht hatte, drückte er die Klinke herunter. Doch die Tür war verriegelt.
»Pansy!«, schrie er erneut und hämmerte wie rasend gegen die Tür. Seine Schwester stieß einen weiteren gellenden Schrei aus, der gar nicht mehr zu enden schien – ein schriller, gleichbleibender Ton.
Adolphus warf sich gegen die Tür, tat es gleich noch einmal, zweimal, dreimal – bis die Zarge endlich nachgab und das Schloss zerbarst.
Genau in dem Moment, in dem er in die Bibliothek stürmte, ebbte Pansys mittlerweile krächzender Schrei ab, weil alle Luft aus ihrer Lunge gewichen war. Adolphus benötigte einen kurzen Moment, um in dem schummrigen Licht etwas zu erkennen, doch was er erblickte, sollte sich für den Rest seines Lebens in sein Gedächtnis einbrennen.
Pansys weißes Sommerkleid war voller Flecken, und auch sie selbst war über und über mit dunkelroten Spritzern bedeckt. Die Sechzehnjährige war mitten im Raum auf die Knie gesunken und hatte sich zusammengekauert. Zuerst glaubte Adolphus, sie wäre verletzt, doch dann erblickte er zwei blutüberströmte Körper neben ihr.
Ihr beider Vater lag mit unnatürlich abgewinkelten Armen auf dem Teppich. Die einzige Bewegung war die des Blutes, das ihm aus der Brust quoll und eine Lache bildete.
Hinter ihm lag mit dem Gesicht nach unten der Körper einer Frau. Obwohl er ihr Gesicht nicht sehen konnte, erkannte Adolphus sofort, dass es sich um seine Mutter handelte. Doch da war etwas Schimmerndes, das irgendwie über ihr zu schweben schien … Dann begriff er: Ein Schürhaken hatte ihr den Rücken durchbohrt und ragte daraus hervor wie eine Gabel aus einem Stück Fleisch.
Entsetzt stieß Adolphus einen erstickten Laut aus. Seine zitternden Beine versagten ihm den Dienst, und er musste sich am Türrahmen anlehnen.
Pansy fing an zu weinen und wiegte sich dabei vor und zurück. Auf ihrem Schoß lag ein weiterer schimmernder Gegenstand. Es handelte sich um das schärfste Hackmesser aus der Küche, dasjenige, mit dem Betsy immer Knochen durchtrennte. Von der breiten Klinge tropfte noch das Blut.
Dann erkannte Adolphus, dass Pansy das Messer fest umklammert hielt, und nun dämmerte in ihm eine entsetzliche Erkenntnis.
»Oh, Pansy …«, flüsterte er, während ihm Tränen das Gesicht herabliefen. »Wa… was hast du …«
»Es war der Teufel«, flüsterte Pansy, jedoch mit einer Stimme, die nicht die ihre zu sein schien. Es war ein rauer, giftiger Ton, der tief aus ihrer Kehle drang.
»Wa… was meinst du damit?«
Plötzlich erhob sich das Mädchen, brüllte auf wie ein wildes Tier, schwang das blutverschmierte Hackmesser und stürzte sich auf Adolphus.
Ein kleiner Schritt zurück rettete ihm knapp das Leben. Das Messer schlitzte ihm die Vorderseite des Mantels auf, und er spürte, wie die Klinge seine Brust einritzte.
Sie kam näher, versuchte ihn zu erdolchen, und er hatte keine andere Wahl, als schützend die Hände zu heben, um die Klinge abzuwehren. Die ersten Hiebe konnte er ablenken, spürte den kalten Stahl und versuchte, Pansys Handgelenke zu fassen zu bekommen, als er plötzlich merkte, dass er blutete. Zwar gelang es ihm, Pansy zu packen, doch sie wehrte sich wie ein wildes Tier.
»Pansy, hör auf!«
Er erhaschte einen Blick auf ihre blutunterlaufenen Augen, die auf ihn geheftet waren. Sie war nicht wiederzuerkennen. Ihre Pupillen waren wie dunkle Löcher, die in eine aufgewühlte Unterwelt führten. Der Moment währte nicht einmal eine Sekunde in diesem fieberhaften Kampf, doch dieser starre Blick würde ihm auf immer in Erinnerung bleiben.
Dann vernahmen sie Stimmen.
Menschen näherten sich und riefen dabei die Namen der McGrays. Unter ihnen erklangen die zu verängstigten Schreien verzerrten Stimmen der Bediensteten, George und Betsy.
Pansy versetzte Adolphus einen heftigen Hieb in die Magengrube, worauf er in die Knie ging. Ein durchdringender Schmerz in der Hand zwang ihn dazu, seine Schwester loszulassen. Sofort stürmte sie aus dem Zimmer, nach wie vor wie wahnsinnig kreischend.
Adolphus vernahm die schockierten Rufe der Männer, die soeben eingetroffen waren, dazu die im ganzen Haus widerhallende Stimme seiner Schwester, die nun wahllos von Zimmer zu Zimmer raste.
Adolphus stützte sich auf dem Boden ab, um sich aufzurichten. Ein brennender Schmerz durchfuhr seine Hand, und als er hinabschaute, konnte er einen entsetzten Schrei nicht unterdrücken.
Sein Ringfinger war fast vollständig abgetrennt.
Unwillkürlich hob er die Hand, worauf ihn ein sengender Schmerz durchfuhr. Der Anblick ließ ihn vor Schreck erstarren: Sein Finger hing nur noch baumelnd an einem dünnen Lappen zerfetzter Haut. Er konnte die weißen Knochen im inneren des blutenden Fleisches sehen.
»Hi– … Hilfe!«, stieß er ächzend hervor, während er sich das Handgelenk hielt und verzweifelt versuchte aufzustehen, doch inmitten des Geschreis in den anderen Zimmern hörte ihn niemand.
Auf den Knien schleppte sich Adolphus verzweifelt zur Tür.
Dann sah er es.
Er erhaschte nicht mehr als einen verschwommenen Blick, bevor er das Bewusstsein verlor. Es war eine entstellte, verdrehte Gestalt, die sich ruckartig auf das Fenster zubewegte.
Der Teufel, so schien es ihm. Mit großen, verbogenen Hörnern und verkohltem Fleisch … Endlich begriff er, dass er wieder den gleichen Traum träumte.
McGray konnte sich gar nicht mehr erinnern, wie oft er von diesem entsetzlichen Abend geträumt hatte, doch der Traum war jedes Mal so lebendig wie das reale Ereignis. Der Anblick seiner toten Eltern, die unerträglichen Schreie seiner Schwester, der brennende Schmerz in seiner Hand … trotz all der Jahre schien nichts davon zu verblassen.
Es war die Furcht vor diesem Traum, die ihn an den meisten Abenden wach hielt, auch wenn er sich dies nicht eingestand. Er tat dann alles, um wach zu bleiben – lesen, schreiben, rauchen, das eine oder andere Schlückchen trinken –, und nach sechs Jahren hatte er sich daran gewöhnt. Doch ganz ohne Schlaf kam er nicht aus.
Am vergangenen Abend beispielsweise war er aus purer Erschöpfung in den Schlaf gefallen. Er war den ganzen Tag über auf einem Dampfschiff von Edinburgh nach Aberdeen unterwegs gewesen und dann weiter auf die Orkney-Inseln gereist, wo Pansy mittlerweile in Abgeschiedenheit lebte. Er war volle zwei Tage lang unterwegs gewesen, hatte sich dabei ausschließlich von Salzhering, hartem Brot und verdünntem Ale ernährt und es arg mit der Seekrankheit zu tun bekommen (von der er nie jemandem etwas gesagt hatte). So hervorragend er das Schwimmen beherrschte, so dreckig ging es ihm auf Booten.
Als McGray es dann endlich auf die einsame, vom Wetter gebeutelte Insel geschafft hatte, hatte man ihm dort schlichtweg beschieden, er dürfe seine Schwester nicht besuchen.
»Der Grund, das Mädchen hierherzubringen, war doch genau der, sie von Ihnen fernzuhalten!«, lauteten die unverblümten Worte der kräftig gebauten Oberschwester, Mrs Jennings.
McGray – nicht gerade ein Vorbild an Zurückhaltung – hatte prompt einen heftigen Wutanfall bekommen und dermaßen geflucht, dass selbst abgefeimteste Kneipenschläger zusammengezuckt wären. Mrs Jennings hingegen behauptete sich ihm gegenüber. Sogar als McGray ihr damit drohte, sich an Dr. Clouston zu wenden, beharrte die Pflegerin darauf, der Arzt stünde hinter ihr. Schließlich sei es doch seine Idee gewesen, Pansy hier unterzubringen.
Der »gute Doktor«, wie ihn die meisten hier nannten, leitete die vorbildliche Irrenanstalt von Edinburgh. Er kümmerte sich schon seit mehr als sechs Jahren um Pansy und kannte ihre Krankengeschichte besser als jeder andere. Ursprünglich von den Orkneys stammend hatte Dr. Clouston in der Welt der Psychiatrie rasch erfolgreich seinen Weg gemacht. Und wenn irgendwer imstande war, Pansy zu behandeln (und sich Gedanken um ihr Wohlergehen machte), dann war er es. Mittlerweile finanzierte er diese Einrichtung, Manse Lodge, aus eigener Tasche. Es handelte sich um ein kleines Altersheim für die Senioren der Insel, und Clouston hielt es für den idealen Ort, um das Mädchen behütet unterzubringen. Wenngleich McGray sich fürchterlich darüber aufgeregt hatte, hatte er zustimmen müssen. Ausschließlich von Pflegerinnen und alten Leuten umgeben, würde dem Mädchen zumindest eine gewisse Ungestörtheit zuteilwerden.
Erst als ihm bewusst wurde, dass er träumte, spürte McGray ihre Gegenwart.
Sie hatte sich ihm behutsam genähert, war aus dem Nichts heraus aufgetaucht und vermischte sich nun allmählich mit dem Alptraum, den er gerade gehabt hatte. Sie war eher ein Gefühl als ein Bild und schwebte nun über seinem Bett wie ein Geist.
Sie flüsterte ihm etwas zu. Was war es? McGray vermochte die Worte nicht auszumachen, hörte nur die bebende, leise Stimme.
Er spürte sogar eine hauchzarte Berührung auf seiner Stirn, eine winzige, zarte Liebkosung, wie ein Gutenachtkuss seiner verstorbenen Mutter, nur zehnmal schwächer. Es war diese auf seiner Haut verweilende Sinneswahrnehmung, die ihn glauben ließ, dass es sich womöglich doch nicht um einen Traum gehandelt hatte.
Während er im Bett lag und darüber nachsann, starrte er die rissige Zimmerdecke an. Durch die verblichenen, hauchdünnen Vorhänge fiel das bereits helle Tageslicht herein, und sie wehten leicht in der Zugluft, die durch das ramponierte Fenster eindrang. Mrs Jennings hatte ihm zwar gestattet, hier zu übernachten, doch nur unter der strikten Auflage, dass er sich gleich frühmorgens wieder auf den Weg machte. Sie hatte ihm ein schäbiges, feuchtes Zimmer im obersten Geschoss überlassen, mit einem Bett, das viel zu kurz für ihn war. Er hatte in Stiefeln geschlafen, und seine Füße hatten über das Fußende hinausgeragt. Die Oberschwester hatte erwähnt, das Zimmer sei nur deshalb frei, weil sein gebrechlicher Bewohner in der Nacht zuvor das Zeitliche gesegnet habe – als könnten derlei Geschichten Nine-Nails McGray vergraulen.
Schließlich setzte er sich auf und erhaschte in dem winzigen Spiegel, der in dem Zimmer hing, einen Blick auf sich. Zwar scherte er sich nicht besonders um Äußerlichkeiten, doch selbst er musste einräumen, dass er eine heruntergekommene Erscheinung abgab. Seine dichte schwarze Mähne, durchsetzt mit frühzeitig ergrauten Strähnen, war völlig zerzaust; sein kantiges Kinn, nach Jahren fortwährender Anspannung hervortretend, von ungepflegten Bartstoppeln überzogen. Einzig in seinen großen tiefblauen Augen blitzte noch immer etwas von jenem sorglosen Fünfundzwanzigjährigen auf, der mitansehen hatte müssen, wie seine Schwester vom Wahnsinn ergriffen wurde.
Jetzt vernahm McGray Stimmengewirr aus dem Stockwerk unter ihm. Es war die Stimme einer Frau, die er nicht kannte. Dann stampfende Schritte, gefolgt von Mrs Jennings wütendem Geschrei.
»Och, das fette Miststück ist schon auf den Beinen«, murrte McGray und rieb sich die Augen. Erneut schrie die Frau etwas, und dieses Mal schwang ein Anflug von Verzweiflung in ihrer Stimme mit. McGray stieß einen verdrießlichen Seufzer aus, stand auf und zog seine Tartanhose an. Als er aus der Zimmertür trat, nichts als die Hose und sein halb zugeknöpftes Hemd tragend, sah er die stämmige Frau auf sich zueilen, gefolgt von zwei jüngeren Schwestern, die beide leichenblass waren.
»Was ist …«
»Ihre Schwester«, sagte Mrs Jennings. »Sie ist verschwunden!«
Wäre sie ein Mann gewesen, hätte McGray sie am Kragen gepackt. »Was soll das heißen, sie ist verschwunden?«
»Unsere Mary hier wollte ihr das Frühstück bringen, aber das Mädchen ist weg!«
Mary zitterte wie Espenlaub. »Ich habe überall nachgeschaut, Sir. In den anderen Zimmern, auf den Fluren …«
»In der Küche und der Waschküche«, fügte die zweite Pflegerin gleichermaßen besorgt hinzu.
Unwillkürlich musste McGray an seinen Traum denken.
»Schließt ihr die Zimmer nicht ab?«
»Wir schließen nie Zimmer ab«, erwiderte Mrs Jennings mit einem Anflug von Stolz. »Wir halten hier niemanden gefangen. Und so etwas hat Ihre Schwester vorher noch nie getan.« Sie trat einen kleinen Schritt vor. »Sie sind es, der hierhergekommen ist und das arme Ding aufgewühlt hat! Bestimmt hat sie Sie gestern Abend herumschreien gehört.«
Am liebsten hätte McGray die Frau mitten auf ihre Knollennase geschlagen. Stattdessen schoss er den Flur entlang auf die Treppe zu.
»Hoffentlich sind Sie jetzt zufrieden!«, rief ihm Mrs Jennings hinterher, doch McGray durchkämmte schon die Zimmer im ersten Obergeschoss.
»Es ist zwecklos, Sir«, sagte die Pflegerin Mary, die ihm hinterhergelaufen war. »Bevor ich Alarm geschlagen habe, haben wir jedes Zimmer im Gebäude durchsucht.«
»Draußen …«, murmelte McGray und eilte zur Haustür hinaus auf die windumtoste Bucht von Kirkwall zu. Die kühle Morgenluft schlug ihm entgegen und verstärkte das nagende Gefühl, das in ihm aufkeimte, während er das offene Gewässer vor sich absuchte.
Manse Lodge befand sich am Rand einer abgeschiedenen Straße, die sich an die kleine Bucht schmiegte, nur wenige Meter vom breiten Sandstrand entfernt, auf dem sich die Wellen brachen.
Unwillkürlich malte sich McGray aus, wie Pansy manisch auf das Wasser zugelaufen war, vielleicht schon vor Stunden, und sich dann ins Meer gestürzt hatte und für immer in seinen Weiten verloren gegangen war.
»Pansy!«, brüllte er und schaute sich in alle Richtungen um. Das flache, baumlose Grünland zog sich entlang, so weit das Auge reichte, karg und öde, fast selbst wie ein Meer. Die einzigen Landmarken waren die Häuser, die sich um den Hafen scharten, eine halbe Meile entfernt, und jenseits davon, kaum sichtbar, die Turmspitze von Kirkwalls einziger Kirche. Seine Schwester war nirgends zu sehen.
Während McGray die Bucht entlanglief, rief er erneut nach Pansy. Es war zwar Hochsommer, doch diese Inseln wurden nicht gerade von der Sonne verwöhnt, und tatsächlich ließ sein hechelnder Atem kleine Dampfwölkchen vor dem Gesicht aufsteigen. Er hörte, dass die Pflegerinnen herausgeeilt kamen. Ihre Rufe vereinten sich mit den seinen, und er fühlte sich vollkommen machtlos.
»Dort!«, rief in diesem Moment jemand hinter ihm. McGray wandte sich um und sah, dass eine junge Pflegerin auf das Wasser deutete. Sein Herz setzte einen Schlag aus.
Mit großen Schritten ging McGray in die Richtung, in die das Mädchen gewiesen hatte. Das Grünland endete abrupt, zerklüftet vom Meer, und fiel steil zu einem sandigen Pfad ab. Bei der im Moment herrschenden Ebbe war ein flacher Strand sichtbar, der ihm zuvor entgangen war. Der feuchte Sand glitzerte im Sonnenlicht, die Oberfläche war vollkommen eben. Gerade hatte sich eine Welle tosend gebrochen. Ihr Wasser rauschte an Land wie ein schaumiger Teppich, und inmitten dieser weißen Fläche erblickte McGray endlich die winzigen Umrisse von Pansy.
Er eilte hinunter, balancierte über Felsbrocken, Sand und Seetang hinweg, ohne die Augen von ihr abzuwenden. Pansy war völlig reglos, doch als McGray erkannte, dass sie zumindest stand, stieß er einen tiefen, erleichterten Seufzer aus.
Als er näher kam, erkannte McGray, dass seine Schwester immer noch ihr weißes Nachthemd trug. Sie hatte sich lediglich in ein dünnes blaues Umschlagtuch gehüllt, doch der größte Teil der Kleidung saß lose und bauschte sich im heftigen Wind, so als wäre sie die Flagge eines gesunkenen Schiffs und Pansy alles, was noch über Wasser ragte.
»Schwester …«, hob er an, spürte jedoch im gleichen Moment, wie sich eine Hand auf seiner Schulter niederließ.
»Sie trägt ihr Nachtkleid«, sagte Mrs Jennings und keuchte dabei so heftig, dass McGray ihre heißen Atemzüge im Nacken spürte. »Lassen Sie mich zu ihr gehen.«
»Verpissen Sie sich, Sie alte Schabracke!«
Es waren eher ihre Worte als ihre Hand, die ihn zur Besinnung brachten. »Lassen Sie ihr ein wenig Würde.«
Sie sagte es mit aufrichtigem Bedauern – die Frau konnte unmöglich völlig teilnahmslos sein – und ging nun mit großen Schritten zu der Wasserfläche, die sich gerade zurückzog. Mary kam ihrerseits herbeigerannt, wobei sie ihren Kleidersaum hob und durch das flache Wasser platschte.
Während er den Blick auf die Frauen geheftet hielt, die beide ein wenig kleiner waren als seine Schwester, ging McGray etwas auf. Für Pansy war Zeit vergangen. Sie war jetzt kein Mädchen mehr, sondern eine hochaufgeschossene, wunderschöne Frau von Anfang zwanzig, die so, wie sie nun auf das tosende Meer hinausschaute, irgendwie würdevoll wirkte, genauso reglos wie seinerzeit, als sie auf die Gärten vor der Anstalt in Edinburgh hinausgestarrt hatte. Schauend, aber nicht sehend.
Zum ersten Mal überfiel McGray eine düstere, schreckliche Gewissheit: Pansy würde erwachsen werden, das Leben würde weiter an ihr vorbeiziehen, sie würde alt werden – und ihre dunkelbraunen Augen würden für immer ausdruckslos bleiben.
Er rührte sich lange Zeit nicht vom Fleck, spürte jedes Mal das sanfte Anrollen des Wassers, wenn es kam und seine Füße umspülte.
Als Mrs Jennings sie am Ellbogen berührt hatte, war Pansy zusammengezuckt, und für einen schrecklichen Moment hatte McGray befürchtet, sie würde sich in die Wellen stürzen. Doch es blieb bei diesem flüchtigen, plötzlichen Zusammenzucken, und gleich danach war sie wieder erstarrt. Die Pflegerinnen, eine rechts, eine links, führten sie wieder zurück ins Haus.
Bewusst hielten sie dabei so viel Abstand wie möglich zu McGray, und aus der Entfernung heraus konnte er Pansys Gesichtszüge kaum ausmachen. Nach all seiner Mühe, nachdem er durch ganz Schottland gereist war, war dies nun alles, was er von ihr zu sehen bekommen hatte.
Aber er würde nicht länger insistieren. Dieser Zwischenfall ging eindeutig auf ihn zurück, und das Schuldgefühl setzte ihm nun stärker zu, als es der kalte Wind vermochte. Dr. Clouston hatte recht gehabt. Der Mann konnte sich eindeutig besser in Pansy hineinversetzen als er selbst.
Stundenlang noch hing McGray diesen Gedanken nach, während er mit beiden Beinen wie angewurzelt auf dem Sand stand, den Blick verloren auf das Meer gerichtet. Die Sonne stand schon hoch am blassen Himmel, als ein junger Mann auf ihn zukam. McGray hatte ihn zwar aus Manse Lodge kommen sehen, fühlte sich jedoch so ausgelaugt, dass er schlichtweg wartete, bis der Bursche ihn erreicht hatte.
»Sind Sie der Polizist?«, fragte der.
»Aye.«
»Da ist eine Telegrammsendung für Sie, Sir. Und zwar eine happige.« Mit diesen Worten überreichte er McGray einen dicken Umschlag.
Es war eine Nachricht von Ian Frey. Vier volle Seiten telegraphierter Text – für so etwas Geld hinzublättern, dazu konnte nur der leichtfertige Londoner bereit sein.
McGray hatte kaum die ersten Zeilen gelesen, als sein Puls zu rasen begann.
Frau aus den Highlands zu Besuch gehabt. Hat Fall für Sie.
UNDbehauptet, Heilmittel für Pansy zu kennen.
TEIL 1
Blicke nicht in den Wein, wie er blutig rauscht,
er verwundet zuletzt doch wie eine Schlange,
und haucht Gift wie eine Natter.
Dein Auge sieht wilde Gestalten, dein Herz denkt Verkehrtes.
(Buch der Sprüche Salomos, 23, 31–33)
1
Edinburgh, 16. August, 18.45 Uhr
Ich muss zugeben, dass ich mehrmals die Augen zusammenkneifen musste, bevor ich zweifelsfrei davon überzeugt war, dass sie eine Frau war.
Miss Millie Fletcher war von enormer Statur. Sie war so groß wie ich, hatte jedoch noch breitere Schultern und dermaßen klobige Hände, dass ich unwillkürlich ein Bild vor Augen hatte, wie sie damit einem Kaninchen das Genick brach. Nichtsdestotrotz hatte sie ein zartes, geradezu kindliches Gesicht – große blaue Augen mit langen Wimpern, feine, rosige Lippen und eine spitze Nase –, doch es war, als versuchte sie bewusst, jeden Anflug dieser Zartheit zu verbergen. Ihre Wangen waren übersät mit Sommersprossen, ihre Haut war wettergegerbt, und eine tiefe Falte auf der Stirn ließ ihren gesamten Gesichtsausdruck verhärtet wirken. Sie trug ihr lockiges blondes Haar in einem sehr schlichten Zopf, und ihre Erscheinung wurde weder verziert durch irgendwelchen Schmuck noch durch ein Tüpfelchen Schminke. Sie trug eine sackartig herunterhängende Herrenjacke und einen schlichten Wollrock, doch die Art und Weise, wie sie sich darin bewegte, verriet mir, dass sie sich ziemlich unwohl darin fühlte.
Zum ersten Mal begegnete ich ihr im Hof der City Chambers von Edinburgh, dem Präsidium der schottischen Polizei. Ich brannte darauf, meinen Dienst für heute zu beenden und zu feiern, dass diese lange (und vollkommen nutzlose) Irving-Terry-Stoker-Untersuchung endlich abgeschlossen war. Außerdem befand sich mein lieber Onkel in der Stadt, und ich freute mich darauf, mit ihm einen großen Brandy zu trinken.
Leider Gottes würde dies warten müssen. McNair, ein ebenso tüchtiger wie hagerer Constable, hatte seine liebe Mühe, die Frau in Schach zu halten.
»Ich sagte Ihnen doch, er ist nicht im Haus!«
»Und wo ist er dann?«, erwiderte sie mit fester Stimme und einem ausgeprägten Highlands-Akzent. »Er ist der Einzige, der mir helfen kann!«
»Zum dritten Mal, ich kann es Ihnen nicht sagen, Herzchen. Tut mir leid!«
Ich war versucht, mich an den beiden vorbeizustehlen und dabei das Gesicht abzuwenden. Diese Frau sah haargenau aus wie der Typ von Geistesgestörten, von denen McGray angezogen wurde, ein Vorbote des Unheils, des Blödsinns oder einer Mischung von beidem. Nichtsdestotrotz wirkte sie verletzt, und mein wirklich nerviges Gewissen spielte mir zum wiederholten Male einen Streich.
»Was ist los, McNair?«
Der junge Mann war erleichtert, als er mich sah. »Oh, Mr Frey, wie gut, dass Sie vorbeikommen. Dieses Mädchen, Millie Fletcher, will Inspector McGray sprechen.«
»Er weilt nicht in Edinburgh«, sagte ich und verschwieg dabei bewusst, dass er auf die Orkneys gereist war. Ich musterte die große Frau, die sich gerade sorgenvoll die Stirn massierte. »Was gibt es denn?«
»Ich reise gleich morgen früh zurück in die Highlands ab, aber ich brauche seine Hilfe. Ich muss mit ihm reden.«
Erneut wünschte ich mir, einfach schulterzuckend davonmarschieren zu können, doch die Frau war dicht davor, vor Verzweiflung in Tränen auszubrechen.
»Inspector Ian Frey, Madam«, stellte ich mich mit einem resignierten Seufzer vor. »Ich bin der Stellvertreter von Inspector McGray. Ich werde mir Ihren Fall anhören, wenn es Ihnen so unter den Nägeln brennt.«
Sie schaute mich argwöhnisch an. »Würde … würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir unter vier Augen miteinander sprechen, Sir? Es handelt sich um eine äußerst heikle Angelegenheit.« Trotz ihres starken Akzents hatte sie eine gut modulierte Stimme ohne jeden Anflug einer unverständlichen Mundart oder eines störenden Slangs.
»Ich war gerade im Begriff, nach Hause zu fahren«, sagte ich und schaute dabei auf die Kutsche, die bereits auf mich wartete. »Möchten Sie sich mir vielleicht anschließen?«
Erneut zögerte sie, holte tief Luft, willigte aber schließlich ein. Mit der Behändigkeit eines Kaminfegers sprang sie auf die Kutsche, und im nächsten Moment setzten wir uns in Bewegung.
Die Droschke brachte uns in die Nähe der drohend aufragenden Burg, die unter den grauen Wolken gespenstisch wirkte. Um die schroffe Anhöhe war leichter Nebel aufgezogen, der das mystisch anmutende Erscheinungsbild noch verstärkte. Es war zwar immer noch Sommer, aber Schottland bleibt eben Schottland.
Miss Fletcher schien verwirrt (geradezu alarmiert) zu sein, als sie begriff, dass wir auf die eleganteren Straßen der New Town zuhielten. Beim Anblick der georgianischen Villen an der Great King Street, wo ich meinen nicht ganz so bescheidenen Wohnsitz hatte, stieß sie einen Pfiff aus.
Wir wurden von Layton, meinem sehr dünnen, sehr englischen Diener, in Empfang genommen, der Miss Fletcher mit verblüffter Miene anstarrte.
»Oh, Mr Frey, ich wusste ja nicht, dass Sie Gesellschaft mitbringen. Ihr lieber Onkel …«
»Bitte sagen Sie meinem Onkel noch nicht, dass ich hier bin. Ich habe mit dieser Dame CID-Angelegenheiten zu besprechen. Bringen Sie uns etwas zu trinken in mein Arbeitszimmer. Tee, Miss Fletcher?«
»Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Whisky bevorzugen, Sir.«
Das war ziemlich dreist für eine Dame, aber ich nickte Layton zu und führte Miss Fletcher nach oben.
Mein privates Arbeitszimmer war klein, aber gemütlich. Es gab darin einen kleinen Kamin, bequeme Ledersessel, einen Bärenfellvorleger und einen schönen Blick auf die Sandsteinvillen auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
»Nicht schlecht für eine schottische Höhle«, hatte mein Onkel bei seiner Ankunft kommentiert.
Wenig später trat Layton mit einer Karaffe und Gläsern auf einem Tablett ein. Rasch entließ ich ihn wieder und schloss die Tür, da ich befürchtete, Onkel Maurice werde sich zu uns gesellen und uns auf seine schillernde Art und Weise stören.
Miss Fletcher hatte es sich derweil recht unbekümmert in einem der Ledersessel bequem gemacht und schenkte sich bereits ein großzügig bemessenes Glas Whisky ein. Als ich Platz nahm, goss sie mir die gleiche Menge ein. Während ich für mich bezweifelte, vor dem Abendessen so viel trinken zu können, kippte die Frau das ganze Glas in einem einzigen Schluck hinunter und goss sich gleich noch ein zweites voll.
Ich umfasste den Tumbler mit beiden Händen, verschränkte die Finger und bemühte mich, meinen Gast nicht allzu zweifelnd anzuschauen. »Also, wie kann ich Ihnen helfen, Miss Fletcher?«
»Ich werde ehrlich zu Ihnen sein, Sir. Ich bin gekommen, weil ich von Mr McGrays … äh … Interessen gehört habe.«
Ich nickte, gefasst darauf, nun etwas ausgesprochen Albernes zu hören zu bekommen. Schließlich widmete sich McGrays Sonderabteilung der Aufklärung von »Sonderbarem und Geisterhaftem«, und ich konnte nicht fassen, dass ich nun schon fast ein verfluchtes Jahr lang unter seiner Befehlsgewalt damit verbracht hatte, Hexen und Irrlichtern hinterherzujagen.
Miss Fletcher würde womöglich einen Fall vorbringen, der so absurd war wie der des durchtriebenen Lakaien, der behauptete, ein Kobold habe das fetteste Schwein seines Herrn geschlachtet und geröstet. Angesichts ihrer erkennbaren Not und der beachtlichen Größe ihrer Fäuste wollte ich nicht respektlos erscheinen und stellte meine Frage daher mit Bedacht.
»Darf ich fragen, woher Sie von Inspector McGray gehört haben?«
»Ja, Sir. Ich – nun, Mrs Koloman, also die Lady, der ich diene, zeigte mir einen Artikel im Scotsman. Darin stand, dass Mr McGray mit dieser Theateraffäre im vergangenen Monat betraut gewesen war.«
»Der Skandal um Henry Irving«, bestätigte ich. »Ja, dieser Fall war – wie soll ich es ausdrücken? Sehr pressewirksam.« Tatsächlich hätte er immer noch die Schlagzeilen beherrscht, wäre da nicht der Mord an Clay Pipe Alice gewesen, der jüngste der Whitechapel-Morde. »Was lässt Sie glauben, Inspector McGrays … unorthodoxe Erfahrungen könnten Ihnen helfen?«
Bewusst erwähnte ich nicht, dass ich zwar an dem Punkt angekommen war, McGrays Fähigkeiten als Detective in gewisser Weise zu respektieren, ihn aber dennoch für ein rücksichtsloses, verblendetes, penetrantes und geistig gestörtes Wrack hielt.
»Oh, Sir, ich glaube, ich bin diejenige, die ihm helfen kann.«
Ich neigte den Kopf und nahm einen kleinen Schluck. »Tatsächlich? Inwiefern?«
Die Frau schüttelte den Kopf. »Nun, ich sollte wohl lieber von vorne beginnen. Ich …« Sie starrte zur Decke, und ihr Gesichtsausdruck ließ mich dabei an einen ungeübten Klippenspringer denken, der soeben gesprungen ist: zaudernd, ängstlich, aber wohlwissend, dass es zu spät zur Umkehr ist.
»Sir, als Erstes muss ich Ihnen etwas erzählen, das nur sehr wenige Menschen von mir wissen. Und es muss streng vertraulich bleiben. Geben Sie mir Ihr Wort darauf?«
»Selbstverständlich, Miss. Ich bin CID-Inspector und ein Gentleman.«
Während sie nun sprach, legte sie die Stirn leicht in Falten. »Ich … nun, ich habe einen Sohn. Ich bekam einen Sohn, als ich noch ganz jung war, obwohl ich nie geheiratet habe.« Die Falten auf ihrer Stirn gruben sich tiefer ein. »Und der Vater war der Bruder meines Dienstherrn.«
Ich schwenkte mein Glas und lehnte mich zurück. »Ihr Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben, seien Sie versichert.«
»Danke, Sir. Das war vor sechzehn Jahren. Ich war selbst fast noch ein Kind, eine Dienstmagd, ohne Geld und ohne Familie, die mich hätte in ihre Obhut nehmen können. Sie können sich vorstellen, wie sehr ich mich damit in die Bredouille gebracht habe.« Hastig trank sie den Rest ihres Drinks aus und stellte das Glas lautstark auf dem Tisch ab. »Maximilian Koloman war ein elender Kerl und sagte zu mir, ich solle mich vom Acker machen. Er meinte, es wäre nicht sein Kind, und er wolle weder mit mir noch mit meinem Sohn etwas zu schaffen haben.«
Ich nickte. »Eine scheußliche Situation. Was haben Sie getan?«
»Ich war so verzweifelt, dass ich an seinen Bruder appellieren musste, das heißt, an meinen Herrn, Mr Konrad Koloman, von den Kolomans von Loch Maree. Haben Sie von der Familie gehört?«
»Ich fürchte, nein, aber ich lebe auch noch nicht lange in Schottland. Wie hat Ihr Herr die Nachricht aufgenommen?«
»Er war sehr gütig zu mir. Er und seine Ehefrau, Mrs Minerva. Die beiden haben mir gegenüber auf jeden Fall ein gutes Herz bewiesen.«
»Verzeihen Sie meine Taktlosigkeit … aber haben die beiden die Vaterschaft nicht in Zweifel gezogen?«
Die Frau schaute mich von der Seite an. »Sie kannten Maximilian – und sie kannten mich. Sie hegten keine Zweifel. Als ich meinen Zustand nicht länger verbergen konnte, schickten sie mich zu einem nahegelegenen Gasthof, wo ich dann heimlich entband. Sie bezahlten für meine Hebamme, den Gasthof und alles, und sie gaben mir auch meine Stellung wieder, aber die Kolomans wollten nicht, dass alle in der Gegend erfuhren, dass Maximilian einen Bast…« – sie zwang sich, tief durchzuatmen – »… ein uneheliches Kind gezeugt hatte.«
Miss Fletcher versank in tiefes Schweigen, und ich ließ ihr die Zeit.
»Benjamin«, fügte sie schließlich mit Tränen in den Augen hinzu. »Ich nannte ihn Benjamin, nach meinem verstorbenen Vater. Mrs Koloman sorgte dafür, dass er nach Norden geschickt wurde, nach Thurso, einem winzigen Küstenstädtchen am nördlichsten Zipfel von Schottland. Sie waren dort über irgendwelche familiären Beziehungen mit einem Priester bekannt. Mein Junge lebte in Thurso und wuchs dort in der Gemeinde auf. Sie haben ihn eingekleidet, ernährt und gut erzogen. Und auch das haben Mr und Mrs Koloman bezahlt.«
Ich schwenkte mein Glas ein wenig hin und her. »Sie sagten, man hat Ihnen gestattet, Ihre Stellung bei den Kolomans wieder aufzunehmen. Darf ich fragen, warum Sie dem zugestimmt haben? Die Vorstellung, so nahe bei dem Vater Ihres Sohnes zu arbeiten, mit dem Sie nichts mehr zu tun hatten, kann doch nicht gerade ansprechend gewesen sein.«
»Das war Teil der Vereinbarung, Sir. Sie würden so lange für mein Kind aufkommen, wie ich für sie arbeitete und den Mund hielt.«
»Ich verstehe. Also haben sie sich Ihr Schweigen erkauft und Sie gut im Auge behalten.«
»Ja, Inspector. Aber es war nicht so schlimm, wie Sie jetzt denken. Maximilian hat nie gearbeitet – die Familie ist sehr wohlhabend –, und er ist ständig in Europa herumgereist, daher habe ich ihn bloß ein- oder zweimal im Jahr zu Gesicht bekommen. Und selbst dann ist er mir aus dem Weg gegangen, oder die Familie schickte mich auf Botengänge nach Glasgow oder Edinburgh. Sie sind nicht gefühllos.
Und so gingen die Jahre ins Land … Später wurde ich dann Haushälterin bei den Kolomans, während Maximilian sein Leben woanders verbrachte und sein Erbteil verprasste, und mein eigenes Kind im Norden glücklich und kräftig wurde, jedenfalls stand das so in den Briefen des Priesters. Er schrieb mir, mein Sohn wachse zu einem sehr klugen jungen Mann heran.« In ihrer Stimme schwang hörbar ein Anflug von Stolz mit.
Ich verlagerte mein Gewicht auf dem Sessel. »Da Sie hierhergekommen sind, vermute ich, die Lage hat sich verschlechtert?«
»Ja, vieles ist geschehen!«, sagte sie mit bitterem Lachen. So selbstverständlich wie ein fahrender Händler in einem Gasthaus genehmigte sich Miss Fletcher erst einmal einen weiteren Whisky. »Zunächst starb Maximilian vor drei Monaten. Er kehrte überraschend und schwer krank von einer seiner Reisen zurück. Als sein älterer Bruder ließ mein Herr die besten Ärzte kommen, die man für Geld beauftragen konnte. Aber es hat nichts genutzt. Maximilian ging ein wie eine Primel und starb binnen weniger Wochen.«
»Um welche Krankheit handelte es sich?«
Miss Fletcher schnaubte. »Die Familie hat zwar nichts verlauten lassen, aber die anderen Bediensteten munkelten allesamt, es wäre die … Franzosenkrankheit. Geschah ihm nur recht, dem dreckigen Mistkerl.« Sie kippte ihren Drink in einem einzigen Zug herunter. »Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, Sir.«
»Ich habe schon Schlimmeres vernommen«, versicherte ich ihr, während ich ihr – sehr zu ihrer Freude – nachschenkte. »Was ist danach passiert?«
»Man erzählte mir, Maximilian habe auf dem Sterbebett Mr und Mrs Koloman darum gebeten, Benjamin in den Schoß der Familie aufzunehmen. Er hat ein Dokument unterzeichnet, in dem er ihn als seinen Sohn und Erben anerkennt.«
Ihr Tonfall verwunderte mich, denn in diesen letzten Sätzen hatte eine deutlich zu vernehmende Bitterkeit mitgeschwungen.
»Sind Sie nicht glücklich mit diesem Resultat?«, wollte ich wissen.
Miss Fletcher führte sich das Glas dicht vor die Lippen, brachte es dieses Mal aber nicht über sich zu trinken.
»Maximilian ließ seinen Bruder zudem schwören, dass Benjamin wie ein Mitglied der Familie behandelt werden würde, als Gleicher unter Gleichen … Aber ich weiß es besser. Sie, Mr Frey, scheinen mir selbst recht wohlhabend zu sein, wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten. Glauben Sie etwa, der Junge hätte eine Chance, in einer Familie der Oberschicht jemals als Gleicher unter Gleichen behandelt zu werden? Natürlich nicht! Er wird immer der Bastard der Haushälterin bleiben!«
Erneut knallte sie das Glas auf den Tisch, wobei Whisky in alle Richtungen spritzte. Dann lehnte sie sich zurück und schlug, ganz wie ein Mann, die Beine übereinander, sichtbar geplagt von ihrem Rock.
Bevor ich meine nächste Frage stellte, ließ ich sie einige Male erbost nach Luft schnappen.
»Miss Fletcher, ich verstehe Ihre Sorge, aber ich vermute, da gibt es noch etwas anderes, was Sie hierhergeführt hat, nicht wahr?«
Die Frau rieb sich das Gesicht, bemüht, ihren Zorn im Zaum zu halten. Sie hielt den Blick fest auf den Boden geheftet und gab erst nach einer ganzen Weile Antwort.
»Vor ein paar Tagen ist etwas wirklich Merkwürdiges passiert. Ich war gerade in meinem Zimmer, im Haus meines Herrn, und wollte zu Bett gehen. Da hat jemand plötzlich einen Ziegelstein durch meine Fensterscheibe geworfen. Beinahe hätte er mich am Kopf getroffen.«
»Oh?«
Sie zog die Hand aus ihrer Jackentasche. »Er war in eine Nachricht gewickelt.«
Sie reichte mir ein zerknülltes Stück Packpapier. Ich entfaltete es und erblickte ein Gekritzel in dicker schwarzer Tinte. Die Worte waren verschmiert, als wären sie hastig geschrieben worden:
HALTEN SIE IHREN BASTARD FERN
SONST BRINGE ICH IHN UM
Ich beugte mich vor und nahm den Zettel an mich. »Haben Sie das der örtlichen Polizei vorgelegt?«
»Das habe ich, Mr Frey. Aber unser Constable ist ein fauler, verantwortungsloser verdammter Narr. Er hat mich bloß ausgelacht und mich unverrichteter Dinge weggeschickt. Er meinte, es wäre nicht der Rede wert.«
Ich schüttelte den Kopf. »Es könnte sich hier um eine durchaus ernst zu nehmende Drohung handeln.«
»Ich weiß, aber es scheint niemanden zu kratzen!«, schrie sie, legte sich jedoch sofort die Hand auf den Mund und lehnte sich wieder zurück. »Bitte … Bitte verzeihen Sie mir, Mr Frey.«
»Sie müssen sich nicht entschuldigen«, besänftigte ich sie. »Konnten Sie sehen, wer das hier geworfen hat?«
»Nein, aber nachgeschaut habe ich schon. Es war ein stürmischer Abend, kein Mond stand am Himmel, kein Sternenlicht.«
»Haben Sie irgendeine Idee, wer es gewesen sein könnte? Gibt es Feinde?«
Ihr Gesicht verdüsterte sich. »Ich kenne da schon einige, die meinen Sohn nicht in der Nähe von Loch Maree sehen wollen. Ich könnte Ihnen eine ganze Liste geben. Aber da ist momentan etwas noch Drängenderes.«
»Drängender? Erzählen Sie es mir.«
»Die Kolomans haben bereits nach meinem Sohn geschickt. Und ich habe Angst um ihn.«
»Er lebt immer noch in Thurso, nehme ich an.«
»Ja.«
»Soll er alleine reisen?«
»Nicht, wenn ich es verhindern kann, Sir. Deswegen bin ich hier.«
Ich dachte eine Weile darüber nach. »Ich vermute, Sie möchten, dass die Edinburgher Polizei Ermittlungen in Bezug auf diese Drohung gegenüber Ihrem Sohn anstellt und …«
»Und dass ihn jemand auf seiner Reise beschützt.«
Ihr Ersuchen stellte ein ziemliches Problem dar. »Ich verstehe Sie, Miss Fletcher, und ich sehe auch ein, dass Sie sich vor Sorge grämen. Aber Sie müssen begreifen, wir vom CID sind keine privaten Leibwächter.«
»Das begreife ich.«
»Und Ihr Akzent verrät mir, dass Sie den ganzen Weg von den Highlands auf sich genommen haben?«
»Ja, ganz aus dem Nordwesten. Hier, das habe ich Ihnen mitgebracht …«
Sie durchwühlte ihre Taschen und reichte mir dann einen dieser billigen Reiseführer, die heutzutage so in Mode sind.
Ich blätterte die ersten Seiten durch. Sie waren voller Gebietskarten. »Edinburgh ist wirklich sehr weit weg von Ihrer Heimat. Sie hätten jemand anderen um Hilfe bitten können. Warum sind Sie ausgerechnet zu uns gekommen? Was hat Inspector McGray zu tun mit …«
»Ich kann ihm etwas als Gegenleistung anbieten«, schnitt sie mir das Wort ab, beugte sich zu mir vor und stützte dabei die Ellbogen auf den Knien ab. Der Anflug eines Grinsens überzog ihr Gesicht.
»Miss Fletcher, ein Polizeiinspektor geht keinen Handel um Dienstleistungen ein. Wir …«
»Ich kann seiner jüngeren Schwester helfen«, spuckte sie plötzlich mit tiefer Stimme aus. »Ich weiß, wie Miss McGray geheilt werden kann.«
2
16. August (Fortsetzung)
»So eine Walküre von Frau habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen!«, konstatierte Onkel Maurice, während er durch das Fenster linste und beobachtete, wie Miss Fletcher um die Ecke bog. »Nicht einmal auf dieser schrecklichen Reise nach Skandinavien. Erinnerst du dich?«
Amüsiert schaute ich ihn an, wie er in seinem Sakko aus der feinsten Wolle, die für Geld zu haben war, mit seinem großen Cognacschwenker und seiner wohlriechenden Zigarre herumwedelte. Er erinnerte mich an all die Wesenszüge, die mir Schottland allmählich austrieb.
Während mein Vater meine ganze Kindheit über eine abwesende, ziemlich farblose Figur gewesen war, war Onkel Maurice meine wahre Vaterfigur. Tatsächlich habe ich mir viele seiner Marotten zu eigen gemacht – Geschmack an einem guten Drink, feine Kleidung und teure Zigarren sind die offensichtlichsten. Außerdem haben wir beide die gallischen Gesichtszüge unserer emigrierten Vorfahren: die gleichen dunkelbraunen Augen und das dichte dunkle Haar. Onkel Maurice’ früher einmal schmale Züge haben sich in letzter Zeit ein wenig gerundet, doch er war nach wie vor so umtriebig und aktiv wie eh und je. Er war mittlerweile sechsundvierzig Jahre alt, hatte aber immer so gelebt, als wäre er zwanzig. Er hat nie geheiratet, keine Kinder gezeugt, und er hat einen unstillbaren Lebenshunger, um den ich ihn beneide. Wäre meine eigene Erziehung nicht so einengend gewesen, wäre ich selbst vielleicht ganz nach ihm gekommen.
Jedenfalls hatte ich bei der Lektüre seines respektlosen Briefes lachen müssen, in dem er seinen Besuch eher verkündete als erbat:
Deine Stiefmutter erzähltallenin London, dass du in einem Schweinestall ohne Bodenbelag und anständiges Dach über dem Kopf wohnst. Natürlich muss ich daher kommen und es mit eigenen Augen sehen. Außerdem scheint mir jetzt Jagdzeit für Moorhühner in den Highlands zu sein …
Als er dann eintraf – sein junger Diener schleppte sechs Kisten Wein und Cognac, hundert kubanische Zigarren und acht Schrankkoffer mit feinen Anzügen, Hemden und Manschettenknöpfen –, erinnerte ich mich wieder daran, warum ich ihm so zugetan war.
»Was wollte die Dame?«
Ich nahm einen Schluck – ich hatte die Portion, die mir die Frau eingeschenkt hatte, noch immer nicht bewältigt. »Das sind polizeiliche Angelegenheiten, Onkel. Einzelheiten darf ich dir nicht weitergeben.«
Mein Onkel setzte ein diabolisches Lächeln auf. »Oh, also fährst du nicht zu diesem Loch Maree?«
Fast hätte ich meinen Drink ausgespuckt. »In Gottes Namen, Onkel! Hast du etwa gelauscht?«
Er hob beschwichtigend die Hand, worauf seine Zigarre Rauchfähnchen aufsteigen ließ. »Ich konnte nicht anders. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie sehr Schottland dich hat verrohen lassen. Ich hatte einen Blick auf sie erhascht und dann befürchtet, du könntest ihr einen Antrag machen!«
Ich massierte mir die Schläfen. »Betrachtest du meinen Beruf als einen Scherz? Eine Art Faulenzerhobby, das keinerlei Respekt verdient?«
Mein Onkel ignorierte meine Proteste und setzte sich vor mich. »Das am Schluss habe ich nicht so recht verstanden. Als sie von einem Heilmittel sprach?«
Ich stieß einen Seufzer aus. Wenn ich ihm etwas vorenthielt, würde das seine Neugier nur noch weiter anstacheln. »Die Frau glaubt an irgendwelche verrückten Geschichten von Heilquellen.« Mit dem Kopf deutete ich auf den Reiseführer, der immer noch auf dem kleinen Tisch lag. Mein Onkel nahm ihn in die Hand und begann ihn durchzublättern.
»Die Highlands«, sagte er mit vor Begeisterung funkelnden Augen.
»Ja, Loch Maree, wie du richtig mitgehört hast.« Ich sah zu, wie mein Onkel eine faltbare Landkarte aufschlug. »Das liegt ganz im Nordwesten. Miss Fletcher arbeitet für eine Familie, die Kolomans, die direkt am Ufer ihren Wohnsitz hat.«
»Ja, diesen Part habe ich mitgehört, aber danach musste ich mir schnell einen Drink holen.«
»Allem Anschein nach gibt es viele Inseln auf diesem See, und auf einigen dieser Inseln befinden sich ihrerseits winzige Seen.«
Mein Onkel lächelte. »Wären das dann also … von Wasser umschlossene Seen?«
»Formal ja, aber das wirklich Eigenartige daran ist, dass auf einer dieser Inseln eine Quelle sprudelt. Ihr ›heilendes‹ Wasser befreit angeblich vom Wahnsinn.«
Mein Onkel stieß einen Pfiff aus und breitete die Landkarte auf dem Tisch aus. »Wasserfälle, Inseln … Hier steht, dass es zu dieser Jahreszeit gute Lachsbestände und Moorhühner gibt.«
»Onkel …«
Er schaute auf den Rand der Landkarte und zog die Stirn in Falten. »Warum stellen Schotten eigentlich Disteln immer so dar, als wären sie verfluchte biblische Wunder? Es ist Unkraut! Bestenfalls dorniger Löwenzahn.«
»Onkel, hörst du mir überhaupt zu?«
»Magische Quelle. Wasser, das vom Wahnsinn befreit. Ja.«
»Und die Frau will McGray dorthin bringen und ihm das sogenannte Wunder vorführen. Seine Schwester, wie du dich vielleicht erinnerst …«
»Vielleicht erinnere! Das war die beste Geschichte, die du mir seit Jahren erzählt hast: die toten Eltern, der Wahnsinn und der abgetrennte Finger … Aber von welchem Wunder hat sie geredet? Hat sie mit eigenen Augen gesehen, wie Leute geheilt wurden?«
Erneut stieß ich einen Seufzer aus. »Das behauptet sie jedenfalls. Sie sagt, da sei eine ziemlich sonderbare Familie – die Familie Nellys –, die auf einer dieser Inseln lebt. Ihr zufolge kamen sie vor etlichen Jahren dorthin und brachten einen verrückten alten Mann mit, der mittlerweile wieder im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist.«
Mein Onkel fuhr mit den Fingern über die Wasserläufe und Küstenlinien auf der Karte. »Wirst du das alles diesem Neun-Finger-Mann gegenüber ansprechen?«
Ich stieß den Atem aus. »Das muss ich. Diese Frau kam her und bat um Hilfe. Also liegt es in meiner Verantwortung. Nicht dass du die Bedeutung dieses Wortes kennen würdest.«
Mein Onkel kicherte. Für einen kurzen Augenblick glaubte ich einen Anflug von Bitterkeit in der Art zu erkennen, wie er die Landkarte anschaute. Er schmauchte an seiner Zigarre. »Was, meinst du, wird er dazu sagen?«
Ich lachte frei heraus. »Da brauche ich nicht groß zu spekulieren, Onkel – ich weiß es ganz genau. Er wird durchdrehen vor Begeisterung und alles tun, was diese Miss Fletcher von ihm verlangt. Er wird zu diesen verfluchten Seen reisen und mir unvorstellbaren Ärger aufhalsen. Am Ende wird er erkennen, dass es sich doch nur wieder um ein erbärmliches Ammenmärchen handelt. Und bevor ich mich’s versehe, wird er irgendeinem anderen Blödsinn hinterherjagen.«
»Willst du denn gar keine Untersuchungen anstellen? Der verfolgten Unschuld zu Hilfe eilen? Für mehr Gerechtigkeit in unserer barbarischen Welt sorgen, wie du immer gerne gepredigt hast, als du noch in London gearbeitet hast?«
»Onkel, selbst wenn ich es wollte, ich kann nicht einfach meine Koffer packen und eine Ermittlung beginnen. Es gibt da polizeiliche Abläufe, die …«
»Hast du mir nicht erzählt, das schottische CID sei immer noch führungslos?«
Allerdings, davon hatte ich ihm im Detail berichtet. Der miserable Superintendent Campbell war nach seinem grob pflichtwidrigen Umgang mit dem Skandal um Irving entlassen worden, und seitdem herrschte in Edinburghs CID eine heitere Ahnungslosigkeit: Die einfachen Officers rührten keinen Finger, taten nur, was unbedingt notwendig war, um die Ordnung in der Stadt aufrechtzuerhalten, während die ranghöheren Beamten sich wie die Hunde um die freien Stellen balgten (nicht nur die des Superintendents, sondern alle, die durch die natürlichen Verschiebungen in der Rangordnung entstehen würden).
Ich antwortete nicht. Stattdessen schaute ich Onkel Maurice an, wie er voller Muße trank, rauchte und das Buch durchblätterte.
»Nun«, sagte er schließlich, »du hattest mir auch erzählt, dass diese … Sonderabteilung zur Anteilnahme an den Quacksalbern und Narren wahrscheinlich aufgelöst werden wird, sobald ein neuer Superintendent auserkoren wird.«
Als ich dies vernahm, musste ich einen Schluck trinken. Die Kommission zur Aufklärung ungelöster Fälle mit mutmaßlichem Bezug zu Sonderbarem und Geisterhaftem (ein Name, der in Wirklichkeit noch lächerlicher war als meines Onkels Versuch, ihn zu verballhornen) existierte nur deshalb, weil McGray den bisherigen Superintendent bestochen hatte. Möglich war alles, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein noch korrupterer Halunke Campbells ehemalige Position einnehmen würde. Und jeder vernünftige Mann – mich selbst eingeschlossen – würde sich dieser Abteilung ohne langes Nachdenken schlichtweg entledigen und den Kellerraum, in dem sich unser Büro befand, sinnvolleren Zwecken übereignen (zum Beispiel der Lagerung von Mehlsäcken).
Unfassbar, dass mir bei dieser Vorstellung trotz meines Gejammers und meines gesunden Menschenverstands wirklich angst und bange wurde.
Ich stieß einen Seufzer aus und zog es vor, in diesem Moment nicht weiter darüber nachzudenken. »Onkel, worauf willst du hinaus?«
Mit einem dumpfen Schlag schloss er den Reiseführer. »Ian, da du offenbar kurz davorstehst, deinen Posten zu verlieren, hättest du da nicht Lust auf einen schönen Landurlaub, bevor du nach London zurückkehrst?«
Mir klappte die Kinnlade herunter. »Du machst wohl Witze!«
»Ganz und gar nicht. Denk mal darüber nach. Frische Luft, Bewegung, atemberaubende Landschaften – glaubst du, du wirst jemals wieder nach Schottland zurückkehren, wenn du hier keine Arbeit mehr hast? Vielleicht bekommst du nie wieder Gelegenheit, dir diese Landschaft zu Gemüte zu führen. Und wir können famos auf die Jagd gehen und trinken, während dein derangierter Boss sich dieses Heilwasser munden lässt.«
»Onkel, bitte, sag nicht wieder ›famos‹. Du weißt doch, wie sehr ich dieses Wort verabscheue.«
Er lachte nur. »Außerdem hast du gerade selbst gesagt, dass Miss Fletchers Angelegenheit eine ordnungsgemäße Untersuchung verdient. Vielleicht kannst du ja sogar wirklich etwas Gutes bewirken.«
Ich seufzte. »Frische Luft würde mir wohl guttun … Und mit Sicherheit würde es mir guttun, mich zu entspannen, bevor ich zurückkehren und diesen Londoner Oberschicht-Nattern gegenübertreten muss.« Ich genehmigte mir einen weiteren Schluck Whisky. »Aber nein. Ich habe schon einmal unter Druck kapituliert, und das hatte verheerende Folgen. Das ist mein letztes Wort, Onkel: Wir fahren nicht zum Loch Maree.«
3
Loch Maree, 20. August, 14.50 Uhr
»Warten Sie, ich ziehe das Boot näher ans Ufer, damit die Gentlemen keine nassen Stiefel bekommen.«
Ich war im Begriff, eine scharfe Antwort zu geben, doch Miss Fletcher sprang sofort ins Wasser. Eher amüsiert schaute Onkel Maurice zu, wie sie das Tau über ihre Schulter warf und durch das knietiefe Wasser auf das Ufer zuwatete. Dabei beschleunigte sich ihr Atem nicht einmal, ganz wie zu erwarten bei ihrer äußeren Erscheinung. Sie trug jetzt eine dicke Jagdausrüstung und schien sich darin viel wohler zu fühlen als in dem Rock, den sie bei unserer ersten Begegnung getragen hatte.
Sie hob einen Felsbrocken von der Größe eines Krugs an, klemmte das Seilende darunter ein und schaute dann zu mir auf. »Benötigen Sie Hilfe, Mr Frey?«
Erneut wollte ich ablehnen, doch als mein Onkel abrupt heraussprang, schaukelte das ganze Boot, und ich hätte fast das Gleichgewicht verloren. Miss Fletcher packte mich am Arm und ließ mich erst wieder los, als ich mit beiden Füßen fest auf dem Kiesstrand stand.
Ich räusperte mich. »Danke, Miss«, sagte ich leicht errötet.