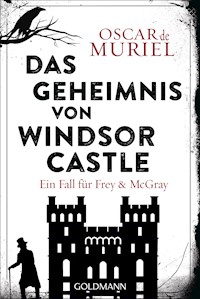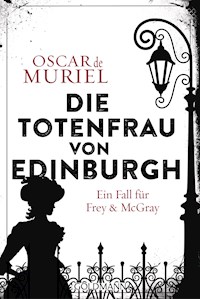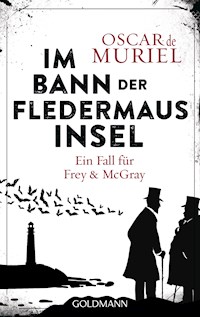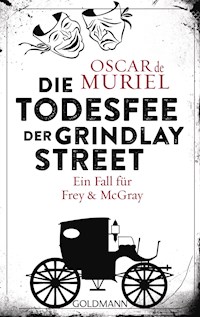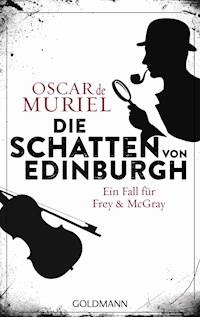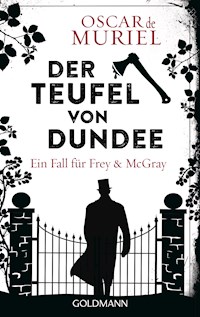
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Frey und McGray
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
»Eine unglaublich unterhaltsame viktorianische Krimiserie!« The New York Times
Edinburgh 1890. Inspector McGray ertappt zwei Grabräuber auf dem Friedhof, und beim Anblick der Leiche gefriert ihm das Blut in den Adern. Der Toten wurde das Zeichen des Teufels ins Gesicht gebrannt. Dasselbe Zeichen taucht kurz darauf in Edinburghs Irrenanstalt auf, mit dem Blut eines getöteten Patienten an die Wand geschmiert. Beschuldigt wird die berüchtigste Insassin des Hauses: McGrays Schwester Amy, die ihre Eltern brutal ermordet haben soll. Verzweifelt wendet sich McGray an einen alten Freund: Ian Frey. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, um Amys Unschuld zu beweisen – und die Spur führt zurück zu jener schrecklichen Nacht, als der Teufel McGrays Elternhaus in Dundee heimsuchte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 709
Ähnliche
Buch
Edinburgh 1890. Auf frischer Tat ertappt Inspector McGray zwei Grabräuber auf dem Friedhof, und bei genauerer Untersuchung der Leiche gefriert ihm das Blut in den Adern. Der Toten wurde das Zeichen des Teufels grausam ins Gesicht gebrannt. Dasselbe Zeichen taucht kurz darauf in Edinburghs Irrenanstalt auf, mit Blut an eine Wand geschmiert – darunter liegt ein ermordeter Patient. Die Hauptverdächtige ist die berüchtigtste Insassin des Hauses: Amy McGray, die jahrelang mit niemandem ein Wort sprach und die ihre Eltern in Dundee brutal mit einem Beil erschlagen haben soll. Verzweifelt wendet McGray sich an einen alten Freund: Ian Frey, der sich nach England zurückgezogen hat und seinen Ruhestand genießt. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, um Amys Unschuld zu beweisen – und die Spur führt in die Vergangenheit zu einer schrecklichen Nacht, in der der Teufel das Haus der McGrays in Dundee heimsuchte …
Weitere Informationen zu Oscar de Muriel
sowie zu lieferbaren Titeln des Autors
finden Sie am Ende des Buches.
Oscar de Muriel
Der Teufel von Dundee
Ein Fall für Frey & McGray
Aus dem Englischen von Peter Beyer
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel
»The Sign of the Devil« bei Orion Fiction, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd., London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Dezember 2022
Copyright © 2022 by Oscar de Muriel
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotive: FinePic®, München
Übersetzung des »Klagelieds des McGray Clans«
von Dr. Andreas Jäger
Redaktion: Eva Wagner
MR · Herstellung: ik
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-28446-6V001
www.goldmann-verlag.de
Das Siebte ist für euch alle,
die ihr mein Geplapper bis zum Ende ertragen habt.
Ich schulde euch ein kleines Schlückchen.
Klagelied des Clan McGray
Lasst Trunkenbolde und Klatschweiber schwätzen,
Mit Spukgeschichten euer Ohr entsetzen,
von Nine-Nails, dem Neun-Finger-Mann.
Hört sie lästern laut und keifen,
und in euch wird Mitleid reifen
mit dem McGray’schen Clan.
Seit dieses Unglück sie hat heimgesucht,
da ist ihr teurer Name – ach! – verflucht.
Zwei Gatten blutig abgeschlacht’ –
Oh weh, welch grausige Geschicht’!
Nun höret alle den Bericht
von jener Todesnacht.
Ihr junges Töchterlein war irr geworden.
Sie tat das teure Elternpaar ermorden,
Das Messer in der Hand, und lachte.
Die Hände blutig rot und nass –
Es schien für sie ein böser Spaß,
dass Leid und Tod sie brachte.
Ihr Bruder sucht’ die Schwester zu ergreifen,
Da tat auch ihn die scharfe Klinge streifen.
Adolphus schrie vor Schmerz und Wut,
Entsetzt er auf den Finger schaut –
Der hing an einem Fetzen Haut,
Zu Boden troff das Blut.
Der Sterne helles Licht ist da verblasst.
Von Ohnmacht ward Adolphus jäh erfasst.
Doch eh er sich umnachtet fand
(verlor jedoch drob nie ein Wort),
Sah er noch, wie zur Höll’ hinfort
Der Teufel flugs entschwand.
1883
Das Lied klang recht vulgär, es entsprang offenkundig den Untiefen einer übelriechenden Spelunke, doch Lady Anne summte die Melodie voller Vergnügen vor sich hin. Damit niemand sie dabei hören konnte, hatte sie das Dach ihres schmalen Cabriolets, der kleinsten Kutsche in ihrem Fuhrstall, schließen lassen.
Wie prompt der Pöbel doch auf solche Ereignisse ansprang. Mr und Mrs McGray waren noch nicht einmal erkaltet, und schon gab es Balladen über sie. Allerdings hatte es ihr Schicksal auch in sich.
In diesem Moment hielt die Kutsche vor der Tür des heruntergekommenen Gasthofs an, der schon vor langer Zeit von seinem griesgrämigen Pächter aufgegeben worden war. Nur hinter einem der verrußten Fenster glomm ein goldener Lichtschein inmitten der blauen Töne der Mittsommernacht.
In der Ferne schimmerten die Lichter von Dundee im gleichen bernsteinfarbenen Ton. Viel näher, als es Lady Anne lieb gewesen wäre. In der Nähe dieser Stadt durfte sie nicht gesehen werden. Nicht so bald.
Die leichte zweirädrige Kutsche schwankte und wackelte, als ihr Hausdiener absprang und polternd mit den Füßen aufkam. Jed, einen Meter neunzig groß und breitschultrig, ging zur Tür des Wirtshauses und klopfte leise an. Drinnen musste jemand reagiert haben, obwohl Lady Anne nichts hatte hören können, denn Jed drückte die Klinke herunter und schob die Tür einen Spaltbreit auf. Er spähte einen Moment hinein und kehrte erst dann zurück, um seiner Herrin den Schlag zu öffnen.
Lady Anne zog feste Lederhandschuhe über ihre mit Altersflecken übersäten Hände. Sie war umsichtig genug, ihren auffälligen Kopfschmuck, eine Sonderanfertigung, dekoriert mit langen, schwarz gefärbten Fasanenfedern, abzunehmen. Sie war berühmt für ihre extravaganten Hüte, und die Leute erkannten ihre Silhouette selbst im Dunkeln.
Jed reichte ihr einen Gehstock aus Ebenholz, worauf Lady Anne Ardglass würdevoll zu der vor Schmutz starrenden, wurmzerfressenen Tür schritt. Glücklicherweise musste sie nur einige wenige Schritte in diesen Schweinestall hineingehen.
Ihr Gewährsmann, Staatsanwalt Pratt, saß bereits in dem großen Schankraum, der noch vor wenigen Monaten gerammelt voll mit betrunkenen Gästen gewesen sein musste. Jetzt standen hier nur noch ein ramponierter Tisch, einige wenige wackelige Stühle sowie ein fadenscheiniger Sessel neben einem verrußten Kamin.
Als Mr Pratt sie erblickte, sprang er sofort auf. Auf seinem gänzlich kahlen Schädel spiegelte sich die Flamme der einzigen brennenden Kerze im Wandleuchter fast perfekt. Mit seiner glänzenden Glatze war er Lady Anne in den tristen Gerichtssälen erstmals aufgefallen. Und dann hatte sie seine listenreiche Ausdrucksweise vernommen und sofort gewusst, dass er der richtige Mann sein würde, um ihre Drecksarbeit zu erledigen. Sie hatte bereits einen beträchtlichen Teil der Kosten für die Ausbildung seines Sohnes übernommen – mehr als genug, um sich der Loyalität des Mannes auf Lebenszeit sicher zu sein.
»Lady Anne«, begrüßte er sie mit einer Verbeugung. »Nehmen Sie Platz, wenn Sie …«
Noch bevor er aussprechen konnte, ließ sich die Frau bereits auf dem Sessel nieder, nachdem ihr Diener eine Decke darauf ausgebreitet hatte, um das feine Kleid Ihrer Ladyschaft zu schützen.
»Jed«, sagte sie und wies dabei auf die kalte Feuerstelle. Ohne eine weitere Anweisung zu benötigen, begann der Mann damit, ein Feuer zu entfachen.
Pratt rang die Hände, während die berüchtigte »Lady Glass« eine Taschenflasche aus ihrer kleinen Handtasche hervorzog. Es handelte sich um ein ausgesprochen wertvolles, silbernes Exemplar mit Lederbezug und abnehmbarem Becher. Lady Anne schenkte sich einen kräftigen Schluck aromatischen Cognac ein und schlürfte ihn lautstark. Manieren waren etwas für das gemeine Volk und die Jugend.
»Ist der Kerl hier?«, erkundigte sie sich.
»Ja … ja, Ma’am. Aber ich habe ihn gebeten, sich vor seinem Treffen mit Ihnen noch zu waschen. Er stank nach …«
»Unsinn. Bringen Sie ihn herein.«
Pratt eilte genau in dem Moment zu einer Tür in der Nähe, als das Feuer im Kamin hell aufloderte. Jed war ausgesprochen tüchtig und loyal. Jammerschade, dass er schon recht bald das Zeitliche segnen würde.
Als Pratt zurückkehrte, war es in dem ehemaligen Schankraum bereits wärmer. Ihm folgte ein junger Bursche, klein und schmächtig und wohl Anfang zwanzig, doch sein hageres Gesicht und seine Arme waren bereits wettergegerbt. Pratt versetzte ihm einen Stoß mit dem Ellbogen, als sie sich Lady Anne näherten, worauf der junge Mann augenblicklich seine verdreckte Schiebermütze abnahm.
»Sie sind also der Gärtner der McGrays?«, wollte die Frau wissen.
»Aye, Ma’am«, erwiderte er, für ihren Geschmack ein wenig zu selbstsicher. »Nur stundenweise. Die haben da noch einen anderen Bur…«
»Wie heißen Sie?«
»Billy, Ma’am.«
Lady Anne genehmigte sich einen weiteren Schluck. Sie hatte den Eindruck, als liege da ein forsches Funkeln in den Augen des jungen Mannes. Er könnte sich noch als nützlich erweisen.
»Ist das alles, was sie in den Wirtshäusern herumtratschen?«, fragte sie. Billy stieß einen Pfiff aus.
»Aye. Es ist sogar noch schlimmer, Ma’am! Ich habe das Mädchen mit eigenen Augen gesehen und auch, was sie dem jungen Mister Adolphus angetan hat. Das war alles, bevor dann dieser Arzt aus der Irrenanstalt …«
»Was war zuvor geschehen?«, unterbrach sie ihn barsch. »Während des Tages. Bevor das Mädchen kreischte, sie sei vom Teufel besessen gewesen.«
»Nun, ich verbrachte den größten Teil des Tages damit, in den Gartenanlagen zu arbeiten. Zur Abendessenszeit war ich fertig und ging in die Küche, um etwas zu essen. Die Familie nahm ihr Essen im Speisesaal ein. Davor hatte ich gesehen, wie sie alle kamen und gingen. Mrs McGray, möge sie in Frieden ruhen, war damit beschäftigt, Blumen zu arrangieren. Ich selbst hatte ein paar Rosen für sie gepflückt.«
»Und ihr Gatte?«
»Ich habe ihn kaum zu Gesicht bekommen, Ma’am. Nur zwei, drei Mal, wenn ich am Fenster seines Bibliothekszimmers vorbeiging. Er saß dort seit dem frühen Morgen über seinen Papieren.«
Lady Anne umklammerte den silbernen Becher ein wenig fester. »Haben Sie sonst noch etwas in diesem Zimmer gesehen?«
»Nein, Ma’am, aber ich weiß, was Sie meinen. Das war dort, wo Mädchen den Verstand verloren hat.«
»Aber im Verlauf des Tages hatten Sie sie gesehen, nicht wahr?«, hakte Lady Anne nach. »Hatte sie vorher auch schon irgendwie wahnsinnig gewirkt?«
Billy schüttelte den Kopf. »Nein, Ma’am. Ich hörte sie am Morgen noch mit ihrer Mutter lachen. Und nach dem Abendessen ritt sie mit Mister Adolphus aus, ihrem Bruder. Ich war gerade draußen, um eine Zigarette zu rauchen, als sie losritten, da sah ich die beiden. Sie wirkten recht vergnügt.«
»Und was ist dann passiert?«, fragte Lady Anne und beugte sich ein wenig vor. Ihre knochige Hand umklammerte die Armlehne wie eine Kralle.
»Nun … Mr McGray, möge er in Frieden ruhen, bat den alten George, uns zu sagen, wir sollten alle in das Pub gehen. Er gab uns sogar Geld für unsere Drinks.«
Lady Anne gluckste. »Tat er das häufig?«
Billy verzog den Mund. »Ab und zu, wenn er mal gut gelaunt war. Für gewöhnlich um Weihnachten und im Sommer. Dachte wohl, er täte uns damit was Gutes, aber unter uns gesagt, waren wir nie besonders scharf drauf. Das Pub ist ein paar Meilen entfernt, das ist ein ganz schöner Spaziergang, der sich aber doch ziemlich in die Länge zieht. Vor allem, wenn man danach angetrunken zum Haus zurückwanken muss.«
»Dort wart ihr alle also«, sagte Lady Anne. »Ihr habt euch im Pub amüsiert, während eure beide Herrschaften von ihrer eigenen Tochter abgeschlachtet wurden.«
Billy biss sich auf die Lippe. »Aye.«
»War außer ihnen noch jemand im Haus geblieben?«
»Nur die alte Betsy.«
Lady Anne blinzelte. »Und wer ist das?«
»Och, aye, Sie kennen sie ja gar nicht. Sie ist die Haushälterin. Die Frau ist in die Jahre gekommen, wenn Sie verstehen, was ich mein …« Billy sah, dass sich Lady Annes Falten bei der Erwähnung von fortgeschrittenem Alter vertieften. »Also, jedenfalls mag sie keine langen Spaziergänge mehr.«
Lady Anne genehmigte sich einen ordentlichen Schluck. »Sie wissen also nur das mit Sicherheit, was diese Frau gesehen hat.«
»Aye.«
»Erzählen Sie es mir«, drängte Lady Anne. Ihre blassen Augen schimmerten mit solch unheimlicher Intensität, dass Billy unwillkürlich einen Schritt zurückwich.
»Sie … sie hat uns erzählt, sie sei in der Küche geblieben, um ein kurzes Nickerchen zu machen. Für sie steht dort ein bequemer Schaukelstuhl. Sie berichtete uns, sie hätte Pferde herbeitrappeln gehört und geglaubt, es seien Miss Amy und Mister Adolphus, die zurückkehrten, aber … sie können es nicht gewesen sein. Mister Adolphus kam erst zurück, nachdem …«
»Eins nach dem anderen«, unterbrach ihn Lady Anne. »Erzählen Sie es mir der Reihe nach. Sie hörte Pferde und dann?«
»Sie hat sich nicht viel dabei gedacht und döste weiter. Und dann … nun, dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Sie schreckte hoch von lautem Geschrei im Bibliothekszimmer. Die kleine Pansy – ich meine, Miss McGray – schien völlig durchgedreht zu sein. Sie platzte einfach in die Küche herein, schnappte sich das größte Hackmesser, das, mit dem Betsy immer die Knochen durchtrennt, und rannte zurück in die Bibliothek. Die arme alte Betsy sagte, sie hätte vor Schreck fast der Schlag getroffen.«
»Ist sie ihr gefolgt?«, hakte Lady Anne nach.
»Aye, und sie hörte Mr und Mrs McGray ebenfalls schreien – um das Mädchen zu bändigen, sollte man meinen.«
Mittlerweile war Lady Anne bis an die Sesselkante nach vorn gerutscht und ignorierte sogar ihren Drink. »Hat sie etwas gesehen? Hat sie das Bibliothekszimmer betreten?«
Billy schüttelte den Kopf. »Sie sagte, sie sei bloß bis zur Tür gekommen. Die stand einen Spaltbreit offen, aber das Mädchen hat sie geschlossen, als sie sah, dass Betsy näher kam.«
Lady Anne wölbte eine Braue. »Hat sie die Tür abgeschlossen?«
»Aye, Ma’am. Und dann hörte Betsy, wie der Herr McGray ihr sagte, sie solle weggehen. Kann’s ihm nicht verübeln. Wenn das eigene Kind den Verstand verliert, will man nicht, dass die Dienerschaft es mitkriegt und dann alles …«
»Oh, nun fahren Sie doch fort!«, kreischte Lady Anne so schrill, dass ihre Stimme den ganzen Raum erfüllte. Alle drei Männer zuckten zusammen, sogar der hünenhafte Jed. Sie bemerkte, dass sie gerade die Hälfte ihres Drinks auf ihren Rock verschüttet hatte, und zwang sich dazu, tief durchzuatmen.
Lady Anne wusste einiges über Nachkommen, die dem Wahnsinn verfielen.
Jed, der als einziger Anwesender den Grund für ihren Gefühlsausbruch kannte, füllte ihr den Becher nach.
Sie kippte den Inhalt mit einem einzigen Schluck hinunter und räusperte sich dann. »Fahren Sie fort.«
Auch Billy zog nun hörbar den Atem ein. »Betsy kam nicht in die Bibliothek rein und wusste, dass wir anderen im Pub waren, meilenweit weg. Also konnte sie nichts anderes tun, als hinauszueilen und nach dem Herrn Adolphus zu suchen. Sie …«
Lady Anne hob die Hand. »Hat sie irgendetwas gehört? Irgendetwas von dem, über das die McGrays sprachen? Irgendetwas, das erklären würde, warum das Mädchen derart durchdrehte?«
»Falls dem so war, würde sie nie ein Wort darüber verlieren. Sie hat die McGrays ins Herz geschlossen. Der alte George auch.«
Lady Anne nickte Mr Pratt zu. Sie würden diese Frau womöglich ausfindig machen müssen. Und dabei, wenn sie tatsächlich der Familie gegenüber so loyal war, umsichtig vorgehen.
»Fahren Sie fort«, befahl sie. Mittlerweile stand Billy der Schweiß auf der Oberlippe.
»Die alte Betsy fand den Herrn Adolphus schon bald. Er war am See. Sie berichtete ihm, dass es Probleme gäbe, worauf er schnell wie der Wind zum Haus zurückgaloppierte. Betsy rannte ihm hinterher, und ungefähr zeitgleich mit ihr trafen auch wir ein. Wir erblickten sie, als sie gerade weinend den Fußweg entlanglief. Sie erzählte uns, was gerade geschehen war. Ich kann mich noch sehr gut an ihre Worte erinnern. Sie sagte, die kleine Pansy habe geschrien, als ob der Teufel in sie gefahren sei. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil sie – wie Sie alle mittlerweile wissen – später dann …«
»Nicht so vorschnell«, pfiff ihn Lady Anne erneut zurück. »Ich nehme an, Sie und die anderen Bediensteten sind ebenfalls ins Haus gelaufen?«
»Aye, natürlich, Ma’am. Der alte Butler George, ich, Conor, der andere Gärtner, und seine Frau Mary, die ebenfalls im Haus aushilft. Und wir hörten die gellenden Schreie schon lange, bevor wir das Haus betraten.«
»Haben Sie Pferde gesehen?«, fragte Lady Anne. Billy war es, als könnten diese geäderten Augen direkt in sein Innerstes blicken.
»Aye, Ma’am. Mister Adolphus’ braunes Pferd und Miss Amys kleines Fohlen.«
Lady Anne öffnete den Mund, als läge ihr noch etwas auf der Zunge, blickte dann stattdessen jedoch zur Seite und starrte eine Weile in das prasselnde Kaminfeuer. Sie wollte wegen der Pferde noch einmal nachfragen, doch ihr wurde klar, dass dies viel zu riskant gewesen wäre. Letztendlich hob sie ihren silbernen Becher hoch, worauf Jed ihn wieder füllte.
»Berichten Sie weiter«, sagte sie, bevor sie einen weiteren Schluck nahm.
Billy musste sich mit seiner Schiebermütze den Schweiß aus dem Gesicht wischen.
»Als wir zur Haustür kamen, stellten wir fest, dass sie weit offen stand. Ich erinnere mich auch, dass die Tür zur Bibliothek immer noch auf- und zuschlug. Dann … sahen wir sie.«
Der junge Mann erschauderte, und eine Ader an seinem Hals trat hervor.
»Das arme Mädchen rannte umher, schrie, fluchte und … Och, sie sah aus wie der Leibhaftige. Ihr Kleid war blutbesudelt … Sie war kreidebleich und … Och, Ma’am, und diese Augen! Ich sehe sie immer noch vor mir, wenn ich die Augen schließe. Und sie umklammerte immer noch dieses fiese Hackmesser. Das Blut daran tropfte überallhin!«
Lady Anne hatte zugehört, ohne zu blinzeln oder Luft zu holen.
»Sind Sie ihr gefolgt?«
Billy zuckte zusammen. »N… nein, Ma’am. Ich dachte, ich würde mir gleich in die Hosen machen! Aber der alte George und Conor liefen ihr hinterher. Mary und ich hatten zu viel Schiss …« Er lief puterrot an und hob dann das Kinn. »Aber es war gut, dass wir blieben, wo wir waren! Wir hörten Mister Adolphus in der Bibliothek stöhnen.« Erneut erschauderte er. »Sie können sich das Chaos vorstellen. Der arme Kerl lag auf dem Boden, war ganz starr und … auch er ganz blutüberströmt. Und seine Mum und sein Dad lagen gleich hinter ihm tot auf dem Boden …«
Einen Moment lang herrschte düsteres, beinahe respektvolles Schweigen, so als wären die Geister der McGrays herabgefahren, um ihre eigene schauerliche Geschichte zu vernehmen.
Billy räusperte sich.
»Es gelang uns, den Herrn Adolphus in die Küche zu bugsieren. Mary gab ihm einen Brandy, aber …« Seine bisher rote Gesichtsfarbe nahm einen grünlichen Ton an. »Erst dann sahen wir, dass seine Hand ganz zermetzelt war. Mary und ich waren zu verängstigt und konnten nichts unternehmen, dabei blutete der arme Herr doch den ganzen Boden voll!«
Lady Anne rief sich die Reimverse in Erinnerung. Dieser Billy musste sich anderen gegenüber verplappert haben.
Er senkte den Blick. »Der arme Herr musste sich mit einem Küchenlumpen selbst verbinden. Dann hat er uns erzählt, was passiert war. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt gemerkt hat, dass er laut vor sich hinplapperte. Er sagte, seine kleine Schwester sei es gewesen. Sie habe die Herrschaften gemeuchelt und ihm dann, als er versuchte, sie zu beruhigen, den Finger abgehackt. Während er sprach, vernahmen wir erneut Geschrei. Schließlich stieß George zu uns und berichtete, das Mädchen sei in ihr Zimmer geflohen. Conor hielte die Tür von außen zu, für den Fall, dass sie versuchen würde, wieder herauszukommen. Sie habe versucht, auch sie beide abzustechen. Dann kam Betsy mit den Schlüsseln angerannt, wäre aber fast in Ohnmacht gefallen. Ich war es dann schlussendlich, der hochging und die Tür verschloss.«
Lady Anne lehnte sich zurück und holte erneut tief Luft, so als hätte sie diese Tortur gerade selbst durchlebt.
»Hat das Mädchen danach noch etwas unternommen?«
»Nein. Sie verhielt sich totenstill, Ma’am. Das galt für uns alle. Keiner sprach an diesem Tag noch ein Wort. Der Herr Adolphus, blutüberströmt, wie er war, legte die leblosen Körper seine Eltern auf ihr Bett. Betsy machte sich daran, sie zu waschen, und in der Zwischenzeit fuhr Mister Adolphus nach Dundee zum Bestatter. George schrieb eine Nachricht an den Irrenarzt in Edinburgh. Ich brachte sie eigenhändig zum Telegraphenamt in Dundee.«
Argwöhnisch zog Lady Anne die Braue hoch. »Und Doktor Clouston kam dann am nächsten Morgen vorbei, nicht wahr?«
»Aye. Noch vor Sonnenaufgang. Er muss die ganze Nacht über gereist sein. Wir schliefen mittlerweile alle, waren völlig am Boden zerstört. George und Betsy haben ihn reingelassen. Aber …« Billy schmatzte laut mit den Lippen, er hatte einen trockenen Mund. Er beäugte Lady Annes kleinen Trinkbecher. »Kann ich einen kleinen Schluck haben?«
Einfaches, gewöhnliches Volk!, dachte Lady Anne. Andererseits waren dies die verstorbenen James McGray und sein Flittchen von Gattin auch gewesen. Und sein ordinärer Sohn Adolphus ebenfalls. Und Amy, die Einzige in dieser Familie, die womöglich die eine oder andere gute Eigenschaft gehabt hatte, war nun für immer verloren.
Während Lady Anne sinnierte, zog Jed eine Taschenflasche hervor und reichte sie dem wie Espenlaub zitternden Gärtner. Billy nahm ein paar große Schlucke, wischte sich dann den Mund ab und schüttelte sich, während ihm der billige Whisky in der Kehle brannte.
»Vom Schrei des Mädchens sind wir dann alle aufgewacht«, stieß er schließlich hervor, seinen Blick auf das Feuer gerichtet. »Es klang wahnsinnig, Ma’am. Es war … so etwas habe ich noch nie gehört. Wir konnten sie bis in unsere Zimmer hören. Wie ein Adler oder eine … Todesfee oder ein Wesen aus der Hölle. Und sie schrie den Namen des Teufels. Wir hörten es alle. Falls einer von uns noch irgendwelche Zweifel hatte, ob das Mädchen wirklich wahnsinnig war, dann waren die damit ausgeräumt.«
Billy genehmigte sich noch einen Schluck, bevor er die Flasche zurückgab.
»Danach hat der Arzt sie mitgenommen«, fügte Mr Pratt hinzu. »Er hat sie gleich in die Irrenanstalt gefahren, wie wir jetzt wissen.«
»Aye, Sir«, bestätigte Billy.
»Die Anstalt …«, murmelte Lady Anne nachdenklich vor sich hin. Ihr war klar, dass dieses Arrangement zu keinem guten Ende führen würde, aber sie konnte deswegen nichts unternehmen. Jedenfalls noch nicht. Sie leerte ihren Becher und richtete ihren Blick wieder auf Billy. »Und das werden Sie alles vor dem Sheriff’s Court an Eides statt versichern?«
»Aye, Ma’am, jedes Wort unter Eid, wenn es denn sein muss. Es sei denn … nun, es sei denn, Sie wollen, dass ich noch etwas hinzufüge oder auslasse und …«
Er rieb langsam Daumen sowie Zeige- und Mittelfinger aneinander.
Erschöpft stieß Lady Anne einen Seufzer aus. »Sie können jetzt fürs Erste gehen. Mr Pratt hatte recht, Sie müffeln wie ein Maulesel.«
Billy verbeugte sich und zog sich in eines der vielen leeren Zimmer des Wirtshauses zurück.
Lady Anne starrte ins Feuer, nun wieder das wohlriechende Aroma ihres Getränks in der Nase.
»Was geschieht nun?«, fragte sie flüsternd.
»Die werden versuchen, das Mädchen für unzurechnungsfähig zu erklären«, erwiderte Mr Pratt. »Um ein ordentliches Gerichtsverfahren zu vermeiden.«
Augenblicklich schüttelte Lady Anne den Kopf. »Nach dem, was ich gerade vernommen habe, ist das Mädchen geistesgestört. Und wenn Doktor Clouston involviert ist, bin ich mir sicher, dass er sämtliche Rechtsverfahren ausnutzen wird, um es zu bescheinigen.«
Und es wird ihm auch gelingen, dachte sie. Auch wenn Schottland eines der strengsten Gesetze im Umgang mit Geisteskranken in der zivilisierten Welt hatte.
Mr Pratt zog einen der wackeligen Stühle heran und setzte sich näher ans Feuer.
»Sie mag wohl geisteskrank sein, Lady Anne. Aber käme es Ihnen denn nicht höchst gelegen … wenn sie es nicht wäre?«
Lady Anne schaute auf wie ein Hund, der gerade Witterung aufgenommen hat. »Sie meinen … sie wegen Mordes vor Gericht stellen und verurteilen zu lassen?«
»In der Tat. Cloustons Inkompetenz ans Licht bringen. Oder einen Interessenkonflikt. Immerhin steht er der Familie sehr nah.«
Lady Anne seufzte. »Ich darf nicht in derlei Intrigen verwickelt sein. Doktor Clouston weiß alles über …« Sie formte die Worte »meinen Sohn« mit den Lippen und schirmte sich dabei für den Fall, dass Billy neugierig aus dem Dunkeln spähte, mit einer Hand den Mund ab.
Mr Pratt zog seinen Stuhl ein wenig näher an den ihren.
»Niemand braucht etwas von Ihrer Beteiligung zu erfahren, Ma’am. Wenn Sie die Angelegenheit mir überlassen …« Er schluckte. »Wenn ich unsere Karten richtig ausspiele, könnte ich damit endlich meine Schuld bei Ihnen begleichen. Und Sie bekommen Ihre Rache am alten McGray.«
Erster Teil
»Störe du
Nicht diesen Staub in seiner Ruh:
Gesegnet, wer ihn ehrt, den Stein
Verflucht, wer rührt an mein Gebein.«
Inschrift auf einer Grabplatte, gefunden auf demSt James’s Cemetery, London datiert 1802
1890
19. Februar
»Passende Nacht, um die Toten wieder auszugraben!«
Das heisere Flüstern hallte durch die rabenschwarze Dunkelheit, untermalt von den dumpfen, hektischen Aufschlägen von zwei Spaten auf der Erde.
Ob man die Augen offen hatte oder nicht, machte keinen Unterschied: Die Nacht war so stockfinster, dass die beiden Leichendiebe nicht einmal die Grabeinfassung erkennen konnten. Sie konnten sich gegenseitig lediglich am Rascheln ihrer Kleidung und am Geräusch ihrer klappernden Zähne wahrnehmen. Und selbst wenn sich der Himmel öffnen würde – was höchst unwahrscheinlich war –, würde es keinen nennenswerten Mondschein geben.
»Erinnert mich an die Nacht, in der wir die arme Bessy McBean wieder ausgebuddelt haben. Nettes Mädchen. Eine Milchmagd. Wir haben uns ein bisschen am Hornpipe Dance versucht, wenn du verstehst, was ich meine. Hab erst begriffen, dass es ihr Grab war, als wir die Kiste aufgestemmt haben. Stell dir vor, wie ich geschrien habe, als ich ihr Gesicht vor Augen hatte! War immer noch drall und hübsch. ’n bisschen grün, aber noch nicht von Würmern angeknabbert.«
Sein Gefährte grub ein wenig schneller.
»Denk nicht, ich wäre ein Rohling, ich fühle mich wirklich schlecht wegen ihr. Ich wusste, dass sie für den Seziertisch bestimmt war, damit sie aufgeschnitten wird und ihre Teile in Gläser gesteckt werden. Aber Geschäft ist Geschäft. Hmm! Vielleicht hast du ihre Augen ja mal im College gesehen! Wie sie in einem dieser Glaskolben herumdümpeln? Sie waren grün, und sie hatte da so einen sonderbaren Fleck auf dem …«
»Oh, nun halt doch mal die Klappe!«
»Ach! Dir rutscht wohl das Herz in die Hose, was, Junge?«
Die Antwort bestand lediglich aus einem Schnauben.
»Und dabei hab ich dir noch nicht mal von den wirklich gruseligen Nächten erzählt! Wie damals, als die Hexen schon vor uns am Werk gewesen waren und sich schon an Fingern, Kopfhaut und Leber bedient hatten …«
»Ich sagte, halt die Klappe! Kannst du nicht …«
In diesem Moment ertönte ein Klirren. Metall auf Metall. Einer der Spaten war gerade auf eines der Scharniere des Sargs geprallt.
»Flaches Grab«, konstatierte der heisere Dieb, nachdem er zufrieden einen Pfiff ausgestoßen hatte. »Glück gehabt. Dieser alte Küster wollte sicher unbedingt nach Hause, bevor er sich hier noch den Arsch abgefroren hätte.«
Hektisch kratzten sie die lose Erde vom Sargdeckel. Dabei hörten sie die Spaten über etwas schrammen, was eine schmiedeeiserne Verzierung sein musste.
»Eine teure Kiste!«, kommentierte der ältere Grabräuber und zog ein Brecheisen aus der Innentasche seines Mantels. Ohne Zeit zu verschwenden, hebelte er den Deckel fast geräuschlos auf.
Der jüngere Mann zog daraufhin ein Taschentuch hervor, doch bevor er noch Gelegenheit bekam, es sich vor die Nase zu halten …
»Noch nicht einmal ein Anflug von Gestank«, murmelte er, während sie das Holz splittern hörten. »Muss an der Eiseskälte liegen.«
»Sagte ich dir’s doch, Junge. Passende Nacht für unser Geschäft.«
Der Jüngere riss ein Zündholz an. Dessen Flamme warf einen so hellen Lichtschein in die Grube, dass er in der pechschwarzen Nacht geradezu blendete.
»Och,mach das aus, Teufel noch mal!«
»Es muss doch die richtige Leiche sein«, erwiderte der junge Mann und beugte sich über den leblosen Körper.
Das Erste, was er sah, waren zwei gelbliche, knochige Hände, so trocken und verschrumpelt wie altes Pergament. Sie ruhten auf einem alten schwarzen Kleid, auf dem die bleiche Haut geradezu leuchtete. Sie umklammerten immergrüne Zweige und ein kleines Gebetbuch.
Der junge Grabräuber hielt die Flamme näher an das Gesicht, sah das Glitzern einer dünnen goldenen Halskette, schaute dann auf und …
»Mein Gott …«
Sein Keuchen drang aus tiefster Kehle, und ein eisiger Schauer lief ihm über den Rücken.
Mehr brachte er nicht hervor, denn der Ältere bedeutete ihm zu schweigen, riss ihm das Zündholz aus der Hand und erstickte die Flamme mit bloßer Hand. Erneut waren sie von Dunkelheit umgeben. Die beiden lauschten.
Reglos und mit angehaltenem Atem warteten sie eine Weile.
Stille.
»Beeilen wir uns lieber, Junge«, mahnte der ältere Leichendieb und zerrte dabei bereits an der Leiche.
»Ihr Gesicht …«, flüsterte sein Begleiter, der sich noch nicht von seinem Schreck erholt hatte. »In dem Gesicht ist so ein … ein … ach, vergiss es.«
Der Ältere stopfte sich das Gebetbuch aus feinem Leder und die Halskette in die Tasche, und dann hoben sie den schlaffen Körper hoch. Die schmächtige alte Lady fühlte sich irgendwie eine Spur zu schwer an. Ihrer beider Hände mussten taub geworden sein.
Die beiden kletterten aus der Grube und tasteten nach einem Tuch für die Leiche, das sie zuvor auf dem Schnee ausgebreitet hatten. Sie betteten den Leichnam darauf und wickelten ihn hastig darin ein. Im Lichtschein einer sehr weit entfernten Straßenlaterne konnten sie immerhin schemenhaft ihre eigenen Umrisse erkennen.
Mit einem Mal schaute der Ältere auf und verrenkte sich dabei fast den Hals. Sein Begleiter erstarrte und hielt den Atem an, bis er das Geräusch ebenfalls vernahm.
»Wir müssen los«, drängte der Alte.
»Aber das Werkzeug …«
»Keine Zeit!«
Sie hoben die notdürftig eingewickelte Leiche an und rannten keuchend über das Friedhofsgelände. Sie erreichten das große Gotteshaus Greyfriars Kirk, einen Ton dunkler als der sie umgebende Schnee, und als sie um die Ecke bogen, tauchten in der Ferne die Lichter der Gebäude am Grassmarket auf. Erneut vernahmen sie das Geräusch, dieses Mal lauter, und rannten schneller, wobei ihnen die in das Tuch eingewickelte Leiche aus den verschwitzten Händen zu gleiten drohte. Vor ihnen tauchten die eisernen Gitterstäbe des rückwärtigen Tors auf, und gleich dahinter zeichneten sich die Umrisse ihres Pferdewagens ab. Der Gaul, bereits unruhig geworden, stampfte mit einem Huf auf die überfrorenen Schieferplatten.
Der alte Leichendieb stieß das Tor auf. Während die rostigen Scharniere quietschten, durchschnitt ein donnernder Ruf die Luft und hallte über den ganzen Friedhof.
»Ich sehe euch, ihr mickrigen Mistkerle!«
Augenblicklich erkannten sie die dröhnende Stimme von Nine-Nails McGray.
Ein Schuss ertönte, und dann hörte man Trillerpfeifen und das Geräusch über den Schnee trampelnder Hufen. Die Schutzmänner kamen zu Pferd vom Haupteingang.
Ohne richtig hinzuschauen, wuchteten die beiden Grabräuber den Leichnam auf ihren Wagen. Der junge Mann sprang auf die Ladefläche, während sein Gefährte auf den Kutschbock stieg und dem Pferd die Peitsche gab. Der Wagen schoss vorwärts, und der junge Mann musste sich mit beiden Händen an den Brettern festhalten, da die Leiche langsam nach hinten rutschte und ihn über den Rand zu schieben drohte.
Er warf einen raschen Blick über die Schulter und erblickte dabei gerade noch das Mündungsfeuer eines weiteren Schusses im Dunklen.
»Halt!«, brüllte Nine-Nails. Seine Stimme verklang, während der Wagen auf die Gartenanlagen des George Heriot’s Hospital zuschoss. Der massive, schlossartige Gebäudeblock ragte wie eine abweisende Mauer in den Himmel auf.
Der Pferdewagen schoss auf die schneebedeckten, großen und offenen Rasenflächen des Krankenhauses, die von Gaslichtern erhellt wurden.
»Bist du wahnsinnig?«, kreischte der junge Mann, während er das Pfeifen und die lauten Rufe der Schutzmänner vernahm. Im gleichen Moment lenkte der ältere Grabräuber das Pferd nach rechts, auf eine Reihe von im Dunkeln liegenden Rosenbeeten zu. Pferd und Wagen walzten Dornenbüsche und Sträucher nieder. Als der Gaul wieherte und sich aufbäumte, versetzte ihm der Grabräuber einen Peitschenhieb, und genau in dem Moment, in dem erneut hinter ihnen ein Schuss fiel, erreichten sie ein schmales Seitentor. Der marode Lattenzaun konnte dem durchgehenden Pferd nichts entgegensetzen, und das alte Holz zerbarst, als Pferd und Wagen hindurchpreschten.
Sie kamen in eine dunkle, schmale Gasse, die nach Pisse und schalem Bier stank und in der lediglich ein blasser gelblicher Lichtfleck das andere Ende erahnen ließ, weit vor ihnen.
Erneut malträtierte der Ältere das Reittier mit der Peitsche, und der Wagen fuhr schneller. Wieder spürte der junge Mann, wie die Leiche nach hinten rutschte und ihn an den Rand des Karrens drängte. Stöhnend umklammerte er mit beiden Händen die Seitenbretter, trat mit dem Fuß den leblosen Körper der alten Frau wieder nach vorn und krallte sich noch fester in das Holz. Erst dann wurde ihm bewusst, dass die Stimmen der Polizisten nicht mehr zu hören waren.
Er gestattete sich einen Seufzer der Erleichterung, und dann schoss der Wagen auf die lang gezogene Esplanade des Grassmarket. Die hohen Mietskasernen, deren Umrisse er vom Friedhof aus schon gesehen hatte, ragten nun direkt vor ihnen auf. Dahinter erblickte er, wie am Firmament schwebend, die zahlreichen Lichtfleckchen, die, verschwommen im nächtlichen Nebel, aus den schmalen Fenstern von Edinburgh Castle drangen.
Der Alte lenkte das Pferd nach Norden, in die sicheren dunklen Gassen. Doch urplötzlich erscholl von rechts eine wilde Kakophonie aus Rufen, Pfiffen und Hufgetrappel.
Der junge Mann stieß einen Laut des Erschreckens aus angesichts von vier Pferden, die auf sie zu galoppiert kamen, des grellen Scheins von Blendlaternen und erneuter, fast gleichzeitig abgefeuerter Schüsse. Er kauerte sich zusammen, während sein Begleiter flugs nach Westen abbog.
»Wo zur Hölle kamen die denn jetzt her?«, rief er.
Ihr Pferd schlitterte mit den Hufen über das überfrorene Kopfsteinpflaster, und die Räder knarrten, während einige der brüchigen Speichen zersplitterten.
Hurtig setzten sie ihre Fahrt fort und überquerten wenig später das nicht befestigte, schlammige Gelände, das zu der breiten Johnston Terrace führte. Der junge Mann vermochte lediglich undurchdringliche Schwärze vor ihnen auszumachen – die steilen Felsen von Castle Rock. Die Polizisten waren ihnen dicht auf den Fersen. Und mittlerweile knarrte ihr Wagen so heftig, als würde er jeden Moment auseinanderbrechen.
Ein Schuss ertönte, gefolgt von einem Schmerzensschrei des älteren Leichendiebs.
Der junge Mann begriff, dass nun alles verloren war. Die Flucht in die Dunkelheit war seine beste Chance. Aber er musste sofort handeln, bevor sie die beleuchtete Straße erreichten, auch wenn dies bedeutete, dass die Hufe von Nine-Nails’ Pferd ihn zermalmen konnten.
Er holte tief Luft, sprang vom Wagen und überschlug sich im kalten Schneematsch. Unkontrolliert rollte er über den Boden, bis schließlich das Geräusch wilden Galopps und das Gebrüll von Männern in der Ferne verklang.
McGray hörte das Splittern von Holz, dann das Wiehern des erbarmungswürdigen Gauls und schließlich das wilde Getrappel von Hufen.
Er gab Onyx, seinem schwarzen Pferd, die Sporen und schaute mit zusammengekniffenen Augen in das grelle Licht der Laternen, die die Beamten nach vorn hielten.
Die zerklüfteten Hänge von Castle Rock waren viel näher, als er erwartet hatte, und inmitten des Schattens konnte er die Umrisse des Pferdewagens ausmachen, der nun umgekippt in einem schlammigen Graben lag, während sich ein zerbrochenes Rad drehte.
Das Pferd versuchte verzweifelt, sich zu befreien. Es wälzte sich hin und her, war aber noch immer festgeschirrt.
McGray hielt sein Pferd direkt vor dem Karren an und schwenkte den Lauf seiner Waffe hin und her.
»Befreit das arme Tier«, beschied er den Officers, als er sich davon überzeugt hatte, dass keine Gefahr bestand.
Der junge Constable McNair und ein weiterer Mann stiegen von ihren Pferden, um diese Arbeit zu erledigen, während McGray auf die blutverschmierte Schläfe des Leichendiebs starrte.
»Verdammt!«, rief er, während er aus dem Sattel stieg. »Ist die arme Sau tot?«
Constable Millar kam mit einer Laterne angerannt und berührte den Kopf des Mannes. Er kippte schlaff zur Seite.
»Aye, Sir. Aber nicht von Ihrem Schuss. Es sieht so aus, als sei der Alte mit dem Kopf gegen den Felsen geschlagen.«
»Wie verdammt rücksichtslos!«, schnaubte McGray. Er hatte vorgehabt, den Halunken in die Mangel zu nehmen. Er sah sich um. »Sucht nach dem anderen Lumpen. Er kann noch nicht weit gekommen sein.«
Millar nickte und machte auf dem Absatz kehrt. Der Lichtkegel seiner Laterne bewegte sich schwankend über das Feld.
McGray wandte sich gerade in dem Moment wieder dem Pferd zu, als McNair den Bauchriemen mit einem sauberen Schnitt durchtrennte. Augenblicklich sprang das Tier auf alle viere und schüttelte die Mähne. McGray eilte zu ihm und packte es an den Zügelringen. Das Pferd schüttelte sich und wieherte, doch McGray zog es zu sich heran, steckte seine Waffe zurück ins Holster und tätschelte ihm den Rücken. Seine großen, glasigen Augen blickten voller Furcht, und McGray empfand Mitleid mit dem armen Geschöpf.
»Na, na, nun trampel mir mal nicht auf den Füßen herum! Dir kann nichts mehr passieren. Er ist tot!« Dann rief er über seine Schulter: »McNair, werfen Sie mal einen Blick in den Karren.«
McNair tat, wie ihm geheißen, wenn auch nicht mit allzu großer Begeisterung. Mitten in der Nacht ausgegrabene Leichen zu untersuchen, bereitete ihm keine besondere Freude.
»Es ist ein alte Frau«, konstatierte er und richtete den Schein seiner Laterne auf die Leiche, nachdem er das Leichentuch angelupft hatte. »Sieht aus wie … Mein Gott, es ist genau, wie Sie befürchtet hatten, Sir. Es ist die Witwe aus dem Irrenhaus.«
»Diese Schweinehunde! Sind Sie sicher?«
»Ich … ich denke schon, Sir.«
»Ich schau mir das gleich selber an«, sagte McGray, während er mit einer Hand – seiner verstümmelten – durch die Mähne des Pferds strich. Es war ein überraschend gutes Reittier, breit gebaut, muskulös und gut genährt. Das kastanienbraune Fell erinnerte ihn an Rye, jenes letzte Pferd, das ihm sein verstorbener Vater geschenkt hatte, und er spürte einen Stich in der Brust.
»Die haben sich an dem Schmuck bedient, Inspector«, fügte McNair hinzu. »Und nach den Spuren am Hals zu urteilen, müssen sie … Mein Gott!«
Dieses letzte Wort drang ihm als schriller Schrei über die Lippen.
»Was ist?«, erkundigte sich McGray und gab dem Pferd einen abschließenden Klaps. Er trat an den Wagen heran und schaute über die Seitenwand. McNair keuchte.
»Da!«, flüsterte er und wies mit einem zitternden Finger auf das Gesicht der Frau.
Augenblicklich lief McGray ein eiskalter Schauer über den Rücken.
»Was zur Hölle ist das?«, fragte McNair, obschon die grausige Markierung auf der Haut der Toten keiner Erklärung bedurfte.
Es war das Werk des Teufels.
Nackte Angst fuhr Caroline Ardglass in die Glieder.
Der Schrei war ganz in der Nähe erklungen – entweder aus dem Nebenzimmer oder eines weiter. Es war ein durchdringender, gequälter Klagelaut gewesen, wie der Todesschrei einer Frau.
Während sie nach wie vor Miss McGrays Hand hielt, schaute sie auf. Die alte Anstalt erwachte zum Leben, Schritte und Gemurmel waren zu vernehmen.
Und sie durfte gar nicht hier sein.
Miss McGray wälzte sich unruhig im Bett hin und her. Sie war kurz davor gewesen, einzuschlafen. Ihre dunklen Haare und ihre langen Wimpern hoben sich von den makellos weißen Betttüchern ab. Sie riss die Augen – so braun wie Carolines – weit auf und schaute sich erschrocken nach allen Seiten um.
Einen Moment lang schien sie ihre Umgebung – die hohe Decke und die Vorhänge um ihr Himmelbett – nicht wiederzuerkennen. Als ihr dann wieder bewusst wurde, wo sie sich befand, nämlich in der Königlichen Heil- und Pflegeanstalt von Edinburgh, stieß sie ein Wimmern aus. Caroline drückte ihre Hand ein wenig fester.
»Es ist alles gut«, redete sie beruhigend auf sie ein. »Es ist alles gut, Pansy.«
Das war der Kosename der jungen Frau aus ihrer Kindheit, den ihr ihre verstorbene Mutter gegeben hatte. Sie hatte allen Bekannten erzählt, mit ihren Wimpern sehe ihre Tochter aus wie ein Stiefmütterchen, ihre Lieblingsblumen.
Diesen Kosenamen zu hören, zeigte offensichtlich Wirkung. Pansys Pupillen bewegten sich ein wenig in Carolines Richtung, wobei sie den direkten Augenkontakt vermied und schließlich – halbwegs erleichtert – den Atem ausstieß.
Caroline tat dies nun ebenfalls. Irgendwie gelang es ihnen beiden immer, einander ohne Worte zu beruhigen.
Dann aber ertönte ein weiterer Schrei, und nun konnte keine der beiden jungen Frauen einen Laut des Erschreckens unterdrücken.
Caroline wandte sich zur Tür und spürte dabei, wie Miss McGrays Hand zitterte.
»Ich bin gleich wieder da«, flüsterte sie und drückte Pansy einen flüchtigen Kuss auf die Wange.
Mit wild klopfendem Herzen stand sie auf und griff nach dem Türknauf. Noch bevor sie die Tür einen Spaltbreit öffnete und vorsichtig hinausspähte, konnte sie schon die Pfleger in den Gängen auf und ab hasten hören.
Im Flur war es noch immer stockdunkel, und ein kalter Luftzug umstrich ihr Gesicht. Caroline holte tief Luft und trat aus dem Zimmer hinaus. Während die Stimmen der Krankenschwestern und Pfleger überall um sie herum widerhallten, schaute sie sich nach beiden Seiten um. Zwar konnte sie nicht verstehen, was gerufen wurde, doch erfüllte eine beklemmende, unheilvolle Atmosphäre die Luft.
Sie hastete durch die Dunkelheit, war jedoch erst wenige Schritte weit gekommen, als sie gegen einen Eichenschrank prallte, dessen Inhalt daraufhin laut schepperte. Sie stöhnte vor Schmerzen auf – und dann packte eine eiskalte Hand sie am Arm.
Am ganzen Körper zitternd, fuhr sie herum, und gerade als sie einen Schrei ausstoßen wollte …
»Sie müssen gehen, Miss Ardglass! Sofort!«
Es war Cassandra Smith, die Oberschwester, das blasse Gesicht von einer schwankenden Petroleumlampe beleuchtet. Caroline gestattete sich einen Seufzer der Erleichterung.
»Was geht hier vor?«, wollte sie wissen, doch Miss Smith schob sie schon weiter.
»Sofort! Wenn Doktor Harland Sie sieht …«
Zu spät. Sie vernahmen die unverwechselbare Stimme des Arztes, der direkt hinter der Ecke des Gangs Anweisungen erteilte.
Als sie sah, dass der Lichtschein der Lampe, die der Arzt mit sich führte, heller wurde, erstarrte Caroline. Sie rührte sich erst wieder, als Miss Smith sie in einem verzweifelten Versuch, sie vor seinen Blicken zu verbergen, hinter einen Schrank stieß – eben jenen, gegen den Caroline vorhin geprallt war.
In diesem Moment bog der Doktor um die Ecke, und Miss Smith eilte ihm entgegen.
»Doktor Harland! Haben Sie das gehört?«
»Und ob ich es gehört habe! Selbst der vermaledeite Lord Provost muss es gehört haben!«
Caroline presste sich mit dem Rücken eng gegen die kalte Wand. Dabei bemerkte sie, dass der Saum ihres schwarzen Kleids hinter dem Sockel des Schranks hervorlugte. Sie wagte es nicht, sich zu rühren, sondern starrte nur auf die langen Schatten des Arztes und der Schwester, die sich scharf vor ihr auf den Dielen abzeichneten.
»Mit wem haben Sie gerade gesprochen?«, wollte der Doktor wissen. »Mit Miss McGray?«
»A… Aye, Doktor.«
Dr. Harland seufzte ungeduldig. »Wieder ein Anfall? Muss ich …?«
»Oh nein! Sie war bloß … durcheinander wegen …«
»Nun, dann kommen Sie mit. Diese Sache ist zu hässlich.«
Caroline konnte anhand des sich bewegenden Schatten erkennen, dass Miss Smith zögerte. »Ähm … Kann ich mich noch vergewissern, dass Miss McGray …?«
»Ich pfeife auf Miss McGray! Soeben ist jemand umgebracht worden!«
Um nicht einen entsetzten Schrei auszustoßen, musste sich Caroline den Mund zuhalten. Durch seinen Schatten erkannte sie, dass sich der Doktor auf sie zubewegte und dann, nur wenige Zentimeter von ihr entfernt, am Schrank vorbeiging. Sie konnte sogar sein billiges Rasierwasser riechen. Als er kurz innehielt, setzte Carolines Herz einen Schlag aus.
Doch dann ging der hochgewachsene Arzt, ohne sich noch einmal umzuschauen, bis zur nächsten Ecke weiter.
Miss Smith folgte ihm, wobei sie die Lampe mitnahm. Sie warf Caroline einen kurzen Blick zu.
»Sie wird dann … Sie wird dann wohl dieses Mal alleine zurechtkommen müssen, nehme ich an!«
Caroline nahm die leicht erhobene Stimme wahr: Diese letzten Worte waren an sie gerichtet gewesen, und in dem Augenblick, als ihr dies bewusst wurde, verschwand die Oberschwester um die Ecke. Fast augenblicklich verblasste der Lichtschein ihrer kleinen Lampe, und Caroline blieb in völliger Dunkelheit zurück.
Allein.
Mitten in dieser grässlichen Anstalt, in der offenkundig gerade jemand ermordet worden war.
Sie wird dann wohl alleine zurechtkommen müssen, hallte es in ihrem Kopf wider.
Sie zwang sich dazu, tief Luft zu holen, und blinzelte angestrengt, um in der Finsternis irgendwelche Konturen auszumachen. Sie würde sich ihren Weg nach draußen ertasten müssen. Zum Glück war sie schon oft durch diese Flure gegangen, auch schon bevor sie erfahren hatte, dass ihre Halbschwester hier Insassin war.
Caroline ging einen Schritt auf die Tür von Pansys Zimmer zu, wollte ihren Mantel holen und ihr Gute Nacht sagen. In diesem Moment vernahm sie jedoch ein wüstes Stimmengewirr, so nah, dass sie zusammenzuckte.
»Er ist tot, das versichere ich euch«, rief jemand. »Große Stichwunden in der Brust!«
Ohne nachzudenken, stürmte Caroline den Flur hinunter und tastete sich dabei an den holzvertäfelten Wänden entlang. Sie musste hier raus, bevor im ganzen Gebäude die Hölle losbrach. Falls wirklich jemand getötet worden war – erstochen! –, würde die Polizei herbeigerufen werden, und darunter wäre dann auch …
Sie schüttelte den Kopf und huschte durch die Gänge und über die Treppen der Bediensteten. Schließlich gelangte sie ins Erdgeschoss und in die große Halle, durch deren Fenster sie einen Blick auf die hinteren Gartenanlagen bekam. Die Rasenflächen wurden von einer einzigen Gaslaterne beleuchtet, die durch die großen Fenster einen schwachen Lichtschein in den Raum warf.
Caroline konnte gerade noch die Umrisse der lang gezogenen Halle erkennen und die Tür zu den dahinter liegenden Lagerräumen, durch die sie schließlich in den Garten gelangen würde. Sie eilte weiter, tastete sich dabei weiter an der Wand entlang, und bemerkte dabei, dass es immer heller wurde. Die zahlreichen Räume der Anstalt erwachten nach und nach zum Leben, und immer mehr Licht fiel auf die Gartenanlagen und in die Halle.
Plötzlich überlief sie ein Schauer, und sie hielt inne.
Ihre Hand war auf etwas Warmem, Schleimigem und Abstoßendem gelandet. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie auch ihre Handschuhe in Pansys Zimmer zurückgelassen hatte.
Caroline zog die Luft ein und schaute auf. Mittlerweile war das Licht, das durch die Fenster der Halle einfiel, hell genug, dass sie erkennen konnte, was sie gerade berührt hatte.
Dieses Mal gelang es ihr nicht, sich zu beherrschen. Sie stieß einen durchdringenden Schrei aus, wich zurück und starrte auf die dunklen roten Flecken auf ihren Fingerspitzen.
Erneut richtete sie ihren Blick auf die Wand. Prompt klappte ihr die Kinnlade herunter, und beinahe hätte sie sich ihre verschmierten Handteller auf das Gesicht gelegt. Stattdessen schrie sie erneut auf und rannte zur Hintertür. Dabei prägte sich der Anblick dieser grässlichen Sudelei vor ihrem inneren Auge so deutlich ein, als starrte sie sie noch immer an.
Auf dem weißen Putz der Wand prangten vier dick mit Blut gemalte Flecken: ein Paar bedrohlich blickende Schlitzaugen, gekrönt von langen, großen Hörnern.
1
Der Tod meines Vaters kam völlig überraschend.
Elgie, mein jüngster Bruder, musste mir die Nachricht telegraphieren, denn die Schneestürme im Februar machten fast vierzehn Tage lang jedwede Reise unmöglich. Selbst der Postbote kam kaum durch, und ich erhielt ein nasses, verschmiertes Stück Papier, auf dem die Nachricht gerade noch zu entziffern war.
Offenbar hatte er einen Schlaganfall erlitten, was als solches keine Überraschung war. Der alte Mr Frey hatte die letzten fünfzehn Jahre damit verbracht, sich Schnaps, Wein, Gebäck und Beef en croûte hinzugeben.
Sein Tod traf mich weit härter, als ich es erwartet hätte, das muss ich zugeben, und das nicht nur wegen meines ziemlich desolaten Gemütszustands.
Ich hatte mich in den vergangenen fünf Wochen in meinem Anwesen in Gloucestershire etwas erholt. Eine Erholung, die ich nach dem schrecklichen Fall, der mich im vergangenen Dezember fast das Leben gekostet hätte, wirklich nötig hatte.
Mein gebrochenes Handgelenk war inzwischen zwar verheilt, doch die Knochen schmerzten bei feuchtem und kaltem Wetter nach wie vor, und ich konnte meine rechte Hand immer noch nicht wieder so weit beugen wie vorher. Nach wie vor plagten mich auch Albträume, in denen Fallbeile auf meinen Hals niederfuhren und sich mir in der Finsternis grüne und blaue Fackeln näherten – zum Glück nicht mehr jede Nacht.
Sobald das Wetter es zuließ, nahm ich einen Zug nach London, eingepackt in meinen dicksten schwarzen Mantel und ausgerüstet mit einer ungewöhnlich voluminösen Taschenflasche – mein Hausdiener Layton schien meine Bedürfnisse weit besser einschätzen zu können als ich selbst. Er hatte auch meinen Sonntagsstaat eingepackt, da er wusste, dass ich es mit den übelsten Oberschicht-Hyänen der gesamten Christenheit zu tun bekommen würde, nämlich der Familie Frey.
Ich hatte seit fünfzehn Monaten nicht mehr in London geweilt, daher schockierte es mich, dass hier alles so düster und rußgeschwärzt aussah und das Kuppeldach von St. Paul’s wie das Gesicht eines Schornsteinfegers daherkam.
Hatte es hier schon immer so ausgesehen? Oder war der Ruß des letzten Jahres besonders ungnädig gewesen? Vielleicht war es einfach so, dass die Stadt Jahr für Jahr ein wenig dunkler und trostloser wurde, was aber nur denjenigen auffiel, die wie ich lange Zeit weg gewesen waren.
Selbst die weiß verputzte Fassade meines Elternhauses in Hyde Park Gate sah trist aus – beinahe grau inmitten der kahlen schwarzen Äste der Ahornbäume, die beide Seiten der Straße zierten. Die Stadt selbst schien sich für die Trauerfeierlichkeiten herausgeputzt zu haben.
Catherine, meine Stiefmutter, war wie jede respektable Lady ihrer Klasse »am Boden zerstört vor Kummer« und nicht in der Lage, mich zu empfangen, worüber ich heilfroh war. Ich kann gar nicht genug betonen, wie viel Verachtung ich für diese Frau empfinde. Mein Halbbruder Oliver war ebenfalls nicht in der Lage zu empfangen (wie der Butler sich ausdrückte), und Elgie hatte, wie ich in Kürze berichten werde, mittlerweile seine eigene Wohnung bezogen. Daher nahm ich das Abendessen alleine zu mir und verbrachte die Nacht dann in einem der Gästezimmer – dem kleinen, dessen Fenster auf den Hinterhof mit Stall und Abort blickten. Catherine verstand es sehr gut, es andere spüren zu lassen, wenn sie nicht willkommen sind.
Am folgenden Morgen stand ich früh auf, legte meinen besten schwarzen Anzug an und steckte mir meinen geliebten Smaragd-Siegelring an. Ich trank eine Tasse grässlichen Tee (ob Catherine nun einen schrecklichen Geschmack hat oder aber die Bediensteten angewiesen hatte, mir das billige Zeug zu servieren, entzieht sich meiner Kenntnis) und bat dann, ohne auf die anderen Mitglieder des Haushalts zu warten, einen Diener, mir eine Droschke zu ordern. In meiner Eile vergaß ich sogar meine Handschuhe.
Die Luft war kalt und trocken, als ich den Brompton Cemetery betrat, und die Sonne war gerade erst im Südosten aufgegangen.
Ich ging um die von einer Kuppel gekrönte Aussegnungshalle herum, deren elegante Sandsteinwände selbst im schwachen Morgenlicht hell leuchteten. Der Sarg meines Vaters würde vor der Beerdigung für den Gottesdienst dorthin gebracht werden, doch momentan war das Tor noch verschlossen, der Friedhof ruhig und menschenleer. Im Hintergrund waren allerdings gedämpft die Geräusche der Stadt zu vernehmen, ein tiefes, gleichmäßiges, allgegenwärtiges Brummen, das mich die friedliche Stille meines Anwesens in Gloucestershire vermissen ließ.
Über mir krächzten Raben. Ruckartig schaute ich hoch und sah sie direkt über meinen Kopf gleiten. Sie ließen sich auf den knorrigen Ästen einer nahen Esche nieder. Ihre scharfen Augen ließen mich sofort nervös werden.
»Ian!«
Ich erschrak, als mein Namen gerufen wurde, erkannte die Stimme jedoch augenblicklich. Als ich mich umdrehte, erblickte ich die schlanke Gestalt von Elgie, der, ebenfalls ganz in Schwarz gekleidet, eilig auf mich zukam. Er wirkte blasser als sonst, hatte dunkle Ringe unter seinen sonst so unbekümmert blickenden Augen. An diesem trostlosen Morgen war es schwer zu glauben, dass er im kommenden Sommer erst zwanzig werden würde.
»Ich komme gerade aus Mutters Haus«, begrüßte er mich atemlos, kaum dass er in Hörweite war. »Sie haben mir gesagt, dass du schon hier sein musst.«
Ich wollte mich gerade über Catherines kühlen Empfang auslassen, besann mich dann aber eines Besseren. Auch Elgie hatte gerade seinen Vater verloren.
»Wie geht es dir?«, fragte ich ihn, nachdem ich ihm voller Zuneigung auf den Rücken geklopft hatte. Ich bot ihm an, mich auf einen Spaziergang über den verschneiten Friedhof zu begleiten.
Er seufzte, als wir uns in Bewegung setzten, und ich sah, nur notdürftig unter seinem weißen Schal verborgen, den geröteten Abdruck des Kinnhalters seiner Violine. Er musste den größten Teil der Nacht mit Üben verbracht haben.
»Ich bin mitgenommen«, räumte er ein. »Damit hat niemand gerechnet. Ich war am gleichen Abend mit ihm zum Abendessen verabredet! Ich wollte ihn in mein neues Zuhause einladen, damit er …«
Ihm schnürte es die Kehle zu, und er schaute zur Seite. Ich wollte ihn fragen, wie der alte Mr Frey darauf reagiert hatte, dass er, Elgie, aus dem Haus der Familie ausgezogen war, biss mir jedoch erneut auf die Zunge und unterließ es. Fast zehn Jahre lang hatte Vater sich bitter darüber beschwert, dass ich ausgezogen war und eine Stelle beim CID angetreten hatte. Ich hatte gut acht Jahre in meiner angemieteten Unterkunft in der Nähe von Scotland Yard gewohnt, wo er mich trotz meiner wiederholten Einladungen nicht ein einziges Mal aufgesucht hatte. Dann, vor etwas mehr als einem Jahr, war ich beruflich gezwungen gewesen, nach Edin-blöd-burgh zu ziehen (wie mein alter Herr es zu nennen beliebte), und obwohl mich Vater dort tatsächlich zweimal besucht hatte (aus Gründen, die an anderer Stelle erläutert werden), vermag ich nicht zu beurteilen, ob er meine Entscheidungen jemals wirklich gutgeheißen hat.
In diesem Moment, am Tag seiner Beerdigung, hätte ich es nicht ertragen können zu erfahren, wie sehr er womöglich Elgies Wohnung gelobt hatte.
Mein junger Halbbruder hatte sich vor Kurzem in einem Haus in einem schicken Abschnitt der Pont Street einquartiert, wo zahlreiche Theatergrößen residierten und nach den Premieren dort ihre Soirées veranstalteten. Elgie, mittlerweile Erster Geiger am Lyceum Theatre Orchestra, würde dort ständig Persönlichkeiten wie Sir Arthur Sullivan, Oscar Wilde und Bram Stoker treffen. Umso glücklicher war ich daher, dass es mir gelungen war, Catherine aus dem Weg zu gehen, denn sie hätte in einem fort über die glorreichen Triumphe ihres Jüngsten geschwafelt.
Höchstwahrscheinlich erriet Elgie meine Gedanken, und so setzten wir in betretenem Schweigen unseren Spaziergang fort.
»Das letzte Mal habe ich Vater in Edinburgh gesehen«, sagte ich schließlich. Ich vernahm das Flattern von Flügeln über uns, schaute jedoch nicht auf, da ich befürchtete, die Raben könnten uns folgen.
»Ach ja«, erwiderte Elgie. »Der Fall der Zigeunerin.« Er rang sich ein Lächeln ab. »Ich hörte, dass er im Club über nichts anderes mehr gesprochen hat, als er zurückkehrte. Und auch bei fast jedem Abendessen brachte er es aufs Tapet, und sei es auch nur, um Mutter damit zu ärgern!«
Nun lachten wir beide, und wie erquickend dies doch war. Doch es folgte unweigerlich ein quälender Kummer. Ich hatte gerade erst begonnen, den alten Mann mit seiner schneidenden Offenheit, seiner messerscharfen Zunge und seinen lockeren Umgangsformen zu mögen. Und er hatte seinerseits gerade erst begonnen, mir anzudeuten, dass er meine Berufslaufbahn »tolerierte« – die mittlerweile so gut wie beendet war.
»Wirst du lange bleiben?«, fragte mich Elgie nun, doch ich zuckte lediglich mit den Schultern. »Du kannst natürlich immer bei mir wohnen. Ich bin in letzter Zeit ohnehin kaum zu Hause! Und an einem Abend musst du unbedingt ins Theater kommen und dir The Dead Heart anschauen.«
Ich rümpfte die Nase. »Henry Irving spielt so einen inbrünstigen, Röstkartoffeln mampfenden Pariser révolutionnaire, und Miss Terry so ein tränenreiches französisches Flittchen mit tiefem Dekolleté?«
Elgie wölbte eine Braue. »So in etwa. Aber mit voller Orchesterbesetzung und echtem Feuer auf der Bühne.«
»Schon verlockend, aber ich nehme lieber Abstand. Stell dir den Wutanfall vor, den Henry Irving bekäme, wenn er mich im Publikum entdecken würde.«
»Aber Bram – ich meine Mr Stoker – würde sich vielleicht freuen, dich zu sehen.«
Ich kicherte. »Das wird nicht der Fall sein. Erinnere dich daran, dass ich ihn einmal verhört habe, als er mit Laudanum betäubt war.«
»Oh, stimmt ja.« Elgie nickte. »Nun, ihm zufolge hält er immer noch Kontakt mit Mr McGray. Er schreibt gerade – sag niemandem, dass du das von mir hast – irgendeinen Schauerroman oder etwas Ähnliches.«
»Und ich bin mir sicher, dass Nine-Nails für ihn eine endlos sprudelnde Quelle von Information über das Sonderbare und Geisterhafte ist!«
»Sag das nicht so abschätzig. Mittlerweile dürftest du fast genauso viel wissen wie er.«
»Wohl kaum«, log ich, wobei mir augenblicklich die Zutaten für eine Hexenflasche in den Sinn kamen.
Elgie schaute zur Seite, zu den schneebedeckten Grabsteinen. Schließlich stieß er einen Seufzer aus.
»Gehst du wirklich nicht zurück?«
Als ich dies hörte, wäre ich fast gestrauchelt.
»Was denn? Nach Schottland?«
»Ja.«
Mein Lachen hallte über den Weg. »Wozu denn? Ich habe nicht einmal irgendwelche Habseligkeiten, die ich von dort oben in Sicherheit bringen müsste.«
»Ja, aber … Du hast mir mal gesagt, du hättest das Bedürfnis, deinen Wert unter Beweis zu stellen. Etwas Nützliches zu tun, um …«
Ich kickte einen vereisten Schotterstein weg, der auf dem Weg lag. »Es ist schon erstaunlich, wie einem ein einziges Jahr voller Prüfungen und Leid die Einstellung diametral verändern kann.«
Wir gingen einen Moment schweigend weiter, zum nördlichen Ende des Friedhofs, wo die Gräber dichter beieinander lagen und die Bäume weniger gepflegt aussahen. Dornengestrüpp wucherte um die Grabsteine herum, die zumeist mit Moos und gelblichen Flechten überwachsen waren. Auch die Bäume wirkten ein wenig wilder – ihre Äste waren stärker gekrümmt, die Stämme knorriger.
»Also, was wirst du jetzt tun?«, fragte mich Elgie. Die Luft musste kälter geworden sein, denn während er sprach, begann, sein Atem zu kondensieren. »Willst du einfach in Gloucestershire herumhocken, abgeschnitten von der Welt, und den Rest deines Lebens Whisky und Brandy herunterkippen, während jemand anderes dein Anwesen verwaltet?«
»Meine Güte, aus deinem Munde hört sich das ja sogar noch verlockender an!«
Elgie schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, aber das passt nicht zu dir.«
Ich war zu erschöpft, um eine Antwort zu geben, verzog lediglich spöttisch die Lippen.
»Ich kenne dich«, beharrte er. »Das ist alles so ähnlich schon einmal passiert, nachdem du, deiner Illusionen über das rechtswissenschaftliche Studium beraubt, aus Cambridge zurückgekehrt warst. Du konntest nicht lange untätig zuhause herumhocken. Du bist nicht wie Oliver.«
Nun musste ich glucksen, da ich mir unseren pausbäckigen Bruder vorstellte, wie er seine Zeit in der Behaglichkeit von Catherines Salons verbrachte und dabei ständig Käse und Kekse knabberte.
Elgie lächelte. »Du wirst im Handumdrehen wieder etwas finden, das deine Aufmerksamkeit fesselt. Ich gebe dir zwei Wochen.«
»Lass uns zurückgehen«, sagte ich – teils, um das Thema zu wechseln, aber auch, weil dieses Ende des Friedhofs für meinen Geschmack zu unheimlich wurde.
Wir machten auf dem Absatz kehrt. Doch mit einem Mal schien die Luft zu vibrieren.
Beschreiben kann ich es nicht. Wir spürten es beide, und im nächsten Augenblick hörten wir das Schlagen von Hunderten Flügeln über uns.
Ein Schwarm schwarzer Vögel stieg zwischen den Grabsteinen und aus dem Unterholz auf, zog einen Kreis über dem Friedhof und flog dann nach Süden.
Ich warf den Kopf herum und erblickte zwei schwarz gekleidete Gestalten, deren Konturen sich perfekt vom frischen Schnee abhoben und deren Gesichter unter Kapuzen verborgen waren. Die eine war groß und schlank, die andere klein und füllig.
Mein Herz setzte einen Schlag aus. Wie Elgies Atem kondensierte nun auch der meine vor meinem Mund, so als wäre auch mein Inneres erkaltet.
»Geh!«, beschied ich meinem Bruder.
»Was?«
»Sofort!«
Ich musste ihn energisch schubsen, dann bemerkte auch er die beiden Gestalten. Sie erinnerten ihn wohl an schlängelnde Schatten, die in der Dunkelheit auf ihn lauerten, um sich ihn zu schnappen, denn statt Protest einzulegen, eilte er davon.
Mein Herz pochte, und instinktiv griff ich in meine Innentaschen und tastete nach meiner Waffe.
Natürlich hatte ich keine mehr. Ich war nicht mehr Inspector beim CID und trug schon seit Wochen keine Waffe mehr.
Die Gestalten näherten sich mir mit langen, hastigen Schritten. Während sie die Reihen der vernachlässigten Grabsteine passierten, wehten ihre Umhänge im Wind. Sie sahen aus wie die Hexen aus meinen Albträumen, jedoch so real und greifbar, wie ich sie vor nicht einmal zwei Monaten erblickt hatte. Ich rechnete damit, dass sich Raben auf ihren Schultern niederlassen würden und dass sie Fackeln mit grünem Feuer hervorholen oder mir Fläschchen voll grässlicher Säuren ins Gesicht schleudern würden.
Doch irgendwie war ich nicht imstande, mich zu rühren.
Ich blieb stehen, die Füße fest auf den Boden gepflanzt, und stellte mich ihnen, ohne zu blinzeln. Ich schaute mich nur einmal kurz um, um mich zu vergewissern, dass Elgie fort war. Als ich mich wieder umdrehte, waren die Frauen nur noch zehn Meter von mir entfernt, und die kleinere hob soeben die Hand, um sich ihre Kapuze abzunehmen. Als ich ihr Gesicht sah, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen.
2
»Joan!«, rief ich.
Tatsächlich war es meine frühere Hausangestellte, die mich, drall wie eh und je, mit liebevollem Blick, aber erschöpft anschaute.
»Master Frey!«, begrüßte sie mich mit ihrem schweren Lancashire-Akzent und machte dabei einen tiefen Knicks. Das war äußerst ungewöhnlich für sie. Ich nahm eine Spur von Gereiztheit in ihrer Stimme wahr, und als die größere der beiden Gestalten ihre Kapuze zurücklegte, verstand ich auch, warum.
Caroline Ardglass.
»Sie!«, rief ich erneut. »Warum immer Sie, verdammt?«
»Mr Frey«, antwortete sie mit einer leichten Verbeugung. »Wie immer ganz der Gentleman.«
Ihre Wangen waren ein wenig hohler als im Dezember, und zwischen ihren Brauen war der Ansatz einer kleinen Falte auszumachen. Mir wurde bewusst, wie sehr sie im Alter ihrer berüchtigten Großmutter ähneln würde. Zum Glück würde dies erst in ein paar Jahrzehnten der Fall sein.
»Was tun Sie denn hier?«, fragte ich, zu verwirrt, um an Höflichkeitsfloskeln zu denken.
Caroline schaute zur Seite und betrachte mit betretenem Gesicht die Gräber.
»Ich weiß, das ist jetzt der denkbar schlechteste Zeitpunkt«, murmelte sie. »Mein … mein Beileid.«
Ihre Stimme bebte, als sie dies sagte. Auch sie hatte vor einem Jahr ihren Vater verloren. Er war geistig verwirrt gewesen, und ich war im Moment seines Todes bei ihnen beiden gewesen.
»Danke«, erwiderte ich. »Aber … von wem haben Sie das erfahren?«