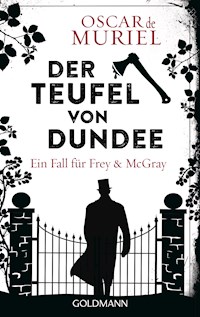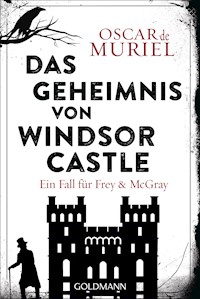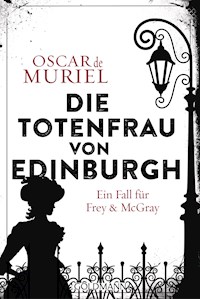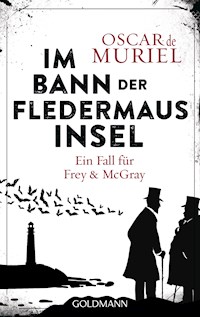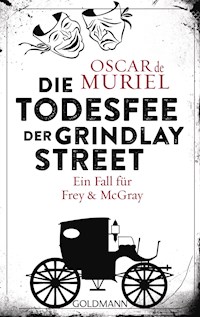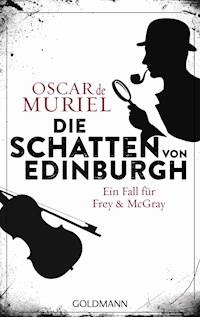8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Frey und McGray
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Neujahr 1889. In Edinburghs berüchtigter Irrenanstalt ermordet ein gefährlicher Psychopath eine Krankenschwester. Kurz bevor ihm die Flucht gelingt, unterhält er sich mit einer jungen Patientin, die seit Jahren kein Wort gesprochen hat. Wieso hat sie ihr Schweigen gebrochen? Sind die Gerüchte von schwarzer Magie wahr, die in den Fluren der Anstalt kursieren? Inspector McGray geht der Fall sehr nahe, denn die junge Frau ist seine Schwester. Zusammen mit seinem Partner Ian Frey verfolgt er den Mörder durch das ganze Königreich – bis zum Pendle Hill, Sitz der gefürchteten Hexen von Lancashire, wo die beiden genialen Ermittler einem furchtbaren Geheimnis auf die Spur kommen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Ähnliche
Buch
Neujahr 1889. Einem mysteriösen Patienten gelingt es, Edinburghs berüchtigter Irrenanstalt zu entfliehen. Eine Krankenschwester lässt er sterbend zurück. Kurz zuvor hat man den Mann in einer leisen Unterhaltung mit einer Patientin gesehen – einer jungen Frau, die seit Jahren kein Wort mehr von sich gegeben hat. Wieso hat sie ihr Schweigen gebrochen? Sind die Gerüchte von schwarzer Magie wahr, die in den Fluren der Anstalt kursieren? McGray geht der Fall sehr nahe, denn bei der jungen Frau handelt es sich um seine kleine Schwester. Zusammen mit Ian Frey, der immer noch im schottischen Exil lebt, jagen sie den gefährlichen Psychopathen quer durch das ganze Land. Bis zum Pendle Hill, Sitz der gefürchteten Hexen von Lancashire, in dessen Schatten die beiden genialen Ermittler einem furchtbaren Geheimnis auf die Spur kommen …
Autor
Oscar de Muriel wurde in Mexico City geboren und zog nach England, um seinen Doktor zu machen. Er ist Chemiker, Übersetzer und Violinist und lebt und arbeitet heute in Manchester.
Die Frey & McGray-Reihe im Goldmann Verlag:
Die Schatten von Edinburgh. Ein Fall für Frey & McGray (Band 1)
Der Fluch von Pendle Hill. Ein Fall für Frey & McGray (Band 2)
Die Todesfee der Grindlay Street. Ein Fall für Frey & McGray (Band 3)
Im Bann der Fledermausinsel. Ein Fall für Frey & McGray (Band 4)
Die Totenfrau von Edinburgh. Ein Fall für Frey & McGray (Band 5)
Das Geheimnis von Windsor Castle. Ein Fall für Frey & McGray (Band 6)
Oscar de Muriel
Der Fluch von Pendle Hill
Ein Fall für Frey & McGray
Aus dem Englischenvon Peter Beyer
Das zweite ist für Don Raul und Doña Enriqueta, die ich sehr vermisse.
’Tis at such a tide and hour,Wizard, witch, and fiend have power,And ghastly forms through mist and showerGleam on the gifted ken;And then the affrighted prophet’s earDrinks whispers strange of fate and fear,Presaging death and ruin nearAmong the sons of men; –Sir Walter ScottThe Dance of Death
1624
31. Oktober
»Zieh die Vorhänge auf«, befahl Lord Ambrose, nach Luft ringend vor Anstrengung. »Ich muss sehen, wie sie sterben.«
Jane versuchte ihn mit sanfter Gewalt wieder ins Bett zu bugsieren. Der Mann war gebrechlich – steinalt, sagten manche – und bereits seit Monaten bettlägerig. Doch es war ihm gelungen, aufzustehen und sich die anderthalb Meter bis zum Fenster zu schleppen. Jane erschrak über den blanken Hass, der seine morschen Knochen antrieb.
»Sie werden kaum etwas erkennen können, Sir. Es ist Neumond.«
»Zieh sie auf, du dreckige Metze!«, brüllte er und schüttelte ihre Hand ab. Prompt bekam er einen Hustenanfall und spuckte Schleim und Blut über das weiße Nachthemd, das ihm Jane gerade erst angezogen hatte.
Die Dienstmagd schnaubte. Ganz gleich, wie oft sie ihn gewaschen und umgezogen hatte, der alte Mann stank immer nach Urin und Krankheit; selbst in die Steinmauern seines Gemachs drang der Gestank ein.
»Also gut«, gab sie nach und wischte ihm Brust und Mund energisch mit einem feuchten Lappen ab. »Aber danach werden Sie sich schön lange ausruhen.«
»Das werde ich in der Tat«, knurrte er. Mit seiner knochigen, von Altersflecken gezeichneten Hand krallte er sich bereits in den Stoff der Gardinen. Sie konnten die Schreie der Menge hören. Jane schob ihren Dienstherrn beiseite und zog die Vorhänge genau zum richtigen Zeitpunkt auf. Die Hinrichtung würde jeden Moment beginnen.
Durch die Butzenscheiben schauten sie auf die Burg und den Marktplatz von Lancaster, auf dem lodernde Fackeln bedrohliche Schatten auf Hunderte von Häuptern warfen. Die Galgen standen bereit, und die Menschen scharten sich um sie wie Motten um das Licht.
Der alte Mann öffnete den Riegel des Fensters, worauf ein eisiger Windstoß durch das Zimmer fegte.
»Da kommen sie«, sagte er, während er sich bemühte, nichts zu verpassen.
Elendig schlurften die sechs Hexen über den Platz. An ihren gefesselten Füßen hingen schwere, auf dem Kopfsteinpflaster rasselnde Ketten, die sie hinter sich herzogen. Jahrhunderte würden kommen und vergehen, doch der Klang dieser rostigen Kettenglieder würde auf ewig widerhallen, da die Seelen der Hexen niemals Ruhe finden würden. In Lumpen gekleidet, mit schmutzigen Gesichtern und grauem, fettigem Haar stellten sie das Böse in Person dar, und die Menge zeigte keinerlei Mitleid: Männer, Frauen und Kinder schrien, spotteten und warfen faules Gemüse nach den verurteilten Frauen.
Angewidert kniff Jane die Augen zusammen; sie verspürte Abscheu bei dem Gedanken, dass all diese grauenhaften, herzlosen Rüpel am nächsten Morgen in die Kirche gehen würden und sich gute Christen schimpften.
Die Hexen schlurften mit hängenden Schultern und barfuß, und doch strahlten sie einen Rest von Würde aus, während sie zu den Galgen gingen. Sie flehten, wehklagten und weinten nicht – nicht einmal, als der Henker schmutzige Kapuzen, die noch den Gestank nach früheren Opfern in sich bargen, über ihre Gesichter zog. Der Mann legte jeder einen Strang um den Hals und zog die Knoten zu, während der Bischof betete und ihnen Sündenablass gewährte.
Ohne mit den Augen zu blinzeln und mit angehaltenem Atem umklammerte Lord Ambrose mit zitternden Händen das Fensterbrett. Als die Hexen schließlich mit den Füßen in der Luft baumelten, stieß er leise den Atem aus.
Doch sie waren nicht sofort tot.
Einen grässlichen Moment lang zappelten ihre Körper wie Würmer an einer Angel, während der Mob wie wild aufheulte. Dann, noch während die Körper der Hexen sich vor Schmerz krümmten, erhoben sich ihre Arme langsam, bis alle sechs mit ausgestreckten Armen auf die gleiche Stelle irgendwo in der Menge wiesen.
Instinktiv stoben die Menschen auseinander, so als seien die knochigen Finger dazu imstande, Feuer zu werfen. Ein Mann jedoch blieb wie versteinert stehen. Es war ein stattlicher, in einen Biberfellmantel gehüllter Mann.
»Ist das Ihr Sohn, Sir?«, fragte Jane Lord Ambrose atemlos, obwohl sie die Antwort nur zu gut kannte. »Steht dort Sir Edward?«
»Wir hätten sie verbrennen sollen«, flüsterte Lord Ambrose. Das Grauen stand ihm ins Gesicht geschrieben, ein Grauen, wie Jane es bei ihm noch nie gesehen hatte.
Unter der schmutzigen Kapuze einer der sich quälenden Hexen – wer es war, vermochte niemand zu sagen – ertönte eine schauderhafte Stimme, trotz des Strangs um den Hals erklang sie tief und heulend.
Lord Ambrose vernahm von der Verwünschung lediglich die Zahl dreizehn. Die Menge hingegen verstand sie zur Gänze, und die verängstigten Einwohner der Stadt ergriffen die Flucht.
Die Arme hoben sich weiter empor und wiesen nun auf die oberste Etage des prachtvollsten Hauses der Stadt.
Jane erschauderte. Die Hexen deuteten auf sie, direkt auf das geöffnete Fenster, und es war, als könnten ihre Augen durch den Stoff der Kapuzen und Augenbinden hindurchblicken.
Genau in diesem Moment, wie von unsichtbarer Hand gestoßen, fiel Lord Ambrose rücklings um. Man hörte Knochen brechen, als er auf dem Boden aufschlug und dabei seinen Nachttopf umstieß, worauf sich dessen ekelerregender Inhalt überall um ihn herum ergoss.
Der höchst erlauchte und mächtige Herr des Hauses von Ambrose, dessen Urgroßvater im Rosenkrieg an der Seite von Königen gekämpft hatte, hauchte in einer Lache seiner eigenen Exkremente sein Leben aus.
Beinahe hätte Jane den Namen der Heiligen Jungfrau ausgesprochen. Sie wollte sich bekreuzigen, doch das Fenster stand weit offen, und Hunderte Protestanten hätten es mit angesehen.
»Hexen in einer Neumondnacht gehängt«, murmelte sie, während sie auf den Platz hinabschaute und sich bewusst wurde, dass es der Abend vor Allerheiligen war.
1882
2. Dezember
So, wie er sich mitten in der Nacht davonschlich, kam Dr. Clouston nicht umhin, sich wie ein Dieb zu fühlen.
Er strich sich über den Bart und betrachtete die in der Ferne scheinenden Lichter von Edinburgh, die allmählich dahinschwanden, während die Kutsche ihn fast geräuschlos durch die mit Reif bedeckte Landschaft fuhr. Tom machte seine Sache gut und sorgte dafür, dass sich die Pferde so leise wie möglich vorwärtsbewegten, doch der Preis dafür war ein quälend langsames Tempo.
Plötzlich ließ ein Geräusch Clouston in seinem Sitz hochfahren. Er drehte sich so rasch um, dass er sich den Hals verrenkte, und sah, dass das Geräusch vom Flügelschlagen eines näher kommenden Raben stammte. Der Vogel krächzte laut, es klang geradezu höhnisch.
Bemüht, seine blankliegenden Nerven zu beruhigen, atmete Clouston tief ein. Doch seine Beklommenheit und das eisige Wetter ließen ihn erschauern. Von dem Moment an, als er vor fast drei Jahrzehnten seine Arbeit der Psychiatrie aufgenommen hatte, war ihm klar gewesen, dass sein Beruf ihm die dunkelsten Seiten von Menschen zeigen und er nicht nur die unwürdige Behandlung der Geisteskranken mitansehen würde, sondern auch die mitunter furchtbaren Reaktionen ihrer Familien. Wahnsinn war etwas Schreckliches; er förderte das Beste und das Schlechteste von Menschen zutage, und heute Abend handelte es sich bedauerlicherweise um Letzteres. Normalerweise fielen ihm solche Fälle in den Schoß, doch bei diesem war es anders gewesen. Diesen Fall hatte er sich selbst eingebrockt.
Warum hatte er sich auf diese schändliche Vereinbarung eingelassen? Es war nicht das erste Mal, dass er so etwas getan hatte. Sein Mitgefühl war stärker gewesen als sein gesunder Menschenverstand, das begriff er jetzt. Genauer gesagt, hatte seine Charakterschwäche obsiegt, wie seine Frau angemerkt hatte. Am liebsten hätte Clouston Tom aufgefordert, umzukehren und zurückzufahren. Doch er hatte sein Wort gegeben, auch wenn das Wort eines Gentleman im Laufe der Zeit immer weniger bedeutete.
Tom klopfte an die Seitenwand der Kutsche, und sie hielten vor einer niedrigen, unter dem Schnee kaum noch sichtbaren Steinmauer an. Etwa zwanzig Meter dahinter stand ein kleines, heruntergekommenes Bauernhaus. Mit seinen schiefen Wänden sah es eher so aus wie ein Haufen abgeerntetes Stroh. Das einzige Anzeichen von Leben war das schwache Licht, das aus einem schmalen Fenster drang.
Clouston holte tief Luft und öffnete den Schlag der Kutsche. Doch er kam nicht einmal dazu, einen Fuß auf den Boden zu setzen.
Wütendes Gebell zerriss die Luft, und drei riesige Hunde tauchten wie aus dem Nichts heraus auf und rannten wie wild auf ihn zu. Unmittelbar bevor der erste Hund ihn erreicht hatte, schlug Clouston den Schlag wieder zu und erhaschte durch das Fenster einen angsteinflößenden Blick auf triefende Fangzähne und wütende kleine Augen.
Bellend und knurrend umrundeten die Hunde die Kutsche. Doch kurz darauf ließ ein einzelner Gewehrschuss sie verstummen, und sie zogen sich mit eingekniffenen Ruten zurück. Ein Mann, dessen wuchtige Figur nur schemenhaft zu erkennen war, tätschelte sie nacheinander, bevor er sich der Kutsche näherte.
In der Hand hielt er eine Blendlaterne, doch ihr Licht schien äußerst schwach. Erst als der Mann direkt vor dem Kutschenschlag stand, konnte Clouston seine groben Züge erkennen. Er erblickte wettergegerbte Haut, hängende Wangen, eine breite Nase und Augen, die so klein waren und wütend blickten wie die der Hunde.
»Ich … ich habe einen Termin«, brachte Clouston stockend hervor. Selbst in seinen Ohren klang seine Förmlichkeit unpassend. »Ich bin gekommen, um Lady …«
»Sprechen Sie nicht ihren Namen aus!«, fauchte der Mann. »Steigen Sie aus und folgen Sie mir.«
Clouston zögerte einen Moment. Dann sah er, dass Tom mit einem Gewehr in der Hand plötzlich auf den Boden sprang, und der Mann trat einen Schritt zurück. Es beruhigte ihn, dass sein getreuester Krankenpfleger genauso einschüchternd war wie dieser hochaufragende Fremde.
»Die Herrin befindet sich drinnen«, sagte der Mann und ging entschlossen auf das Haus zu.
Clouston nickte Tom rasch zu, und sie folgten ihm.
Die alte Tür gab ein markerschütterndes Knarren von sich, als der Mann mit dem Fuß dagegenstieß und eintrat. Tom folgte ihm als Erster und schaute sich rasch um.
»Sie ist hier, Doktor.«
Die Nacht war bitterkalt, sodass Clouston nicht allzu lange zögerte und rasch eintrat. Allerdings war das Innere wenig anheimelnd. Der Raum war klein und dunkel, der Putz an den Wänden bröckelte ab, und auf dem Fußboden lagen überall Stroh, Blätter und Unrat herum. Das Haus war offenkundig seit Monaten nicht mehr bewohnt.
In einem Kamin brannte ein notdürftig entfachtes Feuer. Seine kraftlosen Flammen machten die Temperatur jedoch kaum erträglicher. Das Mobiliar bestand lediglich aus einem zersplitterten Tisch und zwei Stühlen. Auf einem von ihnen saß Lady Anne Ardglass. Ihr war sichtlich unangenehm zumute.
Auf den ersten Blick wirkte sie auf Clouston wie ein altes Weib aus einem Ammenmärchen. Lady Anne war hager, groß und achtunggebietend. Sie war Ende sechzig, wirkte jedoch wesentlich älter; das Feuer warf scharfe Schatten auf ihr faltiges Gesicht, wodurch die tiefen Furchen auf ihrer Stirn und ihre zusammengepressten Lippen noch hervorgehoben wurden.
Sie hatte ein einfaches schwarzes Kleid angelegt und trug einen billigen Tafthut, wohl um zu versuchen, gewöhnlich auszusehen, doch das Ergebnis war eher theatralisch. Ihr selbstsicheres Auftreten konnte sie nicht ablegen; sie drückte den Rücken hochmütig durch, hatte das Kinn erhoben und ließ ihre langen schmalen, von Spitzenhandschuhen geschützten Hände sittsam gefaltet im Schoß ruhen. Ihr Hut vermochte das silberne Haar, das sie sich aufwendig zu Zöpfen geflochten hatte, nicht vollständig zu verdecken.
»Nehmen Sie Platz, Doktor«, bot sie ihm mit schneidender, gebieterischer Stimme an.
Während er sich setzte, nahm Clouston einen sonderbaren Geruch aus Zitronenverbene und Brandy wahr. Wie jedermann in Edinburgh wusste auch er, dass Anne Ardglass den Spitznamen Lady Glass trug, und bei näherem Hinsehen bemerkte er die dunklen, geäderten Ringe unter ihren Augen, die von lebenslangem ausgeprägtem Trinken zeugten. Wahrscheinlich versuchte sie, ihre Alkoholfahne mittels Kräutersäckchen und Parfüm auf ihrer Kleidung zu überdecken.
»Wie Sie sehen, habe ich alle Unterlagen mitgebracht«, sagte sie und wies dabei auf einen Stapel Dokumente auf dem Tisch. »Es fehlt nur noch Ihre Unterschrift.«
Clouston sah die Papiere durch. Er hatte Lady Anne gewarnt, er werde ihr nur helfen, wenn sie sich an das Gesetz hielt. Entsprechend den Scottish Lunacy Acts, dem Gesetz, das den Umgang mit Geisteskrankheiten regelte, durfte niemand für wahnsinnig erklärt werden, wenn nicht zwei voneinander unabhängige Ärzte den Patienten untersucht hatten und sich hinsichtlich der Diagnose einig waren. Offenbar hatte Lady Anne ein Gutachten von einem unbekannten Psychiater in Newcastle bekommen. Die Qualität des Berichts sprach Bände über die Inkompetenz des besagten Arztes, und unter anderen Umständen hätte Clouston seiner Rechtswirksamkeit energisch widersprochen. Nichtsdestoweniger gab es keinerlei Zweifel an der Geisteskrankheit von Lord Joel Ardglass. Lady Annes einziger Sohn hatte mehrere Selbstmordversuche unternommen, und es war Wochen her, dass er zuletzt zusammenhängend geredet hatte – von diesem scheußlich brutalen Vorfall ganz zu schweigen.
»Doktor«, sagte Lady Anne, »ich muss Sie noch um einen Gefallen bitten, bevor Sie meinen Sohn mitnehmen.«
Am liebsten hätte Clouston mit der Faust auf den Tisch geschlagen und ihr lautstark klargemacht, dass er ihr noch nicht einmal die erste Gefälligkeit erwiesen hatte. Stattdessen holte er nur tief Luft.
»Worum geht es, Ma’am?«
Lady Anne schaute ihren Diener an, worauf dieser einen zerknitterten Umschlag aus seiner Brusttasche hervorholte. Lady Anne entnahm ihm ein einzelnes Blatt, das sie auf dem Tisch auseinanderfaltete. »Würden Sie das hier bitte ebenfalls unterzeichnen?«
Noch während sie sprach, reichte ihr der Diener Tinte und Federhalter.
Clouston hatte gerade nur die allerersten Zeilen gelesen, als er schon wütend äußerte: »Lady Anne, bitten Sie mich allen Ernstes, das hier zu unterschreiben?«
»In der Tat. Sie haben darauf gedrängt, dass ich die gesetzlichen Vorschriften einhalte, und ich habe mich gründlich mit ihnen befasst. Es gibt kein Gesetz, das es Ärzten verbietet, anderen von den Angelegenheiten ihrer Patienten zu berichten. Es gab nur einen Präzedenzfall, auf den meine Anwälte stießen. Dabei enthüllte ein Londoner Mediziner, dass eine seiner Patientinnen ein uneheliches Kind abtreiben ließ. Der Gatte des Flittchens erfuhr davon und ließ sich von ihr scheiden. Daraufhin verklagte sie den Arzt, mit Erfolg. Das Gericht erachtete seine Aussagen als ›rufschädigend und verleumderisch‹, obwohl sie vollkommen der Wahrheit entsprachen.«
»Und indem ich dies unterzeichne, räume ich ein, dass ich Sie, falls ich mich über diese Angelegenheit jemals äußern würde, damit verleumden würde«, las Clouston vor.
»So ist es. Es ist exakt der Wortlaut dieses Präzedenzfalls. Das würde uns vor Gericht viel Zeit ersparen, falls diese Angelegenheit jemals publik gemacht werden würde. Offiziell ist mein Sohn heute Nachmittag auf dem Weg nach Belgien ums Leben gekommen.«
Clouston schnaubte. »Ich dachte, Sie hätten eine höhere Meinung von mir und meiner Berufsehre.«
»Das habe ich auch, Doktor, doch ich muss sicherstellen, dass der Name meiner Familie nicht in den Dreck gezogen wird. Das werden Sie sicher verstehen.«
Clouston massierte sich die Schläfen. »Sie bringen mich dazu, mich im Dunkeln herbeizuschleichen Wie ein Schurke … wir unterzeichnen notdürftig zusammengeflickte Dokumente, um den Eindruck zu erwecken, diese Vereinbarung sei gesetzeskonform … Und nun bin ich es auch noch, der Ihren Bedingungen zustimmen muss? Ihr Hochwohlgeborenen seid unbarmherziger gegenüber euren wahnsinnigen Familienangehörigen als wir einfachen Bürger.«
Dr. Clouston kannte das alles nur zu gut. Eine Geisteskrankheit war eine peinliche Angelegenheit für den Adel; für Aristokraten bedeutete es krankes Blut, sündhafte Ahnen oder gar ein Fluch oder eine dämonische Besessenheit.
Lady Anne zog eine feine Taschenflasche aus ihrer kleinen Handtasche hervor, dazu einen kleinen silbernen Trinkbecher, und schenkte sich geziert einen Drink ein. Clouston hoffte, dass sie sich dafür schämte, war sich jedoch nicht sicher, ob sie einer solchen Gefühlsregung überhaupt fähig war.
»Wollen Sie mehr Geld?«
»Lady Anne, es gibt Dinge, die Sie mit Geld nicht kaufen können.«
Sie genehmigte sich zwei kräftige Schlucke, bevor sie den Trinkbecher senkte. »Ich weiß.«
»Was, wenn ich mich weigere zu unterschreiben?«
»Dann bin ich gezwungen, anderweitig Hilfe zu suchen, und wie das aussehen würde, wissen Sie.«
Leider wusste Clouston das tatsächlich. Kein angesehener Arzt würde ihren Bedingungen zustimmen. Letztendlich würde sie sich mit einem jener Scharlatane gemein machen, die schauderhafte Irrenanstalten leiteten, in denen es geradezu mittelalterlich zuging. Dort würde nicht einmal der Versuch unternommen werden, Joels Zustand zu verstehen oder zu verbessern, sondern der Mann würde lediglich vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen werden. Er würde verrotten und vergessen werden.
Lady Anne richtete ihren ausdruckslosen Blick auf das Kaminfeuer. Zum ersten Mal erklang ihre Stimme nur noch als Flüstern.
»Lassen Sie mich nicht betteln, Doktor.«
Das Feuer im Kamin knisterte, und einen Moment lang war in dem Raum kein anderes Geräusch zu vernehmen. Es war, als stünde die ganze Welt still und wartete auf die Antwort des Doktors.
Niedergeschlagen fuhr sich Clouston über das Gesicht. »Irgendetwas sagt mir, dass wir diesen Handel noch bereuen werden …«
Schließlich schnappte er sich den Federhalter und unterschrieb so erbost, dass er fast das Papier durchstoßen hätte.
Draußen heulte einer der Hunde auf. Die anderen taten es ihm nach, und wenig später erklang ein unbändiges Gebell.
»Was zum Teufel …?«, rief Lady Annes Diener, während er die Tür öffnete und eisige Zugluft hereinfuhr. Er und Tom gingen nach draußen, während Clouston auf der Schwelle verharrte.
Er musste die Augen zusammenkneifen, um zu erkennen, was vor sich ging. Die Hunde rannten zur Straße, und inmitten ihres durchdringenden Gebells vernahm Clouston den wilden Hufschlag eines galoppierenden Pferdes. Er benötigte einen Moment, um es deutlich erkennen zu können, denn es war ein kohlrabenschwarzes Reittier – so schwarz wie die mit einer Kapuze verhüllte Gestalt, die dem Pferd die Sporen gab … auf einem Damensattel?
»Nehmen Sie die Waffe herunter«, wies Clouston Tom an, der nervös das Gewehr erhoben hatte.
Es war eine Reiterin, und zwar eine sehr talentierte.
Sie zügelte ihr Pferd mit geübten Bewegungen und sprang dann aus dem Sattel. Die Hunde jaulten auf und sprangen um sie herum, hielten jedoch Abstand.
Lady Glass’ hirnloser Diener eilte zurück ins Haus und hätte Clouston dabei um ein Haar umgerannt. »Sie ist hier, Milady!«
»In Gottes Namen, sagen Sie mir, wer es ist, Jed!«
Er bekam keine Gelegenheit mehr dazu, denn nun trat die Frau auch schon energisch ein.
Sie zog sich die Kapuze ab, und Clouston erblickte das hübsche Gesicht eines neunzehnjährigen Mädchens. Er erkannte Ähnlichkeiten mit der Gestalt von Lady Anne: das längliche Gesicht, die weiche Wangen- und Kieferpartie, das spitze Kinn. Andererseits hatte sie geschmeidige, makellose Haut, und ihre braunen Augen glänzten vor stürmischer Entschlossenheit. Außerdem war sie ziemlich klein oder wirkte neben dem riesigen Jed jedenfalls so.
»Caroline!« Lady Anne stand auf, trat mit raschen Schritten auf das Mädchen zu und versetzte ihr eine heftige Ohrfeige. Es hörte sich an wie ein Peitschenknall.
Sofort baute sich Clouston zwischen den beiden Frauen auf. »Lady Anne, ein solch brutales Verhalten kann ich nicht dulden!«
»Sie ist meine Enkeltochter; ich werde tun, was ich für angebracht halte!«
»Wenn Sie ihr noch ein Haar krümmen, werde ich gehen und Sie mit Ihrem Unglücksfall alleine lassen.«
Lady Annes Augen waren blutunterlaufen, und ihre Nasenlöcher blähten sich auf, während sie ihren Ärger herunterschluckte. Sie schaute das Mädchen über die Schultern des Doktors hinweg an.
»Wer zum Teufel hat dir erzählt, dass wir hier sind? War es Bertha?«
Caroline nickte. Dem heftigen Schlag zum Trotz unterdrückte das Mädchen ihre Tränen.
»Ich wusste es«, murrte Lady Anne und kehrte zu ihrem Stuhl zurück. »Der alten Nervensäge darf man nicht trauen. Die Prügel, die ich ihr verabreichen werde, wenn wir zurück…«
»Tu es nicht!«, sagte Caroline. »Ich habe sie gezwungen, es mir zu verraten. Es ist meine Schuld, ich musste einfach hierherkommen.«
»Du musstest einfach hierherkommen!«, äffte Lady Anne sie nach. »Warum denn?«
»Er ist mein Vater!« Nun lief Caroline eine einzelne Träne die Wange hinab.
Lady Anne kippte lediglich einen weiteren Schluck Branntwein herunter.
Dr. Clouston setzte sich über die üblichen Förmlichkeiten hinweg und legte dem Mädchen sanft eine Hand auf die Schulter. »Beruhigen Sie sich bitte, Miss Ardglass. Setzen Sie sich doch.«
Sie trat einen Schritt auf den noch verbliebenen Stuhl zu, schüttelte dann jedoch den Kopf. »Nein … nein, ich muss ihn sehen.« Mit flehendem Blick schaute sie zu Clouston auf. »Bitte, Doktor, wo ist er?«
Clouston schaute Lady Anne an.
»Oben im Schlafzimmer«, erwiderte diese, worauf Caroline sofort zur Treppe lief. Clouston hörte ihre hektischen Schritte im Obergeschoss und vernahm dann, wie sie plötzlich in Tränen ausbrach.
»Wie kann man in einem solchen Moment nur so brutal zu ihr sein?«, sagte er und warf Lady Anne einen wutschnaubenden Blick zu.
Diese nahm erneut einen Schluck, dieses Mal direkt aus der Taschenflasche – höchstwahrscheinlich, um die Worte hinunterzuspülen, die sie in Wirklichkeit hatte ausstoßen wollen. Lady Anne war eine der mächtigsten Frauen Schottlands, sie war es nicht gewohnt, dass ihr Handeln oder ihre Methoden von jemandem infrage gestellt wurden.
»Jed, holen Sie ihn herunter.« Sie räusperte sich. »Wir haben die Dokumente unterzeichnet; es ist nicht nötig, noch länger hierzubleiben.« Sie kicherte bitter. »Nicht nach diesem skandalösen Auftritt von ihr.«
Jed ging hinauf und holte Lord Ardglass. Der arme Mann war fest in eine Wolldecke eingewickelt und schwankte, fast so, als sei er betrunken. Vielleicht war ihm aber auch absichtlich Alkohol eingeflößt worden, damit er keinen Widerstand leistete. Wie seine Mutter und seine Tochter war auch Joel von schmaler Statur, und sein längliches Gesicht ähnelte dem ihren sehr. Doch am heutigen Abend war sein Blick nicht mit dem der beiden Frauen zu vergleichen. Am heutigen Abend war er eine traurige, gebrochene Gestalt. Clouston betrachtete sein graues Haar und seinen verzerrten Gesichtsausdruck. Es war der hoffnungsloseste Ausdruck, den er seit Langem gesehen hatte.
Caroline kam nach. Um ihr Schluchzen zu unterdrücken, hielt sie sich ein zusammengeknülltes Taschentuch vor den Mund.
Joel legte den Kopf schräg, und nachdem er die Worte mit den Lippen geformt hatte, gelang es ihm, sie mit einer traumverlorenen Stimme auszusprechen. »Du armes Ding … du musst mich so sehr lieben.«
Er liebkoste Carolines Gesicht, und sie presste sich die Hand ihres Vaters einen Moment an die Wange, bevor Jed Lord Ardglass nach draußen zerrte. Caroline wollte ihnen folgen, doch Lady Anne hielt sie am Arm zurück.
»Er befindet sich jetzt in guten Händen«, flüsterte Clouston. Doch er wusste, dass es keine Worte gab, die das Mädchen jetzt hätten trösten können. Auch war ihm klar, dass es ihr nicht erlaubt werden würde, ihren Vater zu besuchen; keine junge Dame aus guter Gesellschaft durfte sich jemals in einer psychiatrischen Anstalt sehen lassen. Alles, um den guten Ruf zu wahren.
»Ich werde Ihnen bald einen Besuch abstatten«, sagte Clouston, während er und Tom hinausgingen. Er schaute Lady Anne direkt in die Augen. »Um sicherzugehen, dass es dem Mädchen gut geht.«
Als Reaktion erntete er lediglich ein Knurren, doch dies war ihm Bestätigung genug, dass Caroline in Frieden gelassen werden würde. Clouston hatte ein wenig Macht über die mächtige Lady Anne gewonnen – und er würde sie ausüben.
Sobald Tom sah, dass Lord Ardglass in der Kutsche bequem untergebracht worden war, machten sie sich auf die Heimfahrt. Das Heulen der Hunde verklang nun allmählich in der Ferne.
Endlich entspannte sich der Doktor.
Er glaubte, das Schlimmste hinter sich zu haben. Nie hätte er sich träumen lassen, wie lange die Ereignisse dieses Abends ihn verfolgen würden, wie viele Leben zerstört werden würden und wie viele Todesurteile er soeben unterzeichnet hatte.
1883
24. Juni
Adolphus McGray spürte den Schmerz, lang bevor er das sanfte Schaukeln der Kutsche wahrnahm, bevor er das Hufgetrappel vernahm, bevor das morgendliche Licht durch seine geschlossenen Augenlider sickerte.
Es war ein stechender, brennender Schmerz in seiner rechten Hand. Dr. Clouston hatte erklärt, er werde bald nachlassen, aber vielleicht hatte er schlichtweg gelogen. Adolphus hätte es ihm nicht übelgenommen: Der Doktor hatte versucht, ihm alles zu erleichtern, doch Schicksalsschläge wurden nicht leichter durch Nettigkeiten.
Als die Kutsche endlich zum Stehen kam, sagte der Doktor sanft: »Adolphus, wir sind da. Ich habe Sie zu Ihnen nach Hause gebracht.«
Adolphus tat so, als habe er nicht gehört. Er wollte sich dieser Welt noch nicht stellen.
Dr. Clouston seufzte. »In Ordnung, ich werde zuerst Amy helfen und komme dann wieder zurück.«
Adolphus hörte, wie er ausstieg. Seine kleine Schwester – die den Spitznamen Pansy trug, weil ihre großen, fast schwarzen, von langen Wimpern umrahmten Augen an Stiefmütterchen erinnerten, die Lieblingsblumen ihrer Mutter –, war in einer zweiten Kutsche nachgekommen. Clouston hatte ihr eine starke Dosis Laudanum verabreicht, und sie war an Händen und Füßen mit Verbandsstoff gefesselt.
Allein der Gedanke daran trieb Adolphus Tränen in die Augen, und ihm lief ein heftiger Schauder über den Rücken. Instinktiv hob er die rechte Hand, um sich die Tränen abzuwischen, doch dann erblickte er die dicke, blutgetränkte Bandage.
Ein Bild hatte sich in seiner Erinnerung eingeprägt. Nicht das seiner toten Eltern oder das seiner Schwester, die mit dem Messer auf ihn eingestochen hatte, sondern das dieser … Kreatur.
Es konnte nicht real gewesen sein. Ganz und gar nicht.
Er wollte etwas Zeit gewinnen, nur einen Moment, um sich zu beruhigen. Sobald er dann seine Fassung wiedergewonnen hatte, würde er aussteigen und Clouston dabei helfen, Pansy ins Haus zu tragen. Er brauchte nur eine Minute.
Unglücklicherweise bekam er diese Schonfrist nicht. Denn nun hörte er, wie eine dritte Kutsche mit galoppierenden und laut wiehernden Pferden auf dem Moray Place vorfuhr.
Adolphus erhaschte durch seine Kutschentür hindurch einen Blick und erkannte, dass es sich um ein großes Gefährt handelte; es war ein eleganter, glänzend schwarz lackierter Landauer mit aufgeklapptem Verdeck. Seines Schicksalsschlags zum Trotz war es heute ein schöner Sommermorgen.
Unmittelbar darauf vernahm er Gebrüll. George, der alte Butler, stieß Flüche aus, und sogar der kultivierte Dr. Clouston schrie wütend.
»Wie können Sie es wagen?«, hörte Adolphus ihn brüllen. »Wie können Sie es wagen, ausgerechnet jetzt zu kommen?«
Eine allzu bekannte Frauenstimme gab eine scharfe Erwiderung, und Adolphus schüttelte seinen Kummer notgedrungen ab.
Als er aus der Kutsche sprang, erblickte er die große Gestalt von Lady Glass, die nach wie vor Trauerkleidung trug. Ihr erwachsener Sohn war vor etwa einem halben Jahr ums Leben gekommen. Die Etikette, was die Trauerfarbe anging, hielt sie zwar ein, doch sie trug einen breitkrempigen, mit schwarzen Federn und ausgestopften Vögeln geschmückten Hut.
Alistair Ardglass, ihr dicklicher Neffe, half ihr aus der Kutsche. Die alte Dame schien ebenso bemüht, ihre Knöchel nicht zu zeigen, wie den Straußenfedern ihres extravaganten Fächers keinen Schaden zuzufügen.
»Was wollen Sie?«, rief Adolphus, obwohl er es bereits wusste. Ein Schwall rasender Wut stieg in ihm hoch – sie waren bereits gekommen, um seinen Familiensitz zu plündern.
Der Blick der alten Frau heftete sich auf Adolphus’ Hand. Sie fächerte sich Luft zu, so als wolle sie einen üblen Geruch aus ihrer Nähe beseitigen. »Jüngchen …«
»Kommen Sie mir nicht mit so einer herablassenden Scheiße. Ich bin fünfundzwanzig Jahre alt.«
Lady Anne lächelte höhnisch. »Na schön, Mr Adolphus Mc… Ach, wie töricht von mir! Sie sind ja jetzt der einzige Mr McGray«, fügte sie voller Genuss hinzu. »Ich komme, um dieses Wohnhaus wieder in meinen Besitz zu nehmen.«
»Verpissen Sie sich!«
Lady Anne geriet ins Straucheln, so als wären die Worte ein Faustschlag gewesen.
»Was ist denn?«, hakte Adolphus nach. »Haben Sie heute früh schon zur Flasche gegriffen, Lady Glass?«
»Dieses Grundstück befindet sich nach wie vor im Besitz meiner Tante«, schaltete sich nun Alistair ein. Seine Stimme klang noch überheblicher als die der alten Frau. »Ihr Vater hat nicht einmal die Hälfte abbezahlt, und da er nun das Zeitliche gesegnet hat, sind wir dazu berechtigt, es wieder in Besitz zu nehmen.«
»Wir haben die Mittel, es abzubezahlen, Sie Fettsack!«
»Darum geht es nicht«, sagte Lady Anne. »Ich will mein Eigentum zurück. Ich bereue es, es Ihresgleichen überhaupt angeboten zu haben.«
»Und mir tut es leid, dass mein Dad jemals Geschäfte mit so einem betrunkenen Weibsstück gemacht hat.«
Alistair fuhr hoch. »Reden Sie nicht so mit meiner Tante, Sie dreckiger Hurensohn.«
Adolphus landete einen Schlag mitten im pausbäckigen Gesicht ihres Neffen. Alistair taumelte und fiel rücklings gegen Lady Annes Busen. Adolphus hätte ihm nun gern eine ordentliche Abreibung verpasst, doch er hatte den Schlag mit seiner verletzten Hand ausgeführt.
»Verdammt!«, schrie er, als er spürte, dass die Nähte gerissen waren. Fast hätte er das Gleichgewicht verloren, doch Clouston stützte ihn.
»Lady Anne«, knurrte der Doktor mit tiefer, drohender Stimme, »wenn Sie nicht alles noch schlimmer machen wollen, dann gehen Sie jetzt lieber!«
»Doktor, zwingen Sie mich nicht, zum Äußersten zu schreiten«, erwiderte sie, ohne groß Notiz von ihrem blutenden Neffen zu nehmen. »Diese Angelegenheit geht Sie nichts an. Wie mein Neffe Alistair schon sagte, sind wir dazu berechtigt, das …«
»Ach, lassen Sie mich mit Ihrem juristischen Geschwafel in Ruhe!«, blaffte Clouston. »Wenn Sie wirklich glauben würden, Sie hätten das Recht auf Ihrer Seite, dann hätten Sie Ihre Anwälte mitgebracht, um es zu bezeugen.«
Die Frau hielt sich den Fächer näher an die Brust.
Den Blick fest auf Lady Anne geheftet, zog Clouston Adolphus mit sich.
»Gehen Sie und belästigen Sie diese Familie nicht länger. Ich werde nicht zulassen, dass Sie etwas gegen sie unternehmen.«
»Doktor« – Lady Anne trat auf die beiden zu – »Sie können sich nicht in meine Angelegenheiten einmischen. Sie können nicht …«
»Lady Anne, Sie wissen verdammt genau, dass ich das tun kann!«
Sie blieb abrupt stehen, als wäre sie gegen eine unsichtbare Wand gelaufen, und unverhohlener Zorn machte sich in ihrem Gesicht breit.
»Das würden Sie nicht wagen«, flüsterte sie. Ihre Brust wogte, während sie mit ihren knochigen Händen die schwarzen Federn des Fächers umklammerte.
»Sie«, entgegnete Clouston und trat näher an Sie heran, »würden es nicht wagen, es darauf ankommen zu lassen.«
Nur ganz wenige Menschen hatten Lady Anne jemals so unter Druck gesetzt – und sie war schon etliche Jahre auf der Welt – und für einen kurzen Moment wirkte sie lammfromm.
Adolphus ließ sich von Clouston mit sanfter Gewalt in das Haus geleiten. Er wollte gerade fragen, was Lady Glass so aus der Fassung gebracht hatte, sah dann aber, dass der alte George sich damit abmühte, Pansy anzuheben.
Trotz des quälenden Schmerzes in seiner Hand rannte Adolphus los, um seine Schwester auf die Arme zu nehmen und ins Haus zu tragen. Er wollte nicht, dass die Nachbarn sie in einem derart beklagenswerten Zustand zu Gesicht bekamen.
Die McGrays würden eine ganze Weile lang nichts mehr von Lady Anne zu hören bekommen.
»So, fertig«, murmelte Clouston und befestigte das Ende des frischen Verbands.
Adolphus drehte ihm den Kopf wieder zu, nachdem Clouston ihn aufgefordert hatte wegzuschauen, während er ihn versorgte. Der Verband sah so unförmig aus wie zuvor, doch der Stoff war sauber und die Blutung endlich gestillt.
Der Ringfinger seiner rechten Hand war alles andere als sauber abgetrennt worden. Es war nur noch ein Fingerglied übrig geblieben – eine immerwährende Erinnerung an diesen schrecklichen Abend.
Zudem würde sich die Nachricht wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreiten und zur Legende werden. Er würde von nun an für alle Nine-Nails McGray sein.
»Wenigstens kann ich Lady Glass noch immer den Stinkefinger zeigen«, witzelte er mit bitterem Lächeln.
Dr. Clouston war nicht zum Lachen zumute. Stattdessen wirkte er, falls das überhaupt möglich war, nun noch niedergeschlagener.
»Was haben Sie denn?«
Sorgfältig legte der Arzt seine Instrumente wieder zurück in den Koffer. Dann schaute er Adolphus mit beinah verängstigtem Blick an. »Ich muss Ihre Schwester in der Anstalt unterbringen.«
Adolphus verschlug es die Sprache. »Was?«, stieß er schließlich keuchend hervor. »Sie ist doch keine Irre!«
»Es ist nur vorübergehend. Ihnen ist doch klar, dass sie fachgerecht behandelt werden muss.«
Adolphus sprang auf. »Sie dürfen Sie nicht dorthin mitnehmen!«
Clouston war nicht imstande, seinen Blick zu erwidern. »Bitte zwingen Sie mich nicht dazu, laut auszusprechen, was sie getan hat.«
Adolphus lief ein Schauder über den Rücken. Es war, als hätten diese Worte die Büchse der Pandora geöffnet. Er legte die Stirn in Falten, und seine Lippen bebten. Dann brach er zum ersten Mal, seit er erwachsen war, im Beisein anderer in Tränen aus. Er sank auf einem Stuhl zusammen, bedeckte mit beiden Händen das Gesicht und schluchzte wie ein kleines Kind.
Jäh war ihm das ganze Ausmaß der Tragödie klar geworden.
Amy hatte ihre Eltern ermordet.
Diese Erkenntnis löste einen stechenden Schmerz in seiner Brust aus – ein körperliches Symptom, das noch Monate anhalten sollte.
Clouston legte Adolphus besänftigend die Hand auf die Schulter und gab ihm einige Minuten, um zu trauern.
»Ich werde mich gut um sie kümmern«, versprach er schließlich. »Das wissen Sie doch, nicht wahr?«
Adolphus benutzte den sauberen Verband, um sich die Tränen abzuwischen. »Aye, das weiß ich.« Er schaute zum Doktor auf und fragte ihn unnötigerweise: »Wann wollen Sie sie dorthin mitnehmen?«
»Ich fürchte, sofort.«
Adolphus nickte. Mit leerem Blick stand er auf, als der Kummer ihn erneut überwältigte. Er begriff, dass es besser war, es sich nicht weiter auszumalen.
Beweg dich einfach, sagte er zu sich selbst. Denk nicht nach, beweg dich einfach.
Er schleppte sich in das kleine Arbeitszimmer, den Raum, in den sein Vater sich gerne mit einem Buch oder einer Zigarre zurückgezogen hatte. Adolphus verdrängte dieses Bild.
Pansy schlief noch immer auf dem Sofa, auf das er sie behutsam gebettet hatte. Betsy, ihre alte Dienerin, hatte ihr das erstbeste saubere Kleidungsstück übergezogen, das sie hatte auftreiben können, ein blaues Sommerkleid aus dünner Seide. Das Mädchen hatte sich zusammengerollt, um sich warm zu halten. Während ihres unruhigen Schlafs zuckten ihre langen Wimpern.
Adolphus zwang sich dazu, den Blick von ihr abzuwenden. Wenn er in das Gesicht seiner jungen Schwester blickte, würde er nie zulassen können, dass Clouston sie mitnahm. Er sammelte seine Kräfte, hob Pansy auf und wickelte sie sanft in eine Wolldecke ein, die George gebracht hatte.
Die wenigen Schritte vom Arbeitszimmer bis zu Cloustons Kutsche waren die schwersten, die Adolphus jemals gemacht hatte, und als das Mädchen auf dem Sitz festgebunden worden war, widerstrebte es ihm, sie alleine zu lassen.
Clouston schloss den Schlag der Kutsche. »Gibt es irgendetwas, das ich für Sie tun kann?«
Adolphus schüttelte den Kopf. »Sie haben alles getan, was in Ihrer Macht stand.«
Erneut tätschelte Clouston ihm den Rücken. »Ich werde schon bald wiederkommen und nach Ihnen sehen. Ist das in Ordnung?«
Adolphus nahm die Frage kaum wahr. Er reagierte erst, als der Doktor Anstalten machte zu gehen. »Warten Sie!«, stieß er keuchend hervor.
Clouston schaute sich um. »Ja?«
»Was hat sie gesagt, bevor sie auf Sie losgegangen ist?«
Der Doktor räusperte sich und schluckte heftig. Es wäre zwecklos, die Wahrheit zu verbergen; der alte George hatte die Worte ebenfalls gehört.
»Sie … Nun, sie hat vom Teufel gesprochen.«
»Aber sie war im Delirium«, hatte Clouston sofort geradezu entschuldigend hinzugefügt. »Sie hätte alles Mögliche sagen können.«
Adolphus verbrachte den ganzen Tag im Arbeitszimmer seines verstorbenen Vaters. Dabei ging ihm nichts anderes als diese wenigen Worte durch den Kopf. Sie hat vom Teufel gesprochen …
Erst als George in das Zimmer trat, um die Kerzen zu entzünden, wurde ihm die Tageszeit bewusst. Doch auch das rüttelte ihn nicht auf. Stattdessen blieb er reglos und tief in Gedanken versunken im Sessel sitzen.
Was war dort gewesen? Hatten ihn seine Sinne im Stich gelassen? War auch er nicht mehr bei Trost?
Er schüttelte den Kopf.
Nein.
Er hatte es gesehen. Er war felsenfest davon überzeugt, dass er sich nicht getäuscht hatte. Jedes Mal, wenn er die Augen schloss, sah er die Gestalt vor sich, so als hätte sich das Bild in seine Netzhaut eingebrannt: die Silhouette einer missgebildeten, verkrüppelten Kreatur, die sich sprunghaft auf ein Fenster zubewegte.
Und diese Silhouette hatte Hörner gehabt.
1
1. Januar 1889
Wenn man um drei Uhr früh am Neujahrsmorgen herbeizitiert wird, weiß man, dass einem harte Zeiten bevorstehen.
Da ich im Tiefschlaf lag und mich noch immer von meiner überhasteten Rückreise nach Edinburgh erholte, benötigte ich eine Weile, bis ich das Hämmern an der Eingangstür wahrnahm. Ich hatte Weihnachten auf dem Gut meines Onkels in Gloucestershire verbracht – ein Ausflug, der ganz und gar kein gutes Ende genommen hatte.
Ich begriff, dass ich von meiner verstorbenen Mutter geträumt hatte, was schon seit Jahren nicht mehr der Fall gewesen war. Wir hatten sie während eines sehr heftigen Typhusanfalls verloren. Sie war binnen kürzester Zeit gestorben. Obwohl ich mich an den Traum selbst nur vage erinnern konnte, blieb eine tiefe, anhaltende Trauer in mir zurück. Während meines ganzen Lebens war dieser Schmerz, den wir während ihrer letzten Tage erlitten hatten, in Abständen immer wiedergekehrt, so wie eine Erinnerung, die durch einen vertrauten Geruch ausgelöst wird.
In meinem Traum war ich in London gewesen. Ich vermisste meine Heimatstadt von ganzem Herzen, da ich seit November nicht mehr dort gewesen war. Zu dieser Zeit hatte mich eine äußerst bedauerliche Angelegenheit dazu gezwungen, nach Schottland zu ziehen. Nach offizieller Version hatte ich die Hauptstadt in Schimpf und Schande verlassen, und zwar auf persönliche Anweisung des Premierministers, und es war mir nicht gestattet, die komplizierten Begleitumstände irgendjemandem zu enthüllen.
Noch immer glaubten daher alle, meine Verlobte habe mir den Laufpass gegeben, ich sei degradiert und gezwungen worden, die schmachvollste und lächerlichste Stelle anzunehmen, die das britische CID anzubieten hatte. Ich fungierte als Assistent der neu gegründeten Kommission zur Aufklärung ungelöster Fälle mit mutmaßlichem Bezug zu Sonderbarem und Geisterhaftem. Doch, doch, eine solch abstruse Abteilung existiert tatsächlich, und sie tut genau das, was ihr Name andeutet.
Da war ich nun also, verbannt aus meiner geliebten Hauptstadt, in einer neuen Anstellung, die mir wenig Freude bereitete. Ich war nun ein trauriger Bewohner von Edin-blöd-burgh, wie mein Vater sich ausdrückte, einer Stadt, in der ich außer meinem jüngeren Bruder Elgie – der sie in wenigen Monaten wieder verlassen würde – keine Menschenseele kannte und in der das Wetter sogar noch grauer war als in London. Und ja, liebe Leser, so etwas ist wirklich möglich.
Ich war heimatlos.
Genau in dem Moment, als mir dies klar wurde, hallte das Gehämmer an der Tür in meinem Kopf wider. Es klang wie ein anhaltendes Gezeter und erinnerte mich schmerzlich daran, wo ich mich befand: Moray Place, Edinburgh, im Haus von Adolphus »Nine-Nails« McGray, wo ich auf einem harten Bett lag, das älter war als meine Haushälterin, die nicht auf mein Rufen reagierte.
»Joan?«, grunzte ich und rieb mir die Augen. »Joan!«
Keine Antwort.
Ich richtete mich auf. Plötzlich wurde mir bewusst, dass dies kein gewöhnliches Klopfen war, sondern jemand verzweifelt an McGrays Haustür hämmerte. Warum machte Joan nicht auf? Das war kein Geräusch, das man einfach ignorieren konnte.
»George!«, rief ich nun noch lauter. Doch auch McGrays alter Butler reagierte nicht.
Eine schreckliche Erkenntnis traf mich: Zum ersten Mal in meinem einunddreißigjährigen Dasein würde ich mich auf unterstes Niveau begeben und selbst die verdammte Tür öffnen müssen!
Fluchend wie ein Rohrspatz zog ich mir den Morgenrock an. Zwar sollten die Leute vom CID mir eine angemessene Unterkunft vermitteln, doch wohnte ich nun schon fast zwei Monate, seit meiner Versetzung, nach wie vor unter einem Dach mit dem unkultiviertesten, vulgärsten und berüchtigsten Mann, den Schottland jemals hervorgebracht hat.
Als ich die Eingangshalle erreicht hatte, sah ich ihn aus seiner Bibliothek treten. Er hatte rote Augen und gähnte, war aber gänzlich bekleidet und trug eine seiner bunten Karohosen und ein nicht dazu passendes Wams. Während ich selbst ein wenig größer und vielleicht schmaler bin als der Durchschnitt, ist McGray ein hochaufragender, breitschultriger und stattlicher Bursche.
»In der einen verdammten Nacht, in der es mir gelingt einzunicken!«, brüllte er so laut, dass ich zusammenfuhr. »Ich schlag gleich jemanden zu Brei!«
Ob er ernst machen würde, vermochte ich nicht zu sagen – nur wenige Minuten, nachdem ich »Nine-Nails« McGray zum ersten Mal begegnet war, hatte ich mitangesehen, wie er jemandem den Arm gebrochen hatte.
»Frey, wo zur Hölle ist Ihr Faultier von Dienstmagd?«
»Na hören Sie mal, das hier ist doch Ihr verfluchter Haushalt. Wo ist denn Ihr alter Klappergaul von Butler?«
Plötzlich hörten wir Gekicher und das Rascheln von Kleidungsstücken. Joan, eine stämmige Witwe mittleren Alters, trat aus dem Hinterzimmer und wickelte sich mit einem sonderbaren Grinsen in ein Umschlagtuch ein. Der Quell ihres Frohsinns eröffnete sich uns sogleich: George folgte ihr auf dem Fuß und glättete sich mit einer Hand das zerzauste graue Haar, während er sich mit der anderen seine alte Kniehose zuknöpfte.
Ihr beider Lächeln erstarb in dem Moment, als sie unserer gewahr wurden.
McGrays Kinnlade klappte herunter.
Joan, für gewöhnlich die größte Plaudertasche im Haus, war wie gelähmt vor Schreck. Dennoch war der Anflug eines Lächelns auf ihrem Gesicht zu erkennen.
»Sir … soll ich zur …«
»Zu – spät – verdammt – noch – mal«, blaffte ich sie an.
»Macht euch davon, ihr perversen Strolche!«, schrie McGray. Doch kaum waren sie seiner Aufforderung gefolgt, stieß er ein gackerndes Lachen aus. »Joan und der alte George! Frey, haben Sie gewusst, dass die beiden miteinander die Furche beackern?«
Ich erschauerte. »Ja, nun, ich … habe sie mal auf frischer Tat ertappt.«
Erneut lief es mir kalt den Rücken hinunter, und McGray erging es jetzt offenkundig genauso.
Das Klopfen wurde nun noch durchdringender.
»Ich denke, ich öffne mal die Tür«, grunzte ich und drückte die Klinke hinunter.
Prompt fegte mir ein eisiger Wind Schneeflocken ins Gesicht. Der mondlose Himmel war immer noch pechschwarz, und nur der goldene Schein der Straßenlaternen spendete ein wenig Licht, gerade genug, dass ich das schmale Gesicht von Constable McNair erkennen konnte.
Der hagere Kerl hatte offenbar eine der bedauernswertesten Stellen bei der schottischen Polizei erwischt, wenn er zu höchst unchristlicher Stunde an jedweden Ort beordert werden konnte. An diesem Abend wirkte er sichtlich verdrießlich.
»McNair! Wollen Sie diese Tür pulverisieren?«
»Tut mir leid, Sirs«, stieß er keuchend hervor. Trotz des umherwirbelnden Schnees stand ihm der Schweiß auf der Stirn. »Superintendent Campbell hat mich geschickt, um Sie auf der Stelle zu holen.«
»Dann hoffe ich für Sie, dass jemand im Sterben liegt, Bürschchen«, knurrte McGray.
Der junge Officer schluckte heftig.
»Oje«, stöhnte ich, als ich sah, wie er das Gesicht verzog.
McNair verstummte. Gespannt schauten wir ihn an, doch er heftete seinen Blick auf den Fußboden.
»Und?«, drängte McGray.
McNair schaute ihn mit banger Miene an. »Es ist ein junges Mädchen – in der Irrenanstalt. Sie liegt tatsächlich im Sterben.«
2
McGray war entsetzt. Hastig schnappte er sich seinen mottenzerfressenen Mantel und rannte zu den kleinen Stallungen hinüber.
Tucker, McGrays Golden Retriever, schien die Besorgnis seines Herrchens zu spüren. Der Hund kam aus dem Bücherzimmer heraus und folgte ihm nervös kläffend.
Mir blieb kaum Zeit, die Kleider anzulegen, denn McGray trieb mich mit unverständlichen Ergüssen schottischer Flüche (nicht vergessen: Dictionary of the Vulgar Tongue von Grose kaufen) zur Eile an.
Zaghaft servierte Joan mir ein Tässchen schwarzen Kaffee. Ich kippte ihn in einem einzigen Schluck herunter, packte mich in meinen dicksten Mantel und trat in die schneidende Kälte der Edinburgher Nacht hinaus.
Als ich die Stallungen erreichte, saß McGray bereits auf Rye, seinem stämmigen Fuchs. In einer Hand hielt er eine große Blendlaterne, in deren Lichtschein der Stumpf zwischen seinem Mittelfinger und seinem kleinen Finger deutlich zu erkennen war.
»Nun beeilen Sie sich schon, Sie Karfunkelgesicht!«
So erschrocken hatte ich ihn noch nie erlebt. Daher ignorierte ich die üble Beleidigung und sprang in den Sattel. Philippa, meiner weißen Bayerischen Stute, kam der frühe Ausritt nicht gelegen, und sie ertrug mich nur übelgelaunt.
Um dem eisigen Wind zu trotzen, schlug ich meinen pelzbesetzten Kragen hoch. McGray hingegen war so in Sorge, dass er auch durch einen Wirbelsturm hätte reiten können, ohne es wahrzunehmen.
Ich wusste, was ihn umtrieb: Er rechnete mit dem Schlimmsten.
Das fragliche Mädchen konnte gut Pansy sein, seine jüngere Schwester.
Man musste beinahe zwangsläufig zu diesem Schluss kommen. Ich hatte Miss McGray zwar nur wenige Male kurz gesehen, aber ihre Geschichte war so traurig und schrecklich, dass sie mich jedes Mal berührte, wenn ich daran dachte. Bei McGray war die Wunde noch nicht verheilt – das würde womöglich nie der Fall sein –, und ich fühlte mit ihm, während er in wildem Galopp vorausritt.
Das Dröhnen der Hufe unserer Pferde und ihr Gewieher, zudem noch das Bellen von Tucker zerrissen die Stille. Wir müssen wie ein donnernder Wirbelwind geklungen haben, der durch die menschenleeren Straßen fegte. Die Old Town durchquerten wir noch bei relativ guter Beleuchtung, doch danach schienen die Gaslaternen nur in größeren Abständen, und bald hatte ich das Gefühl, als ritte ich durch eine pechschwarze Wildnis. Die Irrenanstalt lag im äußersten Süden der Stadt, wo ansonsten nur eine Handvoll größerer Landgüter standen. Ab und zu passierten wir Lichtschimmer von Laternen vor den Toren der weitläufigen Anlagen, und bei vollem Mond hätte dies ausgereicht, die Straße zu erleuchten. Doch unglücklicherweise war die heutige Nacht ausgerechnet eine Neumondnacht, und das einzige beständige Licht ging von McGrays Laterne aus.
Wie er den Weg zur Anstalt fand, ist mir schleierhaft, doch nach kurzer Zeit erblickten wir den Lichtschein der zahlreichen Fenster des Gebäudes. Ein gutes Omen war das nicht: Wenn fast alle Zimmer zu dieser ungewöhnlichen Stunde erhellt waren, musste dort Aufruhr herrschen.
Wir galoppierten durch das Haupttor. Den Officern dort blieb nur der Bruchteil einer Sekunde, um uns zu begrüßen. Am Haupteingang stießen wir auf zwei weitere Wachen. Noch ein schlechtes Zeichen.
»Warum schickt Campbell so viele Männer?«, fragte ich laut, doch McGray hörte mich gar nicht. Er schwang sich bereits aus dem Sattel, und ich musste rennen, um ihn einzuholen.
»Inspector McGray«, sprach ihn der Officer an, der an der Tür stand, »der Doktor erwartet Sie.«
»Zu wie vielen sind Sie hier?«, erkundigte sich McGray, während er den bellenden Tucker mit einer knappen Geste zum Verstummen brachte.
»Neun, Sir.«
»Neun!«
»Aye. Zwei am Tor, wir beide hier, jeweils einer an den beiden hinteren Toren, und drei Männer bewachen das Zimmer, in dem sich das Mädchen befindet.«
»Jesus«, murmelte McGray und trat ein. Er kannte die Flure in diesem Gebäude wie seine Westentasche, und erneut musste ich mich sputen, um mit ihm Schritt zu halten.
In der Anstalt herrschte in der Tat Chaos. Schwestern und Pfleger rannten durcheinander, und die schaurigen Schreie der zahllosen Insassen drangen durch die Flure wie die einer Armee Untoter.
»Hier ist etwas Schreckliches geschehen«, kommentierte ich, während mir ein kalter Schauder über den Rücken lief.
»Mr McGray!« Eine sorgenvoll dreinblickende Schwester kam auf uns zu. »Gott sei Dank, dass Sie so schnell hergekommen sind!«
»Miss Smith«, erwiderte McGray, »was geht hier vor? Ist es …«
»Folgen Sie mir, Sirs.« Sie hatte sich bereits energisch in Bewegung gesetzt. »Dr. Clouston sagte, jede Sekunde zählt.«
Sie führte uns in den Westflügel, wo die vermögenderen Patienten untergebracht waren. Ich sah, dass McGrays Gesicht sich verfinsterte, und bald wurde mir auch klar, warum. Auch ich erinnerte mich an diese Flure.
»Wie es scheint, gehen wir in Richtung von Miss McGrays Zimmer«, bemerkte ich.
»Aye«, erwiderte Miss Smith. Doch als wir um die letzte Ecke bogen, sahen wir, dass die Zimmertür des Mädchens geschlossen war. Die des Nachbarzimmers hingegen stand offen, und drei Officer standen davor. Die grauenhaften heiseren Schreie, die aus dem Inneren drangen, ließen sie allesamt zusammenzucken. »Es handelt sich nicht um Miss McGray«, fügte Miss Smith hinzu, während sie auf die sperrangelweit aufstehende Tür deutete. »Es ist alles hier drinnen geschehen. Bitte treten Sie ein.«
Ich registrierte einen Anflug von Erleichterung in McGrays Augen, als wir eintraten. Lange währte diese jedoch nicht, denn der Raum war ein Angriff auf die Sinne. Der Anblick war zutiefst verstörend, und es herrschten ein Abscheu erregender Gestank und eine eisige Kälte.
Das Fenster war zersplittert, der Rahmen aus der Verankerung gerissen, und überall auf dem Perserteppich lagen Glasscherben herum. Die fortwährende Zugluft hatte das Feuer ausgehen lassen, und im Kamin glomm nur noch eine kümmerliche Glut.
Dann erblickten wir Dr. Clouston. Als er uns sah, stieß er einen tiefen Seufzer aus. Sein für gewöhnlich gepflegter Bart war zerzaust, und seine sonst so zuversichtlich dreinblickenden Augen lagen tief in ihren Höhlen.
»Adolphus, Inspector Frey, Sie kommen gerade zur rechten Zeit!«
Er wies auf ein Himmelbett. Es war ausstaffiert mit einem dicken Samtbaldachin und Vorhängen. Die Schreie drangen hinter den Vorhängen hervor.
Es gelang mir nicht, einen Schauder zu unterdrücken, als ich die arme, teils vom Vorhang verborgene Frau erblickte.
Dass sie auf dem Rücken gelegen hätte, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Zwar lag sie mit dem Gesicht nach oben, doch war ihre Wirbelsäule grausam deformiert und schauerlich gewölbt – ihre Brust schwebte in der Luft, während ihr Gewicht auf ihren Hüften und Schultern ruhte. Kein menschlicher Rücken konnte sich so verbiegen, ohne dass Wirbel dabei gebrochen wären.
Sie hatte die Arme widernatürlich verdreht, ihre Hände waren steif, ihre Finger starr wie Krallen. Als wäre der Anblick noch nicht verstörend genug, waren ihre Augen blutunterlaufen, und ihr Mund, aus dem fortwährend schreckliche Schreie drangen, stand weit offen.
Das Zimmer stank nach Erbrochenem, und ich sah, dass die Bettlaken widerlich verschmutzt waren. Doch neben diesem Gestank lag auch der Hauch von etwas Chemischem in der Luft.
»Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit«, sagte Clouston genau in dem Moment, als Krämpfe die Gliedmaßen der Frau weiter verzerrten.
»O mein …«, murmelte McGray und trat näher. Ich wusste, dass er im Hinterkopf bereits eine dämonische Besessenheit erwog. Für mich hingegen war eine solch verkrümmte Wirbelsäule ein unverkennbares Symptom.
»Strychnin?«, wollte ich wissen.
Clouston nickte düster. »In tödlicher Dosierung. Ich kann nichts mehr für sie tun.«
Kein Mensch hätte mehr etwas für sie tun können.
McGray zog einen Stuhl aus einer Ecke hervor und setzte sich neben das Bett. Der Blick seiner flackernden blauen Augen huschte über die sterbende Frau, und als er sie ansprach, tat er dies in einem geradezu väterlichen Ton. »Mädchen, wer hat dir das angetan?«
»Es hat keinen Zweck«, sagte ich. »Sie ist im letzten Stadium der …«
Plötzlich gab sie einen keuchenden, tiefen, animalischen Laut von sich.
»Lord … Lord …«
Mehr brachte sie nicht mehr hervor. In einer allerletzten Zuckung verdrehte sich ihre Wirbelsäule noch etwas mehr. Ich hörte Knochen brechen, und dann erstarb das Keuchen, und an seiner Stelle erklang ein rasselndes Röcheln, als sie um Atem zu ringen begann. Ihre Brust hob und senkte sich, doch mir war klar, dass keine Luft mehr in ihre Lunge strömte.
Krächzend tat sie ihren letzten Atemzug. Dann entspannte sich ihr Brustkorb, nicht jedoch der Rest ihres Körpers: Die Wirbelsäule blieb verkrümmt, die Finger blieben steif.
Endlich lag ein friedlicher Ausdruck in ihren Augen, so als heiße sie den Tod willkommen. Die Frau war tot.
Lange Zeit herrschte Schweigen. Niemand wagte sich auch nur zu bewegen. Gott allein weiß, wie lange wir so verharrt wären, doch dann … spürte ich etwas.
Es war ein Kribbeln, das mir von unten über das Bein fuhr und mich am ganzen Körper erschauern ließ. Mit verzerrtem Gesicht stellte ich fest, dass ich auf einer Ameisenstraße stand, und prompt richteten sich aller Augen auf mich.
Ich hatte die Fassung noch nicht gänzlich wieder zurückgewonnen, als ich hinter mir ein leises Geräusch vernahm. Als ich mich umdrehte, erblickte ich einen großen Raben, der an den Splittern des Fensterrahmens herumpickte. Ich erhaschte nur einen kurzen Blick auf ihn, dann flog der Vogel mit einem schrillen Krächzen davon.
3
McGray schenkte einen doppelten Whisky ein und reichte das Glas Clouston.
Der Doktor saß zusammengesunken auf dem Ledersessel hinter seinem Schreibtisch und schirmte sich erschöpft mit einer Hand die Augen ab.
»Hier, Doc«, bot McGray ihm das Glas an. »Befeuchten Sie sich die Kehle, dann fühlen Sie sich gleich besser.«
»Zumindest wärmer«, erwiderte Clouston und nahm einen kleinen Schluck von seinem Drink.
McGray goss zwei weitere Whiskys ein, und wir beide setzten uns vor den Schreibtisch. Stumm nippten wir eine Weile an unseren Drinks. Da das Brennen in meiner Kehle meine Lebensgeister wieder halbwegs geweckt hatte, ergriff ich als Erster das Wort.
»Also, Doktor – können Sie uns erzählen, was geschehen ist?«
Clouston starrte auf die Whiskytränen auf seinem Glas. Er war so angespannt, dass sich die Sehnen an seinem Hals abzeichneten. »Gentlemen, Sie müssen mir Ihr Wort geben. Nichts von dem, was ich jetzt berichten werde, darf diesen Raum verlassen.«
»Sie wissen, dass Sie mir vertrauen können«, versicherte McGray. »Und wenn dieser Londoner Gockel hier singen sollte, schneide ich ihm persönlich den … Kamm ab.«
»Das wird nicht notwendig sein«, entgegnete ich so gleichmütig ich konnte. »Doktor, sprechen Sie frei heraus. Über meine Lippen wird nichts kommen.«
Clouston starrte nach wie vor auf sein Glas. Dann holte er tief Luft und kippte den Rest seines Drinks mit einem raschen Schluck herunter.
»Die Frau, deren Tod Sie mitangesehen haben, war Miss Greenwood«, begann er und stellte das Glas ab. »Eine großartige Krankenschwester, sehr fleißig. Vierundzwanzig Jahre alt. Sie war fünf … sechs Jahre bei uns, das arme Ding. Sie hatte Nachtschicht. Miss Smith wollte eigentlich nach Hause gehen, hatte aber wohl etwas vergessen und kehrte noch einmal zurück. Da hörte sie Schreie und rannte zu dem Zimmer. Sie sah das zersplitterte Fenster und … nun, Miss Greenwood, die sich auf dem Boden wälzte und schrie, sie sei vergiftet worden. Danach hat sie kaum mehr zusammenhängend geredet.«
»Haben Sie eine Vorstellung, wer dafür verantwortlich sein könnte?«, wollte ich wissen.
»Es kommt nur einer in Frage, Inspector. Der Insasse, um den sie sich gekümmert hat. Der Mann, der die Fensterscheibe eingeschlagen hat und fortgerannt ist.«
Er senkte den Blick und sprach den Namen aus, der uns wie ein Fluch verfolgen sollte.
»Lord Joel Ardglass.«
McGray riss den Kopf hoch. Er war so geschockt, als hätte er aus dem Mund einer Hexe eine Verwünschung vernommen. »Was? Das kann nicht sein! Der einzige Joel Ardglass, von dem ich gehört habe, ist tot. Er ist schon seit Jahren tot!«
Dr. Clouston stieß einen Seufzer aus und nahm sein Glas wieder in die Hand. »Deshalb müssen Sie Stillschweigen bewahren. Und deshalb brauche ich noch einen hiervon …«
Um zu beschreiben, wie schockiert wir dreinschauten, fehlen mir die Worte. Der Doktor bekam nach nahezu jedem Satz einen trockenen Mund, und als er uns die gesamte Geschichte erzählt hatte, war in seiner Karaffe nur noch ein kleiner Rest Whisky übrig.
»Wie konnten Sie sich nur auf eine solche Vereinbarung einlassen?«, wollte ich wissen.
»Ich sagte Ihnen doch, Inspector, ich sah keine andere Möglichkeit, diesem Mann und seiner Tochter zu helfen. Glauben Sie nicht, ich hätte es nicht schon bereut. Heute weiß ich, dass ich ein verdammter Narr war.«
»Diese Schlampe von Lady Glass!«, zischte McGray, während er herumlief wie ein Tiger im Käfig. Während Cloustons Erzählung hatte es ihn kaum auf seinem Stuhl gehalten. »Wie konnte sie es wagen, mich und meine Schwester zu verspotten, wenn sie doch selbst einen Irren in ihrem Schlangennest barg?«
»Auch Sie haben davon profitiert«, erklärte Clouston. »Ihr Haus in der New Town, das sie Ihnen wegnehmen wollte. Indem ich sie erpresst habe, konnte ich das verhindern.«
McGray presste sich eine Hand gegen die Stirn. Mit der anderen umklammerte er grimmig sein leeres Glas.
»Dr. Clouston!«, stellte ich mit dem Anflug eines Lächelns fest. »Ich hätte nie gedacht, dass Sie zu so etwas imstande wären!«
Clouston lächelte gequält und schenkte sich den restlichen Whisky ein. »Das hätte ich selbst auch nicht gedacht.«
»Sind Sie sicher, dass es Lord Ardglass war, der sie vergiftet hat?«, fragte ich.
»Oh, daran besteht keinerlei Zweifel, Inspector. Sie haben selbst gehört, dass das Mädchen noch Lord sagen wollte. Wir haben zwar eine ganze Reihe vermögender Patienten, aber diesen Titel trägt sonst niemand. Einige Insassen nannten ihn Lord Weibskopf, andere Lord Bampot.«
»Sie könnte deliriert haben«, sagte ich.
»Warum hätte er fortlaufen sollen, wenn er sie nicht vergiftet hat?«, blaffte mich McGray an. »Was mich daran erinnert, Doc: Haben Sie jemanden auf die Suche nach ihm geschickt?«
»Ich hielt es nicht für klug, jemanden hinauszuschicken – es ist stockdunkel, und der Mann ist zu gefährlich. Ich habe Tom, einen meiner Krankenpfleger, losgeschickt, um die Bewohner der benachbarten Anwesen zu warnen. Er ist ein sehr kräftiger Bursche.«
»Gut, dass Sie daran gedacht haben.« McGray nickte. Dann rief er einige Officers herein und beauftragte sie damit, sich auf die Suche nach Lord Ardglass zu machen. »Es ist wahrscheinlich zwecklos«, vermutete er, als er sich schließlich wieder hingesetzt hatte. »Wie Sie schon sagten, es ist so dunkel, dass wir draußen nicht einmal einen verfluchten Elefanten aufspüren würden. Aber wir müssen es wenigstens versuchen.«
»In der Zwischenzeit gibt es viel zu erledigen«, fügte ich hinzu. Dabei dachte ich an einen ähnlichen Fall, mit dem ich es zu Anfang meiner Zeit beim Londoner Scotland Yard zu tun gehabt hatte. »Doktor, ich möchte, dass Sie Ihr Personal darum bitten nachzuschauen, ob irgendwelche Gegenstände fehlen. Ich suche nach Dingen, die Lord Ardglass dazu benutzt haben könnte, seine Flucht zu planen: Waffen, Geld … Zählen Sie natürlich auch Ihre Pferde durch. Und bitte halten Sie das Personal auch an, insbesondere zu kontrollieren, ob Rattengift fehlt.«
»Glauben Sie, er hat das Gift so in die Finger bekommen?«, erkundigte sich McGray.
»Höchstwahrscheinlich. Strychnin ist normalerweise der Hauptwirkstoff.«
»Jetzt fällt es mir wieder ein«, sagte McGray. »Hat mit diesem Gift nicht auch William Palmer gearbeitet?«
»Genau«, bestätigte ich. Der als Rugeley Poisoner bekannt gewordene Giftmörder war zwar schon vor Jahrzehnten hingerichtet worden. Dennoch war er den Menschen im ganzen Land noch immer in frischer Erinnerung, vor allem deswegen, weil einige seiner eigenen Kinder unter den Opfern waren.
Clouston läutete eine Glocke, um die Oberschwester herbeizurufen. »Benötigen Sie sonst noch etwas, Inspectors?«
»Die vollständige Krankengeschichte des Patienten«, erwiderte ich.
»Und wir müssen Ihr Personal befragen«, schaltete sich McGray ein, »und uns dieses Zimmer genauer anschauen.«
»Außerdem müssen wir die Leiche für die Autopsie mitnehmen«, ergänzte ich. »Dr. Reed wird einen wunderschönen Neujahrstag verleben. Oh, und ich muss eine dringende Nachricht an Superintendent Campbell schicken: Sobald wir wissen, ob Lord Ardglass zu Pferd oder zu Fuß geflohen ist, können wir die Größe des Gebiets bestimmen, in dem wir suchen müssen. Und wir werden die Presse informieren müssen – die Menschen in der Stadt müssen Gelegenheit bekommen, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, falls wir ihn nicht bald festnehmen können.«
Clouston räusperte sich. »Ich fürchte, das wird nicht möglich sein.«
»Wie bitte?«
»Wie ich Ihnen gerade sagte, Inspectors, da ist diese mich belastende rechtsgültige Erklärung, die ich unterschrieben habe …«
Ich lachte in mich hinein. »Doktor, das kann nicht Ihr Ernst sein!«