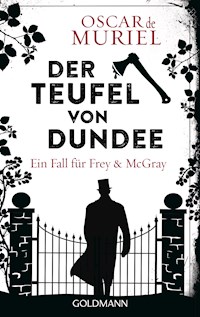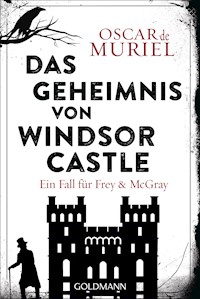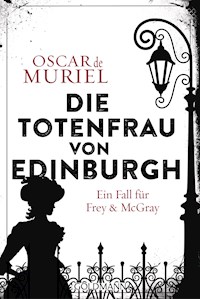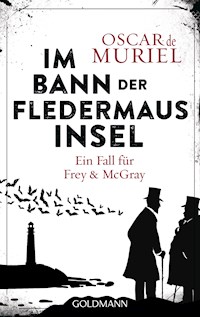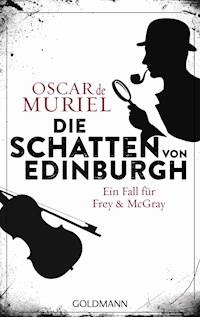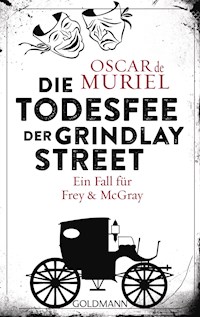
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Frey und McGray
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
London 1889. Nach der Aufführung von »Macbeth« wird eine mit Blut geschriebene Botschaft aufgefunden: In Edinburgh, der nächsten Station der berühmten Theatertruppe, soll jemand grausam zu Tode kommen. Der Fall ruft die Inspectors Ian Frey und Adolphus McGray auf den Plan. Während der vernünftige Engländer Frey die düstere Ankündigung für reine Publicity hält, ist McGray von einem übernatürlichen Phänomen überzeugt, da Besucher eine »Todesfee« vor dem Theater gesehen haben wollen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn was auch immer dahintersteckt – in der Premierennacht in der Grindlay Street soll der Tod die Hauptrolle spielen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Ähnliche
Buch
London 1889. Nach der letzten Aufführung des Theaterstücks Macbeth in der englischen Hauptstadt wird eine mit Blut geschriebene Botschaft aufgefunden. Darin heißt es in gruseligen Versen, in Edinburgh, der nächsten Station der berühmten Theatertruppe, werde jemand den Tod finden. Ein neuer Fall also für die Inspectors Ian Frey und Adolphus McGray. Während der vernünftige Engländer Frey die düstere Ankündigung für reine Publicity hält, ist sein abergläubischer schottischer Kollege davon überzeugt, hinter der Prophezeiung müsse ein übernatürliches Phänomen stecken – erst recht, da auch von der Erscheinung einer »Todesfee« vor dem Theater berichtet wurde. Eines scheint jedoch sicher: Egal, ob durch menschliche oder übernatürliche Hand – wenn sich der Vorhang in der Premierennacht in der Grindlay Street hebt, soll der Tod die Hauptrolle spielen.
Weitere Informationen zu Oscar de Muriel sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Oscar de Muriel
Die Todesfee der Grindlay Street
Ein Fall für Frey & McGray
Aus dem Englischen von Peter Beyer
Das dritte ist für die Hanburians und Mr Akhtar, die Frey & McGray eine faire Chance gaben.
OUVERTÜRE
BANQUO
Die Erd hat Blasen, wie das Wasser hat,
So waren diese – wohin schwanden sie?
MACBETH
In Luft, und was uns Körper schien, zerschmolz
Wie Hauch im Wind. O wären sie noch da!
Tagebuch Bram Stoker, 1889
Fragment eingereicht von Inspector Ian P. Frey
London, 30. Juni – Im Lyceum Theatre herrscht nach wie vor Aufruhr. Niemand vermag genau zu sagen, was gestern Abend geschehen ist, und aus den düsteren Schilderungen kann ich kaum etwas schlussfolgern. Mrs Harwood ist immer noch am Boden zerstört, und Mr Irving wird mir nicht viel erzählen.
Die Polizei traf rechtzeitig ein, lehnte es jedoch ab, genauere Ermittlungen einzuleiten. Die Officers beschieden uns, wir seien allesamt verrückt, und gingen dann wieder, ohne sich das geschändete Bühnenbild auch nur anzuschauen. Mr Irving musste knurren, fluchen und Drohungen ausstoßen, bis die Reinemachefrauen sich endlich bereit erklärten, den grausigen Schlamassel aufzuwischen.
Ich muss unverzüglich Mr Harker kommen lassen, bevor wir nach Schottland aufbrechen. Dies kann ich keinem anderen anvertrauen. Er wird den gesamten unteren Teil der Schlosskulisse ausbessern und neu bemalen müssen. Die Leinwand ist nicht mehr zu retten. Sie ist blutgetränkt.
London, 29. Juni 1889
Es donnerte, die Menge zuckte zusammen. Die inmitten der Nebelschwaden nur schemenhaft zu erkennende Bühne wurde durch grelle Blitze erleuchtet. Plötzlich ragte aus dem dichten Nebel ein Speer heraus, auf dessen Spitze der abgetrennte Kopf von König Macbeth steckte.
Die Damen schnappten nach Luft und bedeckten sich den Mund mit einem Spitzentaschentuch oder drückten sich ihren fedrigen Fächer an die Brust. Einige von ihnen waren berührt, die meisten jedoch angewidert vom Anblick des dunklen, dickflüssigen Bluts, das aus dem Hals des toten Königs tropfte.
Schrille Stimmen vermischten sich mit den hohen Tönen von Streichern und Trompeten, als drei schemenhafte Gestalten emporstiegen und sich wie Aasfresser um den gespenstischen Scheiterhaufen scharten. Es waren keine Geier, sondern drei schwarze Raben, die mit den Flügeln schlugen und ein höhnisches Krächzen ausstießen, während sich ihr unheilvolles Schreien mit dem Chorgesang vermischte.
»Heil dir, Macbeth! Heil! Heil dir!«
Alles endete mit Schrecken, Tragödie und Tod. Alle Augen glitzerten feucht, alle Herzen waren schwer. Alle nahmen an, es gebe keine Erlösung, doch dann trat eine schlanke, scheue Gestalt aus dem dichten Nebel hervor. Es schien, als zögen sich die Nebelschwaden zurück, und die Zuschauer erblickten das goldene Haar und die großen blauen Augen eines Jungen. Die Finsternis umschlang ihn, seine Gestalt wurde nur durch das Licht einer kleinen, dünnen Wachskerze beschienen, die er mitgebracht hatte. Dann aber zerschnitt ein einzelner greller Lichtstrahl den Nebel. Der Lichtstrahl wurde größer und breiter, reflektiert von der edelsteinbesetzten Krone, die der Junge in der anderen Hand trug.
»Fleance«, murmelte ein Gentleman.
Zukünftiger Vater von Königen. Keim von Gerechtigkeit, Frieden und Ruhm. Verheißung auf eine neuerliche Thronbesteigung.
Der Junge schaute auf, und augenblicklich stimmte der Chor eine liebliche, engelsgleiche Melodie an, die verklang, während der Vorhang sich langsam senkte. Lange bevor der Samtstoff den Boden berührte, durchfluteten tosender Applaus und Jubel das Theater – so laut, dass Henry Irving zu spüren meinte, wie der Klang in seiner Brust vibrierte.
Er umklammerte den Rahmen der Kulisse und spähte an der Landschaftsszene vorbei. Dass ihn die Leute womöglich sahen, war ihm bewusst, doch das scherte ihn jetzt nicht. Die ohrenbetäubenden Beifallsrufe hallten im Londoner Lyceum Theatre wider, und für diese Momente lebte er. Er ließ den Blick über das Publikum schweifen, in dessen Reihen die Leute nun begannen, mit den Füßen zu stampfen. Gleich würden sich die Hauptdarsteller zu ihm gesellen. Er würde Ellens weiche, wunderschöne Hand halten und sie hochheben, und …
Sein Herz setzte für einen Schlag aus, und im gleichen Moment wich alle Freude aus ihm.
Aus einer der Sitzreihen, ein gutes Stück von ihm entfernt, fixierten ihn stechende Augen. Er wusste bereits, zu wem sie gehörten, noch bevor er die Gesichtszüge ausmachen konnte.
»Florence!«, rief er, doch inmitten des ganzen Geschreis hörte niemand seine Stimme.
Irving fragte sich, wie er sie bis eben hatte übersehen können: Die Haut der Frau war so blass, wie mit Chlor gebleicht, dass sie inmitten der Sitzreihen gespensterhaft leuchtete, und ihre Stirn durchfurchten so tiefe Falten, dass sie trotz der Entfernung zu erkennen waren. Außerdem wirkte die Frau sehr dünn, so als wäre sie vor Kurzem von einer kräftezehrenden Krankheit heimgesucht worden.
Als Schauspieler glaubte er volle Kontrolle über seine Gesichtszüge zu haben – vor allem Atmung und Augen waren die Werkzeuge seiner Kunst. Doch in diesem Augenblick begriff er trotz dreier Jahrzehnte des Schauspielerns nur, dass er jedwede Kontrolle über seine Gesichtszüge verloren hatte. Als Florence seinen Gesichtsausdruck wahrnahm, hob sie herausfordernd das Kinn, und ihr gespenstisches Lächeln wurde noch breiter.
»Was tust du hier?«, formte Irving wütend mit den Lippen, kurz bevor ihm der Vorhang die Sicht versperrte, doch der unheilvolle starre Blick der Frau brannte sich schier in seine Netzhaut ein.
Und dann vernahmen alle den Schrei der Todesfee.
*
Ellen Terry wusch sich wieder und wieder die Hände.
Es war seltsam, dass die Mischung aus Sirup und Cochenillerot, die sich mit etwas Wasser mühelos aus den Kleidern entfernen ließ, so hartnäckig unter den Nägeln und an den Nagelhäuten kleben blieb.
»Ein wenig Wasser spült von uns die Tat«, rezitierte sie immer auf der Bühne, um sich danach den Rest des Abends mühsam die Hände zu waschen.
Miss Ivor, ihre sauertöpfisch dreinblickende Zweitbesetzung, stand mitten im Flur, hielt das Porzellanbecken in den Händen und sah zu, wie sich die große Miss Terry feinmachte.
Die in die Jahre gekommene Schauspielerin hatte gute Gründe, aufgebracht zu sein: Ellen Terry hatte seit Dezember nicht eine einzige Aufführung versäumt, und da die Londoner Saison an diesem Abend endete, hatte die arme Miss Ivor keine Gelegenheit bekommen, ihre Lady Macbeth aufzuführen.
»Schlacht verloren und gewonnen, höre ich«, sagte sie. »Sie sollten sich jetzt umkleiden, Miss Terry.«
»Das sollte ich wohl«, erwiderte Ellen, trocknete sich die Unterarme ab und reichte Miss Ivor das Handtuch. »Danke, meine Liebe. Und nochmals: Es tut mir leid. Sie wissen ja, dass ich es hasse, Sie wie eine Zofe zu behandeln!«
Miss Ivor tat kaum etwas, um ihren Unmut zu kaschieren, doch Ellen Terry hatte keinen Kopf, sich allzu viele Gedanken darüber zu machen: Sie trug nach wie vor das weiße Nachthemd aus ihrer Schlafwandlerszene, das absolut unangemessen dafür gewesen wäre, die Ovationen des Publikums entgegenzunehmen. Sie zog es vor, wieder ihr reguläres Bühnenkostüm anzuziehen, eben jenes majestätische grüne Kleid, mit Edelsteinen besetzt und mit echten Käferflügeln bestickt, das während des ganzen Jahres in London Gesprächsthema gewesen war.
Die Tür zu ihrer Garderobe stand einen Spalt offen, doch Ellen dachte sich nichts dabei. Es konnte eine der Näherinnen gewesen sein oder die kleine Susy, die gekommen war, um sich ein Buch auszuleihen, mit dem sie sich nach der Aufführung in den Schlaf lesen konnte. Vielleicht auch Bram, der ihr Blumen oder Geschenke von einem ihrer glühenden Verehrer gebracht hatte.
»Fussie!«, rief sie, kaum dass sie Irvings geliebten Foxterrier schwanzwedelnd auf ihrem Schminktisch erblickt hatte. Der Hund hatte einmal ihr gehört, doch Irving hatte sich seine Zuneigung durch Menüs aus Lammkoteletts, Erdbeeren oder in Champagner getränkten Löffelbiskuits und darüber hinaus mit seinem wunderschönen Fellteppich erschlichen. »Was machst du hier?«
Fussie hörte nicht. Er stand dem Spiegel zugewandt, hatte den Kopf halb in ein mit Einschlagpapier umwickeltes Bündel vergraben und schmatzte geräuschvoll.
»Was ist das, mein Liebling?«, fragte Ellen. Der Hund war ein Vielfraß, schnupperte immer und überall nach Leckerlis, die er stibitzen konnte. »Deine Gier wird dir noch den Garaus bereiten, weißt du das?«
Zu beschäftigt, um auch nur einen Blick auf das Bündel zu werfen, langte Ellen nach ihrem Kleid. Dann aber nahm sie einen sonderbaren Geruch wahr, fleischig und ekelerregend.
Sie drehte sich um, und nun stieß der Feuereifer, mit dem der Hund etwas verschlang, sie mit einem Mal ab.
»Oh, Fussie, was frisst du denn da?«
Überall um den Hund herum lag zerknittertes Packpapier. Mit nun zitternden Fingern ergriff Ellen eine Ecke und zog die Verpackung zögerlich beiseite.
Zunächst glaubte sie, es handele sich um einen Haufen Nacktschnecken, deren schleimige graue Häute von einer scheußlichen roten Flüssigkeit durchtränkt waren. Dann blinzelte sie, und ihr war, als wiche alles Leben aus ihr, bis sie nur noch eisige Kälte in ihrer Brust spürte. Fussie hatte an blutgetränktem Hirn herumgekaut.
Und genau in dem Moment, als Ellen Terry zu schreien anhob, war der Schrei der Todesfee zu vernehmen.
*
»Mein Gott, wer hat denn die ganzen Lichter gelöscht?«, fragte Bram Stoker mit Blick in den dunklen Flur.
»Mr Wheatstone«, antwortete die Erste Hexe wie aus der Pistole geschossen.
»Er hat dieses helle Pulver hereingebracht und meinte, ein kleiner Funken genüge, um uns alle ins Jenseits zu befördern«, ergänzte ihre Zauberschwester. »Er hat das Gas persönlich abgestellt.«
Bram spähte in die undurchdringliche Finsternis. »Und hier habt ihr sie zum letzten Mal gesehen?«
»In der Tat. Wir fragten sie, wohin sie ginge, aber sie hat nichts geantwortet. Sie hatte einen ihrer … Momente.«
Bram spürte einen kalten Luftzug. Mr Wheatstone musste die Hintertür offen gelassen haben. Jeder hätte hereinkommen oder hinausgehen können.
»Hier«, sagte die Dritte Hexe, die eine kleine Öllampe mitgebracht hatte. Deren bernsteinfarbene Flamme warf scharfe Schatten auf die Gesichter der Hexen.
Zum ersten Mal in der Geschichte wurden die Zauberschwestern von Frauen gespielt. Und diese Damen nun sahen auch so aus: Sie trugen nach wie vor ihre dunklen Lumpen, und ihre Gesichter waren dank der Masken, die sie immer noch aufgesetzt hatten, allesamt verzerrt. Während Bram die Lampe ergriff, war ihm, als wären sie Monster in einer Höhle. Sie waren genauso gespenstisch wie auf der Bühne.
»Wir müssen jetzt los«, sagte die Erste Hexe, »um unsere Ovationen entgegenzunehmen.«
Tatsächlich hatten sie seit der Premiere stets Beifallsstürme geerntet, die denen für Terry und Irving gefährlich nahe kamen.
»Wollen Sie, dass wir mithelfen?«, fragte die Dritte Hexe.
»Nein«, erwiderte Bram ein wenig zu scharf. »Nein, es ist schon recht. Geht nur und bedankt euch beim Publikum. Ihr habt euch euren Moment des Triumphs verdient.«
Es bedurfte nicht viel, um sie zu überzeugen. Bram sah ihnen hinterher, wie sie wieder zurück ins Theater eilten, als ihn ein weiterer Luftzug frösteln ließ.
Ganz langsam drehte er sich auf den Hacken um und schwang die Lampe wie eine Waffe, während er in die Dunkelheit trat.
Dunkle Orte hatte er noch nie gemocht. Bram hatte die ersten sieben Jahre seines Lebens ans Bett gefesselt verbracht, eine Lampe oder Kerze stets in seiner Nähe, und Mutter im Zimmer nebenan. Bis heute konnte er, obwohl zu einem über eins achtzig großen, breitschultrigen Theaterintendanten herangewachsen, einen dunklen Raum nicht betreten, ohne zuvor tief Luft zu holen.
»Mrs Harwood?«, rief er. Dabei spürte er das leise Beben seiner Stimme und war verwirrt über seine grundlose Besorgnis.
Er umklammerte den kühlen Messinggriff seiner Lampe noch fester und zwang sich dazu weiterzugehen.
Bram hielt auf die Hintertür des Gebäudes zu. Doch genau in dem Moment, als er das silberne Mondlicht erblickte, das sich auf dem Türrahmen abzeichnete, vernahm er ein abscheuliches Matschen, spürte, wie er auf etwas ausglitt, und sein Herzschlag beschleunigte sich.
Als er zu Boden schaute, erblickte er dort etwas Dunkles. Er hockte sich hin, um es näher in Augenschein zu nehmen, doch als er das intensive Rot von Blut ausmachen konnte, fegte erneut ein Windzug, dieses Mal stärker, direkt aus der Hintergasse, und löschte die Flamme im Glaszylinder seiner Lampe.
Irgendwo weiter die Straße hinunter setzte ein Geheul ein. Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah Bram, dass sich eine dunkle Spur auf dem Boden abzeichnete: eine eklige Fährte, die von seinen Füßen bis zur Tür verlief und in einer Lache auf den Steinplatten der Straße endete.
Dann tauchte eine schwarze Gestalt auf.
Sie schleppte sich langsam vorwärts und schlich auf die Lache zu, so als wolle sie daraus trinken. Es war ein Hund, riesig, dunkel und stinkend – ein massiger schwarzer Wolfshund mit verfilztem Fell, blutunterlaufenen Augen und einer langen Schnauze, aus der Blut troff, an dem das Tier geräuschvoll schleckte.
Die Lampe entglitt Brams Hand, ihr Zylinder zerbarst auf dem Boden, und Bram kippte vor Schreck hintenüber. Der Hund zuckte zusammen, und seine langen weißen Fangzähne schimmerten im Mondlicht.
Und dann erklang der Schrei der Todesfee.
*
Es war ein schreckliches Geheul, das rasch lauter wurde, bis es zu einem durchdringenden, unerträglichen Gekreisch anschwoll, das in den Ohren schmerzte und einem das Blut in den Adern gefrieren ließ.
Irving ließ den Kulissenrahmen los, hielt sich die Ohren zu und schloss schmerzverzerrt die Augen. Er nahm die plötzliche Totenstille im Zuschauerraum wahr und stellte sich die schockierten Gesichter der Theaterbesucher vor, entsetzt ob des infernalischen Schreis.
Die verängstigten Aufschreie aus den Reihen des Ensembles wirkten wie Geflüster im Vergleich zu diesem entrückten Kreischen, das immer weiter anhielt, so als schöpfte jemand seine Luft aus einem Blasebalg.
Es erstarb so abrupt, wie es begonnen hatte, doch Irving war einen Moment lang nicht in der Lage zu reagieren. Immer noch fassungslos tastete er sich durch die Kulissen. Wer immer dieses Geräusch verursacht hatte, musste hinter anderen Bühnenbildern stehen.
Es war, als husche man durch zum Trocknen aufgehängte Bettlaken, nur dass es sich hier um riesige Exemplare handelte, sechs Meter hoch und neun Meter breit. Der Lichtschein von der Bühnenbeleuchtung reichte nicht aus, um die ganze Tiefe dieser Leinwandflächen zu erleuchten, und die schmale Lücke vor Irving verschwamm in der Dunkelheit.
Die letzte Leinwand war schwerer, da auf ihr eine Darstellung von Dunsinane Castle prangte, die in dicken Farbschichten gemalt war. Um an ihr vorbeizukommen, musste Irving sich bücken und darunter durchkriechen. Dabei stützte er sich mit der Hand auf dem Boden ab, musste jedoch feststellen, dass er diese dabei in etwas widerlich Zähflüssiges tauchte.
Fast blieb ihm das Herz stehen, als im trüben Licht die Umrisse einer kauernden Frau sichtbar wurden.
»Mrs Harwood!«, rief er aus. Er traute seinen Augen nicht. Die sonst so sanftmütige Schneiderin kniete auf dem Boden, hatte die Hände nach vorne ausgestreckt und zerkratzte mit den Nägeln die Holzdielen. Als sie aufschaute, riss sie den Kopf so ruckartig hoch, dass Irving beinahe befürchtete, sie habe sich das Genick gebrochen.
»Sie haben sie auch gehört!«, stammelte die Frau, am ganzen Körper zitternd. Auf ihrem Rock befanden sich überall dunkle Flecken.
Irving führte die Hand zum Gesicht, doch bevor er sich den Mund bedeckte, bemerkte er, dass seine Finger ebenfalls besudelt waren, und zwar in der gleichen Farbe wie bei Mrs Harwood.
»Sagen Sie mir, dass Sie sie gehört haben!«, beschwor sie ihn und streckte ihre roten Hände nach ihm aus. »Sagen Sie mir, dass Sie sie auch gehört haben!«
»Wir haben es alle gehört!«, rief Irving. In diesem Moment glitt jemand zwischen den Leinwänden hervor und brachte eine große Petroleumlampe.
Auf dem Boden schimmerte, umgeben von Kratzern auf den Holzbrettern, eine Blutspur. Rote Buchstaben, so bizarr wie die Worte, die sie formten:
Heil dir! Macbeth, bald findest du den Tod
Heil dir! Und Schottlands Bühne färbt sich rot
Edinburgh, 17. Juli 1889
[…]
Wir waren alle gewarnt worden, dass es zu einem Mord kommen würde. Einzelheiten wie Datum und Ort waren exakt vorausgesagt, ein Detail jedoch ausgelassen worden: nämlich der Name des oder der letztendlichen Opfer.
Im Lauf ihrer Entwicklung wirkten die Ereignisse, die zu den grässlichen Todesfällen in Edinburghs Lyceum Theatre führten, vollkommen zusammenhanglos […]
Die Handlungen des Mörders ergaben erst dann einen Sinn, als die Aussagen diverser Beteiligter, die nicht miteinander im Zusammenhang standen, zusammengefasst wurden. Ich habe mich bemüht, sämtliche relevanten Dokumente und Aussagen zusammenzutragen, die diesen Bericht untermauern.
Wie diese Dokumente zusammengestellt und chronologisch sortiert wurden, wird bei der Lektüre ersichtlich.
[…]
Inspector Ian P. Frey
(Fragmente seines Vorworts zu der Dokumentation, die bei der Irving-Terry-Untersuchung vorgelegt wurde)
ERSTER AKT
MACBETH
Heil sie davon!
Kannst nichts ersinnen für ein krank Gemüt?
Tief wurzelnd Leid aus dem Gedächtnis reuten?
Die Qualen löschen, die ins Hirn geschrieben?
Und mit Vergessens süßem Gegengift
Die Brust entledigen jener giftgen Last,
Die schwer das Herz bedrückt?
ARZT
Hier muß der Kranke selbst das Mittel finden.
Tagebuch Bram Stoker
Abgeheftet von Inspector Ian P. Frey
Edinburgh, 9. Juli – London um zehn Uhr mit dem Scotch Express verlassen. Der Zug fuhr pünktlich von King’s Cross ab, doch wir hätten ihn beinahe verpasst. Kaum hatte ich den Schlag meiner Droschke geöffnet, fiel ein ganzer Schwarm von Reportern über mich her, und ich musste mir den Weg zum Bahnsteig mit den Ellbogen bahnen.
Sie riefen allesamt, sogar diejenigen, die direkt neben mir standen: »Stimmt es, Mr Stoker? Ist das Stück wirklich verflucht?«
Miss Terry nutzte klugerweise diese Ablenkung. Ihre Kutsche wartete um die Ecke, und während die Journalisten mich bedrängten, schmuggelte sie sich durch die Menge. Ich vermag mir nicht vorzustellen, wie hartnäckig diese Männer ihr nachgestellt hätten.
Bin froh, dass Bühnenausstattung, Garderobe und Fundus schon vor drei Tagen abtransportiert wurden. Angesichts all dieser Pressevertreter, die uns den Weg versperrten, hätten wir das unmöglich bewältigen können. Die braven Mr Howard und Mr Wyndham schickten mir ein Telegramm, das mir sehr gelegen kam und in dem sie mir mitteilten, dass sämtliche Requisiten unbeschadet angekommen waren. Nur einige Käferflügel an Miss Terrys Kleid wurden auf der Reise zerquetscht, aber zum Glück erfuhr ich rechtzeitig davon. Mrs Harwood gelang es, genug Material zu organisieren – woher, vermag ich nicht zu sagen –, und sie arbeitet bereits daran. Versicherte mir, das Kleid sei vor der Premiere wieder ausgebessert. Muss einräumen, dass sie nach wie vor in bedauerlicher Verfassung ist. Ich glaube, sie begrüßt die akribische Arbeit, da diese sie zweifellos von der schrecklichen Erinnerung ablenkt.
Mr Irving hingegen hat unglücklicherweise noch keinen Trost gefunden. Er ist zutiefst bekümmert, und dies nicht nur wegen dieser furchtbaren Prophezeiung – das unerwartete Auftauchen seiner Florence hat bei ihm Spuren hinterlassen.
Bei unserer Ankunft drängte er mich, Hilfe von der Polizei zu erbitten, im Glauben, die schottischen Behörden würden unserer Notlage womöglich mehr Verständnis entgegenbringen als ihre Amtskollegen in London.
Ich war erschöpft von der Acht-Stunden-Fahrt und den schlaflosen Nächten, die ihr vorausgegangen waren. Mr Irving ist derzeit jedoch so angespannt, dass ich es ihm nicht abschlagen konnte. Ich ließ sein Gepäck und das von Miss Terry und mir selbst ins Palace Hotel schicken und erkundigte mich auf der Stelle nach der Polizei.
Die Bahnhofsbeamten erkannten Miss Terry – sie fuhr gerade im offenen Wagen davon und warf den betörten Sergeants Luftküsse zu. Sofort rieten sie mir daraufhin, ich sollte mich mit einem gewissen Superintendent Campbell treffen. Einer von ihnen führte mich freundlicherweise in das örtliche Polizeipräsidium.
Ich wurde von besagtem Mann empfangen und fand ihn extrem unangenehm.
Offenbar hatte er gerade gehen wollen, denn während er sich meine Schilderung anhörte, schaute er immer wieder auf die Uhr auf dem Kamin. Ich erzählte ihm alles, zeigte ihm die Londoner Dokumente, bat ihn inständig um Schutz – doch dieser Mann hatte für mich nur ein spöttisches Grinsen übrig! Dann hatte er auch noch die Unverfrorenheit, mich um zwei Logenplätze für den Eröffnungsabend zu ersuchen, und deutete an, die Ermittlungen könnten rascher voranschreiten, wenn er ein Programmheft mit persönlicher Widmung von Miss Terry erhielte. Mir blieb keine andere Wahl, als beidem zuzustimmen.
Er hätte »genau den Richtigen« für diese Art von Angelegenheiten, meinte er. Seltsame Verlautbarung. Noch neugieriger wurde ich, als er die Adresse eines Inspector McGray zu Papier brachte und sagte, falls ich mich verliefe, bräuchte ich nur einen x-beliebigen Passanten nach dem Wohnsitz von »Nine-Nails McGray« zu fragen.
Er gab mir einen Umschlag mit einer Nachricht für besagten Mann, mit der er diesen angeblich anwies, sich voll und ganz um unseren Fall zu kümmern. Bevor ich jedoch auch nur ein Wort davon hätte lesen können, versiegelte er den Umschlag. Dann entließ er mich unverzüglich, ganz offenkundig bestrebt, zum Abendessen nach Hause zu kommen.
Einer der Officers war so freundlich, mir eine Droschke herbeizurufen, die mich rasch in den nördlichen Teil von Edinburgh beförderte. Ich musste nur den Namen McGray fallen lassen, schon kannte der Kutscher mein Ziel.
Ich war bereits mehrmals in dieser Stadt gewesen, zumeist auf Mr Irvings Tourneen, habe sie aber nie so recht erkundet. Die Kutsche fuhr mich durch ein prächtiges Viertel mit herrlichen georgianischen Herrenhäusern zu beiden Seiten und dann zu einem halbmondförmigen Straßenzug, dessen elegante Häuserfassaden einen sehr gepflegten Park umgaben. Wir hielten vor der Hausnummer 27.
Ein etwas grobschlächtiger, verhutzelter Diener wartete mir auf. Er teilte mir mit, ich wäre an der richtigen Adresse, und er sprach den Namen McGray recht warmherzig aus, doch zu meiner Enttäuschung war der Hausherr selbst nicht zu Hause.
Beschied dem Diener, ich müsse ihn sofort sprechen. Der Alte zögerte zunächst, mir den Aufenthaltsort seines Herrn mitzuteilen, und kam dem erst nach, als ich erwähnte, ich hätte eine Nachricht vom Superintendent dabei, in der es um eine dringliche Polizeiangelegenheit ginge.
Hastig gab er meinem Kutscher eine Wegbeschreibung, und als ich wieder in die Droschke einstieg, fragte ich den jungen Burschen, ob er die Anweisungen verstanden habe.
»Aye, Herr«, erwiderte er. »Der alte Mann schickt uns zur Irrenanstalt.«
Dann fuhren wir los, wendeten und steuerten gen Süden. Als wir die anrüchige Einrichtung erreicht hatten, neigte sich der ausgedehnte Sommertag seinem Ende zu. Der Himmel aber glühte noch, da die schottischen Nächte in dieser Jahreszeit eher wie eine anhaltende Dämmerung sind, sodass der Kutscher und ich die Rasenflächen vor der Anstalt gut überblicken konnten.
Wir hätten uns für unseren Besuch keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können: Es herrschte Aufruhr. Eine schwarze Postkutsche fuhr gerade davon, gelenkt von einem kräftig gebauten Pfleger. Fuhr so dicht an meiner Droschke vorbei, dass ich schon glaubte, wir stießen zusammen. Erhaschte einen Blick auf eine junge Dame, die auf dem Rücksitz saß. Sie war ganz in Weiß gekleidet, und obschon ich nur für den Bruchteil einer Sekunde einen Blick erhaschte, werden die weichen Konturen ihres blassen Gesichts für immer in meinem Gedächtnis haften bleiben. Begleitet wurde sie von einem Mann mittleren Alters, aber von ihm bekam ich kaum mehr als einen dunklen Rauschebart zu sehen.
Vor dem Haupteingang des Gebäudes hielt meine Droschke an. Dort standen ein dürrer Polizist, zwei Krankenschwestern und zwei hoch aufgeschossene Gentlemen, die in eine heftige Auseinandersetzung verwickelt waren.
Ich habe noch nie zwei Menschen zu Gesicht bekommen, die so gegensätzlich waren. Der eine trug einen schwarzen, äußerst eleganten Mantel, einen Bowlerhut und ein strahlend weißes Hemd. Den anderen, den größeren der beiden, kann ich nur als bunten Hund beschreiben: Er trug Tartanhosen und eine Tartanweste, die nicht zueinander passten, sowie einen ausgebeulten Regenmantel minderer Qualität.
Dieser Mann hörte sich unzivilisiert an. Sein schottischer Akzent hallte auf dem gesamten Gelände wider. Er schaute meine Droschke mit grimmigem Gesicht an, schleuderte dem anderen Gentleman einen Fluch entgegen, der an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ, und stolzierte dann davon. Auf dem Fuß folgte ihm ein heller Golden Retriever, den ich zuvor gar nicht wahrgenommen hatte.
Kaum war ich ausgestiegen, fingen mich der Polizist und die Krankenschwestern ab.
Die Frau mittleren Alters (selbstbewusster Gang und gute Umgangsformen – sie musste die Oberschwester sein) fragte, ob sie mir zu Diensten sein könne.
Ich erzählte ihnen rasch, was mein Anliegen war: Ich musste mit Inspector McGray sprechen.
Aus ihrer beider Gesicht wich die wenige Farbe, die ihnen noch geblieben war. Sie schauten ängstlich in Richtung des exzentrischen Schotten. Dieser stand mittlerweile ganz für sich am Ende der Rasenfläche, schaute zum Himmel hinauf und hatte uns den Rücken zugewandt. Mich trennten mehr als zwanzig Meter von ihm, dennoch konnte ich sehen, dass er tief und hektisch atmete, da seine Schultern sich hoben und senkten. Erinnerte mich an einen Zirkuslöwen im Käfig.
Der junge Officer war ebenfalls angespannt. Riet mir, mich stattdessen an Inspector Frey zu wenden, doch in einem Ton, der mir bedeutete, dass ich mir davon nicht allzu viel versprechen solle.
Er führte mich zu dem dünnen Burschen mit den schmalen Schultern, den mit dem Bowlerhut. Als sich dieser Mann mir zuwandte, bekam ich sein mageres Gesicht deutlich zu sehen. Er hatte einen eckigen Kiefer, braune Augen, die alles mit Argwohn betrachteten, und mitten zwischen den Brauen eine tiefe Falte.
Er hatte meinen Akzent vernommen, denn er warf mir daraufhin einen strengen Blick zu und bellte eine noch unsanftere Bemerkung. »Jesus Christus, schafft mir den verfluchten Fenier vom Hals.«
Diese harschen Worte überraschten mich derart, dass ich kein Wort hervorbrachte.
Es war der junge Officer, der antwortete. Wollte zum Ausdruck bringen, meine Angelegenheit sei dringlich, doch der arrogante Kerl schnitt ihm das Wort ab.
»McNair, ist Ihnen nicht bewusst, welchen Alptraum wir hier gerade durchmachen?«
»Aye, Inspector, aber dieser Mann sagt, Campbell habe ihn geschickt. Mit Anweisungen für Inspector McGray.«
Wenn die anderen hier schon angespannt waren, dann trug dieser Inspector Frey das Gewicht der Welt auf seinen Schultern. Er schnaubte gereizt und rieb sich dann den Nasenrücken, um sich zur Geduld zu zwingen. Dann schaute er mich zum ersten Mal mit gebührender Aufmerksamkeit an.
Inspector Frey war ein ganzes Stück kleiner als ich und viel schmächtiger. Bei einem Faustkampf hätte er gegen mich zweifellos den Kürzeren gezogen.
»Wie heißen Sie?«, fragte er mich.
»Stoker. Bram Stoker, Inspector.«
Er starrte mich noch einen Moment lang mit zweifelnder Miene an. »Ihr Name sagt mir irgendetwas …«
»Vielleicht von Henry Irvings Theater …«
»Vergessen Sie es«, unterbrach er mich. »Wie lauten diese Anweisungen, die Sie mitbringen?«
In Anbetracht seiner barschen Art hielt ich es für besser, ihm zunächst die Nachricht seines Vorgesetzten zu überreichen.
»Sie sind in diesem Brief«, sagte ich und legte ihm den versiegelten Umschlag vor. »Mr Campbell ließ keinen Zweifel daran, dass Inspector McGray genau der Richtige ist, um sich um mein Anliegen zu kümmern.«
Meine letzte Bemerkung hatte die genau gegenteilige Wirkung, die ich erwartet hatte. Inspector Frey stieß ein leises, spöttisches Lachen aus und schaute dann zu dem größeren Mann hin. Dieser schottische Kerl mit seiner absonderlichen Kleidung und der hektischen Atmung hätte ohne Weiteres als Insasse dieser Anstalt durchgehen können. Der Londoner stieß einen erschöpften Seufzer aus und schaute dann wieder mich an.
»Ich fürchte, Inspector McGray ist mit seinen Gedanken … momentan woanders. Ich stehe in der Befehlskette jedoch direkt unter ihm. Sie können mir also diese Nachricht geben, ich werde mich sobald als möglich darum kümmern.«
Inspector Frey hielt mir seine behandschuhte Hand entgegen, doch ich weigerte mich, ihm die Nachricht zu überreichen.
»Sir, Sie verstehen nicht«, protestierte ich. »Es geht bei dieser Angelegenheit um Leben und Tod!«
Inspector Frey lachte höchst anmaßend. »Derlei Angelegenheiten hatten wir in letzter Zeit zur Genüge. Sie haben mein Wort, ich werde mich um Ihren Fall kümmern.«
»Entschuldigen Sie, aber diese Angelegenheit ist dringend.«
»Ist jemand verletzt worden oder tot?«
»Nun, noch nicht, aber …«
Die schemenhaft zu erkennende Gestalt von Inspector McGray war so verlockend nahe, dass ich nicht aufgeben wollte. Ich unternahm den törichten Versuch, an dem aufreizend blasierten Engländer vorbeizugehen und die Nachricht persönlich zu übergeben.
Aber nun packte Inspector Frey mit fester Hand meinen Arm. Sein Griff war weit kräftiger, als es sein schmaler Körperbau hätte vermuten lassen.
»Sie wollen jetzt nichtmit ihm sprechen«, zischte er. »Nicht, wenn Ihnen Ihr Schädel lieb ist.«
Sein Tonfall klang dementsprechend düster. Es war keine Warnung, sondern ernste Besorgnis.
»Geben Sie mir diese Nachricht, wenn Sie wollen, dass sie überhaupt jemand liest«, fügte er hinzu. Eine Bitte würde ich dies nicht nennen, denn noch während er sprach, riss er mir das Papier aus der Hand. Hätte ich nicht losgelassen, wäre der Umschlag samt Nachricht zerrissen. »Geben Sie McNair Ihre Karte, dann werde ich so schnell wie möglich Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen.«
Er ließ meinen Arm los und steckte sich die Nachricht in die Brusttasche. Ich machte wohl nicht gerade einen glücklichen Eindruck, denn nun warf mir Inspector Frey noch einen letzten Blick zu, in dem ein leiser Anflug von Mitgefühl aufblitzte.
»Es war ein rabenschwarzer Tag für uns alle«, sagte er.
Randnotiz von I.P. Frey:
Ich kann mich an die Unterhaltung nur noch dunkel erinnern. Auf jeden Fall kann ich mich nicht daran erinnern, den Mann einen verfluchten Fenier genannt zu haben, auch wenn es sich nach mir anhört. Womöglich habe ich mich tatsächlich schroff verhalten, doch Mr Stoker hätte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt ankommen können.
Nine-Nails McGray hatte gerade erst mitansehen müssen, wie seine jüngere Schwester, eine Patientin in der Anstalt, aus Edinburgh weggeholt wurde. Und diese Notwendigkeit hatte er noch nicht eingesehen.
1
Es missfällt mir, diese Geschichte damit zu beginnen, die tragischsten und intimsten Angelegenheiten eines Kollegen auszuposaunen. Doch bevor ich auf den Alptraum zu sprechen komme, den uns Mr Stoker beschert hat, muss ich wohl die traurige Geschichte der Familie McGray erzählen, und zwar je früher, desto besser.
Inspector McGray ist der Sohn eines Geschäfts… Moment mal, welcher Arbeit war sein verstorbener Vater eigentlich nachgegangen? Ich glaube, dem Mann gehörte Ackerland, und ich bin mir sicher, dass er zumindest ein paar Brennereien in und um Dundee betrieb. Jedenfalls zogen die McGrays irgendwann nach Edinburgh, wo sie als Neureiche – wenig überraschend – in den Kreisen der Oberschicht nicht besonders gut angesehen waren – die ihrerseits, wenn ich das ergänzen darf, in den Kreisen in London, in denen ich mich bewege, nicht besonders gut angesehen waren. Aber ich schweife ab.
Sie fielen von einem Tag auf den anderen in Ungnade, nämlich zur Sommersonnenwende 1883, als sie gerade in ihrem Landhaus nahe Dundee Urlaub machten. Miss Amy McGray, damals ein Mädchen von sechzehn Jahren, verlor so plötzlich wie völlig unerklärlich den Verstand. Am besagten Abend metzelte sie ihre Mutter und ihren Vater mit einem Schürhaken und einem Küchenbeil nieder, und als ihr Bruder sie bändigen wollte, trennte sie ihm den Ringfinger der rechten Hand ab. Seitdem nennen ihn die Leute »Nine-Nails« McGray.
Amy, die von ihren Eltern den Kosenamen Pansy bekommen hatte, wurde als gemeingefährlich eingestuft und in die Königliche Irrenanstalt Edinburgh eingesperrt. Es war ein Riesenskandal. Bis zu diesem entsetzlichen Vorfall war sie ein wunderschönes, lebensfrohes Mädchen gewesen, mit guten Chancen, die Herzen betuchter Schotten zu stehlen. Aber das war noch nicht alles.
Mit den letzten Worten, die sie ausstieß (denn mit einer unrühmlichen Ausnahme drang seitdem kein Wort mehr über ihre Lippen) deutete sie an … nun, der Teufel habe Besitz von ihr ergriffen.
Die ganze Angelegenheit war geheimnisumwoben und wird es wohl auch bleiben. Die einzigen Zeugen waren die verstorbenen Mr und Mrs McGray und ihre Tochter, doch daran, dass sie jemals wieder sprechen wird, ist wohl nicht zu denken.
Natürlich regte die Tragödie der McGrays die Fantasie der Leute an. Bei jeder Erzählung wurde sie immer weiter übertrieben und ausgeschmückt. Sie wurde in den Reigen der lokalen Legenden aufgenommen, und ihre Geschichte wird zweifelsfrei rund um Edinburghs Lagerfeuer erzählt. Und ohne es zu beabsichtigen, hält Inspector McGray das Interesse daran lebendig.
Er entwickelte eine Obsession in Bezug auf alles, was irgendwie mit dem Teufel, dem Okkulten und dem Übernatürlichen zu tun hat. Er eignete sich in diesem Bereich ein enzyklopädisches Wissen an und gab letzten Endes den Anstoß für die Gründung einer Polizeieinheit, die derlei Unsinn untersucht, nämlich die – tief Luft holen, Ian – Kommission zur Aufklärung ungelöster Fälle mit mutmaßlichem Bezug zu Sonderbarem und Geisterhaftem (zu gegebener Zeit werde ich von den merkwürdigen Umständen berichten, die mich dazu veranlassten, meinen Dienst in einer derart abstrusen Unterabteilung zu verrichten).
Sechs Jahre sind seitdem vergangen, ohne dass McGrays Entschlossenheit nachgelassen hätte. Nach wie vor hegt er wider jede Vernunft die Hoffnung, Pansy wieder zu Verstand zu bringen. Alles, was er unternimmt, tut er für sie, das einzige Familienmitglied, das ihm noch geblieben ist.
Ein Teil von mir versteht ihn und die Verzweiflung, die ihm anhaftet. Eine andere Seite von mir, die rationalere, fürchtet und hasst die Rücksichtslosigkeit seines Tatendrangs, die schon viele Menschen – mich selbst eingeschlossen – in höchst gefährliche und beunruhigende Situationen gebracht hat.
*
Es war bereits recht spät, weit nach zehn Uhr, doch der schmale Streifen am Himmel, der nicht von Wolken verhangen war, schimmerte in der bläulichen Abenddämmerung. Es erinnerte mich daran, wie weit weg ich von London war: Edinburgh liegt so weit nördlich, dass der Himmel in diesen Mittsommernächten nie gänzlich dunkel wird.
Es war drückend schwül, unverkennbarer Vorbote eines heftigen Sturms. Und tatsächlich öffnete sich der Himmel, als die Kutsche mich zurück in die New Town von Edinburgh brachte, und ich beglückwünschte mich dazu, eine Droschke gerufen zu haben, statt selbst zu reiten.
Ich hatte vor Kurzem eine eigene Unterkunft an der sehr eleganten Great King Street bezogen. So prächtig und komfortabel mein georgianisches Stadthaus aber auch sein mochte, ich konnte es nicht anschauen, ohne unangenehm daran erinnert zu werden, dass ich es notgedrungen von einer der verabscheuungswürdigsten Personen der Stadt angemietet hatte, nämlich Lady Anne Ardglass, von der bekannt war, dass sie trank, und die daher den Spitznamen »Lady Glass« verpasst bekommen hatte.
Ich kletterte aus der Kutsche und spannte sogleich meinen Schirm auf. Der Regen peitschte mir ins Gesicht, und im goldenen Licht der Straßenlaternen schimmerten die Regentropfen. Ich sah, dass ein Fenster im ersten Stock hell erleuchtet war: Mein jüngerer Bruder wartete auf mich. Ich wäre auf dem Holzweg gewesen, wenn ich geglaubt hätte, dass er sich Sorgen um mich machte, denn mir war klar, dass er es eigentlich nur auf Klatsch und Tratsch abgesehen hatte.
»Mr Frey!«, rief Layton von der Tür aus. »Kommen Sie doch aus diesem elendigen Regen!«
Er stand bereits in der Eingangstür und hieß mich eintreten, nahm mir meine durchnässten Sachen – Schirm, Mantel und Hut – ab und schloss die Tür.
»Oh, was für ein regelrechtes Unwetter draußen tobt«, kommentierte er in seinem steifen Kent-Akzent.
Layton war mein neuer Kammerdiener. Mit seinen achtundvierzig Jahren, groß und knochendürr, erinnerte er mich mit seiner Hakennase immer an einen zu groß geratenen Schürhaken. Der Mann hatte meinem Onkel Maurice mehr als zehn Jahre lang gedient, und vorher hatte er in einigen der elegantesten Haushalte Londons gearbeitet. Wie ich selbst verabscheute er nun seine neue Arbeitsstelle in Schottland. Zu seinem Unglück war ich von seinen Diensten so angetan, dass ich ihn auf absehbare Zeit nicht entlassen würde: Er war tüchtig, hatte gute Manieren und beachtete die Etikette (vor allem aber wusste er genau, wie ich meine Kleidung und meinen morgendlichen Kaffee bevorzugte). Mit seiner kultivierten Ausbildung verkörperte er das genaue Gegenteil meiner ehemaligen Haushälterin, Joan, die ich vor Kurzem an … McGrays vermaledeiten Hausdiener verloren hatte.
»Ich hoffe, diese Angelegenheit hat Ihnen nicht übermäßig zugesetzt«, sagte er, während ich mir bequemeres Schuhwerk anzog.
»Übermäßig trifft es nicht einmal annähernd.«
»Ach, das zu hören tut mir leid … Oh, Sir, möchten Sie das hier vielleicht nehmen?« Er reichte mir den mittlerweile zerknitterten Umschlag, den mir Mr Stoker ausgehändigt hatte.
»Ich möchte nicht, aber ich muss«, entgegnete ich und nahm ihn entgegen.
»Sie haben womöglich schon bemerkt, dass Sir Elgie im Raucherzimmer auf Sie wartet. Soll ich Ihnen das Abendessen servieren?«
»Bitte, gerne. Etwas Herzhaftes. Ich bin ausgehungert.«
Ich stieg die Mahagonitreppe hinauf und nahm mit Wonne den leichten Duft nach Leder und Bergamotte wahr, den ich mit diesem Zuhause mittlerweile verband. Seit einigen Monaten hatte ich es gelernt, die kleinen Freuden kultivierten Lebens zu genießen: die Wärme des Kaminfeuers an einem verregneten Tag, das Aroma eines guten Brandys, das Geigenspiel meines Bruders an den Sonntagnachmittagen …
Als ich den kleinen Rauchersalon betrat – mit seiner dunklen Eichenvertäfelung, seinem kleinen Marmorkamin, seinem schönen Bärenfellvorleger und seinen drei Ledersesseln, die um einen Mahagonitisch standen, der für gewöhnlich überladen war mit Büchern, Kristallgläsern, Violinensaiten und Stapeln von Notenblättern –, war er für mich einer der zivilisiertesten Orte in ganz Edin-blöd-burgh (wie mein Vater die Stadt nennt).
Elgie, der jüngste von uns vier Frey-Brüdern, fläzte sich auf dem Sessel, der am weitesten entfernt vom Feuer stand, und schmökerte in einem schäbigen Wälzer von Harrison Ainsworth. Er war ein schmales Kerlchen kurz vor seinem neunzehnten Geburtstag, doch durch seine großen blauen Augen und seine blonden Locken wirkte er jünger, und so behandelte ihn auch jeder in der Familie. Elgies Mutter – meines Vaters Schlampe von einer Gattin – war entsetzt gewesen, als ihr Kleinster verkündete, er wolle nach Edinburgh ziehen, wo er im Royal Lyceum Theatre in der anstehenden Inszenierung von Macbeth die erste Geige spielen werde.
Unser Vater hatte daraufhin erwidert, ihm wäre es lieber, er spiele die dritte Triangel in dieser verdammten Kirchengemeinde in Whitechapel. Ich glaube, sie gestatteten ihm die Fahrt einzig und allein deswegen, weil ich bereits hier weilte, auch wenn ich zu jener Zeit – es lässt mich noch immer schaudern – mit in Nine-Nails’ Haus wohnte.
Als es unmöglich wurde, weiter unter einem Dach mit Inspector McGray zu leben – vor allem aufgrund der immer schlechteren Verfassung seiner Schwester –, und ich mir mein gegenwärtiges Anwesen anmietete, hatte ich darauf bestanden, dass mein Bruder mit mir dort einzog. Dabei hatte ich behauptet, das Haus sei zu groß für einen einzelnen Bewohner und er werde hier komfortabler leben als in angemieteten Räumlichkeiten im New Club. In Wirklichkeit hatte ich mittlerweile Elgies Gesellschaft aufrichtig zu schätzen gelernt. Er und mein Onkel Maurice sind die einzigen Verwandten, deren Gegenwart ich genieße, und nachdem ich das Unglück in der Familie der McGrays aus nächster Anschauung mitbekommen habe, weiß ich die beiden noch mehr zu schätzen. Mittlerweile speisten Elgie und ich häufig gemeinsam zu Abend, oder ich traf mich mit ihm im Theater und lauschte bei seinen Proben, und wenn das Wetter es zuließ, gingen wir abends gemeinsam zurück und sprachen dabei über Gott und die Welt.
Er hatte schläfrig in dem Buch geblättert, doch als er mich nun erblickte, war er sofort wieder putzmunter.
»Und?«, drängte er. »Was ist geschehen? Haben sie das Mädchen fortgeschafft?«
»Dir auch einen guten Abend«, erwiderte ich, goss mir einen wohlverdienten Brandy ein und nahm auf meinem Lieblingssessel Platz. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass ich den Umschlag immer noch in der Hand hielt. Zerstreut steckte ich ihn mir in die Brusttasche, nach wie vor nicht gewillt, die Nachricht zu lesen. »Ich dachte, du würdest üben«, sagte ich und deutete mit dem Kopf auf die verwaiste Geige samt Bogen neben dem Notenständer.
»Ich kann diesen Sullivan mittlerweile vorwärts und rückwärts spielen«, erwiderte er hastig. »Bitte erzähl mir doch, was Mr McGray getan hat. War er sehr verstimmt?«
»Verstimmt, wütend, mordlustig … Es gibt dafür gar keinen passenden Ausdruck.«
»Hat das Mädchen geschrien, als man sie fortgeschafft hat?«
»Elgie, sei nicht so morbid! Es war eine sehr traurige Szene, aber wenn du es unbedingt wissen willst: Sie war ganz ruhig – wie immer.«
Tatsächlich war Pansy McGray nach ihrem blutrünstigen Anfall vor sechs Jahren in einen katatonischen Zustand gefallen, völlig stumm und ihre Umgebung kaum wahrnehmend. So hatte sie die letzten Jahre verbracht, bis zum vergangenen Januar, als sich ihr Zustand drastisch verschlechterte.
»Glaubst du immer noch«, begann Elgie, »dass alles ausgelöst wurde durch …?«
»Die Geschichte in Lancashire? Aber natürlich! Das arme Mädchen war Zeuge eines Mordes, Elgie, und zwar eines äußerst schockierenden. Es wäre schon für einen gesunden, stabilen Menschen schrecklich genug gewesen – stell dir nur mal vor, wie es für ein Mädchen gewesen sein muss, deren Gemüt ohnehin instabil ist.« Ich stieß einen Seufzer aus. »Ja, Miss McGray muss bis ins Mark erschüttert worden sein.«
Während ich sprach, war Layton eingetreten und servierte nun eine Variation von Aufschnitt, Käse, Brot und Chutneys. Als ich von Mord und Geisteskrankheit zu sprechen begann, hatte er keine Miene verzogen, sondern sich lediglich verbeugt und den Raum verlassen.
Elgie hatte zwar bereits zu Abend gegessen, tat sich aber trotzdem an meinem besten Käse gütlich. »Ist Mr McGray immer noch der Meinung, es handelt sich alles um … Zauberei?«
Seine spitzbübische Art entlockte mir ein Lächeln. »Diese Frage brannte dir wohl auf den Nägeln, nicht wahr?«
»Natürlich nicht! Aber die Gentlemen im New Club reden dieser Tage von nichts anderem.«
»Ich habe mit Dr. Clouston ein Gespräch geführt«, sagte ich. Der gute Doktor war vor wenigen Stunden vor meiner Tür aufgetaucht und hatte mich inständig darum gebeten, ihm dabei zu helfen, McGray zur Vernunft zu bringen – als wäre ausgerechnet ich zu so etwas imstande. Ich halte große Stücke auf den Arzt und seine professionelle Einstellung gegenüber Geisteskrankheiten, daher konnte ich es ihm nicht abschlagen. Da ich selbst eine medizinische Ausbildung genossen habe, konnten wir Pansys Fall auf dem Weg in die Anstalt besprechen. »Der Mann schließt sich meiner These an«, sagte ich Elgie. »Der Verstand des Mädchens war schlichtweg überfordert.«
McGray hingegen schrieb den Rückfall seiner Schwester etwas weit Unheilvollerem zu.
»Dr. Clouston ist ein feiner Kerl«, sagte ich. »Er nimmt sie in seiner Kutsche mit.«
»Begleitet er sie den ganzen Weg bis zu den Orkneys?«
»Sch!«, machte ich. »Ich sagte dir doch, du sollst das nicht laut aussprechen!«, fuhr ich im Flüsterton fort. »Ja, ich nehme an, er befürchtet, auf einer Zugfahrt könne sie einen weiteren Anfall erleiden. Und ich hätte dir gar nicht erst verraten dürfen, wohin sie fährt.«
»Wird sie lange Zeit dort bleiben?«
»Das kann ich nicht sagen. Vermutlich wird er sie wieder holen, sobald es Anzeichen einer Genesung gibt.«
Das war die Wahrheit. Clouston glaubte, es sei gerade die Einsamkeit in der Anstalt, die Pansy so quälte. Diese Wände, diese Flure, die Menschen, die sich um sie kümmerten, erinnerten sie fortwährend an die schrecklichen Dinge, die sie gesehen und gehört hatte. Sie brauche einen Tapetenwechsel, müsse von ihren verstörenden Erinnerungen befreit werden. Und so beschloss Clouston nach eingehender Überlegung, sie auf den Orkney-Inseln unterzubringen. Diese waren so abgelegen wie nur möglich, sechs Meilen dem nördlichsten Zipfel von Schottland vorgelagert, doch Dr. Clouston war dort geboren worden und unterstützte mittlerweile ein kleines Heim für die Ältesten auf der Insel. In der Obhut seiner Zöglinge, die sein größtes Vertrauen genossen, würde Pansy gut aufgehoben sein. Vor allem aber würde sie in Sicherheit sein – beschützt auch vor dem Übereifer ihres eigenen Bruders.
McGray hegte mittlerweile den Verdacht, Pansys Geisteskrankheit sei absichtlich herbeigeführt worden. Das war ziemlich verständlich nach der schrecklichen Geschichte, die sich in Lancashire abgespielt hatte und die ich an anderer Stelle ausführlich beschrieben habe. Demzufolge misstraute McGray dem medizinischen Personal und allen, die sich in ihrer Nähe aufhielten. Den ganzen Frühling über war er zu unchristlichen Zeiten in der Anstalt aufgetaucht und hatte darauf bestanden, seine Schwester zu sehen, ihr Zimmer und ihr Essen zu inspizieren und die Menschen zu beaufsichtigen, die ihr die Mahlzeiten zubereiteten und ihre Laken wuschen … Clouston und ich besprachen dies einige Male und kamen dabei zu dem Ergebnis, dass McGrays Verhalten, so gut es auch gemeint sein mochte, den Zustand seiner Schwester womöglich nur noch verschlimmerte.
Abstand, so schien es, würde für beide das Beste sein. Nine-Nails davon zu überzeugen stand natürlich auf einem ganz anderen Blatt, und heute Abend hatte er einen letzten, verzweifelten Versuch unternommen, Dr. Clouston von seinen Plänen abzubringen.
Diese düsteren Gedanken drohten mir den Appetit zu verderben, sodass ich meine Aufmerksamkeit stattdessen auf das Tablett richtete und eine Weile lang stumm aß, während der sintflutartige Regen gegen das Fenster prasselte.
»Wir spielen jetzt endlich Macbeth«, erzählte Elgie, auch er bemüht, die Stimmung aufzuhellen. »Nächste Woche!«
Ich gluckste. »Bist du dir sicher? Wie oft haben sie das verfluchte Stück schon verschoben?«
»Zweimal. Sie wollten eigentlich im Februar damit auf Tournee gehen, dann hieß es, um die Osterzeit.«
Elgie schüttelte den Kopf. Er war eigens nach Edinburgh gekommen, um während der Aufführung des Theaterstücks zu musizieren, doch es hatte den Anschein, als müsse die Inszenierung jedes Mal, wenn das Orchester bereit war, verschoben werden. Beim ersten Mal war es wohl der Laune der Hauptdarstellerin geschuldet gewesen, der hochgepriesenen Ellen Terry, die den Gedanken, Ende des Winters nach Schottland zu reisen, nicht amüsant gefunden hatte.
Die zweite Verschiebung war schon eher gerechtfertigt gewesen: Die Theaterkompanie war von Queen Victoria persönlich einbestellt worden, die eine Privatvorstellung erbeten hatte.
Derweil hatte man die Musiker bei anderen Inszenierungen spielen lassen, was Elgie die Möglichkeit verschaffte, eine Reihe wunderschöner und herausfordernder Stücke zu spielen. Doch hatte nicht jeder seine Begeisterung geteilt. Der Ernüchterung war Zynismus und schließlich Langeweile gefolgt.
»Meine Kollegen sind es leid zu warten«, fuhr Elgie fort. »Neulich haben sie gemunkelt, es werde nie zu der Aufführung kommen, und dies läge an dem Fluch, der über Macbeth liege.«
Ich grinste höhnisch, denn über Flüche hatte ich in jüngerer Zeit so einiges gelernt.
»Inzwischen haben schon drei Musiker gekündigt«, fuhr Elgie fort, »und mehr als zwei Drittel der Eintrittskarten wurden zurückgegeben. Es ist wirklich eine Schande. Die Musik ist fantastisch, und Laurence erzählte mir, er habe wunderbare Kritiken über die Aufführungen in London gelesen.«
Die Erwähnung meines ältesten Bruders, mit dem ich mich überworfen hatte, ließ mich fast knurren.
»Nun, ich hoffe, sie führen es wenigstens dieses Mal auf«, sagte ich. »Du hast wirklich hart an diesen Stücken gearbeitet.«
Und ich wusste nur zu gut, wovon ich sprach, denn ich hatte Elgie so oft den »Chor der Hexen und Geister« spielen gehört, dass ich mittlerweile jeden einzelnen Takt hasste.
»Dieses Mal wird es definitiv geschehen, Ian. Mr Irving und Miss Terry müssten bereits in Edinburgh weilen. Ich hörte Mr Wyndham sagen, sie kämen heute mit dem Zug. Er hat den ganzen Tag lang lauthals damit geprahlt, er werde morgen mit Miss Terry zu Mittag essen. Die Premiere am Samstag wird er versäumen – ich glaube, er ist wegen einer Eigentumsübertragung außerhalb der Stadt verhindert.«
»Nun, dann wirst du ja endlich deinen großen Auftritt bekommen – in vier Tagen! Bestimmt wird deine Mutter sehr stolz auf dich sein.«
Kaum hatte ich dies erwähnt, öffnete sich Elgies Mund ein wenig, so als bereite er sich darauf vor, etwas auszusprechen, was ihm schwer auf dem Herzen lag.
Ich legte den Kopf schräg. »Elgie?«
Plötzlich machte er eine verlegene Miene. Was nun geschehen würde, war mir klar, aber ich wollte es nicht aussprechen und damit real werden lassen. Stattdessen genehmigte ich mir ein Schlückchen Brandy, bis Elgie endlich mit der Sprache herausrückte.
»Mutter und Vater kommen. Mit unserem Bruder Oliver, schätze ich.«
Es fühlte sich so an, als hätte der Branntwein in meiner Kehle Feuer gefangen. Bemüht, den teuren Brandy nicht auf den Läufer zu spucken, presste ich die Lippen aufeinander. Ich schluckte, und Elgie konnte mir meinen Zorn an den Augen ablesen. Seine Lippen zuckten – er war noch nicht mit allem herausgerückt, was er mir zu beichten hatte.
»Und?«, brummte ich.
»Und … Nun, ich bot ihnen an, sie könnten gerne hier wohnen.«
»Verdammt noch mal, Elgie!«
Ich fuhr aus dem Sessel hoch und schmetterte mein Käsemesser auf den Teller, dass die Brösel nur so umherstoben. Bei dem lauten Scheppern sank Elgie tiefer in seinen Sessel und wirkte dabei wie eine Schildkröte, die den Kopf in ihren Panzer zurückzieht. Genau in diesem Moment klopfte jemand hektisch an der Haustür, was ich jedoch kaum registrierte.
»Bist du vollkommen von Sinnen? Du willst, dass deine wahnsinnige Mutter, unser streitsüchtiger Vater und ich – dass wir alle unter einem Dach wohnen? Unser Haus wird binnen fünf Minuten zur verdammten Schlacht von Bosworth werden!«
»Nun, ich konnte sie schlecht einladen, ohne ihnen eine Unterkunft anzubieten! So kurzfristig wäre es schwierig für sie gewesen, ein angemessenes Etablissement zu finden!«
Mir wurde bewusst, wie bedenklich fest ich mein Brandyglas umklammerte. Um es nicht zu zerdrücken, stellte ich es auf dem Tisch ab.
»Und wann darf ich mit dem liebreizenden Paar Turteltauben rechnen?«, fragte ich, worauf Elgie prompt ins Stammeln geriet. »Ach, in Gottes Namen«, setzte ich hinzu, »etwas noch Schockierenderes wirst du mir wohl kaum mitteilen können.«
»Übermorgen. Sie haben heute Nachmittag ein Telegramm geschickt.«
Ich schnappte ein paarmal tief nach Luft, bemüht, so beherrscht zu bleiben, wie es bei dieser Nachricht überhaupt möglich war. Mit zusammengepressten Zähnen sagte ich: »Und für wie lange werden wir das Privileg ihrer Anwesenheit genießen?«
»Nun … mindestens zwei Wo…«
»Verdammt, Elgie!«
In diesem Moment klopfte Layton.
»Was?«, schrie ich auf.
Layton trat ein. Mein Geschrei ließ ihn vollkommen unberührt, er wölbte lediglich verwirrt eine Braue.
»Entschuldigen Sie die Störung. Mr Frey, ein junger Constable steht vor der Tür und verlangt nach Ihnen. Womöglich habe ich mich verhört, aber er behauptet, dass … unter der Regent Bridge eine Todesfee gesichtet wurde.«
Vollkommen entkräftet stieß ich geräuschvoll den Atem aus. »Sie haben sich nicht verhört, Layton. Gewöhnen Sie sich lieber daran, derlei Nachrichten zu überbringen.«
2
»Wer war dieser Mann noch mal?«
»Einer aus dem Süden, Sir«, sagte Constable McNair. »Typ Schauspieler. Wirklich sonderbare Gestalt. Wheatstone, hat er gesagt, glaube ich. Sie werden ihm bald begegnen, Inspector.«
»Ist Inspector McGray schon vor Ort?«
»Nein, Sir. Wir wissen nicht, wo er sich aufhält.«
Ich stieß einen bitteren Seufzer aus, während uns die Kutsche nach Osten beförderte, in Richtung Waterloo Place und zu den schemenhaften Umrissen des Calton Hill. Natürlich war kein Mensch in der Lage, Nine-Nails ausfindig zu machen. Nicht heute Abend. Entweder flennte er gerade, oder er ertränkte seinen Kummer an irgendeinem trostlosen Ort. Ich ahnte zwar, wo er sich vergraben hatte, wollte dies jedoch lieber noch nicht kundtun – er musste jetzt zweifellos in Ruhe gelassen werden.
Der Regen hatte nicht nachgelassen, und die stürmischen Böen schlugen mit solcher Gewalt gegen die Seite der Kutsche, dass ich schon befürchtete, sie werde umkippen. Es ließ einem bewusst werden, wie nah man hier der unruhigen Nordsee war.
Wir bogen rechts ab und gelangten auf die Calton Road, die steil hinab nach Süden führte. Die Kutsche ratterte die Straße entlang, die auf beiden Seiten von erschreckend hohen, rußgeschwärzten Mietskasernen gesäumt wurde.
Vor uns erhob sich der massive, imposante Brückenbogen der Regent Bridge, an dem die prächtige Princes Street mit der Ausfallstraße zum Hafen zusammentraf, und der oberhalb der heruntergekommenen, stinkenden Calton Road verlief.
Das Geländer der oberen Fahrbahn war mit üppigen Säulen im griechischen Stil dekoriert, die Waterloo Place zu einer ansehnlichen Promenade machten. Die Brücke selbst hingegen war ein solides, einfaches Bauwerk und verrußt wie das Armenviertel ringsum. Die Regent Bridge hätte kein passenderes Sinnbild für die erschütternden Klassenunterschiede der Stadt abgeben können.
Als wir näher kamen, stellte ich fest, dass die unterhalb der Brücke verlaufende Straße abgesperrt worden war. Ein halbes Dutzend Officers umringte eine Stelle unter dem Brückenbogen, mitten auf der Straße. Die meisten von ihnen trugen Blendlaternen, deren silbrige Lichtstrahlen in alle Richtungen flackerten. Ein voll beladenes zweirädriges Kohlenfuhrwerk war vor ihnen zum Stehen gekommen, und der entrüstete Kutscher stritt heftig mit den Officers.
»Lasst mich durch, ihr Mistkerle!«, hörte ich ihn mit fast unverständlichem Glasgower Akzent brüllen. »Ich muss meine Ladung ausliefern!«
Meine Kutsche hielt direkt neben ihm, und ich sprang sogleich heraus. Ich spannte meinen Schirm auf, doch er bot mir wenig Schutz, da die hoch aufragenden Gebäude wie ein Trichter fungierten und der Wind den Regen horizontal in alle Richtungen trieb. Als der Fuhrmann sah, dass ich mir meinen pelzbesetzten Kragen um den Hals schlang, stieß er einen Pfiff aus. »Hat das hübsche Bürschchen hier das Sagen?«
So grimmig ich konnte, brüllte ich ihn an: »Fahren Sie weg! Sofort! Sonst verbringen Ihre armseligen Knochen die Nacht in einer Zelle!«
Ich ließ ihm keine Zeit für eine Antwort, sondern wandte mich der kleinen Gruppe Polizisten zu und bahnte mir unter Einsatz der Ellbogen meinen Weg hindurch. Einer der Männer beleuchtete die kopfsteingepflasterte Straße.
»Was um alles in der Welt ist das?«, fragte ich, nachdem mein Blick magisch von vier purpurroten, vom strömenden Regen allmählich verwaschenen Flecken auf den nassen Steinen angezogen worden war.
»Da war eine Art Schriftzug auf der Straße«, erwiderte einer der Beamten. »Wir haben versucht, ihn vor dem Regen zu schützen, damit Sie einen Blick darauf werfen können, Inspector. Wir haben unser Bestes gegeben.«
»Gute Arbeit«, sagte ich, allerdings mehr aus Höflichkeit. Ihren Bemühungen zum Trotz war die Botschaft mittlerweile unleserlich. »Ist es das, wofür ich es halte?«
»Blut?«, fragte McNair. »Aye, wir denken schon.«
Ich kniete mich hin, um es genauer zu inspizieren. Tatsächlich sah es aus wie Blut, dunkelrot und zähflüssiger als das zwischen den Steinen auf der Straße dahinrinnende Wasser. Ich zog mir meinen Lederhandschuh aus und tippte mit dem kleinen Finger in einen Fleck, um dann mit der Zungenspitze daran zu schmecken. Es hatte den unverkennbar eisenhaltigen Geschmack, der Blut zu eigen ist. Sofort spuckte ich es wieder aus, und ein jäher Würgereiz erinnerte mich daran, warum ich meine medizinische Laufbahn an den Nagel gehängt hatte. Ich dachte daran, wie Blut alles durchtränkt – Kleidung, Haut, poröses Gestein – und dabei hartnäckige Flecken hinterlässt, die nur energisches Ausbürsten oder beißendes Pulver entfernen kann.
»Hat irgendjemand die Botschaft notiert?«, fragte ich, während ich rasch aufstand und meinen Abscheu zu verbergen suchte.
Die jungen Officers schauten einander nervös an. Doch bevor ich Gelegenheit bekam, ihnen einen Rüffel zu erteilen, sprang McNair ein. »Der seltsame alte Mann, der den Schriftzug entdeckt hat, hat die Worte immer vor sich hin geplappert.«
»Dieser Idiot, der behauptet, er hätte eine Todesfee gesehen?«
»Aye, ich bringe Sie zu ihm.«
Ich folgte McNair in eine der nahe gelegenen Mietskasernen. Wir mussten die Rinnsale schmutzigen Wassers umgehen, die fortwährend von der Brücke herunterprasselten, ausgespuckt von den Rinnen, die das Wasser von der Straße über uns einsammelten. Ich fragte mich, ob dies das Schicksal unserer immer dichter bevölkerten Städte war: große Blöcke mit billigen, beengten Behausungen, die sich angesichts der immer knapper werdenden Grundstücke in die Senkrechte erhoben.
Schließlich standen wir vor einer halb verfaulten Tür, die in einen schmalen, feuchten, im Dunkeln liegenden Flur führte. Durch die Risse einer weiteren ramponierten Tür, an die McNair nun klopfte, drang ein wenig Licht.
»Constable?«, fragte eine Frau.
»Aye, Herzchen. Der Inspector ist hier.«
Die Tür ging auf, und eine schmächtige Frau empfing uns. Sie hatte sich in einen zerlumpten Umhang gehüllt und trug ein schläfriges, in Decken gewickeltes Kleinkind auf dem Arm. Sie musste Anfang dreißig sein, war also etwa in meinem Alter, doch ihre Haut war dermaßen wettergegerbt, dass sie zehn Jahre älter wirkte. Sie musterte mich nervös mit ihren großen, wachen Augen. Mich übermannte ein jähes Mitgefühl: Sie schien die Art Frau zu sein, die, wäre sie nur in den richtigen Kreisen geboren worden, nun munter, fesch und hübsch vor mir gestanden hätte.
»Kommen Sie herein«, sagte sie und trat beiseite. »Hier ist der Mann, den Sie suchen.«
Ich betrat ihre beengte Behausung. Das Mobiliar bestand lediglich aus einem kargen Bett, einem ramponierten Tisch und zwei Stühlen. Es gab nicht einmal einen Herd zum Kochen oder einen Kamin, und die einzige Lichtquelle stammte von einer verrußten Petroleumlampe auf dem Tisch. Halb verborgen unter dem Bett entdeckte ich einen – glücklicherweise leeren – Nachttopf und erahnte, wie schwer das Leben dieser Frau sein musste.
Vornübergebeugt am Tisch saß ein Mann mittleren Alters, eine Hand um einen Zinnkrug gelegt, während er sich die andere an die Stirn presste. Er war klein geraten und von gedrungener Statur und litt offenkundig unter einem üblen Kater. Davon abgesehen aber machte er einen überraschend respektablen Eindruck. Er trug einen teuren Tweedanzug und eine Halbbrille, und mir stach die schimmernde Goldkette einer Taschenuhr ins Auge. Dichte, feste Locken grauen Haars wuchsen auf beiden Seiten seines schütter werdenden Schopfes, und so wie er insgesamt wirkte, erinnerte er mich an einen meiner verschrobenen Anatomieprofessoren. Verstärkt wurde dieser Eindruck noch durch seine Hände, denn seine dicken, wulstigen Finger waren trocken und schwielig.
»Ich gehe davon aus, dass Sie beide in keiner Beziehung zueinander stehen«, sagte ich.
Die Frau schüttelte den Kopf. »Ich habe ihn zuvor noch nie gesehen. Die anderen Polizisten baten mich, ihn so lange hier bei mir aufzunehmen, bis Sie kämen. Als ich den ganzen Trubel draußen mitbekam, bin ich nur mal kurz hinaus, um mich umzuschauen.«
Als sie dies sagte, ächzte der Mann laut.
Ich setzte mich ihm gegenüber. »Wie heißen Sie?«
Er räusperte sich und rieb sich die Schläfen. »Wheatstone«, erwiderte er mit einer Stimme, die unverkennbar nach einem Angehörigen der englischen Oberschicht klang. »John Wheatstone.«
»Mr Wheatstone«, sagte ich, »Constable McNair hier informierte mich, Sie hätten ausgesagt, eine Todesfee gesehen zu haben.«
Ich gab mir keine Mühe, meine Ungläubigkeit zu verbergen, worauf er mir seinerseits einen bitteren Blick zuwarf.
»Wollen Sie, dass ich lüge, Inspector …?«
»Ian Frey.«
»Wollen Sie, dass ich einfach lüge, Inspector Frey, um Ihrem Spott zu entgehen?«
»Was lässt Sie glauben, eine Todesfee gesehen zu haben?« In Anbetracht des Gestanks nach Alkohol, den der Mann ausströmte, konnte ich es mir allerdings schon denken.
Ich bekam nicht sofort Antwort. Der Mann zögerte, rieb sich heftig die Stirn und heftete seinen Blick dann auf den fettverschmierten Tisch.
»Mr Wheatstone, wollen Sie, dass ich in dieser Angelegenheit ermittle, oder …«
»Ich habe schon einmal eine gesehen!«
Diese Worte, die er regelrecht ausgestoßen hatte, ließen alle anderen im Raum zusammenzucken. Das kleine Mädchen brach in Tränen aus, worauf seine Mutter es noch fester einwickelte und dann in ihren Armen wiegte.
»Nun … gesehen nicht«, schnaubte Wheatstone. »Aber gehört. Heute Abend habe ich zum ersten Mal eine zu Gesicht bekommen.«
»Wie hat sie ausgesehen?«
»Es war eine zierliche Frau, ganz in weiße Tücher gehüllt – ihr Gesicht konnte ich nicht erkennen. Sie hockte mitten auf der Straße und wusch ein Bündel ekliger blutiger Kleider in den Pfützen.«
Ich ließ diese Worte auf mich wirken. Selbst für einen rational denkenden Menschen ist jemand, der Kleidung von Blut reinigt, nie ein gutes Vorzeichen.
»Ich hielt sie zunächst bloß für eine Bettlerin. Aber dann sah ich, dass sie diese Verse auf die Straße geschrieben hatte … und dann stieß sie auch noch diesen Schrei aus.«
»Den Sie wiedererkannt haben, da Sie den Schrei einer Todesfee ja bereits einmal vernommen haben«, ergänzte ich, bemüht, mehr Verständnis zu heucheln. Vergebens.
Mr Wheatstone schob sich die Brille hoch. »Inspector, ich bin ein Mann der Wissenschaft. Ich traue meinen Augen und Ohren und meiner Nase. Ich weiß, was ich gehört habe, und ich bin nicht der Einzige.«
Er schaute McNair an, der daraufhin einen Schritt vortrat.
»Auf der Straße sind mehrere Leute an uns herangetreten, Inspector Frey«, sagte er. »Sie wollten von uns wissen, was das für ein Schrei gewesen sei. Sie haben alle das Gleiche ausgesagt. Ein paar haben sie auch gesehen, von ihren Fenstern aus.«
Ich nickte. »Wir wissen also nur eines mit Sicherheit, nämlich dass unter der Brücke eine Frau gellend geschrien hat.«
»Es hörte sich unnatürlich an«, erklang nun die Stimme der Frau aus einer Ecke des Zimmers. Sie wiegte ihre Tochter mechanisch, so als wolle sie mehr sich selbst als das Kind beruhigen.
»Wie das?«, fragte ich. Ich erkannte, dass die Anspannung in ihr wuchs.