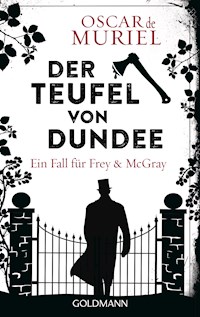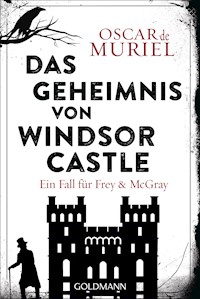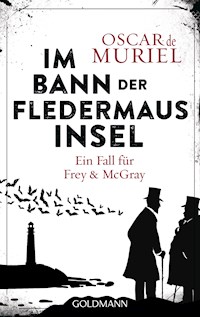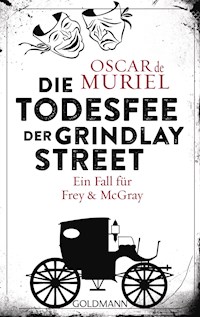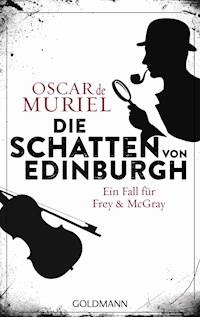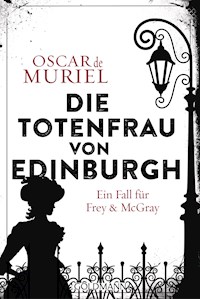
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Frey und McGray
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Madame Katerina, Hellseherin und Inspector McGrays enge Vertraute, hält eine Séance mit sechs Mitgliedern von Edinburghs reichster Familie ab. Am nächsten Morgen sind alle Teilnehmer tot, nur Madame Katerina selbst hat überlebt. Sie beteuert, dass der herbeigerufene Geist die Opfer aus Rache tötete. McGray glaubt ihr jedes Wort, muss aber eine weltliche Erklärung finden, um sie vor dem Galgen zu bewahren. Verzweifelt bittet er Ian Frey um Hilfe, der sich nach der grausamen Ermordung seines geliebten Onkels zurückgezogen hat. Doch in diesem mysteriösen Fall fällt es selbst dem vernunftbegabten Engländer schwer, nicht an Geister zu glauben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Ähnliche
Buch
Madame Katerina, Hellseherin und Detective McGrays enge Vertraute, hält eine Séance mit Mitgliedern von Edinburghs wohlhabendsten Familien im edlen Viertel Morningside ab. Als der Kammerdiener im Morgengrauen eintrifft, sind alle sechs Teilnehmer am Séance-Tisch tot. Nur Madame Katerina selbst hat schwer verletzt überlebt und gerät so unter Mordverdacht. Sie beteuert, dass der herbeigerufene Geist die Opfer aus Rache tötete. Der abergläubische McGray, der seiner alten Bekannten natürlich jedes Wort glaubt, muss trotzdem eine logische Erklärung für den Fall finden, möchte er Madame Katerina vor dem Galgen bewahren. Verzweifelt bittet er seinen ehemaligen Kollegen Inspector Frey um Hilfe, der sich nach dem schrecklichen Mord an seinem geliebten Onkel in großer Trauer auf dessen Gut in Gloucestershire zurückgezogen hat. Und dieses Mal fällt es selbst dem vernunftbegabten Engländer schwer, nicht an Geister zu glauben …
Weitere Informationen zu Oscar de Muriel sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Oscar de Muriel
Die Totenfrauvon Edinburgh
Ein Fall für Frey & McGray
Aus dem Englischenvon Peter Beyer
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Darker Arts« bei Orion Fiction, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd., London. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Oscar de Muriel Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by Wilhelm Goldmann Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München Covermotiv: FinePic®, München Redaktion: Eva WagnerMR · Herstellung: kw Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-641-26327-0
Das fünfte ist für meine allerliebste Schwester Olivia.
Ich habe meinen Tod gesehen.
Ich sah mich hängen.
Ich sah die Menge um mich herum jubeln.
Ich spürte die Schlinge um meinen Hals;
das würgende Gefühl;
die Haut, die zu reißen drohte.
Und du warst dabei.
Ich sah deine Tränen.
Du warst immer da …
A. K. Dragnea
1883
2. Juli
Öffentliche Anhörung vor dem Sheriff’s Court Dundee nach dem Tod von Mr James McGray und seiner Gattin Amina McGray (geborene Duncan)
Die Schritte, mit denen Doktor Clouston zögerlich vortrat, wirkten ohrenbetäubend in der Totenstille, die im Gerichtssaal herrschte. Seine Hände zitterten, und er musste sie zu Fäusten ballen, um seine Beklemmung zu verbergen. Aller Augen waren auf ihn gerichtet, alle Blicke feindselig, so als wäre er es gewesen, der die Morde begangen hatte.
Er nahm im Zeugenstand Platz, hob das Kinn, legte den Eid ab und wartete, bis der Staatsanwalt auf ihn zutrat.
Der glatzköpfige Mann, dessen Kopfhaut so glatt und bleich war wie polierter Marmor, ließ sich Zeit. Er sortierte Dokumente und las dabei einige von ihnen noch einmal durch, während die Spannung im Raum mit Händen zu greifen war und alle still verharrten.
Clouston blickte den jungen Adolphus McGray an, der soeben seine Aussage gemacht hatte. Der Fünfundzwanzigjährige ragte aus den Reihen der Sitzenden heraus, da er größer war als die meisten anderen und breite Schultern und rabenschwarzes Haar hatte. Außerdem war sein Gesicht bleicher als das aller anderen, während er auf seine bandagierte Hand hinabstarrte, die er sich gegen die Brust gepresst hielt. Die Wunde war noch nicht gänzlich verheilt.
»Doktor Thomas Clouston«, stieß der Staatsanwalt unvermittelt aus, worauf der eine oder andere im Gerichtssaal zusammenfuhr. »Von der Königlichen Irrenanstalt Edinburgh.«
Während er aus der Personalakte vorlas, trat er, spöttisch grinsend, näher. Cloustons Blick blieb an einem Bleizahn hängen.
»Das ist korrekt«, bestätigte der Arzt, der augenblicklich eine Abneigung gegen den Mann verspürte.
»Können Sie uns schildern, was an jenem Abend geschehen ist?«
»Ich bin ausschließlich hier, um über den Geisteszustand von Miss McGray Zeugnis abzulegen.«
»Oh, seien Sie doch so nett, Doktor.«
Murrend kam Clouston der Aufforderung nach. »Ich erhielt ein Telegramm, in dem mir mitgeteilt wurde, dass Mr McGray und seine Gattin angegriffen worden seien. Dass sie bedauerlicherweise verschieden waren. Dass ihr Sohn verletzt worden sei und ihre Tochter in ihr Zimmer habe gesperrt werden müssen. Als ich eintraf …«
»Nein, nein, Doktor«, unterbrach ihn der Staatsanwalt. »Vorher. Ich möchte wissen, was vorher an diesem Tag geschehen ist.«
Clouston schnaubte. »Ich kann nur berichten, was ich von Mr McGrays Sohn und den Bediensteten gehört habe. Ich sehe nicht, inwiefern die Aussage eines Dritten …«
»Bitte«, schaltete sich nun der Sheriff von seiner erhöhten Position aus ein, »beantworten Sie die Frage des Staatsanwalts.« Sein »Bitte« klang eher wie ein Knurren.
Clouston räusperte sich. Je rascher er seiner Pflicht nachkam, desto schneller würde er es hinter sich haben.
»Nach dem, was mir erzählt wurde, verließen Adolphus und Amy, der Sohn und die Tochter von Mr McGray, am frühen Abend das Haus. Sie unternahmen einen Ausritt, da es trotz der fortgeschrittenen Tageszeit draußen noch freundlich war. Um ihren Pferden eine Rast zu gönnen, legten sie nach einer Weile eine Pause ein und setzten sich an den kleinen See, der an das Grundstück der Familie angrenzt. Sie plauderten eine Weile miteinander, bis Miss McGray dann sagte, sie sei unpässlich, und …«
»Inwiefern unpässlich?«
»Auch hier kann ich nur wiederholen, was …«
»Inwiefern?«
Ungeduldig zwirbelte Clouston seinen Schnurrbart. »Ihr Bruder sagte, sie habe über Kopfschmerzen und Atemnot geklagt. Sie beschloss, die Rückkehr zum …«
»Allein?«
»Ja.«
»Um wie viel Uhr war das?«
»Ich gehe fest davon aus, dass es vor der Abenddämmerung war.«
»Sie sagten, die beiden seien am frühen Abend aufgebrochen. Glauben Sie, sie könnten so lange geritten sein, dass die Pferde eine Ruhepause benötigten, und danach noch einen Plausch gehalten haben, und das alles noch vor Sonnenuntergang?«
»Ist Ihnen der Mittsommer nicht geläufig, Mr Pratt?«
Im Gerichtssaal brach Gelächter aus, und allein die Nennung seines Namens bewirkte, dass ein unkontrollierbarer Tic die Lippe des Staatsanwalts zucken ließ.
»Es erscheint mir schlichtweg sonderbar«, sagte er mit unheilvoll klingender Stimme, »dass eine junge Lady sich dazu entscheiden sollte, alleine zu reiten, mitten in der Wildnis, während der Tag sich bereits seinem Ende zuneigte.«
»Es handelte sich um das Grundstück der Familie. Das Mädchen war wahrscheinlich dort schon viele Male allein entlanggeritten.«
»Und sie bestand darauf, ihr Bruder solle zurückbleiben?«
»Sie haben es ihn gerade selbst sagen gehört.«
»Eine junge Lady, die sich unwohl fühlt, lehnt es trotz zunehmender Dunkelheit ab, sich nach Hause begleiten zu lassen. Und das Nächste, was wir erfahren, ist, dass sie Amok läuft und die einzigen beiden Personen im Haus tötet. Kommt Ihnen das nicht ein wenig verdächtig vor?«
»Verdächtig?«
»Sie war kerngesund, als sie ihren Bruder verließ, nicht wahr?«
»Ja.«
»Und nur Minuten später wird sie zu einer mordlustigen Furie?«
Bei dieser Bemerkung fuhr Adolphus hoch, und er starrte den Staatsanwalt zornig an. Der neben ihm postierte beleibte Gerichtsdiener drückte ihn wieder auf seinen Stuhl hinunter. Es war nicht das erste Mal am heutigen Tag, dass der junge Mann die Beherrschung verlor.
Clouston holte tief Luft. »Das ist ein ungewöhnlicher Verlauf, aber nicht beispiellos. Die Funktionsweise des Verstandes bleibt bedauerlicherweise ein Rätsel.«
Der Staatsanwalt nickte, setzte jedoch ein leicht süffisantes Lächeln auf. »Sie halten also am Antrag auf verminderte Schuldfähigkeit fest?«
»Allerdings. Das Mädchen befindet sich zurzeit in meiner Obhut.«
»Wann haben Sie sie in Ihre – ähm – höchst ehrenhafte Anstalt gebracht?«
»Direkt am nächsten Tag.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Sie stellte eine Gefahr für sich selbst und für andere dar. Bei unserer ersten Begegnung hat sie mich angegriffen.«
»Ach ja«, erwiderte der Staatsanwalt und wandte sich wieder dem Publikum zu, um nun Betsy anzuschauen, die stämmige, in die Jahre gekommene Haushälterin der McGrays, und George, den wettergegerbten Butler. »Wie diese Bediensteten aussagten, haben Sie Miss McGray bei Ihrem Eintreffen mühelos überwältigt.«
Clouston, der eine Falle witterte, holte Luft. »Ja. Das war mir möglich.«
Der Staatsanwalt gluckste. »Es gelang dem Mädchen also, zwei putzmuntere Erwachsene zu töten und ihren Bruder zu verstümmeln, der, wie wir vor Augen haben, nicht gerade ein Fliegengewicht ist … und doch kamen Sie, Doktor, zu keiner Zeit zu Schaden.«
Clouston strich sich über seinen langen dunklen Bart. »Das ist richtig. Als ich eintraf, war Miss McGray ausgehungert und dehydriert. Die Hausangestellten hatten sie in ihrem Schlafzimmer eingesperrt, und niemand wagte sich in ihre Nähe. Das arme Mädchen hatte einen Tag lang nichts gegessen oder getrunken. Sie war nur noch in der Lage, für einen kurzen Moment ein Messer zu zücken. Mit diesem stürzte sie sich auf mich, brach dann aber zusammen.«
Aus dem Augenwinkel heraus schaute Clouston auf die Geschworenen. Hier und da bemerkte er ein Kopfnicken.
»Hat sie noch etwas gesagt?«, erkundigte sich der Staatsanwalt. »Bevor sie zusammenbrach?«
Auf diese Frage hatten alle gewartet. Die Leute reckten den Hals und lauschten gespannt. Einige blinzelten nicht einmal. Zwar kursierten bereits Gerüchte, doch Clouston war der Einzige, der die letzten bekannten Worte des Mädchens vernommen hatte.
»Denken Sie daran, dass Sie hier unter Eid stehen«, mahnte der Staatsanwalt.
Clouston schaute Adolphus an. Sie beide hatten darüber gesprochen. In seinen blauen Augen lag ein gequälter, flehender Blick. Erzählen Sie es ihnen nicht, schien er zu bitten.
Aber er stand unter Eid …
Der Doktor schluckte und spie die Worte dann förmlich aus. »Sie sagte: Ich bin nicht verrückt …«
Raunen und Laute des Erstaunens kamen auf. Triumphierend schritt der Staatsanwalt zur Geschworenenbank.
»Das Mädchen sagte selbst, es sei nicht verrückt! Und wenn sie nicht verrückt war, müssen diese Morde behandelt werden wie …«
»Oh, was für eine törichte Bemerkung!«, brüllte Clouston und sprang auf. Seine dröhnende Stimme ließ alle im Raum verstummen. »Ich habe in den zurückliegenden zwanzig Jahren Hunderte von Patienten behandelt. Neun von zehn behaupten, sie seien nicht geistesgestört. Wollen Sie etwa, dass ich ihnen das abnehme und sie alle auf einmal entlasse – Mr Pratt?«
Erneut brandete tosendes Gelächter auf, worauf der Staatsanwalt dunkelrot anlief.
Noch bevor der Lärm verebbte, fuhr Clouston fort. »Außerdem sagte Miss McGray gleich danach, es sei alles ein Werk des Teufels.«
Augenblicklich verwandelte sich das Gelächter in schockierte Rufe und Laute des Erschreckens. Das war es, wonach die Leute gegiert hatten. Das waren die Aussagen, die sämtliche Zeitungen in Dundee und Edinburgh am folgenden Tag abdrucken würden.
Clouston warf Adolphus einen besorgten Blick zu. Der junge Mann war im Begriff zusammenzubrechen und umklammerte mit der unversehrten Hand seinen Verband. Clouston empfand ein solches Mitleid mit ihm, dass es ihm zu Herzen ging – und doch musste die Wahrheit berichtet werden …
Er richtete seinen Blick direkt auf die Geschworenen. »Miss McGray, ein zierliches Mädchen von sechzehn Jahren, wandte sich gegen ihre Mutter und ihren Vater, die sie über alles liebte, und tötete die beiden. Sie wurde hysterisch und musste gebändigt und sediert werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie nicht sie selbst war. Sie …« Clouston senkte den Blick, und nun schwang Trauer in seiner Stimme mit. »Sie wird womöglich nie wieder sie selbst sein.«
Seine Worte hingen eine ganze Weile im Raum, bis der Staatsanwalt mit der Zunge schnalzte.
»Eine sehr zu Herzen gehende Geschichte – jedoch ohne Aussagekraft. Das Mädchen muss vor Gericht aussagen.«
»Was!?«, brüllte Adolphus von seinem Platz aus los.
Die Menge jubelte und klatschte, und einige Männer rieben sich geradezu lüstern die Hände. Eine junge Frau vor Gericht verhieß stets ein großartiges Schauspiel.
Der Staatsanwalt nahm die Unruhe in den Reihen der Geschworenen wahr, die miteinander tuschelten, und sagte in höhnischem Ton: »Ich fürchte, die Unzurechnungsfähigkeit des Mädchens muss ordnungsgemäß …«
»Ihre Unzurechnungsfähigkeit ist bewiesen!«, machte Clouston geltend, nun ausschließlich an den Richter und die Geschworenen gerichtet. »Mein Bericht ist umfassend. Ich habe ihn heute Morgen abgegeben, Sie können ihn sofort lesen. Einer meiner Kollegen aus Inverness ist unterwegs, und ich bin davon überzeugt, dass er meine Erkenntnisse uneingeschränkt bestätigen wird. Sie entsprechen den Bestimmungen des Lunacy Act über psychische Gesundheit.«
Wie ein Wolf auf der Pirsch näherte sich ihm der Staatsanwalt. »Und in der Zwischenzeit wollen Sie einer potenziellen Mörderin Unterschlupf in Ihrer Anstalt gewähren?«
Erneut sprang Adolphus auf. »Sie verfluchter Schwachkopf!«
Auf ein Zeichen des Richters hin eilten zwei weitere Gerichtsdiener herbei, um Adolphus aus dem Gerichtssaal zu zerren. Noch während sie alle Hände voll damit zu tun hatten, fuhr Clouston fort.
»Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun, Mr Pratt? Das Mädchen herbeischaffen, damit sie zum Affen gemacht werden kann? Damit wäre niemandem gedient außer Ihrem krankhaften Verlangen, dabei zuzuschauen, wie ein hilfloses Geschöpf öffentlich gedemütigt wird.« Er wandte sich dem Sheriff und den Geschworenen zu. »Das Gesetz muss eingehalten werden. Dieses Mädchen hat hier nichts verloren. Das Gericht muss ihr gegenüber menschliches Mitgefühl aufbringen.«
»Hat sie denn ihrer eigenen Familie gegenüber Mitgefühl aufgebracht?«
Nun kam es zu einem Tumult. Zuschauer sprangen auf, klatschten und pfiffen und verlangten lauthals, das Mädchen müsse vor Gericht erscheinen. Sie wollten ihr Blut, ihre Würde.
Clouston spürte, dass sich Tränen der Wut in seinen Augen sammelten. Vor seinem inneren Auge formte sich ein Bild, in dem er sich selbst und die McGrays als in Käfigen gehaltene Beutetiere sah, umgeben von einer Meute aus Tausenden Hunden, die wie wild an ihren Ketten zerrten, die sie hielten. Ketten, die zu zerreißen drohten.
Eingehüllt in einen schwarzen Umhang mit Kapuze stand die Zigeunerin vor der Tür des Pubs. Sie presste ihre Hand mit krallenartigen, schwarz lackierten Fingernägeln gegen die Tür, zögerte vor dem Eintreten jedoch. Sie schaute sich nach beiden Seiten um und warf einen prüfenden Blick auf die Royal Mile. Zu dieser Tageszeit war die kopfsteingepflasterte Straße menschenleer. Sogar in der Schankwirtschaft war es ruhig.
»Soll ich Sie hineinbegleiten?«, bot ihr Diener an, der auf dem Kutschbock des Pferdewagens saß.
»Nein«, murmelte die Zigeunerin. »Warte hier.«
Leise trat sie ein und schaute sich um. Im Inneren war es stockdunkel, beleuchtet wurde der Raum lediglich vom goldenen Glanz verlöschender Glut, und es stank nach billigem Ale – die Zigeunerin erkannte den Geruch ihres eigenes Gebräus wieder.
Nur noch einige wenige Gäste waren zugegen. Es war eine Mischung aus den betrunkensten Männern in Edinburgh, die sich über ihre Pints oder ihr Whiskyglas beugten, sowie jenen, die anscheinend von einem solchen Kummer erfüllt waren, dass kein noch so großer Drink diesen ertränken konnte.
Der Erbe der McGrays war unschwer auszumachen. Ihre Kontaktpersonen hatten ihr berichtet, dass er dazu übergegangen war, sich in auffälligem Tartanmuster zu kleiden, doch selbst ohne die Hose und die Weste, die nicht zueinanderpassten, hätte sie seine große, kräftige Statur anhand der Zeitungsartikel wiedererkannt.
Sie hatte damit gerechnet, dass er am Boden zerstört wäre, eine traurige Erscheinung mit rotgeweinten Augen und mit einer Flasche Single Malt in der Hand. Stattdessen klebte der hochaufgeschossene junge Mann förmlich an der Schankwirtin.
Die beiden verlustierten sich in einer abgedunkelten Ecke des Schankraums miteinander, in einer engen Umarmung verschlungen wie zwei Kraken.
Als die Zigeunerin näher trat, streifte ihr Umhang das Knie eines der besonders üblen Trunkenbolde in dem Etablissement.
Der Mann starrte sie schwankend an und stieß dann einen Pfiff aus. »He! Ihr beide gefallt mir!«
Sie drehte sich nicht zu ihm um, blieb nicht einmal stehen. »Ich würde dich mit einem Fluch belegen – wenn du noch irgendetwas zu verlieren hättest.«
Ihre wohlgewählten Worte, vorgebracht in einem sonderbaren osteuropäischen Akzent, trafen ihren Widersacher an seiner empfindlichsten Stelle. Bemüht, sein rot angelaufenes, verhärmtes Gesicht zu verbergen, senkte der Mann den Blick.
Die Zigeunerin trat energisch an den Tisch des Paars und stieß ein gackerndes Lachen aus.
»Du verschwendest aber keine Zeit, meine Liebe. Gut so!«
Die junge Wirtin schnellte hoch. Ihre Wangen waren so feuerrot wie ihre lockige Mähne. »Madame Katerina!«
Die Zigeunerin lächelte.
»Oh, du brauchst dich nicht zu schämen, Mary! Immerhin arbeitest du dich nach oben. Der hier ist viel attraktiver als der Halunke, den ich letzten Monat für dich verhexen sollte.« Sie senkte die Stimme. »Übrigens, seine Warzen dürften gerade kräftig wachsen.«
Sie ließ sich auf Marys Stuhl nieder, doch der junge McGray schnippte augenblicklich ungehalten mit den Fingern.
»He! Ich sagte nicht, dass Sie sich setzen sollen.«
In einem stummen Machtspiel starrten sie einander an. Seine Augen waren hellblau, die ihren leuchtend grün. Beide blickten listig.
Sie ergriff zuerst das Wort. »Ich glaube, Sie sollten sich anhören, was ich zu sagen habe.« Sie knöpfte ihren Umhang auf und ließ ihn von den Schultern gleiten.
McGrays Blick heftete sich sofort auf ihre ausladenden Brüste, die größten in ganz Edinburgh, die sie durch ihr tiefes Dekolleté aller Welt stolz präsentierte.
Sie lächelte. Damit brachte sie ihre Widersacher immer aus der Fassung.
»Möchten Sie einen Drink, Madam?«, fragte Mary, noch bevor es McGray gelang, seinen Mund wieder zuzuklappen.
»Ja, meine Liebe. Aber das gute Zeug, nicht die Pisse, die ich dir für deine Kunden verkaufe.«
Mary zwinkerte ihr zu. »Ich bringe Ihnen einen Single Malt aus der Brennerei der McGrays. Die verstehen sich auf ihr Handwerk.« Während sie das Hinterzimmer ansteuerte, tauschten Mary und McGray verschwörerische Blicke aus.
McGray war alles andere als erfreut.
»Ich will nicht unhöflich sein, Herzchen«, sagte er, »aber Sie sollten sich wirklich verpissen.«
»Oh! Haben Sie zu tun, mein Junge?«
»Aye. Ich feile mir gerade meine Nägel, sehen Sie das nicht, verdammt?«
Im Hintergrund war das Lachen des Trunkenbolds zu vernehmen. »Och, jetzt wirst du schneller fertig!«
McGray stürzte den Rest seines Drinks herunter und warf das Glas nach dem Mann. Es traf ihn genau zwischen den Augen und zerbarst. Der Betrunkene jaulte auf, sprang auf und versuchte eine Faust zu machen, geriet dann aber ins Schwanken, taumelte und schaute seine Hand so an, als würde er ihrer zum ersten Mal gewahr. Er stieß eine Reihe von Obszönitäten aus und torkelte dann schwerfällig hinaus.
»Adolphus!«, knurrte Mary, die mit einer weiteren Flasche zurückkam. »Das ist heute schon der dritte gute Kunde, den du mir vergraulst! Der hätte vielleicht noch eine weitere Flasche runtergekippt!«
»Ich bin mir sicher, dass sich meine Anwesenheit bezahlt macht, meine Liebe«, sagte Katerina und schenkte sich einen großzügigen Schluck ein. »Und ich verspreche dir, dass ich diesen hier nicht vergraulen werde.«
»Genau das tun Sie aber gerade!«, blaffte McGray.
Mary fasste ihn am Arm. »Ich bin gleich wieder da, Adolphus. Hör auf Madame Katerina.« Mit diesen Worten trippelte sie ins Hinterzimmer, eindeutig gemeinsame Sache mit der üppig ausgestatteten Zigeunerin machend.
McGray seufzte. »Was zum Teufel wollen Sie?«
Er verschränkte die Finger. Man hatte ihm den Verband vor Kurzem abgenommen, aber die Nähte am Stumpf des Fingers, den ihm seine eigene Schwester abgehackt hatte, sahen trotzdem schaurig aus.
»Ringfinger, rechte Hand«, kommentierte die Zigeunerin ein wenig trübsinnig. »Genau wie es in den Zeitungen stand.«
»Aye. Ich bin froh, dass ich nicht den hier verloren habe – oder diese beiden hier!«
Sie lächelte. »Sie sind mir schon jetzt sympathisch.« Sie schwenkte das Glas, schnupperte an dem Getränk, genehmigte sich einen kräftigen Schluck und verzog das Gesicht. »Ahh, wirklich ein gutes Tröpfchen!«
»Ich hasse es, wenn ich zweimal fragen muss. Was zum Teufel woll…«
»Ich glaube Ihnen Ihre Geschichte, mein Junge.«
McGray schaute auf. Der Lichtschein des Herdfeuers spiegelte sich in seinen Augen und verwandelte ihr Blau in feuerrotes Bernstein.
»Treiben Sie keine Spielchen mit mir!«, warnte er, legte eine Hand auf den Tisch und ballte sie langsam zur Faust. »Ich bin schon einer Menge Quacksalbern wie Ihresgleichen begegnet. Ihr seid mit euren billigen Tricks und Lügen doch nur alle hinter dem Geld her.«
»Werfen Sie mich nicht mit denen in einen Topf, Junge. Ihr Verlust tut mir sehr leid.«
»Was geht Sie das an?«
Sie lächelte gequält. »Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe meine Eltern verloren, als ich noch blutjung war. Sie können von Glück reden.«
»Glück!Aye.«
»Sie haben Ihre Fäuste, Ihr Stadthaus und Ihre Brennereien …« Sie schwelgte in dem Bukett des Getränks. »Ich hatte nichts dergleichen. Ich war ein bettelarmes Mädchen mit einem komischen ausländischen Akzent, ganz auf sich allein gestellt. Ich tauschte alles, was Sie sich nur vorstellen können, gegen einen schimmligen Laib Brot oder eine Nacht mit einem Dach über dem Kopf. Manchmal …«
Sie verstummte, verschluckte plötzlich die Worte, die sie hatte sagen wollen. Stattdessen nahm sie einen ausgiebigen Schluck und räusperte sich schließlich.
»Aber ich habe mich hochgearbeitet. Ich bin weder verzweifelt noch hilflos und werde es auch nie wieder sein. Glauben Sie mir, ich bin nicht hier, um zu betteln oder mich an Ihnen schadlos zu halten. Ich bin hier, um zu helfen. Auch wenn mir, als ich auf der Straße stand, niemand geholfen hat.«
Mitfühlend und gleichzeitig verärgert verzog McGray den Mund. Dieses kurze Aufblitzen von Empathie bewirkte, dass die Zigeunerin lächelte. Dies war ihre Chance – ein Riss im Schutzschild des jungen Mannes.
»Sie glauben, etwas gesehen zu haben«, flüsterte sie entrückt und zischte dabei wie eine Schlange. »Etwas, das Sie sich nicht erklären können … Sie haben sogar schon befürchtet, vielleicht selbst verrückt geworden zu sein.«
McGray blieb stumm, starrte sie an, ohne zu blinzeln, während er langsam und tief die Luft einsog.
»Sie haben den Teufel gesehen, nicht wahr? Sie haben seine Hörner und sein verbranntes Fleisch erblickt. Sie haben gesehen, wie er fortgelaufen ist. Ist es nicht so?«
Erregt schnappte McGray nach Luft. »Woher wissen Sie das?«
Die Zigeunerin legte beide Hände auf den Tisch. Ihre Nägel waren geformt wie die Krallen eines Adlers.
»Ich sehe diese Dinge, mein Junge. Ich sehe, dass Ihrer kleinen Schwester etwas Furchtbares widerfahren ist. Etwas Dunkles und so Grausiges, dass es nicht zu ertragen ist.«
In diesem Moment fegte ein Luftzug durch die Tür herein, stieß sie einen Spalt auf und ließ die Glut aufflackern.
»Solche Ereignisse hinterlassen eine Spur, mein Junge«, beharrte sie. »Sie stinken. Dies alles riecht nach Dämonen.«
McGray hob an, um etwas zu erwidern. Mittlerweile sprach ganz Edinburgh von nichts anderem mehr als von Cloustons Aussage. Pansy hatte den Teufel erwähnt, das hatten alle Zeitungen abgedruckt. Dies wollte er der Frau nun auch mitteilen, sie am Arm packen und hochkant hinauswerfen. Doch da war etwas in ihren Augen, das er nicht zu ignorieren vermochte. Sie schaute ihn mit einem geradezu mütterlichen Blick an.
Schließlich beugte sie sich zu ihm vor und flüsterte: »Sie haben gesehen, was wirklich geschehen ist, nicht wahr? Sie haben gesehen, was ich sehen kann.«
Die von draußen eindringende Kälte kroch ihm allmählich in die Knochen. So robust er auch sein mochte, konnte er ein leichtes Schaudern doch nicht unterdrücken.
»Da ist noch etwas, was ich sehe«, fuhr sie unvermittelt fort, so als hätte McGray aufgrund dieses kurzen Zitterns seine Deckung verloren. Sie lächelte, doch es war ein warmherziges, erleichtertes Lächeln. »Ihre kleine Schwester ist vielleicht nicht ganz verloren. Noch nicht.«
McGray spannte seinen ganzen Körper an. Diese Anspannung fühlte sich an wie ein Schutzschild, der die Zigeunerin irgendwie in Schach hielt. Da war nun eine Frau, die ihm genau die Worte sagte, die zu hören er sich so verzweifelt gewünscht hatte. Ein Grund mehr, weiter auf der Hut zu sein.
Er sagte nichts, während sie sich noch näher zu ihm vorbeugte. Ihre Augen glitzerten wie glühende Kohlen.
»Ich kann Ihnen helfen.«
McGray reckte das Kinn und ballte eine Faust noch fester zusammen. Und doch war er nicht imstande, den Blick von ihr abzuwenden.
Das Lächeln der Zigeunerin wurde breiter.
»Wir können uns gegenseitig helfen.«
1889
PROLOG
Freitag, 13. September 1889
23.30 Uhr
»Deine verdammte Zigeunerin verspätet sich!«, bellte Colonel Grenville, während er durch das Fenster auf den im Dunkel versunkenen Garten hinausstarrte. Er hatte so kräftig auf der Zigarre in seinem Mundwinkel herumgekaut, dass er jetzt lauter Tabakkrümel im Mund hatte. Er spuckte sie aus und wandte sich wieder dem abgedunkelten Raum zu, doch der Anblick der anderen Anwesenden trug ganz und gar nicht zur Verbesserung seiner Stimmung bei.
Leonora hatte die Nase in ihr vermaledeites Buch über Geisterbeschwörung und ähnlichen Unsinn gesteckt, während die zahlreichen Kerzen auf dem runden Tisch Schlagschatten auf ihr hageres Gesicht warfen.
»Sie kommt schon noch«, erwiderte die Zweiundzwanzigjährige, die traumverloren vor sich hin starrte, so als sei sie darauf bedacht, selbst wie eine Erscheinung daherzukommen. So, wie das alberne Mädchen sich als perfekte Wahrsagerin gefiel, dachte Colonel Grenville, hatte sie sich eine saftige Ohrfeige verdient.
Mrs Grenville, die auf der Kante eines Sofas in der Nähe saß, fächelte sich besorgt Luft zu. Das fortwährende Rascheln der Federn war das einzige Geräusch in der angespannten Atmosphäre des Salons. Sie warf ihrem Gatten einen ängstlichen Blick zu – der Colonel war nur selten zum Warten verurteilt gewesen. Selbst als er ihr einen Antrag gemacht hatte, hatte sie sich trotz ihrer Aufregung genötigt gefühlt, mit militärischer Promptheit eine Antwort zu geben. Damals hatte sie es sehr romantisch gefunden. Im Nachhinein jedoch …
Sie stieß einen erschöpften Seufzer aus.
Der alte Mr Shaw, ihr Großvater, saß stocksteif neben ihr. Der weiße Kinn- und Backenbart des Mannes und der goldene Rahmen seiner runden Brille glänzten im Lichtschein der Kerzen, doch davon abgesehen war von ihm kaum etwas wahrzunehmen. Wie ein Gespenst führte er seine gebrechliche Hand in den Lichtkegel und hielt das Handgelenk seiner Enkelin fest, um das Wedeln des Fächers zu beenden.
»Danke, Hector«, erklang eine heisere Stimme aus den Tiefen des Schattens. Es war die Stimme eines Mannes, den der Colonel verabscheute: Mr Willberg. Schwarz gekleidet und so gut wie unsichtbar stand er in einer abgedunkelten Ecke. Wie aus dem Nichts heraus trat der Mann nun einige Schritte ins Licht und begann auf und ab zu gehen. Peter Willberg war fast zehn Jahre älter als der Colonel und der einzige anwesende Mann, der es mit ihm aufzunehmen wagte. Dies wusste Colonel Grenville und starrte nun zornig auf Willbergs zottigen und gekräuselten Bart, der pechschwarz war, obschon der Mann dünnes, ergrauendes Kopfhaar hatte.
»Sie werden jemanden bitten müssen, das hier sauberzumachen«, erklärte Mr Willberg dem Colonel und deutete dabei mit dem Kopf auf die Tabakkrümel auf dem roten Teppich.
»Fahren Sie zur Hölle, Pete!«, blaffte Colonel Grenville. »Das hier ist mein Haus, verflucht noch mal!«
»Oh, ist es das jetzt?«, feixte Mr Willberg.
Niemand sagte etwas, alle warteten auf die Reaktion des Colonels. Leonora war die Einzige, die sich rührte – sie streckte die Hand aus, um den Arm von Mr Willberg zu drücken. Mit flehentlichem Blick bat sie ihn, nicht die Beherrschung zu verlieren.
Trotzig warf der Colonel seine Zigarre auf den Boden und zog eine neue aus seiner Tasche hervor.
»Das Letzte, was wir brauchen, ist noch mehr verfluchter Qualm, Sie Narr!«, schimpfte Mr Willberg.
Zumindest mit dieser letzten Bemerkung stimmten alle überein. Die Luft in der kleinen Kammer war dick. Eklige Rauchschwaden waberten zwischen den flackernden Kerzenflammen.
»Dann sagen Sie Ihrer verfluchten Nichte, sie soll diese verdammten Dinger ausblasen!«, zeterte der Colonel.
»Wir müssen das Zimmer reinigen!«, rief Leonora ihrerseits und hob dabei die Arme, so als müsse sie sich wappnen, diese brennenden Kerzen zu verteidigen. Es waren diejenigen, die ihre Großmutter vor so vielen Jahren gesegnet hatte und die – der Zigeunerin zufolge – der Schlüssel zu ihrer aller Erfolg waren. »Wir brauchen sie, um mit den Toten in Kontakt zu treten!«
»Na, kommen Sie«, sagte der alte Mr Shaw, während er sich sein schon durchweichtes Taschentuch auf die Stirn presste. »Wir sind alle … wir sind alle sehr nervös.«
Alle hörten die Furcht heraus, die in seiner Stimme mitschwang, und verstummten augenblicklich. Falls die Séance erfolgreich sein würde, würde der arme alte Mann mit Dämonen konfrontiert werden, die sich keiner der anderen auch nur vorstellen konnte. Mrs Grenville legte eine Hand auf die ihres Großvaters, doch der Mann zuckte zurück und entzog sie ihr.
»Ist dieser Angsthase von Bertrand zur Stelle?«, wollte der Colonel wissen.
Augenblicklich war eine Fistelstimme von der Tür des Salons zu vernehmen. Bertrand hatte sich in den Türrahmen gelehnt. »A… Aye. Ich bin hier, Sir. Tut mir leid. Es ist so stickig im Zimmer.«
Schnaubend warf ihm der Colonel einen verächtlichen Blick zu. Bertrand verkörperte alles, was er an Männern hasste: Er war kränklich, unbeholfen, unsicher auf den Beinen, hatte eine piepsige Stimme und nervöse, zappelige Hände, die er sich andauernd an der Brust rieb. Viele Male schon hatte der Colonel eine Bemerkung über Bertrands eunuchenhaftes Gebaren gemacht – mehr als einmal hatte er es ihm sogar direkt ins Gesicht gesagt, doch der dumme Kerl kicherte dann nur, als wäre alles ein Scherz. Seine Manieren mochten kindisch sein, doch der Bursche war gar nicht mehr so jung; sein fettiges Haar, das er stets mit zwanghafter Sorgfalt scheitelte und glättete, ergraute oben auf dem Schädel bereits. Die Gattin des Colonels war Bertrands Cousine ersten Grades, und es erzürnte ihn nach wie vor, dass seine drei Kinder blutsverwandt mit einem solch hirnlosen Trampeltier waren.
»Da kommt sie!«, informierte Mr Willberg, der zum Fenster hinausspähte.
Bertrand kniff die Augen zusammen, denn ihm war vor dieser Aussicht von Anfang an bang gewesen. Er war nur deshalb hier zugegen, weil seine Tante Gertrude just an diesem Morgen gekniffen hatte und für diese Zeremonie der Zigeunerin zufolge sieben Personen nötig waren.
Mrs Grenville stand auf, wobei sie an den Perlen ihrer eng anliegenden Halskette herumnestelte, und erblickte den Lichtschein einer Kutsche, die sich durch den Garten näherte. Die Nacht war so dunkel, der Himmel so dicht mit Wolken verhangen, dass es aussah, als glitte der Wagen inmitten einer endlosen Leere dahin.
Sie trat näher ans Fenster. Dabei streifte sie versehentlich mit der Schulter die von Mr Willberg, worauf sie beide zusammenzuckten. Sie bemerkte, dass der Mann sich stark verändert hatte, und auch die ihn ständig begleitende Bierfahne war stärker als üblich.
Der Colonel schob sie brüsk beiseite, um einen Blick nach draußen zu werfen. Dort sah er, wie Holt, sein korpulenter Hausdiener mittleren Alters, vom Kutschbock sprang und einer Gestalt herunterhalf, die aussah wie ein Bündel extravaganter Vorhänge.
Kurz darauf betrat Holt den Salon, und als nach ihm die Zigeunerin eintrat, erstarrten sämtliche Anwesenden. Sie benötigten allesamt einen Moment, um die Frau zu mustern, und selbst der Colonel musste einräumen, dass sie etwas Irritierendes an sich hatte.
Die Frau war untersetzt, kräftig gebaut und in zahllose Schals, Umschlagtücher und Schleier jeglicher Farbe gehüllt. Ihr Gesicht war kaum zu erkennen, da sie den Kopf mit einem Schleier aus schwarzem Tüll umhüllt hatte, der mit billigen Pailletten besetzt war, die bei jeder ihrer Bewegungen leise klimperten. Die vielen Stofflagen sonderten einen stechenden pflanzlichen Geruch ab, der so kräftig war, dass er den der wabernden Rauchschwaden überdeckte. Ihre Hände steckten in schwarzen, fingerlosen Handschuhen, sodass von ihr einzig und allein die Spitzen ihrer kräftigen, blassen Finger mit krallenartigen Fingernägeln zu sehen waren – sie bewegte sie langsam, so als trommele sie auf einen unsichtbaren Tisch.
Die junge Leonora sprang hoch, rannte auf die Frau zu und griff nach einer dieser bedrohlich wirkenden Hände.
»Madame Katerina, es ist mir eine Ehre! Ich wusste, dass Sie kommen würden.«
»Zu denen, die mich brauchen, komme ich immer«, erwiderte sie mit heiserer, fremdländisch klingender Stimme.
»Oder zu denen, die Sie bezahlen«, zischte der Colonel zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
Leonora wandte sich ihm zu und machte Anstalten, eine scharfe Erwiderung zu geben, doch die Zigeunerin fasste ihren Arm.
»Lassen Sie es gut sein, Kind. Dieser Raum ist ohnehin schon in ziemlichem Aufruhr.«
»Oh, aber ich habe ihn doch gereinigt, wie Sie es wünschten, Madam! Wie Grannie Alice es auch getan hätte.«
Der Colonel trat auf Holt zu und bellte ihn an: »Warum hast du so lange gebraucht?«
Holt öffnete gerade den Mund, um etwas zu erwidern, als die Zigeunerin auch schon selbst Antwort gab.
»Ich war noch mit etwas anderem beschäftigt.«
Der Colonel stieß ein lautes »Ha!« aus, was die Zigeunerin jedoch ignorierte. Stattdessen zog sie einen ihrer Fingerlinge aus, legte die Handfläche an die Wand und strich langsam damit über die Eichenvertäfelung. Ihre langen, schwarz lackierten Fingernägel schimmerten im Lichtschein der Kerzen. Dann wandte sie sich Leonora zu.
»Sie haben Recht getan, Mädchen. Wir können die Rituale hier durchführen … aber nur gerade so eben.« Sie trat näher an den Tisch mit den Kerzen heran, und nun durchdrang das Licht den dünnen Stoff ihres Schleiers, und alle erblickten das Funkeln ihrer listig schauenden Augen, mit denen sie einen nach dem anderen musterte. Erst als sie sie alle studiert hatte, ergriff sie wieder das Wort. »Ja, nur gerade so. Hier lastet zu viel Schuld.«
Ihre Worte bewirkten, dass mehr als einer der Anwesenden schluckte.
»Die Stühle, Bertrand!«, blaffte Mr Willberg, worauf der zappelige Mann zusammenfuhr und dann damit begann, Stühle aus dem angrenzenden Speisezimmer hereinzuschleifen. Das Quietschen des Holzes auf dem Fußboden war für den alten Mr Shaw so unerträglich, dass seine Enkeltochter zu ihm gehen und ihm die Hand halten musste.
Leonora führte Madame Katerina an den runden Tisch. »Wir haben die Bediensteten weggeschickt, Ma’am. Sie haben alle schon vor Sonnenuntergang das Haus verlassen, genau wie Sie es sich erbeten hatten.«
Die Frau warf einen anerkennenden Blick auf den Tisch und nickte zustimmend.
Bertrand stellte den siebten Stuhl an den Tisch, und Leonora bot der Zigeunerin so ehrerbietig einen Sitzplatz an, als hätte sie es mit Queen Victoria persönlich zu tun. Die Frau nahm Platz, während Bertrand ein Stativ hereinbrachte und es ungeschickt am Fenster aufstellte.
»Wofür ist das?«, fragte sie. »Eine Kamera?«
Mit vor Begeisterung funkelnden Augen setzte sich Leonora neben sie. »Oh, bitte, bitte tun Sie mir den Gefallen, Ma’am. Ich möchte Photographien von dieser Sitzung machen. Ich habe gelesen, dass die Geister manchmal auf den Platten sichtbar sind.«
Die Zigeunerin blieb stumm, ihre Miene war unergründlich.
»Von derlei habe ich noch nie gehört«, sagte sie schließlich.
»Hinterlassen Sie nicht gerne Beweise?«, fragte der Colonel, der neben der Hellseherin saß und mit herablassender Miene an seiner Zigarre schmauchte.
Die Zigeunerin legte beide Hände auf den Tisch, so als wolle sie unter Beweis stellen, dass sie Herrin der Lage war. »Nicht mehr als Sie auch, kleiner Mann.«
Der Colonel machte Anstalten, sich von seinem Stuhl zu erheben, worauf ihm die Zigarre zu Boden fiel. Es war Mr Willbergs Hand, die ihn wieder hinunterdrückte.
»Hören Sie jetzt auf damit, Grenville? Ausgerechnet Sie …«
»Oh, sparen Sie sich die Worte, Pete!«
Mrs Grenville setzte sich neben ihren Gatten, sagte jedoch kein Wort. Sie wusste, dass ihn jeder Versuch, ihn zu besänftigen, nur noch weiter aufbringen würde.
»Haben Sie die Opfergaben?«, fragte die Zigeunerin.
»Selbstverständlich!«, versicherte Leonora, bereits zu einem Beistellschrank unterwegs. Sie kehrte mit einer Karaffe aus geschliffenem Kristall zurück, worauf Holt ein Schauer über den Rücken lief, denn es hatte den Anschein, als enthielte sie Blut.
Als würde sie seine Unruhe spüren, wandte sich die Hellseherin ihm zu. »Er muss gehen.«
Der Colonel stieß einen ungeduldigen Seufzer aus, stand auf und schleifte Holt aus dem Salon. Dem Hausdiener war das nur recht.
»Hier«, sagte der Colonel und zog ein großzügig bemessenes Bündel Geldscheine aus seiner Tasche. »Das ist mehr, als ich versprochen hatte. Falls Sie vorhaben, es für Bier oder Frauen auszugeben, dann sorgen Sie dafür, dass es nicht heute Abend geschieht, denn ich brauche Sie morgen früh wieder hier.«
»Selbstverständlich, Sir«, erwiderte Holt, vermochte seinen Drang, das Geld zu zählen, dabei jedoch kaum zu unterdrücken. »Um welche Zeit benötigen Sie mich wieder hier?«
»Bei Tagesanbruch«, erwiderte Greenville und packte Holt dann am Kragen. »Keine verdammte Minute später. Je eher dieser ganze Abschaum aus dem Haus ist, desto besser.«
Holt hatte immer schon das Bedürfnis verspürt, diesem Mann ins Gesicht zu spucken, aber der Colonel bezahlte ihn stattlich, sodass er sich schlichtweg verbeugte.
»Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir.«
Colonel Grenville richtete sich sein Jackett, warf Holt einen warnenden Blick zu und kehrte in den Salon zurück.
Bevor er die Tür hinter sich zuzog, bemühte sich Holt, noch einen letzten Blick auf die junge Leonora zu erhaschen, die gerade damit beschäftigt war, die photographische Kamera aufzustellen. Dabei erblickte er auch die nervösen Gesichter derer, die um den Tisch versammelt saßen, und die dunkle Flüssigkeit in der Karaffe zwischen den Kerzen.
Schließlich steckte er das Geld ein und ging auf direktem Weg zum Wagen. Während er durch das Gartentor schritt, warf er einen letzten Blick auf die Hausfront. Er sah einen grellen Lichtblitz aus dem Fenster des Salons dringen, sicher vom Blitzpulver der Kamera. Danach wurde der Raum so dunkel wie ein Grab, wie es alle anderen Räume in dem ansonsten menschenleeren Haus auch waren. Holt glaubte, ein heiseres, tiefes Knurren aus dem Salon dringen zu hören, und prompt lief ihm ein Schauer über den Rücken.
Der Colonel hatte ihm zwar nichts von diesem Treffen erzählt, doch Holt kannte die Familie nur zu gut. In diesem Raum würde etwas Ungeheuerliches geschehen. Etwas, was viel zu grauenhaft war, als dass man es offen aussprechen würde.
Je weniger er wusste, desto besser.
TEIL 1
Das Verbrechen
Ausschnitt aus The Scotsman
Samstag, 14. September 1889, Nachmittagsausgabe
GRAUEN BEI TAGESANBRUCH IN MORNINGSIDE: SECHS TOTE!
Blankes Entsetzen herrschte im vornehmen Viertel Morningside bei Tagesbeginn, als Mr Alexander Holt, persönlicher Hausdiener des berühmten Colonel James R. Grenville, das Haus seines Dienstherrn betrat und sich ihm ein absolut grauenvoller Anblick bot.
Sechs Leichen, darunter die seines Herrn, lagen im großen Salon des Hauses. Mr Holt entdeckte sie etwa um 7 Uhr 45 morgens, als er zurückkehrte, um sich den morgendlichen Bedürfnissen seines Herrn zu widmen.
Nachdem sie vom entsetzten Mr Holt benachrichtigt worden waren, eilten Polizeibeamte an den Ort des Schreckens. Es gab keinerlei Anzeichen von Gewalt oder Verstümmelung, und die Polizei konnte die Todesursache bislang noch nicht ermitteln. Alle Leichen wurden in das Präsidium desCIDüberführt, eine forensische Untersuchung steht noch an.
Verblüffender noch ist, dass eine siebte Person, eine Ausländerin mittleren Alters, bewusstlos unter den sechs Toten lag. Ursprünglich als siebtes Opfer betrachtet kam die kräftig gebaute Dame wieder zu sich und erwies sich wie durch ein Wunder als unversehrt. Der Schreiber dieser Zeilen sah mit eigenen Augen, wie die fragliche Frau aus dem Domizil der Grenvilles kam, ohne fremde Hilfe und ohne jedwedes Anzeichen einer Verletzung oder Erkrankung.
Ihre Identität wurde als Madame Katerina, wohnhaft in Cattle Market Nr. 9, bestätigt. In den weniger reputierlichen Kreisen von Edinburgh hat sie sich mit ihrem florierenden Geschäft als Wahrsagerin einen Namen gemacht. Man geht davon aus, dass der ehrenwerte Colonel Grenville und seine vornehmen Gäste einer Séance beiwohnten, die von der oben genannten Frau angeleitet wurde. Mr Holt lehnte es ab, dies zu bestätigen.
Hauptverdächtige ist nun logischerweise die eigentümliche Ausländerin, die während der Untersuchung des ruchlosen Verbrechens in Polizeigewahrsam bleiben wird.
Unter den Anwohnern werden bereits Rufe nach Gerechtigkeit laut. Colonel Grenville war ein hochangesehenes Mitglied der Gesellschaft. Er bleibt insbesondere wegen seiner Tapferkeit und seines Heldenmuts in Erinnerung, die er während der jüngsten Militäreinsätze im südlichen Afrika bewies. Die vollständige Liste mit den Namen der Opfer wurde zwar noch nicht veröffentlicht, doch ist davon auszugehen, dass sich unter den weiteren Todesopfern die Gattin des braven Colonels sowie einige Mitglieder seines erweiterten Familienkreises befinden. Colonel Grenville hinterlässt drei kleine Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren.
Der vor Kurzem zum Superintendent desCIDernannte Robert Trevelyan wollte keine weiteren Details preisgeben. Der Schreiber dieser Zeilen vernahm jedoch aus sehr zuverlässiger Quelle, dass der Fall wohl in den Verantwortungsbereich des hiesigen Detectives Adolphus McGray fallen dürfte, im Volksmund bekannter als »Nine-Nails«.
1
Sonntag, 15. September 1889
4.45 Uhr
Gloucestershire
Mir war klar gewesen, dass die Fahrt mit der Kutsche eine Tortur werden würde, aber aufgrund der Leiche wurde alles nur noch schlimmer.
So wie er an mir lehnte, die bleichen Hände auf dem Schoß ruhend, die Melone nach wie vor auf dem Kopf, hätte er wie ein ganz normaler Fahrgast durchgehen können. Ich betrachtete sein Gesicht. Der Kopf war leicht nach vorne gebeugt und schwankte sanft hin und her, den holprigen Bewegungen der Kutsche folgend. Seine Wangen waren grau und eingefallen, ja sogar geädert, und dunkle Ringe umgaben seine geschlossenen Augen. Davon abgesehen erweckte er den Eindruck, als wäre er einfach nur eingedöst, als erhole er sich geistig und warte darauf auszusteigen und nach einer Zigarre und einem heißen Bad zu verlangen.
Ich hüllte mich in meinen Mantel, da mir so kalt war, wie er es war, und ich war auch kaum weniger bleich als er. Ich war sogar versucht, ihn in eine der Decken zu hüllen, die unter den Sitzen aufbewahrt wurden, begriff dann aber, wie närrisch das gewesen wäre.
Letztendlich beugte ich mich lediglich ein wenig weiter vor und streckte den Arm aus, um ihm den zerknautschten Hut zu richten.
Und da öffnete er die Augen.
Wie von der Tarantel gestochen fuhr ich hoch, schnappte nach Luft und spürte, wie mir der kalte Schweiß die Schläfen hinabrann.
Mein Schlafzimmer war nicht minder düster, wie es mein Traum gewesen war. Nur ein winziger Streifen Mondlicht schien durch einen kleinen Spalt zwischen den Vorhängen herein. Nach wie vor sah ich die glasigen Augen meines Onkels vor mir, so deutlich, als schwebten sie direkt vor meinem Gesicht. Ich hastete zur Gaslampe, und sobald ihr sanfter Lichtschein meine Kammer erleuchtete, stieß ich einen Seufzer der Erleichterung aus.
Auf der Kaminuhr sah ich, welch unchristliche Zeit es war. Frustriert rieb ich mir die Augen, da mir klar war, dass ich nicht wieder würde einschlafen können. Ich spielte mit dem Gedanken, Layton um einen Tee zu bitten, unterließ es dann aber, denn auch mein betagter Hausdiener hatte eine schwere Zeit durchgemacht. Im Übrigen hatten heiße Getränke meine allgemeine Stimmung schon in den letzten Tagen kaum verbessern können. Nichtsdestotrotz stand ich auf und zog die Vorhänge beiseite, um durch das Fenster zu linsen. Vor mir öffneten sich über viele Meilen hinweg im Dunkel liegende Ländereien und Wald: das große Anwesen meines Onkels – meines verstorbenen Onkels.
Es war eine friedliche, sternenklare Nacht, in der das Mondlicht wunderschöne blaue und silberne Schatten auf die Landschaft warf.
Genau wie es in jener schrecklichen Nacht in den Highlands gewesen war. In der Nacht, in der meinen Onkel inmitten dieses grausigen Lichtscheins von Fackeln der Tod ereilt hatte.
Ich schüttelte den Kopf und wandte mich von diesem Anblick ab, damit sich diese Bilder nicht ihren Weg in meinen Kopf bahnten, wie sie es seitdem fast jede Nacht taten.
Ich betrachtete den Stapel angelesener Bücher auf dem Nachttisch und streckte die Hand nach einem davon aus, hielt jedoch inne, noch bevor ich es berührt hatte. Ich war es leid, stundenlang immer dieselben Seiten anzustarren, ohne die Worte aufnehmen zu können, oder um mich urplötzlich zehn Seiten weiter wiederzufinden ohne auch nur die geringste Erinnerung daran, was ich gerade gelesen hatte.
Da ich sonst nichts mit mir anfangen konnte, tigerte ich die folgende Stunde auf und ab.
»So muss es Nine-Nails jede Nacht ergehen«, murmelte ich irgendwann. Ob auch er Alpträume hatte? Ob er nach wie vor von seinen toten Eltern träumte oder von dem Moment, als ihm seine geistesgestörte Schwester den Finger abgehackt hatte?
Ich hatte seine Korrespondenz ignoriert, seine Briefe und Telegramme nicht einmal geöffnet, insgeheim darauf hoffend, dass er meiner überdrüssig werden und mich entlassen würde, weil ich nicht reagierte. Doch ein solches Glück, das wusste ich, würde mir niemals zuteilwerden.
Als der Himmel allmählich aufklarte, klopfte es leise an meiner Tür. Es war der hochaufgeschossene, knochendürre Layton, der mir bereits meinen morgendlichen Kaffee brachte. Die Ringe unter seinen Augen verrieten mir, dass auch er eine schlaflose Nacht hinter sich hatte. Das war kein Wunder, denn bevor er in meine Dienste gekommen war, hatte er über zehn Jahre lang Onkel Maurice gedient und war von seinem Tod ebenfalls furchtbar betroffen.
Während er das Service aufdeckte und noch bevor ich eine Bemerkung zu der noch frühen Stunde machen konnte, deutete er mit seiner langen Adlernase auf das Fenster.
»Wie es scheint, bekommen Sie Besuch, Sir.«
Ich trat erneut ans Fenster und sah, dass sich eine Kutsche in vollem Tempo näherte. Sie wurde von vier Pferden gezogen, sodass es sich um einen echten Notfall handeln musste. Kurz darauf erreichte der Wagen das Herrenhaus meines Onkels, und genau in dem Moment, in dem Layton mir eine Tasse Kaffee reichte, sah ich eine unverwechselbare Gestalt aussteigen.
»Was bin ich doch für ein Glückspilz!«, murrte ich.
»Soll ich ihn hereinlassen, Sir?«
»Selbst wenn Sie es nicht täten, würde er einen Weg hereinfinden«, prophezeite ich. Kaum hatte ich den Satz beendet, sah ich auch schon, wie Nine-Nails die Eingangsstufen hinaufstieg und die Tür aufstieß.
»Sagen Sie dem Personal, sie sollen ab sofort diese Tür verriegeln!«, wies ich Layton an. Prompt konnte ich meinen verstorbenen Onkel geradezu aufschreien hören: »Die Türen verriegeln? Wir sind hier in England!«
Im nächsten Augenblick führte Layton McGray in meine Schlafkammer.
Eigentlich war ich den Anblick seiner ungepflegten Bartstoppeln gewohnt, seiner grellen und zerknitterten Kleidung und seines Haars, das so zerzaust war, als wäre er durch einen Schneesturm geritten. Doch umrahmt von meinen altertümlichen Läufern und Möbeln wirkte er so deplatziert wie ein borstiges Moorhuhn, das in einem Korb mit feiner Wäsche gelandet war.
»Sie sehen schrecklich aus, so viel steht fest«, konstatierte ich.
McGray legte die Stirn in Falten. »Och, ich bin ja auch die ganze Nacht über unterwegs gewesen! Sie, in Ihrem seidenweichen Frauenhemd und gerade dem Bett entstiegen, sehen noch verdammt viel schlechter aus.«
Es wäre sinnlos gewesen, mich mit ihm herumzustreiten. Mein Schlafrock war tatsächlich aus Seidendamast.
»Genug der Spitzfindigkeiten«, sagte ich. »Genehmigen Sie sich einen Kaffee.«
Er rümpfte die Nase. »Haben Sie nichts Stärkeres?«
»McGray, es ist erst kurz nach sechs Uhr morgens!«
»Und damit wollen Sie sagen, dass …?«
Layton verbeugte sich und zog los, um ihm etwas Hochprozentiges zu holen.
McGray fläzte sich auf einen der beiden Sessel, streckte seine langen Beine und Arme aus und warf einen prüfenden Blick auf die Eichenvertäfelung und das Himmelbett.
»Das ist ja ein schöner Schutthaufen, auf dem Sie da geruht haben, Frey! Passt irgendwie zu Ihrer verfluchten Vornehmtuerei.« Er schnalzte mit der Zunge. »Irgendwie.«
Ich quälte mir ein Lächeln ab, setzte mich und nippte an meinem Kaffee.
»Ich habe hier viele glückliche Weihnachtsfeste verbracht«, war alles, was ich über die Lippen bringen konnte.
McGray nickte. »Also … gehört das jetzt alles Ihnen?«
Das war eine berechtigte Vermutung. Onkel Maurice hatte nie geheiratet, und das einzige Kind, das er gezeugt hatte (soweit er es mir erzählt hatte), war sehr jung gestorben.
»Mein Onkel hat mir dies mehr als nur einmal gesagt. Wenn man allerdings bedenkt, wie er … war, dann hat er seine Erbangelegenheiten womöglich nicht in Ordnung gebracht. Mein Bruder Laurence könnte einen Prozess anstrengen, um seinen Anteil zu bekommen.«
»Laurence? Etwa der Idiot, wegen dem Ihre Verlobte Sie sitzengelassen hat?«
Mit einem Klirren stellte ich meine Tasse auf der Untertasse ab. »Müssen Sie dazu immer eine Bemerkung machen? Sie wissen verdammt genau, wer er ist.«
»Na, kommen Sie! Kein Grund, so herumzumaulen. Was ist mit Ihren jüngeren Brüdern?«
»Elgie und Oliver waren nicht mit ihm blutsverwandt.«
»Och, richtig! Deren Mum ist Ihre Zicke von Stiefmutter.«
»Allerdings. Und selbst wenn sie einen Rechtsanspruch hätten, bezweifle ich, dass sie daran interessiert wären, ein Gut wie dieses zu verwalten. Elgie ist zu sehr Künstler und nicht eben praktisch begabt. Und Oliver ist … eben Oliver.«
In diesem Moment kehrte Layton zurück und brachte für McGray eine Karaffe Single Malt, aus der er bereits eine großzügige Portion in einen Tumbler eingeschenkt hatte.
»Die Beerdigung haben Sie hinter sich, vermute ich.«
Ich stieß einen lang anhaltenden Seufzer aus. »Die traurigste Angelegenheit, die Sie sich nur vorstellen können. Elgie war der einzige meiner Verwandten, der daran teilgenommen hat. Alle anderen waren Gläubiger und Pächter meines Onkels, die mehr daran interessiert waren zu fragen, ob sein Tod sich negativ auf ihre Geschäfte auswirken würde.«
Womöglich betroffen von dem, was ich gesagt hatte, verließ Layton diskret den Raum.
Ich massierte mir die Stirn. »McGray, ich muss mich im Moment um unzählige Angelegenheiten kümmern. Es tut mir leid, dass Sie den ganzen Weg auf sich nehmen mussten, aber Sie werden verstehen, dass es mir nach dieser Sache nicht möglich ist, nach Schottland zurückzukehren.«
Da ich einen seiner für ihn typischen Ausbrüche erwartete, schaute ich ihn zunächst gar nicht an. Doch er sagte nichts, und als ich ihm dann meinen Blick zuwandte, erkannte ich, dass er sich auf die Lippen biss. Der ungehobelte, unzerstörbare Nine-Nails McGray wirkte zum ersten Mal zaghaft und nervös.
»Ich fürchte, Sie müssen.«
Eine tiefe Stille schloss sich seinen Worten an, was meine Besorgnis zunehmend wachsen ließ.
»Was … was meinen Sie damit?«
McGray hätte nicht düsterer klingen können. »Der Premierminister will unsere Unterabteilung bestehen lassen. Und wir sollen uns bereithalten.«
»Die höchst illustre Kommission zur Aufklärung ungelöster Fälle mit mutmaßlichem Bezug zu Sonderbarem und Geisterhaftem?«, rief ich, wobei mir der nicht enden wollende Name leicht über die Lippen ging. »Warum um alles in der Welt sollte irgendwer, geschweige denn der Premierminister, Interesse daran haben, diesen Misthaufen bestehen zu lassen?«
Ich rechnete damit, dass Nine-Nails nun über mich herfallen würde. Immerhin war diese Unterabteilung sein Baby und nur aus einem Grund ins Leben gerufen worden: nämlich um herauszufinden, was seine Schwester in den Wahnsinn getrieben hatte, und er finanzierte sie auch fast gänzlich aus seiner eigenen Tasche. Doch er blieb stumm, was mir die Zeit verschaffte, allmählich selbst auf den Trichter zu kommen.
Ich beugte mich zu ihm vor, vergrub das Gesicht in den Händen und murmelte: »Die Sache in Lancashire?«
»Schon möglich …« McGray kippte seinen Drink mit einem einzigen Schluck herunter. »Verdammt, ich kann Sie nicht belügen. Ich weiß es sicher. Ich habe mit dem neuen Superintendent gesprochen. Er hat einen Brief vom Premier persönlich bekommen. Lord Salisbury hat keine Erklärungen abgegeben, sondern ihn bloß angewiesen, unsere Abteilung zu erhalten.«
Augenblicklich stand ich auf und begann auf und ab zu gehen.
Im vergangenen Januar, als uns die Ermittlungen in einem anderen Fall bis nach Lancashire verschlagen hatten, waren wir zufällig darauf gestoßen, dass der Sohn des Premierministers regen Umgang mit einem sogenannten Hexenzirkel pflegte – nun, McGray nannte die Gruppe jedenfalls so. In meinen Augen handelte es sich lediglich um hinterlistige Schmugglerinnen und Scharlatane, so gefährlich und einflussreich, dass die Borgias neidisch auf ihre Organisation gewesen wären. Mittlerweile war klar, dass ihnen auch Lord Salisbury persönlich »Gefälligkeiten« schuldete.
McGray bemühte sich, mich zu besänftigen. »Es ist vielleicht gar nichts, Frey. Vielleicht will uns Salisbury bloß als Vorsichtsmaßnahme in der Hinterhand behalten.«
Ich stieß ein lautes Lachen aus. »Oh natürlich, es ist nichts! Glauben Sie das ruhig, McGray, wenn es Sie glücklich macht.«
Irgendwie ahnte ich bereits, dass Lord Salisbury und seine dubiosen Angelegenheiten uns erneut vor die Füße fallen würden – und das sollte sich als einer der übelsten Alpträume unseres Lebens erweisen. Allerdings würde das noch eine Weile dauern.
»Frey«, begann Nine-Nails und schaute nun noch düsterer drein, falls so etwas möglich war, »ich bin aus einem anderen Grund gekommen.«
»Einem anderen Grund!« Ich langte nach der Karaffe und »verstärkte« meinen schwarzen Kaffee – ungeachtet der Tageszeit. »Ein noch schlimmerer Notfall? Vielleicht ein Ausbruch der Beulenpest?«
Er kramte in seiner Brusttasche.
»Es ist ein echter Notfall. Die Uhr tickt.«
»Ach, tatsächlich? Wer wird denn das Zeitliche segnen?«
Nine-Nails verzog das Gesicht und zog dabei ein Stück Zeitung hervor. »Madame Katerina.«
Noch bevor er zu Ende gesprochen hatte, hatte ich meine Tasse bereits halb heruntergekippt.
»Nanu, Ihre schwindlerische Hellseherin?«
»Aye.«
»Die zufällig auch toxisches Ale braut, um fahrenden Händlern damit das Augenlicht zu rauben? Sie steckt in Schwierigkeiten? Nun sieh mal einer an, wie verflucht unerwartet!«
»Es ist wirklich eine heikle Sache, Frey«, knurrte McGray und entfaltete das Blatt auf dem Tisch. »Die bringen ihren Fall vielleicht vor den High Court. Sie könnte am Galgen enden!«
Ich schnaubte. »Ein elendiges, verkommenes Leben, auf das ein früher Tod folgt? Tja, genau das passiert eben, wenn man nach Schottland zieht.«
»Frey …«
»Und wenn sie einen dann in den Sarg betten und unter die Erde bringen, ist es dort wärmer, als man es vorher je erlebt hat.«
»Och, ich hatte vergessen, dass Sie herumjammern können wie Ophelia, wenn Sie in Stimmung dafür sind!«
»Und sechs Fuß unter der Erde ist außerdem der sicherste …«
»Frey, können Sie mal einen Moment die Klappe halten und das hier lesen?«
Ich schnappte mir den Zeitungsausschnitt und wollte ihn in die Glut werfen. Doch bevor ich das Papier zerknüllen konnte, sprangen mir die reißerisch großen Buchstaben der Schlagzeile ins Auge.
2
»Haben Sie sie verhört?«, fragte ich, während wir aus dem Herrenhaus traten. Ich war immer noch verblüfft, wie rasch es mir gelungen war, mein Gepäck zusammenzuraffen.
»Nein, man hat sie direkt ins …«
»Haben Sie sich zum Haus dieses Grenville begeben?«
»Noch nicht. Ich …«
»Konnten Sie denn wenigstens ein Wörtchen mit diesem Kammerdiener wechseln? Oder mit den Officers, die er gerufen hatte?«
»Nein! Frey, ich …«
»Oh, um Himmels willen, Nine-Nails! Was haben Sie denn überhaupt unternommen?«
Er versetzte mir einen Schlag auf den Hinterkopf. »Ich versuche verdammt noch mal Ihnen zu erklären, dass ich bislang für gar nichts Zeit hatte! Der verfluchte neue Superintendent wollte, dass ich als Erstes zu Ihnen fahre, um Sie zu holen. Er hat wörtlich gesagt: Bringen Sie Ian Percival Frey her, sonst …«
»Was denn? Er bittet Sie hierherzufahren obwohl doch ein Verbrechen wie dieses untersucht werden muss?«
Er wölbte beide Hände zu einer Art Waagschale. »Ein dringender Brief vom Premierminister … Das Leben einer dubiosen Zigeunerin retten …«
»Ich verstehe. Wissen Sie wenigstens, ob man die Leichen ordnungsgemäß …«
»Frey, was zur Hölle … Wollen Sie etwa Stein für Stein Ihres beschissenen neuen Herrenhauses mitnehmen?«
Was er andeutete, war nicht ganz so weit hergeholt. Die Bediensteten brachten gerade drei weitere meiner Schrankkoffer zu der bereits schwer beladenen Kutsche.
»Ich war aus Edinburgh mit meinem gesamten Hab und Gut weggezogen. Ich hatte nicht die Absicht, jemals zurückzukehren. Ich habe sogar meine Miete bei Ihrer geliebten Lady Glass beglichen.«
McGrays Kinnlade klappte herunter. »Sie sind auf Nimmerwiedersehen dort weg, Sie kleiner glibberiger Schleimbeutel?«
»Lady Anne wird mich womöglich genauso titulieren, wenn ich ihr eröffne, dass ich die Immobilie erneut beziehen will. Und ich bin mir sicher, dass sie den Preis verdreifachen wird.«
In diesem Moment trat Layton an mich heran. »Sir, wie sollen wir mit Ihrer Stute verfahren? Der Stallbursche sagt, er wird eine Weile brauchen, bis …«
»Sie haben auch Philippa mitgenommen?«, kreischte McGray förmlich.
»Ich sagte doch gerade, ich hatte keinerlei Absicht …«
»Och, vergessen Sie’s. Sie können sie später nachholen lassen. Sie werden ohnehin nicht viel reiten können. Das Wetter wendet sich bereits zum Schlechteren.«
Ich blies die Backen auf. »Nicht nur das Wetter …«
Ich wusste, dass die Kutschfahrt schrecklich werden würde, aber McGrays Unbehagen gestaltete sie nur noch übler. Immer wieder las er den Zeitungsausschnitt vor, wobei er jedes Mal eine andere Passage betonte und eine neue Spekulation äußerte. Zum Glück dauerte die Fahrt zum Bahnhof von Gloucester nicht allzu lang, und von dort an fiel es mir wesentlich leichter, Nine-Nails zu ignorieren, auch wenn wir den letzten Zug nach Schottland verpassten.
Um sicherzustellen, dass wir den ersten Zug am nächsten Morgen erwischen würden, verbrachten wir die Nacht in Gloucester. McGray war natürlich darauf versessen, sich mit mir zu unterhalten, aber ich erteilte seiner Offerte, ein Schlückchen Whisky zu trinken, kategorisch eine Abfuhr und schloss mich in einem separaten Raum ein. Immerhin war der Gasthof des Bahnhofs sauber und ausgesprochen komfortabel.
Am nächsten Tag fuhr der Zug nach Schottland mit erheblicher Verspätung ab. Im verrußten Birmingham mussten wir umsteigen und uns wie wahnsinnig abhetzen, um den Anschlusszug noch zu erwischen. Dabei purzelte sogar einer meiner Koffer auf die Schienen und wäre um ein Haar aufgesprungen. Der zweite Teil der Reise gestaltete sich sogar noch übler, denn unser Zug blieb fast drei volle Stunden lang am Stadtrand von Carlisle stehen, ohne dass dafür eine Erklärung abgegeben wurde. Als wir in Edinburgh ankamen, ging bereits die Sonne unter.
Sobald wir aus dem Waggon stiegen, wurde mir klar, dass ärgerlicherweise pünktlich der Herbst einsetzte. Die Bäume der Princes Street Gardens warfen bereits ihre Blätter ab, und der Wind trug von Nordosten eine beißende Kälte herbei. Bitter betrachtete ich die gleichmäßige Schicht aus grauen Wolken, die womöglich bis April keinen einzigen Sonnenstrahl durchlassen würden. Das gedrungene Castle auf seinem zerklüfteten Berg ließ mich an einen dicklichen alten Mann in einem braunen, verrußten Tweed denken, der sich in einem Sessel räkelte und Pfeife rauchte, während er die Zeitalter verstreichen ließ.
»Da wäre ich also wieder«, konstatierte ich und stieß einen resignierten Seufzer aus, während ich mich enger in meinen Mantel hüllte. »Entgegen jeder Erwartung …«
Ich schickte Layton mit meinem gesamten Hab und Gut zur Great King Street und bezahlte einen kleinen Jungen dafür, Lady Anne Ardglass eine Nachricht zu überbringen.
»Sie bitten dieses alte Miststück, Ihren Hausdiener hereinzulassen?«, fragte McGray. Er war ganz ohne Gepäck gereist, und ich beneidete ihn um seine beschwingte Gangart.
»So ist es. Ich würde es ja mit einer anderen Unterkunft versuchen, aber sämtliche respektablen Immobilien in dieser heruntergekommenen Stadt gehören ihr.«
»Falls sie Sie nicht wieder aufnimmt, können Sie ein Weilchen bei mir am Moray Place unterkommen. Joan würde sich über Ihre Anwesenheit freuen.«
Bei der Erwähnung ihres Namens konnte ich ein Seufzen nicht unterdrücken. Joan war acht Jahre lang meine Haushälterin gewesen, bis sie McGrays schon etwas in die Jahre gekommenen Butler George kennengelernt und beschlossen hatte, mit ihm in Sünde zu leben. Nach wie vor vermisste ich ihren Kaffee, ihre köstlichen Braten und manchmal sogar ihren respektlosen Klatsch.
In diesem Moment schlug die Bahnhofsuhr neunzehn Uhr.
»Es ist zu spät, um noch zu den City Chambers zu fahren«, stellte ich fest.
»Wohl wahr. Heute werden wir auf keinen Fall mehr etwas Sinnvolles erreichen können. Aber wir haben noch Zeit, um Katerina zu besuchen.«
Ich stieß erneut einen Seufzer aus, denn die Vorstellung, diese Frau zu treffen – wieder einmal –, versetzte mich nicht gerade in Begeisterung. Und in den folgenden Wochen würde ich weit häufiger mit ihr sprechen, als ich es mir je gewünscht hätte.
»Dann sputen wir uns lieber.«
»Nein, nur die Ruhe. Ich habe mit den Burschen in Calton Hill ein paar Vereinbarungen getroffen.«
»Calton – sitzt sie bereits im Gefängnis von Calton Hill ein?«
»Aye, zu ihrer eigenen Sicherheit. Die haben sie erst in den City Chambers untergebracht, aber als dann der Artikel im Scotsman erschien, bekamen wir es mit einem Mob aus sabbernden Idioten zu tun, die einen Blick auf sie erhaschen wollten. Einige der Trunkenbolde haben sogar Steine auf das Gebäude geworfen.«
»Du lieber Himmel. Wenn wir nicht aufpassen, wird dieser Fall ein öffentliches Spektakel werden.«
»Um das zu verhindern ist es vielleicht schon zu spät, Percy.«
Das Gebäude, in dem sich das Gefängnis von Calton Hill befand, führte den Betrachter auf eine falsche Fährte.
Mit seinen Rundtürmen, die von einem Gemälde von Camelot hätten stammen können, umschlossen von wehrhaften Mauern und mit einem Tor, das von mittelalterlich anmutenden Zinnen umgeben war, hätte man es für ein Märchenschloss halten können. Zudem thronte es stolz auf der steil abfallenden Seite des Calton Hill, und selbst seine Adresse – Regent Road Nummer 1 – klang vornehm.
Nichts hätte weiter von der Realität entfernt sein können.
In den hoheitlichen Türmen befanden sich Residenz und Büroräume des Gouverneurs, und diese waren tatsächlich nobel. Die Flügel hingegen, in denen die Zellen lagen, waren schäbig, feucht und überbelegt und daher verständlicherweise gefürchtet bei denen, die auf die falsche Seite des Gesetzes geraten waren. Einige der zum Tode Verurteilten waren, während sie auf ihre Hinrichtung warteten, an die Wände gekettet.
Ich war nur ein einziges Mal dort gewesen, im Februar, als ein armseliger Gefangener behauptete, das mysteriöse Loch im Boden seiner Zelle wäre von einem steinefressenden Erdgeist aufgerissen worden. Dieses Märchen hatte sogar McGray ein Lachen entlockt – ich selbst lachte ebenfalls darüber, musste aber heftig schlucken, als ich erfuhr, dass in der Nasszelle des Gefangenen wie durch ein Wunder ein Stahllöffel aufgetaucht war.