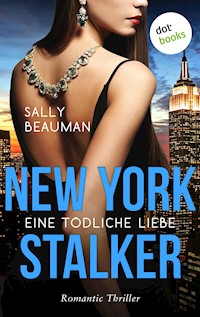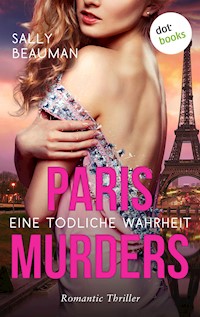0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hinter manch einer Tür verbirgt sich ein Abgrund: Die Familiensaga »Das Geheimnis von Winterscombe Manor« von Sally Beauman als eBook bei dotbooks. Es ist der lang erwartete 10. April 1910. Während die Familien Cavendish und Shawcross gebannt nach dem Halley’schen Kometen Ausschau halten, überschlagen sich die Ereignisse auf dem Anwesen Winterscombe: Eddie Shawcross wird tot aufgefunden – war es ein schrecklicher Unfall oder Mord? Wie ein Fluch lastet der ungeklärte Fall auf den Überlebenden … Viele Jahrzehnte später macht sich Victoria, die letzte Cavendish, auf die Suche nach der Wahrheit. Schon bald stößt sie auf ein finsteres Geheimnis, dessen Hüterin ihre Patentante Constance Shawcross zu sein scheint – eine Frau, die als eiskalte Femme Fatale gilt. Aber ist Constance wirklich die Einzige, die Schuld auf sich geladen hat? Erleben Sie, wie sich ein dunkles Familienschicksal entspinnt: »Fesselnd und rasant!« Observer Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der dramatische Schicksalsroman »Das Geheimnis von Winterscombe Manor« von Sally Beauman, auch bekannt unter dem Titel »Engel aus Stein«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1573
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Es ist der lang erwartete 10. April 1910. Während die Familien Cavendish und Shawcross gebannt nach dem Halley’schen Kometen Ausschau halten, überschlagen sich die Ereignisse auf dem Anwesen Winterscombe: Eddie Shawcross wird tot aufgefunden – war es ein schrecklicher Unfall oder Mord? Wie ein Fluch lastet der ungeklärte Fall auf den Überlebenden … Viele Jahrzehnte später macht sich Victoria, die letzte Cavendish, auf die Suche nach der Wahrheit. Schon bald stößt sie auf ein finsteres Geheimnis, dessen Hüterin ihre Patentante Constance Shawcross zu sein scheint – eine Frau, die als eiskalte Femme Fatale gilt. Aber ist Constance wirklich die Einzige, die Schuld auf sich geladen hat?
Erleben Sie, wie sich ein dunkles Familienschicksal entspinnt: »Fesselnd und rasant!« Observer
Über die Autorin:
Sally Beauman (1944–2016) war eine englische Autorin und Journalistin. Sie studierte in Cambridge Englische Literaturwissenschaft und war anschließend in England und den USA als Journalistin für viele angesehene Zeitschriften wie die »New York Times« und die »Vogue« tätig. Besonders bekannt ist sie für ihre acht international erfolgreichen Bestsellerromane, die in über zwanzig Sprachen übersetzt wurden.
Sally Beauman veröffentlichte bei dotbooks bereits »Rebeccas Geheimnis«, »Die Frauen von Wyken Abbey« und »Erben des Schicksals«.
***
eBook-Neuausgabe Mai 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1990 unter dem Originaltitel »Dark Angel« bei Bantam Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1991 unter dem Titel »Engel aus Stein« bei Blanvalet.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1990 by Sally Beauman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1991 by Blanvalet Verlag GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-100-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Geheimnis von Winterscombe Manor« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sally Beauman
Das Geheimnis von Winterscombe Manor
Roman
Aus dem Englischen von Charlotte Franke
dotbooks.
Meinen Eltern
Ronald und Gabrielle Kinsey-Miles,
in Liebe.
Das menschliche Herz ist der Ausgangspunkt für alle Belange des Krieges.
Moritz, Graf von Sachsen
Einfälle über die Kriegskunst, 1731
Teil Eins
Aus den Tagebüchern
Winterscombe, 2. April 1910
Wenn Männer unter sich sind, reden sie von Sex. Wenn Frauen unter sich sind, reden sie von Liebe. Was können wir aus diesem widersprüchlichen Verhalten schließen? Nun, daß Frauen Heuchlerinnen sind.
Mit Jarvis und zwei anderen gestern abend im Club. Bei der zweiten Flasche Portwein stellte ich ihnen eine Frage: Hatten sie je das Glück, einer Frau zu begegnen, die sie achten konnten? (Ich erlaubte ihnen, ihre Mütter auszuschließen. Denn wir wissen ja alle, daß Mütter ein Fall für sich sind.)
Nicht gerade Verfechter der weiblichen Intelligenz. Stelle ich fest – obwohl mich das kaum überraschte. Jarvis stellte weitschweifige Überlegungen über ihr vortreffliches Aussehen an: Davor habe er die höchste Achtung, erklärte er. Hitchings, vom Portwein mürrisch, ereiferte sich über alle Maßen. Er kletterte auf einen Stuhl und erklärte – Gott sei sein Zeuge –, daß er vor allen Frauen große Achtung habe. Besaßen sie feinere Instinkte als wir? Erfreuten sie sich köstlicherer geistiger Qualitäten, rigoroserer feinfühligerer Herzen, die sich unserem strengen Sex verschlossen? Frauen würden (so lautete seine These) durch ihre Abhängigkeit von unseren Begünstigungen zugrunde gerichtet – ein nicht gerade überzeugendes Plädoyer. Es folgte ein ganzer Wust darwinistischer Thesen, Männer seien wilde Tiere, nicht viel mehr als Affen, und Frauen, seltsamerweise von der Affenherkunft ausgeschlossen, seien ihre Schutzengel. Zu diesem Zeitpunkt fiel er vom Stuhl, so daß wir zu dem Schluß kamen, seinen Argumenten keine Bedeutung beimessen zu müssen.
Später am Abend wieder zu Hause. Nahm die Kinderfrau auf meinem Schreibtisch im Schein der Gaslaterne. Ihre Haut leuchtete bläulich wie ein Kadaver.
Gerade als ich zum Höhepunkt kam, schrie das Kind nebenan – wie der Schrei einer Möwe, spitz und schrill.
Einen derart ungünstigen Zeitpunkt hatte sie sich schon des öfteren ausgedacht, aber als ich dann hinging, um nachzusehen, schlief sie schon wieder.
Heute morgen, neun Uhr, nach Winterscombe, zu dem Kometen (und anderen Vergnügungen).
Kapitel 1:Der Wahrsager und meine Patentante
Ich war einmal bei einem Wahrsager. Er hieß Mr. Chatterjee; er übte seine Geschäfte in einem kleinen Laden, zwischen einem Pastetenbäcker und einem Seidenhändler, in einem Bazar mitten in Delhi aus.
Es war nicht meine Idee gewesen, Mr. Chatterjee aufzusuchen. Ich glaubte nicht an Wahrsager, Horoskope, Tarotkarten, das I-Ging oder ähnlichen Humbug. Und ich nehme an, daß mein Freund Wexton genauso wenig daran glaubte, obwohl es sein Vorschlag gewesen war, zu dem Wahrsager zu gehen.
Mr. Chatterjee war Wexton empfohlen worden. Einer der Inder, die wir bei unserem Besuch getroffen hatten, hatte ihn geradezu gepriesen – Mr. Gopal vielleicht, von der Universität, oder die Maharani. Am nächsten Tag gingen wir zum Bazar, und Wexton machte seinen Laden ausfindig; und am Tag darauf machte er mir den Vorschlag, ihn aufzusuchen.
Wenn man mit Wexton reiste, mußte man immer auf Abenteuer und Überraschungen gefaßt sein. Warum nicht? dachte ich.
»Willst du nicht mitkommen, Wexton?« fragte ich. »Er könnte dir doch auch deine Zukunft voraussagen.«
Wexton lächelte sein gütiges Lächeln.
»In meinem Alter braucht einem kein Wahrsager die Zukunft vorauszusagen, Victoria«, sagte er.
Er deutete zum Friedhof, aber ohne ein Zeichen von Melancholie. Am nächsten Nachmittag machte ich mich auf den Weg, mein Glück in Erfahrung zu bringen.
Während ich mich in den Gassen des Bazars durch die Menschenmenge drängte, dachte ich über das Alter nach. In einem viktorianischen Roman – wie mein Vater sie so gern las – ist eine Frau mit fünfundzwanzig bereits alt, und mit dreißig hat sie den Zenit überschritten. Heute, in den achtziger Jahren dieses Jahrhunderts, wird eine Frau, zum Teil durch den Einfluß des Fernsehens, mit fünfzig noch für jung gehalten. Aber als ich Mr. Chatterjee aufsuchte, hatten wir 1968. Alle Welt trug Ansteckplaketten mit der Aufschrift: Trau keinem über dreißig.
Wexton, der weit über siebzig war, fand das höchst amüsant. Ich war mir nicht so sicher.
Als ich mich auf den Weg zu dem Wahrsager machte, war ich ungebunden, kinderlos, erfolgreich in meinem selbstgewählten Beruf. Und ich war fast achtunddreißig Jahre alt.
Die Reise nach Indien war Wextons Idee gewesen. In den drei Monaten davor war ich in England gewesen, in Winterscombe, bei meinem Onkel Steenie, der im Sterben lag – um ihm dabei zu helfen, ohne allzu große physische Schmerzen Abschied zu nehmen.
Morphincocktails waren eine Hilfe – Steenie behauptete sogar, sie seien fast so gut wie Champagner –, aber natürlich gab es noch andere Todesqualen, gegen die es keine Medizin gab. Als Steenie dann starb, verlor ich einen Onkel, den ich sehr gern gehabt hatte, einen meiner letzten Verwandten. Und Wexton verlor seinen ältesten Freund, einen Bilderstürmer, der, wie ich annahm, früher einmal mehr als nur ein Freund gewesen war – obwohl weder Steenie noch Wexton darüber je ein Wort hatten verlauten lassen.
»Sieh uns an«, sagte Wexton, als wir allein in Winterscombe zurückgeblieben waren. »Trüb wie zwei Novembermorgen. Wir sollten irgendwo hinfahren, Victoria. Was hältst du von Indien?«
Ein verblüffender Vorschlag. Unter dem Vorwand von Arbeitsdruck (aber in Wahrheit aus Angst vor einer Selbstprüfung), hatte ich seit acht Jahren keinen Urlaub gemacht. Wexton, der durch seine Gedichte international berühmt geworden war, machte niemals Urlaub. Er war von Geburt Amerikaner, aber seit gut fünfzig Jahren lebte er in England und hatte seine Zelte in einem unordentlichen, mit Büchern vollgestopften Haus in der Church Row, in Hampstead, aufgeschlagen; er haßte es, wenn man ihn zu überreden versuchte, es zu verlassen. Es war völlig unwahrscheinlich, daß er ausgerechnet eine Einladung nach Delhi annehmen würde, um sich in der besseren Gesellschaft herumreichen zu lassen. Aber er tat es. Er würde fahren, sagte er; und, mehr noch, ich würde ihn begleiten. Ich war ängstlich darauf bedacht, dem Kummer und der Verantwortung für Winterscombe (einem großen weißen Elefanten von einem Haus – das ich wahrscheinlich verkaufen mußte) zu entkommen, daher willigte ich ein. Ich änderte meine Arbeitspläne. Drei Tage später landeten wir in Delhi.
Als wir dort waren, hielt Wexton erst einmal seinen Vortrag an der Universität; er las einige seiner berühmten Gedichte vor einer auserlesenen Zuhörerschaft – Inder, Europäer und Amerikaner; dann machte er sich, würdevoll, aber entschlossen, aus dem Staub.
Wextons Verse haben sich in mein Gedächtnis eingegraben; und wie alle großen dichterischen Werke sind auch sie zu einem unauslöschbaren Teil meines Denkens geworden. Viele seiner Gedichte handeln von Liebe, von der Zeit und von der Veränderung: Während ich ihm zuhörte, mußte ich an verpaßte Gelegenheiten denken, an eine zerbrochene Liebesbeziehung von vor acht Jahren und an mein Alter. Ich war unsagbar traurig.
Wexton, dessen Einstellung zur Poesie pragmatischer war, fühlte sich nicht traurig. Er hielt seinen Vortrag. Er beugte sich tief über das Mikrofon und verrenkte seinen Körper, daß er wie ein menschliches Fragezeichen aussah. Er zupfte und zerrte, wie er es immer tat, an den tiefen Falten und Furchen in seinem Gesicht. Er riß an seinen Haaren, daß sie in kleinen Büscheln von seinem Kopf wegstanden. Er war ein großer gutmütiger Bär, dem es Spaß machte, bei seinen Zuhörern genau die Wirkung zu erzielen, die er erzielen wollte.
Am Ende seines Vortrags stieg er vom Podium, nahm an dem offiziellen Empfang teil, den man ihm zu Ehren gab, und ging, zum Ärger seiner Gastgeber von der Botschaft, allen berühmten Persönlichkeiten unter den Gästen aus dem Weg und unterhielt sich statt dessen mit Mr. Gopal, einem ernsten und begeisterungsfähigen jungen Mann, der an der Universität jedoch nur eine unbedeutende Rolle spielte. Noch länger unterhielt er sich dann mit der Maharani, einer äußerst gutmütigen Frau mit gebirgsartigen Körperformen, deren gesellschaftliche Bedeutung der Vergangenheit angehörte. Bereits einen Tag später reiste er zum Erstaunen seiner Gastgeber wieder ab. Wexton liebte die Eisenbahn. Er ging zum Bahnhof und stieg – aus keinem besonderen Grund – in einen mit Dampf betriebenen Zug nach Simla.
Von Simla weiter nach Kaschmir, in ein Hausboot mit nach Curry duftenden Vorhängen und einem Grammophon. Von Kaschmir nach Taj Mahal, vom Taj Mahal zu einer heiligen Stätte mit Pavianen, die Wexton geradezu umlagerten und wo uns Mr. Gopal – der inzwischen sein ergebener Jünger war – einholte.
»Ein sehr mutiger Mann, Ihr Pate«, sagte er zu mir, während Wexton den Pavianen huldigte, indem er sie tiefsinnig anstarrte. »Diese Biester können häßliche Bißwunden zufügen.«
Vom Pavianheiligtum zu den Küsten von Goa, von Goa nach Udaipur; von dort kehrten wir, nach zahlreichen Stippvisiten in Tempeln, Wäldern und Bahnhöfen, nach Delhi zurück.
Das frenetische Leben und Treiben, das hier herrschte, munterte Wexton ungeheuer auf. »Genau das richtige für uns«, sagte er und machte es sich, in einem weiteren Abteil eines weiteren Zugs, gemütlich. »Neue Orte, neue Gesichter. Am Ende muß etwas geschehen.«
Natürlich geschah etwas, nachdem ich Mr. Chatterjee besucht hatte – aber das wußten wir damals beide nicht. Ich würde mich auf eine ganz andere Reise begeben. Ich glaube, ich hatte mich schon, ohne mir dessen bewußt zu sein, seit einiger Zeit darauf vorbereitet. Mein Onkel Steenie und ein paar Dinge, die er, als er im Sterben lag, zu mir gesagt hatte – Dinge, die mich erschreckten –, hatten mich noch darin bestärkt, diese Reise anzutreten. Aber den letzten Anstoß lieferte Mr. Chatterjee.
Wexton war strikt dagegen, als er von meiner Absicht erfuhr. Er sagte, es sei ein Fehler, in der Vergangenheit zu wühlen – diesem gefährlichen Territorium. Er wich mir aus, und wir wußten beide, warum. Meine Vergangenheit hatte mit Winterscombe zu tun (das sei gut so, meinte Wexton, was aber ein Irrtum war). Sie hatte auch mit New York zu tun, wo ich aufgewachsen war (auch das war in Ordnung, falls ich mir nicht wegen eines ganz bestimmten Mannes, der noch immer dort lebte, den Kopf zerbrach). Und schließlich gehörten zu ihr auch noch meine anderen Paten, insbesondere eine Frau, insbesondere Constance.
Constances Name war für Wexton tabu. Sie war das genaue Gegenteil von ihm. Ich glaube, er hat sie noch nie gemocht. Es gab nur ganz wenige Menschen, die Wexton nicht leiden konnte, aber wenn er sie nun mal nicht leiden konnte, zog er es vor, gar nicht erst von ihnen zu reden, denn Bösartigkeit lag ihm ganz und gar nicht.
In einem Gespräch mit Steenie – der Constance anbetete –, das ich einmal mitangehört hatte, hatte er sie als den weiblichen Teufel bezeichnet. Eine derart übertriebene Beschreibung paßte nicht zu Wexton – und sie hat sich auch nie wiederholt. Als ich ihm von meinem Besuch bei Mr. Chatterjee erzählte, und von der Entscheidung, die ich getroffen hatte, erwähnte Wexton kein einziges Mal ihren Namen, obwohl ich wußte, daß er gleich als erstes an sie gedacht haben mußte. Statt dessen wurde er – für seine Verhältnisse – außerordentlich trübsinnig.
»Ich wünschte, ich hätte nie auf Gopal gehört«, sagte er (oder war es die Maharani gewesen?). »Ich hätte wissen müssen, daß nichts Gutes dabei herauskommt.« Er sah mich beschwörend an. »Denk doch mal nach, Victoria. Ich setze hundert Rupien – und ich gehe jede Wette ein –, daß Chatterjee ein Scharlatan ist.«
Da wurde mir klar, wieviel Wexton daran gelegen war, mich zu überzeugen. Denn gewöhnlich wettete er nicht.
Mr. Chatterjee sah nicht aus wie ein Scharlatan. Allerdings muß ich zugeben, daß er auch nicht gerade wie ein Wahrsager aussah. Er war ein kleiner Mann, ungefähr vierzig, der ein sauberes Bri-Nylonhemd und frisch gebügelte beigefarbene Hosen trug. Seine Schuhe glänzten; sein Haaröl glänzte. Er hatte vertrauenerweckende, sehr sanfte braune Augen; er sprach englisch mit einem Akzent, der noch aus den Tagen des Raj stammte, ein Akzent, wie er selbst in England seit 1940 aus der Mode gekommen war.
Sein Laden war, im Vergleich zu denen seiner Konkurrenten im Bazar, unauffällig und schwierig zu finden. Über dem Eingang war auf einem Pappschild das Bild eines Halbmonds mit sieben Sternen. Und darüber stand in kleiner Schrift: Die Vergangenheit und die Zukunft – 12.50 Rupien, mit einem Ausrufungszeichen dahinter, vielleicht um auf Mr. Chatterjees günstigen Preis hinzuweisen: Seine Konkurrenz nahm fünfzehn Rupien und mehr.
Das Innere von Mr. Chatterjees Geschäft war schmucklos. Es wurde nicht der Versuch unternommen, eine geheimnisvolle orientalische Atmosphäre vorzutäuschen. Es enthielt nur einen alten Tisch, zwei Bürosessel, einen Aktenschrank aus Metall und – an der Wand – zwei Poster mit Porträts. Das eine war von der derzeitigen Königin von England, das andere von Mahatma Gandhi: Sie waren mit Reißzwecken an der Wand befestigt.
In dem Zimmer roch es nach der Bäckerei von nebenan und – leicht – nach Sandelholz. Vor einer Tür hing ein bunter Fliegenvorhang aus Plastik, und dahinter ertönte Sitarmusik aus dem Grammophon. Das Zimmer sah aus wie der Schlupfwinkel eines kleinen Beamten – vielleicht von der Eisenbahn –, von denen ich in den vergangenen Wochen eine ganze Menge zu Gesicht bekommen hatte. Mr. Chatterjee setzte sich hinter seinen Tisch und legte Karten. Er nickte mir ermutigend zu und lächelte. Ich fühlte mich nicht ermutigt. Mr. Chatterjee sah liebenswert aus, aber als Wahrsager verbreitete er nicht gerade Vertrauen.
Zuerst schien Mr. Chatterjee seinen Job nicht besonders ernst zu nehmen: Unsere Unterhaltung zog sich ziemlich in die Länge, und an irgendeinem Punkt – ich weiß gar nicht genau, wann das war –, fing er an, die Oberhand zu gewinnen. Das war, glaube ich, als er meine Hände berührte – ja, wahrscheinlich war es von da an: Mr. Chatterjees Berührung, kühl, leidenschaftslos, wie die Berührung eines Arztes, fühlte sich merkwürdig an. Mir wurde ein wenig schwindlig – leicht benommen, genauso, als hätte ich auf nüchternen Magen ein Glas Wein getrunken.
Ich erinnere mich nicht mehr genau an alle Einzelheiten seines Verhaltens, aber es ging alles ganz flüssig vor sich, war jedoch gleichzeitig sehr bewegend. Es waren Kräuter mit im Spiel, daran erinnere ich mich, denn meine Handballen wurden mit einer brennenden Tinktur eingerieben, und dazwischen wurde viel über den Geburtsort (Winterscombe) und das Geburtsdatum (1930) gesprochen.
Die Sterne hatten auch etwas damit zu tun – zu diesem Zeitpunkt kamen die Karten ins Spiel. Mr. Chatterjee sah sich die Karten sehr genau an; er setzte sich extra eine Brille auf. Er zog Linien, die er zu Mustern von klarer Schönheit verband, Schicksale und Planeten wurden mit Hilfe eines Bleistifts, der andauernd abbrach, miteinander verbunden. Diese Muster schienen Mr. Chatterjee nicht besonders zu gefallen; ja, sie schienen ihn sogar zu beunruhigen.
»Ich sehe ein Datum. Es ist 1910«, sagte er und schüttelte den Kopf.
Er betrachtete ein bestimmtes Gebiet auf dieser Karte genauer, ein Gebiet, das allmählich feste Formen annahm und so ähnlich aussah wie eine große Straßenkreuzung. Je länger er hinsah, desto blasser wurde Mr. Chatterjee. Er schien nur zögernd weiterzumachen.
»Was sehen Sie noch?« drängte ich ihn.
Mr. Chatterjee antwortete nicht.
»Etwas Schlimmes?«
»Besonders schön ist es nicht gerade. Ach, du liebe Zeit, nein. Ganz bestimmt nicht.« Er spitzte seinen Bleistift wieder an. Die Sitarmusik verstummte, dann – nach einer kleinen Pause – spielte sie weiter. Mr. Chatterjee schien eingeschlafen zu sein (seine Augen waren geschlossen), oder vielleicht hatte ihn auch seine Kreuzung von 1910 erstarren lassen.
»Mr. Chatterjee«, sagte ich leise, »das ist zwanzig Jahre vor meiner Geburt.«
»Ein Schimmer.« Mr. Chatterjee machte die Augen wieder auf. »Zwanzig Jahre sind nur ein Schimmer. Ein Jahrhundert ist eine Sekunde. Trotzdem, ich glaube, wir sollten weitergehen. Eine neue Spur verfolgen.«
Mit sichtlicher Erleichterung sammelte er seine Karten wieder ein. Er legte sie in den Aktenschrank aus Stahl und verschloß ihn fest. Nachdem die Karten nicht mehr zu sehen waren, schien er aufzuatmen. Für das zweite Stadium benötigte er Goldstaub – jedenfalls sagte er, daß es Goldstaub sei.
»Wenn Sie so freundlich wären. Bitte, schließen Sie die Augen und denken Sie ganz fest an jene, die Ihnen lieb sind.«
Ich machte die Augen zu und bemühte mich. Die Sitarmusik kratzte. Auf meine Augenlider und meine Wangen wurde eine puderartige Substanz gesprenkelt. Es folgte ein fröhlicher Zauberspruch auf Hindi.
Mir war heiß. Das Schwindelgefühl wurde stärker. Meine Gedanken begannen in Richtungen zu laufen, die ich nie für möglich gehalten hätte. Als die Zauberformel zu Ende war und ich meine Augen wieder aufmachte, wurde der Goldstaub sorgfältig zusammengefegt und wieder in seinen Behälter geschüttet, eine alte Tabakdose für Navy Cut. Mr. Chatterjee sah mich traurig an.
»Ich sehe zwei Frauen«, sagte er. »Die eine nah, die andere sehr weit entfernt. Ich sage mir immer von neuem, daß Sie sich zwischen den beiden entscheiden müssen.«
Dann begann er mit dem Wahrsagen, und zwar bis ins Detail. Sein Bericht über meine Vergangenheit war erschreckend genau; sein Bericht über meine Zukunft allzu rosig, um wahrscheinlich zu sein. Er endete, indem er mir mitteilte, daß ich in Kürze eine Reise antreten würde.
Darüber war ich enttäuscht. Ich hatte schon angefangen, Mr. Chatterjee richtiggehend gern zu haben. Ich war fast soweit, ihm zu glauben. Ich hatte Angst, daß er jetzt gleich auf große schwarze Fremde zu sprechen kommen würde, auf Reisen über das Wasser. Das wäre mir verhaßt gewesen; ich wollte nicht, daß er mir auf diese billige Art kam.
Eine Reise? Ich reiste andauernd. Meine Arbeit als Innendekorateurin brachte es mit sich, daß ich ständig unterwegs war, zum nächsten Auftrag, zum nächsten Haus, ins nächste Land. In einer Woche würde ich nach England zurückkehren. Der nächste Auftrag war in Frankreich, der danach in Italien. Von welcher Reise sprach Mr. Chatterjee? Dann zögerte ich. Es gab noch andere Arten von Reisen.
Mr. Chatterjee spürte diese momentane Skepsis. Er lächelte mich sanft und entschuldigend an, als sei er schuld an meinem Unglauben, und nicht ich. Er ergriff meine Hände und hielt sie fest. Er hob sie an mein Gesicht.
»Schnuppern Sie«, sagte er, als würde das alles erklären. »Riechen Sie.«
Ich schnupperte. Die brennende Substanz, die er vorher auf meine Handballen gerieben hatte, hatte sich verflüchtigt. Sie enthielt Öle, aber auch Alkohol. Die Wärme des Zimmers und meine Haut gaben Gerüche ab, die noch durchdringender waren als vorher. Ich zog die Luft ein, und ich roch Indien. Ich roch Halbmonde, Honig und Sandelholz, Henna und Schweiß, Überfluß und Armut.
»Konzentrieren Sie sich; um zu sehen, müssen Sie zuerst die Augen schließen.« Mit fest geschlossenen Augen atmete ich wieder ein und roch – Winterscombe. Feuchtigkeit und Holzrauch, Lederstühle und lange Korridore, Leinen und Lavendel, Glück und Kordit. Ich roch Kindheit, meinen Vater und meine Mutter.
»Konzentrieren Sie sich. Noch einmal.«
Mr. Chatterjees Druck gegen meine Handballen wurde fester; ein Zittern lief durch sie hindurch. Der Geruch, der jetzt in meine Nase stieg, war unmißverständlich. Ich roch das frische Grün von Farn; dann etwas Kraftvolleres, Aggressiveres dahinter: Moschus und Zibet. Ich kannte nur einen Menschen mit diesem besonderen Geruch, der für mich genauso bezeichnend war wie ein Fingerabdruck. Ich ließ meine Hände heruntersinken, ich roch Constance.
Ich glaube, Mr. Chatterjee wußte von meiner Verzweiflung, denn er redete danach sehr freundlich mit mir. Und am Ende gab er mir – mit dem Ausdruck eines Priesters im Beichtstuhl oder wie ein Eisenbahnbeamter, der einen komplizierten Fahrplan enträtselt – schließlich noch einen Rat. Er sagte mir, ich solle zurückgehen.
»Wohin zurück? Bis wann zurück?« fragte Wexton an jenem Abend beim Essen nachdenklich.
»Ich bin mir nicht sicher«, sagte ich. »Aber ich kenne den Weg, und du kennst ihn auch.«
Am nächsten Tag schrieb ich ihr. Als ich keine Antwort bekam, war ich darüber nicht erstaunt; sie hatte auch nicht geantwortet, als Steenie nach ihr verlangte und ich ihr ein Telegramm geschickt hatte – ich buchte meinen Flug um.
Eine Woche später flog Wexton allein nach England zurück. Ich flog um den halben Globus bis nach New York und zu meiner Patentante Constance.
Constance hat aus mir gemacht, was ich bin. Ich könnte sagen, sie hat mich aufgezogen, denn das hat sie, da ich schon als Kind zu ihr kam und über zwanzig Jahre in ihrer Obhut blieb; aber Constances Einfluß auf mich war viel weitergehend. Für mich war sie eine Mutter, ein Mentor, eine Inspiration, eine Herausforderung und eine Freundin. Vielleicht eine gefährliche Kombination – aber schließlich bedeutete Constance selbst schon Gefahr, wie wohl jeder der vielen Männer, die unter ihr gelitten haben, bestätigen könnte. Gefahr war die Essenz ihres Charmes.
Mein Onkel Steenie, der sie bewundert, und, wie ich glaube, gelegentlich auch gefürchtet hat, pflegte immer zu sagen, Constance sei wie ein Matador. Man könne sehen, wie sie die prächtige Capa ihres Charmes herumwirbelte, sagte er immer, und ihre Darbietung sei so atemberaubend, so vollkommen, daß man erst zu spät merke, wie gekonnt sie mit der scharfen Klinge zugestoßen habe. Aber Steenie hat schon immer gern übertrieben; die Constance, die ich kannte, war voller Kraft und Energie, aber sie war auch verwundbar.
»Denk doch mal an ihre Hunde«, sagte ich dann immer zu Steenie, aber Steenie schlug seine blauen Augen zum Himmel auf.
»Ihre Hunde. Ja, tatsächlich«, sagte Steenie einmal auf seine trockene Art. »Ich war mir nie so ganz sicher, was ich davon halten soll.«
Ein Rätsel, aber schließlich war Constance ein einziges Rätsel. Ich bin bei ihr aufgewachsen, aber ich hatte nie das Gefühl, sie zu verstehen. Ich bewunderte sie, liebte sie, manchmal wunderte ich mich über sie, und manchmal war ich von ihr schockiert – aber ich hatte nie das Gefühl, sie zu kennen. Vielleicht gehörte das auch zu ihrem Charme.
Wenn ich Charme sage, dann meine ich nicht dieses glatte künstliche Benehmen, das in der Gesellschaft häufig für Charme gehalten wird; ich meine etwas, das sich viel schwerer erklären läßt; ich meine die Fähigkeit, andere zu verzaubern. Darin war Constance, lange bevor ich ihr begegnete, eine Meisterin. Als ich nach New York kam, um bei ihr zu leben, hatte sie bereits den Ruf einer modernen Circe. Ich nehme an, wegen ihrer Männergeschichten – obwohl ich, unschuldig, wie ich war, nichts von Männern verstand, auch nicht viel von ihnen wußte.
»Sie hinterläßt eine breite Spur, Vicky, Liebes!« würde sich Onkel Steenie später nicht ohne Bosheit ereifern. »Ein ganzes Heer gebrochener Herzen. Constances hektische Karriere hinterläßt ein Trümmerfeld, Vicky!«
Steenie war der Ansicht, daß sich Constances Zerstörungswut auf das männliche Geschlecht begrenzte. Wenn Frauen zu Schaden kamen, erklärte er, sei das reiner Zufall: weil sie nur aus Versehen in Constances Schußlinie geraten waren.
Ich glaube, für Steenie war Constance nicht nur ein edler weiblicher Ritter, sondern auch eine tapfere Kriegerin. Sie griff Männer an, erklärte er, sie trug ihre Sexualität offen vor sich her, benutzte ihre Schönheit, ihre Intelligenz, ihren Charme und ihre Willenskraft als Waffen, stürzte sich wie der Teufel auf irgendeinen privaten Zerstörungskrieg. Seiner Veranlagung nach sei er, Steenie, eine Ausnahme gewesen: Nur so, erklärte er, konnte er als ihr Freund überleben.
Ich habe damals nichts davon geglaubt. Ich war überzeugt, daß mein Onkel, wie sooft, maßlos übertrieb und die Dinge dramatisierte, und ich liebte Constance; immerhin war sie ungeheuer freundlich zu mir gewesen. Wenn Steenie derartige Behauptungen aufstellte, sagte ich immer: »Aber sie ist mutig, sie läßt sich nicht unterkriegen, sie ist begabt, sie ist großzügig.« Und das war sie auch wirklich. Aber in einer Hinsicht hatte mein Onkel recht. Constance war gefährlich. An Constance klebte das Chaos wie Eisennadeln an einem Magneten. Früher oder später (ich schätze, das war unvermeidbar) würde Constance Spaß daran haben, sich auch in mein Leben einzumischen, um Unruhe zu stiften.
Und das war dann auch geschehen, vor acht Jahren, als es Constance gelang, meine Heirat zu verhindern. Wir hatten uns damals gestritten und alle Beziehungen abgebrochen. Das war jetzt acht Jahre her, und seit dieser Zeit hatte ich sie weder gesehen noch mit ihr gesprochen; und bis zu Onkel Steenies Tod, der sie mir wieder ins Gedächtnis gerufen hatte, war ich bemüht gewesen, nicht an sie zu denken. Das war mir auch gelungen. Ich führte ein neues Leben. Constance, die selbst Innenarchitektin war, hatte mir eine gute Ausbildung gegeben: Mit meiner Karriere ging es gut voran; ich gewöhnte mich daran, allein zu leben, es sogar zu genießen; ich tröstete mich mit meinem vollen Terminkalender und hatte mein straffes Arbeitspensum zu schätzen gelernt; ich hatte (glaube ich) gelernt, mit der Tatsache zu leben, daß alle erwachsenen Menschen nur mit Bedauern zusammenleben.
Aber jetzt fuhr ich zurück. Ich saß in einem Flugzeug, das nach Osten flog, eine lange Reise mit vielen Zwischenlandungen. Von Delhi nach Singapur, von Singapur nach Perth, von dort nach Sidney. Weiter nach Fiji, von dort nach Los Angeles, von L. A. nach New York. So viele Zeitzonen. Als ich schließlich auf dem Kennedy-Airport landete, war ich mir nicht mehr sicher, ob es gestern oder morgen war – ein Zustand, der sogar noch länger anhielt als der Jet-Lag.
Ich war auf Constance eingestellt. Sobald ich aus dem Flugzeug hinaustrat, in die Hitze New Yorks, wußte ich, daß sie hier war, irgendwo in der Stadt, noch nicht sichtbar, aber ganz in der Nähe. Während ich in einem gelben Taxi in Richtung Manhattan fuhr, dröhnten meine Ohren von dem Druck in zehntausend Metern Höhe, und meine Augen brannten von der trockenen Luft im Flugzeug, und von zu wenig Schlaf waren meine Nerven aufs äußerste gespannt und mit falschem Optimismus erfüllt, einem Nebenprodukt von Adrenalin, denn ich war nicht nur völlig sicher, daß Constance ganz in der Nähe war: Ich fühlte, daß sie auf mich wartete.
Ich glaube, ich stellte mir irgendeine Art letzte Abrechnung vor – keine Versöhnung, aber Fragen, die beantwortet würden, Erklärungen für Dinge, die in der Vergangenheit geschehen waren, einen sauberen Strich, der unter eine saubere ausgeglichene Summe gezogen würde. Das würde der Augenblick sein, so sagte ich mir, an dem Constances und meine Rechnung am Ende aufgehen würde. Ich verstand mich, ich verstand meine Patentante, ich würde endlich frei sein.
Natürlich täuschte ich mich. Ich glaubte, angekommen zu sein, dabei hatte meine Reise in Wirklichkeit gerade erst begonnen.
Constance schrieb niemals Briefe, aber sie liebte das Telefon. Sie besaß mehrere Telefonnummern, und ich probierte alle durch.
Ich rief in dem Haus in East Hampton auf Long Island an. Ich wählte alle drei Nummern der Wohnung in der Fifth Avenue an. Das Haus in East Hampton war vor zwei Jahren verkauft worden; der neue Besitzer hatte Constance seither nicht mehr gesehen. Unter keiner der Nummern in der Fifth Avenue meldete sich jemand, was ungewöhnlich war, denn selbst wenn Constance verreist wäre, müßte ein Dienstmädchen dort sein.
Da es Freitag war und die Büros schon geschlossen waren, hatte es keinen Sinn, in Constances Geschäft in der 57. Straße anzurufen. Ich fing an, Constances Freunde anzurufen.
Es war Ende Juli. Ich hatte Adressen, die vielleicht schon seit acht Jahren nicht mehr stimmten, kein Wunder, daß ich viele Nieten zog. Die Freunde waren umgezogen oder in den Ferien – aber diejenigen, die ich erreichte, benahmen sich äußerst merkwürdig. Sie waren höflich, sie zeigten sich entzückt, nach so langer Zeit von mir zu hören, aber sie wußten nicht, wo sich Constance aufhielt, konnten sich nicht erinnern, wo oder wann sie sie zum letzten Mal gesehen hatten. Nicht einer von ihnen war überrascht, daß ich anrief – das war das Merkwürdigste. Schließlich war der Bruch zwischen Constance und mir kein Geheimnis – wie ich wußte, sogar Anlaß zu endlosen Klatschgeschichten und Spekulationen. Constance und ich waren Geschäftspartnerinnen gewesen, wir waren wie Mutter und Tochter gewesen, wie die besten Freunde. Ich wartete darauf, daß jemand sagte: »Warum die Eile? Ich dachte, ihr hättet euch gestritten, du und Constance.« Aber das sagte niemand. Zuerst hielt ich sie nur für taktvoll. Aber nach dem zehnten Anruf kamen mir Zweifel.
Gegen acht Uhr abends kämpfte ich mit dem Schlaf und nahm mir ein Taxi in die Stadt, zu Constances Wohnung, wo wir zusammen gewohnt hatten. Ein mürrischer, mir unbekannter Portier teilte mir mit, daß Miss Shawcross verreist sei, die Wohnung sei verschlossen. Eine Adresse habe sie nicht hinterlassen.
Ich kehrte ins Hotel zurück. Ich bemühte mich, praktisch und vernünftig zu denken. Schließlich war es mitten im Sommer und sehr heiß – es war unwahrscheinlich, daß sich Constance in New York aufhielt. Wenn sie nicht in Long Island war, dann würde sie in Newport sein. Wenn sie nicht in Newport war, würde sie in Europa sein. Auf jeden Fall gab es eine begrenzte Anzahl von Orten, an denen sich Constance aufhalten konnte – und ich kannte sie alle.
Ich rief überall an, in ihren bevorzugten Hotels, in denen sie immer darauf bestanden hatte, in derselben Suite zu wohnen. Sie war in keinem: Niemand hatte für das laufende Jahr, und schon gar nicht für den Sommer, eine Reservierung auf ihren Namen. Ich war noch immer nicht bereit aufzugeben, selbst da nicht. Ich spürte die Symptome des Jet-Lags, die falsche Energie und gleichzeitige Erschöpfung. Ich spürte auch noch etwas viel Gefährlicheres – ein unsichtbares Band, das an einem zieht und zerrt, wenn man auf die Suche geht, Nachforschungen anstellt.
Constance war hier, ich fühlte es. Sie war nicht in Europa, trotz der Jahreszeit, sondern hier in Manhattan, gleich um die Ecke, aber unsichtbar, und sie amüsierte sich. Nur noch ein Telefonanruf, und ich würde sie finden. Ich machte noch zwei, bevor ich der Müdigkeit nachgab und ins Bett ging.
Der erste – ich wählte die Nummer mehrere Male – war mit Betty Marpruder, Constances rechte Hand im Büro, die Person, die sonst immer wußte, wo sich Constance aufhielt. Ich hatte noch nie erlebt, daß sich Miss Marpruder Urlaub nahm; und außerdem konnte ich mich auch nicht erinnern, daß sie je New York verlassen hatte. Unter ihren Nummern – sie war die erste gewesen, die ich angerufen hatte – antwortete niemand, als ich um sechs anrief; und es meldete sich auch niemand, als ich es um zehn noch einmal versuchte.
Ich ging ins Bett. Ich setzte mich ins Bett, ich war erschöpft, blätterte die New York Times durch, die ich im Zimmer gefunden hatte. Und dort, auf den Klatschseiten, fand ich die perfekte Quelle. Conrad Vickers, der Fotograf, kam nach New York. Er bereitete eine fünfzig Jahre umfassende Retrospektive seiner Arbeiten im Museum of Modern Art vor, die im Herbst mit einer Party eröffnet wurde, die der Journalist als le tout New York bezeichnete. Conrad Vickers hatte Verbindungen zu meiner Familie, die viele Jahre zurückreichten; er hatte auch Verbindungen zu Constance. Neben Steenie war Conrad Vickers Constances ältester Freund.
Ich mochte Vickers nicht, und es war schon spät; trotzdem rief ich ihn an.
Da Vickers mich ebenfalls nicht mochte, erwartete ich, von ihm abgewiesen zu werden; zu meinem Erstaunen war er übertrieben freundlich. Fragen nach Constance umging er, aber blockte sie nicht ab. Er war sich nicht ganz sicher, wo sie sein könnte, aber ein paar Nachforschungen, so deutete er an, und er würde sie ausfindig machen.
»Komm doch auf einen Drink zu mir. Dann besprechen wir die Sache«, rief er mit seiner flötenden Stimme. »Morgen um sechs, Schätzchen? Gut. Also bis dann.«
»Schätzchen«, sagte Conrad Vickers und küßte die Luft neben meinen Wangen.
Schätzchen war für Vickers kein Begriff, um Zuneigung oder Nähe auszudrücken, denn er verwendete ihn sowohl bei engen Freunden als auch bei völlig Fremden. Ich nehme an, er diente ihm nur dazu, die Tatsache zu verbergen, daß er oft gar nicht wußte, wen er da gerade so herzlich begrüßte. Vickers konnte sich keine Namen merken – nur von ganz berühmten Leuten.
Er tat so, als wäre er entzückt, mich zu sehen. Conrad Vickers, in seinem üblichen Gefieder: Eine exquisite Figur in einer exquisiten Wohnung in einem exquisiten Haus in der 62. Straße – nur fünf Minuten von Constances Wohnung entfernt. Aus der Tasche eines blaßgrauen Savile-Row-Anzugs ragte ein blaues Seidentaschentuch; es paßte zu dem blauen Hemd: Das blaue Hemd paßte zu seinen Augen. Ein weißhaariger Wuschelkopf, dessen Haare sich schon ein wenig lichteten; der Gesichtsausdruck eines Mädchens: An Conrad Vickers, der früher einmal, wie mein Onkel Steenie, ein wunderschöner junger Mann gewesen war, waren die Jahre auch nicht spurlos vorübergegangen. Sein Maß an Oberflächlichkeit schien ungemindert.
»Was für eine Zeit, in der wir leben! Ich bin so froh, daß du angerufen hast. Schätzchen, du siehst hinreißend aus. Setz dich und laß dich anschauen. Toll, was du mit dem Antonelli-Haus gemacht hast – und auch mit dem von Molly Dorest. So schrecklich klug – beide. Du bist absolute Spitze.«
Ich setzte mich hin. Ich überlegte, warum sich Vickers wohl die Mühe machte, mir zu schmeicheln, das hatte er früher nie getan – aber vielleicht hatte er beschlossen, daß ich in Mode war.
»Ist das eine Hitze!« fuhr Vickers ohne Unterbrechung fort. »Absolut unerträglich. Was haben die Leute bloß gemacht, als es noch keine Klimaanlage gab? Ich bin wie ein Vogel auf der Durchreise, Schätzchen, ich bin nur kurz hier hereingeflattert, um das da fertigzumachen.« Er deutete auf einen Stoß Fotos. »Die reinste Hölle. Ich meine, fünfzig Jahre Arbeit, Schätzchen. Wo soll man da anfangen? Was soll man drinlassen? Was soll man rausnehmen? Diese Museumsleute sind absolut rücksichtslos, meine Liebe. Sie wollen natürlich das Beste. Margot und Rudy, Andy und Mick, Wallis und Lady Diana. O ja, und sie wollen natürlich Constance. Nun, das ist ja klar. Aber jeder, von dem sie noch nichts gehört haben, ist draußen, Schätzchen. Ich werde die Hälfte meiner Freunde verlieren.«
Bekümmertes Gejammer. Aber schon im nächsten Augenblick war der Kummer vergessen, und er deutete mit dem Finger auf einen Blumenstrauß auf dem Tisch neben mir.
»Sind die nicht himmlisch? Liebst du sie auch so – Rittersporn? Englische Gartenblumen – ich muß sie immer um mich haben, egal, wo ich gerade bin. Und jetzt habe ich diesen schrecklich klugen jungen Mann gefunden, der sie mir genauso macht, wie ich sie haben will. Wahnsinnig ursprünglich. Ich kann Blumen nicht ertragen, die arrangiert sind. Sollen wir einen Schluck Champagner trinken? Bitte, sag ja. Ich kann die Martinis nicht ausstehen – viel zu ungesund. Man fühlt sich völlig blind danach. Ja, Champagner. Wir werden wahnsinnig großzügig sein und eine Bollinger aufmachen.«
Vickers unterbrach sich abrupt. Er hatte gerade die Lieblingsmarke von Onkel Steenie angesprochen. Auf seinem Hals breitete sich Röte aus; auch sein Gesicht wurde rot. Er zupfte nervös an seinem Hemd. Er wandte sich ab, um dem jungen Mann, der mich hereingelassen hatte und der nun abwartend an der Tür stand, Anweisungen zu erteilen.
Es war ein Japaner, ein hübscher junger Mann in schwarzer Jacke und gestreiften Hosen.
Als er das Zimmer verließ, setzte sich Vickers, und ich wußte endlich, warum er mich eingeladen hatte. Vickers war mehr als verlegen; er hatte ein schlechtes Gewissen.
Da Conrad Vickers über fünfzig Jahre mit meinem Onkel Steenie befreundet gewesen war – und immer wieder auch sein Liebhaber – und da er sich dann, als Steenie im Sterben lag, so rar gemacht hatte, waren seine Schuldgefühle verständlich. Ich sagte nichts. Ich glaube, ich wollte mir ansehen, wie sich Vickers aus dieser mißlichen Situation befreien würde.
Eine Weile schwieg er, als wartete er darauf, daß ich das Gespräch auf Steenie bringen und ihm helfen würde. Aber ich schwieg ebenfalls. Ich sah mich in seinem Wohnzimmer um, das – wie alle Zimmer in seinen vielen Häusern – mit viel Geschmack eingerichtet war. Vickers Sinn für Loyalität mochte schwach oder gar nicht vorhanden sein, und seine Freundschaften oberflächlich, aber wenn es um leblose Dinge ging, um Stoffe, um Möbel, dann war sein Auge genauso unfehlbar wie das von Constance. Das war mir früher einmal wichtig vorgekommen. Ich hatte geglaubt, daß Geschmack einen besonderen Wert darstellt. Jetzt war ich mir nicht mehr so sicher.
Vickers umklammerte nervös die Lehne seines französischen Sessels. Die Seide, mit der er bespannt war, eine geschickte Nachahmung eines Musters aus dem achtzehnten Jahrhundert, kam mir bekannt vor. Sie stammte aus der neuesten Constance-Shawcross-Kollektion. Der Sessel war restauriert und dabei listig demoliert worden. Eine Lage Farbe über der Kreidegrundierung: aus Constances Werkstatt? Es war unmöglich – fast unmöglich – festzustellen, ob die blasse blaue Farbe vor zweihundert Jahren oder vergangene Woche aufgetragen worden war.
»Vergangenen Monat«, sagte Vickers, dem mein Blick nicht entgangen war. Vickers war, egal, welche Fehler er sonst hatte, nie dumm gewesen.
»Vergangenen Monat.« Er seufzte. »Ja, ja, ich weiß, ich kann dich nicht hinters Licht führen – von dem Restaurateur, mit dem Constance immer arbeitet. O Gott.«
Er beugte sich nach vorn. Anscheinend hatte er sich entschlossen, den Sprung zu wagen.
»Wir müssen über Steenie reden. Ich weiß, ich hätte kommen sollen. Aber ich hab es einfach nicht über mich gebracht, das mitanzusehen. Steenie im Sterben. Es schien so gar nicht zu ihm zu passen. Ich konnte es mir kaum vorstellen. Und schon gar nicht wollte ich es mit eigenen Augen sehen. Ah, der Champagner.«
Er stand auf. Seine Hand zitterte, als er mir das Glas reichte.
»Würdest du es schrecklich finden, wenn wir ein Glas auf ihn trinken? Auf Steenie? Das hätte ihm bestimmt gefallen. Schließlich hatte sich Steenie, was mich betrifft, nie irgendwelche Illusionen gemacht. Ich schätze, du hältst mich jetzt für einen schrecklichen Feigling, und natürlich bin ich das auch. Mir wird in Krankenzimmern immer übel, weißt du. Aber Steenie hätte es verstanden.«
Das stimmte. Ich hob mein Glas. Vickers sah mich reumütig an.
»Also dann – auf Steenie? Auf die alten Zeiten?« Er zögerte. »Auf die alten Freunde?«
»Also gut. Auf Steenie.«
Wir tranken. Vickers stellte sein Glas auf den Tisch. Er legte die Hände auf die Knie; er sah mich lange abschätzend an.
»Besser, du sagst es mir. Ich will es wissen. Als du das Telegramm geschickt hast ... bin ich mir wie ein Wurm vorgekommen. War es leicht? Für Steenie, meine ich?«
Ich dachte darüber nach. Konnte der Tod jemals leicht sein? Ich hatte mich bemüht, es Steenie möglichst leicht zu machen, genauso wie Wexton. Wir hatten nur begrenzten Erfolg gehabt. Mein Onkel hatte Angst gehabt, als er starb, und er hatte sich Sorgen gemacht.
Zuerst hatte er sich bemüht, es nicht zu zeigen. Aber als ihm dann klar wurde, daß es keine Hoffnung mehr gab, hatte er sich darauf vorbereitet, stilvoll zu sterben.
Für meinen Onkel Steenie war Stil immer vor allem anderen gekommen. Ich glaube, er nahm sich vor, den großen Hades wie einen alten Freund zu begrüßen, den er schon von Partys kannte; so sorglos über den Styx zu rudern, als säße er in einer Gondel zur Giudecca; und wenn er seinem Fährmann Charon begegnete, wollte ihn mein Onkel Steenie, glaube ich, wie den Portier im Ritz behandeln: Steenie würde vorbeirauschen, aber er würde ihm ein großzügiges Trinkgeld geben.
Das erreichte er am Ende sogar. Steenie verließ uns, ganz nach seinem Geschmack, an seine Seidenkissen gelehnt, eben noch amüsant, im nächsten Augenblick tot.
Aber dieser plötzliche Abschied erfolgte am Ende von drei langen Monaten, in denen Steenie die Fähigkeit, sich selbst darzustellen, manchmal im Stich gelassen hatte. Er hatte keine Schmerzen – dafür hatten wir gesorgt –, aber jene Morphincocktails hatten, wie die Ärzte uns vorher gewarnt hatten, seltsame Nebenwirkungen. Sie versetzten Steenie manchmal zurück in die Vergangenheit, und was er dort sah, brachte ihn zum Weinen.
Er versuchte mir zu vermitteln, was er sah, er redete und redete, oft bis spät in die Nacht. Er war besessen davon, mich sehen zu lassen, was auch er sah. Ich saß bei ihm, ich hielt seine Hand, ich hörte ihm zu. Er war einer der letzten, die von meiner Familie noch übriggeblieben waren: Ich wußte, er wollte mir die Vergangenheit zum Geschenk machen, bevor es zu spät war.
Aber oft war es schwer, seine Worte zu verstehen. Die Worte selbst waren deutlich genug, aber die Ereignisse, die er schilderte, gerieten ihm durcheinander. Das Morphin machte Steenie zu einem Reisenden durch die Zeit; es ermöglichte ihm, sich vor und zurück zu bewegen, von einem eben geführten Gespräch konnte er, ohne Unterbrechung, in ein anderes übergehen, das vor zwanzig Jahren stattgefunden hatte, als wäre es ein und derselbe Tag, ein und derselbe Ort.
Er sprach von meinen Eltern und meinen Großeltern; aber mir waren nur die Namen vertraut, denn wenn Steenie von ihnen sprach, waren sie wie unbekannte Menschen für mich. Das war nicht der Vater, an den ich mich erinnerte, und auch nicht die Mutter. Die Constance, von der er sprach, war eine Fremde. Und noch etwas: Manche von Steenies Erinnerungen waren lieb und gut und manche waren es – ganz eindeutig – nicht. Steenie sah die Dinge mit jenen Schatten, die ihn zum Zittern brachten. Dann ergriff er meine Hand, richtete sich in seinem Bett auf, spähte ins Zimmer, sah Erscheinungen, die für mich unsichtbar waren.
Das machte mir Angst. Ich war mir nicht sicher, ob es nicht das Morphin war, das zu mir sprach – denn ich war mit einigen Rätseln aufgewachsen, die niemals gelöst wurden, Rätsel, die bis zu meiner Geburt und meiner Taufe zurückreichten. Ich hatte geglaubt, mich von diesen Rätseln gelöst zu haben – sie hinter mir zurückgelassen zu haben. Mein Onkel Steenie brachte sie alle wieder zurück.
Eine solche Fülle von Worten und Bildern: Onkel Steenie konnte in der einen Minute vom Crocketspielen reden, und in der nächsten von Kometen. Oft sprach er von den Wäldern in Winterscombe – ein Thema, zu dem er mit wachsender und mir unverständlicher Beharrlichkeit immer wieder zurückkehrte. Er sprach auch – und das mußte das Morphin sein, da war ich mir ganz sicher – von einem gewaltsamen Tod.
Ich glaube, daß Wexton, der einige Male dabei war, es besser verstand als ich, aber er machte keine Anstalten, es mir zu erklären. Er blieb still, in sich zurückgezogen, verschwiegen – und wartete auf den Tod.
Bevor er kam, vergingen zwei Tage, in denen alles feierlich und klar war, in denen sich Steenie sammelte, um sich auf den letzten Schritt vorzubereiten. Dann starb er mit einer Geschwindigkeit, die eine Gnade war.
»Würdest du das leicht nennen?« Ich sah Vickers an, vermied es aber, ihm in die Augen zu sehen. Ich hatte das Gefühl, daß es Steenie lieb gewesen wäre, wenn ich bei meinem Versuch, seine Abschiedsvorstellung bühnenreif zu machen, die Aspekte seines Heldentums gebührend hervorhob.
»Laß dich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken, sei auf der Hut.«
»Er ... hat Haltung bewahrt«, sagte ich.
Das schien Vickers zu gefallen oder zumindest sein Gewissen zu erleichtern. Er seufzte.
»Gut.«
»Natürlich war er im Bett. In seinem Zimmer in Winterscombe. Du erinnerst dich doch an das Zimmer ...«
»Aber Schätzchen, wer könnte das wohl vergessen? Völlig absurd. Sein Vater hätte einen Anfall gekriegt.«
»Er trug seine Seidenpyjamas. An den Tagen, an denen die Ärzte kamen, lavendelfarben – du weißt doch, wie gern er die Leute schockiert hat.«
Vickers lächelte. »Make-up? Erzähl mir bloß nicht, daß er Make-up aufgelegt hat ...«
»Nur ein bißchen. Für Steenies Verhältnisse absolut diskret. Er sagte ... er sagte, wenn er dem Tod schon die Hand reiche, wolle er wenigstens so gut wie möglich aussehen ...«
»Laß dich bloß nicht aus der Fassung bringen. Es wäre Steenie verhaßt, wenn du seinetwegen die Fassung verlieren würdest.« Vickers Stimme klang fast freundlich. »Sag mal – es hilft dir doch, wenn du jetzt darüber redest. Das hab ich gelernt, weißt du. Steenie und ich waren gleichaltrig, weißt du. Achtundsechzig. Natürlich ist das kein Alter, heutzutage. Trotzdem ...« Er machte eine Pause. »Hat er denn von mir gesprochen ... am Ende, meine ich?«
»Ein bißchen«, erwiderte ich und beschloß, ihm seinen Egoismus zu verzeihen. In Wirklichkeit hatte Steenie so gut wie nie von Vickers gesprochen. Ich zögerte. »Du weißt ja selbst, wie gern er geredet hat. Er hat seinen Bollinger getrunken, er hat diese schrecklichen schwarzen Zigaretten geraucht. Er hat Gedichte gelesen.«
»Wextons Gedichte?« Vickers hatte Wexton als seinen Rivalen angesehen. Er schnitt eine Grimasse.
»Meistens die von Wexton. Und seine Briefe – alte Briefe, die er im Ersten Weltkrieg an Steenie geschrieben hatte. Die ganzen alten Fotoalben. Das war komisch – die jüngere Vergangenheit interessierte ihn überhaupt nicht; er wollte immer weiter zurück. Bis in seine Kindheit, nach Winterscombe, wie es damals gewesen war. Er hat viel von seinen Großeltern gesprochen und von seinen Brüdern. Von meinem Vater natürlich.« Ich machte eine Pause. »Und von Constance.«
»Ah, Constance. Natürlich. Steenie hat sie immer verehrt. Aber die restliche Familie...« Vickers setzte ein kleines boshaftes Lächeln auf. »Ich glaube, die waren alle nicht besonders gut auf sie zu sprechen. Deine Tante Maud hat sie natürlich verflucht, das ist ja klar, und deine Mutter ... na ja, wie ich hörte, war sie es, die sie, mehr oder weniger, von Winterscombe verbannt hat. Ich habe nie herausgefunden, warum. War ein ziemliches Geheimnis, wenn du mich fragst. Hat Steenie es erwähnt?«
»Nein«, erwiderte ich, nicht ganz wahrheitsgemäß, und falls Vickers meine kleine Lüge bemerkte, ließ er es sich nicht anmerken. Er füllte die Gläser noch einmal mit Champagner. Irgend etwas – vielleicht der Hinweis auf Wexton – mußte ihm gegen den Strich gegangen sein. Er stand auf und begann in den Fotos zu wühlen, die auf dem Tisch lagen.
»Weil wir gerade von Constance reden, sieh dir das an! Ich bin erst neulich darauf gestoßen. Ich hatte es völlig vergessen. Meine erste Arbeit. Das erste Foto, das ich je von ihr gemacht habe. Schrecklich gestellt, viel zu künstlich – trotzdem nehme ich es vielleicht mit rein in die Retrospektive. Es hat eine gewisse Ausstrahlung, findest du nicht?« Er hielt ein großes Schwarzweißfoto in die Höhe. »1916 – das bedeutet, daß ich sechzehn war, und Constance auch, obwohl sie heute natürlich Jahre abzieht. Sieh dir das an? Kennst du das? Findest du das nicht hervorragend?«
Ich sah mir das Foto an: Ich hatte es noch nie gesehen, und Constance sah wirklich außergewöhnlich darauf aus. Sehr künstlich, wie Vickers sagte, ganz anders als seine späteren Arbeiten. Die junge Constance lag auf einer Art Bahre, eingehüllt in schweren weißen Stoff, vielleicht Satin. Nur ihre Hände, die eine Blume hielten, und ihr Kopf waren zu sehen; der übrige Körper war in ein Grabtuch eingehüllt. Ihre schwarzen Haare waren damals lang gewesen; ich hatte Constance noch nie mit langem Haar gesehen – und es war gekämmt und kunstvoll gelegt, so daß es ihr in mehreren Stufen aus dem Gesicht und über die Schultern fiel. Schockierend in seiner Fülle, wie Vickers es zweifellos beabsichtigt hatte, fiel es bis auf den Boden. Constance war im Profil zu sehen; ein Streifen aus gestricheltem Licht hob die großen Flächen ihres Gesichts hervor, das, ohnehin faszinierend, zu einer malerischen Komposition wurde, einem Muster aus Licht und Schatten. Die schwarzen Augenlider bildeten einen Halbmond über den weißen, hohen, fast slavischen Backenknochen. Merkwürdig, aber obwohl ihre – fast schwarzen – Augen Constances auffälligstes Merkmal waren, hatte Vickers beschlossen, sie mit geschlossenen Augen zu fotografieren.
»La Belle Dame sans Merci.« Vickers, der sich wieder gefangen hatte, stieß ein hohes heulendes Gelächter aus. »So habe ich es genannt. Damals hat man solche Sachen gemacht. Constance auf einer Leichenbahre, die Sitwells auf Leichenbahren – nichts als Leichenbahren, ein ganzes Jahr lang, das ging entsetzlich schlecht, sag ich dir, natürlich, schließlich war es mitten im Ersten Weltkrieg, und die Leute fanden, es wäre dekadent. Aber nützlich, dieser Zorn ...« Er sah mich von der Seite an. »Das machte mich zum enfant terrible, was für einen guten Start immer das beste ist. Jetzt bin ich ein großer alter Mann, und die Leute haben ganz vergessen, daß ich mal so war. Deshalb dachte ich mir, daß es auch in die Ausstellung soll – um sie daran zu erinnern. Ach, und natürlich ihre Hochzeitsfotos. Die sind herrlich ...«
Er wühlte in den Fotos. »Ah, sieh dir das hier mal an; hier, das wird dich interessieren ...«
Das Foto, das er mir zeigte, war das, was Vickers als Familienschnappschuß bezeichnete.
Ich erkannte es sofort. Es war 1956 in Venedig aufgenommen worden. Constance mit einer Gruppe Freunde am Canal Grande; hinter ihnen sah man die Türme einer Kirche – es war die Santa Maria della Salute. Eine elegante Gruppe in hellen Sommerkleidern. Auch die legendären Van-Dynem-Zwillinge waren dabei, die jetzt beide tot waren.
Abseits der Gruppe standen zwei jüngere Personen. Eingefangen in das goldene venezianische Licht: ein hochgewachsener, dunkelhaariger Mann mit angespanntem Gesichtsausdruck, eine umwerfende Erscheinung, fast wie ein Italiener, was er aber nicht war, und eine junge Frau, die er ansah.
Auch sie war groß. Sehr schlank. Sie trug ein grünes Kleid und flache Sandalen, mit bloßen Beinen. Das Auffälligste an ihr war ihr Haar, das sie offen trug. Es war sehr lang. Es wehte ihr ins Gesicht: Das venezianische Licht vertiefte seine Farbe in Rotgold oder Kastanienbraun. Eine Strähne ihres Haares, die ihr quer über das Gesicht geweht war, verdeckte ihre Gesichtszüge. Sie sah nicht in die Kamera und auch nicht zu dem Mann im dunklen Anzug. Sie sah aus, als wollte sie sich gerade in die Lüfte schwingen, fand ich – diese junge Frau, die ich einmal gewesen war.
Damals war ich fünfundzwanzig, nicht ganz sechsundzwanzig. Und ich hatte mich in den Mann, der neben mir stand, noch nicht verliebt; aber ich hatte an jenem Tag eine Vorahnung von Liebe gespürt. Ich wollte dieses Foto nicht sehen. Mit diesem Mann und mir selbst. Ich legte es schweigend aus der Hand und drehte mich wieder zu Vickers um.
»Conrad«, sagte ich, »wo ist Constance?«
Er machte Ausflüchte. Er drehte und wendete sich. Ja, er hatte einige Anrufe getätigt, wie er es mir versprochen hatte, aber – zu seiner großen Überraschung – war nichts dabei herausgekommen. Aber Constance würde sicherlich ganz plötzlich wieder auf der Bildfläche erscheinen, meinte er, genauso wie sonst auch immer. Schließlich, war sie nicht schon immer ziemlich unberechenbar gewesen?
»Einer von Constances Anfällen. Du weißt doch selbst, wie gern sie einfach abhebt ...«
Dann deckte er mich mit Überlegungen ein. Die Wohnung war verschlossen? Wie merkwürdig. Hatte ich es schon in East Hampton versucht? Was, das war verkauft? Er hatte ja keine Ahnung gehabt... Er beeilte sich, schnell auf etwas anderes zu sprechen zu kommen, so daß ich mir ganz sicher war, daß er über den Verkauf Bescheid wußte, bei all den Anstrengungen, die er unternahm, es zu leugnen.
»Sie wird in Europa sein«, rief er, als sei ihm diese Idee gerade erst gekommen. »Hast du es im Danieli versucht, dem Crillon? Und was ist mit Molly Dorest, dem Connaught?« Als ich ihm versicherte, daß ich all diese vertrauten Häfen bereits angerufen hatte, und einige andere auch noch, machte Vickers den Eindruck tiefster Ratlosigkeit, als stünde er vor einem Rätsel.
»Dann tut es mir leid, dann kann ich dir leider nicht helfen. Siehst du, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen, fast ein Jahr lang nicht.« Er machte eine Pause, warf mir einen abschätzenden Blick zu. »Sie ist sehr seltsam geworden, weißt du – lebt völlig zurückgezogen. Partys gibt sie überhaupt nicht mehr – seit Ewigkeiten nicht. Und wenn man sie einlädt ... also, dann weiß man nie mit Sicherheit, ob sie auch wirklich aufkreuzt –«
»Zurückgezogen? Constance?«
»Vielleicht ist das nicht das richtige Wort. Nicht direkt zurückgezogen. Aber seltsam – ausgesprochen seltsam. Als wäre sie dabei, irgend etwas auszuhecken. Sie saß nur da, mit ihrem sphinxhaften Lächeln, während ich an dem Rätsel herumknobelte.«
»Keine Hinweise? Das sieht aber gar nicht nach Constance aus.«
»Kein einziger. Sie sagte, ich würde es am Ende schon herausfinden – wenn nicht, dann würde sie sich wirklich sehr wundern. Das war alles.« Vickers zögerte. Er sah auf seine Uhr. »Großer Gott! Ist es wirklich schon so spät? Tut mir leid, aber ich muß in einer Minute lossausen –«
»Conrad ...«
»Ja, Schätzchen?«
»Geht mir Constance aus dem Weg? Ist es das?«
»Dir aus dem Weg gehen?« Er sah mich an – wenig überzeugend –, als wäre er außerordentlich überrascht. »Warum sagst du das? Offenbar habt ihr euch gestritten – nun, das wissen wir doch alle. Und sie spricht immer mit sehr viel Wärme von dir. Deine neueste Arbeit hat ihr gefallen: dieses rote Wohnzimmer, das du für Molly Dorest gemacht hast.«
In seinem krampfhaften Bemühen, mich zu überzeugen, hatte er einen Fehler gemacht. Ich sah es an seinen Augen, daß es ihm sofort bewußt wurde.
»Das Wohnzimmer der Dorests? Das ist komisch. Ich habe dieses Zimmer doch erst vor vier Monaten fertiggestellt. Es war die letzte Arbeit, die ich abgeschlossen habe, bevor Steenie krank wurde. Ich dachte, du hättest vorhin gesagt, daß du Constance seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen hast.«
Vickers schlug sich mit der Hand an die Stirn – eine bühnenreife Geste.
»Himmel, wie ich immer alles durcheinanderbringe! Dann kann es ja gar nicht das von den Dorests gewesen sein. Es muß sich um irgendein anderes Zimmer gehandelt haben. Das ist das Alter, du weißt schon, Schätzchen. Fortschreitende Senilität. So was passiert mir jetzt andauernd, ich bringe alles durcheinander, Daten, Orte; das ist wirklich eine Geißel. Also, du darfst mir nicht böse sein, aber ich muß dich jetzt leider rausschmeißen. Ich muß in einer halben Stunde im Village sein – nur ein Treffen mit alten Freunden, aber du kennst ja den Verkehr. Die ganze Stadt vollgestopft mit den schrecklichsten Menschen – Touristen, weißt du, Autoverkäufer aus Detroit, Hausfrauen aus Idaho, die sich jedes verfügbare Taxi schnappen ...«
Er schob mich mit festem Griff am Ellbogen in Richtung des Flurs. Dort hockte der japanische Hausjunge.
»Ich liebe dich in diesem Blau – es paßt wunderbar zu deinem Tizianhaar«, säuselte er, und da Vickers häufig Schmeicheleien benutzte, um schnell zu flüchten, war ich nicht überrascht, mich einen Augenblick später draußen auf dem Gehsteig wiederzufinden.
Ich drehte mich noch einmal um, aber Vickers, der in bestimmten Kreisen wegen seiner Zuvorkommenheit gerühmt wurde, hatte sich nie gescheut, unhöflich zu sein.
Ein überstürzter Abschied. In diesem Augenblick war ich mir völlig sicher, daß Vickers, der sich Constance gegenüber loyal verhalten hatte, nicht aber meinem Onkel Steenie gegenüber, gelogen hatte.
Bevor ich zu Conrad Vickers ging, hatte ich, zumeist am Telefon, einen enttäuschenden und frustrierenden Tag verbracht. Der Rest des Abends war nicht viel anders. Es war ein Fehler gewesen, Champagner zu trinken, denn nun war ich noch durstiger, und der Jet-Lag machte sich wieder bemerkbar. Vor allem aber war es ein Fehler gewesen, daß ich mir dieses venezianische Foto angesehen hatte, das mir gezeigt hatte, wie ich einmal gewesen war, aber jetzt nicht mehr.
Es gab genügend Leute, die ich hätte anrufen können, wenn ich Gesellschaft wollte, aber ich tat es nicht. Ich wollte allein sein. Ich mußte mich entscheiden, ob ich meine Suche fortsetzen sollte oder ob ich sie aufgeben und nach England zurückkehren sollte.
Ich schaffte es, eins der Fenster in meinem Hotelzimmer aufzumachen. Und dann ließ ich mir die warme Stadtluft ins Gesicht wehen: Ich sah hinaus über Manhattan. Es waren die Stunden des Übergangs vom Tag zur Nacht. Ich fühlte mich ebenfalls im Übergang, fühlte mich vor einer entscheidenden Veränderung – und vielleicht wurde ich gerade aus diesem Grund wieder störrisch. So leicht würde ich mich nicht geschlagen geben. Ich wußte, daß Constance hier war; das Gefühl, daß sie in der Nähe war, war noch stärker als am Tag zuvor. Na, komm doch, sagte ihre Stimme, wenn du mich finden willst.
Bevor ich ins Bett ging, rief ich noch einmal bei Betty Marpruder an. Ich rief dreimal an. Ich wählte ein viertes Mal. Noch immer keine Antwort. Das kam mir sehr merkwürdig vor.
Betty Marpruder – Miss Marpruder für alle, außer für Constance und mich, wir durften sie Prudie nennen – war anders als alle Frauen, die Constance sonst einstellte; sie war weder jung noch dekorativ. Wie die meisten Innenarchitekten, so achtete Constance sorgfältig darauf, Frauen – und Männer – einzustellen, von deren Akzent, Kleidung und Benehmen ihre Kunden beeindruckt sein würden. Das tat sie mit einem gewissen zornigen Pragmatismus – Fassadenputz nannte sie es. Miss Marpruder mit ihren Halsketten, ihren eckigen Bewegungen, ihren bunten Slacks, ihrer alten behinderten Mutter, ihrer trotzigen, aber traurigen Altjüngferlichkeit wurde jedoch sorgfältig in einem Hinterzimmer verborgen. Dort herrschte sie über allem: Sie überwachte die Bücher, sie tyrannisierte für Constance die Werkstätten, sie jagte den Herstellern Gottesfurcht ein, und – unter gar keinen Umständen – begegnete sie je einem Kunden. Constance war innerhalb der Firma immer das inspirierende Element gewesen; aber es war Miss Marpruder, die Constances unleugbar kapriziöse Ader ausglich und die sämtliche praktischen Arbeiten ausführte.
Dafür genoß sie gewisse Privilegien. Ich war überzeugt, daß sie die noch immer genoß. Das wichtigste dieser Privilegien war, daß sie stets wußte, wo sich Constance aufhielt. Und nur Miss Marpruder gab diese Einzelheiten weiter. Miss Marpruder, eine Verehrerin in Constances Tempel, war zugleich Constances höchste Priesterin.
»Prudie hat eine perfekte Nase«, jubelte Constance. »Wenn es eine Krise gibt, ist sie die Richterin des Obersten Gerichtshofs.«
Ich lauschte auf Miss Marpruders Telefon. Ich konnte es sehen, ganz deutlich, diesen Apparat, während ich auf das Klingeln lauschte. Ich konnte das Spitzendeckchen sehen, auf dem es stand, den wackligen Tisch darunter, all die Einzelheiten dieses traurigen Zimmers, das Prudie, auf ihre flotte Art, gern als ihr Junggesellenzelt bezeichnete.
Als Kind wurde ich oft bei Prudie abgestellt. Sie nahm mich mit, die 32. Straße hinunter, brachte mich bei ihrer behinderten Mutter vorbei, setzte mich in ihrem kleinen Wohnzimmer ab, gab mir kleine Schleckereien – selbstgebackene Plätzchen, Gläser mit richtiger Limonade; ich glaube, Prudie hätte gern eigene Kinder gehabt.
Ihr Wohnzimmer war grell und mutig. Es verbreitete eine Atmosphäre übertriebener Sparsamkeit, unzureichender Geldmittel, die bis an ihre Grenzen durch medizinische Rechnungen erschöpft waren. Da war eine trotzige Couch in einem unglücklichen rötlichen Ton, mit einer Decke auf eine Art drapiert, die Constances kostspielige Wegwerftechnik imitieren sollte. In Constances Räumen wäre die Decke aus Kaschmir gewesen oder aus einem alten Paisleystoff; bei Miss Marpruder war es Taiwanseide.