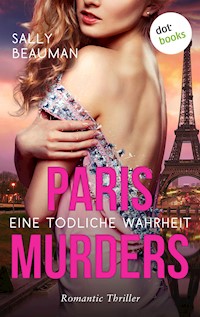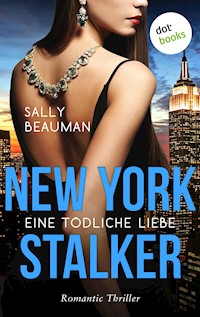
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Journalists
- Sprache: Deutsch
Er weiß alles über dich … Der fesselnde Romantik-Thriller »New York Stalker – Eine tödliche Liebe« von Sally Beauman jetzt als eBook bei dotbooks. Die Welt der Reichen und Schönen – und ihre Abgründe ... Die junge Journalistin Lindsay verlässt London, um in New York noch einmal ganz neu durchzustarten. Ein Rechercheauftrag in New Yorks Filmwelt verspricht, ihre große Chance zu werden: Colin, der unverschämt gutaussehende Assistenten des Regisseurs Tomas Court, ist gerne bereit, ihr mit seinen vielen Kontakten zu helfen – lässt aber auch ihre Knie weich werden… Trotzdem findet Lindsay schnell eine aufsehenerregende Story: Natasha Lawrence, die berühmte Schauspielerin und Exfrau von Court, musste ihre Karriere wegen den Morddrohungen eines Stalkers unterbrechen – und nun scheint der Schrecken für sie von Neuem zu beginnen. Aber woher kennt der Täter intimste Details aus Leben seines Opfers? Lindsay und Colin wollen helfen – und begeben sich in tödliche Gefahr ... »Ein raffiniert inszeniertes Versteckspiel – Thriller und Liebesgeschichte zugleich!« Kirkus Reviews Jetzt als eBook kaufen und genießen: »New York Stalker – Eine tödliche Liebe« von Bestsellerautorin Sally Beauman, ein Thriller voll prickelnder Leidenschaft und rasanter Spannung, ist der dritte Band der »Journalists«-Reihe, deren Bücher unabhängig voneinander gelesen werden können. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 914
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Welt der Reichen und Schönen – und ihre Abgründe ... Die junge Journalistin Lindsay verlässt London, um in New York noch einmal ganz neu durchzustarten. Ein Rechercheauftrag in New Yorks Filmwelt verspricht, ihre große Chance zu werden: Colin, der unverschämt gutaussehende Assistenten des Regisseurs Tomas Court, ist gerne bereit, ihr mit seinen vielen Kontakten zu helfen – lässt aber auch ihre Knie weich werden… Trotzdem findet Lindsay schnell eine aufsehenerregende Story: Natasha Lawrence, die berühmte Schauspielerin und Exfrau von Court, musste ihre Karriere wegen den Morddrohungen eines Stalkers unterbrechen – und nun scheint der Schrecken für sie von Neuem zu beginnen. Aber woher kennt der Täter intimste Details aus Leben seines Opfers? Lindsay und Colin wollen helfen – und begeben sich in tödliche Gefahr ...
Über die Autorin:
Sally Beauman (1944–2016) war eine englische Autorin und Journalistin. Sie studierte in Cambridge Englische Literaturwissenschaft und war anschließend in England und den USA als Journalistin für viele angesehene Zeitschriften wie die »New York Times« und die »Vogue« tätig. Besonders bekannt ist sie für ihre acht international erfolgreichen Bestsellerromane, die in über zwanzig Sprachen übersetzt wurden.
Sally Beauman veröffentlichte bei dotbooks bereits »Rebeccas Geheimnis«, »Das Geheimnis von Winterscombe Manor«, »Die Frauen von Wyken Abbey«, »Erben des Schicksals«.
Außerdem erscheint von ihr die Romantic-Thriller-Reihe »Journalists« mit den Titeln »London Killings – Ein tödliches Geschenk«, »Paris Murders – Eine tödliche Wahrheit« und »New York Stalker – Eine tödliche Liebe«.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »Sextett« bei Bantam Press, Transworld Publishers Ltd., London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Die Liebe einer Unbekannten« bei Goldmann.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1997 by Sally Beauman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-446-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »NEW YORK STALKER« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sally Beauman
New York Stalker – Eine tödliche Liebe
Romantic Thriller
Aus dem Englischen von Christoph Göhler
dotbooks.
Für Alexander Mackinnon fear ioúil gasda, caraid gasda, agus duine gasda.
There are terrible spirits, ghosts,in the air of America.
D. H. Lawrence, Edgar Allan Poe, 1924
Hippolyta: Was diese Liebenden erzählen, mein Gemahl, ist wundervoll.
Theseus: Mehr wundervoll wie wahr.
Ich glaubte nie an die Feenpossen und Fabeleien.
Verliebte und Verrückte sind beide von so brausendem Gehirn,
So bildungsreicher Phantasie, die wahrnimmt,
Was nie die kühlere Vernunft begreift!
So gaukelt die gewalt’ge Einbildung.
Empfindet sie nur irgendeine Freude:
Sie ahnet einen Bringer dieser Freude!
Und in der Nacht, wenn uns ein Grau’n befällt,
Wie leicht, daß man den Busch für einen Bären hält!
Shakespeare, Ein Mittsommernachtstraum (5. Akt, 1. Szene)
Erster Teil: Das Interview
Kapitel 1
Hatte sie Angst oder nicht? Das Gespräch näherte sich seinem Ende, und durch die Tür der Garderobe, in der es stattfand, drangen das Murmeln des Verkehrs und das Plätschern des Regens herein. Es war früher Nachmittag, aber es dämmerte bereits.
Beide Frauen saßen auf harten, gerade Stühlen, wobei die Schauspielerin Natasha Lawrence, den Rücken dem Ankleidetisch mit seinen diversen Spiegeln zugewandt, in dreifacher Ausführung zu sehen war. Leicht nach vorn gebeugt, die Hände im Schoß, beantwortete sie eine Frage, die ihre Arbeit betraf. Sie sprach leise, beinahe zögernd, was zusammen mit dem Plätschern des Regens und dem kaum hörbaren Summen des Luftbefeuchters von einer regelrecht einschläfernden Wirkung war. Hatte sie Angst? Dies war eine der zahlreichen Fragen, die sich ihre Gesprächspartnerin Gini Hunter zu verkneifen gezwungen war.
Wie bei vielen anderen Interviews zuvor hatte man Gini bereits vor Gesprächsbeginn zahlreiche Beschränkungen auferlegt. Während des letzten Jahres hatte Natasha Lawrence die Hauptrolle in Estella gespielt, dem Musical eines gefeierten, englischen Komponisten, das erst in London und nun in New York äußerst erfolgreich war. Das Musical basierte auf Dickens’ Roman Große Erwartungen, wobei die Romanvorlage stark verändert worden war. Die Figur der Estella, des liebreizenden, doch zugleich bösartigen Kindes, das von der verrückten Miss Havisham dazu erzogen wurde, daß es die Herzen der Männer brach, war im Musical von größerer Bedeutung als im Buch. Man war allgemein überrascht gewesen, als die Rolle von der berühmten Filmschauspielerin Natasha Lawrence, die nie zuvor öffentlich gesungen hatte, übernommen worden war. Allerdings hatte sie zur Verblüffung der Kritiker eine kräftige, natürliche, klangvolle Singstimme unter Beweis gestellt und dadurch und durch ihre nie bezweifelten schauspielerischen Fähigkeiten dazu beigetragen, daß Estella ein derartig triumphaler Erfolg beschieden war. Auch wenn Gini Hunter, eine Agnostikerin, wenn es um Musicals ging, die Leistung der Lawrence bewunderte, zog sie doch – obgleich sie es ihrer Gesprächspartnerin gegenüber sicherlich nicht äußerte – die ursprüngliche Geschichte vor.
Nun, nach einem anstrengenden Jahr, in dem sie wöchentlich achtmal auf der Bühne des Minskoff zu sehen gewesen war, kehrte Natasha Lawrence dem Theater den Rücken. Sie wurde durch eine weniger berühmte Kollegin ersetzt, was – Gerüchten zufolge – die Zahl der Kartenreservierungen bereits zurückgehen ließ. Natasha Lawrence kehrte zur Filmarbeit zurück, genauer gesagt unter die Regie ihres früheren Ehemannes Tomas Court. Wie Gini vermutete, würde dieser Film in England gedreht – doch Fragen zu diesem Thema waren unerwünscht.
Gini hatte das Interview auf die dringende Bitte eines mit ihr befreundeten Redakteurs der New York Times arrangiert. Es ging um ein letztes Gespräch mit Natasha Lawrence, ehe diese das Estella-Ensemble verließ, oder zumindest hatte sie diesen Grund der Unzahl von Pressesprechern, PR-Leuten, Sekretärinnen und Assistentinnen genannt, hinter denen sich Natasha Lawrence vor der Außenwelt sorgsam verbarg. Der wahre Grund für das Gespräch war, wie Ginis Erfahrung nach normalerweise bei fast jedem Interview, ein anderer.
»Ich habe Gerüchte gehört«, hatte Ginis Redakteur, ein junger Mann, der so eilig die Karriereleiter erklomm, daß er inzwischen kaum noch die Zeit zum Zuhören fand, gesagt. Gini hatte immer das Gefühl, daß, selbst wenn er ihr unmittelbar gegenübersaß, eines seiner Augen ständig auf das, was er als nächstes zu tun gedachte, gerichtet war. Er hatte mit Gummibändern herumgespielt, was eine lästige Angewohnheit von ihm war.
»Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte«, hatte er wiederholt, ein Gummiband über den Tisch geschnippt und es wieder aufgefangen. »Zum Beispiel Gerüchte, was ihr Verhältnis zu ihrem Exmann betrifft. Die weiße Hoffnung des amerikanischen Films et cetera, aber nach allem, was man hört, ein seltsamer Kerl. Warum die Scheidung? Immerhin arbeiten sie noch zusammen. Ich finde das eigenartig. Du nicht? Ich kann dir sagen, ich würde noch nicht mal mehr ein Flugzeug besteigen, in dem meine Exfrau sitzt.«
Er hatte eine Pause gemacht, ein ausführliches Gespräch über das Elend seiner früheren Ehe – was eines seiner Lieblingsthemen war – erwogen, Gini angesehen und es sich anders überlegt.
»Gerüchte über die Leibwächter, von denen sie ständig umgeben ist«, hatte er stattdessen gesagt und sich eine Reihe von Gummibändern über das Handgelenk geschoben. »Es heißt, sie macht keinen Schritt ohne sie. Warum? Meinst du, daß es einfach gewöhnliche Paranoia ist oder daß mehr dahintersteckt? Hat sie vielleicht Angst? Wenn ja, vor wem? Vor was?«
Gini hatte laut geseufzt. »Ich werde sie danach fragen«, hatte sie gesagt. »Obwohl ich nicht erwarte, daß sie mir darauf eine Antwort gibt. Du vielleicht?«
»Man kann nie wissen.« Der junge Mann hatte sie flüchtig angesehen, und Gini hatte gespürt, daß er das Interesse an dem Gespräch verlor. Bestimmt dachte er bereits darüber nach, auf welchem Posten er wohl morgen oder übermorgen saß. »Das Conrad«, hatte er sie überrascht. »Es heißt, daß sie es auf eine Wohnung im Conrad abgesehen hat. Warum? Prestige? Sicherheit? Natürlich kriegt sie sie nicht. Ihre Chancen auf ein Apartment dort sind genauso groß wie meine Chancen, daß man mich bittet, ins Weiße Haus zu ziehen ...« Er hatte eine Pause gemacht. »Wenn überhaupt.«
Das hatte Gini ebenso gesehen. Das Conrad, dessen Architektur einst als die Antwort der East Side auf das Dakota beschrieben worden war, galt als eine der begehrtesten, konservativen Hochburgen in ganz New York. Bei seinem Anblick ging Gini jedesmal der Gedanke an eine Festung durch den Kopf: mit Türmen und Zinnen bewerte Mauern und eine Zugbrücke, über die man nur mit einer besonderen Erlaubnis kam. Das Conrad, eine Bastion der alten Noblesse, war wohl kaum ein Gebäude, in dem eine schöne, junge, geschiedene Schauspielerin mit einem Kind zugelassen war. Natasha Lawrence hatte aus ihrer Ehe mit Tomas Court einen Jungen, der inzwischen – am besten sähe sie einmal in ihren Unterlagen nach – ungefähr sechs oder sieben war.
»Ich soll sie nach dem Conrad fragen?« hatte Gini gefragt. »Darüber spricht sie bestimmt noch weniger als über die Bodyguards, mit denen sie sich umgibt. Sonst noch was?«
»Sorg dafür, daß sie dich einen kurzen Blick in ihre Seele werfen läßt.« Der aufstrebende junge Mann verfügte, wenn er lächelte, über jede Menge Charme. »Los, Gini, du weißt schon, was ich will. Einblicke, Einblicke. Ich will wissen, wer sie wirklich ist. Was in ihr vorgeht ...«
Gini hatte ihn mit einem verächtlichen Blick bedacht und sich zum Gehen gewandt. »Wie viele Wörter?« hatte sie gefragt.
»Fünfzehnhundert.« Der junge Mann hatte sich die Gummibänder vom Handgelenk gestreift, sie in die Luft geworfen und wieder aufgefangen – was eine beachtliche Leistung war.
»Wie viele Wörter?« hatte Gini wiederholt.
»Also gut. Dreizehnhundert. Dreizehnhundert maximum.«
»Na klar. Willst du den Einblick in ihr Seelenleben in der Einleitung oder vielleicht lieber erst am Schluß? Bei dreizehnhundert Wörtern habe ich schließlich die Wahl.«
»Also bitte, Gini, keine Witze«, hatte der junge Mann gesagt.
»Warum denn nicht? Das Ganze ist doch sowieso der reinste Witz.«
»Okay, okay. Wieviel Zeit wird dir gewährt?«
»Eine Stunde. In ihrer Garderobe.«
»Tja.« Der Redakteur hatte mit den Schultern gezuckt. »Vielleicht öffnet sie dir ja trotzdem ihr Herz ...«
»Und wenn nicht? Ich bin mir sicher, es kommt nichts dabei heraus.«
»Dann fällt eben einfach ihr Photo ein bißchen größer aus«, hatte er mit einem Gähnen gesagt. »Sonst noch was?«
Jetzt fuhr die Schauspielerin in der Stille der Garderobe mit ihrer leisen, einschläfernden Stimme fort. Der Luftbefeuchter summte, und alle paar Sekunden machte der Motor eine geringfügige Störung durch, surrte, klickte und entließ eine plötzliche Wolke Wasserdampf in den Raum, ehe er wieder in seinen monotonen Rhythmus verfiel. Die Schauspielerin beantwortete eine Frage über den berühmtesten Film, den sie mit ihrem Ehemann gedreht hatte, Dead Heat. Ein höchst widersprüchlicher Film, doch Natasha Lawrence sprach auf eine gemessene, intelligente und zugleich so unpersönliche Art darüber, als wäre der Regisseur ein Fremder gewesen und als hätte nicht sie die Hauptrolle gespielt, sondern eine andere. Gini blickte in Richtung ihres Kassettenrecorders, der die ganze Zeit geduldig lief. Der Großteil der Antwort war wertlos für sie, und Gini vermutete, daß genau dies Natasha Lawrence’ Absicht war. Sie sah unauffällig auf ihre Uhr. Sie hatte noch nicht einmal mehr zehn Minuten Zeit, und immer noch hatte die Lawrence die vollkommene Kontrolle über das gesamte Interview.
»Keine persönlichen Fragen«, hatte der für die Estella-Publicity verantwortliche Pressesprecher gesagt, und alle anderen, durch die die Lawrence vor der Außenwelt behütet wurde, hatten diese Bedingung, während das Datum, die Uhrzeit und der Ort für das Interview über Wochen hinweg ständig verändert worden waren, unabläßlich wiederholt. Als letztes hatte am Vortag des Interviews die tiefe, von einem starken Akzent durchsetzte Stimme einer Frau namens Angelica, dem Drachenweib, das anderen Journalisten zufolge Natasha Lawrence’ oberste Wächterin war, diesen Befehl wiederholt.
Angelica fungierte offenbar sowohl als Natashas Hausangestellte als auch als Managerin und gleichzeitige Beschützerin, und Gini war von ihren Informanten geraten worden, ihr gegenüber stets auf der Hut zu sein. Offiziell war Angelica das Kindermädchen und die Hüterin des Sohnes der Schauspielerin, inoffiziell allerdings schien sie vor allem Natashas Hüterin zu sein.
»Keine persönlichen Fragen«, hatte sie durchs Telefon gekrächzt. »Haben Sie das verstanden? Keine Fragen über ihren Sohn, ihre Ehe, ihre Scheidung oder Tomas Court. Und bilden Sie sich ja nicht ein, Sie bräuchten nur eine Weile zu warten und könnten diesbezügliche Fragen stellen, wenn Ihr Recorder ausgeschaltet ist. Sie haben eine Stunde. In dieser Stunde können Sie sie über ihre Filme, über ihre Bühnenarbeit oder über Estella befragen. Sie ist da, um über ihre Arbeit zu sprechen, nichts anderes. Sie darf sich nicht anstrengen und muß ihre Stimme schonen. Acht Auftritte pro Woche sind sehr viel. Sie haben Glück, daß sie Sie überhaupt empfängt. Ginge es nach mir, bekämen Sie sie nicht zu Gesicht. Sie haben die Bedingungen des Interviews gesagt gekriegt, und glauben Sie ja nicht, Sie könnten sich bei ihr einschmeicheln und sie ändern, wenn Sie erst mal bei ihr sind. Auf solche Tricks fällt sie nicht rein.«
Tatsächlich nicht, dachte Gini und sah in Richtung der Schauspielerin, die, trotz ihres zarten Äußeren und ihrer sanften Stimme, eine ihr nicht unbedingt sympathische Härte nach außen zeigte. Sie hatte erwartet, daß die Lawrence ihren Argwohn nach einer Weile weit genug überwinden würde, um halbwegs aufgeschlossen zu sein, und hatte ihre Fragen zur Förderung des Mitteilungsbedürfnisses ihres Gegenübers extra vieldeutig formuliert. Außerdem hatte sie absichtlich mit Schweigen auf die Antworten der Schauspielerin reagiert – eine Technik, die bei den meisten Befragten das Bedürfnis weckte, weiterzusprechen, damit die Stille ein Ende nahm. Doch weder durch Spitzfindigkeit noch durch Stille gelangte sie ans Ziel. Natasha Lawrence sagte, was zu sagen war, und schwieg. Sie hatte ein Talent dafür, der Befragerin das Gefühl zu geben, daß sie unzulänglich war. Ohne daß sie die Fragen kritisierte oder sich auch nur die geringste Ungeduld anmerken ließ, sprach sie, als hätte sie alles genau vorausgesehen und verläse ein vorbereitetes Skript.
Sie war geschickter im Ausweichen, Ablenken und Verschweigen als die meisten Politiker, und Gini dachte, daß, wie erwartet, tatsächlich kein Durchkommen war. Sie stellte eine weitere Frage, auf die ihr die Schauspielerin erneut geduldig Antwort gab. Wie fast die ganze Zeit sprach sie, den Blick zu Boden gerichtet, so daß Gini den Raum nach irgend etwas abzusuchen begann, das ihrem ansonsten bestenfalls stilistisch guten Artikel ein wenig Farbe verlieh.
Ganz sicher hatte die Lawrence die Garderobe deshalb als Ort für das Gespräch gewählt, weil sie an Anonymität kaum zu überbieten war. Der Ankleidetisch hinter ihrem Rücken wies weder Telegramme noch Karten, noch Photos auf. Er ähnelte einem Operationstisch, nur daß er statt Tupfern, Klammern und Messern in einer ordentlichen Reihe die Instrumente von Lawrence’ Berufsstand enthielt, mit denen sie achtmal in der Woche ihr Äußeres vollkommen zu verändern verstand. Es gab weiche Pinsel, kleine Töpfe, Tuben, farbige Stifte und eine riesige Kristallschale mit rosafarbenem Puder, auf der eine ungewöhnlich stachlig wirkende, ebenfalls rosafarbene Puderquaste lag.
Auf der anderen Seite des Raumes waren in einem Regal diverse wogende Estella-Perücken aufgereiht, und daneben hingen, durch ein weißes Laken geschützt, die verschiedenen Kostüme an einer Stange, die die Lawrence als Estella trug. Wie die anderen Kleider schien auch das weiße Kleid, in dem das grausame Kind im ersten Akt auf die Bühne trat, geduldig darauf zu warten, daß ihm die Schauspielerin Leben verlieh. Das glatte, weiße Baumwollgewebe wirkte wie der Kokon, in dem der liebliche, doch giftige Schmetterling Estella vor seiner Entpuppung geborgen war.
Konnte man einen Charakter wie Estella spielen, überlegte Gini, eine Frau, die von frühester Jugend auf das Brechen von Männerherzen abgerichtet war, wenn man nicht irgendwo in seinem Inneren den Keim derartiger Eigenschaften in sich trug? Schließlich war Estella das Instrument der Rache der armen, verrückten, sitzengelassenen Miss Havisham am männlichen Geschlecht, wobei das Ziel der Rache die Ermordung der Seele des Feindes war. Gelang einem die Verkörperung einer solchen Person oder einer der anderen seltsamen, ambivalenten Frauen, als die die Lawrence in den Filmen ihres Exmannes aufgetreten war, ohne daß man sie in seiner Phantasie vor sich sah? Und konnte man sie vor sich sehen, wenn man nicht im Nebel der eigenen Psyche irgendein Körnchen in sich barg, das einen, wenn es den richtigen Boden, genügend Wasser und Nährstoffe fand, selbst in eine solche Frau verwandelte?
Sie hatte keine Antwort auf diese Frage, die, so überlegte sie flüchtig, wohl nicht nur auf Schauspielerinnen Anwendung fand. Gern hätte sie diese Überlegung zur Diskussion gestellt, doch wußte sie nicht wie, ohne daß es banal oder abgedroschen klang.
Ihr blieben weniger als fünf Minuten Zeit, und so wandte sie sich wieder ihrem Gegenüber zu. Auch wenn die Lawrence eine Berühmtheit war, wäre eine Erwähnung ihres Erscheinungsbildes in diesem Artikel erforderlich. Doch eine Beschreibung war nicht leicht. Schon des öfteren hatte Gini festgestellt, daß sich Schönheit schwer in Worte fassen ließ. Die Lawrence trug ein schlichtes schwarzes Kleid, und ihr hübscher Kopf wurde von den drei Spiegeln eingerahmt. Die beiden äußeren Spiegel dieses Triptychons waren leicht nach vorn geklappt, und alle drei wurden von nackten Glühbirnen erhellt, so daß über ihrem dunklen, schweren Haar, ihrem bleichen Gesicht und dem schlanken Hals ein Heiligenschein zu leuchten schien. Es wirkte, als hätte sie es mit mehreren identischen Frauen auf einmal zu tun; wenn sich die Lawrence bewegte oder den Kopf drehte, regten sich ihre gespenstischen Doppelgängerinnen ebenfalls.
Die Länge und das Gewicht ihrer Haare waren nur in einem Spiegel zu sehen, da sie es zusammengerollt im Nacken trug. War sie schön? Ja, dachte Gini, auch wenn nicht zu sagen war, worin genau diese Schönheit bestand. Waren es die dunklen, geraden Brauen, waren es die scharf geschnittenen Wangenknochen, oder waren es die erstaunlichen blauschwarzen Augen, in denen auf der Leinwand und auch vom hintersten Platz in einem Theater noch die winzigste Regung, noch das leiseste Aufflackern eines Gedanken zu erkennen war?
Vielleicht lag die Schönheit ihres Gesichts in seiner Beweglichkeit, denn auch wenn Natasha Lawrence völlig reglos sprach, waren ihre Züge ungewöhnlich ausdrucksstark. Sie verrieten Argwohn, Angespanntheit und Müdigkeit, verrieten, daß sie, ob allgemein furchtsam oder nicht, auf der Hut vor Fragen war. Sie sah auf ihre Uhr. Die Schauspielerin erhob sich bereits von ihrem Platz, und ihr blieben nur noch zwei Minuten Zeit.
»Macht es Ihnen etwas aus, ständig von Leibwächtern umgeben zu sein?« fragte Gini sie.
Wie erhofft war die Schauspielerin, auch wenn sie es eilig verbarg, von der Frage überrascht.
»Natürlich. Aber – es ist nun einmal erforderlich. In meiner Position ...« Sie zuckte die Schultern. »Ich lebe inzwischen seit Jahren damit. Man gewöhnt sich daran.«
»Ich habe gehört ...«, setzte Gini an und stellte den Recorder aus.
»Ich bin sicher, Sie haben eine Menge Dinge über mich gehört.« Lächelnd wandte sich die Lawrence zum Gehen.
»Ist es schlimmer, wenn man auf einer Theaterbühne steht? Ein abgeschiedener Drehort gibt einem doch sicherlich ein größeres Gefühl der Sicherheit ...«
»Nicht unbedingt. Egal, wo man ist, sicher fühlt man sich nirgendwo. Haben Sie Ihren Recorder ausgestellt? Ich möchte nicht, daß irgend etwas zu diesem Thema in Ihrem Artikel erscheint.«
Gini schob das Gerät in ihre Tasche und erhob sich ebenfalls. Plötzlich war sie die ganze Sache furchtbar leid und wartete ungeduldig darauf, daß diese Begegnung ein Ende nahm und sie aus dem Theater auf die Straße kam. Bei Interviews ging es darum, daß man Informationen bekam, aber bei dieser Art von Interview kam nur selten etwas heraus. Was ihrer Meinung nach nicht an ihr, sondern an den äußeren Voraussetzungen lag. In dem einstündigen Gespräch hatte sie kaum etwas gehört, was sich in ihr Porträt der Schauspielerin einflechten ließ; im besten Fall käme ein nichtssagender Artikel dabei heraus.
Sie sah die Lawrence an, die bereits an der Tür der Garderobe stand, und brachte ihrem jungen Redakteur zu Gefallen noch eine letzte Frage vor.
»Ist es wahr, daß Sie einen Umzug ins Conrad in Erwägung ziehen?« fragte sie.
Zu ihrer Überraschung reagierte die Schauspielerin auf diese Frage stärker als während des gesamten vorangegangenen Interviews. Sie lächelte und brach schließlich sogar in lautes Lachen aus.
»Wer hat denn diese Geschichte in die Welt gesetzt?« fragte sie. »Ins Conrad? Ich glaube kaum, daß man mich dort mit offenen Armen willkommen heißen würde, was meinen Sie? Nein, ich kehre nach Kalifornien zurück. Ich habe ein Haus in den Hügeln hinter Hollywood gekauft. Im Augenblick wird es gerade umdekoriert.« Sie stieß einen leisen Seufzer aus. »Diese Woche müßte es fertig werden, so daß ich unmittelbar nach Beendigung der Estella ...«
»Darf ich diese Information in meinem Artikel verwenden?«
»Aber sicher doch. Es ist kein Geheimnis, daß ich wieder nach Kalifornien will. Tut mir leid, aber die Stunde ist wirklich um ...«
Sie gab Gini kurz die Hand, verabschiedete sich höflich von ihr und erinnerte sie daran, daß sie – wie verabredet – zur Überprüfung der Fakten, und nur der Fakten, betonte sie und setzte erneut ein Lächeln auf, vor Veröffentlichung eine Kopie des Artikels erwartete. Dann geleitete sie Gini höflich auf den Gang hinaus, ehe sie erneut von innen die Tür der Garderobe schloß.
Gini suchte sich einen Weg durch das nach Make-up, Haarspray, Desinfektionsmitteln und Schweiß riechende Backstage-Labyrinth, ehe sie endlich durch eine Tür auf die Straße trat. Es regnete immer noch, und nach wie vor war Manhattan in graues Dämmerlicht getaucht. Am besten nähme sie den nächsten Flug nach Washington D. C., wo ihr Mann Pascal sie mit dem gemeinsamen Söhnchen erwartete. Heute war Halloween, und die Erinnerung an das Interview wurde bereits von der Vorfreude auf ihre Familie verdrängt. Eingehüllt in die bläulichen Abgase der Autos und die für den städtischen Winter typischen Gerüche von Brezeln und Röstkastanien, wandte sie sich dem Times Square zu, und noch während sie versuchte, das Interview nicht völlig aus den Gedanken zu verlieren, winkte sie ein Taxi heran und überredete den Fahrer, der ihr verzweifelt und leicht verrückt erschien und der obendrein kaum ein Wort Englisch sprach, daß er sie jetzt, ja jetzt, zum Flughafen fuhr.
Auf dem Rücksitz des Taxis klappte sie ihr Notizbuch auf, in das von ihr während des Interviews hin und wieder ein Wort gekritzelt worden war, klappte es wieder zu, beugte sich vor und begann, dem Fahrer zu erklären, wie er am besten zum Flughafen kam, was dieser entweder nicht zu verstehen oder nicht zu akzeptieren schien. Statt dem Interview wandten sich ihre Gedanken der vor ihr liegenden Reise zu: Flugzeug, dann wieder ein Taxi, bis sie in die vertrauten, sauberen Straßen von Georgetown mit ihren backsteinbelegten Gehwegen, bis sie zurück zu ihrem Mann und ihrem Sohn in das Haus ihres verstorbenen Vaters kam.
Wie eine dunkle Woge brach die Erinnerung an die vor einem Monat erfolgte Beerdigung ihres Vaters über sie herein, an die Besuche in der letzten Klinik, in der er vor seinem Tod gewesen war, an die Stationen auf dem Weg zum Ende – einem Ende, das von ihm beschleunigt worden war. Zwanzig Jahre lang täglich zwei Flaschen Bourbon, Hoffnung, die ertränkt, Talent, das vergeudet worden war, ohne daß es im Verlauf der letzten Wochen zu den von ihr erhofften Versöhnungsszenen gekommen wäre. Ihr Vater hatte als zorniger Mensch gelebt, war als zorniger Mensch gestorben, und alles, was ihr blieb, war das Bewußtsein, daß es im doppelten Sinn des Wortes hinter ihm aufzuräumen galt.
Mit jedem Block, den sie dem Haus näher kam, verstärkte sich das eigenartig weibliche Bedürfnis, Staub zu wischen, zu schrubben, zu polieren, zu fegen, das Verlangen nach einem gründlichen Reinemachen, nach dem Auslöschen ihrer angesammelten Erinnerungen aus den einunddreißig Jahren, in denen sie die ungeliebte Tochter ihres Vaters gewesen war. Dann würde das Haus verkauft, und sie, Pascal und ihr wunderbarer Sohn, dem sie in schmerzlich intensiver Liebe verbunden war, wären endlich frei. Sie könnten Washington verlassen und gehen, wohin es sie trieb. Nach Osten, Westen, Norden, Süden, vor ihnen lag ganz Amerika. Fingen sie besser mit der reinen, kräftigenden Luft der Ostküste oder mit den Plantagen und Sümpfen des noch nie besuchten, tiefen Südens an?
Sie freute sich auf ein, zwei Stunden mit ihrem Sohn. Er war noch zu jung, um Halloween zu verstehen, aber trotzdem hatten sie und Pascal am Vorabend einen dicken, orangefarbenen Kürbis ausgehöhlt und ihn mit runden Augen, einer dreieckigen Nase und einem breiten, lächelnden, freundlichen Mund verziert. Von diesem von innen durch eine Kerze erleuchteten, im Fenster stehenden Kürbis würde sie zu Hause begrüßt, ebenso wie die Kinder, die es an Halloween auf der Jagd nach süßen Geschenken an fremde Türen trieb. So weit und nicht weiter ginge sie, was den Abend vor Allerheiligen betraf. Sie wollte ihrem Sohn Lucien die Kindheit geben, die ihr nie zuteil geworden war, aber der Verlust ihres Vaters – war es wirklich ein Verlust? – lag noch zu kurz zurück, als daß sie zu einer fröhlichen Begehung der Nacht der Toten in der Lage war.
Der Kürbis würde leuchten, irgendwann ließe ihr Sohn sich davon überzeugen, daß er zum Schlafen in seiner kleinen roten Wiege lag, und dann stünde ihr ein langer ruhiger Abend mit ihrem Mann bevor. Sie würden Pläne für das Erntedankfest schmieden – ihre Freundin Lindsay Drummond käme zur gemeinsamen Feier aus England zu Besuch –, und sie sprächen über ihren amerikanischen Reiseweg, über das Buch, das Pascal zu photographieren und sie zu schreiben beabsichtigte. Sie säßen vor dem Kamin und sähen sich wie schon so oft zuvor Führer und Pläne an, bis es Zeit war, ins Bett zu gehen.
Der Gedanke an die vor ihr liegende Reise und an all die lockenden Highways, die es zu befahren galt, hellte ihre Stimmung auf, so daß Natasha Lawrence ebenso wie die Liste unbeantworteter Fragen lange, bevor der aufsässige, zappelige und aus unerfindlichen Gründen zornbebende Taxifahrer den Flughafen erreichte, vergessen war.
Die Schauspielerin vergaß das Gespräch sogar noch schneller als sie. Im Durchschnitt gab sie jede Woche zwei oder drei, vor der Premiere eines Theaterstücks oder eines Kinofilms auch mehr, Interviews, so daß sie sie als notwendiges Übel sah. Waren sie vorüber, löschte sie sie aus ihren Gedanken, und bereits fünf Minuten später hatte sie keine Erinnerung mehr an die Person, von der sie befragt, oder an das, was gesagt worden war. Als äußerst disziplinierte Frau hatte sie bereits vor Jahren gelernt, daß die Sorge um Interviews Eitelkeit, Selbstzweifel und in letzter Zeit auch Furcht wachrief, so daß sie sie lieber eilends vergaß. Klick, und schon war die Unterhaltung aus ihren Gedanken und ihrer Erinnerung fortgewischt.
Bei diesem Gespräch hatte sie einzig die Frage nach dem Conrad kurzfristig erschreckt – doch auch diese Klippe hatte sie bravourös umschifft. Klick, die letzte Stunde war gelöscht, und sofort fühlte sie sich besser als zuvor.
Ihr von anderen geplantes Leben war bestens durchorganisiert. Bereits fünf Minuten, nachdem Gini Hunter gegangen war, saß sie auf dem Rücksitz ihrer dunklen Limousine und blickte während der Fahrt nach Norden durch die getönten Scheiben auf die dämmrigen Straßen von New York hinaus. Nach einer halben Stunde war sie wieder in ihrem Apartment im Carlyle Hotel, in dem ihr ein zweistündiges Zusammensein mit ihrem Sohn beschieden wäre, ehe es wieder zurück ins Theater ging. Diese Stunden, während derer sie sich durch nichts und niemanden stören ließ, waren der einzige Augenblick am Tag, an dem sie, unbeobachtet, allein und sicher, nicht länger schauspielerte, sondern einfach sie selber war.
Heute jedoch ging ihr eine kleine zusätzliche Sorge im Kopf herum.
»Ist das Paket von Tomas gekommen?« fragte sie Angelica, als sie das Apartment betrat und ihren Mantel über einen Sessel warf.
»Nein, aber er hat angerufen. Er schickt es per Kurier ins Theater, so daß es dort sein müßte, wenn du heute abend zurückfährst.«
»Ah«, sagte Natasha, sah Angelica an, nahm den Stapel Briefe und Päckchen, den diese in den Händen hielt, und blickte ängstlich darauf hinab. Angelica stieß einen Seufzer aus.
»Alles in Ordnung«, sagte sie. »Nichts von ihm dabei. Ich habe es überprüft. Und Anrufe gab es auch nicht ...«
In Natashas Augen blitzte schwache Hoffnung auf. Sie blickte über ihre Schulter auf ihren Sohn, der mit einem Buch auf dem Sofa saß. Er hob kurz den Kopf, doch kannte er seine Mutter gut genug, um ihr keine Fragen zu stellen, so daß er weiter in der Schatzinsel blätterte, als wäre er allein im Raum ... Angelica senkte ihre Stimme.
»Das letzte Mal liegt inzwischen vier Monate zurück. Seit vier Monaten haben wir nichts mehr von ihm gehört.«
»Ich weiß.«
»So lange hat er noch nie geschwiegen.«
»Ich weiß.«
»Vielleicht ist er tot.« Angelica senkte ihre Stimme noch weiter. »Könnte schließlich sein, daß er von einem LKW überfahren worden, von einer Brücke gesprungen, zur falschen Zeit am falschen Ort rumgelaufen ist. Vielleicht hat er auch einfach eine Flasche Temazepam geschluckt. Solche Dinge passieren jeden Tag ...«
»Anderen Leuten, ja.«
»Ich habe geträumt, daß er gestorben ist. Ich habe es dir erzählt. Erst gestern habe ich es geträumt.«
»Ach, Angelica.«
Angelica gab viel auf ihre Träume, in denen oft Finsteres und manchmal auch Böswilliges geschah. Natasha Lawrence hätte ihren Träumen gern einen ebensolchen Glauben geschenkt, doch hatte die Erfahrung sie gelehrt, daß sie es besser unterließ. Angelicas Träume kehrten die Wahrheit oft um, und manchmal führten auch – wie bei den meisten Träumenden – ihre eigenen Wünsche die Regie. Die Schauspielerin sah in ihr von harten Linien durchzogenes Gesicht und auf die beiden grauen Strähnen in ihrem kurzen, schwarzen Haar. Im sanften Licht des Raumes sahen Angelicas Augen wie zwei kleine, glitzernde, schwarze Diamanten aus. Sie war von sizilianischer Abstammung, liebte und haßte mit einer Entschlossenheit und Unnachgiebigkeit, um die die Schauspielerin sie oft beneidete, und behauptete, daß sie des Verfluchens ihrer Feinde mächtig war. Vielleicht, dachte Natasha hoffnungsvoll, vielleicht hatten Angelicas komplizierte, knifflige Flüche ja endlich tatsächlich Wirkung gezeigt. Sie beugte sich vor und küßte Angelica auf die Wange.
»Wann hat Tomas angerufen?« fragte sie.
»Vor ungefähr einer Stunde. Wie gesagt, ich soll dir ausrichten, daß er das Buch ins Theater schickt. Und noch etwas anderes – eine Überraschung, hat er gesagt. Eine Art Geschenk. Klein. Du sollst es nicht übersehen, er hat es zwischen die Seiten des Buchs gelegt ...«
»Ein Geschenk? Dabei habe ich weder Geburtstag, noch haben wir irgendeinen Jahrestag. Zwischen den Seiten des Buchs?«
»Er sagte, es wäre das beste Geschenk, das er dir machen kann ...« Angelica verzog verächtlich das Gesicht. Sie hatte Tomas Court noch nie gemocht. »Was auch immer das heißt. Er sagt, du wirst es verstehen, wenn du es siehst.« Sie machte eine Pause, da ihr die Weitergabe der restlichen Nachricht nicht zu behagen schien. »Er schickt dir alle seine Liebe. Außerdem hat er sich ein bißchen mit Jonathan unterhalten ...«
Natasha Lawrence ging zu ihrem Sohn und küßte ihn auf die Stirn.
»Du hast mit Daddy gesprochen, mein Schatz? War er in Montana? War er auf der Ranch?«
»Ich schätze, ja. Ich habe vergessen, ihn zu fragen. Er hat zwei neue Pferde gekauft. Eine graue Stute für dich, sie heißt Misty, und ein kleines Pferd für mich – Diamond. Er hat gesagt, daß es eine weiße Blesse und vier weiße Fesseln hat.«
»Oh, wie hübsch.« Seine Mutter küßte ihn ein zweites Mal. »Dann war er sicher auf der Ranch.«
»Vielleicht.« Ihr Sohn runzelte die Stirn. »Ich wollte ihn fragen, aber dann habe ich ihm von meinem Buch erzählt.« Er hielt die Schatzinsel in die Luft. »Ich habe ihm alles über den blinden Pew und den schwarzen Fleck erzählt. Der blinde Pew ist ganz schön unheimlich. Er hat diesen Stock, und obwohl er blind ist, findet er jeden, den er sucht. Er spürt die Leute auf, und man kann hören, wie er kommt. Sein Stock macht die ganze Zeit tapp, tapp, tapp ...«
Seine Mutter richtete sich wieder auf und winkte Angelica unmerklich zu. »Ich glaube, ich erinnere mich«, sagte sie. »Es nimmt ein schlimmes Ende mit dem blinden Pew. Er bekommt seine gerechte Strafe ...«
»Das hat Daddy auch gesagt.«
»Wollen wir vielleicht unseren Tee trinken, mein Schatz – unseren Halloween-Tee?« Sie blickte auf ihre Uhr. »Das machen wir besser, bevor Maria zur Massage kommt. Und dann zeigst du mir und Maria dein selbstgemachtes Kostüm. Ich bin schon ganz gespannt. Aber erst trinken wir Tee. Angelica hat extra einen Halloween-Kuchen besorgt ...«
Der Kuchen hatte die Form einer Hexe, die auf einem Besen über einem Mond aus Puderzuckerglasur durch einen milchigen Schokoladenhimmel ritt. Jonathans Aufregung darüber und über sein Halloween-Kostüm rührte seine Mutter an. Er war klein für sein Alter, hatte ein winziges, irgendwie melancholisches, ausdrucksvolles Clownsgesicht, und seine Unschuld schmerzte sie. Mit seinen sieben Jahren verstand der sorgsam beschützte und verhätschelte Kleine noch nicht, wie ungewöhnlich diese Feier war. Statt wie andere Kinder auf der Suche nach kleinen Geschenken von Tür zu Tür zu ziehen, ginge er lediglich zu einer älteren Dame, die ebenfalls Gast des Carlyle war, die ihn ins Herz geschlossen hatte und deren Harmlosigkeit überprüft worden war. Dann käme er hierher zurück, zeigte Maria sein Kostüm und sähe sich, wenn seine Mutter wieder ins Theater führe, zusammen mit Angelica ein Disney-Video an, während wie immer ein Leibwächter in der Nähe war. Ihr Sohn war ein Gefangener ihres und seines Vaters Ruhm, ein Gefangener der Menschen und Kräfte, für die ein derartiger Ruhm allzu verlockend war.
Wie immer dachte sie lieber nicht länger darüber nach. Vier Monate Schweigen, sagte sie sich und versuchte, sich auf die Einzelheiten eines Tages zu konzentrieren, der von ihr voller Freude erwartet worden war – auf den Hexenkuchen, auf Jonathans Magierkostüm, auf seinen selbstgebastelten Zauberstab, auf die Sterne auf seinem Cape. Sie versuchte, so zu reagieren, wie er es erwartete, denn sie sah, wie stolz er auf seine Verkleidung war. Sie schrie furchtsam auf, als er sie verzauberte, und schrak ordnungsgemäß zusammen, als Angelica als stämmige und überzeugende Hexe den Raum betrat. Konzentrieren allerdings konnte sie sich nicht; ihre Gedanken waren bereits im Theater und bei dem mysteriösen Geschenk ihres Ehemanns. Tomas, ein Mann weniger Worte, ein Mann, der nie bedachtlos sprach, verspräche ihr nicht das beste Geschenk, wenn er nicht meinte, daß es das tatsächlich war.
»Du bist angespannt«, sagte Maria eine halbe Stunde später in Natashas Schlafzimmer, goß ein wenig von ihrem Kräuteröl in ihre Hand und setzte zu einer langsamen, rhythmischen Massage von Natashas Rücken an. Nach kurzer Zeit war der Raum vom Duft von Lavendel und Rosmarin erfüllt.
»Du bist vollkommen verkrampft«, sagte sie, während sie mit ihren Fingern Natashas Nacken knetete. »Du mußt versuchen, dich zu entspannen, wenn du heute abend gut singen willst. Worüber machst du dir Sorgen? Etwas belastet dich – ich spüre es.«
»Nichts. Alles. Das Conrad, ein Interview, das ich gegeben habe, die Aufführung heute abend, Tomas, Jonathan, das Leben als solches, weshalb ich jetzt vier Monate lang in Ruhe gelassen worden bin ... ach Maria, ich weiß es nicht.«
»Du bist einfach wunderbar«, stellte Maria seufzend fest, während sie ihre magischen Hände über Natashas Rücken gleiten ließ. »Du bist das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Lieg still. Du arbeitest einfach zu hart. Entspann dich. Du weißt, daß ich dafür sorgen kann, daß du all deine Probleme vergißt.«
Doch an diesem Abend versagte die Magie, und anderthalb Stunden vor Beginn der Aufführung kehrte Natasha Lawrence verspannter und nervöser als zuvor in ihre Theatergarderobe zurück, wo tatsächlich, wie versprochen – Tomas Court war ein Mann, der jedes Versprechen hielt –, das Paket ihres früheren Ehemannes lag.
Sie riß den wattierten Umschlag auf und zog den in dickes, braunes Papier mit der Aufschrift »Helen« gewickelten Gegenstand heraus. Sie drehte ihn hierhin und dorthin, löste schließlich das Papier und zog die erwartete Kopie eines Romans heraus, zwischen dessen Seiten sie die versprochene Überraschung fand – einen winzigen Ausschnitt aus einer Zeitung, die vor wenigen Tagen in Montana erschienen war.
Ihre Hände zitterten, und ihre Sicht verschwamm, ehe sie den Bericht über die Entdeckung einer Leiche im Glacier-Nationalpark zu lesen begann. Sie las ihn dreimal. Tatsächlich hätte Tomas ihr kein schöneres Geschenk machen können als diesen Text. Trotzdem zündete sie umgehend ein Streichholz an, hielt es an das Blatt und sah zu, wie das Papier verglomm. Anschließend zerrieb sie das Häuflein Asche zwischen ihren Fingern, wusch sich die Hände, setzte sich an den Ankleidetisch und begann mit dem Auftrag ihres Estella-Make-ups.
Als ihr Garderobier den Raum betrat, war sie – wie immer vor einer Aufführung – ruhig und konzentriert. Der androgyne junge Mann, der auf ihren Wunsch hin angeheuert worden und der jedesmal, wenn sie am Theater arbeitete, für ihre Kostüme verantwortlich war, machte sich immer so gut wie unsichtbar. Er half ihr in das weiße Baumwollkleid, in dem sie in der ersten Szene auf die Bühne trat. Für diesen Teil des Musicals, in dem Estella noch ein kleines Mädchen war, waren keine Perücken erforderlich, und Natasha machte ihr Haar immer lieber selbst zurecht, so daß der unsichtbare junge Mann lautlos den Raum verlassen und erst zurückkommen würde, wenn sie nach ihm rief.
Die Verwandlung, deren Zeuge er in der letzten halben Stunde gewesen war, faszinierte ihn. Bei seinem Eintritt hatte die Garderobe einer Frau gehört – nun jedoch blickte er, in der Tür stehend, auf ein eigenwilliges, starrsinniges Kind zurück. Er sah auf das dreifache Spiegelbild dieses Kindes, das mit dem Auftragen rosafarbenen Lippenstifts beschäftigt war, vernahm das Surren des Luftbefeuchters und fragte wie an jedem Tag: »Gleich ist es halb, Miss Lawrence. Haben Sie vielleicht noch irgendeinen Wunsch?«
Er wußte, daß die Antwort stets ein herablassendes, ungeduldiges »Nein« in der herrischen, britischen Stimme der Estella war, und als begeisterter Anhänger der Schauspielerei liebte er diese Transformation, diese vollkommene Veränderung des Charakters, der dort vor dem Spiegel saß. Wenn er sich hin und wieder vor Freunden mit den Einblicken brüstete, die ihm seine Arbeit ins Theaterleben gab, dann brüstete er sich auch mit dieser Verwandlung, deren Zeuge er an jedem Abend war. Er wartete, zog die Nase kraus und nahm durch die feuchte Luft hindurch den leicht beißenden Geruch nach Feuer wahr.
»Ein Glas Wasser. Ein wenig Honig. Meine Stimme ist ein bißchen rauh«, erwiderte die Schauspielerin, wobei sie mit ihrer normalen Stimme sprach.
Der junge Mann riß überrascht die Augen auf. Diese Abweichung von der Tradition beunruhigte ihn, auch wenn sein Unbehagen im nachhinein offenbar unbegründet war, da Natasha Lawrence’ Auftritt an diesem Abend nach übereinstimmender Auffassung sämtlicher Mitglieder des Ensembles aus unerfindlichen Gründen besonders elektrifizierend gewesen war.
Zweiter Teil: Halloween
Kapitel 2
Die Halloween-Party galt einem Film, wahrscheinlich dem Ende irgendwelcher Dreharbeiten, einer Premiere oder irgendeinem großen Geschäft im Zusammenhang mit einem Film. Der Photograph Steve Markov, der Lindsay Drummond die Einladung verschafft hatte, meinte, daß sicher der letztgenannte Grund zutreffend war. »Geld«, sagte er, als er, die ein wenig eigenartige Einladungskarte in den Händen, im Wohnzimmer von Lindsays Londoner Apartment stand. Er schnupperte theatralisch an der Karte herum. »Ich rieche Geld. Ein Coproduktionsdeal? Weiterverwertungsrechte? Anlauf des Videoverleihs in Venezuela? Wer weiß.«
Er setzte sein flüchtiges, spöttisches Lächeln auf, woraufhin Lindsay argwöhnisch das Gesicht verzog. Obgleich Markov einer ihrer ältesten Freunde war, war seine unbändige Energie hin und wieder zuviel für sie. Früher hatten andere Freunde, vor allem Gini Hunter, Markovs Einfluß auf sie gedämpft, aber seit Ginis Umzug nach Washington D. C. hatte sie das Gefühl, schutzlos zurückgelassen worden zu sein, weshalb sie nun irgendein einsames Rückzugsgefecht auszutragen gezwungen war. Im Augenblick war Markov energisch um eine Veränderung ihres von ihm als trübsinnig bezeichneten Lebens bemüht, so daß Lindsay die Einladung zu der Party als Teil seines Manövers sah. Und genau, er rückte die dunkelgetönte Brille, die er ständig trug, zurecht, lehnte sich gemütlich in den Kissen ihres Sofas zurück und bestätigte ihren Verdacht.
»Du mußt einfach auf diese Party, Lindy«, fuhr er im Ton des strengen Vaters fort. »Ich gehe, Jippy geht, und am besten gehst du ebenfalls. ›Nel mezzo del cammin‹, mein Schatz ... Fang endlich an zu leben.«
»Ich hasse diesen Satz«, erwiderte Lindsay und drehte die Einladungskarte hin und her. »Eine oberflächliche Phrase, sonst nichts.«
»Welcher Satz? Etwa mein Dante-Zitat?«
»Nein, nicht das Dante-Zitat, und hör endlich auf mit der elenden Angeberei. Außerdem kann ich es nicht leiden, wenn du mich Lindy nennst. Wie rum hält man dieses verdammte Ding überhaupt?«
»Ich glaube, daß man es vor einen Spiegel halten muß.«
Lindsay befolgte den Rat, wodurch der Text der schockierend pinkfarbenen Einladungskarte, der ihr zuvor wie Arabisch, Sanskrit oder Hieroglyphen erschienen war, lesbar wurde, wenn auch nicht unbedingt informativ.
Diablo!!! hieß es, und des weiteren folgte in kleinerem Druck der knappe Befehl: ›Lulu sagt, kommt und feiert mit ihr die Nacht von Allerheiligen.‹ Darunter waren in noch kleinerer Schrift eine Adresse in den Londoner Docklands, drei Faxnummern und das Datum von Halloween abgedruckt.
»Wer ist Lulu?« fragte Lindsay und sah sich die Karte genauer an.
»Lulu Sabatier. Du mußt sie kennen. Sie ist eine Legende. Jeder kennt Lulu Sabatier.«
»Kennst du sie, Markov?«
»Nicht persönlich.« Sein Ton wurde ausweichend. »Ich habe von ihr gehört. Sie hat von mir gehört. Und jetzt hat sie von dir gehört, so daß sie dich zu ihrer Party eingeladen hat. Nur, daß es eigentlich nicht ihre Party ist. Sie findet bei ihr statt, aber sie ist nur das Aushängeschild. Willkommen im Wunderland, Lindy. Du kennst dich doch mit Filmleuten aus. Du weißt doch sicher, wie sie arbeiten, oder nicht?«
»Mit anderen Worten, sie ist im PR-Geschäft.« Lindsay bedachte ihn mit einem kühlen Blick. »Das Ganze ist eine PR-Party. Gott steh mir bei.«
»PR? PR? Dieser Vorwurf trifft mich tief ...«
»Das Ganze weist sämtliche Merkmale einer Werbeveranstaltung auf: verzweifeltes Bemühen um Originalität, Spiegelschrift, um Himmels willen. Das alles erscheint mir wie der Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen in einer Welt, die sich gerade mal zehn Sekunden auf eine Sache konzentrieren kann. Was kommt beim nächsten Mal, Markov? Meinst du, daß sie die nächste Einladung vielleicht herübermorst?«
»Das wäre gar keine schlechte Idee. Wenn ich sie sehe, werde ich ihr ...«
»Und Diablo? Wer ist Diablo? Was ist Diablo? Wo ist Diablo?«
»Du meinst, das weißt du nicht?« Markov nahm seine dunkelgetönte Brille ab und bedachte sie mit einem mitleidigen Blick. »Lindy, wo hast du eigentlich während des letzten Monats gelebt? Auf dem Pluto vielleicht? Diablo, mein Herz, ist der Name von Tomas Courts neuer Produktionsgesellschaft, und Tomas Court, die weiße Hoffnung des amerikanischen Films, wird ebenfalls auf dieser Party sein, Lindy-Schatz. Höchstpersönlich. In Fleisch und Blut. Zumindest behauptet das Lulu, obwohl man sich natürlich auf das, was sie sagt, nicht tausendprozentig verlassen darf.«
Lindsay hatte ihren Stolz.
»Markov«, sagte sie in entschlossenem Ton. »Ich habe nicht die Absicht, auf diese Party zu gehen.«
»Deine Neugier ist geweckt. Gib zu, daß du neugierig geworden bist. Lulu hat dich geködert. Ich wußte, daß ihr das gelingt.«
»Den Teufel hat sie. Lulu? Das ist der dümmste Name, der mir seit Jahren zu Ohren gekommen ist ...«
»Früher wurde sie Pandora genannt ...«
»Was das Ganze nicht besser, sondern noch wesentlich schlimmer macht. Markov, ich gehe prinzipiell nicht auf Feste dieser Art. Dafür ist das Leben viel zu kurz.«
Sofort wurde Lindsay klar, daß diese Bemerkung ein Fehler gewesen war. Markovs Mund wurde von einem versonnenen Lächeln umspielt, und er trank genüßlich den von ihr nach dem Essen servierten Kaffee, ehe er mit gemessener Stimme sprach.
»Willst du nun dein Leben ändern oder nicht?« fragte er. »Denn, mein Schatz, ich meine mich zu erinnern, daß du letzten Monat ebenso wie den Monat zuvor noch gesagt hast ...«
»Ich weiß selbst, was ich gesagt habe.«
Lindsay erhob sich eilig von ihrem Platz, trat ans Fenster und blickte auf die vertraute Londoner Straße hinaus. Bunte Blätter wirbelten im Herbstwind herum, die Sonne schien, und alles in allem kam ihr das Wetter unangemessen optimistisch vor. Also kehrte sie dem Fenster wieder den Rücken zu, rückte ein, zwei Kissen zurecht, räumte den bereits ordentlichen Stapel Zeitungen auf, musterte die Überbleibsel des Mittagessens auf dem Tisch, nahm die Kaffeekanne und schenkte sich eine weitere Tasse Kaffee ein, obgleich sie wußte, daß sie sie nicht mehr trank.
Sie hatte gehofft, daß sich Markov durch eine dieser sinnlosen Aktivitäten ablenken ließ, aber nein. Mit der Entschlossenheit einer Kreissäge arbeitete er sich tief in ihre angeschlagene Seele vor.
»Du hast dein Alter erwähnt«, fuhr er, immer noch aufreizend lächelnd, fort, »deine Karriere und dein Heim. Ich glaube, du nanntest es ›Leeres-Nest-Syndrom‹ ...«
Lindsay stöhnte schmerzlich auf. Eine von Markovs unangenehmen Eigenschaften war sein perfektes Erinnerungsvermögen, was vergangene Gespräche betraf. Hatte sie allen Ernstes eine so banale Phrase wie ›leeres Nest‹ verwandt? Und sicher war sie nicht so tief gesunken und hatte von einem ›Syndrom‹ gefaselt, oder vielleicht doch?
»Bei dem Gespräch war ich sicher betrunken«, sagte sie. »Falls ich so etwas gesagt habe – was ich bezweifle –, dann muß ich betrunken gewesen sein. Das zählt also nicht.«
»Pech gehabt, mein Schatz. Du warst vollkommen nüchtern ...« Markov machte eine Pause und sah sie an. »Aber du warst wütend und voller Zorn. Du hast vor Entschlossenheit regelrecht gebebt. Ich war wirklich gerührt, Lindy. Beeindruckt ...«
»Hörst du wohl bitte auf?«
»›Ich habe es satt, Moderedakteurin zu sein‹, hast du gesagt. ›Ich habe die Nase voll von der Modewelt.‹ Du wolltest mit deinem Herausgeber sprechen, hast du gesagt. Und, hast du das getan?«
»Mit wem, mit Max? Nein, noch nicht.«
»Du wolltest dich verändern, du warst auf der Suche nach einer neuen Herausforderung – hast du gesagt.«
Markov stieß einen Seufzer aus, der beinahe ebenso theatralisch wie seine normale Redeweise war. »Außerdem, Darling, hast du etwas von einer Essensverabredung mit irgendeinem Verleger gesagt. Es ging um einen Vertrag. Dieser Verleger – ein wirklich großes Tier – wollte ein Buch über Coco Chanel. Und du, Lindy, wolltest es schreiben. Es war alles so gut wie abgemacht. Du meintest, dabei würdest du zwar arm, aber das wäre dir egal. Und, warst du inzwischen mit diesem Halbgott des britischen Verlegertums zum Essen aus?«
»Ich habe es verschoben. Ich brauche noch Zeit zum Nachdenken.«
»Und dann war da dieser Immobilienmakler ...« Das Kreischen der Kreissäge verschlimmerte sich. »Dieser Typ hatte zwei potentielle Käufer für dein Apartment, hast du gesagt. Er hat dir versprochen, daß er den Preis in die Höhe treibt. Er meinte, daß das hier inzwischen eine noble Londoner Gegend ist und daß du bei einem Verkauf auf jeden Fall Gewinn machen wirst. Zugegebenermaßen keinen Riesengewinn, aber auf jeden Fall genug, daß du dir davon eine nette, kleine Hütte irgendwo in der Provinz kaufen oder mieten kannst. In dieser Hütte wolltest du mit der Natur kommunizieren, Lindy. Die Rede war von einem Hund und einer Katze, von Enten und, so leid es mir tut, von einem Hühnerhof ...«
»Von einem Hühnerhof habe ich kein Wort gesagt.«
»O doch, das hast du – sogar lang und breit. Lindy, du hast diese Hütte so gut beschrieben, daß ich sie deutlich vor mir sehen kann. Sie hat einen Kamin, Patchwork-Decken auf den Betten, und du sitzt ernst und gelehrt und allein am Küchentisch und schreibst an deinem Buch.«
»Na und? Das Ganze war nichts weiter als bloße Gedankenspielerei.«
»Es war ein Hirngespinst, Lindy. Ich denke, dieser Tatsache solltest du ins Auge sehen.«
»Bisher hat es einfach noch nicht geklappt. Der Immobilienmakler, von dem die Rede war, ist bei seiner Firma rausgeflogen, so daß er mir nicht mehr weiterhelfen kann. Außerdem hatte ich bisher einfach noch keine Zeit, um mir irgendwelche Häuser anzusehen, aber ich werde es noch tun. Ich ...«
»Und, war ich etwa unfreundlich zu dir, als du mir diese Idylle beschrieben hast, Lindy? Nein, das war ich nicht. Ich habe dir geduldig zugehört und dir sogar noch Mut gemacht. Und warum? Weil ich wußte, daß der wahre Grund für dein plötzliches Bedürfnis nach Veränderung in deinem Leben ...«
»Hör bitte auf, Markov. Es reicht ...«
Lindsay vergrub den Kopf in den Händen. Allmählich bedauerte sie ihre Einladung an Markov und seinen Geliebten Jippy zum sonntäglichen Mittagessen zutiefst. Zum Teil hatte sie die beiden eingeladen, weil sie sie mochte und weil es nur selten geschah, daß sie zur selben Zeit in London waren, vor allem jedoch, weil der Sonntag, der Familientag, inzwischen für sie der härteste, einsamste und endloseste Tag der Woche war.
Seufzend hob sie den Kopf und sah sich in ihrem hübschen und vertrauten Wohnzimmer um. Dieses Apartment war seit nunmehr beinahe achtzehn Jahren ihr Zuhause, und früher hatte sie hier zusammen mit ihrem Sohn Tom und ihrer schwierigen Mutter gelebt. Dann hatte die problematische Luise überraschenderweise geheiratet, so daß sie fast gleichzeitig mit Tom, der seit zwei Jahren in Oxford Neuere Geschichte studierte, ausgezogen war. Dank der Abwesenheit der beiden, war das Zimmer auf deprimierende Weise aufgeräumt. Markov und sein Freund Jippy, der wie immer wortlos neben ihm saß, würden bald wieder gehen, und dann wäre die Wohnung auch noch deprimierend ruhig. Lindsay fürchtete sich davor.
Doch selbst die Ruhe wäre vielleicht angenehmer als Markovs unerbittliche Rede, die eine höchst unwillkommene Richtung für sie nahm. Nicht lange, dachte Lindsay, und dann spräche er auch noch den verbotenen Namen aus. Abermals sprang sie auf und rückte sinnlos Gegenstände im Zimmer herum, bis sie auf Markovs angeberische Brille sah und sich erneut in einen Sessel sinken ließ. Sie starrte auf die Brille, die fast ständig auf seiner Nase saß, und dachte, vielleicht wäre er ja wenigstens dieses eine Mal gnädig mit ihr. Er war es nicht.
»Rowland«, sagte er. »Du hast mehrmals den Namen Rowland McGuire erwähnt, was in meinen Augen bereits ein Fortschritt war. Wenigstens warst du während des Gesprächs einmal ehrlich, mein Schatz. Denn wir müssen nun einmal der Tatsache ins Auge sehen, meine Süße, daß dieser Kerl die Ursache allen Übels ist.«
»Ich habe Rowland mit keinem Wort erwähnt«, jammerte Lindsay, wobei sie einen vertrauten, defensiven Unterton in ihrer Stimme vernahm. »Nun, vielleicht ein-, zweimal, aber das war vollkommen bedeutungslos. Könnten wir jetzt endlich das Thema wechseln? Also gut, ich habe gesagt, daß ich in meinem Leben ein paar Veränderungen vornehmen will. Und das mache ich auch, Markov. Nur eben auf die Art und in der Geschwindigkeit, die mir gefallen.«
»Geschwindigkeit?« Markov stieß ein verächtliches Schnauben aus. Er sah auf seine Uhr und stand vom Sofa auf. »Geschwindigkeit? Lindy, das, was du Geschwindigkeit nennst, ist der Inbegriff der Schwerfälligkeit. Eine Schnecke wäre schneller als du, die du wie eine Klette an den Dingen hängst. Du bist von chronischer Trägheit und erschreckender Unentschlossenheit. Es müssen wahrscheinlich mindestens zweihundert Jahre vergehen, bis du dich auch nur einen Millimeter von der Stelle bewegst ...«
»Es reicht, Markov.«
»Und warum das Ganze? Wegen eines Mannes? Wegen diesem Mann. Lindy, du mußt dich von diesem Mann befreien, und zwar möglichst schnell. Für diesen Mann bist du unsichtbar. Weniger als ein Staubkorn an einem fernen Horizont. Wann siehst du das endlich ein?«
»Ich habe es bereits eingesehen. Ich habe es fast eingesehen.«
»Lindy, ich werde jetzt auf brutale Weise ehrlich zu dir sein.« Markov richtete sich zu seiner vollen Größe auf. »Du, Lindy, bist einfach nicht sein Typ. Gott allein weiß, was sein Typ ist, aber du bist es nicht. Ich denke, er ist ein Narr, Jippy denkt, er ist ein Narr, aber du vergötterst ihn. Vor drei Jahren dachte ich, wir könnten dafür sorgen, daß er Vernunft annimmt. Falls du dich erinnerst, habe ich eine Menge Zeit und Energie in dieses Vorhaben investiert ...«
»Ich erinnere mich durchaus. Auch wenn es vollkommen sinnlos gewesen war.«
»Genau. Was ist dabei herausgekommen? Nada. Nichts. Und so ist der Augenblick gekommen, Lindy-Schatz, in dem du das Unternehmen abblasen solltest, wenn du den Schaden begrenzen willst. Du mußt sehen, meine Liebe, daß du einen Zug in die nächste Stadt entlang der Straße des Lebens bekommst ...«
»Markov, bitte. Verschon mich mit solchem Gewäsch.«
»Und daß du den elenden Hurensohn dabei auf dem Bahnsteig stehenläßt. Habe ich recht oder nicht?«
»Du hast recht, aber ein Hurensohn ist er nicht. Er ist gut, er ist freundlich, er ist clever, er ist hübsch, und er ist nett.«
»Er ist blind.« Markov setzte eine strenge Miene auf. »Was du brauchst, meine liebe Lindy, ist ein McGuire-Antibiotikum ...«
»Ich weiß. Und ich nehme es bereits. Ich bin mitten in der Behandlung ...«
»Ach ja? Und wann schlägt diese Behandlung endlich an?«
»Ende des Monats. Ende dieses Monats. Ich habe mir selbst eine Frist gesetzt, Markov. Ehrlich ...«
Beinahe umgehend merkte Lindsay, daß diese spontane Antwort abermals ein Fehler gewesen war. Markovs Mund umspielte erneut ein listiges Lächeln, und der ruhige, sanfte Jippy stieß einen mitleidigen Seufzer aus. Als sein Blick auf die vor ihm liegende, pinkfarbene Einladungskarte fiel, nahm Markov sie eilig in die Hand.
»Diese Party«, sagte er mit Nachdruck, »findet am letzten Tag dieses Monats statt. Jetzt hast du noch einen Grund mehr, hinzugehen. Sieh es als Feier deiner neugewonnenen Freiheit an. Du lernst neue Leute kennen, gewinnst neue Freunde und fängst dein neues McGuire-loses Leben gleich so richtig schwungvoll an.«
»Na, vielen Dank.«
Lindsay nahm Markov die Karte aus der Hand und schob sie in die Tasche seiner chartreusefarbenen Jacke zurück. Da sie jedoch wußte, daß Markov hinter seiner gezierten Redeweise und Kleidung ein goldenes Herz verbarg, klopfte sie ihm auf die Brust und bedeckte seine Wange mit einem liebevollen Kuß.
»Wirklich, Markov, ich weiß, es ist gut gemeint, aber ich hätte dort bestimmt keinen Spaß. Ich kenne dort niemanden ...«
»Genau darum geht es ja.«
»Du und Jippy geht hin, und hinterher erzählt ihr mir ausführlich, wie es gewesen ist. Die Party findet am Abend vor eurer Griechenlandreise statt, nicht wahr? Dann könnt ihr mir davon berichten, wenn ihr wieder zu Hause seid. Auf diese Weise habt ihr genügend Zeit, um euch eine tolle Geschichte auszudenken – wer alles da war, was ich alles verpaßt habe, nur, weil ich so starrsinnig war ...«
Markov, der nur selten zögerte, trat von einem Fuß auf den anderen und sah sie verlegen an.
»Jippy denkt, du solltest hingehen«, brachte er schließlich vor. »In der Tat war das alles Jippys Idee. Du hast doch den Vorschlag gemacht, Jippy, nicht wahr?«
Es war Jippys hervorstechendste Eigenschaft, daß er nur sprach, wenn es sich wirklich nicht vermeiden ließ. Wie immer hatte er auch heute wortlos Lindsays Wohnung betreten, wortlos sein Essen verzehrt und anschließend wie ein kleiner, gütiger Schatten neben Markov gesessen, ohne daß auch nur eine Silbe über seine Lippen gedrungen war. Nun, da man eine direkte Antwort von ihm erwartete, erhob er sich von seinem Platz. Jippy war Stotterer. »J-j-ja«, sagte er.
Diese unerwartete Bestätigung brachte Lindsay aus dem Gleichgewicht. Bei ihrer ersten Begegnung mit Jippy vor zwei Jahren hatte sie angenommen, daß er deshalb so wenig von sich gab, weil er stotterte, doch mit der Zeit hatte sie herausgefunden, daß der Grund für sein Schweigen tiefer lag.
Jippy war einer der wenigen Menschen, die nur sprachen, wenn es etwas Bedeutendes zu sagen gab. Wenn er also etwas sagte, dann waren seine Bemerkungen, auch wenn man sie manchmal nur schwer verstand, bei aller Kürze von einer Eindeutigkeit und Weisheit, für die Lindsay Bewunderung empfand. Sie sah ihn zärtlich an, und mit einem Mal wallten Zweifel in ihr auf. Jippy war ein kleiner, vierschrötiger Mann mit kurzem dunklem Haar, sanften Augen und einem kindlichen Gemüt. Lindsay selbst war nicht groß, aber Jippy war mit seinen knapp ein Meter fünfundfünfzig noch kleiner als sie. Sie wußte nicht, wie alt er war, fünfunddreißig oder auch jünger vielleicht, aber bei bestimmtem Licht sah er wesentlich älter aus – als wäre er, wie Markov sagte, bereits seit Hunderten von Jahren auf der Welt.
Anders als der eher grell gekleidete Markov, kultivierte Jippy, was seine Garderobe betraf, eher die Unauffälligkeit. Wie gewöhnlich trug er auch heute saubere, gebügelte Jeans, einen marineblauen Pullover, der auch zu einem Schuljungen gepaßt hätte, und ein weißes Hemd. Seine altmodischen Schnürschuhe waren blank poliert, und auf eine Weise, die Lindsay stets schmerzlich traurig erschien, war er immer geschniegelt wie auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch – wobei seine schüchterne und zugleich hoffnungsvolle, hartnäckige und zugleich melancholische Miene darauf schließen ließ, daß Jippy den Job niemals bekam.
In einer Menschenmenge hätte wohl niemand zweimal hingesehen – was, wie Lindsay vermutete, wahrscheinlich seine Absicht war –, aber wenn man ihn genauer betrachtete, strahlte er eine kraftvolle und beunruhigende Güte aus. Wie genau er das machte, wußte Lindsay nicht, denn außer von seinen Augen, deren Blick so ruhig war, als sehe er immer nur das Beste von anderen, und gleichzeitig so voller Trauer, ging diese Güte von keiner sichtbaren Quelle aus.
Jippys Vergangenheit war in vielerlei Hinsicht obskur: Lindsay hatte nie herausbekommen, wie er wirklich hieß, wo er gelebt und als was er gearbeitet hatte, ehe er Markov traf, oder auch nur, wie er diesem begegnet war. Was jedoch seine Abstammung betraf, so war er aus irgendeinem Grund ungewöhnlich akkurat. Er war zur Hälfte Weißrusse, zu einem Viertel Armenier, zu einem Achtel Brite und zu einem Achtel Grieche – in diesem Punkt war Jippy von pedantischer Genauigkeit. Er war Markovs photographischer Assistent und sein Geliebter und Markov zufolge bei der Arbeit in der Dunkelkammer ein Genie, ohne dessen Hilfe sich keines von Markovs jüngsten Experimenten mit Silber- und Platindrucken realisieren ließ. Lindsay wußte so gut wie nichts über ihn, außer einer Sache, die, ob wahr oder unwahr, für Markov von besonderer Bedeutung war. Er behauptete, von seiner armenischen Großmutter hätte Jippy das zweite Gesicht geerbt.
Markov sagte, daß er ein begabter Astrologe war; er konnte aus den Händen lesen, die Aura eines Menschen spüren und in unerwarteten Augenblicken in die Zukunft sehen. Es hieß, daß Jippy diese hellseherische Fähigkeit, ob sie nun ein Fluch oder ein Segen war, stets mit Tapferkeit und Behutsamkeit ertrug. »Auf Jippy sollte man hören«, sagte Markov stets. »Er ist der siebte Sohn eines siebten Sohns, und glaub mir, mit einem solchen Mann streitet man sich besser nicht.«
Natürlich liebte Markov ihn, weshalb seine Sicht von Jippy nicht unbedingt objektiv zu nennen war, aber auch Lindsay, die vertrauensseliger und abergläubischer war, als es ihr gefiel, sah keinen Grund zu einem Streit. Bereits bei ihrer ersten Begegnung hatte Jippy es ihr angetan. Sie mochte sein Erscheinungsbild, mochte seine Schweigsamkeit, mochte sein Stottern, mochte ihn.
Als sie also nun erfuhr, daß der Vorschlag, sie auf diese lächerliche Party einzuladen, von Jippy gekommen und daß er nicht einer von Markovs abwegigen, schwachsinnigen Ideen gewesen war, sah sie die Einladung plötzlich in einem gänzlich anderen Licht. Wäre es möglich, könnte es sein, daß ... Jippy etwas Schicksalhaftes auf der Party sah, das ihr als Nichtsehende verborgen blieb? Jippy sah sie mit seinen ruhigen, glänzenden, braunen Augen an. Vielleicht hatte sie ihre Entscheidung etwas übereilt getroffen. Was konnte es schon schaden, wenn sie sich kurz auf der Party blicken ließ? Die Hoffnung, daß sie dort vielleicht endlich einen neuen Sinn und eine neue Richtung für ihr Leben fand, war wirklich verführerisch.
Schlimmstenfalls ginge sie das Risiko eines langweiligen Abends ein; die Flucht wäre leicht; sie wäre frei. Hatte sie nicht, wie ihr eben erst von Markov unangenehmerweise in Erinnerung gerufen worden war, den Entschluß gefaßt, aus der Unentschlossenheit und der Trägheit auszubrechen, von denen sie während der letzten drei Jahre beherrscht worden war? Andererseits war Jippy natürlich, was gesellschaftliche Veranstaltungen betraf, ein unbeschriebenes Blatt. Es würde sicherlich ein grauenhaftes Fest mit Leuten, die sie nicht kannte und an deren Bekanntschaft ihr auch nicht im geringsten gelegen war. Ja, vielleicht wäre es interessant, Tomas Court zu begegnen, dessen Filme sie sehr bewunderte, aber ein flüchtiger Blickwechsel oder ein kurzes Händeschütteln mit dem Mann war sicher das höchste, was sie erwarten durfte, und sie könnte, so dachte sie, durchaus leben, ohne daß es dazu kam.