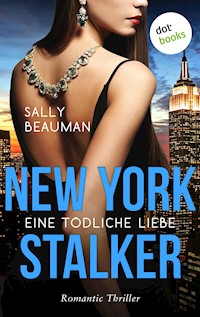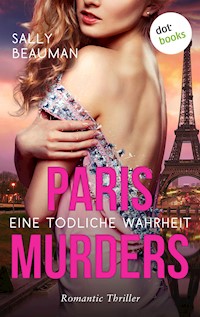Rebeccas Geheimnis - Die Fortsetzung des Weltbestsellers REBECCA von Daphne du Maurier E-Book
Sally Beauman
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Familiengeheimnis, so faszinierend und mitreißend wie ein Thriller: »Rebeccas Geheimnis« von Bestsellerautorin Sally Beauman als eBook bei dotbooks. Manche Seelen finden keine Ruhe … England, 1951. Zwanzig Jahre sind seit dem Verschwinden von Rebecca de Winter vergangen, doch noch immer zieht das Rätsel um die legendäre Schönheit weite Kreise: Oberst Julyan, der damals ermittelte, hat sich immer geweigert zu glauben, dass Rebecca Selbstmord beging, auch wenn alles dafür zu sprechen schien. Ist der lang zu den Akten gelegte Fall für ihn zur gefährlichen Obsession geworden? Als der junge Terrence Grey den Fall neu aufrollen will, schöpft Julyans Tochter Ellie neue Hoffnung, dass dies ihrem Vater endlich Frieden schenken wird. Gemeinsam machen die drei sich auf die Suche nach der Wahrheit – aber dies wird ihr Schicksal auf ungeahnte Weise verändern … Die offizielle Fortsetzung des internationalen Bestsellers »REBECCA« von Daphne du Maurier: »Ein äußerst gelungener Roman, sehr romantisch und mit einem unglaublich guten Sinn für Atmosphäre.« Kate Saunders, DAILY EXPRESS Jetzt als eBook kaufen und genießen: der fesselnde Roman »Rebeccas Geheimnis« von Bestsellerautorin Sally Beauman verwebt wie sein berühmter Vorgänger die Elemente eines Schauerromans und eines psychologischen Thrillers zu einem großartigen Lesevergnügen, sodass man sich wünscht, auch er könnte von Alfred Hitchcock verfilmt werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 920
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Manche Seelen finden keine Ruhe … England, 1951. Zwanzig Jahre sind seit dem Verschwinden von Rebecca de Winter vergangen, doch noch immer zieht das Rätsel um die legendäre Schönheit weite Kreise: Oberst Julyan, der damals ermittelte, hat sich immer geweigert zu glauben, dass Rebecca Selbstmord beging, auch wenn alles dafür zu sprechen schien. Ist der lang zu den Akten gelegte Fall für ihn zur gefährlichen Obsession geworden? Als der junge Terrence Grey den Fall neu aufrollen will, schöpft Julyans Tochter Ellie neue Hoffnung, dass dies ihrem Vater endlich Frieden schenken wird. Gemeinsam machen die drei sich auf die Suche nach der Wahrheit – aber dies wird ihr Schicksal auf ungeahnte Weise verändern …
Die offizielle Fortsetzung des internationalen Bestsellers »REBECCA« von Daphne du Maurier:
»Ein äußerst gelungener Roman, sehr romantisch und mit einem unglaublich guten Sinn für Atmosphäre.« Kate Saunders, DAILY EXPRESS
Über die Autorin:
Sally Beauman (1944–2016) war eine englische Autorin und Journalistin. Sie studierte in Cambridge Englische Literaturwissenschaft und war anschließend in England und den USA als Journalistin für viele angesehene Zeitschriften wie die »New York Times« und die »Vogue« tätig. Besonders bekannt ist sie für ihre acht international erfolgreichen Bestsellerromane, die in über zwanzig Sprachen übersetzt wurden.
***
eBook-Neuausgabe November 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2001 unter dem Originaltitel »Rebecca’s Tale« bei Little, Brown and Company, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2001 by Sally Beauman
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2002 Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Mark Spokes / Man Johnston / Plotnikova Olga / Margrit Hirsch / Moolkum / Gayvoronskaya_Yana / Jusky sowie © pixabay / fotshot
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-871-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Rebeccas Geheimnis« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sally Beauman
Rebeccas Geheimnis
Roman – Die Fortsetzung des Weltbestsellers REBECCA von Daphne du Maurier
Aus dem Englischen von Barbara Röhl
dotbooks.
Wir fuhren vor Morgengrauen über gefrornes Feld,
Der rote Flügel hob sich, noch war es Nacht.
Und plötzlich lief dicht vor uns ein Hase vorbei,
Und einer von uns zeigte auf ihn mit der Hand.
Das war vor langer Zeit. Sie leben heute nicht mehr,
Der Hase nicht und nicht der ihn entdeckte.
Du meine Liebe, wo sind sie, wohin verrinnen
Die Blitze der Hand, die Linien des Laufs, das Rascheln der Scholle –
Ich frage danach nicht in Trauer, nur im Besinnen.
BEGEGNUNG: Czeslaw Milosz, Gedichte 1933–1981
Sie dachten, das lohne den Tod, aber ich
Habe ein Selbst, eine Königin aufzulesen.
Ist sie tot oder schläft sie?
Wo ist sie gewesen
Mit ihrem löwenroten Leib, ihren Flügeln aus Glas?
Nun fliegt sie,
Schrecklicher als sie je war, eine rote
Narbe am Himmel, ein roter Komet,
Über den Motor, der sie getötet hat –
Das Mausoleum, das Wachshaus.
STICHE: Sylvia Plath, Ariel
Teil I
Julyan
12. April 1951
Kapitel 1
Heute Nacht träumte mir, dass ich wieder nach Manderley fuhr. Diese quälenden Bilder treten jetzt beunruhigend oft auf, und ich beginne sie zu fürchten. Alle Träume von Manderley lassen mir das Blut in den Adern stocken, aber dieser war fraglos bisher der schlimmste.
Im Schlaf rief ich Rebeccas Namen, so laut, dass ich davon erwachte. Kerzengerade saß ich dann da, starrte in die Finsternis und fürchtete, wenn ich nach dem Lichtschalter griff, könnte diese kleine Hand sich wieder um die meine legen. Ich hörte nackte Füße über den Korridor tappen. Immer noch in meinem Traum befangen, erlebte ich immer wieder den grauenvollen Moment, in dem der winzige Sarg sich zu bewegen begann. Wohin hatte ich ihn gebracht? Warum war er so klein gewesen?
Die Tür öffnete sich, ein schmaler Lichtstrahl huschte über die Wände, und eine blasse Silhouette bewegte sich lautlos auf mich zu. Erschrocken stöhnte ich auf. Dann sah ich, dass das Gespenst einen Morgenmantel trug und sein Haar zerzaust war. Ich zog die Möglichkeit in Betracht, dass es sich um meine Tochter handelte – aber war sie wirklich da, oder gehörte sie ebenfalls in meinen Traum? Sobald ich mir sicher war, dass die Gestalt tatsächlich Ellie war, ließ mein Herzklopfen nach, und der Traum verblasste ein wenig. Ellie verbarg ihre Besorgnis hinter häuslichem Getue: Sie holte mir warme Milch und Aspirin, zündete den Gasofen an, schüttelte meine Kissen auf und machte sich an meinem auf Abwege geratenen Federbett zu schaffen. Eine halbe Stunde später, als wir beide ruhiger waren, gab sie meinem Eigensinn die Schuld an meinem Albtraum – und meiner Schwäche, spätabends noch Brot und Käse zu naschen.
Diese angebliche Magenverstimmung sollte mich beruhigen – und sie lieferte Ellie einen guten Vorwand für ihre besorgten Fragen nach meinen Schmerzen. Ob ich Stiche in der Herzgegend spüre? Allerdings, aber davon sagte ich nichts. Atembeschwerden? »Nein, ich habe verdammt noch mal nichts dergleichen«, knurrte ich. »Das war nur ein Albtraum, nichts weiter. Mach um Himmels willen keinen solchen Wirbel, Ellie, und hör auf, so herumzuwieseln …«
»Quatsch!«, erwiderte meine wunderschöne, aufgeregte unverheiratete Tochter. »Warum hörst du nicht auf mich, Daddy? Nicht einmal, sondern tausendmal habe ich dich gewarnt …«
In der Tat. Aber ich bin noch nie gut darin gewesen, Warnungen zu beherzigen, einschließlich meiner eigenen.
Schließlich pflichtete ich ihr bei, dass meine Gelüste um elf Uhr abends schuld gewesen waren; ich gab zu, dass es unbesonnen und unklug gewesen war, meine gesamte Wochenration Cheddarkäse – eine ganze Unze! – auf einmal zu verschlingen. Inzwischen waren meine Ängste verflogen, und eine vertraute Trostlosigkeit ergriff Besitz von mir. Ellie stand am Fußende meines Betts und umklammerte das Messinggestell. Ihr offener Blick ruhte auf meinem Gesicht. Mitternacht war vorüber. Meine Tochter ist mit Unschuld gesegnet, aber sie lässt sich von niemandem zum Narren halten. Sie sah auf ihre Uhr. »Es ist Rebecca, stimmt’s?«, fragte sie in sanftem Ton. »Heute ist ihr Todestag – und das macht dir immer zu schaffen, Daddy. Warum machen wir uns etwas vor?«
Weil das besser so ist, hätte ich antworten können. Rebecca ist jetzt zwanzig Jahre tot, und damit habe ich zwei Jahrzehnte Zeit gehabt, die Vorteile solcher Selbsttäuschungen kennen zu lernen. Das war allerdings nicht die Antwort, die ich Ellie gab; tatsächlich sagte ich überhaupt nichts darauf. Irgendetwas – vielleicht der Ausdruck in ihren Augen, der Umstand, dass ihre Stimme weder vorwurfsvoll noch anklagend klang, oder einfach die Tatsache, dass meine einunddreißigjährige Tochter mich immer noch »Daddy« nennt – irgendetwas jedenfalls versetzte mir an diesem Punkt einen Stich. Ich sah zur Seite, und der Raum verschwamm vor meinen Augen.
Ich lauschte dem Rauschen des Meeres, das in ruhigen Nächten, wenn der Wind es nicht übertönt, in meinem Schlafzimmer deutlich zu vernehmen ist. Die Wellen schlugen gegen die Felsen der kargen kleinen Bucht unterhalb meines Gartens: Flut. »Öffne das Fenster ein wenig, Ellie«, bat ich.
Ellie, die sehr feinfühlig ist, tat dies ohne weitere Bemerkungen oder Fragen. Über die vom Mond erhellte Bucht sah sie zu der Landspitze gegenüber, auf der Manderley liegt. Das große, heute verfallene Haus der de Winters ist weniger als eine Meile Luftlinie entfernt. Wenn man sich ihm über Land nähert, scheint die Strecke weit zu sein, da unsere Landstraßen hier schmal und gewunden sind und in zahlreichen Schleifen um die vielen kleinen Buchten verlaufen, die in unsere Küste einschneiden; aber per Boot ist es schnell zu erreichen. In meiner Jugend bin ich mit Maxim de Winter häufig in meinem Dingi hinübergesegelt. Dann pflegten wir in der Bucht unterhalb von Manderley anzulegen – derselben, in der Jahrzehnte später seine junge Frau Rebecca unter mysteriösen Umständen ums Leben kommen sollte.
Ein leises Stöhnen drang aus meiner Kehle, das Ellie nicht zu hören vorgab. Sie fuhr fort, über das Wasser zur Landzunge von Manderley zu schauen, auf die Felsen, die die Spitze der Halbinsel bezeichnen, den Wald, der das Haus schützt und vor Blicken abschirmt. Ich dachte, sie würde vielleicht sprechen, aber das tat sie nicht; stattdessen seufzte sie leise, öffnete den Fensterflügel ein wenig, wie ich sie gebeten hatte, und wandte sich mit resignierter Miene ab. Sie ließ die Vorhänge einen Spaltbreit offen, machte mich zum Schlafen fertig und ließ mich dann mit einem letzten sorgenvollen, bedauernden Blick allein mit der Vergangenheit.
Ein schmaler, heller Streifen Mondlicht fiel schräg ins Zimmer, und die Luft trug einen Hauch von Salz und Meeresfrische heran. Rebecca trat vor mein inneres Auge. Wieder sah ich sie wie beim ersten Mal, als ich noch nicht ahnte, welche Macht sie später über mein Leben und meine Vorstellungskraft ausüben sollte – obgleich die meisten Menschen bestreiten würden, dass ich überhaupt so etwas wie Fantasie besitze. Immer wieder sah ich sie in den Salon von Manderley treten, der einem gewaltigen Mausoleum glich – ein Raum, ja ein ganzes Haus, das sie binnen kurzem vollständig verwandeln würde. Sie war sich nicht bewusst gewesen, dass jemand auf sie wartete, und stürmte herein, brach aus dem hellen Sonnenlicht hervor: eine seit drei Monaten verheiratete Braut, eine junge Frau in einem weißen Kleid, an dem direkt über ihrem Herzen eine winzige blaue Emailbrosche in Form eines Schmetterlings steckte.
Durch den Tunnel der Jahre betrachtete ich sie. Immer wieder blieb sie, genau wie damals, stehen, als ich aus dem Halbdunkel trat. Wieder und wieder sah ich in ihre außerordentlichen Augen. Kummer und Schuldgefühle stiegen in meinem Herzen auf.
Ich wandte den Blick von dem Streifen Mondlicht ab. Wie alle früh Verstorbenen bleibt Rebecca ewig jung; ich habe weitergelebt und bin alt geworden. Mein Herz pumpt nicht mehr allzu kräftig; wenn man unserem Arzt glaubt, einem notorischen Unheilspropheten, haben die Arterien sich verengt, und es weist Anzeichen einer Klappenstörung mit einem unaussprechlichen Namen auf. Vielleicht läuft der Motor noch ein paar Jahre, andererseits könnte ich auch morgen früh umfallen. Kurz gesagt, ich habe möglicherweise nicht mehr viel Zeit und sollte – wie der gute Doktor das gern ausdrückt – »meine Angelegenheiten bald in Ordnung bringen«. Eingedenk dessen und in Erinnerung an meinen Traum gestand ich mir ein, dass ich aus Gründen, die ich stets bewusst nicht genau untersucht habe, seit Jahrzehnten gezaudert, Ausflüchte gesucht und mir, wie Ellie zu Recht bemerkte, etwas vorgemacht habe. Zu lange habe ich die Wahrheit über Rebecca de Winter verborgen.
Ich spürte, wie sich etwas in mir veränderte. Auf der Stelle beschloss ich, Frieden mit den Toten zu schließen. Eine kluge Wahl des Zeitpunkts, zweifellos beeinflusst durch den Umstand, dass ich jeden Moment den Löffel abgeben und mich zu ihnen gesellen konnte – das will ich gern zugeben. Wie auch immer, ich beschloss, zum ersten Mal alles, was ich über Manderley, die de Winters, Rebecca, ihr geheimnisumwobenes Leben und ihren mysteriösen Tod weiß, aufzuzeichnen und nichts auszulassen – und aus Gründen, die ich später erläutern werde, weiß ich mehr als andere, ich weiß eine ganze Menge. Dort in meinem Zimmer, wo der Mondschein die vertraute Umgebung fremd erscheinen ließ, traf ich meinen Entschluss.
Es war zwei Uhr morgens. Als ich endlich die Augen schloss, wobei ich fürchtete, mein Traum werde wiederkehren, konnte ich immer noch den Atem der See hören, obwohl die Ebbe eingesetzt hatte und das Wasser jetzt schnell zurückwich.
Kapitel 2
Ich bin ein alter Soldat. Militärische Gewohnheiten haben Bestand, und sobald ich mich endlich zu etwas entschlossen habe, handle ich.
»Ellie«, erklärte ich bei einem guten Frühstück aus Speck und Eiern, »heute Nachmittag wollen wir im Wald von Manderley spazieren gehen. Ich werde Terence Grey anrufen und ihn bitten, uns zu begleiten. Ihn juckt es schon lange, dort herumzuschnüffeln, daher bezweifle ich, dass er ablehnen wird.«
Meine Ankündigung wurde mit einem kurzen Schweigen quittiert. Ellie, die zwischen Herd und Küchentisch hin und her geflitzt war, drückte mir einen Kuss aufs Haar – eine Vertraulichkeit, die sie sich nur erlauben kann, wenn ich sitze, denn im Stehen bin ich zu groß für solche Faxen. »Wie schneidig du heute Morgen bist«, rief sie aus. »Sehr stattlich! Ist der Schlips neu? Fühlst du dich besser? Du siehst jedenfalls besser aus. Aber bist du dir sicher, dass …«
»Bin munter wie ein Fisch im Wasser«, versicherte ich energisch. »Also fang nicht wieder an, Ellie. Grey ist seit Ewigkeiten darauf aus, nach Manderley zu kommen, und ich kann ihn nicht immer hinhalten. Heute ist der Tag!«
»Wenn du dir sicher bist«, meinte Ellie nachdenklich. Sie nahm mir gegenüber Platz und hantierte zuerst mit ihrer Serviette, dann mit der Morgenpost; ihre Wangen liefen rosig an. »Vielleicht würde er gern zuerst zum Mittagessen kommen«, fuhr sie beiläufig fort. »Das würde dir doch sicher Spaß machen. Oh, sieh mal, da ist ein Päckchen für dich. Das ist ungewöhnlich. Mal etwas anderes als Rechnungen …«
Spürte ich schon da eine Vorahnung? Vielleicht, denn ich beschloss, das Päckchen nicht in Ellies Anwesenheit zu öffnen, obwohl es nichts besonders Bemerkenswertes aufwies – das dachte ich damals zumindest. Ein stabiler brauner Umschlag, mit Klebeband verschlossen, der etwas enthielt, das sich wie eine Art Broschüre anfühlte; adressiert war er an Herrn A. L. Julyan, J. P., The Pines, Kerrith. Das war insofern bemerkenswert, als die meisten Menschen mich immer noch als »Oberst Julyan« ansprechen, obwohl ich schon vor fast einem Vierteljahrhundert meinen Abschied von der Armee genommen habe. Das »J. P.« für »Justice of the Peace« war nicht korrekt; es ist fünfzehn Jahre her, dass ich hier als Friedensrichter tätig war. Ich erkannte weder die Handschrift, noch hätte ich sagen können, ob sie von einem Mann oder einer Frau stammte – und dabei finde ich, dass man für gewöhnlich eine weibliche Schrift erkennt. Frauen können gewissen blumigen kalligraphischen Tricks und Schnörkeln nicht widerstehen, die ein Mann vermeiden würde.
Ich gebe zu, dass ich mich über das Päckchen freute. Heutzutage bekomme ich sehr wenige Briefe, da die meisten meiner früheren Freunde und Kollegen schon lange den Rasen von unten betrachten. Sicher, meine Schwester Rose, die Dozentin in Cambridge ist, schreibt gelegentlich, aber ihre gelehrte Spinnwebschrift ist ebenso unverkennbar wie unleserlich. Von ihr stammte der Umschlag nicht. Ich schleppte ihn in mein Arbeitszimmer wie ein Köter einen Knochen, während mein eigener Hund, der alte Barker, der zu alt und zahnlos ist, um sich mit Knochen abzugeben, hinter mir hertrottete. Dort ließ Barker sich auf dem Kaminvorleger nieder, und ich setzte mich an den Schreibtisch meines Vaters gegenüber dem undichten Erkerfenster, aus dem man auf eine schwermütige Araukarie, eine Palme, ein paar verkümmerte Rosen und über eine kleine Terrasse aufs Meer blickt.
Ich nahm meinen Federhalter zur Hand und begann die Liste meiner morgendlichen Aufgaben niederzuschreiben. Selbst heute behalte ich diese Gewohnheit bei, die mir seit meinen Tagen als Subalternoffizier in Fleisch und Blut übergegangen ist. Immer noch schreibe ich jeden Tag diese verflixten Listen, obwohl sie selbst meine große Erfindungsgabe auf die Probe stellen. Ich kann wohl kaum schreiben »herumkramen«, »Schreibtisch aufräumen« oder »Daily Telegraph lesen, bis die Dämlichkeit der modernen Welt droht, Herzversagen auszulösen«. Und ich weigere mich, »Däumchen drehen« als potenzielle Tätigkeit aufzunehmen, obwohl ich viel zu viel von meiner Zeit auf diese Weise verbringe.
Heute war meine Liste ausgesprochen viel versprechend. Sie lautete:
1) Rebeccas Tod: Hauptsächliche Fakten zusammenfassen. Objektive Tatsachen aufführen.
2) Liste von »Zeugen« bzgl. Manderley und Familie de Winter usw. aufstellen.
3) Alles vertrauliche Material in Bezug auf Rebecca ordnen und zügig ablegen.
4) Terence Grey anrufen.
5) Päckchen öffnen. Falls Inhalt dringend (unwahrscheinlich), beantworten.
Ungefähr zwei Minuten lang gab diese Liste mir Auftrieb. Dann stieg eine vertraute Panik in mir auf. Den Namen »Rebecca« zu schreiben hatte mich sofort aus der Fassung gebracht; und das Wort »Fakten« entmutigte mich. Wann immer ich über Rebeccas kurzes Leben und die aufrührenden Umstände ihres Todes nachdenke, fällt es mir irgendwie schwer, meine übliche Objektivität beizubehalten: Die Faktendecke ist ohnehin dünn; nach wie vor grassieren Gerüchte, und gewisse Vorurteile lassen sich beim besten Willen nicht vermeiden.
Entschlossen, sie auszumerzen, nahm ich meine Feder, zog ein Blatt Papier hervor und begann zu schreiben. In der Schule hatte mich ein melancholischer Pauker namens Hanbury-Smythe, ein Mann, der in Cambridge zwei Fächer mit »sehr gut« abgeschlossen und dann eine kurze, hervorragende Karriere im Auswärtigen und im Kolonialamt hingelegt hatte, die verzwickte Kunst des Précis gelehrt. Er hatte außerdem eine Schwäche für die Flasche, aber darüber will ich mich nicht weiter auslassen. Hanbury-Smythe behauptete, es gebe kein Problem, keine Situation, wie komplex diese auch sein mochten, die man nicht in drei Sätzen zusammenfassen könne, und dass diese Reduzierung die Klarheit des Denkens fördere. Dann, so glaubte er, sähe man seine daraus folgende Handlungsweise, seine Ziele, glasklar vor sich. Diese Überzeugung muss ihm während seiner Zeit als Diplomat auf dem Balkan einige Schwierigkeiten bereitet haben, aber egal: Ich habe mich früh zur Hanbury-Smythe-Methode bekehrt und mich ihrer während meiner Militärkarriere mit bemerkenswertem Erfolg bedient.
Nun wandte ich die Hanbury-Smythe-Methode an. Nicht lange danach – nun ja, eine Stunde später – hatte ich Folgendes zustande gebracht:
Das Rätsel um Rebeccas letzte Stunden
Am Abend des 12. April 1931 traf Mrs. Maximilian de Winter, von einem Besuch in London zurückkehrend, irgendwann nach acht Uhr abends auf Manderley, ihrem Besitz in Cornwall, ein; gegen neun Uhr verließ sie allein das Haus und ging zu Fuß zu der darunter liegenden Bucht, wo ihr Segelboot ankerte – das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurde.
Vierzehn Monate später wurden in der Folge eines Schiffsunfalls, der nichts mit der Sache zu tun hatte, und lange, nachdem man jede Suche aufgegeben hatte, sowohl ihr vermisstes Boot, das versenkt worden war, als auch ihre Leiche entdeckt. Das Urteil »Selbstmord«, zu dem die gerichtliche Untersuchung der Todesursache gelangte, war kontrovers; doch in der Folge entdeckte man als direktes Ergebnis der brillanten und energischen Nachforschungen des örtlichen Friedensrichters, dass Mrs. de Winter unheilbar krank gewesen war und ein Londoner Arzt ihr diese Diagnose am Tag ihres Verschwindens mitgeteilt hatte; so ergab sich jetzt das zuvor anscheinend fehlende Motiv für einen Selbstmord, und die Angelegenheit war geklärt.
Niedergeschlagen betrachtete ich meinen Text. Mit Hilfe einer plumpen Satzkonstruktion und ausreichend Semikola kann man immer pfuschen. Meine Zusammenfassung war schwerfällig, und obwohl sie sachlich »korrekt« war, enthielt sie mindestens acht Ausweichmanöver und eine Irreführung; ich zählte nicht weniger als acht Suppressio veri, sämtlich von gewaltigem Kaliber. Ich hatte die Sache in drei Sätze gebracht und eine Karikatur der Wahrheit produziert. Hanbury-Smythe war ein Esel und Trunkenbold und seine Methode nutzlos. »Die Angelegenheit geklärt?« Wäre dem doch so gewesen! Ich war nicht besonders stolz auf mich. Rebecca hatte Besseres verdient.
Ich beschloss, meine Bemühungen zu intensivieren, und öffnete die Schreibtischschublade, in der ich die Zeitungsausschnitte, die sich auf Rebeccas Tod und Verschwinden beziehen, sorgfältig archiviert habe. Es ist eine dicke Akte, die im Lauf der Jahre unaufhörlich angewachsen ist – dieser Fall hat eine Faszination, der die Reporter nicht widerstehen können. Sie sind natürlich wie besessen von der Idee, dass ein Justizirrtum vorliegt; die meisten scheinen zu glauben, dass die Sache eine konzertierte Verschleierung war – ich sollte hinzufügen, dass sie nicht zögern, mit dem Finger auf die Betreffenden zu zeigen –, und angesichts von Rebeccas Schönheit und Réclame gibt die Geschichte unbestreitbar eine gute »Story« ab, wie mir kürzlich jemand sagte – Terence Grey, glaube ich.
Sorgfältig inspizierte ich die Ausschnitte. Nachdem ich mit dem Hanbury-Smythe-Ansatz gescheitert war, konnten mir vielleicht diese professionellen Schmierfinken ein paar Tipps geben. Sie haben, zusammen mit dem lokalen Klatsch, dafür gesorgt, dass die Geschichte lebendig blieb, sodass die Spekulationen über Rebeccas Person und die Art ihres Todes nie verstummt sind, wie ich das einst in meiner Naivität erwartet hatte. Eher ist das Gegenteil der Fall: Ihr Verschwinden und ihr Ende sind immer noch häufig das Thema von Artikeln; der Großteil davon ist – wie Grey dies verächtlich ausdrückt – das Werk von »Artikelausschneidern«, die durch reine Wiederholung die dubiosesten Informationen in den Rang der »Wahrheit« erhoben haben. Mindestens zwei Bücher haben sich mit dem Thema beschäftigt, die beide vorgeben, neue und sensationelle Informationen zu enthalten – und beide sind, zumindest meiner Ansicht nach, reine Belletristik.
Im Ergebnis ist das »Geheimnis von Manderley«, wie es inzwischen genannt wird, eines der »klassischen Rätsel des Verbrechens« geworden – ich zitiere einen Mann namens Eric Edwards, dem ich einmal aus reiner Dummheit ein Interview gewährt habe. Zu dieser Zeit – das war vor dem letzten Krieg – hatte es eine solche Flut an Skandalberichterstattung gegeben, die so lange über mein Haupt niedergegangen war, dass ich endlich beschloss, mein Schweigen zu brechen. Ich würde den Beweis für Rebeccas unheilbare Krankheit liefern und klare Verhältnisse schaffen. Heute weiß ich, dass ich mich in einem Irrtum erster Ordnung befand: Kein Zeitungsmensch von Selbstachtung ist daran interessiert, »klare Verhältnisse zu schaffen«. Schmutzige Wäsche waschen, das wollen diese Leute.
Mr. Evans stellte sich mir als erfahrener Kriminalreporter vor, ein Mann mit einem Riecher für die Wahrheit. Er schrieb mir auf Papier mit dem Briefkopf des Daily Telegraph, das er höchstwahrscheinlich zweckentwendet hatte, wie mir später klar wurde. Mir war zwar aufgefallen, dass dieser Brief schlecht getippt war und voller Rechtschreib- und Grammatikfehler, doch das hielt ich für die Schuld einer unerfahrenen Sekretärin. Ich Esel glaubte ihm auch, als er von einem »Kreuzzug für die Wahrheit« sprach. Ich erinnere mich, dass ich mich an einem Tiefpunkt befand – der Klatsch in Kerrith war inzwischen so schlimm geworden, dass ich mein Richteramt aufgeben musste. Trotzdem hätte ich es besser wissen müssen. Zwei Minuten, nachdem ich ihn gesehen hatte, wusste ich, dass Evans ein Spinner war, und warf ihn umgehend hinaus – womit ich mir natürlich einen nagelneuen Feind schuf.
Unser Interview, das hier in meinem Arbeitszimmer auf The Pines stattfand, spielte sich folgendermaßen ab:
(Ein Novembernachmittag im Jahr 1936. Oberst Julyan, bis vor kurzem Friedensrichter für den Distrikt von Kerrith und damit auch für Manderley, eine stattliche Erscheinung, sitzt an seinem Schreibtisch. Seine Frau Elizabeth, deren Gesundheitszustand schlecht ist, öffnet die Tür, kündigt den Besucher an und zieht sich dann zurück. Auftritt Eric Evans, ein Mann in den Fünfzigern mit schütterem Haar, bleicher Haut, Hornbrille, einem nordenglischen Akzent und fanatischem Blick. Er trägt einen Koffer, den er sofort öffnet. Wie sich zeigt, ist dieser mit Zeitungsausschnitten, aus Zeitschriften ausgerissenen Fotografien von Rebecca de Winter und den handschriftlichen Notizen für das Buch gefüllt, das Evans, wie er jetzt verkündet, über das »Rätsel von Manderley« schreibt. Mit einem bösen Blick auf Barker, den jungen Hund des Obersts, der knurrt, setzt er sich. Evans zieht weder Notizbuch noch Stift hervor, sondern beginnt sofort mit seinen Fragen.)
EVANS: Es war Mord, nicht wahr?
OBERST J.: (nach einer Pause) Sie werden feststellen, dass die Untersuchung zu dem Urteil »Selbstmord« gelangt ist.
EVANS: Der Ehemann hat es getan. Das sieht doch jeder Esel.
OBERST J.: (ruhig) Sind Sie mit den Gesetzen dieses Landes über Verleumdung vertraut, Mr. Evans?
EVANS: Wer war Rebeccas Liebhaber? Hat de Winter die beiden in flagranti ertappt?
OBERST J.: (weniger gelassen) Sagten Sie nicht, Sie arbeiten für den Telegraph?
EVANS: Die Wahrheit ist vertuscht worden. Sie haben Ihren Freund de Winter gedeckt. Ich lasse mich nicht mundtot machen! Es ist eine verfluchte Schande! (Abgang Evans, verfolgt von dem Hund)
Nun ja, zweifellos übertreibe ich – warum sollte ich mir nicht genau wie alle anderen ein paar Erfindungen erlauben? Aber so ungefähr hat sich die Szene schon abgespielt. Und Evans ließ sich tatsächlich nicht zum Schweigen bringen. Er war unermüdlich, ja besessen. Im Lauf der Jahre veröffentlichte er nicht weniger als sechzehn Artikel über den Fall de Winter; er schrieb ein Buch – Die verschwundene Lady: Eine Lösung des Rätsels von Manderley –, das zu einem gewaltigen Bestseller wurde. Er entwickelte sich zum Fluch meines Lebens, und bevor er schließlich bei einem deutschen Luftangriff starb, als sein möbliertes Zimmer von einer V-1-Rakete getroffen wurde – ja, es gibt noch einen Gott –, da hatte er eine Industrie begründet. Er ganz allein hatte dauerhaft für Unruhe gesorgt. Sex und Tod sind leicht entzündbare Komponenten, und Edwards hatte ohne Zögern die Lunte angebrannt. Das Ergebnis? Ein Feuerwerk. Er erhob Rebecca zur Legende und machte ihren Tod zu einem Mythos.
Ich zog einen seiner frühesten Versuche aus meiner Akte. Der Artikel war ursprünglich 1937 erschienen, ein paar Monate nach unserem Zusammentreffen; in der Zwischenzeit hatte jemand – ich habe Jack Favell im Verdacht – Evans in den Ohren gelegen. Trotz seiner unverhohlenen Voreingenommenheit, seiner schier unglaublichen Vulgarität, seiner Manipulationen, ungerechtfertigten Verunglimpfungen, groben Ungenauigkeiten und wahrhaftig kolossalen Dummheit übte er eine nachhaltige Wirkung aus. Dies war der Artikel, der Rebecca, Maxim und mich selbst zu einem kuriosen, zwielichtigen Nachleben verdammte, in dem Gestalten, die uns vage ähneln, in alle Ewigkeiten Gesten vollführen, die von fern Dinge widerspiegeln, die wir tatsächlich getan oder gesagt haben. Es ist eine Pantomime, ein Jahrmarkts-Zerrspiegel, und ich – der Letzte von uns, der noch am Leben ist – stehe immer noch davor und gestikuliere herum. Ich erkenne die Menschen im Spiegel nicht, aber wer gibt schon etwas darauf, was ich denke?
Um die Wahrheit zu sagen, dachte ich, als ich noch einmal Evans’ bedauerliche Prosa las, lag eine herkulische Arbeit vor mir. Das Problem bestand zugegebenermaßen darin, dass einige von Evans’ Fragen durchaus sachdienlich waren; ihm fehlte nicht eine gewisse Bauernschläue, und zumindest machten seine Methoden den Hintergrund ein ganzes Stück klarer als meine. O tempora, o mores, dachte ich bei mir. Mein Dilemma wird nicht verständlich, ohne Evans zu zitieren, daher will ich es tun: Zum Besseren oder Schlechteren war dies der Artikel, der die Rebecca-Industrie begründete und seither häufig plagiiert worden ist:
Am Abend des 12. April 1931 begab sich eines der faszinierendsten ungelösten Rätsel der neueren Zeit. Die Ereignisse dieser Nacht und die dramatischen Monate, die ihnen folgten, stellen den Ermittler vor eines der klassischen Rätsel der Kriminalgeschichte: Wer war die bezaubernde Rebecca de Winter, die gefeierte Schönheit und Gastgeberin, die Herrin des legendären Anwesens Manderley im West Country? Welche Ereignisse führten zu ihrem tragischen Verschwinden an diesem linden Aprilabend, und wer war für ihren Tod verantwortlich?
Zur Zeit ihres mysteriösen Verschwindens war Rebecca de Winter seit ungefähr fünf Jahren verheiratet. Ihr Ehemann Maximilian (besser bekannt als Maxim) stammte aus einer alteingesessenen Familie in Cornwall und konnte seine Vorfahren bis ins elfte Jahrhundert und darüber hinaus verfolgen. Manderley, sein legendärer Familiensitz, hoch über einem wilden, entlegenen Stück Küste gelegen, war dank des Geschmacks und der Energie seiner jungen Frau zu neuem Leben erwacht: Ständig fanden Feste, Lustbarkeiten, Gesellschaften und Kostümbälle statt. Die Einladungen waren sehr begehrt, und die bunt gemischte Gästeliste umfasste viele berühmte und einige berüchtigte Namen.
Die Gesellschaftsjournale berichteten häufig über Mrs. de Winter, die berühmt war für ihre Schönheit, ihren Geist, ihren Charme und ihre Eleganz. Sie segelte und gewann zahlreiche Pokale bei lokalen Regatten; sie besaß umfangreiche Kenntnisse des Gartenbaus, und der Park von Manderley, der während ihrer Jahre dort neu entworfen und bepflanzt wurde, erlangte Berühmtheit. In der Umgebung war sie sehr beliebt, besonders bei den Pächtern der de Winters, aber einige der alteingesessenen Familien in diesem konservativen Teil der Welt hegten Vorbehalte: Sie fühlten sich durch ihre unverblümte Redeweise düpiert und lehnten ihre oft unkonventionellen Ansichten ab. Manche drückten ihr Erstaunen darüber aus, dass Maxim de Winter – zehn Jahre älter als sie und, wie es heißt, sehr traditionell eingestellt – sie geheiratet hatte. Sie betrachteten sie als Eindringling, und es stimmt, dass ihre Herkunft geheimnisvoll blieb. Wer waren ihre Eltern? Wo wuchs sie auf? Darüber ist so gut wie nichts bekannt.
Obwohl die beiden Gatten nach ihrer Herkunft, ihren Interessen und ihrem Alter so unterschiedlich waren, schien die Ehe der de Winters erfolgreich zu sein, wenn nach dem Verschwinden der jungen Frau die Leute auch zu reden begannen. Der Keim der Tragödie, so hieß es hinter vorgehaltener Hand, sei schon Jahre zuvor gelegt worden. Gerüchte griffen um sich, aber es sollte noch mehr als ein Jahr dauern, bis im Gefolge schockierender, schrecklicher Ereignisse nach und nach die Wahrheit ans Licht kam. Ein Skandal folgte. Doch es ist offensichtlich, dass über die Geschehnisse des 12. April 1931 und das Intrigengewirr, das zu ihnen führte, noch weitere Einzelheiten zu entdecken bleiben. Manderley schützt die Geheimnisse der Familie de Winter … sogar heute noch.
Lassen Sie uns die Ereignisse des 12. April und die Fragen, die sie aufwerfen, genauer betrachten. An diesem Abend kehrte Mrs. de Winter von einem kurzen Besuch in London heim, dessen Zweck niemals zufrieden stellend geklärt werden konnte. War sie dorthin gefahren, um einen Liebhaber zu treffen, wie mancher behauptet? Warum unternahm sie eine solch beschwerliche Reise – sechs Stunden Autofahrt hin und sechs zurück – an einem Tag, obwohl sie eine Wohnung in London besaß? Warum begab sie sich nach ihrer Heimkehr, bei der sie sich, wie mehrere Hausangestellte bemerkten, in einem erregten, bedrückten Zustand befand, gegen neun Uhr abends zu Fuß zum Strand unterhalb des Hauses? Wollte sie in dem Bootshaus, das sie dort unterhielt, jemanden treffen? Gerüchte gingen um, dass sie es für heimliche Stelldicheins benutzte. Oder wollte sie nur segeln gehen, wie ihr Mann bei der nachfolgenden Untersuchung behauptete – bei Nacht und allein?
Wie immer die Antworten auf diese Fragen lauten mögen, eine Tatsache ist unstrittig: Die schöne, damals dreißigjährige Rebecca de Winter kehrte niemals von diesem letzten, verhängnisvollen Segelausflug zurück, und es sollte vierzehn Monate dauern, bis ihr Boot – ein umgerüstetes bretonisches Fischerboot mit dem prophetischen Namen »Je reviens« – entdeckt wurde. Als man es aus der Bucht unterhalb von Manderley barg, wo es über ein Jahr im Verborgenen gelegen hatte, machte man zwei schreckliche Entdeckungen. Das Boot war versenkt worden … und in der verschlossenen Kabine fand man die Leiche einer Frau: Sie war entsetzlich entstellt und befand sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung. Die genaue Todesursache wurde niemals festgestellt, und in Ermangelung eines exakten Gegenbeweises ging man von Ertrinken aus. Erstaunlicherweise konnte die Leiche, sobald sie an Land gebracht worden war, sofort identifiziert werden. Jeder, der bei dieser makabren Gelegenheit anwesend war, wusste sofort, wen er vor sich hatte. Denn an der Hand trug die Tote immer noch die beiden Ringe, die sie im Leben niemals abgenommen hatte …
Endlich hatte man Rebecca de Winter gefunden. Weitere tragische Ereignisse folgten – und ein Hohn auf die Gerechtigkeit. Eilig trommelte man eine Untersuchungskommission zusammen, und die Geschworenen – hauptsächlich Pächter der de Winters, die dem Gatten der Toten nur zu bereitwillig ihre Reverenz erwiesen – kamen zu dem Urteil, sie habe Selbstmord begangen. Der ältliche Vorsitzende fasste Maximilian de Winter, damals einundvierzig, im Zeugenstand mit Samthandschuhen an. Und der damalige Friedensrichter für den Distrikt, Oberst A. L. Julyan, von dem die Einheimischen erklärten, er sei »ein Snob, der sich gern lieb Kind bei den Honoratioren macht« und außerdem ein Jugendfreund von Rebeccas Mann, lehnte es ab, weitere Nachforschungen zu betreiben. Wie er bis heute behauptet, sei die Angelegenheit geklärt.
Doch betrachten wir einmal die folgenden sieben Tatsachen, die angsichts der ungewöhnlichen Umstände dieses »Selbstmords« auf jeden Fall weitere Nachforschungen hätten veranlassen müssen:
1)Nicht lange nach dem Verschwinden seiner Frau hatte Mr. de Winter eine Leiche, die in einigen Meilen Entfernung an die Küste gespült worden war, als die Rebeccas identifiziert. Bei dieser Identifizierung, die sich später als »Irrtum« erwies, war er allein.
2)Weniger als ein Jahr nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Mr. de Winter wieder. Seine zweite Frau, die er bei einer Spritztour nach Monte Carlo kennen lernte, war nur halb so alt wie er.
3)Seine Bewegungen in der Todesnacht seiner ersten Frau konnten nicht vollständig geklärt werden. Er aß mit seinem Gutsverwalter, Mr. Frank Crawley, der in der Nähe wohnte, zu Abend, aber für die entscheidenden Stunden ab zehn Uhr fehlt ihm offensichtlich ein Alibi.
4)Im benachbarten Kerrith und in der Umgebung hielten sich beharrlich Gerüchte, seine Ehe mit Rebecca, die kinderlos blieb, sei stürmisch verlaufen.
5)Die de Winters teilten auf Manderley nicht dasselbe Bett, und Mrs. de Winter übernachtete häufig in ihrer Londoner Wohnung oder in ihrem Bootshaus, was ihr Mann anscheinend stillschweigend duldete.
6)Am 12. April hatte Mrs. Danvers, Mrs. de Winters ergebene Haushälterin, die auch als ihr persönliches Mädchen fungierte, einen ihrer seltenen freien Abende. Wer aus dem Haushalt wusste, dass Mrs. Danvers – die Erste, die am nächsten Morgen Alarm schlug –, nicht auf Manderley weilen würde? Erklärt ihre Abwesenheit, warum Mrs. de Winter ausgerechnet an diesem Abend verschwand?
7)An dem Nachmittag vor ihrem Verschwinden suchte Mrs. de Winter Dr. Baker, einen Gynäkologen, in dessen Praxis in Bloomsbury auf. Dies war ihr zweiter Termin. Was war bei ihrem ersten Besuch geschehen? (Dr. Baker, der ein inoperables Krebsgeschwür diagnostiziert hatte, ist seitdem »ins Ausland verzogen«.)
Diese und zahlreiche andere Fragen sind bis heute nicht geklärt. Und Rebecca de Winter ruhte nicht in Frieden, jedenfalls behaupten das die Einheimischen. Nach der Untersuchung wurde sie in der Gruft der de Winters begraben, neben den Vorfahren ihres Mannes. Nur Stunden nach dieser hastigen, verstohlenen Beisetzung brannte Manderley bis auf die Grundmauern nieder … Zufall? Oder waren da finstere Mächte am Werk? War Rebecca, ein Opfer der Ungerechtigkeit und anscheinend von ihrem Gatten nicht betrauert, von den Toten zurückgekehrt, um Rache zu nehmen? Hatte sie sich aus ihrem Grab erhoben, so wie sie aus dem Meer aufgestiegen war? Vergessen Sie nicht den Namen dieses Bootes … Je reviens.
Auf der Suche nach Antworten auf diese und andere Fragen machte ich mich letzten Monat nach Kerrith auf,die Manderley am nächsten gelegene Kleinstadt. In den Schenken und bescheidenen Häuschen dieses malerischen, entlegenen Ortes traf ich auf viele Menschen, die Rebecca de Winter geliebt und geachtet hatten. In ihrer Empörung über die Ereignisse, so stellte ich fest, waren sie nur zu gern bereit, mit mir zu sprechen.
Innerhalb eines Tages war ich mit neuem und sensationellem Beweismaterial gerüstet und zweifelte nicht mehr daran, dass die Wahrheit über Rebecca de Winters Tod durch eine Verschwörung vertuscht worden war. Endlich stand ich auf der sturmgepeitschten Landzunge bei den Ruinen von Manderley und blickte über die dunkle See, wo Rebecca ihr Ende gefunden hatte. Und ich wusste ohne den Schatten eines Zweifels, dass Mrs. de Winter nicht von eigener Hand gestorben war. Ich kannte den Namen ihres Mörders und wusste, wie er vorgegangen war. Nur eine Frage blieb noch: Warum war Rebecca umgebracht worden? Lag die Antwort auf diese Frage vielleicht in ihrer geheimnisumwobenen Vergangenheit? Ich wandte den von Gespenstern bewohnten Ruinen von Manderley den Rücken und machte mich auf die Suche nach der Wahrheit über ihre Herkunft …
Zum Glück hat er sie nie vollendet. Die Rakete hat ihn zuerst erwischt. Aber der Schaden war natürlich schon geschehen.
Ich begrub den Kopf in den Händen. In dem Jahrmarktsspiegel, in dem ich in alle Ewigkeit gefangen bin, gestikulierten zwei Geister und ein Clown. Mein unzuverlässiges Herz machte wieder Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ausgesprochen unwohl.
Kapitel 3
Ich schloss den Aktendeckel mit den Zeitungsausschnitten und sah durch das Fenster auf meine klägliche Araukarie. Barker zuckte im Schlaf mit den Pfoten, und mein eigener Traum von letzter Nacht kehrte zurück. Wie Faulgas stieg er aus dem Sumpf meines Unterbewusstseins auf. Wieder fand ich mich gefangen am Steuer dieses unheimlichen schwarzen Wagens, der sich ohne mein Zutun zu steuern und fortzubewegen schien. Noch einmal fuhr ich jene endlose Auffahrt nach Manderley entlang; ich fuhr durch einen Schneesturm, und als ich auf die Bremsen trat, reagierten sie nicht. Neben mir, merkwürdig unpassend auf dem Beifahrersitz, begann der winzige Sarg sich zu bewegen.
Ich stand von meinem Stuhl auf, ging ein paar Male durch das Zimmer und inspizierte meine Bücher – der Raum ist mit Büchern voll gestopft. Energisch und zielbewusst hatte ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt, doch nun fühlte ich mich wie schon so oft alt, schwach und unzureichend, geblendet von einem Sturm an Desinformationen, der zwanzig Jahre und länger zurückreicht.
Eric Evans mochte behaupten, er habe »neues und sensationelles Beweismaterial« entdeckt, aber was hieß das schon? Herzlich wenig. Wie die Zeitungsschnüffler, die nach ihm gekommen waren, hatte er den übel riechenden Müllhaufen des Klatsches in Kerrith durchwühlt; ehemalige Angestellte auf Manderley und dergleichen hatten ihm ein paar stinkende Knochen zugeworfen. Aber weder er noch seine Nachfolger haben jemals einen Beweis über das zu Tage gefördert, was Rebecca in der letzten Nacht ihres Lebens zugestoßen ist. Sie hatten praktisch nichts über ihre Vergangenheit vor Manderley entdeckt. Selbst Terence Grey, der Historiker und kein Journalist ist, aber trotzdem ein cleverer Bursche, hat mit derlei Nachforschungen rein gar nichts herausgebracht – jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Das wundert mich nicht. Ich war Rebeccas Freund, und ich wusste besser als jeder andere, wie gut Rebecca ihre Spuren verwischt hatte, wie verschlossen sie war. Würde ich diese Aufgabe übernehmen, fragte ich mich, als ich an meinen Schreibtisch zurückkehrte, ohne den Einfluss von Terence Grey, diesen eigenartigen jungen Mann, der vor kurzem nach Kerrith gekommen war – ein junger Mann, der aus unerklärten Gründen in letzter Zeit ein so hartnäckiges Interesse an den Umständen von Rebecca de Winters mysteriösem Leben und Tod gezeigt hat?
Wahrscheinlich nicht. Seit er aufgetaucht ist und sich daran gemacht hat, alle Leute zu befragen, haben meine Träume sich jedenfalls verschlimmert. Ich zog das Telefon zu mir heran: Zeit, mit dem Mann zu reden und für den Nachmittag einen Gang nach Manderley vorzuschlagen – einen lange verschobenen Besuch, den ich als Test zu betrachten begann. Wie würde Grey reagieren, wenn er endlich das Haus zu Gesicht bekam, von dem er anscheinend besessen war? Und warum war er das eigentlich?
Ich nahm den Hörer, legte aber wieder auf. Wir hatten erst zehn Uhr – ich stehe früh auf, und Ellie und ich frühstücken zeitig; die Einladung konnte warten. Mr. Grey ist ein beeindruckender Mensch. Er ist jung und energisch, und gewisse Aspekte des Mannes bereiten mir Sorge – am wenigsten jedoch seine Beweggründe, die für mich immer noch im Dunkeln liegen.
So langsam sah ich ein, dass Grey mir nützlich sein könnte, aber bevor ich mit ihm sprach, musste ich nachdenken. Ich nahm das Päckchen, das heute Morgen gekommen war, wog es in der Hand und beschloss, dass es bis später warten konnte. Dann wandte ich die Aufmerksamkeit der zweiten meiner selbst auferlegten Aufgaben zu: meiner Liste von »Zeugen«.
Im Unterschied zu den Zeitungsschreibern und Mr. Grey brauchte ich im Grunde keine Aussagen von anderen, um die Wahrheit über Rebecca zu schreiben. Ich war ihr Freund gewesen, vielleicht ihr engster, so schmeichelte ich mir zumindest; und Maxim hatte ich fast mein Leben lang gekannt. Mit Manderley bin ich von frühester Kindheit an vertraut, und es gibt nur sehr wenig, das ich über die Familie de Winter nicht weiß. Wie Mr. Grey mir immer wieder erklärt, bin ich eine erstrangige Quelle – die allerbeste seit Maxims Tod. Trotzdem weist, wie meine Gespräche mit Grey mir gezeigt haben, mein Wissen ein oder zwei Lücken auf – nichts von großer Bedeutung, aber dennoch irritierend. Ich hege von jeher eine Vorliebe für Kriminalgeschichten, Sherlock Holmes, Hercule Poirot und so weiter … Ein bisschen Nachbohren, ein wenig Detektivspielen wäre vielleicht nicht verkehrt, daher meine Zeugen. Wer könnte etwas wissen, das ich nicht wusste?
Konzentration, Konzentration, sagte ich mir. Ich musste mich zur Ordnung rufen. Wie schon erwähnt, trödle ich dank meiner Selbstdisziplin und meiner militärischen Ausbildung niemals, aber in letzter Zeit habe ich an mir eine gewisse Tendenz bemerkt, mich ablenken zu lassen. Dass ich zweiundsiebzig Jahre alt bin, mag noch dazu beitragen. Mir ist aufgefallen, dass diese Neigung sich verschlimmert, wenn ich mich einsam, gereizt, unsicher, misstrauisch oder aufgeregt fühle – suchen Sie sich etwas aus. Doch ich erhole mich immer rasch, und so schrieb ich zügig die folgende Liste nieder:
1) Rebecca
2) Maxim de Winter
3) Beatrice (Maxims Schwester)
4) die ältere Mrs. de Winter (seine Großmutter, die ihn aufgezogen hat)
5) Mrs. Danvers (zu Rebeccas Zeit Haushälterin auf Manderley)
6) Jack Favell (Rebeccas nichtsnutziger Cousin und einziger bekannter Verwandter)
7) ehemaliges Personal (Dienstmädchen, Lakaien usw. auf Manderley, von denen viele noch hier in der Gegend leben)
8) Frith (ehemals Butler auf Manderley und Faktotum seit ewigen Zeiten)
Keine lange Liste. Der Umstand, dass die ersten vier Kandidaten verstorben sind, hätte manche Leute entmutigt, aber nicht mich, denn ich besitze Briefe von ihnen, und ich habe meine Erinnerungen. Auf diese Weise können die Toten sprechen.
Trotzdem deprimierte es mich, allein ihre Namen niederzuschreiben. Beatrice, die am Ende des letzten Krieges starb, hatte ich seit ihrer Kindheit gekannt, und Maxim, der acht Jahre jünger war als ich, seit dem Tag seiner Geburt. Seine Furcht einflößende Großmutter war mir aus meiner Knabenzeit nur zu lebendig in Erinnerung: Sie war während seiner Ehe mit Rebecca noch am Leben gewesen und hatte die junge Frau angebetet; wenn ein Mensch in Rebeccas zahlreiche Geheimnisse eingeweiht gewesen war, dann sie, so argwöhnte ich – tatsächlich habe ich oft vermutet, dass sie mehr über Maxims Frau wusste als Maxim selbst. Natürlich könnte ich mich auch irren.
In den Ecken des Zimmers schwebten Geister. Ich hatte sie heraufbeschworen, indem ich ihre Namen niederschrieb. Barker hob sein gewaltiges Haupt; sein Nackenfell wogte. Er schenkte mir einen tiefsinnigen, tröstlichen Blick. Wir beide dachten an meinen alten Freund Maxim, der jetzt seit fünf Jahren tot war, umgekommen bei einem Autounfall, den er mit Sicherheit selbst herbeigeführt hatte, kurz vor den Toren von Manderley auf der kurvenreichen Landstraße. Das geschah nur Monate nachdem sein langes Exil im Ausland mit seiner zweiten Frau endlich zu Ende war; ganz kurz, nachdem die beiden nach England zurückgekehrt waren, um sich wieder hier niederzulassen.
Ich weiß, was es heißt, von Furien verfolgt zu werden, und ich habe nie bezweifelt, dass diese Geister Maxim, nachdem er Manderley verlassen hatte, mit ihrer gewohnten Beharrlichkeit nachsetzten, obwohl er damals die Verbindung zu mir abbrach und meine Briefe nie beantwortete, sodass ich dies nicht bestätigen kann. Ich wurde nicht einmal zu seiner Beisetzung eingeladen; dieser Affront schmerzt mich bis heute. Dabei bin ich meinem alten Freund Maxim gegenüber loyal gewesen – zu loyal sogar vielleicht.
Die zweite Frau – »dieses traurige kleine Phantom«, wie meine Freundinnen, die Schwestern Briggs, sie bezeichnen – verstreute, wie ich gehört habe, seine Asche unterhalb von Manderley. Fand sie die Vorstellung unerträglich, dass er in der Gruft der de Winters neben Rebecca ruhen würde? Erstaunen würde mich das nicht, denn besitzergreifende Frauen ändern sich auch durch den Tod nicht. Seither soll sie sich nach Kanada abgesetzt haben, das erzählt man mir jedenfalls. Ich überlegte, ihren Namen auf meine Zeugenliste zu setzen, und entschied mich dann dagegen.
Bei den wenigen Gelegenheiten, zu denen ich ihr begegnet bin, fand ich sie nichts sagend; ich konnte mich nicht für sie erwärmen, obwohl ich wegen meiner Bewunderung für Rebecca wahrscheinlich voreingenommen war. Gewiss, die zweite Mrs. de Winter könnte mehr über Rebeccas Tod wissen als jeder andere Mensch; ich zweifle nicht daran, dass Maxim sie ins Vertrauen gezogen hätte. Aber würde sie mir ihr Wissen jemals enthüllen? Eher würden Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, dachte ich – und praktisch überlegt, hätte ich sie überhaupt nicht aufspüren können. Laut meinen Spießgesellinen, den alten Jungfern Elinor und Jocelyn Briggs, steht niemand in dieser Gegend noch in Verbindung zu ihr. Es heißt, sie hätte sich oben in Toronto – oder war es Montreal? – eingeigelt, und niemand kennt ihre Adresse.
Ich überflog meine Liste noch einmal: Viele Namen blieben nicht übrig. Wie Terence Grey einmal bemerkte, besteht in diesem Fall ein ausgesprochener Mangel an Informanten. Von den verbleibenden Kandidaten waren mehrere rasch auszuschließen. Ich hegte keinerlei Absicht, den verknöcherten Frith zu konsultieren, den einstigen Butler, Lakai, Stiefelknecht und so weiter auf Manderley. Ich gebe zu, dass er ein vorbildlicher Butler war, aber er war auch ein beispielhafter Wichtigtuer, und er hatte eine unerklärlich überlegene Art, mich anzusehen, die mich immer noch ärgert. Er lebt heute in einem Altenheim hier in der Gegend und ist sowieso praktisch senil. Wieso hatte ich seinen Namen überhaupt auf die Liste gesetzt? Wahrscheinlich, weil Terence Grey Interesse an ihm gezeigt hat, entschied ich. Pech für ihn. Ich zog einen dicken Strich durch den Namen des Trottels. Wer noch?
Zu Rebeccas Zeit, in den Ruhmestagen von Manderley, als das Haus jedes Wochenende mit hochrangigen Gästen gefüllt war, hatte es ganze Scharen von Dienstboten gegeben, von denen die meisten unsichtbar blieben – unsichtbar, taub und stumm zu sein war damals natürlich die wichtigste Eigenschaft eines gut ausgebildeten Dieners. Viele davon sind noch am Leben, und ein großer Teil wohnt in der Gegend von Kerrith. Anders als Evans und seine Jünger, die sich nicht zu gut waren, ehemalige Zimmermädchen zu interviewen und eifrig danach auszufragen, wer wo schlief und so weiter, ziehe ich bei den weiblichen Angestellten die Grenze. Die meisten waren hohlköpfige Klatschweiber, die von nichts eine Ahnung hatten – nicht, dass dieser Umstand sie davon abgehalten hätte, Unmengen von Zeug für die Zeitungsschmierer zu erfinden und über Bettlaken, Geschrei, Zerwürfnisse und Versöhnungen et cetera zu plappern. Einige der Diener allerdings, zum Beispiel Robert Lane, könnten möglicherweise ein Stückchen Wissen beizutragen haben.
Wie das in einem kleinen Ort so ist, stolpere ich ab und zu über Robert, und er ist mir immer als ganz netter Bursche aufgefallen. Er war einst ein junger Lakai auf Manderley – Lakai! Wie antiquiert das klingt –, hat den letzten Krieg überlebt und ist laut der Briggs-Schwestern, meinen unschätzbar wertvollen lokalen Informantinnen, heute verheiratet und hat vier Kinder. Er trägt Brillantine im Haar und arbeitet hinter der Bar eines wenig einnehmenden Hotels in Tregarron, einer mit Souvenirs vollgestopften, mit Gipsornamenten verschandelten Touristenfalle etwa drei Meilen von hier.
Man munkelt, Robert, der früher in Kerrith wegen seiner Schwäche für Rothaarige berüchtigt war, sei redselig. Konnte das stimmen? Meine Zuversicht schwand: Mitteilsam mochte Robert ja sein, aber mir ist noch nie aufgefallen, dass er die geringste Beobachtungsgabe besitzt, und die Aussicht, ihn über eine Theke hinweg mit Fragen einzudecken, gefiel mir ganz und gar nicht. Das hatte etwas unsagbar Schmieriges an sich. Einen Mann zu verhören, der mir üblicherweise einen Whisky mit Soda brachte? Undenkbar! Aber wer noch, wer noch? Meine Informantenliste schrumpfte mit jeder Sekunde. Nur zwei Namen waren noch übrig. Mit einem gewissen Widerstreben kam ich zu meiner nächsten Kandidatin: Mrs. Danvers. Eine eigenartige Frau, diese Mrs. Danvers.
Sicher, sie war insofern eine offensichtliche Kandidatin, als sie während der Jahre, die Rebecca auf Manderley lebte, dort Haushälterin war und immer behauptet hatte, Rebecca näher zu stehen als jeder andere Mensch. Ich schenkte dieser Behauptung allerdings wenig Glauben. Wem immer Rebecca vertraute, wirklich vertraute – sie war das nicht. Auf jeden Fall hatte sie Rebecca schon als Kind gekannt, aber da weder sie noch Rebecca sich je darüber ausgelassen hatten, wann oder unter welchen Umständen, war dieses Körnchen Information mir niemals besonders nützlich erschienen. Die Danvers war eine Hysterikerin, wie ich gleich erkannte, als sie mir zum ersten Mal unter die Augen kam – bei der Armee schnappt man derart nützliche psychologische Erkenntnisse auf. Abgesehen davon, dass sie eine blühende Fantasie besaß und daher als »Zeugin« nur von begrenztem Nutzen war, stand sie mir ebenfalls nicht zur Verfügung. Sie hat die Gegend in der Nacht des großen Feuers auf Manderley verlassen, und meines Wissens hat seither niemand sie gesehen oder von ihr gehört. Sie könnte noch unter den Lebenden weilen – das meint auf jeden Fall Grey –, aber wahrscheinlicher ist, dass sie ebenfalls die Radieschen von unten anschaut.
Damit blieb mir nur ein weiterer offensichtlicher Kandidat: Jack Favell, Rebeccas Cousin, ein schwarzes Schaf und ein außerordentlich abscheulicher Mensch. Favell war ein Halunke und Prasser. Er ist aus der Marine geflogen – mir ist ein Rätsel, wie er überhaupt hineingelangt war –, und als er begann, ab und zu bei einem Fest in Manderley aufzukreuzen (ich bin mir sicher, dass er sich selbst einlud), hatte er eine weit erfolgreichere Laufbahn als Schnorrer eingeschlagen. Während meiner Jahre bei der Armee hatte ich zu viele Männer von Favells Kaliber getroffen, um ihn nicht gleich richtig einzuschätzen. Ich lernte ihn kennen, kurz nachdem er begann, als ungeladener Gast bei Gesellschaften auf Manderley aufzutauchen – das muss um 1928 gewesen sein, etwa zweieinhalb Jahre nach Rebeccas Heirat –, und verabscheute ihn von dem Augenblick an, in dem wir uns die Hand schüttelten. Wie sich herausstellte, reichte ich meiner Nemesis die Hand, doch das ahnte ich damals leider nicht.
Ich habe immer den Verdacht gehegt, dass Favell einen Einfluss auf Rebecca besaß, der bis in beider Jugend zurückreichte; abgesehen von Mrs. Danvers, die über dieses Thema kein Wort verlor, bin ich sonst niemandem, wirklich keinem Menschen begegnet, der Rebecca als junges Mädchen gekannt hätte … Nicht dass Favell je mit mir darüber geredet hätte. Unsere Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit; daher sprachen wir nur knapp miteinander. Ich bezweifle, dass wir vor Rebeccas Tod jemals mehr als drei Sätze auf einmal gewechselt haben. Und ich stand nicht allein mit meiner Ablehnung; mir schien, dass auch Rebecca ihren Vetter nicht besonders mochte, obwohl gewisse Zeitungskleckser anderes angedeutet haben. Maxim verabscheute ihn von Anfang an und gab sich keine Mühe, das zu verbergen. Er und Favell waren natürlich so verschieden wie Tag und Nacht. Maxim legte hohe Maßstäbe an, so wie ich; Favell mit seinem losen Mundwerk, der stark trank, zum Fluchen neigte und sich Frauen gegenüber plump vertraulich verhielt, wäre auf Manderley niemals ein gern gesehener Gast gewesen – obwohl ich immer geargwöhnt habe, dass die Probleme tiefer lagen.
War Maxim eifersüchtig auf Favell? Meine Frau jedenfalls war dieser Ansicht; vielleicht haben Frauen ein besseres Gespür für solche Gefühle als Männer. Ich selbst neige nicht zur Eifersucht. Mein Instinkt sagte mir, dass Favell, der gern Unruhe stiftete, Maxim Geschichten aus Rebeccas Vergangenheit erzählte, die ihre Ehe belasteten – das muss gegen Ende gewesen sein, im letzten Jahr vor Rebeccas Tod. Während dieser Zeit herrschte auf Manderley jedenfalls eine bedrückte Atmosphäre, und selbst Rebecca mit ihren beachtlichen schauspielerischen Fähigkeiten konnte die Spannungen zwischen ihr und Maxim nicht immer verbergen. Meiner Erfahrung nach wittert man Eheprobleme immer schon auf große Entfernung.
Ich weiß, dass Maxim Favell nach einer skandalösen Episode, bei der dieser sich schwer betrank, aus dem Haus wies, aber immer wieder schlich er sich ein. Vielleicht habe ich die Sache Rebecca gegenüber ein- oder zweimal erwähnt. Ich argwöhnte, sie habe sich überreden lassen, Favell Geld zu leihen, und war der Ansicht, jemand sollte sie warnen. Als ich ihr Vorhaltungen machte – bei allem, was Favell betraf, ging mir der Hut hoch, sodass ich mich möglicherweise reichlich drastisch ausgedrückt habe –, lächelte Rebecca. Wahrscheinlich hat mein »Beschützerinstinkt« sie immer amüsiert. Sie erklärte, sie wisse ganz genau, was für eine Art von Mensch ihr Vetter sei, und setzte dann auf ihre rätselhafte Weise hinzu – Rebecca konnte eine Sphinx und ein Biest sein –, trotz all seiner Fehler sei Favell »korrekt«. Korrekt? Davon sah ich verdammt wenig, obwohl ich zugeben muss, dass ich nach ihrem Tod begriff, was sie gemeint haben mag.
Schon der Gedanke an Favell wühlte mich auf; so etwas kommt heute vor, und da mein Arzt, dieser Schwarzseher, mir ständig erklärt, das sei nicht gut für mich, stand ich wieder auf und spazierte im Zimmer umher. Die geisterhaften Präsenzen, die angefangen haben, sich an meine Fersen zu heften, waren wieder da: Sie ließen sich in den Ecken nieder, vermutlich, um sich auf Dauer festzusetzen. Barker knurrte sie an. Erfolglos versuchte ich die Geister zu ignorieren. Ich kehrte an meinen Schreibtisch zurück. Meine Hände waren unstet. Ich überprüfte meine Zeugenliste noch einmal.
Ich dachte an meine letzte Begegnung mit Favell. Das war an dem Tag gewesen, der sich als entscheidend für den gesamten Fall erweisen sollte, dem Tag nach der Untersuchung, die Rebeccas Todesursache feststellen sollte. Favell war nicht zufrieden mit dem Urteil »Selbstmord« gewesen, und ich ebenfalls nicht, um die Wahrheit zu sagen. Ich fand, dass das Ganze keinen Sinn ergab: Es gab keinen Hinweis auf ein Motiv, sie hatte keinen Abschiedsbrief hinterlassen, und ich konnte einfach nicht glauben, dass die Rebecca, die ich gekannt hatte, sich das Leben nahm. Daher regte ich etwas eigentlich sehr Offensichtliches an, nämlich Rebeccas Schritte am letzten Tag ihres Lebens zu überprüfen. Man hätte meinen sollen, dass der Untersuchungsrichter den Grips dazu aufgebracht hätte, doch das war nicht der Fall.
Wir untersuchten Rebeccas Terminkalender, den Mrs. Danvers glücklicherweie aufbewahrt hatte, und so entdeckten wir, dass Rebecca an ihrem letzten Lebenstag um zwei Uhr nachmittags, insgeheim und ohne jemandem etwas davon zu sagen, einen Arzt in London konsultiert hatte – einen Spezialisten für Frauenleiden. Rebecca hatte diesen Termin auf eine eigenartige, halb verschlüsselte Weise festgehalten, was mich misstrauisch machte. Dieser Mann war einer der letzten Menschen, die Rebecca lebend gesehen hatten. Warum hatte sie sich an ihn gewandt und nicht an ihren üblichen Hausarzt? Was hatte er ihr an jenem letzten Nachmittag mitgeteilt?
Am folgenden Tag fuhr ich nach London, um ihn zu befragen. Begleitet wurde ich von Maxim, dessen zweiter Frau sowie Jack Favell. Letzterer bestand darauf, anwesend zu sein, und wahrscheinlich war das als Rebeccas Vetter sogar sein Recht. Favell behauptete damals sogar, er habe Rebecca näher gestanden als ein Cousin und stellte die allerschmutzigsten und verwerflichsten Behauptungen über ihre Beziehung auf. Er war ein gewohnheitsmäßiger Lügner, daher glaubte ich ihm nicht unbedingt, aber ich sah, dass seine Behauptungen, falls sie stimmten, Maxim das Motiv für einen Mord lieferten. Das bereitete mir Sorgen, zumal ich ohnehin tiefe Bedenken hegte, was Maxims mögliche Verwicklung in Rebeccas Tod anging.
Wir sprachen Dr. Baker zu Hause, nicht in seiner Praxis. Ich erinnere mich, dass es ein ganz normales, nettes Anwesen irgendwo nördlich von London war. Als das Gespräch vorüber war, traten wir auf eine grün belaubte Vorstadtstraße. Ein armes Fossil aus dem Ersten Weltkrieg spielte auf einem Leierkasten Die letzte Rose, eine Melodie, die ich seitdem nicht hören kann, ohne mich niedergedrückt zu fühlen. Ich stand unter einem schweren Schock: Dr. Baker, so hatten wir erfahren, hatte Rebecca zweimal gesehen. Bei dem ersten Termin eine Woche vor ihrem Tod hatte er Röntgenaufnahmen durchgeführt und verschiedene Tests angestellt; bei ihrem zweiten Besuch hatte er ihr die Ergebnisse mitgeteilt. Er hatte ihr erklären müssen, dass sie unter Gebärmutterkrebs litt und die Geschwulst inoperabel war; ihr stand eine Zeit der Invalidität und zunehmender Schmerzen bevor, und sie hatte im besten Fall noch drei bis vier Monate zu leben.
Dies war nicht die Information, die ich von Baker zu hören erwartet hatte. Als ich dann vor seinem Haus stand, musste ich darum kämpfen, mir den Schock und das Mitgefühl, die ich empfand, nicht anmerken zu lassen. Ich bin in dem Glauben großgezogen worden, dass es unmännlich sei, Gefühle zu zeigen, und im Ergebnis verabscheue ich Tränen.
Ob Rebecca geahnt hatte, dass sie krank war? Oder hatte Bakers Diagnose sie vollständig überrumpelt? Es schmerzte mich, mir vorzustellen, wie sie dieses Wissen verborgen hatte, und zuerst war ich zu betäubt, um weiterzudenken. Dann wurde mir klar, dass diese Information von beträchtlicher Tragweite war. Nun gab es ein klares Motiv für einen Selbstmord; nun würde das Untersuchungsergebnis niemals angefochten, und die Polizei hatte keinerlei Beweggrund, ihre Ermittlungen wieder aufzunehmen – ganz gleich, welche Vorwürfe Favell oder sonst jemand erheben mochte. Maxim de Winter war entlastet, aus dem Schneider. Ich wandte mich um und sah meinen alten Freund an; sein kleines Frauchen hatte gerade zärtlich seine Hand ergriffen, und entsetzt und empört sah ich, dass sich Erleichterung auf seine Zügen malte.
Ich glaube, da wusste ich es genau – aber nein, ich zeichne hier die Wahrheit auf, daher will ich zugeben, dass ich schon zuvor an Maxims Unschuld gezweifelt hatte, bei zwei Gelegenheiten. Zum ersten Mal, als Rebeccas armer Körper geborgen wurde und ich sein Gesicht beobachtete, während er sich darüber beugte, um sie offiziell zu identifizieren. Und zum zweiten Mal bei dieser Farce von einem Begräbnis, das Maxim für Rebecca arrangiert hatte, als wir beide als einzige Trauergäste Seite an Seite in der Gruft der de Winters standen.
Mit niemandem, nicht einmal mit Ellie oder meiner verstorbenen Frau, habe ich jemals über diese Beisetzung gesprochen. Aber sie will sich nicht vergessen lassen und schleicht sich nachts in meine Träume. Beisetzung ist nicht einmal das richtige Wort; man hat sich ihrer unmittelbar nach der Untersuchung in ungebührlicher Hast entledigt. Die Zeremonie fand eilig und verstohlen statt – in der Hinsicht stimmte alles, was dieser Evans darüber schrieb. Es war Abend, und es regnete stark. Die Gruft, eine Reihe niedriger Gewölbe mit eisernen Toren, ist sogar noch älter als die Kirche von Manderley selbst, und die ist schon uralt. Sobald man sich unter der Erde befindet, spürt man die Nähe des Flusses und des Kirchhofs, der an einigen Stellen direkt darüber liegt. Und dann die Blicke, die man auf tote de Winters in bleibeschlagenen Särgen erhascht, die rechts und links zur Ruhe gelegt sind, die neueren Särge noch intakt, die älteren nicht – nun, dies ist kein Ort, an dem jemand länger würde verweilen wollen. Und bei dieser Gelegenheit fühlte ich … aber darauf kommt es nicht an. Ich will nur sagen, dass ich sehr tiefe Zuneigung für Rebecca empfand und am Ende meiner Nerven war.
In der Gruft war es bitterkalt, und an den Wänden rann die Feuchtigkeit herunter. Die Elektroleitungen, die in stark verrosteten Metallrohren unter der Erde verlegt waren, schlossen sich immer wieder kurz, sodass, als wir dort standen und den Worten des Trauerrituals lauschten, die Lichter ständig flackerten, verloschen und wieder angingen. Der Pfarrer, der sich ebenso unwohl fühlte wie ich, rasselte die Gebete herunter. Ich hatte gebeugten Hauptes dagestanden, aber irgendwann spürte ich eine Bewegung von Maxim neben mir, und sah auf. Einen kurzen Moment lang, als ein Stromstoß die Lampen heller werden ließ, trafen sich Maxims und meine Blicke – zumindest glaubte ich das zuerst. Er war kalkweiß im Gesicht und schwitzte trotz der Kälte sichtlich; mir wurde klar, dass er nicht mich anschaute, sondern eine Stelle in der Luft ein Stückchen über meiner Schulter. Und was immer er dort erblickte, ließ ihn vor Entsetzen erstarren. Nie werde ich seine Miene vergessen und die Todespein, die ich in seinen Augen sah. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich das Gefühl hatte, er schaue der Verdammnis direkt ins Auge. Ich habe den Ersten Weltkrieg erlebt, ich habe in den Schützengräben gekämpft, daher kann ich mit einer gewissen Sachkenntnis sprechen: Ich erkannte diesen Ausdruck, weil ich ihn – Gott helfe mir – schon auf den Gesichtern anderer Männer gesehen habe, die heute lange tot sind.
Bestürzt sah ich meinen Freund an; der Moment kann nur kurz gewährt haben, obwohl es mir wie Stunden vorkam. Dann flackerten mit einem Zischen und Knistern die Lichter und wurden wieder trüb. Bevor die Gebete vorüber waren, noch während die Worte »Sie ruhe in Frieden« gesprochen wurden, wollte Maxim gehen. Er versuchte sich an mir vorbeizuschieben; ich legte die Hand auf seinen Arm, um ihn zurückzuhalten, und stellte fest, dass er zitterte. Damals konnte er mir nicht in die Augen sehen – und er wäre auch heute nicht in der Lage dazu.