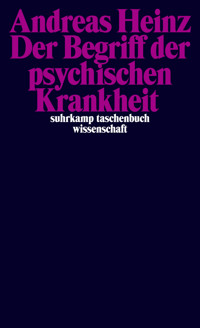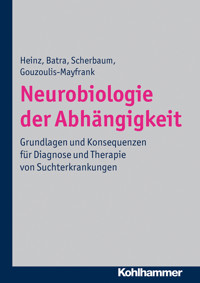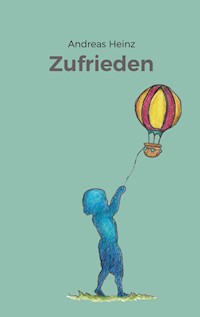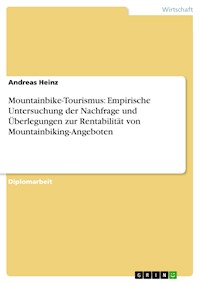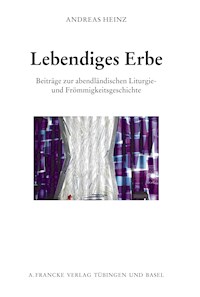Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Psychotherapeutische Dialoge.
- Sprache: Deutsch
Der Mensch ist ein biologisches Wesen. Damit entstehen auch alle psychischen Phänomene innerhalb einer biologischen Struktur, nämlich der des Gehirns. Wer daraus jedoch folgert, psychische Beeinträchtigungen ließen sich etwa mit einem Mehr oder Weniger an Dopamin oder Serotonin im synaptischen Spalt erklären, irrt, denn viel zu komplex und wechselwirkend ist die Funktionsweise der neuronalen Struktur, um sie mit einem schlichten »Wenn A, dann B« zu erklären. Hochkomplexe psychische Beeinträchtigungen und Erkrankungen resultieren zudem aus einer von Sinnfragen überlagerten inneren Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst. So werden sowohl reine Biologisten als auch jene Fachleute, die einen von neuronalen Abläufen unabhängigen menschlichen »Geist« propagieren, dem komplizierten Zusammenspiel von Hirnphysiologie einerseits sowie der kulturellen, also psychosozial gewordenen Überformung durch Sinngebung andererseits nicht gerecht. Gerhard Roth und Andreas Heinz diskutieren in ihrem Gespräch die vielschichtigen Bedingungen, die das Entstehen psychischer Störungen nach sich ziehen können. Die Hirnforschung wirkt hier als hilfreiche Stütze der Psychotherapie, zeigt dieser aber auch die Begrenztheit bisheriger therapeutischer Wirkmodelle auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von Uwe Britten
Andreas Heinz/Gerhard Roth
Das Gehirn selbst nimmt sich nicht wahr: Hirnforschung und Psychotherapie
Andreas Heinz und Gerhard Roth im Gespräch mit Uwe Britten
Mit 5 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99857-2
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
Umschlagabbildung: dalinas/shutterstock.com Texterfassung: Regina Fischer, Dönges Korrektorat: Edda Hattebier, Münster; Peter Manstein, Bonn
© 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen / Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.www.v-r.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
Inhalt
Der Mensch als Beobachter des Menschen
Eine Frage der Definition
Halluzinationen
Was wissen wir?
Die Komplexität der psychischen Welt
Wie kommt der psychische Inhalt in die Neuronen?
Das Gehirn in Worte fassen
Psychotherapie ist für die Psyche da
Das Gehirn ist wie ein Schwamm
Psychische Stabilität vermitteln
Empathie und Bindung
Wer braucht die Compliance?
Resilienz
Menschliches Helfen
Einflüsterungen
Ausgewählte Literatur
An der Berliner Charité haben im 20. Jahrhundert zahlreiche Psychiater gearbeitet, die dem Fach bedeutende Impulse gegeben haben. Entsprechend ist das Gebäude der heutigen psychiatrischen Klinik zwar immer noch in alten Gemäuern untergebracht, doch innen wird eine innovative Behandlung psychisch beeinträchtigter Menschen vertreten und praktiziert.
Im Juli 2016 treffen sich der Klinische Direktor Andreas Heinz und der Hirnforscher Gerhard Roth zu einem Gespräch darüber, in welchem Verhältnis Hirnforschung und Psychiatrie beziehungsweise Psychotherapie heute stehen. Diese Diskussion wird oft sehr verengt und polarisiert geführt: Während für so manchen Psychotherapeuten die Hirnforschung nichts anderes als das »Feuern« von Neuronen nachzeichnen könne und dies so gar nichts mit dem menschlichen Geist zu tun habe, halten viele rein naturwissenschaftliche Hirnforscher das psychotherapeutische Vorgehen für ein eher naives, wenn nicht gar allzu prosaisches Unterfangen. Hier werde von Dingen geredet, die es gar nicht gebe in der empirisch nachprüfbaren Welt.
Stecken wir immer noch mitten im Körper-Seele-Dualismus?
Andreas Heinz ist seit 2002 Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Campus Charité Mitte in Berlin und war von 2010 bis 2014 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Biologische Psychiatrie. In den Jahren 1995 bis 1997 war er in den USA an den National Institutes of Health in Washington tätig. Er ist im Fach Philosophie promoviert, und zwar mit der Arbeit »Der Begriff der psychischen Krankheit«.
Sehr kritisch hat sich Andreas Heinz mit den Psychose- und Schizophreniekonzepten des 20. Jahrhunderts beschäftigt und dabei sowohl evolutionäre Modelle als auch konservative anthropologische Ansätze eines rassistischen Menschenbildes überführt (in »Anthropologische und evolutionäre Modelle in der Schizophrenieforschung«). Er plädiert für einen personzentrierten Ansatz, der den einzelnen Individuen gerecht werden und dabei überkommene normative Vorstellungen überwinden müsse (siehe dazu auch das von ihm und Thomas Bock verfasste Buch »Psychosen. Ringen um Selbstverständlichkeit«), und gehört zum Autorenteam des großen Lehrbuchs »Irren ist menschlich«.
Andreas Heinz ist ausgebildeter Gesprächspsychotherapeut, forscht an der Charité aber auch zu neuronalen Prozessen bei psychischen Störungen.Kritisch sieht er psychologische Konzepte und Klassifizierungen mancher Beeinträchtigungen als Störungen des Ichs oder der sogenannten Ich-Grenzen. »Was soll das sein?«, fragt er. »Wieso sollte das Ich Grenzen haben wie ein Land, die auch noch verteidigt werden sollten?« Er möchte psychiatrisches und psychotherapeutisches Arbeiten stärker auf naturwissenschaftliche Fundamente gestellt wissen, insistiert aber darauf, dass Hilfen immer von den Erfahrungen des individuellen Menschen auszugehen hätten, wir Menschen bräuchten eine Narration unseres Lebens, um uns »gesund« zu fühlen.
Gerhard Roth ist seit 1976 Professor für Verhaltensphysiologie und Entwicklungsneurobiologie an der Universität Bremen und seit 1989 am Institut für Hirnforschung, dessen Gründer er war und das er viele Jahre auch leitete. Von 2003 bis 2011 war er darüber hinaus Präsident der Studienstiftung des deutschen Volkes. Zudem hat er in Philosophie promoviert und war einige Jahre als Lehrender in diesem Fach tätig.
Schon in seinem Mitte der Neunzigerjahre erschienenen Buch »Das Gehirn und seine Wirklichkeit« plädierte Gerhard Roth dafür, den Begriff »Wirklichkeit« für das subjektive Bild eines Menschen von der ihn umgebenden Welt zu reservieren und dies davon zu unterscheiden, wie die davon unabhängige »Realität« beschaffen sei. Die Frage nach »Repräsentanz« versus »Konstruktion« der Welt im Gehirn bleibe vorläufig unaufklärbar. Als Hirnforscher ist er gleichwohl fest davon überzeugt, dass alles Psychische nur aufgrund von Hirnprozessen entstehen könne und dass sich früher oder später psychische Inhalte als Ergebnisse neuronaler Vernetzungsprozesse werden nachweisen lassen.
Gerhard Roth forscht inzwischen intensiv an der Schnittstelle von Hirnforschung und Psychotherapie, erweist sich aus dieser Arbeit heraus aber auch als jemand, der so manche theoretische Grundannahme der heute etablierten psychotherapeutischen Schulen als nicht mehr haltbar in Zweifel zieht. Er fordert, dass insbesondere die Wirkungsannahmen von Psychotherapie stärker auf die Erkenntnisse der Hirnforschung gründen müssen. Ansätze zu einer Verständigung von Hirnforschung und Psychotherapie hat er gemeinsam mit Nicole Strüber in dem Buch »Wie das Gehirn die Seele macht« formuliert.
DER MENSCH ALS BEOBACHTER DES MENSCHEN
»Eine Verbindung zur Realität muss es geben,sonst würden wir uns unentwegt die Knochen brechen.«
Andreas Heinz
Eine Frage der Definition
Herr Professor Roth, was ist denn eigentlich davon zu halten, wenn ein Oberschlundganglion dem anderen sagt, es sei psychisch krank?
ROTH Na, das kann natürlich viele Gründe haben. Es kann eine Feststellung, eine Beleidigung oder eine Aufforderung sein, weil die Zuweisung »psychisch krank« immer eine Definition voraussetzt, und zwar insbesondere bei demjenigen, der das unterstellt. Das gilt auch für einen Kliniker, der das bei einem anderen Menschen festzustellen glaubt – ob zu Recht oder zu Unrecht. Es könnte sich natürlich auch um einen Politiker handeln, zum Beispiel in einem diktatorisch regierten Land, der jemandem sagt: »Du bist psychisch krank und gehörst in die psychiatrische Klinik.«
Es gibt also ganz viele Deutungsmöglichkeiten, und zwar mit dem ganzen Rattenschwanz, wer das sagt, warum er das sagt und was man dann unter »psychisch krank« versteht. Dann gibt oder gab es natürlich auch viele Leute, die sagen, psychische Erkrankungen gebe es ja gar nicht, es handle sich lediglich um Fehlkonditionierung, oder diese »Erkrankungen« seien zu sehr von Krankenkassen und dem Gesundheitssystem ausgedacht, um damit Geld zu machen.
Aber Herr Heinz weiß dazu sicher viel mehr und aus der eigenen klinischen Erfahrung.
HEINZ Ja, da haben wir zwei Punkte: die Aktivität des Gehirns und die Definition psychischer Erkrankungen. Der erste berührt die Frage, ob das Gehirn selbst überhaupt irgendetwas tut, sprechen zum Beispiel, oder ob das nicht die Fähigkeit einer Person oder zumindest ihrer Psyche ist. Ich führe dazu öfter bewegte Diskussionen mit meinem Freund Werner Eberwein, der Psychologe ist und dann immer auf den Kategorienfehler verweist, wenn »Gehirne« mit »Personen« verwechselt würden – wobei ich den Vorwurf des Kategorienfehlers etwas oberlehrerhaft finde.
Aber ja, in Ordnung, das Gehirn ist immer in einen Leib eingebettet. Es gibt eine wunderschöne Geschichte von Roald Dahl, in der ein Mann unsterblich sein möchte und sein Gehirn konservieren lässt, und zwar plus einem Auge. Das alles wird in einer Nährflüssigkeit aufgehoben. Aber: Nun setzt ihm seine Frau morgens immer genau jene Zeitung vor, die er am meisten gehasst hat. Also, auch das Gehirn ist natürlich abhängig von dem gesamten Körper, nicht Gehirne »sprechen«, sondern lebendige Menschen mit ihren Lebenserfahrungen.
Allerdings: Wer soll denn sonst das Sprechen verursachen, wenn nicht das Gehirn? Die Bauchspeicheldrüse ist es nun mal nicht, da bin ich einfach Neurologe. Natürlich gibt’s auch ein Hormonsystem im Körper, es gibt auch ein vegetatives Nervensystem und es gibt Interaktionen zwischen allem, aber das meiste macht eben doch letztendlich das Gehirn.
ROTH Man darf das sagen, ohne ein Reduktionist zu sein. Wer im Körper kommt denn sonst infrage, der da redet? Da bleibt nur das Gehirn übrig. Aber es ist natürlich in der Tat ein philosophischer Kategorienfehler, wenn gesagt wird, ein »Gehirn« sage etwas. Man müsste besser sagen, dass Zentren oder Instanzen, die im Gehirn zu lokalisieren sind, dafür sorgen, dass ein Satz entsteht. Dazu muss man nichts reduzieren und muss auch nicht behaupten, psychische Erkrankungen seien nichts anderes als ein Feuern von Neuronen, was im Übrigen ja auch wirklich nicht stimmt, sondern der ganze Komplex der sozialen und kommunikativen Einbettung spielt eine Rolle.
Insofern gibt es ein Zentrum oder ein Netzwerk von Zentren im Gehirn, das erst einmal den Satz formulieren darf: »Hier liegt eine psychische Erkrankung vor.«
Sie haben jetzt beide meinen Begriff »Oberschlundganglion« akzeptiert, man könnte aber entgegenhalten, schon dies sei eine unzulässige Reduzierung unseres Gehirns auf ein reines Nervenbündel.
ROTH Das würde ich nicht sagen. Ein Oberschlundganglion kann schon bei Invertebraten, also Wirbellosen, äußerst kompliziert sein – unser Gehirn ist vom Bauplan her ganz klar ein Oberschlundganglion. Dass es natürlich bei uns oder bei Mollusken »Gehirn« heißt, bei anderen Tieren hingegen Oberschlundganglion ist eine eher zoologische Frage. Ganz eindeutig haben wir Menschen ein Oberschlundganglion, es liegt ja oberhalb des Schlundes. Aber es ist ein sehr kompliziertes Oberschlundganglion.
Jetzt sind wir schon bei der Zoologie. Reden wir uns unser kompliziertes Gehirn nicht auch gerne ein, um als Menschen etwas Besonderes zu sein? Letztlich ist doch nur alles Genetik und Vererbbarkeit?
ROTH Der Begriff der Vererbbarkeit, um damit anzufangen, ist ein äußerst dubioser Begriff, der gerade in letzter Zeit diskutiert wurde. Es ist kürzlich ein Büchlein »Erblichkeit der Intelligenz« von den Verhaltensgenetikern Karl-Friedrich Fischbach und Martin Niggeschmidt erschienen, die ausführlich erläutern, was in der Genetik im engeren Sinne und insbesondere in der Züchtungsgenetik unter »Vererbung« zu verstehen ist. Das hat mit dem, worüber wir gleich reden werden, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wenn ich zum Beispiel eine Pflanze züchte oder auch Tiere, dann muss ich wissen, wie groß die Varianz der Gene und wie groß die Varianz der Umweltfaktoren ist, das heißt, es handelt sich um die Aufklärung der Varianz. Dieses Modell ist überhaupt nicht geeignet, epigenetische Prozesse oder vorgeburtliche wie auch nachgeburtliche Prozesse einzubeziehen. Wir müssten also immer erst mal wissen, wie hoch die genetische Varianz ist. Meist kennen wir die aber gar nicht bei unseren psychiatrisch relevanten Genen – und erst recht kennen wir nicht die Varianz der Umwelt.
Also können wir, was unser Thema der psychischen Auffälligkeiten betrifft, über den Begriff der Vererbung ein ganz großes Kreuz machen. Er ist unbrauchbar. »Vererbung« heißt nach Züchtungsgenetik nur diese Aufklärung der phänotypischen Gesamtvarianz im genotypischen Feld. Und das geht bei uns nicht. Im strengen wissenschaftlichen Sinne gibt es zwar ein Vererbungsmodell, aber das ist nicht anwendbar auf unser Thema, nämlich psychische Erkrankungen.
Man kann dann aber fragen: Worum könnte es denn sonst gehen? Interessant ist erst einmal die Frage, was »genetisch bedingt« heute überhaupt heißt: Reden wir von Genen, von Genvarianten, von Polymorphismen oder von genomischen, also von epigenetischen Effekten? Das muss man erst mal beantworten. Schnell wird damit »angeboren«, also bei Geburt vorhanden, verwechselt. Da können wir Hirnforscher nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Was bei Geburt vorhanden ist, braucht längst nicht nur genetisch bedingt zu sein. Oder, Herr Heinz?
HEINZ Ich kann da gern noch mal nachsetzen, weil das zurzeit auch in der Intelligenzdebatte eine riesige Rolle spielt, nicht nur bei psychischen Erkrankungen.
Ich habe mir erzählen lassen, dass man in den Siebzigerjahren nicht über Genetik hätte reden dürfen. In den Achtzigern und Neunzigern hingegen, als ich in die Psychiatrie kam, wurde eigentlich nur noch über Genetik geredet. Da wurden zum Teil Umweltfaktoren auch einfach weggelassen, was hart an der Grenze zum Wissenschaftsbetrug war. Anschließend sind wir zu diesen Gen-Umwelt-Interaktionen gekommen. Eines festzuhalten ist unglaublich wichtig, nämlich dass Umwelt- und genetische Faktoren zusammen zu 100 Prozent ein solches Phänomen erklären. Das heißt: Je ähnlicher die Umwelt ist, desto stärker kommen genetische Faktoren durch. Wenn beispielsweise die Menschen in einer abgeschotteten Klassengesellschaft aufwachsen, dann finden sich hinterher bei allen Menschen mit Arbeitern als Eltern unglaublich starke Einflüsse der benachteiligenden Umwelt auf die Kognitionen, während in einer perfekten herrschaftsfreien Gesellschaft, in der alle, die benachteiligt sind, jedwede Form von Unterstützung erhalten, am Schluss idealerweise nur noch die genetischen Faktoren die individuellen Unterschiede bestimmen würden. Das ist das eine.
Das Zweite ist: Wir versuchen das immer so zu berechnen, dass wir uns die Ähnlichkeit von eineiigen und zweieiigen Zwillingen anschauen und sagen, dass wir bei beiden, wenn sie doch im selben Umfeld aufwachsen, die Umweltfaktoren rausrechnen können. Das geht natürlich auch wieder nur zum Teil, denn die Umweltfaktoren hängen ja schon davon ab, wie die beiden aussehen. Haben wir zwei als schön oder attraktiv empfundene eineiige Zwillinge, dann ist das anders, als wenn sie irgendeinen sichtbaren Makel hätten. Für Intelligenz spiele Schönheit keine Rolle, kann man jetzt antworten, aber wir wissen auch, dass die Umwelt oft positiver auf schöne als auf weniger schöne Menschen reagiert.
Aber es ist komplizierter, denn oft haben eineiige Zwillinge eine geteilte Plazenta. Wenn man das versucht zu ignorieren, dann gehen wir unberechtigt von der Annahme aus, dass sie keine Durchblutungsstörung gehabt haben während der Schwangerschaft oder keine Infektion, die geteilt wäre durch die Plazenta oder eben nicht. In Wirklichkeit kommen bereits hier Umweltfaktoren ins Spiel. Jetzt kommt die Epigenetik hinzu: Man hat bisher gesagt, alles das, was nicht direkt durch Umweltfaktoren erklärbar ist, sei erblich. Dabei würde man aber die Epigenetik übersehen, bei der Umweltfaktoren langwierige Einflüsse auf die Ablesbarkeit der Gene bewirken. Die geteilte Plazenta, die Frage interuteriner Probleme, die Frage der Epigenetik, da kommt vieles an möglichen Einflussfaktoren durch die Umwelt zusammen.
Und noch etwas kommt hinzu: Alle diese Erblichkeitsfaktoren sind additiv.
Das heißt, man sagt, eineiige Zwillinge seien zu 100 Prozent genetisch identisch, zweieiige zu 50 Prozent, beide wachsen in derselben Umwelt auf, also können wir »Umwelt« streichen. Demnach wäre also die beobachtbare Ähnlichkeit zwischen eineiigen und zweieiigen Zwillingen im Wesentlichen genetisch bedingt, weil sie ja in derselben familiären, geteilten Umwelt aufwachsen. Aus dem Unterschied in der genetischen Konstitution der zu 100 Prozent identischen eineiigen versus der genetisch zu 50 Prozent identischen zweieiigen Zwillinge und deren Ähnlichkeit in einem Testresultat kann man nun die Erblichkeit der Testleistung berechnen. Ein Beispiel: Eineiige Zwillinge ähneln sich zu 70 Prozent, zweieiige zu 30 Prozent in der Testleistung – dann ist die Differenz der Ähnlichkeit 70 minus 30, also gleich 40 Prozent. Da eineiige Zwillinge zu 50 Prozent genetisch ähnlicher sind als zweieiige, folgt daraus, dass 100 Prozent genetischer Einfluss dann doppelt so hoch ausfiele wie die Ähnlichkeit in den Testleistungen der eineiigen versus zweieiigen Zwillinge. Damit wären nicht 40 Prozent des Testresultats, sondern zweimal 40 Prozent, also 80 Prozent erblich bedingt.
So weit, so logisch. Was kommt aber typischerweise bei solchen Berechnungen heraus? Die eineiigen Zwillinge sind oft sehr viel ähnlicher als die zweieiigen. Das wiederum führt häufig zu unsinnigen Ergebnissen: Eineiige Zwillinge sind zum Beispiel zu 80 Prozent ähnlich, etwa in der Leistung eines kognitiven Tests, zweieiige zu 20 Prozent, die Differenz ist dann 60 Prozent, die dadurch erklärt werden, dass die eineiigen um 50 Prozent genetisch ähnlicher sind als die zweieiigen Zwillinge. Durch die komplette, also 100-Prozent-Erblichkeit müssten dann aber 120 Prozent, weil ja zweimal 60 Prozent, der Ergebnisse des Testresultats erklärt werden – das geht aber nicht, da 100 Prozent nun mal die Obergrenze sind!
Woran liegt das? Es könnte daran liegen, dass Ähnlichkeiten nicht additiv durch Gene bestimmt werden, sondern sich in bestimmten wichtigen Pathways wie der Dopaminproduktion und der Rezeptorempfindlichkeit gegenüber Dopamin potenzieren, deshalb nimmt dann die Auswirkung mehrerer Gene nicht additiv, sondern zum Beispiel exponentiell zu. Solche Möglichkeiten sind in solchen Rechnungen aber gar nicht drin.
Deswegen muss man verdammt vorsichtig sein, wenn man über Vererbung redet. Es gibt da immer Modebewegungen. Ich verstehe aber auch die Biologen, die irgendwann gesagt haben: »Jetzt hört doch mal auf, immer nur auf das Soziale zu gucken, es gibt auch biologische Unterschiede.« Das finde ich durchaus nachvollziehbar. Dieser biologische Trend hat in den Neunzigerjahren in den USA aber eine sehr ungute Entwicklung forciert. Ich habe seinerzeit in den USA gelebt und konnte das unmittelbar mitverfolgen. Unter Bill Clinton wurde die Sozialhilfe gekürzt. Da gab es eine ganz breite Bewegung, die fand, dass alles genetisch bedingt sei, was es an sozialen Problemen zwischen Schwarzen und Weißen, zwischen Armen und Reichen gibt. Die Meinung war: Das Einzige, was hilft, ist Arbeitsdisziplin. Und die erreicht man nur dadurch, dass es keine Sozialhilfe mehr gibt. Dort wurde das Sozialsystem »soziale Hängematte« genannt, man sprach sogar von »Ketten der Abhängigkeit«. Wenn man diese Ketten beseitige, dann befreie man die Menschen von ihrer Abhängigkeit.
Psychische Krankheiten werden als solche selbstverständlich nicht vererbt, denn dazu sind sie zu komplex und genetische Prozesse viel zu basal.
ROTH Ich bin Großvater von eineiigen Zwillingen und habe mich aus diesem Grund auch etwas mit diesen Fragestellungen beschäftigt. Sowohl den Eltern als auch mir fiel schon früh auf, dass meine Enkelinnen, die äußerlich kaum auseinanderzuhalten sind, deutlich zu unterscheiden sind, sobald sie sich verhalten. Es zeigten sich schon sehr früh Verhaltensunterschiede. Das hat mich erst einmal irritiert und ich habe mich gefragt: Wie ist das erklärbar? Das Erste, was einem auffällt, ist, dass eineiige Zwillinge in der Regel unterschiedliche Geburtsgewichte haben. Das sind zum Teil mehrere Hundert Gramm. Das wiederum ist extrem wichtig, weil am Ende der Schwangerschaft häufig ein Fötus stärker wächst als der andere und diesen »aufsaugt«. Bei meinen Enkelinnen waren das immerhin dreihundert Gramm. Mir kann keiner erzählen, dass es nicht wichtig ist, ob ein Fötus zwei Kilogramm wiegt und der andere zweieinhalb.
Später habe ich meine Schwiegertochter, Neurobiologin wie ich, danach gefragt, wie die beiden in der Gebärmutter lagen. Auch das war deutlich unterschiedlich. Natürlich versorgt die Plazenta die beiden Föten dann nicht symmetrisch, sondern wie auch immer unterschiedlich. Das mag ja nicht dramatisch sein, aber es ist unterschiedlich.
Je mehr man da recherchiert, desto klarer sieht man, dass zum Beispiel auch eineiige Zwillinge unterschiedliche Genvarianten haben können, die einfach zufällig entstehen. In seltenen Fällen wird der eine homosexuell, der andere heterosexuell, der eine Linkshänder, der andere Rechtshänder. Das kann man erklären damit, wann das befruchtete Ei sich noch mal teilt, bis zum Schluss dann die Organe symmetrisch angelegt werden. All das zusammengenommen erklärt, dass beide zwar dieselben DNA-Abschnitte haben, aber alles andere durchaus verschieden sein kann. Eineiige Zwillinge können unterschiedliche Genvarianten haben, die zufällig entstehen. Wir müssen, ganz abgesehen von dem Einfluss des Gehirns, den vorgeburtlichen Einfluss auf den Fötus berücksichtigen. Das ist schon sehr interessant und war lange gar nicht bekannt. Das sind zum Teil ganz neue Erkenntnisse, andere waren durchaus Fachleuten schon bekannt, wurden aber nicht angemessen berücksichtigt.
Wie Herr Heinz schon sagt, von der nackten DNA bis hin zu dem Zustand, in dem ein Kind geboren wird, akkumuliert sich das auf eine häufig nicht lineare Weise. Deshalb ist die ganze Debatte um Anlage und Umwelt viel, viel komplizierter.
Aber was bedeutet das nun für die chemische und die elektrische Übertragung oder auch für die Rezeptorsensibilität im Gehirn?
ROTH Wenn der Unterschied des Einwirkens auf die beiden Föten der eineiigen Zwillinge asymmetrisch ist, dann kann die Anlage zum Beispiel von Stresshormonrezeptoren ebenfalls verschieden ausfallen. Wenn also die Spiegel von CRF, ACTH und Cortisol verschieden sind, dann haben wir auch eine unterschiedliche Stressachse. Das könnte erklären, dass eine Enkelin von mir ein wenig mehr verschlossen ist und die andere ein wenig mehr offen – könnte es erklären, muss nicht. Man muss damit immer sehr vorsichtig sein, ich habe es ja nicht überprüft. Diese Fragen nach der Rezeptorebene, der Hormonproduktion, nach den Stresshormonen oder den Neurotransmittern sind die absolut entscheidenden für die Psyche.
HEINZ