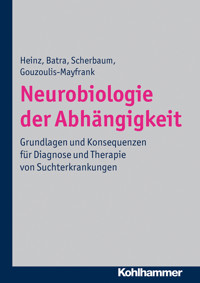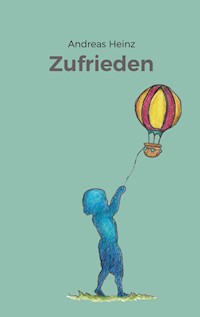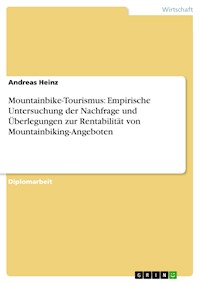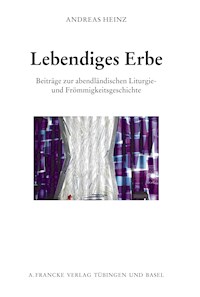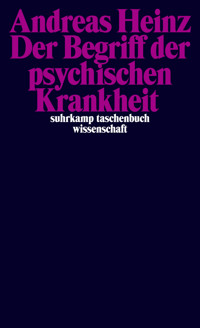
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Im Rahmen der Überarbeitung zentraler Handbücher zur Diagnose und Einordnung psychischer Erkrankungen wird momentan heftig darüber gestritten, wie lange beispielsweise ein Mensch nach dem Tod eines nahen Angehörigen trauern darf, ohne als depressiv oder anderweitig psychisch krank zu gelten. In der Debatte stehen Versorgungsansprüche der Betroffenen sowie deren Ängste vor Pathologisierung und Bevormundung einer medizinischen Wissenschaft gegenüber, die festlegen muss, was als »normal« gelten darf. Der Mediziner und Philosoph Andreas Heinz plädiert angesichts der Diversität menschlicher Lebensformen für einen philosophisch informierten Krankheitsbegriff, der Krankheit als Störung wesentlicher Organfunktionen definiert, die für die betroffene Person schädlich sind oder erhebliches Leid verursachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Im Rahmen der Überarbeitung zentraler Handbücher zur Diagnose und Einordnung psychischer Erkrankungen wird momentan heftig darüber gestritten, wie lange beispielsweise ein Mensch nach dem Tod eines nahen Angehörigen trauern darf, ohne als depressiv oder anderweitig psychisch krank zu gelten. In der Debatte stehen Versorgungsansprüche der Betroffenen sowie deren Ängste vor Pathologisierung und Bevormundung einer medizinischen Wissenschaft gegenüber, die festlegen muss, was als »normal« gelten darf. Der Mediziner und Philosoph Andreas Heinz plädiert angesichts der Diversität menschlicher Lebensformen für einen philosophisch informierten Krankheitsbegriff, der Krankheit als Störung wesentlicher Organfunktionen definiert, die für die betroffene Person schädlich ist oder erhebliches Leid verursacht.
Andreas Heinz ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Campus Charité Mitte in Berlin.
Andreas Heinz
Der Begriff der psychischen Krankheit
Suhrkamp
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der folgende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2108.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2014
© Andreas Heinz
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-73687-6
www.suhrkamp.de
Inhalt
Einführung
1 Krankheit und Kranksein
2 Psychische Krankheit als Normabweichung lebenswichtiger Funktionen?
3 Psychische Krankheit als Entfremdung?
4 Krankheit als Funktionsstörung in der Innen-, Außen- und Mitwelt
5 Alltagspraktische Kriterien zur Diagnose psychischer Krankheiten
6 Subjektives Leid als Kriterium psychischer Krankheit?
7 Psychische Krankheit und Störung sozialer Teilhabe
8 Objektive Krankheitssymptome im Lichte von Kants Anthropologie
9 Die Wahnsymptomatik im Lichte der Philosophischen Anthropologie Schelers und Plessners
10 Ich-Störungen und der entfremdete Selbstbezug
11 Affektion und Stimmung bei Heidegger und ihre Bedeutung für affektive Erkrankungen
12 Zucht gegen Sucht?
13 Kooperation und soziale Teilhabe
14 Der Begriff der psychischen Krankheit – Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
Danksagung
Namenregister
7Einführung
Wozu dient die Diskussion des Begriffs psychischer Krankheit? Ärzte, das stellte schon Jaspers in seiner Psychopathologie fest, interessieren sich in der Regel für einzelne Krankheiten, nicht aber für Definitionen eines abstrakten Krankheitsbegriffs.[1] Die Bestimmung dessen, ob ein Mensch krank ist oder nicht, erscheint in lebenspraktischer Hinsicht häufig ganz unkompliziert: Wer kennt nicht das plötzlich eintretende Gefühl von Unwohlsein und Schmerzen, das mit einem akuten grippalen Infekt verbunden ist? Menschen spüren also, wenn sie krank sind, und die Ärzte interessiert nicht, ob sie krank sind, sondern welche Krankheit sie haben und wie diese behandelt werden kann. Ist die Diskussion eines allgemeinen Begriffs, sei es nun psychischer oder somatischer Krankheit, also eine vorwiegend akademische Angelegenheit, mit wenig Bezug zu lebenspraktischen Fragen?
Aber schon diese erste Annäherung an die Problemstellung zeigt beim näheren Hinsehen, dass die Sachlage so einfach nicht ist. Denn wie steht es um die zunehmende Zahl von Schönheitsoperationen? Handelt es sich hier um Krankheiten, deren Beseitigung durch plastische Chirurgie von der Solidargemeinschaft der Versicherten zu tragen ist, oder um individuelle Vorlieben beziehungsweise Optimierungsbemühungen, die in den Verantwortungsbereich – auch in finanzieller Hinsicht – des Einzelnen fallen? Und wo genau verläuft die Grenze? Diese Frage verweist auf einen praktischen Aspekt der Erörterung von Krankheitsbegriffen. Denn mit Krankenrolle und Krankenstatus sind Rechte und Pflichten verbunden, wie etwa das gerade genannte Recht auf solidarische Unterstützung durch die Gesunden.
Zu den praktischen Fragen im weiteren Sinn gehören aber auch die (medizin-)ethischen Fragestellungen. Wenn beispielsweise jemand aufgrund eines bisher unbemerkten Tumors in seinem Gehirn plötzlich einen epileptischen Anfall erleidet und infolgedessen einen Verkehrsunfall verursacht, werden wir spontan davon ausgehen, dass dieser Mensch keine Schuld an seinem Verhalten 8trägt. Die entsprechende Argumentation lautet kurz gesagt wie folgt: Eine neurobiologisch fassbare Erkrankung (das Tumorleiden) hat hier zu Störungen wesentlicher psychischer Funktionen wie beispielsweise der Wachheit, Orientierung oder Aufmerksamkeit während des epileptischen Anfalls geführt, und da der Tumor unbekannt war, hatte der Autofahrer keinerlei Chance, zu wissen, dass er besser kein Fahrzeug geführt hätte. Die Diagnose einer Erkrankung hat also direkte Bedeutung für die Zuschreibung von Schuld beziehungsweise Verantwortlichkeit und damit für die ethische Beurteilung der Situation.
Diese vorläufigen Überlegungen verweisen auf eine weitere Differenzierung, die wir bei der Erörterung des Krankheitsbegriffs vornehmen sollten – nämlich die Frage, auf welcher Ebene der Beobachtung beziehungsweise empirischen Untersuchung Befunde nachweisbar sind, die dazu führen, dass eine Krankheit diagnostiziert werden kann. In dem genannten Beispiel sind dies Befunde auf mindestens zwei Ebenen – jener der objektiv (etwa durch Bildgebung) erfassbaren neurobiologischen Veränderung im Sinne des Gehirntumors und jener zweiten Ebene der Beeinträchtigung wesentlicher psychischer Funktionen, die dazu führt, dass der Betroffene beispielsweise im Verlauf eines epileptischen Anfalls das Bewusstsein verliert und einen Unfall verursacht.
Der Krankheitsbegriff kann in dem genannten Fall den Schutz des Betroffenen vor strafrechtlicher Verfolgung sichern, die eintreten würde, wenn ein Mensch plötzlich willentlich die Kontrolle über sein Fahrzeug aufgäbe und andere im nachfolgenden Unfall schwer verletzt würden. Auf der anderen Seite kann eine Krankheitsdiagnose aber auch entscheidend dazu beitragen, dass der betroffene Mensch einerseits zwar strafrechtlich entlastet wird, andererseits aber gegen seinen Willen zum Schutz anderer Menschen oder seiner selbst in einer psychiatrischen Klinik untergebracht und behandelt wird. In Deutschland existieren hier unterschiedliche rechtliche Grundlagen, je nachdem, ob es sich um eine akute und dringend abzuwendende Fremd- oder Selbstgefährdung handelt (dann greifen die psychiatrischen Krankengesetze der Bundesländer, die von Bundesland zu Bundesland eine gewisse Variation aufweisen) oder um eine chronische Gefährdung des Lebens und der Gesundheit des Betroffenen (dann findet in der Regel das Betreuungsrecht Anwendung). Was hier formaljuristisch geschildert 9wird, kann im Alltag Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen werden. Wenn beispielsweise eine Person davon überzeugt ist, dass Teufel in die Körper ihrer Mitmenschen fahren und diese deshalb körperlich angreift, dann ist sie zumindest zu Beginn der Behandlung nach zwangsweiser Unterbringung in einer Klinik in der Regel nur selten davon zu überzeugen, dass ihre Ansicht irrig ist und sie »in Wirklichkeit« an einer Psychose leidet. Genauso wenig wird es einem solchen Patienten einleuchten, dass die beste Reaktion auf seine bedrohlichen Erlebnisse nicht der körperliche Angriff auf die vermeintlichen Teufel ist, sondern die Teilnahme an psychotherapeutischen Gesprächen und die Einnahme von Medikamenten zur Regulation neurobiologischer Veränderungen, welche nach dem Stand des medizinischen Wissens die Psychose auslösen. Hier stellt sich also die medizinethische Frage nach den Rechten der Betroffenen, bei denen psychische Erkrankungen diagnostiziert werden und die selbst keine sogenannte Krankheitseinsicht haben.
Findet sich bei dem Menschen mit der psychotischen Überzeugung, dass Teufel plötzlich in Mitmenschen fahren können, ein neurobiologisch objektiv nachweisbarer Befund, zum Beispiel ein Tumor oder eine entzündliche Reaktion in Hirnregionen, deren Störung dazu führen kann, dass (etwa im Rahmen epileptischer Anfälle beziehungsweise deren Vorstadien, die durch Tumoren oder Entzündungen ausgelöst werden können) ein derartiges psychotisches Erleben auftritt, regt sich in der Regel wenig Widerspruch, wenn dieser Patient auf einer neurologischen Intensivstation gegen seinen Willen behandelt wird. Ja, es erschiene geradezu unmenschlich, wenn er keine medizinische Hilfe erfahren würde, ganz unabhängig davon, ob er oder sie dies im Moment einsehen kann.
Auf der anderen Seite steht die Befürchtung größerer Teile der Bevölkerung, dass fehlende Krankheitseinsicht als ein Kriterium für das Vorliegen einer psychischen Krankheit gewertet werden könnte, das immer dann Anwendung findet, wenn der Patient nicht die Meinung des ihn behandelnden Arztes teilt. Es besteht also die Befürchtung, dass Mediziner willkürlich Patienten immer dann einweisen und gegen ihren Willen behandeln, wenn diese sich nicht so verhalten, wie es der Arzt, in diesem Fall der Facharzt für psychische Erkrankungen beziehungsweise der Psychiater, von ihnen erwartet. Zur Verhinderung eines solchen möglichen Missbrauchs des Krankheitsbegriffes, wie er beispielsweise von Amnesty 10International in der Sowjetunion beobachtet wurde, dient die Definition des Begriffs der psychischen Krankheit. Nur wenn die Grenzen hinlänglich klar und praktikabel definiert werden können, kann der politische oder soziale Missbrauch eines solchen Begriffs eingeschränkt werden.
Besondere Aktualität gewinnt die Diskussion um den Begriff der psychischen Krankheit und seine ethischen Implikationen durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention, die seit dem 26.März 2009 in der Bundesrepublik Deutschland geltendes Recht ist. Denn eine der zentralen Forderungen, die mit der UN-Konvention verbunden sind, lautet, dass Menschen mit Behinderung nicht anderen Gesetzen unterworfen werden dürfen als der Rest der Bevölkerung. Einige Patientenvertreterinnen und -vertreter sowie Psychiatriebetroffene postulieren nun, dass psychisch Kranke aufgrund ihrer eingeschränkten Teilnahme an der Gesellschaft immer als Behinderte im Sinne der Konvention zu sehen sind und nie im Rahmen von Gesetzen zur Behandlung psychischer Erkrankungen gegen ihren Willen behandelt werden dürfen. Unabhängig von der möglichen Differenzierung zwischen somatisch objektivierbaren Erkrankungen (etwa einem Tumorleiden) und ihren Folgen für psychische Funktionen (Orientierung, Auffassung, Konzentration) gelten die in der UN-Konvention genannten Rechte für alle Menschen mit Behinderungen und damit auch für Personen mit (längerfristig bestehenden) psychischen Störungen infolge organischer Erkrankungen. Eine mögliche Lesart der UN-Konvention besagt also, dass weder der Mensch, der im Rahmen einer Psychose Teufel in andere Personen fahren sieht, noch der Alkoholabhängige im Delir oder der im Rahmen einer Tumorerkrankung verwirrte Patient gegen seinen aktuell geäußerten (»natürlichen«) Willen behandelt werden dürfte, auch wenn ihn dies das Leben kosten kann und ihm diese Gefahr nicht einsichtig ist.
Unabhängig von den sich hier abzeichnenden ethischen Problemen ist festzuhalten, dass der Begriff der »Behinderung« in der UN-Behindertenrechtskonvention juristisch so gefasst ist, dass eine solche weite Auslegung tatsächlich möglich ist. Sind dann also alle Gesetze, welche eine Zwangsbehandlung derjenigen ermöglichen, die – wie der genannte Patient mit Epilepsie oder eine Person mit schizophrener Psychose – im Rahmen ihrer Erkrankung andere angreifen, Sondergesetze gegen Menschen mit psychischer Behin11derung, die entsprechend der Ratifizierung der Konvention sofort abzuschaffen sind? Im Rahmen des Umgangs mit Personen, die beispielsweise an schizophrenen Psychosen leiden, ist dies eine sehr wichtige und heftig diskutierte Frage.
Allerdings wird diese Frage in der Regel nicht im konkreten Umgang mit Menschen diskutiert, die wie der Patient mit Hirntumor an einer epileptischen Erkrankung leiden, welche zu vergleichbaren psychischen Störungen führen kann, wie sie unter einer schizophrenen Psychose auftreten. Jemanden in solch einer akuten Verwirrtheit alleinzulassen erscheint, wie oben angedeutet, inhuman. Wäre es vertretbar, einen Menschen, der »ohne eigenes Zutun beziehungsweise eigene Schuld« einen Hirntumor entwickelt, von dem er nichts weiß, den Auswirkungen dieser neurobiologisch fassbaren Erkrankung zu überlassen inklusive der durch sie bewirkten Störung seiner Wachheit, Orientierung und Handlungskontrolle sowie der möglichen Gefährdung seines eigenen Lebens oder der Gesundheit anderer? Aber wenn wir diese Frage verneinen, wie lässt es sich dann rechtfertigen, dass Menschen, die vergleichbare Störungen ihrer Orientierung und Handlungskontrolle im Rahmen einer schizophrenen Psychose erleiden, ohne dass mit den derzeit verfügbaren Methoden eine verursachende Strukturauffälligkeit dokumentiert werden kann, zumindest im Sinne der weiten Auslegung der UN-Behindertenrechtskonvention nicht behandelt werden dürfen, selbst wenn sie aufgrund ihrer Erkrankung den Sinn der Behandlung, ja das Vorliegen einer Erkrankung nicht einsehen und sich selbst oder andere gefährden? Muss hier also zwischen Krankheit und Behinderung unterschieden werden? Und ist diese Unterscheidung davon abhängig, ob es sich um somatische oder psychische Krankheiten handelt?
Die hier angesprochene Frage verweist also wieder darauf, wie dringend eine genaue Definition der Begriffe psychischer und somatischer Krankheit benötigt wird. Wichtig erscheint es hier, wie oben angedeutet, die Ebenen der Definition beziehungsweise der empirischen Befunderhebung genau zu betrachten und zu prüfen, welche Auffälligkeiten auf neurobiologischer beziehungsweise psychopathologischer ebenso wie auf sozialer Ebene als Kriterien für das Vorliegen einer Erkrankung gewertet werden und welche Konsequenzen sich jeweils daraus ergeben.
Natürlich lassen sich diese Fragen, nur weil sie gestellt werden 12können, nicht automatisch auch beantworten. Psychiatriekritiker wie Thomas Szasz haben gegen Versuche, psychische Krankheit zu definieren, eingewendet, dass der Krankheitsbegriff bereits in der allgemeinen Medizin unscharf definiert ist und dass sich Krankheitsbezeichnungen aus so unterschiedlichen Momenten ergeben wie der Verursachung (so bei der Tuberkulose im Sinne des Tuberkelbazillus) oder dem Schadensmechanismus (wie beim Hirninfarkt im Sinne der Durchblutungsstörung).[2] In anderen Fällen bezieht sich der Name der Erkrankung nur auf das Symptom (wie bei der essentiellen Hypertonie, bei der das Wort essentiell die fehlende Kenntnis der Entstehungsbedingungen andeutet und die Erkrankung nur nach ihrem Leitsymptom, dem Bluthochdruck, benannt ist). Was schon in der Allgemeinmedizin schwierig ist, erscheint in der Psychiatrie und Psychotherapie noch komplexer. Denn es gibt (wie zu erörtern sein wird) nur bei einer beschränkten Anzahl von psychischen Erkrankungen organische Befunde, die ohne Beurteilung psychischer Funktionen zumindest eine vorläufige Krankheitsdiagnose zulassen – ein Beispiel ist die Alzheimer-Demenz mit neurobiologisch beobachtbaren Veränderungen in der Struktur des Gehirns wie in der chemisch messbaren Zusammensetzung des Hirnwassers. Deshalb stellt sich für Erkrankungen ohne richtungweisende neurobiologische Korrelate umso dringlicher die Frage nach ihrer Definition und Diagnosestellung. Angesichts der Diskussion um die UN-Behindertenrechtskonvention ergibt sich hier zudem die Notwendigkeit, Krankheit und Behinderung entweder klar voneinander abzugrenzen oder den Überlappungsbereich beider Definitionen zu benennen.
Zu den ethischen Dimensionen des Krankheitsbegriffs gehören aber auch Versuche, ein Kriterium des guten Lebens aus der Definition psychischer Krankheit und Gesundheit zu gewinnen. So verweist Ernst Tugendhat darauf, dass ein Begriff psychischer Gesundheit beziehungsweise Krankheit ein objektives, »vom Willen unabhängiges« Kriterium des »Wohls« darstellen könnte.[3] Tugendhat betont aber gleichzeitig, dass ein moderner Begriff psychischer Gesundheit nie den Inhalt, sondern nur die Form des je individuellen Lebens betreffen darf. Auf der Suche nach einem solchen 13formalen Begriff, der den Inhalt des gelebten Lebens nicht vorgibt, unterscheidet Tugendhat zwischen krankhaftem Verhalten, das er als »zwanghaft« versteht, und gesundem Verhalten, das »flexibel« beziehungsweise »willentlich« kontrolliert sei.
Hier wird eines der Probleme der Definition psychischer Krankheit deutlich – die Abhängigkeit von einem je bestimmten Menschenbild, in diesem Fall von dem der Psychoanalyse. Gemäß dem Motto »Wo Es war, soll Ich werden« wird Gesundheit bei Tugendhat zumindest mit der Möglichkeit zur willentlichen Kontrolle des Verhaltens und Krankheit mit automatischem beziehungsweise sich zwanghaft wiederholendem Verhalten gleichgesetzt. Die ganze jüngste Diskussion über Willensfreiheit in Anbetracht neurobiologischer Befunde stellt aber solche einfachen Dichotomien infrage. Denn wenn sich bei entsprechender Subtilität der Untersuchungsmethodik immer neurobiologische Korrelate jedweden menschlichen Verhaltens nachweisen lassen (was auch nicht anders zu erwarten wäre, wenn wir davon ausgehen, dass psychische Funktionen nicht im leeren Raum entstehen, sondern ein zentralnervöses Korrelat haben), aufgrund welcher Tatsache halten wir dann ein Verhalten, das im Rahmen einer Tumorerkrankung ausgelöst wird, für ein entschuldbares beziehungsweise gar nicht schuldfähiges Tun, während ein Verhalten, das im Rahmen einer anderen neurobiologischen Konstellation, die in dem Fall »dem normalen Zustand« des betroffenen Menschen entspricht, als zu verantwortendes Tun bestraft werden kann?
An diesem Punkt könnte man einwenden, dass eine Tumorerkrankung je nach Lokalisation im Gehirn zu regelhaft auftretenden neurologischen Symptomen (Lähmungen, Sensibilitätsstörungen etc.) und zu typischen psychischen Beeinträchtigungen (zum Beispiel zu Sprachstörungen oder Störungen des Arbeitsgedächtnisses) führt, während die Frage, inwiefern vorhergehende neuronale Zustände meinen jetzigen Willen beeinflussen, philosophisch wie naturwissenschaftlich durchaus umstritten ist.[4] Das gilt aber für alle psychischen Auswirkungen einer Tumorerkrankung: Sind exzes14siver Alkoholkonsum und sozial enthemmtes Verhalten, die nach Läsionen bestimmter Bereiche des Stirnhirns (etwa des orbitofrontalen Kortex) auftreten können, Auswirkungen der Zerstörung dieser Hirnareale oder Ausdruck der Reaktion der betroffenen Person auf ihre Erkrankung, die erlebte Beeinträchtigung oder die sozialen Folgen, zu denen Verarmung und Ausschließung gehören können? Wenn jemand wie der berühmte Phineas Gage nach seinem Unfall verstärkt Alkohol konsumiert – ist das die Folge einer Beeinträchtigung seiner freien Willensbildung durch die Verletzung des Stirnhirns oder eine verständliche Reaktion auf das traumatische Ereignis und den damit verbundenen sozialen Abstieg? Generelle Diskussionen um die Beeinträchtigung der Willensfreiheit durch neurobiologisch fassbare Erkrankungen helfen hier nicht wirklich weiter. Entscheidend für die Einschätzung der psychischen Auswirkung der genannten Tumorerkrankung ist die Frage, welche klinisch nachweisbaren Fähigkeiten oder testpsychologisch erfassbaren Funktionen beeinträchtigt sind und in welchem Ausmaß das die Möglichkeiten des Individuums einschränkt, flexibel mit wechselnden Anforderungen der Umwelt umzugehen.
Die Diskussion um die Willensfreiheit soll an dieser Stelle nicht vertieft werden, es sei jedoch darauf hingewiesen, dass mit der Flexibilität des Verhaltens eine Definition gegeben sein könnte, die Probleme der Zuschreibung von Willensfreiheit umgehen und die genannten Fragen auf einer deskriptiven Ebene der genaueren Analyse zugänglich machen könnte. Dann wäre nicht zu prüfen, ob ein bestimmtes Verhalten willentlich gesteuert ist oder nicht, sondern zu beurteilen, ob der Mensch zumindest zu anderen Zeiten in derselben Situation andere Verhaltensweisen zeigt und wie flexibel sein Verhalten demnach gestaltet werden kann. Eine solche Flexibilität des Verhaltens im Sinne einer Pluralität individuell möglicher Verhaltensmuster und -manifestationen kann als Kriterium psychischer Gesundheit beziehungsweise als Ressource interpretiert werden, die dazu beiträgt, psychische Gesundheit zu erhalten.[5]
Ob aber ein Begriff psychischer Gesundheit dazu taugt, Hinweise auf ein »gutes Leben« oder das »Wohl« der Menschen zu liefern, ist eine davon unabhängige Frage und muss deshalb geson15dert erörtert werden. An dieser Stelle sei nur vermerkt, dass solche Diskussionen von hoher Aktualität sind, denkt man daran, dass derzeit heftig darum gestritten wird, ob pharmakologische Eingriffe zur Verbesserung kognitiver Leistungsfähigkeit bei Gesunden oder gar Kindern generell erlaubt werden sollten, ja in bestimmten Situationen sogar erzwungen werden müssten (beispielsweise zur Durchführung einer komplizierten Operation, wenn der Eingriff dem Operateur hilft, weniger Schaden anzurichten). Der Begriff des guten Lebens beziehungsweise des gesunden oder natürlichen Verhaltens ist also medizinethisch von großer Bedeutung.[6]
Diese einführenden Bemerkungen verweisen implizit bereits auf die philosophische Dimension jeglicher Diskussion über psychische Gesundheit – auf die mehr oder weniger explizite Bezugnahme auf anthropologische Grundannahmen. Denn wie zu zeigen ist, kann eine Definition psychischer Krankheitszustände (wie jeder anderen Erkrankung auch) nur dann erfolgen, wenn subjektive Leidenszustände, objektivierbare Krankheitssymptome und Einschränkungen der sozialen Teilhabe berücksichtigt und eingeschätzt werden, wenn Krankheitssymptome und -folgen also auf der Ebene der Innen-, Außen- und Mitwelt definiert werden.[7] Aber selbst wenn man diese Dreiteilung der begrifflichen Definition mit ihrer expliziten Differenzierung zwischen der Innen-, Außen- und Mitwelt nicht für plausibel hält und sich allein auf »objektivierbare Krankheitszeichen« (zugänglich durch Außen- beziehungsweise Fremdbeobachtung) spezialisiert, kommt man um anthropologische Grundannahmen nicht herum. Denn warum sollte beispielsweise eine akute Desorientiertheit im Alkoholentzugsdelir, bei der ein Patient nicht mehr weiß, wo er ist und in welcher Jahreszeit oder gar welchem Jahr er lebt, Zeichen einer psychischen Erkrankung sein, wenn man nicht vorher festgelegt hat, dass es zu den »natürlichen« oder zumindest normativ zu erwartenden Fähigkeiten des Menschen gehört, bezüglich Ort und Zeit orientiert zu sein? Und selbst wenn wir letztgenannte Frage als einfach zu beantworten beiseitetun, da es schwer sein wird, Menschen zu finden, 16die ohne örtliche und zeitliche Orientierung ihren Alltag meistern können, stellt sich die Frage nach dem Menschenbild beziehungsweise den anthropologischen Grundannahmen umso dringlicher bei Symptomen wie dem Hören von Stimmen, die einen Suizid befehlen. Denn diese können nur dann als Krankheitszeichen gelten, wenn vorher ausgeschlossen wurde, dass auch zur Diskussion stehen könnte, dass hier tatsächlich Dämonen, Teufel oder »höhere« geistige Wesen wie Engel dem Betroffenen eine wichtige Botschaft geben. Letztgenannte Option mag zumindest in westlichen Industriegesellschaften auf den ersten Blick absurd erscheinen, das Auftreten von Exorzisten in öffentlichen psychiatrischen Kongressen – wie im Oktober 2007 in Graz – weist aber darauf hin, dass solche Fragen noch nicht einmal im deutschsprachigen Raum als allgemein geklärt und konsentiert betrachtet werden können.
Aus diesen Vorüberlegungen ergibt sich also, dass eine Definition des Begriffs psychischer Krankheit aus mehreren Gründen interessant sein kann:
Erstens mit Blick auf die medizinisch-ethischen und praktischen Konsequenzen, die sich direkt aus Fragen des Umgangs mit psychisch Kranken in ethischer und humanitärer Hinsicht ergeben;
zweitens im Rahmen allgemein-ethischer Überlegungen, die auf ein »gutes Leben« zielen und versuchen, einen wie auch immer physiologisch oder normativ definierten Zustand als Gesundheit zu bezeichnen und daraus Argumente abzuleiten, unter welchen Bedingungen beispielsweise eine pharmakologische Veränderung dieses Zustands zuträglich oder abträglich und gegebenenfalls zu unterstützen oder zu verbieten ist;
und drittens im Hinblick auf verallgemeinerungsfähige anthropologische Grundannahmen, die jeder Definition des Begriffs psychischer Krankheit implizit oder explizit zugrunde liegen. Das ist insbesondere deshalb interessant, weil Krankheitsdefinitionen heute international erörtert und angewendet werden und sich die ihnen zugrunde liegenden anthropologischen Grundannahmen von daher in diverse kulturelle Kontexte übertragen lassen müssten.
International bestehen zur Klassifikation psychischer Krankheiten im Wesentlichen zwei große Systeme: das der WHO (World Health Organization), die International Classification of Disorders (ICD), und das der American Psychiatric Association (APA), das Diagnostic and Statistic Manual (DSM). Der internationale Kon17text und die zumindest postulierte internationale Anwendbarkeit dieser Klassifikationen und ihrer diagnostischen Kriterien weisen darauf hin, dass anthropologische Grundannahmen, die der Definition von Krankheitssymptomen und Krankheiten in diesen Klassifikationssystemen implizit oder explizit zugrunde liegen, als universal gültig angesehen werden. Anhand der Klassifikationssysteme kann also untersucht werden, welche anthropologischen Annahmen die jeweiligen Krankheitsdefinitionen geprägt haben. Wenn dabei wie erwartet unterschiedliche Menschenbilder beziehungsweise anthropologische Modelle zur Anwendung kommen, kann geprüft werden, welche Theorien sich dafür eignen, solche Definitionen ohne ideologische Scheuklappen (Stichwort Eurozentrismus) zu formulieren und welche nicht. Das heißt, es stellt sich die Frage, inwiefern etwa die europäische historische Entwicklung und die damit verbundenen Lebensweisen und Anforderungen an individuelle Anpassungsleistungen als universelle Norm gesetzt werden, so dass Abweichungen nicht als alternative Lebens- oder Gesellschaftsentwürfe, sondern als defizitäre Formen interpretiert werden. Damit ergibt sich die Möglichkeit des Vergleichs und der Diskussion der anthropologischen Grundannahmen und Traditionen im Hinblick darauf, inwiefern sie zur Konstruktion und Kritik der Krankheitsdefinitionen nutzbar gemacht werden können.
Aber können ein Begriff der »psychischen Krankheit« sowie eine Definition einzelner Krankheitsbilder überhaupt angemessen formuliert werden, wenn damit bereits implizit vorausgesetzt wird, dass zwischen psychiatrischen und neurologischen beziehungsweise psychischen und somatischen Krankheiten angemessen unterschieden werden kann? Eine somatische Erkrankung im Sinne von tumorösen oder epileptischen Krankheiten ließe sich demnach hinreichend schlüssig auf neurobiologischer Ebene definieren (auch wenn Störungen psychischer Funktionen wie der Wachheit dazukommen können), eine psychische oder psychiatrische Erkrankung aber nur auf der Ebene psychischer Funktionsstörungen und der damit verbundenen klinisch auffälligen Symptome. Diese Unterscheidung ist allerdings nicht hinreichend. Denn im Bereich der neurologischen Erkrankungen gibt es Krankheitsbilder, welche als organische, neurobiologisch vermittelte Erkrankungen gelten, aber dennoch ganz vordringlich anhand von Symptomschilderungen der betroffenen Menschen diagnostiziert werden. Migräne wäre 18ein Beispiel hierfür; zwar findet man im Einzelfall begleitende, neurobiologisch erfassbare Auffälligkeiten wie Sehstörungen oder Veränderungen der Aktivierung unterschiedlicher Hirnareale im Schmerzanfall, diese sind aber für die entsprechende Diagnosestellung nicht notwendig. Ebenso lässt sich mittlerweile bei Abhängigkeitserkrankungen oder schizophrenen Psychosen eine Vielzahl neurobiologischer Auffälligkeiten nachweisen, ohne dass diese für die Diagnosestellung entscheidend sind.[8]
Hinzu kommt, dass manche Betroffene den Begriff der psychischen Erkrankung grundsätzlich ablehnen, weil er stigmatisierend sei. So erzählte mir eine selbst von einer Psychose betroffene Rehabilitationspädagogin, dass sie nicht grundsätzlich gegen den Begriff der Krankheit sei, aber explizit den der »psychischen« Erkrankung ablehne. Sie sah durchaus die Bedeutung, die dem Krankheitsbegriff zur Einschätzung der Schuldfähigkeit beziehungsweise Schuldhaftigkeit des Tuns eines Menschen – beispielsweise bei Vorliegen einer Psychose – im gesetzlichen Rahmen zukommt. Was sie störte, war also nicht das Postulat, dass es Krankheiten gibt, die psychische Funktionen beeinträchtigen, sondern dass es sich dabei tatsächlich um »psychische Krankheiten« handele. Dies führt zu der Frage, ob man die psychischen Störungen, wie sie in ICD und DSM genannt werden, in »echte Krankheiten« einerseits und allgemeinmenschliche Leidenszustände andererseits unterteilen kann. Eine solche Unterteilung würde zumindest die häufig geäußerte Kritik ernst nehmen, dass die Zahl der in beiden Klassifikationssystemen genannten psychischen Störungen beständig zunimmt und dass es bald keinen Leidenszustand mehr gibt, der nicht als Störung diagnostizierbar wäre. So wurde im Rahmen der Erneuerung des DSM diskutiert, wie lang eine Trauerreaktion dauern darf, bevor sie als psychische Störung zu werten ist –zwölf, sechs oder drei Monate oder gar nur zwei Wochen? Wie lange also muss ein psychischer Leidenszustand, der in bestimmten Belastungssituationen verständlicherweise entsteht und typischerweise im Leben aller Menschen auftritt, dauern, damit eine Krankheit diagnostiziert und sich die Betroffenen auf Kosten der Solidargemeinschaft behandeln lassen dürfen? Auf der anderen Seite: Welche mensch19lichen Reaktionsweisen bleiben überhaupt noch übrig, wenn jeder Zustand, der über die Idealnorm des glücklichen, zufriedenen und leistungsbereiten Bürgers hinausweist, bereits pathologisiert wird? Hier geht es also um die Definition psychischer Krankheiten, und in der Tat gibt es in der deutschen Psychiatrie eine Tradition, diesen Begriff auf wenige, klar umgrenzte Krankheitsbilder einzuengen. Leidenszustände wie eine lange Trauerreaktion gehören dann zu den Variationen menschlichen Lebens, die subjektiv und sozial beeinträchtigen können, aber eben keine »Krankheit« darstellen. Aber was ist dann das Kriterium einer »richtigen« Krankheit? Das Vorliegen neurobiologischer Korrelate? Das Auftreten besonders schwerer Funktionsstörungen? Das schicksalhafte Hereinbrechen der Erkrankung ohne lebensgeschichtliche Verständlichkeit wie das plötzliche Auftreten von Beschwerden bei einer bisher unentdeckten Krebserkrankung? Die Unausweichlichkeit oder Schwere der Erkrankung?
In diesem Buch sollen die genannten Fragen im Hinblick auf Einschränkungen im Bereich der Innen-, Außen- und Mitwelt geordnet werden, um zu prüfen, ob in diesen Anwendungsbereichen gleichartige oder unterschiedliche Krankheitskriterien anzuwenden sind. Daran anschließend wird die Frage erörtert, ob der Begriff der »psychischen« Erkrankung überhaupt Sinn ergibt oder ob stattdessen ein anderer Begriff gefunden werden muss.
Die Unterschiede zwischen dem subjektiven Krankheitserleben und einem objektivierbaren Krankheitsprozess sowie den dadurch bedingten Funktionsstörungen im sozialen Miteinander werden in Kapitel 1 begrifflich differenziert. Im englischsprachigen Raum werden hierzu häufig die Begriffe illness, disease und sickness verwendet, wobei illness das individuelle Krankheitserleben, disease den objektiven Krankheitsprozess und sickness die Auswirkungen des Krankheitsprozesses im Mitsein beziehungsweise sozialen Miteinander bezeichnet.[9] Unterschiedliche Krankheitskonzeptionen, beispielsweise mit Bezug auf Verhaltensflexibilität und Willensfreiheit sowie auf die Leidenszustände und Beeinträchtigungen in der Lebenswelt, werden in diesem Bezugsrahmen voneinander abgegrenzt.[10]
20In Kapitel 2 wird unter Verweis auf Thomas Schramme[11] ein »wissenschaftlich« ausgerichteter Krankheitsbegriff vorgestellt, der auf Normabweichungen Bezug nimmt.[12] Hierbei werden Fragen der Normsetzung, ihrer versuchten Herleitung aus evolutionären Theorien sowie ihrer normativen Implikationen kritisch diskutiert.
Der Versuch, Krankheit als Entfremdung zu definieren, wird in Kapitel 3 analysiert. Ähnlich wie bei dem Ansatz, Krankheit als wissenschaftlich objektivierbare Normabweichung zu fassen, wird hier traditionell auf eine je nach Theorie unterschiedliche Idealnorm menschlichen Lebens Bezug genommen, was aber als »essentialistisch« kritisiert wurde. Anknüpfend an Jaeggi[13] wird deshalb ein Ansatz zur Definition von Entfremdung vorgestellt, der auf Definitionen des universellen »Wesens« menschlicher Lebensführung verzichtet und stattdessen unterschiedliche Grade des Gelingens oder Misslingens der Lebensgestaltung thematisiert und so Elemente der auch von Tugendhat diskutierten Flexibilität menschlichen Handelns im Sinne des guten Lebens aufnimmt.[14]
In Kapitel 4 wird erörtert, auf welchen Erfahrungsbereich menschlichen Lebens die bisherigen Krankheitsbegriffe vordringlich Bezug nehmen und ob sie sich mittels der von Plessner definierten Perspektiven der Innen-, Außen- und Mitwelt ordnen lassen. Es wird diskutiert, ob eine Krankheitsdefinition notwendigerweise Störungen beziehungsweise Einschränkungen in allen genannten Dimensionen der Innen-, Außen- und Mitwelt postulieren und erfassen muss und welche praktischen Konsequenzen aus einem solchen Ansatz zu ziehen sind.
Anhand der Einteilung relevanter Krankheitszeichen in Bezug auf die Innen-, Außen- und Mitwelt werden in Kapitel 5 mögliche Kriterien psychischer Erkrankungen im jeweiligen Bereich menschlicher Erfahrung entwickelt. Beschreibungen individuellen Leidens, sogenannte »objektivierbare« Krankheitssymptome sowie 21Einschränkungen der Fähigkeit, am sozialen Miteinander teilzunehmen, werden anhand des »kleinsten gemeinsamen Nenners« klinischer Praxis identifiziert, mit Blick auf eine universell gültige Beschreibung psychischer Krankheit zusammengefasst und in Hinblick auf ihre Kompatibilität untersucht.
Daran anschließend wird in Kapitel 6 die Frage diskutiert, ob beziehungsweise inwiefern sich individuelle Leidenszustände in der »Innenwelt« objektivieren lassen und ob sie nötige oder sogar hinreichende Symptome psychischer Krankheit darstellen. Ein historisches Beispiel für die Relevanz dieser Frage ist die juristische und fachliche Diskussion über die angemessene Diagnose des Leidens und die davon abhängige Entschädigung von KZ-Häftlingen.
Ethisch relevante Probleme der Definition von Krankheitssymptomen werden in Kapitel 7 im Hinblick auf soziale Ein- und Ausgrenzung durch unterschiedliche Krankheitsbegriffe diskutiert.
Die folgenden Kapitel sind unterschiedlichen anthropologischen Konstrukten und Modellen gewidmet, die der Definition psychischer Krankheit zugrunde liegen können. Zunächst wird in Kapitel 8 unter Rückgriff auf Kants »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht« ein Ansatz vorgestellt, der bewusst von einer Diskussion der physiologischen Grundlagen menschlichen Verhaltens Abstand nimmt.[15] In Kapitel 9 werden Ansätze Schelers und Plessners diskutiert, und es wird untersucht, ob eine Beeinträchtigung der von Plessner als Charakteristikum des Menschen gewerteten Fähigkeit zum Positionswechsel zwischen der zentrischen und exzentrischen Perspektive bestimmte Symptome psychischer Erkrankungen (wie die Wahnbildung) charakterisiert. Besonderes Gewicht wird auf die kulturübergreifende Generalisierbarkeit der jeweiligen anthropologischen Ansätze gelegt, da moderne Krankheitsdefinitionen sich ja explizit nicht nur auf einen bestimmten kulturellen Kontext beziehen sollen.
Als zentrale Kennzeichen psychotischer Erkrankungen gelten die sogenannten Ich-Störungen. Am Beispiel der Gedankeneingebung wird in Kapitel 10 erörtert, ob die Aussage, dass »mir fremde Gedanken eingegeben werden«, als Störung einer präreflexiven Selbst22vertrautheit oder eines reflexiven Selbstbezugs verstanden werden kann. Die Problematik eines solchen Selbstbezugs wird anhand von Plessners Verständnis des Menschen diskutiert, der als exzentrisches Lebewesen in einem durch seine leibliche Zentrizität vermittelten, vermeintlich unmittelbaren Bezug zur Außenwelt steht. Alternative Ansätze, die zwischen dem Besitz (ownership) und der Autorschaft (agency beziehungsweise authorship) von Gedanken unterscheiden und besonderes Gewicht auf die fehlende »Verursachung« eigener Gedanken legen, werden im Hinblick auf die Übertragung von Modellvorstellungen aus dem Bereich der Sensomotorik kritisch erörtert. Die interkulturelle Validität von Konzepten wie der Autorschaft oder Verursachung der eigenen Gedanken wird anhand von Beispielen diskutiert, und es wird betont, dass Ich-Störungen nur dann als Kriterium für das Vorliegen einer psychischen Erkrankung gelten können, wenn sie individuelles Leid oder eine wesentliche Beeinträchtigung der sozialen Teilhabe verursachen.
Minimale anthropologische Grundannahmen bezüglich emotionaler Prozesse und ihrer Störungsmöglichkeiten werden in Kapitel 11 vorgestellt. Heideggers Konzept der jeweils so und so gestimmten Befindlichkeit des »In-der-Welt-Seins« wird im Hinblick auf aktuelle Diskussionen um die welterschließende Funktion der Gefühle reflektiert, und länger andauernde Stimmungen werden von akut auftretenden Affekten unterschieden. Dimensionale und kategoriale Ansätze zur Klassifikation der Emotionen werden im Hinblick auf ihre Relevanz für affektive Erkrankungen und hier insbesondere für depressive Verstimmungszustände diskutiert. Die grundsätzliche Kritik von Griffiths wird erörtert, der infrage stellt, ob es überhaupt Sinn ergibt, basale und komplexe emotionale Phänomene unter einem Begriff zu fassen, und der auf den performativen Aspekt und damit die soziale Wirkung des Gefühlsausdrucks verweist.[16] Die Diskussion um die soziale Einbettung emotionaler Phänomene wird dann anhand der Kritik Adornos[17] an Heidegger sowie aktueller Diskussionen um eine unangemessene Ausweitung des Krankheitsbegriffs auf ubiquitär auftretende menschliche Leidenszustände vertieft.
23In Kapitel 12 wird der Handlungsaspekt menschlicher Lebensäußerungen anhand von Gehlens philosophischer Anthropologie erörtert.[18] Es wird dargestellt, warum Gehlens Verzicht auf eine Stufenfolge pflanzlicher, tierischer und menschlicher Funktionen nicht zu einem Begriff menschlicher Freiheit und Gleichheit, sondern zum Postulat einer vermeintlich notwendigen »Zucht« führt und welche Bedeutung diese herrschaftsaffine Konstruktion für das Verständnis von Suchterkrankungen hat. Die daraus resultierende Annahme, dass »Willensschwäche« ein hilfreicher Erklärungsansatz für das Entstehen von Suchterkrankungen ist, wird anhand aktueller Annahmen zur Pathogenese von Abhängigkeitserkrankungen kritisch diskutiert und mit einem alternativen Modell zur Entstehung von Suchterkrankungen kontrastiert.
Anthropologischen Ansätzen, die explizit die mitweltliche Perspektive menschlichen Lebens betonen und dementsprechend die Bedeutung der gegenseitigen Hilfe und der Fähigkeit zum Verständnis der Intention des anderen als wesentliches Kennzeichen des Menschen benennen,[19] ist Kapitel 13 gewidmet. Hier soll insbesondere der Frage nachgegangen werden, ob sich aus den damit entfalteten Dimensionen eines Lebens in der Mitwelt Anhaltspunkte dafür ergeben können, bei welchen Einschränkungen im Bereich der sozialen Teilhabe von einer (psychischen) Erkrankung gesprochen werden kann.
Zum Abschluss werden in Kapitel 14 der zuvor konstruierte und operationalisierte Begriff psychischer Krankheit sowie die Kritik daran im Lichte verschiedener anthropologischer Modelle zusammengefasst und insbesondere im Hinblick auf die Frage nach der Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung eines solchen Begriffs untersucht.
241 Krankheit und Kranksein
Aus dem persönlichen Erleben heraus erscheint es oft ganz selbstverständlich, dass sich der Zustand des Krankseins von der Gesundheit unterscheidet. Bekommt man plötzlich »aus heiterem Himmel« Kopf- und Gliederschmerzen, tut einem der Hals weh und steigt die Temperatur, dann wissen wir in der Regel, dass es sich um einen grippalen Infekt handelt, und verbinden Annahmen über Ursachen und sinnvolle Therapien mit den Erfahrungen unserer Erkrankung. Ganz anders kann die Krankheitserfahrung gestaltet sein, wenn es sich um eine schleichende oder chronisch-persistierende Erkrankung handelt. So erlebte ein Patient zum Abend hin immer wieder Müdigkeits- und Erschöpfungszustände, die er anfangs für ein Zeichen hielt, dass seine persönliche Belastungsgrenze erreicht sei. Über die Jahre nahmen aber diese Müdigkeitserscheinungen zu, es fiel ihm schwer, abends noch die Augen offen zu halten, und er ging, wie er dachte »vor Müdigkeit«, immer früher ins Bett. Er stellte fest, dass ihm ein spiritueller Heiler in den Niederlanden Erleichterung verschaffen konnte, der ein unkonventionelles Ritual anwendete, bei dem der Hilfesuchende in eine Art Alufolie eingehüllt und mit anderen schulmedizinisch nicht gesicherten Verfahren behandelt wurde. Der Patient fühlte sich durch diese Prozeduren jedes Mal erleichtert, konnte sich aber schließlich die teure und privat zu zahlende Behandlung nicht mehr leisten und begab sich in eine neurologische Klinik, in der eine besondere Form der Muskelschwäche, die Myasthenia gravis, festgestellt wurde. Bei dieser Art der gestörten Übertragung zwischen der Innervation der Muskulatur und der Reaktion der Muskeln auf die entsprechenden Botenstoffe kommt es typischerweise zu einer Abnahme der Muskelkraft im Verlauf des Tages, weshalb der Patient abends beobachtete, dass er die Augenlider kaum noch offen halten konnte. Angesichts all dessen, was über die Natur der Erkrankung bekannt ist, ist es kaum verständlich, dass symbolische Handlungen wie das Einwickeln in Alufolie eine wesentliche Erleichterung bringen konnten.
In diesem Fall zeigt sich zweierlei: einerseits das Auseinander25klaffen zwischen einer objektiv feststellbaren Erkrankung (bei der Myasthenia gravis können bestimmte Antikörper gegen Rezeptoren, das heißt Empfangsstrukturen für die Botenstoffe der Nervenzellen, nachgewiesen werden, die die Diagnose sichern) und dem subjektiven Empfinden der Betroffenen, andererseits der schleichende Übergang zwischen subjektiv erlebbaren Belastungsgrenzen und dem Vorliegen einer Erkrankung. Den entscheidenden Nachweis dafür, dass es sich um eine schulmedizinisch zuordenbare Erkrankung handelte, erbrachte letztlich der objektivierbare Laborbefund. Hier zeichnen sich also zwei Ebenen beziehungsweise Aspekte einer Erkrankung ab: erstens die subjektive Ebene der Erfahrung, dass ein Leidenszustand vorliegt, der basale Funktionen, die für das Alltagsleben wichtig sind, beeinträchtigt, und zweitens die objektive Ebene der Krankheitssymptome. Im Englischen wird dieser Unterschied häufig mit den Begriffen für das subjektive Kranksein und für das Vorliegen einer objektivierbaren Krankheit bezeichnet. Dabei wird meist davon ausgegangen, dass das subjektive Erleben des Krankseins lebensweltlich bestimmt ist. Es unterliegt also sozialen und kulturellen Einflüssen, ob ein bestimmter Leidenszustand von der betroffenen Person als Krankheit interpretiert wird. Alternative Erklärungsversuche könnten diesen Leidenszustand als Ausdruck einer göttlichen oder anderweitig übernatürlichen Strafe für Fehlverhalten sehen oder als Variation des üblichen menschlichen Leidens, das zum Leben gehört und keinen besonderen Krankheitszustand darstellt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!