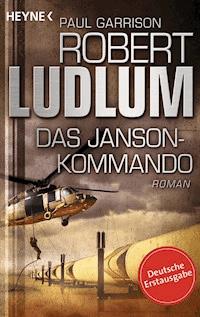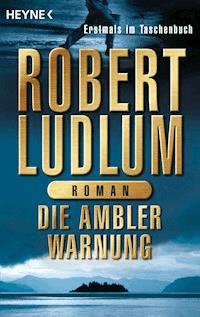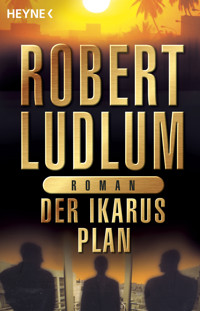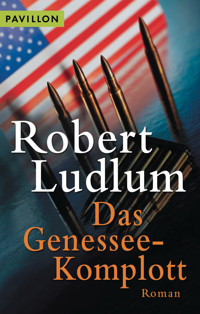
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Andrew Trevayne hat den Auftrag, Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Rüstungsaufträgen zu untersuchen. Im Zuge seiner Ermittlungen gerät er in höchste Gefahr. Er deckt eine Verschwörung auf, die die USA in ihren Grundfesten zu erschüttern droht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 736
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der Originalausgabe TREVAYNE
Ausgabe 10/2004
Copyright © der Einleitung 1989 by Robert Ludlum
Copyright © für den Roman 1973 by Jonathan Ryder
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1984 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © dieser Ausgabe 2004 by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
ISBN 978-3-641-07213-1V002
www.heyne.de
Inhaltsverzeichnis
FÜR GAIL & HENRY
Auf das Savoy! Auf Hampton!Auf den Pont Royale und Bernini!Und alles andereDank
VORWORT
Hie und da vereinen sich im Laufe der menschlichen Odyssee fast zufällig Kräfte und bringen Männer und Frauen von verblüffender Weisheit und ebensolchem Talent hervor; und daraus entstehen wahrhaft wunderbare Resultate. Die Künste und die Wissenschaften sprechen für sich selbst, denn sie umgeben uns und bereichern unser Leben mit Schönheit, Wissen und vielen Bequemlichkeiten. Aber da gibt es noch einen Bereich menschlichen Strebens, der sowohl eine Kunst und zugleich eine Wissenschaft ist; und auch dieser Bereich umgibt uns – und bereichert unser Leben oder zerstört es.
Ich meine damit die Führung einer Gesellschaft gemäß den allgemeinen Gesetzen der Regierungskunst. Ich bin kein Gelehrter; aber ich habe auf dem College einige Vorlesungen über politische Wissenschaften gehört, die mich zutiefst beeindruckt und bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Ich war fasziniert, hingerissen, wie erschlagen, und hätte es nicht andere, ausgeprägtere Neigungen gegeben, so wäre ich vielleicht der schlimmste Politiker der ganzen westlichen Welt geworden. Mein Temperament fängt etwa am Siedepunkt des Wassers an abzukühlen.
Die demokratische Regierungsform durch gewählte Volksvertreter ist für mich eine der wahrhaft großen Errungenschaften des Menschen. Und von all den Versuchen im Verlauf der Geschichte, ein solches System zu schaffen, war wohl der bedeutendste jenes großartige amerikanische Experiment, das sich in unserer Verfassung manifestiert. Sie ist nicht perfekt; aber, um Churchills Worte in etwas anderer Form zu wiederholen, wohl die beste, die wir in der ganzen Straße haben.
Doch es gibt immer jemanden, der versucht, sie kaputtzumachen.
Dies ist der Grund, weshalb ich vor beinahe zwei Jahrzehnten Das Genessee-Komplott (Trevayne) schrieb. Das war die Zeit von Watergate, und mein Stift flog empört über die Seiten. Worte und Sätze wie Verlogenheit! Machtmißbrauch! Korruption! Polizeistaat! drohten mir in jüngerer – nicht jugendlicher – Maßlosigkeit den Schädel zu sprengen.
Das war eine Regierung, das Gremium unserer höchsten gewählten und ernannten Beamten, denen die Obhut über unser System übertragen war – und diese Regierung belog das Volk nicht nur, sondern sammelte Millionen und Abermillionen, um weiterhin ihre Lügen zu verbreiten und damit die Macht auszuüben, von der sie glaubte, daß sie nur ihr alleine gehöre. Eine der furchterregendsten Aussagen bei den Watergate-Anhörungen war die folgende, die im wesentlichen vom höchsten Repräsentanten der Nation gemacht wurde, dessen Auftrag es doch war, über die Einhaltung der Gesetze zu wachen:
»Es gibt nichts, was ich nicht tun würde, um die Präsidentschaft zu behalten...« Ich brauche den Satz nicht exakt zu Ende zu führen, die Bedeutung war klar. Die Präsidentschaft wie das Land gehörte ihnen. Nicht mir oder dir oder selbst den Nachbarn auf der anderen Straßenseite, mit denen wir häufig Meinungsverschiedenheiten über politische Fragen hatten. Nur ihnen. Wir übrigen waren irgendwie weder von Bedeutung noch kompetent. Sie wußten es besser, und deshalb mußten die Lügen fortgesetzt und die Schatztruhen der ideologischen Reinheit gefüllt bleiben, um so die Unreinen mit Geld niederzumachen und sie schon in den Startlöchern des politischen Wettbewerbs zu stoppen.
Ich mußte Das Genessee-Komplott auch unter einem anderen Namen veröffentlichen, nicht aus Angst vor politischer Vergeltung, sondern weil man damals der Ansicht war, daß ein Schriftsteller innerhalb eines Jahres nicht mehr als ein Buch herausbringen durfte. Warum das so war? Verdammt will ich sein, wenn ich mir das zusammenreimen konnte – es hatte wohl mit >Marketingpsychologie< zu tun, was zum Teufel das auch sein mag. Doch all das liegt fast zwanzig Jahre zurück.
Plus ça change, plus c’est la même choses, sagen die Franzosen. Je mehr die Dinge sich verändern, desto mehr bleiben sie dieselben. Vielleicht wiederholt auch die Geschichte all ihre Narrheiten bis zum Erbrechen, weil der Mensch ein Geschöpf von ungezügeltem Appetit ist und immer wieder an die Gifttröge zurückkehrt, die ihn krank machen. Vielleicht werden auch die Sünden vergangener Generationen weitergetragen, weil die Kinder zu dumm sind, aus unseren schrecklichen Fehlern zu lernen. Wer weiß? Das einzige, was seit undenklichen Zeiten wahrhaft dokumentiert ist, ist, daß der Mensch fortfährt zu töten, ohne das Fleisch seines Opfers zu benötigen. Er lügt, um der Verantwortung zu entkommen, oder umgekehrt, um die Zügel der Verantwortung an einem Punkt zu ergreifen, wo es ihm alleine zusteht, den sozialen Kontrakt zwischen der Regierung und den Regierten zu schreiben; er strebt endlos danach, sich selbst auf Kosten des öffentlichen Wohls zu bereichern. Und während er damit beschäftigt ist, bemüht er sich nur allzuoft darum, seine persönliche Moralität oder Religion zur Legalität oder Religiosität aller anderen zu machen, ohne den Ungläubigen, die für ihn nur Parias sind, Gnade zu gewähren. Du großer Gott, so könnten wir immer weiterschreiben, nicht wahr?
Doch während ich diese Zeilen schreibe, hat unser Land gerade zwei der wohl widerwärtigsten, bedrückendsten, beleidigendsten und schändlichsten Präsidentenwahlkämpfe erlebt, an die sich irgendein lebender Bewunderer unseres Systems erinnern kann. Leute, die auf die zynischste Weise die niederen Ängste der Öffentlichkeit manipulierten, ›verpackten< die Kandidaten; schlagfertige Repliken wurden intelligenten Positionsdarstellungen vorgezogen, und das Image hatte den Vorrang vor der Sache. Die Debatten der Kandidaten waren weder Debatten noch eines zukünftigen Präsidenten würdig, sondern meist nur gezüchtete Pawlowsche Reaktionen, die mit den Fragen wenig oder gar nichts zu tun hatten. Und die Regeln für diese roboterhaften rituellen Tänze wurden von glattzüngigen intellektuellen Taugenichtsen aufgestellt, die eine so schlechte Meinung von ihren Klienten hatten, daß sie ihnen nicht erlaubten, länger als zwei Minuten zu sprechen! Die großen Redner jener Wiege unserer Zivilisation im antiken Athen hätten sich wahrscheinlich schon bei dem Gedanken an eine solche Beschneidung übergeben. Vielleicht werden wir eines Tages zu legitimen, zivilisierten Wahlkampagnen zurückkehren, wo man wieder einen offenen Gedankenaustausch pflegt. Aber ich fürchte, das wird so lange nicht der Fall sein, bis die Werbefritzen wieder zu ihren Deodorant-Kampagnen zurückkehren.
Im Wahlprozeß jedenfalls sind sie nicht mehr willkommen, weil sie die beiden Kardinalsünden ihres Berufs begangen haben – und die gleichzeitig. Sie haben es geschafft, ihre >Produkte< gleichzeitig widerwärtig und langweilig erscheinen zu lassen. Natürlich gibt es eine Lösung. Wäre ich einer der Kandidaten, würde ich es einfach ablehnen, ihre Rechnung zu bezahlen, und zwar wegen moralischer Verkommenheit. Zum Teufel, dieser Grund ist so gut wie jeder andere, und wer von diesen Imagemachern würde schon vor Gericht gehen und sich dagegen verteidigen können? Doch genug. Die Kampagne hat dem ganzen Land Ekel bereitet.
Und dieses widerliche Fiasko vollzog sich nicht einmal zwei Jahre, nachdem wir Bürger dieser Republik einer so albernen Folge von Ereignissen ausgesetzt waren, die überall Lachstürme ausgelöst hätten, wären sie nicht so scheußlich gewesen. Läßt man einmal die ganze Tölpelhaftigkeit beiseite, dann haben ernannte Beamte – nicht einmal gewählte! – die Flammen des Terrorismus geschürt, indem sie einem terroristischen Staat Waffen verkauften, während sie zur gleichen Zeit forderten, daß unsere Verbündeten ebendies nicht taten. Schuld wurde zu Unschuld; Amtsmißbrauch trug dem Amt Ehre ein; übereifrige, willfährige Darsteller wurden Helden, und als Zeichen tüchtiger Haushaltsführung sah man es an, im Keller Geschöpfe zu haben, die diesen schmutzig machten. Im Vergleich dazu war Alice’ Spiegelwelt ein Ort unwiderlegbarer Logik.
Es gibt immer jemanden, der versucht, es kaputtzumachen. Jenes große Experiment, jenes wunderbare System, das wir besitzen und das auf dem Prinzip des Kräftegleichgewichts beruht.
Verlogenheit? Machtmißbrauch? Korruption? Polizeistaat?
Nun, ganz sicher werden diese Auswüchse nicht von Dauer sein, solange die Bürger solche Spekulationen zum Ausdruck bringen und ihre Anklagen, und wären sie noch so extrem, hinausschreien können. Man kann uns hören; das ist unsere Stärke, und die ist unbezwingbar.
Und so will ich auf meine bescheidene Art versuchen, mir wieder mit jener Stimme aus einer anderen Zeit, einer anderen Epoche, Gehör zu verschaffen, stets eingedenk, daß ich im Grunde lediglich ein Geschichtenerzähler bin, welcher hofft, daß Sie Spaß an dem haben, was ich schreibe, aber ebenso hofft, daß Sie mir auch ein oder zwei Ideen gestatten.
Zu guter Letzt habe ich der Versuchung widerstanden, den Roman zu >aktualisieren< oder etwas an den Freiheiten zu verbessern, die ich mir mit den tatsächlichen Ereignissen oder der Geographie genommen habe, weil sie der Geschichte dienten, die ich damals schrieb. Jeder, der jemals ein Haus gebaut oder umgebaut hat, wird Ihnen sagen, daß Sie – fangen Sie erst einmal an, daran herumzubessern – ebensogut die Pläne gleich wegwerfen können. Es wird dann ein anderes Haus.
Danke für Ihre Zeit.
Robert Ludlum alias (für kurze Zeit) Jonathan Ryder November 1988
TEIL I
1.
Der glatte Teerbelag der Straße hörte plötzlich auf. An diesem Punkt auf der kleinen Halbinsel endete die Verantwortung der Gemeinde, und der Privatbesitz begann. Die Postbehörde von South Greenwich, Connecticut, führte die Zustellroute auf ihrer Karte als Shore Road, Northwest, aber die Zusteller, die mit ihren Fahrzeugen hierherkamen, kannten sie einfach als High Barnegat oder nur Barnegat.
High Barnegat.
Acht Acres Besitz am Ozean mit fast einer halben Meile, die direkt an den Sund grenzte. Zum größten Teil war das Anwesen wild bewachsen, unbeeinträchtigt, ungezähmt. Der Wohnkomplex wirkte im Vergleich dazu widersprüchlich – das Haus und der Grundstücksteil siebzig Meter vom Strand entfernt. Das lange, großzügig angelegte Gebäude war im zeitgenössischen Stil gehalten, mit großen holzgefaßten Glasflächen, die den Blick über das Wasser boten. Die Rasenflächen waren von tiefem Grün und dick, gleichsam manikürt, und von Plattenwegen und einer großen Terrasse direkt über dem Bootshaus unterbrochen.
Es war Ende August, in High Barnegat die beste Zeit im Sommer. Das Wasser war so warm wie es nur überhaupt werden konnte. Die Winde kamen in Böen vom Sund herein, was das Segeln noch interessanter machte – oder gefährlicher – je nachdem, wie man es betrachtete; das Blattwerk stand in vollstem Grün. Zu dieser Zeit trat ein Gefühl der Ruhe anstelle der hektischen Sommerwochen. Die Saison war fast vorbei.
Es war halb fünf Uhr nachmittags, und Phyllis Trevayne lehnte sich genüßlich in einem Liegestuhl auf der Terrasse zurück und ließ sich von der warmen Sonne bestrahlen. Sie dachte mit einigem Stolz, daß ihr der Badeanzug ihrer Tochter doch recht bequem paßte. Da sie zweiundvierzig und ihre Tochter siebzehn war, hätte die Befriedigung in einen kleinen Triumph umschlagen können, wenn sie sich gestattet hätte, länger darüber nachzudenken. Aber das konnte sie nicht, weil ihre Gedanken immer wieder zum Telefon zurückkehrten, zu dem Anruf aus New York für Andrew. Sie hatte das Gespräch auf der Terrasse entgegengenommen, da die Köchin mit den Kindern in der Stadt war und sich das kleine weiße Segel ihres Mannes noch immer weit draußen auf dem Wasser bewegte. Beinahe hätte sie das Telefon klingeln lassen, ohne abzuheben, aber nur sehr gute Freunde und sehr wichtige – ihr Mann zog das Wort ›notwendige< Geschäftsbekannte vor – besaßen die Nummer von High Barnegat.
»Hello, Mrs. Trevayne?« hatte die tiefe Stimme am anderen Ende der Leitung gefragt.
»Ja?«
»Hier Frank Baldwin. Wie geht es Ihnen, Phyllis?«
»Gut, sehr gut, Mr. Baldwin. Und Ihnen?« Phyllis Trevayne kannte Franklyn Baldwin schon seit einigen Jahren, konnte sich aber immer noch nicht dazu überwinden, den alten Herrn mit Vornamen anzusprechen. Baldwin war einer der letzten Angehörigen einer aussterbenden Gattung, einer der ursprünglichen Giganten des New Yorker Bankwesens.
»Mir würde es viel besser gehen, wenn ich wüßte, weshalb Ihr Mann meine Anrufe nicht erwidert hat. Geht es ihm gut? Nicht, daß ich so wichtig wäre, weiß Gott, aber er ist doch nicht krank, oder?«
»O nein. Überhaupt nicht. Er war jetzt seit einer Woche nicht mehr im Büro. Er hat überhaupt keine Anrufe entgegengenommen. Die Schuld liegt in Wirklichkeit bei mir; ich wollte, daß er sich etwas ausruht.«
»Meine Frau hat mich auch immer so gedeckt, junge Frau. Instinktiv. Die ist ständig in die Bresche gesprungen und fand auch stets die richtigen Worte.«
Phyllis Trevayne lachte freundlich und nahm das Kompliment zur Kenntnis. »Aber es ist wirklich wahr, Mr. Baldwin. Im Augenblick zum Beispiel weiß ich, daß er nicht arbeitet, weil ich das Segel seines Katamarans etwa eine Meile vor dem Ufer sehe.«
»Ein Kat! Du lieber Gott! Ich vergesse immer wieder, wie jung Sie sind! Zu meiner Zeit ist niemand in Ihrem Alter so verdammt reich geworden. Nicht aus eigener Kraft.«
»Wir haben eben Glück. Das vergessen wir nie.« Phyllis Trevayne sprach die Wahrheit.
»Es ist sehr schön, so etwas zu sagen, junge Frau.« Franklyn Baldwin sprach ebenfalls die Wahrheit und wollte, daß sie das wußte. »Nun, wenn Captain Ahab an Land kommt, dann bitten Sie ihn, mich anzurufen. Würden Sie das tun? Es ist wirklich äußerst dringend.«
»Das werde ich ganz sicher.«
»Dann leben Sie jetzt wohl, meine Liebe.«
»Wie dersehn, Mr. Baldwin.«
In Wirklichkeit hatte ihr Mann täglich im Büro angerufen. Er hatte Dutzende von Anrufen wesentlich weniger wichtiger Leute als Franklyn Baldwin erwidert. Außerdem mochte Andrew Baldwin; das hatte er mehrere Male gesagt. Er war häufig zu Baldwin gegangen, um seinen Rat in der komplizierten Welt der internationalen Finanzen einzuholen.
Ihr Mann verdankte dem Bankier viel, und jetzt brauchte ihn der alte Herr. Warum hatte Andrew nicht zurückgerufen? Das paßte einfach nicht zu ihm.
Das Restaurant an der Achtunddreißigsten Straße zwischen der Park – und der Madison Avenue war klein und faßte höchstens vierzig Leute. Seine Klientel gehörte im allgemeinen den Rängen der Leitenden Angestellten an, die sich den mittleren Jahren näherten und plötzlich über mehr Geld verfügten, als sie je zuvor verdient hatten, und von dem Wunsch, vielleicht sogar dem Bedürnis, erfüllt waren, sich ihr junges Aussehen zu erhalten. Die Küche war nur mittelmäßig, die Preise hoch und die Getränke teuer. Aber die Bar war geräumig, und die Vertäfelung reflektierte die weiche indirekte Beleuchtung. Dadurch kam eine Atmosphäre auf, wie in den Lokalen, an die die Gäste sich aus ihrer Collegezeit in den fünfziger Jahren so angenehm erinnerten.
Und genau mit der Absicht war die Dekoration entworfen worden.
Wenn man dies bedachte, und das tat er stets, so überraschte es den Geschäftsführer ein wenig, einen kleinen, gut gekleideten Mann Anfang der Sechzig zögernd durch die Türe hereinkommen zu sehen. Der Gast sah sich um und paßte seine Augen dem schwachen Licht an. Der Geschäftsführer ging auf ihn zu.
»Einen Tisch?«
»Nein... ja, ich treffe mich mit jemandem... nein, lassen Sie nur, vielen Dank. Wir haben einen.«
Der gut gekleidete Mann hatte die Person, die er suchte, an einem Tisch ganz hinten entdeckt. Er ließ den Geschäftsführer stehen und schob sich ein wenig ungeschickt an den überfüllten Stühlen vorbei.
Der Geschäftsführer erinnerte sich an den Gast an dem hinteren Tisch. Er hatte darauf bestanden, gerade diesen zu bekommen.
Der ältere Herr setzte sich. »Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir uns nicht gerade in einem Restaurant getroffen hätten.«
»Keine Sorge, Mr. Allen. Niemand, den Sie kennen, kommt hierher.«
»Hoffentlich haben Sie recht.«
Ein Kellner trat an ihren Tisch, und sie bestellten ihre Drinks.
»Ich bin gar nicht so sicher, daß Sie sich Gedanken machen sollten«, sagte der jüngere Mann. »Ich finde, ich bin derjenige, der das Risiko eingeht.«
»Man wird sich um Sie kümmern; das wissen Sie. Wir wollen keine Zeit vergeuden. Wie stehen die Dinge?«
»Die Kommission hat einstimmig Andrew Trevayne gebilligt. «
»Er wird ablehnen.«
»Man ist allgemein anderer Meinung. Baldwin soll das Angebot überbringen; vielleicht hat er es sogar schon getan. «
»Wenn er das hat, dann haben Sie sich verspätet.« Der alte Mann kniff die Augen zusammen und starrte die Tischdecke an. »Wir haben die Gerüchte gehört; wir nahmen an, es handle sich um bewußte Vernebelungstaktik. Wir haben uns auf Sie verlassen.« Er blickte zu Webster auf. »Wir waren davon ausgegangen, daß Sie die Identität bestätigen würden, ehe irgendwelche endgültigen Schritte unternommen werden.«
»Ich hatte keine Kontrolle darüber; niemand im Weißen Haus hatte das. Diese Kommission ist uns nicht zugänglich. Ich kann von Glück reden, daß ich den Namen überhaupt herausbekommen habe.«
»Davon reden wir noch. Warum glauben die, daß Trevayne annehmen wird? Weshalb sollte er? Seine Danforth Stiftung ist genauso groß wie Ford oder Rockefeller. Weshalb sollte er das aufgeben?« fragte Allen.
»Das wird er wahrscheinlich nicht. Vermutlich nimmt er nur Urlaub.«
»Keine Stiftung, die so groß ist wie Danforth, würde einen so langen Urlaub akzeptieren. Besonders nicht in einer solchen Stellung. Die sind alle in Schwierigkeiten.«
»Ich kann Ihnen nicht folgen ...«
»Glauben Sie, daß die immun sind?« fragte Allen, ohne den anderen ausreden zu lassen. »Die brauchen Freunde in Ihrer Stadt, nicht Feinde ... Wie läuft es denn weiter? Wenn Baldwin tatsächlich das Angebot macht? Wenn Trevayne akzeptiert?«
Der Kellner kam mit den Drinks zurück, und die beiden Männer verstummten. Er ging, und Webster gab Antwort.
»Die Bedingungen lauten so, daß der Betreffende, den die Kommission auswählt, die Billigung des Präsidenten erhält und sich einer nichtöffentlichen Anhörung eines paritätisch aus beiden Parteien besetzten Senatsausschusses stellen muß.«
»Schon gut, schon gut.« Allen hob sein Glas und nahm einen langen Schluck. »Das gibt noch viel Arbeit; da können wir etwas tun. Wir werden ihn in dem Hearing disqualifizieren. «
Der Jüngere sah ihn verblüfft an. »Warum? Wozu denn? Jemand wird ja doch den Vorsitz in diesem Unterausschuß übernehmen. Soviel ich höre, ist dieser Trevayne zumindest ein vernünftiger Mann.«
»Soviel Sie hören!« Allen leerte schnell sein Glas. »Was haben Sie denn gehört? Was wissen Sie über Trevayne?«
»Was ich gelesen habe. Ich habe meine Recherchen angestellt. Er und sein Schwager – der Bruder ist Elektronikingenieur – haben Mitte der fünfziger Jahre eine kleine Firma in New Haven gegründet, die sich mit Entwicklungs – und Fabrikationsaufgaben für die Raumfahrtindustrie beschäftigte. Sieben oder acht Jahre später zogen sie das große Los. Sie waren beide Millionäre, als sie fünfunddreißig waren. Der Schwager machte die Konstruktionen, während Trevayne die Produkte verkaufte. Er hat sich die Hälfte der frühen Nasa-Verträge an Land gezogen und Tochtergesellschaften an der ganzen Atlantikküste aufgebaut. Trevayne stieg aus, als er siebenunddreißig war, und übernahm einen Posten im State Department. Übrigens, er hat dort verdammt gute Arbeit geleistet.« Webster hob sein Glas und sah Allen über den Rand an. Der junge Mann erwartete ein Kompliment für sein Wissen.
Statt dessen tat Allen seine Worte ab: »Scheiße. Material aus der Time. Einzig wichtig ist, daß Trevayne ein Original darstellt ... er ist völlig unkooperativ. Das wissen wir; wir haben schon vor Jahren versucht, an ihn heranzukommen.«
»Oh?« Webster stellte sein Glas weg. »Ich wußte nicht ... Herrgott. Dann weiß er Bescheid?«
»Nicht viel; aber es reicht vielleicht. Wir sind nicht sicher. Aber Sie verstehen immer noch nicht, Mr. Webster. Mir scheint, Sie haben von Anfang an nicht richtig verstanden. . . Wir wollen nicht, daß er den Vorsitz in diesem verdammten Unterausschuß übernimmt. Wir wollen ihn nicht und auch sonst niemanden wie ihn. Diese Art von Wahl ist undenkbar.«
»Was können Sie denn dagegen tun?«
»Ihn hinausdrängen ... wenn er tatsächlich angenommen hat. Das läßt sich hoffentlich bei dem Senatshearing machen. Wir werden uns verdammte Mühe geben, daß er abgelehnt wird.«
»Und wenn Sie das schaffen, was dann?«
»Dann nominieren wir unseren eigenen Mann. Was von Anfang an hätte geschehen sollen.« Allen winkte dem Kellner und deutete auf die beiden Gläser.
»Mr. Allen, warum haben Sie ihn nicht aufgehalten? Wenn Sie dazu imstande waren, warum haben Sie es dann nicht getan? Sie sagten, Sie hätten die Gerüchte über Trevayne gehört; das war die Zeit, sich einzuschalten.«
Allen wich Websters Blick aus. Er trank das Eiswasser, das noch in seinem Glas war, und als er sprach, klang seine Stimme wie die eines Mannes, der sich große Mühe gibt, seine Autorität zu wahren, dies aber immer weniger schafft. »Wegen Frank Baldwin, das ist der Grund. Frank Baldwin und dieser senile Hundesohn Hill.«
»Der Botschafter?«
»Der verdammte Botschafter mit seiner verdammten Gesandtschaft im Weißen Haus ... Big Billy Hill! Baldwin und Hill; das sind die zwei Oldtimer, die hinter diesem Bockmist stehen. Bill kreist die letzten zwei oder drei Jahe schon wie ein Falke. Er hat dafür gesorgt, daß Baldwin in die Verteidigungskommission kam. Und die beiden haben sich Trevayne herausgepickt ... Baldwin hat seinen Namen vorgeschlagen; wer zum Teufel könnte da etwas dagegen sagen? Aber Sie hätten uns mitteilen müssen, daß das endgültig war. Wenn wir sicher gewesen wären, hätten wir es verhindern können.«
Webster beobachtete Allen scharf. Als er antwortete, klang eine neue Härte in seinen Worten. »Und ich glaube, daß Sie lügen. Irgend ein anderer hat das verpatzt. Sie oder einer von den sogenannten Spezialisten. Zuerst dachten Sie, daß diese ganze Ermittlung von Anfang an auffliegen würde, im Ausschuß von jemandem gekillt werden würde. Aber Sie hatten unrecht. Und dann war es zu spät. Trevayne trat an die Oberfläche, und Sie konnten es nicht verhindern. Sie sind nicht einmal sicher, daß Sie ihn jetzt aufhalten können. Deshalb wollten Sie mich sprechen ... Also sparen wir uns doch besser diesen Unsinn, daß ich zu spät daran wäre und die Dinge nicht richtig sehe, ja?«
»Passen Sie auf, was Sie sagen, junger Mann. Vielleicht erinnern Sie sich, wen ich vertrete.« Diese Feststellung fiel, ohne besonders überzeugend zu wirken.
»Und Sie erinnern sich bitte, daß Sie mit einem Mann sprechen, der persönlich vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt wurde. Vielleicht paßt Ihnen das nicht, aber das ist der Grund, warum Sie zu mir gekommen sind. Also, wie steht es? Was wollen Sie?«
Allen atmete langsam aus, als wolle er damit seinen Zorn loswerden. »Einige von uns machen sich mehr Sorgen als andere ...«
»Und Sie sind einer davon«, warf Webster ruhig ein.
»Ja ... Trevayne ist ein komplizierter Mann. Teils jugendliches Genie der Industrie – was bedeutet, daß er seine Verbindungen hat. Teils Skeptiker – er ist mit bestimmten Realitäten nicht einverstanden.«
»Mir scheint, daß das sehr positive Eigenschaften sind, die gut zueinander passen.«
»Nur wenn man von einer Position der Stärke aus handelt. «
»Kommen Sie zur Sache. Worin liegt Trevaynes Stärke?«
»Wir wollen sagen, daß er nie Unterstützung braucht.«
»Wir wollen sagen, daß er sie abgelehnt hat.«
»Schon gut, schon gut. So kann man es auch sehen.«
»Sie sagten, Sie hätten versucht, mit ihm Verbindung aufzunehmen. «
»Ja, als ich bei ... lassen wir das. Es war Anfang der sechziger Jahre. Wir befanden uns damals in einer Konsolidierungsphase und dachten, er könnte ein nützliches Glied in unserer ... Gemeinschaft sein. Wir haben uns sogar erboten, die Nasa-Verträge zu garantieren.«
»Du großer Gott! Und er hat abgelehnt.« Webster gab damit eine Erklärung ab, stellte keine Frage.
»Eine Weile hat er uns hingehalten. Dann ist ihm klargeworden, daß er die Verträge auch ohne uns bekommen konnte. Und sobald er das wußte, sagte er uns, wir sollten uns gefälligst zum Teufel scheren. Tatsächlich ist er sogar noch viel weiter gegangen. Er hat mir erklärt, ich solle meine Leute dazu bringen, aus dem Weltraumprogramm auszusteigen, sich nicht mehr um Regierungsgelder zu bemühen. Er drohte damit, zur Staatsanwaltschaft zu gehen.«
Bobby Webster griff geistesabwesend nach seiner Gabel und stocherte damit auf dem Tischtuch herum. »Und wenn es nun umgekehrt gewesen wäre? Wenn er Sie tatsächlich gebraucht hätte? Hätte er sich dann Ihrer >Gemeinschaft< angeschlossen? «
»Genau das wissen wir nicht. Einige von den anderen glauben ja, aber sie haben nicht mit ihm gesprochen; das habe nur ich getan. Ich war der Mittelsmann. Ich war der einzige, den er wirklich hatte ... Ich habe nie Namen benutzt, nie gesagt, wer meine Leute waren.«
»Aber Sie glauben, daß die bloße Tatsache, daß es sie gab, ausgereicht hat? Für ihn.«
»Auf die Frage gibt es keine Antwort. Er hat uns bedroht, nachdem er hatte, was er wollte; er war sicher, daß er niemanden brauchen würde, nur sich, seinen Schwager und seine verdammte Firma in New Haven. Wir können es uns einfach nicht leisten, dieses Risiko jetzt einzugehen. Wir dürfen nicht zulassen, daß er den Vorsitz in diesem Unterausschuß übernimmt. Niemand weiß, wozu er fähig ist.«
»Und was soll ich tun?«
»Sie sollen jedes vertretbare Risiko eingehen, um an Trevayne heranzukommen. Optimal wäre, wenn Sie sein Verbindungsmann im Weißen Haus werden könnten. Ist das möglich?«
Bobby Webster überlegte und antwortete dann mit Entschiedenheit. »Ja. Der Präsident hat mich in die Sitzung geholt, die sich mit dem Unterausschuß befaßte. Das war eine vertraulich klassifizierte Zusammenkunft; ohne Protokoll, ohne Notizen. Außer mir war nur noch ein weiterer Assistent zugegen; keine Konferenz. Das läßt sich machen.«
»Sie müssen verstehen; vielleicht ist es gar nicht nötig. Man wird gewisse Präventivmaßnahmen treffen. Wenn die greifen, dann ist Trevayne weg vom Fenster.«
»Da kann ich Ihnen helfen.«
»Wie?«
»Mario de Spadante.«
»Nein! Unter keinen Umständen! Wir haben Ihnen schon einmal gesagt, daß wir mit ihm nichts zu tun haben wollen.«
»Er hat Ihnen und Ihren Leuten schon oft geholfen. Mehr als Ihnen vielleicht klar ist. Oder als Sie zugeben wollen.«
»Er kommt nicht in Frage.«
»Es wäre kein Schaden, gewisse freundschaftliche Beziehungen zu ihm aufzubauen. Wenn Sie das stört, dann denken Sie an den Senat.«
Die Runzeln auf Allens Stirn glätteten sich. Der Blick, mit dem er jetzt den anderen ansah, wirkte fast billigend. »Ich glaube, ich verstehe.«
»Das wird natürlich meinen Preis gehörig nach oben treiben. «
»Ich dachte, Sie glauben an das, was Sie tun.«
»Ich glaube daran, daß ich meine Flanken schützen muß. Der beste Schutz besteht darin, daß ich Sie zahlen lasse.«
»Sie sind widerwärtig.«
»Und sehr talentiert.«
2.
Andrew Trevayne ließ den Doppelrumpf des Katamaran vor dem Wind laufen und nutzte so die schnelle Strömung zum Ufer. Er streckte seine langen Beine und griff nach der Ruderpinne, um eine zusätzliche Heckwelle zu erzeugen. Ohne jeden Grund, es war nur eine Bewegung, eine bedeutungslose Geste. Das Wasser war warm; seine Hand fühlte sich an, als würde sie durch einen klebrigen, lauwarmen Film gezogen.
Ebenso wie er – unaufhaltsam – in ein Rätsel hineingezogen wurde, an dem er keinen Anteil wollte. Und doch würde die letzte Entscheidung bei ihm liegen, und er wußte, wie sie lauten würde.
Das war es, was ihn an dem Ganzen am meisten irritierte; er begriff die Furien, die ihn zogen, und ärgerte sich über sich selbst, daß er auch nur in Betracht zog, sich ihnen zu unterwerfen. Er hatte sie schon lange hinter sich zurückgelassen.
Vor langer Zeit.
Das Boot war noch hundert Meter vom Ufer von Connecticut entfernt, als der Wind plötzlich umschlug – so wie der Wind das häufig tut, wenn er vom offenen Meer hereinweht und auf festen Boden trifft. Trevayne schwang die Beine über den Steuerbordrumpf und straffte das Hauptsegel, worauf das kleine Boot einen Bogen beschrieb und nach rechts schwenkte, auf das Dock zu.
Trevayne war ein großer Mann. Nicht unförmig, einfach größer und breiter als die meisten Männer, mit der Art von lockerer Körperbeherrschung, die auf eine viel aktivere Jugend hindeutete, als sie je in seinen Gesprächen zum Ausdruck kam. Er erinnerte sich an einen Artikel in Newsweek, der sich mit seinen früheren Errungenschaften auf dem Sportplatz befaßt hatte. Er war voll von Übertreibungen gewesen, wie das in solchen Artikeln stets der Fall war. Er war gut gewesen, aber nicht so gut. Er hatte immer das Gefühl gehabt, daß er besser aussah als er war, oder daß zumindest die Mühe, die er sich gab, seine Schwächen überdeckte.
Aber er wußte, daß er ein guter Segler war. Vielleicht sogar etwas mehr als gut.
Der Rest war für ihn ohne Bedeutung. Das war er immer gewesen. Nur in dem Augenblick nicht, in dem er im Wettbewerb gestanden hatte.
Und jetzt würde ihm ein unerträglicher Wettbewerb bevorstehen. Wenn ei die Entscheidung traf. Die Art von Wettbewerb, in dem es keine Gnade gab, in dem Strategien eingesetzt wurden, die in keinem Regelverzeichnis enthalten waren. Er verstand sich auch auf diese Strategien, aber nicht, weil er schon Teil an ihnen gehabt hatte; das war wichtig, ungemein wichtig für ihn.
Man mußte sie verstehen, imstande sein, gegen sie zu manövrieren, sich am Rande mit ihnen zu befassen, aber nie Teil an ihnen zu haben. Vielmehr galt es, das Wissen einzusetzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Es gnadenlos einzusetzen, unbarmherzig.
Andrew hatte einen kleinen Schreibblock und einen Stift an Deck neben der Ruderpinne befestigt, um sich, wie er immer sagte, Zeiten zu notieren, Bojen, Windgeschwindigkeiten – alles mögliche. Tatsächlich dienten sie nur dazu, um flüchtige Gedanken aufzuschreiben, Ideen, Notizen, die er sich machte.
Manchmal Dinge ... nun eben >Dinge<, die ihm klarer vorkamen, wenn er auf dem Wasser war.
Deshalb war er jetzt verstimmt, als er auf den Block sah. Er hatte ein Wort hingeschrieben. Es aufgeschrieben, ohne sich dessen bewußt zu werden.
Boston.
Er riß das Blatt ab, zerknüllte es mit mehr Kraft als notwendig und warf es ins Wasser.
Verdammt! Verdammt! dachte er. Nein!
Der Katamaran glitt an den Pier, und er beugte sich hinaus und hielt sich mit der rechten Hand am Dock fest. Mit der linken zog er am Schot, und das Segel flatterte. In weniger als vier Minuten hatte er das Ruder abmontiert, seine Jacke verstaut, die Segel vertäut und das Boot an den vier Ecken gesichert.
Er ging zu dem Plattenweg neben dem Bootshaus und dann den steilen Hang zur Terrasse hinauf. Dieser Weg war für ihn so etwas wie ein Barometer für seinen körperlichen Zustand. Wenn er die Hälfte zurückgelegt hatte und kurzatmig war oder seine Beine schmerzten, führte das gewöhnlich zu dem Gelöbnis, weniger zu essen oder mehr Sport zu treiben. Diesmal stellte er befriedigt fest, daß seine Kondition offenbar recht gut war. Aber vielleicht waren seine Gedanken auch zu abgelenkt, um den Streß überhaupt zu registrieren.
Nein, er fühlte sich recht gut, dachte er. Die Woche, die er nicht im Büro gewesen war, die dauernde Salzluft, die aktive Betätigung am Ende der Sommermonate; er fühlte sich ausgezeichnet.
Und dann fiel ihm wieder der Block ein und das unbewußt – unterbewußt – hingeschriebene Wort. Boston.
Jetzt fühlte er sich gar nicht mehr gut.
Er brachte die letzten Stufen hinter sich, erreichte die Terrasse und erblickte seine Frau, die in einem Liegestuhl lag, die Augen offen, aufs Wasser hinaus starrte, nichts sah, was er sehen würde.
Er hatte immer ein Gefühl von leichtem Schmerz, wenn er sie so antraf. Den Schmerz trauriger, qualvoller Erinnerungen.
Wegen Boston, verdammt.
Er bemerkte jetzt, daß seine weichen Sohlen den Klang seiner Schritte gedämpft hatten; er wollte sie nicht erschrekken.
»Hallo«, sagte er mit sanfter Stimme.
»Oh?« Phyllis blinzelte. »War’s schön, Darling?«
»Schön. Gut geschlafen?« Trevayne trat neben sie und gab ihr einen leichten Kuß auf die Stirn.
»Ja, schon, so lange es ging. Aber man hat mich geweckt. «
»Oh? Ich dachte, die Kinder hätten Lillian in die Stadt gefahren? «
»Das waren nicht die Kinder. Und Lillian auch nicht.«
»Das klingt geheimnisvoll.« Trevayne griff in eine große rechteckige Kühlbox, die auf dem Tisch stand, und holte eine Dose Bier heraus.
»Nicht geheimnisvoll. Aber ich bin neugierig.«
»Wovon redest du?« Er riß den Verschluß der Dose auf und trank.
»Franklyn Baldwin hat angerufen ... Warum hast du nicht zurückgerufen?«
Trevayne hielt die Bierdose an den Lippen und sah seine Frau an.
»Habe ich diesen Badeanzug nicht schon an jemand anderem gesehen?«
»Ja, und vielen Dank für das Kompliment – ob es nun beabsichtigt war oder nicht –, aber ich würde trotzdem gerne wissen, warum du ihn nicht angerufen hast.«
»Ich versuche ihm aus dem Weg zu gehen.«
»Ich dachte, du magst ihn.«
»Tue ich auch. Sehr. Ein Grund mehr, ihm aus dem Weg zu gehen. Er wird mich um etwas bitten, und ich werde ablehnen. Zumindest glaube ich, daß er mich bitten wird, und ich will ablehnen.«
»Was denn?«
Trevayne ging geistesabwesend an die Steinmauer, die die Terrasse umgab, und stellte die Bierdose darauf. »Baldwin möchte mich für etwas gewinnen, so geht das Gerücht; ich glaube, man nennt das einen ›Versuchsballon‹. Er leitet diese Kommission, die sich mit den Verteidigungsausgaben befaßt. Sie sind gerade dabei, einen Unterausschuß zu gründen, um, wie das höflich formuliert wird, eine >gründliche Studie< der Beziehungen zum Pentagon anzustellen.«
»Was bedeutet das?«
»Vier oder fünf Firmen – in Wirklichkeit sind es Konglomerate – bestreiten gute siebzig Prozent des Verteidigungsetats. Auf die eine oder andere Art. Es gibt keine wirksame Kontrolle mehr. Dieser Unterausschuß soll Ermittlungen für die Verteidigungskommission führen. Sie suchen einen Vorsitzenden.«
»Und der bist du?«
»Der will ich nicht sein. Ich bin da zufrieden, wo ich bin. Was ich jetzt tue, ist etwas Positives; der Vorsitz in diesem Ausschuß wäre das Negativste, das ich mir vorstellen kann. Wer auch immer diesen Job übernimmt, wird zum Paria der ganzen Nation ... wenn er auch nur die Hälfte von dem tut, was man von ihm erwartet.«
»Warum?«
»Weil das Pentagon sich in einem scheußlichen Zustand befindet. Das ist kein Geheimnis; du brauchst bloß die Zeitungen zu lesen. Jeden Tag. Man versteckt das nicht einmal mehr.«
»Warum wird man dann zum Paria, wenn man versucht, da Ordnung hineinzubringen? Wenn du gesagt hättest, daß du dir damit Feinde machst, würde ich es verstehen, aber nicht, daß du zum Paria wirst.«
Trevayne lachte leise, als er mit seinem Bier zu einem Stuhl neben seiner Frau ging und sich setzte. »Ich liebe dich wegen deines einfachen New England Gemüts und wegen des Badeanzugs.«
»Du gehst zuviel auf und ab. Deine Denkfüße machen Überstunden, Darling.«
»Nein, das tun sie nicht; ich bin nicht interessiert.«
»Dann beantworte meine Frage. Warum ein Paria?«
»Weil dieser scheußliche Zustand zu tief verwurzelt ist und zu weit verbreitet. Um überhaupt eine Wirkung zu erzielen, muß dieser Unterausschuß eine Menge Leute anprangern. Im Wesen muß er die Furcht zu seiner Waffe machen. Wenn man anfängt, von Monopolen zu sprechen, dann spricht man nicht nur von einflußreichen Männern, die mit Aktienpaketen jonglieren. Man bedroht Tausende und Abertausende von Arbeitsplätzen. Am Ende ist es immer das, worauf Monopole beruhen, von ganz oben bis ganz unten. Man tauscht die eine Verantwortung gegen die andere. Mag sein, daß es notwendig ist, aber man fügt damit vielen Schmerz zu. Viel Schmerz.«
»Mein Gott«, sagte Phyllis und setzte sich auf. »Du hast viel nachgedacht.«
»Gedacht ja, aber nicht getan.«
Andrew federte aus dem Stuhl, ging an den Tisch und drückte seine Zigarette aus. »Offen gesagt, mich hat es überrascht, daß die ganze Idee überhaupt soweit kam. Diese Dinge – Studien, Ermittlungen, du kannst sie nennen, wie du willst – werden gewöhnlich lautstark vorgeschlagen und in aller Stille abgewürgt. In der Garderobe des Senats oder im Speisesaal des Repräsentantenhauses. Diesmal ist es anders. Ich würde gerne wissen, weshalb.«
»Dann frag doch Frank Baldwin.«
»Das werde ich lieber nicht tun.«
»Das solltest du aber, das bist du ihm schuldig, Andy. Weshalb glaubst du, daß er dich ausgewählt hat?«
Trevayne ging wieder an die Mauer und blickte über den Long Island Sund hinaus. »Ich bin qualifiziert; das weiß Frank. Ich habe mit diesen Vertragsleuten gesprochen; ich habe mich in Zeitungsartikeln kritisch über die Kostenüberschreitungen geäußert, die Verträge, die das zulassen. Auch das weiß er. Ich bin sogar zornig gewesen, aber das reicht weit zurück ... Hauptsächlich, glaube ich, weil er weiß, wie sehr ich diese Art von Manipulation verachte. Und die Leute, die dahinterstehen. Die haben viele gute Männer ruiniert, ganz besonders einen. Erinnerst du dich?« Trevayne drehte sich um und sah seine Frau an. »Jetzt können die nicht an mich heran. Ich habe nichts zu verlieren, nur Zeit.«
»Ich glaube, damit hast du dich selbst so gut wie überzeugt. «
Trevayne zündete eine weitere Zigarette an und lehnte sich an die Mauer, die Arme vor der Brust verschränkt. Er starrte noch immer Phyllis an. »Ich weiß. Und das ist der Grund, weshalb ich Frank Baldwin aus dem Wege gehe.« Trevayne schob sein Omelette auf dem Teller herum, er hatte keinen Appetit. Franklyn Baldwin saß ihm im Kasino der Bank gegenüber. Der alte Herr redete eindringlich auf ihn ein.
»Diese Arbeit wird getan werden, Andrew, und das wissen Sie. Nichts wird das verhindern. Ich möchte nur, daß der beste Mann sie tut. Und ich glaube, dieser beste Mann sind Sie. Vielleicht sollte ich hinzufügen, daß die Kommission sich einstimmig entschieden hat.«
»Was macht Sie denn so sicher, daß die Arbeit getan werden wird? Ich bin da gar nicht so überzeugt. Der Senat ereifert sich immer über Einsparungen. Das ist populär und wird so bleiben. Das heißt, so lange, bis ein Straßenbauprojekt oder ein Flugzeugwerk in irgendeinem Distrikt gestrichen werden. Dann hört das Geschrei plötzlich auf.«
»Diesmal nicht. Mit zynischen Bemerkungen ist es in dem Fall nicht getan. Sonst hätte ich mich nie darauf eingelassen. «
»Sie äußern da Ihre Meinung. Da muß noch etwas sein, Frank.«
Baldwin nahm seine stahlgeränderte Brille ab und legte sie neben seinen Teller. Er blinzelte ein paarmal und massierte sich den Ansatz seiner Patriziernase. Dann lächelte er schwach, es wirkte beinahe traurig. »Ja. Sie sind sehr aufmerksam. . . Nennen Sie es das Vermächtnis von zwei alten Männern, deren Leben – und das gilt auch für ihre Familien, über einige Generationen – in diesem unserem Lande auf höchst angenehme Weise produktiv war. Ich möchte sagen, daß wir unseren Beitrag geleistet haben, aber dafür auch mehr als reichlich belohnt worden sind. Besser kann ich es nicht formulieren.«
»Ich fürchte, ich verstehe nicht.«
»Natürlich nicht. Ich will das auch klarer ausdrücken. William Hill und ich kennen einander seit unserer Kindheit. «
»Botschafter Hill?«
»Ja ... Ich will Sie nicht mit den Exzentritäten unserer Beziehung langweilen – nicht heute. Ich will jetzt nur sagen, daß wir wahrscheinlich nicht mehr zu viele Jahre bleiben können. Ich bin auch gar nicht sicher, daß ich das möchte... Diese Verteidigungskommission, der Unterausschuß – das ist unsere Idee. Wir wollen erreichen, daß daraus funktionierende Realität wird. Soviel können wir garantieren; wir sind jeder auf seine Art mächtig genug, um das zu bewirken. Und um diesen schrecklichen Begriff zu benutzen, auch hinreichend >respektabel<.«
»Und was glauben Sie, daß Sie damit erreichen werden?«
»Die Wahrheit. Das Maß an Wahrheit, an das wir glauben. Dieses Land hat ein Recht darauf, das zu wissen, ganz gleich, wie weh es auch tun mag. Um eine Krankheit zu kurieren, bedarf es einer korrekten Diagnose. Vordergründige Behauptungen, Etiketten, wie sie von selbstgerechten Eiferern verteilt werden, bösartige Anklagen von Unzufriedenen. . . die helfen nicht weiter. Die Wahrheit, Andrew. Lediglich die Wahrheit. Das wird unser Geschenk sein, das von Billy und mir. Vielleicht unser letztes.«
Trevayne hatte das Bedürfnis, sich zu bewegen, sich physisch abzureagieren. Der alte Herr, der ihm gegenübersaß, war im Begriff, genau das zu erreichen, was er sich vorgenommen hatte. Die Wände begannen ihn einzuschließen, und der Weg, den er zu gehen hatte, wurde immer schmaler.
»Warum soll dieser Unterausschuß das schaffen, was Sie sagen? Das haben schon andere versucht; es ist ihnen nicht gelungen.«
»Weil er durch Sie gleichzeitig unpolitisch und in keiner Weise ein Selbstzweck sein wird.« Baldwin setzte seine Brille wieder auf; seine plötzlich größer gewordenen alten Augen hypnotisierten Trevayne. »Und das sind die notwendigen Faktoren. Sie sind weder Republikaner noch Demokrat, weder ein Liberaler noch ein Konservativer. Beide Parteien haben versucht, Sie in ihren Einfluß zu bekommen, und Sie haben beide abgelehnt. In dieser Zeit der festen Definitionen sind Sie ein Widerspruch. Sie haben nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Man wird Ihnen glauben. Das ist das Wichtige ... Wir sind ein polarisiertes Land geworden, festgelegt auf intransigente, in Konflikt stehende Positionen. Es ist dringend nötig, daß wir wieder an objektive Wahrheit glauben.«
»Wenn ich akzeptiere, wird sich das Pentagon und alle, die mit ihm in Verbindung stehen, an die Politiker wenden – oder an ihre Public Relations Leute. Das tun die doch immer. Wie werden Sie das verhindern?«
»Der Präsident. Er hat uns Zusicherungen gegeben; er ist ein guter Mann, Andrew.«
»Und ich bin niemandem verantwortlich?«
»Nicht einmal mir. Nur sich selbst.«
»Ich kann meine eigenen Leute anstellen; keine Personalentscheidungen von außen?«
»Geben Sie mir eine Liste der Leute, die Sie wollen. Ich werde dafür sorgen, daß sie freigegeben wird.«
»Ich tue, was ich für richtig halte. Ich bekomme die Unterstützung, die ich für notwendig erachte.« Das waren keine Fragen, die Trevayne aussprach; er traf Feststellungen, die nichtsdestoweniger Antworten vorwegnahmen.
»Vollkommen. Das garantiere ich. Das kann ich Ihnen versprechen.«
»Ich will den Job nicht.«
»Aber Sie werden ihn annehmen.« Wieder eine Feststellung, diesmal von Franklyn Baldwin.
»Ich habe schon zu Phyllis gesagt, Sie sind sehr überzeugend, Frank. Deshalb bin ich Ihnen aus dem Weg gegangen.«
»Kein Mann kann dem aus dem Wege gehen, was ihm bestimmt ist. In dem Augenblick, in dem es ihm bestimmt ist. Wissen Sie, woher ich das habe?«
»Klingt hebräisch.«
»Nein ... Aber weit weg sind Sie nicht. Mark Aurel. Kennen Sie Bankiers, die Mark Aurel gelesen haben?«
»Hunderte. Die glauben, das sei ein Aktienfonds.«
3.
Steven Trevayne starrte die ausdruckslosen Kleiderpuppen mit ihren Tweedjacken und den grauen Flanellhosen in unterschiedlichen Farbtönen an. Die gedämpfte Beleuchtung des College Shoppe entsprach dem gemessen wohlhabenden Image, das die Bewohner von Greenwich, Connecticut, suchten. Steven warf einen Blick auf seine eigenen Jeans, die schmutzigen Slipper und stellte dabei fest, daß einer der Knöpfe an seiner alten Cordjacke im Begriff war abzureißen.
Er sah auf die Uhr und ärgerte sich. Fast neun. Er hatte seiner Schwester versprochen, daß er sie und ihre Freundin nach Barnegat bringen würde, aber er hatte auch festgelegt, daß sie sich bis halb neun mit ihm treffen sollten. Er mußte das Mädchen, mit dem er verabredet war, um Viertel nach neun in Cos Cob abholen. Er würde sich verspäten.
Wenn sich nur seine Schwester nicht ausgerechnet diesen Abend für eine Mädchenparty ausgesucht hätte, oder zumindest nicht allen versprochen hätte, daß sie sie nach Hause bringen würden. Seine Schwester durfte nachts nicht fahren – eine Festlegung, die Steven Trevayne für lächerlich hielt; sie war schließlich siebzehn – und so fiel die Wahl bei solchen Anlässen immer auf ihn.
Wenn er ablehnte, konnte sein Vater auf die Idee kommen, daß alle ihre Wagen gebraucht wurden, und dann würde er ohne fahrbaren Untersatz sein.
Er war fast neunzehn. In drei Wochen ging es aufs College. Ohne Wagen. Sein Vater hatte gesagt, daß er in den ersten zwei Semestern keinen Wagen brauchte.
Steven wollte gerade über die Straße in den Drugstore gehen, und sein Mädchen anrufen, als vor ihm ein Polizeiwagen hielt.
»Sind Sie Steven Trevayne?« fragte der Polizist am Fenster.
»Ja, Sir.« Der junge Mann war unsicher; der Polizist sprach mit barscher Stimme.
«Einsteigen. «
»Warum? Was ist denn? Ich stehe doch bloß da ...«
»Haben Sie eine Schwester, die Pamela heißt?«
»Ja. Ja, die habe ich. Ich warte auf sie.«
»Die kommt nicht hierher. Das können Sie mir glauben. Steigen Sie ein.«
»Was ist denn?«
»Hören Sie, junger Mann. Wir können Ihre Eltern nicht erreichen; die sind in New York. Ihre Schwester hat gesagt, daß Sie hier sein würden, also sind wir hergekommen. Wir tun Ihnen beiden einen Gefallen. Jetzt steigen Sie ein!«
Der junge Mann öffnete die hintere Tür des Wagens und stieg schnell ein. »Hat es einen Unfall gegeben? Ist sie verletzt? «
»Ist ja immer ein Unfall, nicht wahr?« sagte der Beamte, der am Steuer saß.
Steven Trevayne packte die Rücklehne des Vordersitzes. Er war jetzt beunruhigt. »Bitte sagen Sie mir, was los ist!«
»Ihre Schwester und ein paar Freundinnen haben sich da auf eine Rauschgiftparty eingelassen«, antwortete der andere Beamte. »Im Gästehaus der Swansons. Die Swansons sind in Maine ... natürlich. Wir haben vor einer Stunde einen Hinweis bekommen. Als wir hinkamen, stellten wir fest, daß es ein wenig komplizierter war.«
»Was meinen Sie damit?«
»Das war der Unfall, junger Mann«, warf der Fahrer ein. »Harte Sachen. Der Unfall war, daß wir das Zeug gefunden haben.«
Steven Trevayne war wie benommen. Vielleicht hatte seine Schwester gelegentlich gehascht – wer hatte das nicht? – aber keine harten Sachen. Das kam nicht in Frage.
»Ich glaube Ihnen nicht«, sagte er überzeugt.
»Sie werden ja selbst sehen.«
Der Streifenwagen bog an der nächsten Ecke nach links ab. Das war nicht der Weg zum Polizeirevier.
»Sind sie nicht auf dem Revier?«
»Wir haben sie noch nicht offiziell festgenommen. Noch nicht.«
»Ich verstehe nicht.«
»Wir wollen nicht, daß etwas herauskommt. Wenn wir sie festnehmen, haben wir keine Kontrolle mehr darüber. Die sind immer noch im Haus der Swansons.«
»Sind die Eltern da?«
»Wir haben Ihnen doch gesagt, daß wir sie nicht erreichen konnten«, antwortete der Mann am Steuer. »Die Swansons sind in Maine; Ihre Eltern sind in der Stadt.«
»Sie sagten, daß da noch andere seien. Freundinnen.«
»Die sind von außerhalb Connecticuts. Freunde aus dem Internat. Wir wollen uns zuerst mit den hiesigen Eltern auseinandersetzen. Wir müssen vorsichtig sein. Das ist im Interesse aller. Sie müssen wissen, wir haben zwei Pakete Heroin gefunden. Schätzungsweise im Wert einer Viertelmillion Dollar.«
Andrew Trevayne nahm den Arm seiner Frau, als sie die Betontreppe zum Hintereingang des Polizeireviers von Greenwich hinaufgingen. Es war vereinbart, daß sie diesen Eingang benutzen würden.
Die Vorstellung war höflich und kurz angebunden, dann geleitete man die Trevaynes in das Büro von Detective Fowler. Ihr Sohn stand an einem Fenster und ging mit schnellen Schritten auf seine Eltern zu, als sie zur Türe hereinkamen.
»Mom! Dad! ... Das ist ja ganz große Kacke!«
»Beruhig dich, Steve«, sagte der Vater streng.
»Bei Pam alles in Ordnung?«
»Ja, Mutter, alles klar. Die sind immer noch bei den Swansons. Sie ist bloß völlig durcheinander. Alle sind sie das. Und ich kann es ihnen wirklich nicht verübeln!«
»Du sollst ruhig bleiben, habe ich gesagt!«
»Das bin ich ja, Dad. Ich bin nur zornig. Diese Mädchen wissen gar nicht, was Aitsch ist, geschweige denn, wo sie es verkaufen könnten!«
»Wissen Sie das?« fragte Detective Fowler unpersönlich.
»Um mich geht es hier nicht, Bulle!«
»Jetzt sag ich es dir nochmal, Steve. Reiß dich zusammen oder halt den Mund!«
»Nein, das tue ich nicht! ... Tut mir leid, Dad, aber das tue ich nicht! Diese Witzbolde haben telefonisch den Tip bekommen, sich bei den Swansons umzusehen. Ohne Namen und ohne Grund. Sie ...«
»Augenblick mal, junger Mann!« unterbrach ihn der Polizeibeamte. »Wir sind keine ›Witzbolde‹ und ich gebe Ihnen den guten Rat, mit der Wahl Ihrer Worte etwas vorsichtig zu sein! «
»Er hat recht«, fügte Trevayne hinzu. »Ich bin sicher, daß Mr. Fowler uns erklären kann, was passiert ist. Was war das für ein Telefonanruf, Mr. Fowler? Den haben Sie bei unserem Gespräch nicht erwähnt.«
»Dad! Das wird er dir nicht sagen!«
»Ich weiß nicht! ... Das ist die Wahrheit, Mr. Trevayne. Heute Abend um neunzehn Uhr zehn kam ein Anruf herein, daß bei den Swansons Gras wäre; daß wir nachsehen sollten, weil es um viel mehr ginge. Der Anrufer war ein Mann und sprach mit einem ... nun, sagen wir, etwas affektierten Tonfall. Ihre Tochter ist als einzige namentlich erwähnt worden. Wir sind der Sache nachgegangen ... Vier Mädchen. Sie gaben zu, sie hätten im Laufe der letzten Stunde zu viert eine Zigarette geraucht. Es war keine Party. Ehrlich gesagt, der Streifenbeamte machte den Vorschlag, wir sollten das Ganze vergessen. Aber als die gerade ihren Bericht über Funk durchgaben, war ein weiterer Anruf hereingekommen. Dieselbe Stimme. Dieselbe Person. Diesmal sagte man uns, wir sollten in der Milchbox auf der Veranda des Gästehauses nachsehen. Dort fanden wir die zwei Pakete mit unverschnittenem Heroin. Unverschnitten; wir schätzen zweihundert, zweihundertfünfzigtausend. Es ist eine ganze Menge.«
»Ja, und das ist auch die durchsichtigste konstruierte Geschichte, die ich je gehört habe. Das ist völlig unglaubwürdig. « Trevayne sah auf die Uhr. »Mein Anwalt sollte binnen einer halben Stunde hier sein; ich bin sicher, daß er Ihnen dasselbe sagen wird. So, ich bleibe hier und warte, aber ich weiß, daß meine Frau gerne zu den Swansons hinausfahren würde. Ist Ihnen das recht?«
Der Polizist seufzte hörbar. »Schon gut.«
»Brauchen Sie meinen Sohn noch? Kann er sie fahren?«
»Sicher.«
»Dürfen wir sie mit nach Hause nehmen?« fragte Phyllis Trevayne besorgt. »Sie alle zu unserem Haus mitnehmen?«
»Nun, es gibt da gewisse Formalitäten ...«
»Laß nur, Phyl. Fahr zu den Swansons. Wir rufen dich an, sobald Walter hier ist. Mach dir keine Sorgen. Bitte.«
»Dad, sollte ich nicht hierbleiben? Ich kann Walter sagen... «
»Ich möchte, daß du mit deiner Mutter fährst. Die Schlüssel sind im Wagen. Geh jetzt.«
Trevayne und Detective Fowler blickten den beiden nach. Als die Türe sich hinter ihnen geschlossen hatte, griff Trevayne in die Tasche und holte ein Päckchen Zigaretten heraus. Er bot dem Polizeibeamten eine an, aber der lehnte ab. »Nein, danke. Ich esse lieber Pistazienkerne.«
»Das ist gut für Sie. So, wollen Sie mir jetzt sagen, was das alles soll? Sie glauben doch genauso wenig wie ich, daß es eine Verbindung zwischen diesem Heroin und den Mädchen gibt.«
»Warum sollte ich das nicht? Das ist eine sehr teure Verbindung. «
»Weil Sie sie sonst schon lange hierher geholt und festgenommen hätten. Und zwar exakt aus dem Grund, den Sie gerade erwähnt haben. Weil es teuer ist. Sie betreiben den ganzen Fall in höchst unorthodoxer Weise.«
»Das ist richtig.« Fowler ging um seinen Schreibtisch herum und setzte sich. »Und Sie haben recht, ich glaube nicht, daß eine Verbindung besteht. Andererseits darf ich die Möglichkeit nicht ganz außer acht lassen. Die Geschichte ist hochexplosiv, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen.«
»Was werden Sie tun?«
»Das wird Sie jetzt vielleicht überraschen, aber vielleicht lasse ich mich von Ihrem Anwalt beraten.«
»Was meine Behauptung unterstützt.«
»Ja, das tut es. Ich glaube nicht, daß wir Gegner sind, aber ich habe Probleme. Wir haben Beweismaterial; das darf ich nicht einfach ignorieren. Andererseits wirft die Art und Weise, wie das Material in unseren Besitz gekommen ist, natürlich Fragen auf. Ich kann es diesen Mädchen nicht anhängen – nicht, wenn ich alles in Betracht ziehe ...«
»Ich würde Sie wegen unberechtigter Verhaftung vor Gericht ziehen. Das könnte teuer werden.«
»Ach, kommen Sie, Mr. Trevayne. Drohen Sie mir doch nicht. Im juristischen Sinne haben diese Mädchen einschließlich Ihrer Tochter zugegeben, daß sie Marihuana geraucht haben. Das ist gegen das Gesetz. Aber es handelt sich um ein geringfügiges Vergehen, und wir würden daraus nichts machen. Das andere wiegt schwerer. Greenwich will diese Art von Publicity nicht. Und Heroin im Wert von einer Viertelmillion Dollar ist eine ganze Menge Publicity. Wir wollen hier keine Zustände wie in Darien.«
Trevayne sah, daß Fowler es ernst meinte. Das Ganze war ein Problem. Und verrückt war es auch. Welches Interesse konnte jemand daran haben, vier junge Mädchen zu belasten und dafür eine solch ungeheure Summe Geldes wegzuwerfen? Es war eine außergewöhnliche Geste.
Phyllis Trevayne kam die Treppe herunter und betrat das Wohnzimmer. Ihr Mann stand vor der Glaswand und sah auf den Sund hinaus. Es war lange nach Mitternacht, und der Augustmond stand am Himmel und leuchtete hell auf die Wellen.
»Die Mädchen sind in den Gästezimmern. Die reden bestimmt bis morgen früh; sie haben eine Heidenangst. Kann ich dir einen Drink holen?«
»Das wäre nett. Wir könnten beide einen gebrauchen.«
Phyllis ging zu der kleinen Bar links vom Fenster. »Was wird jetzt geschehen?«
»Fowler und Walter haben sich geeinigt. Fowler wird den Fund des Heroins melden und die Tatsache, daß er einen telefonischen Tip bekommen hat. Dazu ist er gezwungen. Aber er wird keine Namen und keine Orte erwähnen mit der Begründung, daß die Ermittlungen in Gange sind. Wenn man ihn unter Druck setzt, wird er sagen, daß er nicht das Recht hat, unschuldige Leute hineinzuziehen. Die Mädchen können ihm gar nichts sagen.«
»Hast du mit den Swansons gesprochen?«
»Ja. Die haben durchgedreht; Walter hat sie beruhigt. Ich habe ihnen gesagt, daß Jean bei uns wohnen und morgen oder übermorgen zu ihnen kommen könnte. Die anderen fahren morgen heim.«
Phyllis reichte ihrem Mann ein Glas. »Gibt es für dich einen Sinn?«
»Nein, überhaupt nicht. Wir können uns keinen Reim darauf machen. Die Stimme am Telefon klang wohlhabend, meinen Fowler und der Sergeant in der Vermittlung. Das könnte auf Tausende von Leuten zutreffen; vielleicht auch etwas weniger, weil er das Gästehaus der Swansons kannte. Das heißt, er nannte es >das Gästehaus<; er beschrieb es nicht als separates Gebäude oder so etwas.«
»Aber warum?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht hat jemand etwas gegen die Swansons; etwas Schwerwiegendes, meine ich; im Wert einer Viertelmillion Dollar. Oder ...«
»Aber Andy«, unterbrach ihn Phyllis. Sie wählte ihre Worte sorgfältig. »Der Mann, der angerufen hat, hat Pams Namen genannt. Nicht den von Jean Swanson.«
»Sicher. Aber das Heroin befand sich auf dem Anwesen der Swansons.«
»Ich verstehe.«
»Nun, ich nicht«, sagte Trevayne und führte sein Glas an die Lippen. »Das sind alles nur Vermutungen. Wahrscheinlich hat Walter recht. Vermutlich ist der Betreffende zwischen zwei Transaktionen in Panik geraten. Und dann kamen die Mädchen ins Spiel; reich, verzogen, die idealen Sündenböcke für ein Alibi.«
»Ich kann nicht so denken.«
»Ich kann das in Wirklichkeit auch nicht. Ich zitiere nur Walter.«
Von der Einfahrt vor dem Hause waren die Geräusche eines Wagens zu hören.
»Das muß Steve sein«, erklärte Phyllis. »Ich hab’ ihm gesagt, daß er nicht zu spät kommen soll.«
»Das ist er aber«, meinte Trevayne nach einem Blick auf die Kaminuhr. »Doch ich werde ihm keinen Vortrag halten, das verspreche ich. Mir gefiel, wie er sich heute nacht verhalten hat. Seine Ausdrucksweise ließ vielleicht zu wünschen übrig, aber er hat sich nicht einschüchtern lassen. Das hätte leicht sein können.«
»Ich war stolz auf ihn. Er war der Sohn seines Vaters.«
Die Haustüre ging auf, Steven Trevayne kam herein und schloß sie langsam hinter sich. Er machte einen verstörten Eindruck.
Phyllis Trevayne ging auf ihren Sohn zu.
»Augenblick, Mom. Ehe du herkommst, will ich dir etwas sagen. Ich bin gegen Dreiviertel elf bei den Swansons weggefahren. Der Cop hat mich in die Stadt mitgenommen, weil dort mein Wagen stand. Dann bin ich zu Ginny und wir sind beide in die Cos Cob Tavern gefahren. Gegen halb zwölf waren wir dort. Ich hatte drei Flaschen Bier, kein Gras, nichts.«
»Warum sagst du uns das?« fragte Phyllis.
Der hochgewachsene Junge stammelte, wirkte unsicher. »Wir sind vor etwa einer Stunde weggegangen, hinaus zum Wagen. Der Vordersitz sah schrecklich aus; jemand hatte Whisky oder Wein oder so etwas darüber gegossen; die Sitzbezüge waren aufgeschlitzt, die Aschenbecher ausgeleert. Wir hielten das für einen miesen Witz, einen lausigen Witz ... Ich hab’ Ginny heimgebracht und wollte dann nach Hause fahren. Als ich an die Stadtgrenze kam, hat mich ein Polizeiwagen aufgehalten. Ich bin nicht zu schnell gefahren oder so etwas; niemand war hinter mir. Dieser Streifenwagen hat mich einfach aufgehalten. Ich dachte, er hätte vielleicht Probleme mit seinem Wagen. Ich wußte es nicht ... Der Beamte kam auf mich zu und verlangte meinen Führerschein und meine Papiere. Und dann hat er es gerochen und sagte, ich sollte aussteigen. Ich versuchte, es ihm zu erklären, aber er wollte nichts hören.«
»War er von der Polizei von Greenwich?«
»Ich weiß nicht, Dad. Ich denke nicht; ich war noch in Cos Cob.«
»Weiter.«
»Er hat mich durchsucht; sein Kollege hat sich den Wagen vorgenommen, wie in French Connection. Ich dachte, die würden mich mitnehmen. Irgendwie habe ich das sogar gehofft; ich war ja ganz nüchtern. Aber das taten sie nicht. Statt dessen haben sie eine Polaroidaufnahme von mir gemacht, mit ausgestreckten Armen vor dem Wagen – ich mußte mich so hinstellen, damit sie mir die Taschen durchsuchen konnten – und der eine fragte, wo ich hergekommen sei. Das habe ich ihm gesagt, und dann ging er zu seinem Streifenwagen und rief jemanden an. Er kam zurück und fragte mich, ob ich etwa zehn Meilen weiter hinten einen alten Mann angefahren hätte. Natürlich nicht, erklärte ich. Und dann erzählte er, daß dieser alte Knabe im Krankenhaus wäre, in kritischem Zustand.«
»In welchem Krankenhaus? Den Namen!«
»Das hat er nicht gesagt.«
»Hast du ihn denn nicht gefragt?«
»Nein, Dad! Ich hatte schreckliche Angst. Ich habe niemanden angefahren. Ich hab’ überhaupt niemanden auf der Straße gesehen. Nur ein paar Wagen.«
»O mein Gott!« Phyllis Trevayne sah ihren Mann an.
»Was war dann?«
»Der andere Polizist hat weitere Bilder von dem Wagen aufgenommen, und dann hat er eine Nahaufnahme von mir gemacht, nur das Gesicht. Ich sehe den Blitz immer noch ... Herrgott, hatte ich Angst ... Und dann sagten sie, ich könnte jetzt gehen. Einfach so.« Der Junge blieb im Flur stehen; die Schultern hingen ihm herunter, und die Angst und Verwirrung in seinen Augen waren nicht zu übersehen.
»Hast du mir alles gesagt?« fragte Trevayne.
»Ja, Sir«, erwiderte der Sohn mit kaum hörbarer, von Furcht gequälter Stimme.
Andrew trat an den Tisch neben der Couch und nahm den Telefonhörer ab. Er wählte die Auskunft und erkundigte sich nach der Nummer des Polizeireviers von Cos Cob. Phyllis ging zu ihrem Sohn und führte ihn ins Wohnzimmer.
»Mein Name ist Trevayne, Andrew Trevayne. Wie ich höre, hat einer Ihrer Streifenwagen meinen Sohn angehalten an der ... wo war es, Steve?«
»Junction Road, an der Kreuzung. Etwa eine Viertelmeile vom Bahnhof.«
»... Junction Road, an der Kreuzung, in der Nähe des Bahnhofes; vor höchstens einer halben Stunde. Würden Sie mir bitte sagen, was in dem Bericht steht? Ja, ich warte.«
Andrew sah seinen Sohn an, der sich inzwischen gesetzt hatte. Phyllis stand neben ihm. Der Junge zitterte und atmete ein paarmal tief durch. Er sah seinen Vater an, hatte Angst, verstand nichts.
»Ja«, sagte Trevayne ungeduldig in den Hörer. »Junction Road, auf der Seite von Cos Cob ... Natürlich bin ich sicher. Mein Sohn ist hier bei mir! ... Ja, ja ... Nein, ich bin nicht sicher ... Augenblick.« Andrew sah den Jungen an. »Hast du an dem Polizeiwagen die Aufschrift Cos Cob gesehen? «
»Ich ... ich habe nicht hingeschaut. Er stand an der Seite. Nein, ich habe es nicht gesehen.«
»Nein, das hat er nicht. Aber es muß doch einer von den Ihren sein, oder? Er war in Cos Cob ... Oh? ... Verstehe. Sie könnten das nicht für mich nachprüfen, oder? Schließlich ist er auf Ihrem Gebiet aufgehalten worden ...? Schön, ich verstehe. Mir paßt das nicht, aber ich verstehe, was Sie meinen. «
Trevayne legte den Hörer auf und holte ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche.
»Was ist denn, Dad? Waren die es nicht?«
»Nein. Die haben zwei Streifenwagen, und keiner von den beiden ist in den letzten zwei Stunden in der Nähe der Junction Road gewesen.«
»Was war das mit >nicht passen<, aber >verstehen<?« fragte Phyllis.
»Sie haben keine Möglichkeit, Wagen der anderen Gemeinden zu überprüfen. Nicht ohne formelle Aufforderung, und die müßte registriert werden. Das tun die nicht gern; da gibt es Übereinkünfte. Falls Polizeifahrzeuge bei der Verfolgung irgendwelcher Leute Verwaltungsgrenzen überschreiten, holen sie sie nur formlos zurück.«
»Aber du mußt das doch herausfinden! Die haben Fotos gemacht. Die haben gesagt, Steve hätte jemanden angefahren !«
»Ich weiß. Das werde ich auch. Steve, geh hinauf unter die Dusche. Du riechst wie eine Bar an der Eighth Avenue. Beruhig dich. Du hast nichts Unrechtes getan.«
Trevayne stellte das Telefon auf den Tisch vor der Couch und setzte sich.
Westport, Darien. Wilton. New Canaan, Southport.
Nichts.
»Dad, ich hab’ das nicht geträumt!« schrie Steven Trevayne; er trug jetzt einen Bademantel.
»Sicher hast du das nicht. Wir versuchen es weiter; wir rufen die New Yorker Reviere an.«
Port Chester. Rye. Harrison. White Plains. Mamaroneck.
Das Bild seines Sohnes, nach vorne ausgestreckt, die Hände auf der Motorhaube eines Wagens, der mit Alkohol durchtränkt war, ein Verhör durch unauffindbare Polizisten auf einer dunklen Straße, ein unbekannter Mann überfahren – Fotografien, Anklagen. Es gab keinen Sinn; das Ganze hatte die abstrakte Qualität des Unglaublichen. Ebenso unglaublich, ebenso unwirklich wie das mit seiner Tochter und ihren Freundinnen und Heroin im Wert von zweihundertfünfzigtausend Dollar in einem Milchbehälter auf der Veranda des Swanson-Gästehauses.
Wahnsinn.