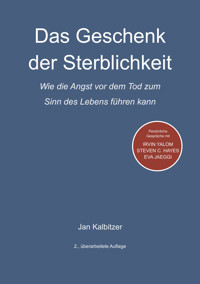
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In einer Gesellschaft, in der wir den Tod oft ausblenden, lädt uns Jan Kalbitzer in seinem Buch „Das Geschenk der Sterblichkeit“ ein, den Umgang mit der eigenen Endlichkeit neu zu betrachten. Als erfahrener Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie zeigt er auf ruhige, reflektierte und zugleich bewegende Weise, wie die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit helfen kann, ein tieferes, bewussteres und erfüllteres Leben zu führen. Anhand von authentischen persönlichen Erfahrungen und fundierten therapeutischen Erkenntnissen beschreibt Kalbitzer, warum gerade unbequeme Gefühle wie Angst, Verlust oder Vergänglichkeit wertvolle Begleiter sein können. Weil sie uns helfen, Klarheit über das Wesentliche zu gewinnen und unseren Alltag intensiver und lebendiger wahrzunehmen. „Das Geschenk der Sterblichkeit“ ist nicht nur ein Buch über die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, sondern vor allem über das bewusste Leben – eine Einladung, mutig innezuhalten, Prioritäten neu zu setzen und das eigene Dasein wertvoller zu gestalten. Es richtet sich an alle, die mehr Tiefe und Sinn in ihr Leben bringen möchten und bereit sind, den Blick für das wirklich Wesentliche zu öffnen. -- IN DEN MEDIEN (Auswahl): „Wenn man Dingen einen Sinn gibt, wird es ein wunderbares Leben“ (Interview, FAZ) "Ich hatte ständig Angst, morgens nicht wieder aufzuwachen" (Interview, ZEIT) "Die Angst vor dem Tod als Kompass nutzen" (Interview, DLF Nova)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jan Kalbitzer
Das Geschenk der Sterblichkeit
Wie die Angst vor dem Tod zum Sinn des Lebens führen kann
Ein kluger, ehrlicher Ratgeber, der zeigt, wie wir durch die bewusste Auseinandersetzung mit unserer Endlichkeit Ängste überwinden und den Weg zu einem tieferen und erfüllteren Leben finden können.Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen: eine notwendige psychiatrisch-psychotherapeutische Packungsbeilage
Wie mich, als ich alles erreicht zu haben glaubte, plötzlich eine seltsame Angst vor dem Tod überkam
Wie die in meiner Nähe mir nicht helfen konnten, weil sie mir helfen wollten, eine Erklärung zu finden
Wie unser Pfarrer mich beeindruckte, obwohl er genau das tat, was ich befürchtet hatte
Wie ich bei Eva Jaeggi meine Gefühle nicht zuließ und sie dann in Menschen in der U-Bahn sah
Wie eine Massage manchmal mehr bewirken kann als viele Stunden intensiver Psychotherapie
Warum der Körper vielleicht der beste Kompass zu sich selbst ist
Wie ich mich bei Irvin D. Yalom auf die Suche nach meinem ungelebten Leben begab - und es bei den Rudower Kickers fand
Wie Steven C. Hayes meine Krise zu einem spirituellen Erlebnis erklärte und mir empfahl, mein Ego zu töten
Wie ich aufhörte, vor der Angst zu fliehen, und Irvin D. Yalom sagte, dass ich wütend auf ihn bin
Wie mein Sambalehrer meine Gedanken las und mir sagte, dass ich schon wieder wie ein Baby sei
Wie ein Gärtner mir beibrachte, dass man keine Religion braucht, um das Heilige in der Welt zu erkennen
Wie meine Eltern mich befreiten und warum es keinen Weg zu sich selbst ohne Narzissmus gibt
Warum mein Weg nicht für einen Ratgeber taugt und wie Sie Antworten für sich selbst finden können
Impressum
Meinen Eltern, meinen Kindern
Für die befreiende Einsicht, dass mein Leben beides ist – für sich selbst erfüllend und trotzdem Teil eines Staffellaufs
Vorbemerkungen: eine notwendige psychiatrisch-psychotherapeutische Packungsbeilage
Die subjektive Perspektive, die ich in diesem Buch einnehme, eröffnet mir eine Vielfalt an Möglichkeiten, auf das Thema Sterblichkeit und Tod zu blicken. Ernsthaft, humorvoll, kritisch oder verklärt. Ich nehme in diesem Buch deshalb an vielen Stellen die Rolle der Privatperson ein, um Dinge zu sagen, die ich als Psychiater offiziell so nicht unbedingt sagen würde. In meiner Rolle als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie bin ich Ihnen deshalb diese folgenden Vorbemerkungen schuldig:
Der Tod ist nur selten ein Geschenk. Er ist es allenfalls dann, wenn er die einzige Erlösung von unerträglichen, unendlichen Qualen bedeutet. Vor allem dann, wenn er einen mitten im Leben und völlig unerwartet trifft, ist die Perspektive bald sterben zu müssen, alles andere als ein Geschenk. Schlimmer noch ist meist nur der Tod geliebter Angehöriger, der eigenen Kinder, des Partners, der Eltern, von Freunden. All das soll in diesem Buch nie infrage gestellt werden.
In diesem Buch geht es um die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, die viele Menschen schon lange vor dem Nahen des eigenen Todes beschäftigt. Es geht darum, wie diese Auseinandersetzung dabei helfen kann, ein bewussteres, ein sinn- und bedeutungsvolleres Leben zu führen. Das Geschenk der Sterblichkeit besteht also nicht darin, endlich sterben zu dürfen oder glücklicherweise sterben zu müssen, sondern in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Dasein, zu der uns die Brutalität der Tatsache, dass jedes Leben endlich ist, zwingt. Vielen Menschen begegnet diese Tatsache in Form einer allgegenwärtigen, irrationalen Angst vor dem Tod.
Dieses Buch ist keinesfalls ein Plädoyer dafür, das eigene Leben vorzeitig zu beenden. Sei es durch Sterbehilfe oder sei es durch Selbsttötung. Alle Menschen, die bisher mit dem Wunsch zu sterben zu mir kamen, wollten dies nach einer erfolgreichen Therapie nicht mehr. Oft haben Psychiater aber nicht die Chance, Menschen mit Todesgedanken zu helfen, weil einige aufgrund der Stigmatisierung psychischer Beschwerden davor zurückschrecken, sich professionelle therapeutische Hilfe zu suchen.
Um dieser Stigmatisierung entgegenzutreten, habe ich dieses Buch aus meiner eigenen subjektiven Perspektive geschrieben. Weil mir immer wieder diese Frage gestellt wurde: »Was würden Sie denn als Arzt tun, wenn Sie selbst in meiner Situation wären?« Wie sich in diesem Buch zeigen wird, ist das gar nicht so anders als das, was die meisten Menschen ohnehin tun, nämlich erst mit Freunden reden und früher oder später professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Meine Hoffnung ist, durch die offene Beschreibung eigener Krisen und des Potenzials für ein besseres Leben, das in der aktiven Auseinandersetzung mit sich selbst steckt, anderen Menschen Mut zu machen, sich auch auf den Weg zu begeben.
Wenn Sie viel an den Tod denken oder daran, sich das Leben zu nehmen, dann sprechen Sie mit jemandem darüber. Je nachdem, was Ihnen leichter fällt, können das Verwandte und Freunde oder Ärzte, Psychologen und Geistliche sein. Sie können sich in Deutschland auch anonym an die Telefonseelsorge wenden: per Telefon (0800/111 0 111) oder per E-Mail und Chat (über die Webseite http://ts-im-internet.de).
Wie mich, als ich alles erreicht zu haben glaubte, plötzlich eine seltsame Angst vor dem Tod überkam
Auch Ärzte und Therapeuten haben Krisen. Die meisten Psychiater und Psychotherapeuten haben sich ihren Be ruf sogar ausgesucht, weil sie selbst sehr gut wissen, was eine psychische Krise ist. Nur wenn sie selbst in der Lage sind, Krisen zu überwinden, können sie anderen Menschen helfen. Sie brauchen eine eigene Therapie, um aus der Erfahrung eine Ressource zu machen. Sonst laufen sie Gefahr, dort, wo sie selbst verletzt wurden, übersensibel zu reagieren und ein Helfersyndrom zu entwickeln – oder abzustumpfen und ihren Patienten gegenüber zynisch zu werden.
»Selbsterfahrung« heißt die Psychotherapie, die deshalb jeder Therapeut im Rahmen der eigenen Ausbildung aus gutem Grund machen muss. Mit Patienten über die eigene Krise reden sollten Therapeuten jedoch nur wohldosiert. Der Raum in der Therapie gehört den Patienten, er soll nicht der Erleichterung eines mitteilungsbedürftigen Therapeuten dienen. Sinn macht es dort, wo es Patienten beim eigenen Verständnis, bei der eigenen Entwicklung hilft. Mehr über ihre Krisen sprechen sollten Therapeuten hingegen in der Öffentlichkeit. Denn wenn wir es ernst meinen mit dem Kampf gegen die Stigmatisierung und dem Argument, dass aus Krisen neue Kraft und Kompetenz erwachsen kann, dann müssen wir mit eigenem Beispiel voran gehen und die große Bedeutung der Krise für die eigene Entwicklung benennen. Auch wenn gerade wir Ärzte dazu den weißen Kittel ablegen müssen, dessen Funktion viel zu häufig darin besteht, sich vom Leid der Patienten abzugrenzen. Gerade auf psychiatrischen Stationen, auf denen ärztliche Arbeit oft vorwiegend im Sprechen besteht, ist der weiße Kittel mittlerweile vor allem nur noch eins: ein Fetisch – und nichts, was man der Hygiene wegen tragen muss.
Dabei vereint uns Menschen nichts so sehr wie das Wissen um die Unausweichlichkeit des eigenen Todes. Und für die meisten Menschen führt diese Erkenntnis zunächst in eine Krise mit schweren Ängsten und Depressionen. Manche Menschen tragen diese Angst seit ihrer Kindheit mit sich herum, und andere trifft sie erst im hohen Alter, wenn die Freunde um einen herum anfangen, krank zu werden und zu sterben – oder wenn bei einem selbst die ersten Symptome einer schwerwiegenden Erkrankung auftreten. Und fast alle fühlen sich sehr einsam mit dieser Angst – bis sie anfangen, darüber zu sprechen. Gerade ältere Menschen berichten mir manchmal, wie sie von ihren Bekannten Tabletten zugesteckt bekommen, die diese schon seit Jahren aufgrund genau der gleichen Ängste, der Schwindelgefühle, des Herzrasens und der schlaflosen Nächte nehmen. Das Teilen eines Tablettenblisters mit Beruhigungsmitteln wird so zum Aufnahmeritual einer verschworenen Gemeinschaft.
Mich traf die Angst vor dem Tod mit Ende dreißig. Einer von vielen typischen Zeitpunkten. Manche entwickeln die Erkenntnis der bedrohlichen Endlichkeit der Welt schon als Kind, wenn zum Beispiel wichtige Bezugspersonen wie die Großeltern oder Urgroßeltern sterben oder sie ein Umzug oder Schulwechsel aus vertrauten Bezügen reißt. Und neben den Ängsten in der Kindheit und der Lebensmitte gibt es auch die Angst der Älteren, die anfangen, Dinge in ihrem Leben aufzugeben - ohne die Perspektive zu haben, dass danach wieder etwas Neues kommen wird.
Die Mitte des Lebens ist insofern ein besonderer Zeitpunkt für diese Angst, weil sich die Perspektive langsam dreht, der Blick ist nicht mehr permanent nach vorne gerichtet und begegnet in der Wendung zu der oft vergangenheitsorientierten Sicht der älteren Menschen in großer Härte den Realitäten der Gegenwart. Rückblickend stellt dieser Moment für viele Menschen einen Zeitpunkt großer Aufrichtigkeit und Radikalität dar, der wichtigen Lebensentscheidungen vorausgeht. Aber da diese Einsicht meist erst im Nachhinein kommt, ist die Begegnung an sich für viele sehr qualvoll und zieht sich lange hin. Und meiner Erfahrung nach ist der beste Umgang mit Ängsten der, offen darüber zu sprechen, denn nur dann erzählen andere Menschen auch von sich. Die Einsicht, dass es sich bei diesen Ängsten um eine Erfahrung handelt, die viele Menschen machen, die also womöglich zum Leben dazugehört, und die Einsicht, dass diese Phase auch bei anderen Menschen vorbeigegangen ist und womöglich zu etwas Besserem geführt hat, erleichtert es, schneller in den produktiven Teil überzugehen, sodass aus dieser schmerzhaften Begegnung im besten Fall ein Geschenk werden kann.
Der Tag, an dem ich der Angst begegnete, war bis dahin eigentlich ein sehr schöner Tag gewesen – schöner als viele andere. Es war Mitte April, und ich hatte Berlin morgens mit dem ICE verlassen. In der letzten Zeit hatte ich viel gearbeitet, und nun genoss ich es, Musik mit Kopfhörern zu hören und dabei das Gefühl zu haben, ganz allein zu sein. Nichts zu hören, was ich nicht hören wollte. Nicht sprechen zu müssen, keine Antworten schuldig zu sein.
Während der Zug nach Süden sauste, ging die Sonne über der Brandenburger Landschaft auf, zog weiter durch den Himmel, und als ich in München ankam, war draußen ein warmer Frühlingsnachmittag. Ich war zum ersten Mal in München und hatte erst am nächsten Morgen einen Termin. Und obwohl ich pompöser Architektur in der Regel wenig abgewinnen kann, beeindruckten mich schon vom Hauptbahnhof aus die Gebäude der Stadt. Deshalb beschloss ich, zu Fuß zu meinem Hotel zu gehen. Ohne Ortskenntnis ging ich zunächst zum Stachus, dann in Richtung der berühmten Türme durch die belebte Fußgängerzone zur Frauenkirche und anschließend am Rathaus vorbei zu den Ständen und Geschäften des Viktualienmarkts. Am Isartor holte ich zum ersten Mal mein Telefon heraus, um auf die Karte zu schauen. Ich orientierte mich links in Richtung meines Hotels und folgte einer großen Verkehrsader, bog dann aber doch wieder ungeplant in die Maximilianstraße ein und landete anschließend beim imposanten Bayerischen Landtag. Schließlich hatte ich genug von der architektonischen Pracht und ging am Isarufer entlang zum Englischen Garten. Leicht bekleidete, lachende Menschen lagen auf den Wiesen, und die entgegenkommenden Spaziergänger lächelten mich freundlich an.
Über eine Brücke verließ ich den Park und gelangte zu einem kleinen Platz, an dem sich mein Hotel befand. Ich ging zur Rezeption und nannte meinen Namen. »Ihr Verlag hat ein schönes Zimmer für Sie reserviert, Herr Dr. Kalbitzer«, sagte der Mitarbeiter respektvoll. Mein Verlag. Leicht benommen nahm ich meinen Schlüssel und ging hinauf in das Zimmer. Es war schlicht und sauber, roch aber etwas nach Putzmitteln. Ich öffnete die Fenster, und von draußen strömte mit der frischen, warmen Frühlingsluft eine friedliche Mischung aus Vogelgezwitscher und Stimmengemurmel herein. Ich legte meine Jacke auf das Bett, setzte mich daneben und schaute hinaus.
Ich hatte noch amüsiert die Nachttischlampe fotografiert: Der Ständer der Lampe bestand aus kleinen Elefanten, die jeweils auf den Schultern der anderen standen. Bei einigen waren die Stoßzähne abgebrochen, was mich in Anbetracht des durchaus gepflegten Hotels überraschte. Ich schickte das Foto an meine Frau, mit der scherzhaften und zugleich stolzerfüllten Frage, ob die bekannteren Autoren des Verlages wohl auch in diesem Zimmer untergebracht würden. Dann ging ich zum Fenster, lehnte mich an den Fensterrahmen und atmete die Frühlingsluft ein. Ich nahm meine Jacke vom Bett auf, klopfte sie etwas ab und entdeckte an der Schulter die Reste des Frühstücksbreis, den unser Sohn bei der Verabschiedung noch am Mund gehabt haben musste. Der Fleck ließ sich nicht wegputzen, aber das war egal. »Orden der Vaterschaft« hatte ein befreundeter Vater diese Flecken einmal genannt. So fühlten sie sich auch an. Ich lächelte den Herrendiener an. Was für ein großartiges Gefühl, stolzer Vater zu sein und genau die Dinge im Leben tun zu können, die ich mir immer gewünscht hatte! Dann zog ich die Überdecke zurück, nur so weit, dass mein Kopf auf dem sauberen Kissen liegen konnte, und legte mich auf das Bett.
Von dort stürzte ich in die Tiefe. Nicht plötzlich und zunächst gar nicht unangenehm: Nachdem ich die Augen geschlossen hatte, entstand in meinem Kopf und meinem Oberkörper das Gefühl einer intensiven Leere. Dann schien das Bett auf einmal keinen Halt mehr zu bieten, und es fühlte sich an, als ob sich mein Körper in einem weiten dunklen Raum befände. Sobald ich die Augen schloss, war er da, und ich begann, rückwärts in ihn hineinzustürzen.
Ich hatte keinen Alkohol getrunken, nicht geraucht, und es gab auch sonst keine äußeren Umstände, mit denen ich mir das Erlebnis hätte erklären können. Ich war bei all dem komplett wach, konnte die Augen öffnen, mich normal bewegen. Es gab, soweit mir eine Selbstuntersuchung möglich war, auch keine neurologischen Auffälligkeiten. Es war eher so, dass ich durch das Schließen der Augen einfach losließ und sofort anfing zu stürzen. Es fühlte sich an, als ob langsam und tonlos alle Gewissheiten in mir splitterten. Ich konnte den Vorgang durch das Öffnen der Augen zwar kurzzeitig unterbrechen, aber ich wusste auch, dass es sinnlos war. Dass es weitergehen würde, sobald ich die Augen wieder schloss. Ich machte die Augen wieder zu und fragte mich, wie lange es dauern würde. Es waren ungefähr zwei Minuten.
Als der Sturz vorbei war, machte ich die Augen wieder auf. Ich fühlte mich unruhig und leer. Da ich den Zustand nicht begreifen konnte, versuchte ich, mich irgendwie dingfest zu machen, mich zu verorten. Ich nahm mein Telefon und schickte meiner Frau die Freigabe meines Standorts. So konnte sie jederzeit sehen, wo ich mich gerade befand. Das gab mir etwas Sicherheit. Dann versuchte ich, das Geschehene zu begreifen, in Worte zu fassen: der Sturz nach hinten, das Gefühl, dass auch in mir alles zusammenfiel. Wenn ich die Augen schloss, konnte ich den Eindruck des Sturzes auch jetzt, nachdem es vorbei war, noch beliebig reproduzieren – aber das Gefühl konnte ich trotzdem nicht fassen. Das steigerte die Unruhe, und in der Folge entwickelte sich zunehmend eine diffuse Angst, die sich auf nichts Konkretes bezog. Frei flottierend nennen wir das im psychiatrischen Jargon: eine Angst ohne ein klares Bezugsobjekt. Wie eine Panikattacke war es bis jetzt noch nicht – ich nahm meinen Körper zunächst kaum wahr und fühlte mich während des inneren Sturzes auch eher wie ein unbeteiligter Beobachter. Ein Beobachter, der sieht, dass etwas Ungewöhnliches passiert, das vielleicht bedrohlich sein könnte – aber nicht genau begreift, worin die Gefahr besteht.
Schnell bekam ich das Gefühl, dass mich das Nachdenken und In-mich-Hineinfühlen nicht weiterbrachten. Ich verließ mein Zimmer und das Hotel und machte mich auf die Suche nach einem Restaurant. Es war gut, im Freien und unter Menschen zu sein. Aber beim Gehen merkte ich, dass sich mein Körper fremd anfühlte. So, als hätte ich ihn gerade wie ein Kleidungsstück angezogen, in das ich hineinspüren konnte. Und mit einer Mischung aus Neugierde und Unbehagen tat ich das dann auch. Ich fühlte zunächst vorsichtig in seine Randregionen. In die Spitzen meiner Finger, in meine Fersen, in die obere Wölbung meiner rechten Ohrmuschel. Ich betastete mein Ohr von außen, die Haut, die darunterliegenden Knorpel. Dann berührte ich vorsichtig meinen Hinterkopf, tastete mich an den Knochen entlang und versuchte, mich an die anatomischen Bezeichnungen zu erinnern. Und dann überfiel mich der Gedanke, von wo aus ich meinen Körper gerade betrachtete. Wo befindet sich dieses subjektive Etwas, das von innen durch meinen Körper streifen und gleichzeitig die Perspektive von außen einnehmen kann? Ich verlor mich in philosophischen Gedanken und konzentrierte mich nicht mehr so sehr auf die Wahrnehmung. Als ich beim Restaurant ankam, war ich schon fast wieder guter Stimmung.
Erst auf dem Weg vom Restaurant zurück in mein Hotel wurde aus dem diffusen Gefühl eine konkrete, intensive Angst. Ich stellte mir vor, wie ich meiner Frau am Telefon oder zu Hause von dem Erlebnis erzählen würde, und begann dabei, an meine Familie zu denken. Und plötzlich kamen diese Gedanken: Was wäre, wenn irgendetwas mit meinem Körper nicht in Ordnung war? Wenn es eine akute Krankheit war und ich nicht mehr nach Hause zurückkehren konnte? Wenn ich heute Nacht hier in München sterben würde, ohne dass es irgendjemand mitbekam? Alleine im Bett eines anonymen Hotels in einer mir unbekannten Stadt, in der mein Leben niemandem etwas bedeutete? Und was würde aus meiner Familie werden, meinen Kindern, die ohne mich aufwachsen würden, und meiner Frau, die alleine die finanzielle Versorgung und die Erziehung stemmen müsste, bis sie die Trauer hinter sich gelassen und einen neuen Partner gefunden hätte? Ich überlegte, wie lange das wohl dauern würde, und rechnete ihren Anspruch auf Witwenrente durch, der siebzig Prozent meiner bisher erwirtschafteten Rentenansprüche betrug zuzüglich der Halbwaisenrente für die Kinder. Würde das reichen, um sich und die Kinder versorgen zu können?
Ich prüfte noch im Gehen meinen Puls. Mein Herz schlug schneller als sonst. Sicher steigt der Adrenalinspiegel, wenn man Angst hat. Deshalb ist Selbstbeobachtung in solchen Situationen nicht immer eine gute Idee, weil die erhöhte Pulsfrequenz wieder Angst macht, und diese neue Angst wiederum lässt den Puls noch schneller schlagen. Der Teufelskreis einer Panikattacke. Aber ich schaffte es einfach nicht, entspannter zu atmen. Zusätzlich verspannte sich die Muskulatur zwischen meinen Schultern, und ein stechender Schmerz zog durch meinen Brustkorb. Verspannungen, völlig klar. Wenn ich die Schultern rollte und den Rücken etwas bewegte, war der Schmerz sofort wieder weg. Und er war auch viel zu schwach für einen Herzinfarkt. Warum in aller Welt sollte ich auch gerade jetzt einen Herzinfarkt haben? Ich war doch körperlich völlig in Ordnung.
Als ich wieder in meinem Hotelzimmer ankam, trank ich zwei Flaschen Bier aus der Minibar und war kurz darauf betrunken. Dann putzte ich mir die Zähne, zog mich aus, legte mich ins Bett und schlief sofort ein. Am nächsten Morgen war ich ruhiger. Aber ich spürte mit großer Gewissheit, dass sich irgendetwas in mir, in meinem Leben, verändert hatte. Dass dieses diffuse Gefühl vom Vortag in mir fortbestand. Und immer, wenn ich versuchte, es zu fassen, überkam mich sofort eine tief gehende Angst, dass ich plötzlich aufhören könnte zu existieren. Der Gedanke selbst machte mir nicht zwangsläufig Angst, aber er trat immer gemeinsam mit dieser Unruhe auf. Und im Lauf der Zeit verschmolzen sie miteinander zu einem dauerhaften Gefühl der Unruhe und Sorge, verbunden mit permanenten Gedanken an den Tod, die mir irgendwann doch Angst machten. Als dieses Gefühl auch nach meiner Rückkehr nach Berlin und in den darauffolgenden Tagen und Wochen bei mir blieb, machte ich mich auf die Suche.
Hinter meinem Wunsch, dem eigenen Erleben hier nachzugehen, steht nicht nur die Hoffnung auf eine größere Selbsterkenntnis. Sondern auch die Absicht, die Unterteilung in Therapeut und Patient, krank und gesund aufzubrechen, die aus meiner Sicht für eine wirklich hilfreiche Therapie nicht sinnvoll ist.
Wie die in meiner Nähe mir nicht helfen konnten, weil sie mir helfen wollten, eine Erklärung zu finden
Um das Erlebte besser einordnen zu können, begann ich, mit Freunden und Bekannten darüber zu sprechen. Zu meiner Überraschung kannten viele von ihnen das Gefühl der Angst zu sterben sehr genau. Manche plagte diese Angst seit ihrer Jugend regelmäßig abends im Bett, und sie konnten deshalb auch als Erwachsene nie ohne eine Ablenkung wie zum Beispiel ein Hörspiel oder ein Buch einschlafen. Andere kannten sie aus bestimmten Lebensabschnitten als Erwachsene, die von dieser Angst geprägt waren. Bei einigen war die Angst wieder vergangen, bei anderen kehrte sie periodisch wieder.
Christoph, den ich noch nie persönlich getroffen hatte, war vor allem Kollege. Ich wusste, dass er schon länger Psychiater, Autor und auch Vater von Kindern ist, die ein paar Jahre älter sind als meine. Er hatte mir also vieles voraus und konnte das Phänomen bestimmt einordnen, vielleicht sogar Entwarnung geben. Gleichzeitig hatte ich auch etwas Angst, von einem Kollegen in eine diagnostische Schublade gesteckt zu werden. Ich kannte das schon aus anderen Situationen, in denen ich mit befreundeten Therapeuten über Probleme gesprochen hatte: Erst kommt dieser psychotherapeutische Mitgefühlsblick, und dann werden Fragen nach typischen Symptomen einer schwerwiegenderen psychiatrischen Erkrankung gestellt, rein vorsorglich, um das Schlimmste auszuschließen. Eine fürchterliche Angewohnheit, sich als Therapeut bei der Begegnung mit Menschen durch die diagnostische Einordnung ihrer Probleme Sicherheit verschaffen zu wollen. Und darüber hinaus möglichst noch ein standardisiertes Vorgehen vorzuschlagen. Wo doch die meisten Krisen eigentlich eine gute Möglichkeit sind, sich auf die Suche nach individuellen Lösungen für das eigene Leben zu machen.
Um es möglichst unpsychiatrisch zu gestalten, schlug ich für unser Treffen ein kleines äthiopisches Restaurant in Berlin-Schöneberg vor, in das ich gerne mit Menschen gehe, mit denen ich etwas Wichtiges zu besprechen habe. In dieser Gegend, die abends geprägt ist von sichtlich prekärer Prostitution, betritt man in einer kleinen Seitenstraße das im Souterrain liegende, etwas dunkle, teilweise traditionell eingerichtete Restaurant, das vom Duft nach Weihrauch und dem Klang äthiopischer Musik erfüllt ist. Schon beim Reinkommen hat man das Gefühl, in eine andere Welt einzutreten. Und wenn man dann noch gemeinsam eine gemischte Platte mit würzigen Soßen bestellt, die mithilfe von Brotfladen mit der Hand gegessen werden, was für sich genommen schon eine ungewohnte und deshalb herausfordernde Koordinationsaufgabe sein kann, dann gibt man schnell die angestammte Rolle und die Erwartung auf, mit denen man der gegenübersitzenden Person in einem austauschbaren Berliner Café vielleicht begegnet wäre.
Christoph sah ganz anders aus, als ich es erwartet hatte. Mit seiner verspielten bunten Kleidung wirkte er eher wie ein Intellektueller aus Berlin-Mitte als wie ein gestandener Psychiater. Ich erzählte ihm meine Geschichte, und er reagierte weder mit einem Mitgefühlsblick noch mit therapeutischen Fragen. Stattdessen teilte er seine Erfahrung als Psychiater zum Thema Ängste mit mir. Er war der Meinung, dass sich alle Ängste, denen wir in unserer Arbeit als Psychiater begegnen, auf die Angst vor dem Tod zurückführen lassen. Höhenangst, weil der Sturz in die Tiefe den Tod bedeuten könnte. Hypochondrie, also die Angst vor Krankheiten, weil Krankheit zum Tod führen kann.





























