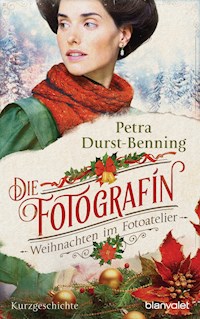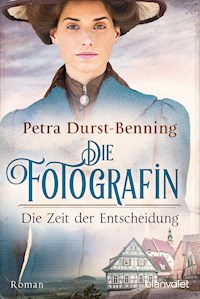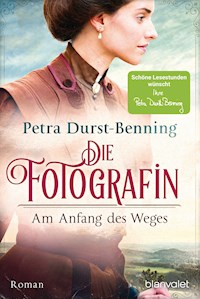12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Das erlebt die junge Wanda am eigenen Leib, als sie 1911 zu ihrer Glasbläserfamilie in den Thüringer Wald zurückkehrt: Das gläserne Paradies ist in Gefahr, denn eine der wichtigsten Glashütten soll verkauft werden. Wanda versucht, mit allen Mitteln zu helfen. Doch was als vielversprechende Rettungsaktion gedacht war, endet fast in einer Katastrophe ... Das erlebt die junge Wanda am eigenen Leib, als sie 1911 zu ihrer Glasbläserfamilie in den Thüringer Wald zurückkehrt: Das gläserne Paradies ist in Gefahr, denn eine der wichtigsten Glashütten soll verkauft werden. Wanda versucht, mit allen Mitteln zu helfen. Doch was als vielversprechende Rettungsaktion gedacht war, endet fast in einer Katastrophe ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Schöne Lesestundenwünscht herzlichst
Petra Durst-Benning
Das Buch
Lauscha im Thüringer Wald, 1911. Johanna, die älteste der drei Steinmann-Schwestern, führt schon seit Jahren die Glasbläserei der Familie weiter, die durch die künstlerische Begabung von Marie, der jüngsten Schwester, zu unerwartetem Ruhm gelangt ist: Die farbenfrohen, fein verzierten Christbaumkugeln werden in der ganzen Welt geschätzt. Doch nun ist »das gläserne Paradies« in Gefahr, denn eine der wichtigsten Glashütten der Gegend soll verkauft werden. Den Lauschaer Glasbläsern droht eine Übernahme durch die reichen Großhändler. Johannas Nichte Wanda, frisch aus Amerika zurückgekehrt, ist fest entschlossen, die Glashütte zu retten. Mit Hilfe des jungen Bankangestellten David Wagner gründet sie eine Genossenschaft und investiert das mühselig zusammengekratzte Kapital der Lauschaer in ein vielversprechendes, aber auch riskantes Börsengeschäft. Doch Glück und Glas sind zerbrechlich: Was als rauschhaftes Abenteuer beginnt, endet in einer Katastrophe. Vom gläsernen Paradies bleibt nur ein Scherbenhaufen, Wanda und die Glasbläser scheinen alles verloren zu haben …
Mit Das gläserne Paradies präsentiert Petra Durst-Benning den dritten Band ihrer großen historischen Saga um die drei Steinmann-Schwestern.
Die Autorin
Petra Durst-Benning, 1965 in Baden-Württemberg geboren, ist Autorin, Übersetzerin und Dolmetscherin. Sie lebt südlich von Stuttgart auf dem Land. Die Gesamtauflage ihrer Bücher liegt inzwischen bei zwei Millionen. Mehr über Petra Durst-Benning und ihre Romane erfahren Sie unter www.durst-benning.de.
Von Petra Durst-Benning sind in unserem Hause bereits erschienen:
Die Glasbläserin · Die Amerikanerin · Das gläserne Paradies ·
Die Samenhändlerin · Floras Traum (Das Blumenorakel) ·
Die Zuckerbäckerin · Die Zarentochter · Die russische Herzogin ·
Solange die Welt noch schläft · Die Champagnerkönigin · Bella Clara ·
Die Silberdistel · Die Liebe des Kartographen · Die Salzbaronin ·
Antonias Wille · Winterwind · Mein Findelhund
Petra Durst-Benning
Das gläserne Paradies
Roman
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,
wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Neuausgabe
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch
List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.
Juni 2017
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2006/Ullstein Verlag
Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München
Titelabbildung: living4media / © Sarah Hogan
Satz: Dörlemann Satz, Lemförde
eBook-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
eBook ISBN 978-3-8437-0408-3
IN MEMORIAMAlfi
»Die Menschen, die am hellen Tag träumen,
lernen Dinge, die denen entgehen müssen,
die nur nachts träumen.«
Dante Gabriel Rosetti
PROLOG
18. September 1911
Mit steifem Rücken und versteinerter Miene ging Wanda in Richtung Bahnhof. Wie immer um diese Tageszeit herrschte dort reger Betrieb: Glasbläser aus dem nahen Lauscha, die ihre Waren bei einem Sonneberger Verleger ablieferten, Hausfrauen aus Steinach und anderen umliegenden Gemeinden, die es nach ihren Einkäufen in der großen Stadt nun eilig hatten, wieder nach Hause zu kommen, Geschäftsleute, die mit wichtiger Miene wichtige Aktenkoffer mit sich trugen. Viele der Wartenden streckten ihre Gesichter der Sonne entgegen, um die letzten wärmenden Strahlen zu genießen.
Doch Wanda spürte weder die Sonne, die für Mitte September noch ungewöhnlich warm war, noch bemerkte sie den verführerischen Geruch, der aus einer nahen Wurstbraterei herüberwehte.
Als sie endlich auf dem Bahnsteig stand, erschlaffte ihre angespannte Miene.
Aus. Vorbei. Sie brauchte keine Contenance mehr zu zeigen. Niemanden würde es mehr kümmern, ob sie heulte oder tobte oder ob ihr der Rotz aus der Nase lief wie bei einem kleinen Kind.
Aber sie heulte nicht. Und sie tobte nicht.
Sie spürte nicht einmal mehr ihre Traurigkeit, nicht die Angst und nicht die Sorge.
Denn sie hatte alles verloren.
Sie hatte die Menschen, die ihr am nächsten standen, enttäuscht, war eine Versagerin auf der ganzen Linie.
Hatte sie das nicht schon immer gewußt?
Ihr Blick heftete sich auf die Schienen. Oh, wie vertraut war ihr der Weg, den die Bahn von Sonneberg nach Lauscha nahm! In- und auswendig kannte sie diese Strecke. Kannte jede der Kurven, in denen es einen auf den harten Bänken zur Seite drückte, kannte das Stück, wo die Lokomotive zu schnaufen anfing und immer langsamer wurde. Sie wußte, wann die schattigen Stellen entlang der steilen Berghänge kamen, wo es in den Abteilen urplötzlich düster wurde.
Wie romantisch hatte sie diese Bahnstrecke stets empfunden! Genauso romantisch wie ihr Lauscha am Ende der Strecke. Eingebettet in das hochgelegene Tal, mitten im gläsernen Paradies …
Wanda stöhnte auf. Bei dem Gedanken daran, wie viele Menschen dort am Bahnhof auf sie warteten, verkrampfte sich ihr Magen. Bestimmt stand schon jetzt ein Empfangskomitee bereit, womöglich mit Wein und Gesang – warum sonst hatten die anderen darauf bestanden, ausgerechnet heute in Lauscha zu bleiben, statt sie an diesem großen Tag nach Sonneberg zu begleiten? Und diesen treuen, lieben Seelen, die ihr vertraut hatten und die nun mit ihr feiern wollten, sollte sie entgegentreten und ins Gesicht sagen, daß –
Nein, niemals! Nie mehr würde sie die Bahnstrecke entlangfahren, nie mehr würde sie in Lauscha ankommen. Für sie gab es keine Einkäufe mehr zu tätigen oder wichtige Unterlagen in wichtig aussehenden Aktenkoffern zu transportieren.
Sie war am Ende ihrer Reise angelangt. Was für ein seltsames Gefühl.
Wieviel anders hatte sich gestern noch alles angefühlt, während des feierlichen Gottesdienstes zur Einweihung der neuen Kirche in Lauscha!
In ihrem Rücken hörte sie die Geräusche des nahenden Zuges. Schon lag ein Hauch von verbrannter Kohle in der Luft. Je näher der Zug kam, desto rußgeschwängerter würde die Luft werden, und die Menschen auf dem Bahnsteig, die gerade noch so genießerisch in die Sonne schauten, würden anfangen zu prusten, und ihre Nasen würden sich kräuseln.
Erst im letzten Winter hatte sich eine junge Frau vor einen herannahenden Zug gestürzt. Ihr schrecklicher Tod hatte in allen Zeitungen Schlagzeilen gemacht. Wanda hatte sich damals nicht vorstellen können, welche Verzweiflung einen Menschen zu solch einer Tat treiben konnte. Dem Leben auf diese Art ein Ende zu setzen wäre feige, hatte sie behauptet. Sie erinnerte sich noch genau an das Gespräch mit Eva, das über diesem Thema zum Streit ausgewachsen war. Eva hatte die Selbstmörderin und ihre Verzweiflung verstanden. Als feige hätte sie einen solchen Menschen nie bezeichnet. Von den Schienen zermalmt zu werden war schließlich kein gnädiger Tod, die Gliedmaßen wurden durch tonnenschwere Lasten abgetrennt, Gedärme entblößt, der ganze Körper zermalmt … Wanda hatte davon nichts hören wollen.
Du und deine selbstherrliche Arroganz! tönte es schrill in ihren Ohren. Immer hast du geglaubt, alles allein meistern zu können. Hast dir eingebildet, besser zu sein als andere. Mehr zu können, mehr zu wissen und zu wagen.
Das Schrillen in ihren Ohren wurde lauter und lauter. Wanda drehte sich um, sah den dampfenden, schwarzen Koloß näher und näher kommen.
Aus. Vorbei. Alles verloren.
Sie machte einen Schritt nach vorn.
1. KAPITEL
Ende Mai 1911
»Entschuldigen Sie, gnädige Frau, daß ich nochmals frage, aber soll ich wirklich ›Vater unbekannt‹ eintragen?«
Mit gezückter Feder und erhobenen Brauen beugte sich der Beamte über den Tisch, schob die Geburtsurkunde dabei fast angewidert von sich. Die Sonnenstrahlen, die durch das Fenster hinter ihm fielen, verliehen seinem Haupt eine Art Heiligenschein, der so gar nicht zu der Art paßte, wie er das »gnädige Frau« aussprach.
Weder Wanda noch Johanna war sein anmaßender Ton entgangen, doch keine der beiden Frauen reagierte darauf. Was hätten sie auch sagen sollen?
Als Wanda nicht gleich antwortete, setzte der Mann noch hinzu: »Den Makel, in Schande geboren worden zu sein, verliert ein Mensch sein Leben lang nicht mehr, das ist Ihnen doch sicher bewußt? Wollen Sie das Ihrer Tochter wirklich antun?« Er machte sich keine Mühe, sein Mißfallen zu verbergen.
Wanda blinzelte.
Noch nie in ihrem Leben war sie so müde gewesen.
Ihr Blick fiel auf den Säugling auf ihrem Arm, der selig schlief – nachdem er die ganze Nacht hindurch gekräht hatte. Wie jede Nacht seit ihrer Rückkehr nach Lauscha vor fünf Tagen …
»Ja«, sagte sie mit bemüht fester Stimme.
Der Beamte seufzte. »Ich muß schon sagen, das ist eine ziemlich abenteuerliche Geschichte. Eine Amerikanerin besucht ihre Verwandtschaft in Lauscha, weilt jedoch zur Niederkunft ihres Kindes in Italien …« Abwartend, fast lauernd, starrte er über seinen Schreibtisch, auf dem kleine Staubflusen im Sonnenlicht tanzten.
Ein müdes Lächeln huschte über Wandas Gesicht.
Abenteuerlich? Was würde der Mann erst sagen, wenn er die Wahrheit wüßte? Bestimmt würde ihm der Bleistift, den er gerade so hingebungsvoll spitzte, vor Schreck aus der Hand fallen.
Die Wahrheit lautete nämlich, daß das Kind auf ihrem Arm gar nicht ihr eigenes war, sondern das ihrer Tante Marie.
Marie, der sie, Wanda, nicht mehr hatte helfen können. Die jämmerlich verreckt war.
Marie, die ihrer großen Liebe Franco nach Genua gefolgt war und dort hatte feststellen müssen, daß ihr Mann nicht nur ein Lügner, sondern auch ein Mörder war.
Marie, die aufgrund dieses Wissens von Francos Familie eingesperrt worden war wie ein Tier. Oh, der Käfig war ein goldener gewesen, das schon! Aber das hatte nichts an der Tatsache geändert, daß sie die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft hatte allein überstehen müssen, den Kopf voller Sorgen und Ängste, das Herz schwer ob des Betrugs, dem sie aufgesessen war. Weder Maries Schwestern noch Wanda hatten etwas von dieser schrecklichen Entwicklung gewußt – Marie war jeglicher Kontakt mit der Außenwelt verboten worden. Ihr Ehemann Franco war zu jener Zeit längst von der New Yorker Polizei in Haft genommen worden, nachdem Ermittlungen ergeben hatten, daß die Familie de Lucca Menschenhandel im großen Stil von Italien nach Amerika durchführte. Menschenhandel, bei dem es Tote gegeben hatte. Ihr Mann ein Mörder – allein dieses Wissen mußte Marie fast umgebracht haben.
Wanda schauderte. Reiß dich zusammen, sieh zu, daß du die Sache mit der Geburtsurkunde erledigt bekommst, sagte eine drängende Stimme in ihr, doch die Erinnerung an die schrecklichen Erlebnisse in Genua war stärker.
Wanda hatte ihre Tante nur besuchen wollen und war auf nichts Böses gefaßt gewesen. Die Hölle, in die sie dann geriet, hätte sie sich nicht in ihren schlimmsten Alpträumen vorstellen können.
Sie schaute hoch zu dem Beamten, der gerade einen zweiten Bleistift zu spitzen begann.
Noch einmal Luft holen, ein bißchen wacher werden, die Erinnerung wegschieben – dann würde sie dem Mann all die Antworten liefern, die er haben wollte. Damit sie bekam, was sie dringend haben mußte: eine rechtmäßige Geburtsurkunde für Sylvie.
Das war es, was Marie gewollt hatte.
Marie …
Wenn sie nicht aufpaßte, würde der Gedanke an die Tante ihre Tränen zum Fließen bringen, und sie würde nicht mehr aufhören können zu weinen.
Nur das nicht. Nicht in dieser stickigen Amtsstube auf dem Sonneberger Rathaus, wo zwischen staubigen Aktenmappen Tod und Leben festgehalten wurden.
Als Marie nach der Geburt starkes Fieber bekam, hatte ihnen lediglich der Arzt der Familie de Lucca zur Seite gestanden. Der Mann sprach weder Deutsch noch Englisch, so daß Wanda keine Möglichkeit hatte, sich mit ihm zu verständigen. Mehrmals hatte sie Francos Mutter, die Contessa, angefleht, man möge Marie doch in ein Krankenhaus bringen, weil es dort vielleicht bessere Mittel und Wege gab, die eitrige Entzündung und das Fieber, das daraus entstanden war, zu behandeln. Doch die Contessa hatte vehement abgelehnt und darauf bestanden, daß ausschließlich der Familienarzt Zutritt zum Krankenzimmer bekam.
Wanda schluckte. Hätte sie in diesem Punkt beharrlicher sein sollen? Hätte sie Marie nicht eigenhändig aus dem Palazzo befreien und in ein Krankenhaus schleppen können? Wäre sie dann noch am Leben? Aber wie hätte sie das bewerkstelligen sollen? Wo sie selbst es nicht einmal gewagt hatte, den Palazzo zu verlassen, aus lauter Angst, keinen Einlaß mehr zu bekommen.
Sie hatte Francos Eltern nicht getraut, genausowenig, wie sie Franco traute.
Franco … Allein der Gedanke an ihn ließ Wanda frösteln.
War er noch in Amerika? Oder war der Einfluß der Familie de Lucca groß genug, um den Sohn aus einem amerikanischen Gefängnis herauszuholen? Wußte Franco inzwischen, daß er eine Tochter hatte und daß sie, Wanda, dieses Kind von seinen schrecklichen Eltern freigekauft hatte?
Marie hatte Tagebuch geführt, und diese Aufzeichnungen durften den Palazzo nach Meinung der Familie de Lucca unter keinen Umständen verlassen. Sylvie im Austausch gegen Maries Wissen um die Schandtaten der Familie: Das war der Handel gewesen, auf den Wanda eingegangen war. Denn hätte sie Maries Tochter etwa in Italien zurücklassen sollen?
»Du mußt Sylvie nach Lauscha bringen!« hatte Marie sie angefleht. »Meine Tochter soll unter Glasbläsern aufwachsen und nicht unter Mördern!« Ihre Augen hatten zu jener Zeit schon einen seltsamen Glanz gehabt. Einen Glanz, der Wanda erschreckte. Als ob Marie von innen her glühen würde. Kurze Zeit später hatte sie die Augen für immer geschlossen.
Wanda handelte also nach Maries Letztem Willen. Aber was war mit dem Kindsvater? Wenn Franco von der Sache erfuhr, würde er nicht zulassen, daß sein Kind woanders als im elterlichen Palazzo aufwuchs, soviel war sicher.
Wanda gab sich einen Ruck. Sie verlagerte Sylvie auf ihren linken Arm, dann zog sie ein zerknittertes Papier aus ihrer Tasche.
»Das hier ist die italienische Geburtsurkunde meiner Tochter.«
Stirnrunzelnd nahm der Beamte das Dokument entgegen. »Warum haben Sie mir die nicht gleich gegeben? Nicht, daß Ihnen ausländische Papiere bei uns viel nutzen würden … Aber wenn ein solches Dokument schon von den italienischen Behörden ausgestellt wurde, erleichtert das meine Arbeit natürlich erheblich. Also, was steht denn da … Geboren am 21. Mai …« Er warf erst dem Kind einen Blick zu, dann nahm er erneut Wandas Reisepaß in die Hand und blätterte ihn durch. Man konnte förmlich sehen, wie es hinter seiner Stirn ratterte.
Johanna räusperte sich. »Sie vermuten richtig«, sagte sie mit belegter Stimme. »Meine Nichte war schon – guter Hoffnung, als sie im vergangenen Oktober bei uns eingetroffen ist. Meine Schwester Ruth hielt es für sinnvoll, ihre Tochter für unbestimmte Zeit in unsere Obhut zu geben. Wäre sie in New York geblieben, hätte dies nur für unnötiges Gerede gesorgt, Sie verstehen? Ich hab zu ihr gesagt: ›Ruth, so was kommt in den besten Familien vor, mach dir keine Sorgen!‹« Sie lachte gekünstelt.
Wanda warf ihrer Tante einen schrägen Blick zu. Ob Johanna nicht ein bißchen zu dick auftrug?
Die Mundwinkel des Mannes kräuselten sich mißbilligend.
»Und Ihre Obhut bestand also darin, ein minderjähriges, lediges Mädchen in guter Hoffnung mutterseelenallein nach Italien reisen zu lassen? Ich habe ja schon einiges gehört, aber …« Geradezu fassungslos schaute der Beamte Johanna an.
Die starrte wütend aus dem Fenster.
Wanda schmunzelte heimlich. Somit wäre also nicht nur ihr Ruf ruiniert …
»Amerika – damit hat sich die Frage nach dem Kindsvater wohl endgültig geklärt«, murmelte der Beamte und kritzelte etwas in das vor ihm liegende Formular.
Wanda seufzte erleichtert auf. Gleich würden sie es geschafft haben. Ob sie den Herrn wohl bitten konnte, das Fenster ein wenig zu öffnen? Etwas Luft täte ihr gut und –
»Und Ihre Mutter? Wo ist die eigentlich?«
Verwirrt und auch eine Spur ängstlich schaute Wanda den Beamten an. Sylvies Mutter? Glaubte der Mann immer noch nicht, daß sie Sylvies Mutter war?
Johanna räusperte sich. »Wir erwarten Wandas Mutter in den kommenden Wochen. Sie kann es kaum erwarten, ihre Tochter wieder in die Arme zu schließen. Auf ihr Enkelkind freut sie sich natürlich auch – eine große Versöhnung steht uns also ins Haus, Sie verstehen?«
Der Mann beugte sich erneut über die Geburtsurkunde und murmelte dabei etwas von »liederlichen Verhältnissen«. Im nächsten Moment schob er das Dokument über den Tisch.
»Sylvie Miles, geboren am 21. Mai 1911 in Genua, Mutter Wanda Miles, Vater unbekannt – das macht drei Mark vierzig, zahlbar gleich im Zimmer nebenan, dort bekommen Sie auch eine Quittung über diesen Betrag.«
2. KAPITEL
Nachdem sich ihr Aufenthalt im Sonneberger Rathaus so lange hingezogen hatte, war der Zug, der die drei nach Lauscha hätte bringen sollen, längst abgefahren. Bis der nächste Zug fuhr, blieb ihnen noch eine gute Stunde Zeit. Johanna schlug vor, in eine nahe gelegene Wirtschaft zu gehen. Wanda hätte lieber auf dem Bahnsteig gewartet, willigte aber schließlich ein. Es war zwar ein sonniger Tag, doch der Wind kam aus Osten und war frisch – zu frisch, um sich mit einem Säugling über eine Stunde lang auf einem zugigen Bahnsteig die Beine in den Bauch zu stehen.
»Puh, das wäre geschafft!« Johanna umklammerte ihre Kaffeetasse, als befände sich darin das kostbarste Lebenselixier.
»Was für ein schrecklicher Mensch!« sagte sie zwischen zwei Schlucken. »Dieser unverschämte Ton – unter anderen Umständen hätte der etwas von mir zu hören bekommen! Nun ja, was soll’s …« Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Jedenfalls haben wir erreicht, was wir wollten. Du bist Mutter, und ich weiß nicht, ob ich dir dazu gratulieren soll! Herr im Himmel, wo du noch nicht einmal volljährig bist …« Ein tiefer Seufzer folgte.
»Aber in einem Jahr bin ich’s!« sagte Wanda. Nachdem sie sich versichert hatte, daß Sylvie noch immer selig in ihrem Kinderwagen schlief, trank auch sie in Ruhe ihren Kaffee. Früher hatte sie das schwarze Gebräu nicht ausstehen können, aber in den Monaten, in denen sie bei Johanna und ihrer Familie gelebt hatte, änderte sie ihre Meinung. Eine Tasse Kaffee war für sie nun nicht mehr ein etwas bitteres Heißgetränk, sondern bedeutete ein bißchen Luxus in einem sonst nicht gerade luxuriösen Haushalt. Wanda schloß für einen Moment die Augen. Als sie die Lider wieder hob, sah sie, daß Johanna leise weinte.
»Wenn Marie nur nicht mit diesem schrecklichen Mann auf und davon gegangen wäre!« brach es unvermittelt aus ihr hervor. Sie preßte eine Hand vor den Mund und blinzelte heftig.
»Ach, Tante …«, sagte Wanda hilflos. Sie vermißte Marie so sehr, daß es weh tat, und hätte manchmal vor Wut über ihr Schicksal toben können. Warum ausgerechnet sie?
Marie, die Glasbläserin, deren Gesicht stets mit einem Hauch Glitzerstaub überzogen war. Marie, mit ihrer Gier nach Leben! Verscharrt in einer Steinwand auf einem Friedhof in Genua.
Nur eine Handvoll Menschen hatte der Beerdigung beigewohnt. Alles war eiligst in die Wege geleitet worden, das sähen die italienischen Gesetze so vor, hatte die Contessa Wanda erklärt. Doch sicher hatte die Eile eher damit zu tun gehabt, daß Francos Familie zusammen mit Marie auch alle unangenehmen Fragen seitens der örtlichen Behörden begraben wollte.
»Und dann diese Geschichte heute! Jetzt gibt es kein Zurück mehr, das ist dir doch wohl klar?« platzte Johanna in Wandas Gedanken und wischte sich die Tränen fort. »Mir wäre ehrlich gesagt wohler gewesen, wenn wir mit dem Gang aufs Amt gewartet hätten, bis deine Mutter da ist. Ich meine, eigentlich hätte sie ja in dieser Angelegenheit auch noch ein Wörtchen mitzureden gehabt, oder?« Sie verdrehte die Augen. »Herrje, Ruth wird mir die Hölle heiß machen, das weiß ich jetzt schon.«
»Das wird sie nicht«, erwiderte Wanda müde. Sie tippte neben sich auf die gepolsterte Bank, wo ihre Handtasche stand. »Diese Geburtsurkunde schützt Sylvie vor Franco und seiner Familie, jetzt kann niemand mehr daherkommen und uns das Kind wegnehmen. Genau das hat Marie gewollt. Mutter wird also verstehen, daß ich gar keine andere Wahl hatte.«
Johanna schüttelte den Kopf. »Es gibt immer mehr als eine Möglichkeit. Auch Peter und ich hätten die Kleine aufnehmen können, ich meine, immerhin bin ich ihre Tante!« Bei ihren letzten Worten zitterte ihre Unterlippe schon wieder verdächtig.
Wanda legte eine Hand auf ihren Arm. »Sylvie braucht uns alle, wir alle werden uns um die Kleine kümmern! Aber ich habe doch tagsüber viel mehr Zeit für sie als du. Und wenn Richard und ich erst einmal verheiratet sind, hat Sylvie eine richtige kleine Familie.«
Johanna schnaubte. »Das ist auch so eine Sache! Du weißt, daß ich Richard sehr schätze, er ist ein ausgezeichneter Glasbläser! Aber ob er auch einen ausgezeichneten Ehemann abgeben wird? Ich weiß es nicht …« Sie brach ab, als die Serviererin zwei Teller mit Apfelkuchen brachte. Kaum war die Frau wieder in der Küche verschwunden, fuhr Johanna fort, noch ehe Wanda etwas sagen konnte: »Richard ist so … versessen! Ich meine, wir haben auch tagein, tagaus mit Glas zu tun, wir leben damit, und manchmal habe ich das Gefühl, wir brauchen es zum Atmen so wie andere Menschen die Luft.« Sie schüttelte den Kopf. »Aber Richard … Bei ihm steht die Liebe zum Glas tatsächlich an oberster Stelle. Ob da noch genug Zeit und Gefühl für eine Frau oder gar eine Familie sein wird?«
Wanda hob konsterniert die Augenbrauen. »Natürlich! Was redest du denn da? Richard ist der liebenswürdigste Mann, den ich kenne! Du müßtest mal erleben, wie besorgt er um Sylvie und mich ist! Und was seine Arbeit angeht – wäre es dir lieber, ich hätte mir einen Faulpelz ausgesucht? Er ist eben sehr zielstrebig! Und ehrgeizig. Was ist daran falsch?«
Johanna winkte ab. »Nichts ist daran falsch. Trotzdem – ich glaube kaum, daß deine Mutter begeistert sein wird, wenn sie erfährt, daß ihr noch in diesem Sommer heiraten wollt. Ihr kennt euch doch gerade einmal ein halbes Jahr! Es heißt nicht umsonst: Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Schau dir doch nur Marie an …«
»Also, das kannst du nun wirklich nicht vergleichen!« erwiderte Wanda heftig. »Richard ist ein Ehrenmann, er wird immer für Sylvie und mich dasein. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte ich ihn als Vater angeben sollen – so weit geht sein Verantwortungsgefühl uns gegenüber. Er war beinahe eingeschnappt, als ich seinen Vorschlag ablehnte.«
Johanna murmelte etwas, was einer Entschuldigung glich, und stocherte dabei in ihrem Apfelkuchen herum.
Wanda nahm einen weiteren Schluck Kaffee, um gegen die erneut aufsteigende Erschöpfung anzukämpfen. Vielleicht war es ganz gut, daß sie so müde war – sonst hätte sie sich bestimmt ernsthaft mit Johanna angelegt. Statt dessen kaute sie auf ihrem Apfelkuchen herum, ohne wirklich etwas zu schmecken.
»Und dann die Tatsache, daß du bei deinem Vater wohnst und nicht bei uns …« Johanna schaute von ihrem Kuchenstück auf.
»Auch das wird böses Blut geben. Wie soll ich deiner Mutter erklären, daß du mit Sylvie nicht wieder zu uns gezogen bist?«
Wanda spürte, wie sich Ärger in ihre Müdigkeit mischte. Dieses ewige Diskutieren … Sie wußte doch auch nicht, was richtig oder falsch war, sie handelte nach Gefühl und bestem Wissen und Gewissen – war das denn ein Verbrechen? Es gab eben kein Handbuch, in dem sie hätte nachschlagen können! Sie war auch in Genua allein auf sich gestellt gewesen. Niemand hatte ihre Entscheidungen angezweifelt, alle hatten bei ihrer Heimkehr gesagt – Johanna, ihr Vater und ihre Mutter am Telefon, Richard –, sie habe richtig gehandelt. Erwachsen und besonnen. Alle hatten sie gelobt ob ihrer Tapferkeit. Aber seit sie vor fünf Tagen nach Lauscha zurückgekehrt war, hatte jeder unzählige Ratschläge für sie parat. Am liebsten hätte sie Johanna deshalb barsch abgefertigt.
»Daß ich bei Vater wohne, ist für alle die beste Lösung«, sagte sie in bemüht ruhigem Ton. »Eva tut nichts lieber, als nach Sylvie zu schauen, sie ist mir eine große Hilfe. Und Platz ist auch genügend, Vater will mir das ganze zweite Stockwerk überlassen. Und er hat sogar wieder zu heizen begonnen.« Sie lachte.
Auch Johanna schmunzelte. Thomas Heimer war noch nie ein Mann großer Worte gewesen, aber die Tatsache, daß er Ende Mai teures Brennholz verfeuerte, um seiner Tochter ein warmes Zuhause zu bieten, zeigte, wie sehr er Wanda liebte.
»Wir hätten auch noch ein Plätzchen für euch gefunden, zum Beispiel in Maries altem Zimmer«, insistierte Johanna dennoch. »Ich hätte Magnus rauswerfen können – warum der noch bei uns wohnt, ist mir sowieso schleierhaft. Als er und Marie noch zusammenwaren, war das ja keine Frage, aber er kann doch nicht ewig in Maries Kammer hausen!«
Ihre Stirn legte sich in Falten.
Auch Wanda verzog das Gesicht. Sie kannte ihre Tante gut genug, um zu wissen, daß Magnus’ Tage im Haushalt Steinmann-Maienbaum von nun an gezählt sein würden.
Trotzdem sagte sie: »Laß doch den armen Kerl in Ruhe. Er hatte genug damit zu kämpfen, daß Marie ihn wegen Franco verlassen hat. Und nun kommt noch die Trauer um sie dazu … In seiner derzeitigen Verfassung wäre er doch gar nicht in der Lage, sich eine neue Unterkunft zu suchen!«
Johanna schnaubte. »Ach, vielleicht hast du ja recht. Hör einfach nicht auf deine alte Tante! Vielleicht meckere ich heute nur, damit ich nicht dauernd anfange zu weinen. Jedenfalls …« – sie setzte sich aufrechter hin, als wolle sie ihren Worten dadurch Gewicht verleihen – »jedenfalls bist du jetzt Mutter, und ich wünsche dir alles, alles Gute!« Und schon folgte der nächste Seufzer. »Wenn nur nicht –«
Wanda unterbrach sie lachend. »Ach, Tante …«
Kurze Zeit später machten sie sich auf den Weg zum Bahnhof. Von den Kastanienbäumen, die zu beiden Seiten die Straße säumten, rieselten immer wieder kleine Blättchen der verblühenden Kerzen auf sie herab. Als Wanda Johanna ein paar Blütenblätter aus dem Haar zupfen wollte, blieb diese abrupt stehen. Sie nahm Wandas Hand.
»Fast auf den Tag genau vor sieben Monaten war ich auch auf dem Weg zum Bahnhof. Damals habe ich dich abgeholt.« Sie lachte. »Ich weiß noch alles so genau, als ob es gestern gewesen wäre. Es war eisig kalt, dein Zug hatte Verspätung, und ich habe mich auch in eine Wirtschaft gesetzt. Dabei konnte ich es nicht erwarten, dich endlich in die Arme zu schließen! Nach so vielen Jahren …«
Auch Wanda lächelte. »Sieben Monate … Mir kommt es eher vor, als wären seitdem sieben Jahre vergangen!«
War das wirklich sie gewesen? Dieses naive Kind, das im Oktober des vergangenen Jahres aus Amerika mit Unmengen von Gepäck hier eingetroffen war? Den Kopf voller Illusionen, das Herz voller Sehnsucht, endlich den leiblichen Vater kennenzulernen. Sie wollte ernst genommen werden, wollte dazugehören – wozu genau, hätte sie gar nicht sagen können. Sie wollte »wichtig« sein und nicht nur die hübsche, aber nichtsnutzige Tochter von Ruth und Steven Miles.
Kurz zuvor hatte Marie, die bei Schwester und Nichte in Amerika zu Besuch weilte, beschlossen, nicht mehr nach Lauscha zurückzukehren, sondern mit Franco nach Italien zu reisen. Zur selben Zeit hatte Wandas Cousine Anna, Johannas Tochter, sich den Knöchel verstaucht. Hierin hatte Wanda ihre Chance gewittert: Wenn sie nach Lauscha führe, könne sie Johanna helfen, hatte sie gegenüber ihrer Mutter argumentiert. Ruth war nämlich gegen diese Reise gewesen und hätte ihre Tochter lieber bei sich in New York behalten. Sie übernehme gern die Pflicht, Johanna aufzumuntern, auch für alle anderen wolle sie stets ein gutes Wort bereit haben, hatte Wanda hinzugefügt.
Wanda, die Retterin – ha!
Statt dessen war sie erst einmal fürchterlich krank geworden und Johannas Familie nur zur Last gefallen …
Wanda schüttelte sich unwillig. Was war heute nur mit ihr los? Dieses ewige Zurückschauen … Als ob es kein Morgen gäbe.
Sie war nach Lauscha gekommen, um ihren Vater kennenzulernen. Sie war gekommen, um ihren Platz im Leben zu finden. Den Platz, den sie in New York vergeblich gesucht hatte.
»Jeder Mensch hat eine Aufgabe im Leben …« Urplötzlich fielen ihr Maries Worte wieder ein. Es war ihr Abschiedsgespräch gewesen, kurz bevor sie mit Franco Richtung Europa aufgebrochen war. Wie unzählige Male zuvor hatten sie zusammen auf dem Dach des Hochhauses gehockt, in dem das Apartment der Familie Miles lag. Wie wahrhaftig Marie damals geklungen hatte!
Ihr Blick fiel in den Kinderwagen. Sylvie hatte die Augen weit aufgerissen und gab kleine quietschende Geräusche von sich.
Jetzt hatte sie, Wanda, in der Tat eine Aufgabe – durch Marie. War das nicht eine grausame Ironie des Schicksals?
Der Gedanke, künftig an Maries Stelle Mutterpflichten zu erfüllen, machte ihr ziemlich angst, auch wenn sie das Johanna gegenüber nie zugegeben hätte.
Aber sie hatte Richard an ihrer Seite, der immer für sie dasein würde, dessen Liebe sie stark und unverwundbar machte.
Wanda holte noch einmal tief Luft. Dann war es Zeit, den Zug zu besteigen, der sie nach Hause bringen würde.
Nach Lauscha.
3. KAPITEL
Es war Nachmittag, als Wanda die Tür zum Haus ihres Vaters aufstieß. Aus der Küche waren Stimmen zu hören: ihr Vater, Richard, Michel, ihr Onkel. Waren die Männer für heute schon mit ihrer Arbeit fertig? Um so besser, dachte Wanda erfreut.
Mit letzter Kraft bugsierte sie den sperrigen Kinderwagen in den Flur. Ihr Rücken war schweißnaß, das Kleid klebte unter ihren Achseln fest, verschwitzte Strähnen hingen ihr in die Stirn. Leise seufzend hob Wanda Sylvie aus dem Wagen.
In diesem Gefährt habe schon Wanda selbst gelegen, hatte Vater ihr erzählt, als er den verstaubten Wagen aus dem Lagerschuppen holte. Und daß es damals, vor zwanzig Jahren, noch höchst ungewöhnlich gewesen sei, daß eine Frau ihr Kind im Kinderwagen durch die Gegend fuhr. Aber daß für Ruth ja immer nur die neuesten Moden gut genug gewesen wären. Und daß sie schon damals ihren Kopf durchgesetzt hätte.
Ach, Mutter, hast du dich auf der steilen Hauptstraße vom Bahnhof bis hier oben auch so geplagt?
Wanda wechselte zuerst Sylvies Windeln, dann machte sie sich selbst ein wenig frisch. Sehnsüchtig schaute sie auf ihr Bett. Jetzt ein Stündchen hinlegen, die Augen schließen, nichts denken müssen, keine Fragen beantworten …
Aber unten in der Küche saß Richard, der bestimmt wissen wollte, wie es auf dem Amt gelaufen war. Richard … Der Gedanke an ihn ließ Wanda ihre Müdigkeit vergessen, und mit raschen Schritten lief sie die Treppe hinunter.
»Wanda! Gerade haben wir von dir gesprochen!« rief Thomas Heimer, als sie mit Sylvie im Arm in der Tür erschien.
Außer Richard saß auch Michel, ihr Onkel, mit am Tisch, der mit Zeichnungen übersät war. Die Sonne, die durchs Fenster ins Zimmer fiel, warf gelbe Streifen auf die Papiere.
»Wir brauchen deinen Rat«, sagte Richard und bedeutete Wanda, näher zu kommen.
Immer wenn Wanda in die Heimersche Küche trat, wunderte sie sich heimlich darüber, daß der Raum so gar nichts mehr mit der kalten, düsteren Kammer gemein hatte, die er im Winter bei ihrem ersten Besuch gewesen war. Damals war das Licht nur mühsam durch die verschmutzten Scheiben gekrochen, und erst, nachdem Wanda ihren Vater überredet hatte, die beiden riesigen Tannen direkt vor dem Küchenfenster zu fällen, war es drinnen hell geworden. Mit dem Licht kam Leben in den Raum: Die Küche wurde zum Mittelpunkt des Hauses. Wo früher lediglich Eva mit mißmutigem Gesicht herumhantierte, traf sich nun die Familie auf ein Glas Bier oder um sich auf den neuesten Stand zu bringen, was die Geschäfte anging. Der Tisch war sauber, und das Geschirr, das neben der Spüle trocknete, war es auch. Gemeinsam mit Eva hatte Wanda einen alten Schaukelstuhl neben den Tisch gestellt – hier hatte es Wilhelm Heimer bequem, wenn er an einem seiner guten Tage sein Bett verlassen konnte. Dank der neuen Aufträge ihres Vaters war der Vorratsschrank inzwischen stets gut gefüllt – die Zeiten, in denen Eva für die Suppe an Stelle von Hühnern knochige Eichhörnchen hatte auskochen müssen, waren vorbei.
Bei dem Gedanken daran verzog Wanda das Gesicht. Noch heute hatte sie den muffigen Geruch von damals in der Nase – widerlich!
»Was heckt ihr denn wieder Neues aus? Und wo ist Eva?« fragte sie, während sie gleichzeitig zu Richard auf die Bank rutschte. Sie gab ihm verstohlen nur einen Kuß, denn Liebesbekundungen in Anwesenheit ihres Vaters waren Richard unangenehm.
»Hier bin ich schon!« hörte man im nächsten Moment. »Da ist ja mein kleiner Engel …« Bevor Wanda etwas sagen konnte, langte Eva nach dem Säugling und legte ihn sich über die Schulter. »Jetzt gibt es erst einmal warme Milch, und dann fährt deine Tante Eva mit dir nach Steinach!« Und mürrisch fuhr sie an Wanda gerichtet fort: »Spät seid ihr gekommen! So spät! Das Kind ist sicher schon halb verhungert!« »
Die Sache mit der Geburtsurkunde war schwieriger, als ich gedacht habe«, sagte Wanda. Im stillen legte sie sich schon zurecht, mit welch dramatischen Worten sie die Geschehnisse auf dem Amt wiedergeben wollte, doch niemand fragte nach. Die Männer steckten die Köpfe über den Papieren zusammen und nahmen ihre Unterhaltung wieder auf.
Wanda runzelte die Stirn. Interessierte es denn niemanden, was ihr widerfahren war?
»Du willst heute noch nach Steinach?« sagte sie schließlich zu Eva. »Das Kind ist bestimmt müde, vielleicht wäre es besser, Sylvie bekäme ein wenig Ruhe und –«
»Papperlapapp!« fuhr Eva dazwischen. »Frische Luft hat noch keinem Kind geschadet. Außerdem habe ich mit meinen Schwestern ausgemacht, daß ich mir ihre alten Kindersachen anschaue – bestimmt ist für unser Goldstück noch etwas Brauchbares dabei!« Mit verklärtem Gesicht schaute sie Sylvie an.
»Aber ich –« Ich will nicht, daß Sylvie alte, kratzige Sachen, in denen womöglich schon die Motten hausen, trägt, wollte Wanda sagen. Lieber kaufe ich ihr neue, hübsche Kleidchen! Doch sie hielt wohlweislich den Mund.
»Wenn du Hunger hast, es sind noch gekochte Kartoffeln übrig und Quark!« rief Eva. Im nächsten Moment war sie samt Säugling und Nuckelflasche verschwunden.
Richard schaute von den Papieren auf.
»Was ist denn in die gefahren? Ist das tatsächlich noch die alte Kratzbürste von früher?«
»Richard«, sagte Thomas Heimer tadelnd, allerdings ohne Nachdruck in der Stimme.
Wanda lächelte. Entspannt lehnte sie sich für einen Moment zurück und schloß die Augen.
Nicht nur die Heimersche Küche war verändert, auch Eva, die Lebensgefährtin ihres Großvaters, war nicht mehr wiederzuerkennen. Ihre einstmals ständig verbiesterte Miene war nun die meiste Zeit über entspannt, fast fröhlich. Als junge Frau hatte sie sich ein Kind gewünscht, doch diesen Traum hatte sie zusammen mit vielen anderen begraben müssen. Daß das Schicksal ihr doch noch einen Säugling ins Haus gebracht hatte – auch wenn es nicht ihr eigener war –, bedeutete Eva viel.
Wanda war manches an der Art, wie die ältere Frau mit Sylvie umging, suspekt. War es wirklich gut, ein Kind so eng in ein Tuch zu binden, daß es sich kaum noch bewegen konnte? Und wäre es nicht besser gewesen, zum Waschen das Wasser anzuwärmen? Aber da Wanda es nicht besser wußte, schwieg sie meistens. Außerdem bedeutete Evas Hilfe, daß sie sich hin und wieder für einige Zeit zurücklehnen konnte. So wie jetzt …
»Sie soll sich bloß nicht zu sehr an Sylvie gewöhnen«, knurrte Richard. »Sonst ist nach unserer Hochzeit, wenn das Haus wieder still ist, das Geheule groß.«
Wanda schreckte auf. Da sie jedoch nur mit halbem Ohr dem Tischgespräch gefolgt war, blieb sie eine Erwiderung schuldig.
»Nun ja, Wanda wird uns hoffentlich oft besuchen kommen, nicht wahr? Eure Hütte ist schließlich nur ein paar Häuser von uns entfernt.«
Wanda nickte zögernd, während sie gegen das ungute Gefühl ankämpfte, das sich urplötzlich in ihrer Bauchgegend breitmachte. Natürlich sehnte sie den Tag herbei, an dem sie und Richard sich das Jawort geben würden. Tag und Nacht mit dem geliebten Mann zusammenzusein, keine heimlich ausgetauschten Zärtlichkeiten mehr, sondern innige Zweisamkeit – es fehlte ihr die Phantasie, sich dieses Glück vorstellen zu können.
Gleichzeitig machte ihr der Gedanke, für einen eigenen Haushalt verantwortlich zu sein, angst. Was, wenn sie als Hausfrau völlig ungeeignet war? Falls sie überhaupt über hausfrauliche Tugenden verfügte, so waren ihr diese Talente zumindest bisher verborgen geblieben …
Sie schüttelte sich unwillkürlich wie eine Katze, die einen unerwarteten Regenguß abbekommen hat. Um sich abzulenken, griff sie nach einem der Papierbögen.
»Noch eine Vogelfigur?« Sie hatte Mühe, nicht enttäuscht zu klingen. War es ihr immer noch nicht gelungen, ihren Vater davon zu überzeugen, daß seine alten Glasfiguren in Tierform auf dem Markt nicht mehr gefragt waren?
»Das soll ein Kuckuck sein – erkennst du das denn nicht?« gab Thomas Heimer zurück.
»Wir haben einen Auftrag von Karl-Heinz Brauninger bekommen«, kam es nun von Michel, der bisher noch keinen Ton gesagt hatte. Was nicht ungewöhnlich war. Ungewöhnlich war vielmehr die Tatsache, daß er sich überhaupt aus seinem Zimmer herausbequemt hatte. Ja, es hatte sich einiges verändert in den letzten Monaten …
»Ein Hotel im Schwarzwald will, daß wir Entwürfe für Wein- und Wassergläser, Obstteller und große Servierplatten schicken. Jedes Teil soll mit einem Kuckuck verziert sein. Warum es ausgerechnet dieser Vogel sein soll, weiß der Kuckuck!« Er lachte über seinen eigenen Scherz.
Richard hielt Wanda eine Zeichnung hin. »Ich bin dafür, die Figuren einzugravieren, vielleicht auch einzuätzen, aber dein Vater will sie auf die gute alte Art und Weise aufmalen. Was meinst du?«
Angestrengt schaute Wanda auf die fein ausgearbeitete Zeichnung, die Richards unverkennbare Handschrift trug. Ein Kuckuck? Ein Auftrag aus dem Schwarzwald? Hatten die denn nicht genügend eigene Glasbläser? Bevor sie antworten konnte, nahm Richard ihr den Entwurf schon wieder aus der Hand.
»Vielleicht wäre es am besten, einfach ein paar Musterteile unterschiedlicher Art herzustellen …«
»Ja, dann könnten wir auch gleich sehen, ob …« Munter plauderte Thomas Heimer weiter.
Entgeistert schaute Wanda von einem Mann zum anderen.
Natürlich freute sie sich über den neuen Auftrag und über die Begeisterung, die ihr Vater und Michel an den Tag legten. Die Zeiten, in denen die Flamme am Heimerschen Bolg fast gar nicht mehr glühte, lagen schließlich noch nicht lange zurück. Daß Karl-Heinz Brauninger nach dem ersten Auftrag, den sie von ihm bekommen hatten, mit Folgeaufträgen daherkam, zeigte, wie gut Thomas Heimer war.
Aber … interessierte denn wirklich niemanden, wie es ihr ging? Was auf dem Amt vorgefallen war? Warum saßen sie hier und debattierten über einen Kuckuck? Marie war tot und hatte ihr Sylvie hinterlassen! Wieso ließen die Männer sie einfach links liegen?
»Ihr seid so herzlos!« Unvermittelt brach Wanda in Tränen aus. Heulend schleuderte sie den Männern ihre Vorwürfe an den Kopf.
Thomas Heimer und sein Bruder Michel schauten sich an.
Michel räusperte sich. »Haben wir nicht noch etwas Dringendes zu erledigen?«
Thomas Heimer nickte hastig.
Schon im nächsten Moment waren Richard und Wanda allein. Er nahm sie in den Arm und wiegte sie wie ein Kind, das einen Alptraum hat. Nur langsam beruhigte sie sich.
»Du hast vollkommen recht«, murmelte er in ihr Ohr. »Wir sind wirklich eine herzlose Bande. Aber … weißt du …« Er seufzte.
Mit tränenverhangenen Augen schaute sie ihn an. »Ja?«
»Bei uns in Lauscha hat man gelernt, daß ein Unglück nicht nachläßt, indem man ewig und drei Tage darüber spricht. Es mindert viel eher den Schmerz, wenn man nach vorn schaut! Wenn man das, was einem weh tut, so schnell wie möglich vergißt.«
»Und wenn einem das nicht gelingt?« fragte Wanda mit belegter Stimme. Wie sollte sie Marie je vergessen? Sie wollte Marie nicht vergessen!
Ihr Weinkrampf hatte sie erschöpft, und sie hatte das Gefühl, nicht mehr richtig durchatmen zu können. Kraftlos holte sie Luft, brachte jedoch außer einem Gähnen nichts zustande.
»Dir bleiben doch all die schönen Momente, die du mit Marie erlebt hast! Erinnere dich an eure Zeit in New York, an all das, wovon du mir mit so strahlenden Augen erzählt hast! Diese Zeit kann dir niemand nehmen, oder?«
»Natürlich nicht.« Trotz dieses tröstlichen Gedankens blieb die Enttäuschung über das Desinteresse von Richard und ihrem Vater.
Richard hob ihr Kinn an, sein Blick suchte den ihren. »Wenn wir erst einmal verheiratet sind, wirst du eh keine Zeit mehr haben zum Trübsalblasen.« Er blinzelte sie aufmunternd an. »Dann hast du deine eigene kleine Familie, hast ein Zuhause zu versorgen und Sylvie. Und was diesen Franco angeht … Mach dir keine Sorgen. Niemand und nichts wird uns Sylvie je wegnehmen, das verspreche ich dir!«
Gedankenverloren kaute Wanda auf ihrem Daumennagel herum. Richards Worte, so wohlmeinend sie waren, schafften es nicht, ihre Trauer zu lindern. Sie weckten auch keine Zuversicht, ganz im Gegenteil, sie machten ihr fast ein bisschen angst.
»Und was ist, wenn ich das alles gar nicht schaffe?«
»Was gibt es da nicht zu schaffen? Meine Hütte ist klein, die ist also gut sauberzuhalten. Und was das Essen angeht, bin ich nicht anspruchsvoll. Herrje«, er lachte auf, »ich bin ja schon froh, wenn ich überhaupt etwas Warmes auf den Teller bekomme! Außerdem hast du ja sonst nichts zu tun. Wie du siehst, kommen dein Vater und Michel gut allein zurecht. Und mir brauchst du, was das Geschäft angeht, auch nicht zu helfen. Der Besuch der Kunstmesse in Venedig hat Gotthilf Täuber und mir interessante Verbindungen beschert, da werden sicherlich einige gute Aufträge folgen. Solange ich in Ruhe arbeiten kann und nicht ständig gestört werde, läuft alles bestens. Du kannst dich also voll und ganz Sylvie und deinen hausfraulichen Tätigkeiten widmen. Und wer weiß? Vielleicht bekommt die Kleine bald ein Geschwisterchen …«
Wanda nickte beklommen. So, wie Richard die Dinge darlegte, hörte sich wirklich alles einfach an, aber … Etwas störte sie an seinen Ausführungen, kratzte, wie ein Splitter, der versehentlich in die Haut getrieben wurde. Sie hätte nicht sagen können, was es war. Vielleicht, wenn sie nicht so müde wäre …
»Sag mal, an welchem Tag genau kommt deine Mutter an?« fragte Richard nach einer Minute des Schweigens – doch Wanda war eingeschlafen.
4. KAPITEL
Auch in den kommenden Nächten wachte Sylvie mehrmals auf und schrie wie am Spieß, bis Wanda sie fütterte, wickelte oder einfach ein wenig mit ihr redete. So urplötzlich, wie die Kleine aufwachte, schlief sie nach einiger Zeit auch wieder ein, während Wanda stundenlang wachlag, den Kopf voller Gedanken an Genua und Marie, an den Besuch ihrer Mutter und an die Hochzeitsvorbereitungen. Nach solchen Nächten war sie tagsüber wie gerädert und froh, wenn Eva ihr das Kind für ein paar Stunden abnahm. Ein Geschwisterchen für Sylvie? Darüber würde sie mit Richard noch einmal reden müssen.
Die Tage waren mittlerweile lang und hell. Die Sonne stand hoch über den steilen Berghängen und schickte ihre Strahlen auch in die hintersten Ecken von Lauscha. Dank des regenreichen Frühjahrs und des warmen Wetters in den letzten Wochen waren die Wipfel der Nadelbäume um ein gutes Stück gewachsen. Ihre hellgrünen Hauben verliehen den Wäldern ein fröhlich geschecktes Aussehen. Fenster standen sperrangelweit offen, Wäsche wurde auf kreuz und quer gespannten Leinen draußen getrocknet, Möbel zum Lüften vors Haus geschleppt.
Thomas Heimer und Michel hatten eine hölzerne Sitzbank nach draußen gestellt, so daß Wanda – den Kinderwagen neben sich – das schöne Wetter genießen konnte. Zusammen mit ihrem Großvater saß sie oft stundenlang auf der Bank, während er ihr erklärte, welcher Vogel gerade sang, zu welchen Büschen und Blumen sich die Bienen auf ihrer Nektarsuche aufmachten und daß es Marder waren, die frühmorgens im Gebüsch hinterm Haus so keifend schrieen. Wanda atmete den leicht bitteren Duft der Holunderblüten ein, bewunderte Wilhelm Heimers Wissen und die Nähe, die der alte Mann zur Natur empfand. Diese Naturverbundenheit hätten alle Waldbewohner inne, erklärte er ihr, das sei nichts Besonderes. Wer so viele Stunden an der Glasbläserflamme verbringen müsste, den dränge es in der wenigen freien Zeit nach draußen, der wolle eins werden mit Gottes Schöpfung. Viele Lauschaer bezeichneten den Wald sogar als »Doktor Wald«, was damit zusammenhing, daß viele Kräuter zu hilfreichen Heilsalben und Tinkturen verarbeitet wurden. Aber genauso heilsam sei auch ein Spaziergang im Wald, weil der Mensch dabei wieder zu sich selbst finde, behauptete der Großvater. Aus diesem Grund sei schon ein gutes Vierteljahrhundert zuvor der »Thüringer Waldverein« gegründet worden, der bis zum heutigen Tag Bestand habe.
Wie gern hätte Wanda das gleiche empfunden! Doch sosehr sie auch in ihrem Inneren forschte, sie konnte kein ähnliches Gefühl feststellen. Ein Vogel war für sie ein Vogel – daß er anders pfiff als der Vogel auf dem nächsten Baum, blieb ihren Ohren fremd. Und als sie einmal einen längeren Waldspaziergang mit Sylvie gewagt hatte, waren die Räder ihres Kinderwagens prompt auf den noch feuchten Wegen eingesunken, was ein Vorankommen äußerst schwer machte. Danach hatte sich Wanda geschworen, nur noch auf den Dorfwegen spazierenzugehen.
In New York habe ich so etwas eben nicht kennengelernt, dachte sie stumm bei sich.
Immer wieder kamen Leute vorbei, um Sylvie zu bewundern und von Wanda zu hören, wie Marie gestorben war. Für die Dorfbewohner hatten sich Wanda und Johanna eine eigene Version der Ereignisse zurechtgelegt, die besagte, daß Marie am Kindbettfieber gestorben und der Kindsvater während einer Reise ums Leben gekommen war. Es sei Maries Letzter Wille gewesen, daß sie, Wanda, das Kind nach Lauscha brachte und dort aufzog. Von Francos Verbrechen und den Qualen, die Marie durch seine schreckliche Familie hatte erleiden müssen, wußten nur die engsten Familienmitglieder. Nicht einmal Magnus, Maries früheren Lebensgefährten, hatte man eingeweiht.
Es rührte Wanda, wie freundlich die Menschen von Marie sprachen. Wie jeder sich bemühte, eine Anekdote oder eine kleine Geschichte zum besten zu geben, die mit Marie zu tun hatte. Gleichzeitig spürte sie, wie schwer dies den Leuten fiel – Marie war eine Einzelgängerin gewesen, die nur selten am dörflichen Leben teilgenommen hatte.
Als Joost Steinmann noch lebte, hatte er ein wachsames Auge auf seine drei Töchter gehabt. Weder Marie noch Johanna oder Ruth war es erlaubt gewesen, auf Tanzfeste oder andere Veranstaltungen zu gehen. Später, als Marie es wagte, das jahrhundertealte Privileg zu brechen – welches besagte, daß nur Männer Glas blasen durften, während Frauen es versilberten, bemalten und verzierten –, hatte sie das Handwerk in der Einsamkeit ihrer Hütte betrieben. Natürlich waren die Leute stolz auf Marie, die Glasbläserin, deren Christbaumkugeln in der ganzen Welt gefragt waren! Das hörte Wanda aus ihren Worten sehr wohl heraus. Was sie jedoch ebenfalls heraushörte, war, daß Maries Schaffensdrang, ihre unermüdliche Kreativität und die Art, wie sie ihren eigenen Weg gegangen war, vielen auch nach all den Jahren suspekt geblieben waren.
Wanda nahm sich vor, anders als ihre verstorbene Tante aktiv am Lauschaer Dorfleben teilzunehmen. Gleichzeitig hatte sie das beklemmende Gefühl, daß ihr genau dies nicht gelingen wollte: Als Eva und viele andere Frauen im März einen Wohltätigkeitsbasar zugunsten der neuen Kirche veranstaltet hatten, hatte Wanda außer Richard nichts im Kopf gehabt und sich mit ihren mangelnden Handarbeitsfähigkeiten aus der Sache herausgeredet. Als Mitte Mai die Fertigstellung des Kirchenrohbaus gefeiert wurde, war sie auf dem Weg nach Italien gewesen. Als am 19. Mai die neuen Glocken kamen, hatten Richard und sie trunken vor Liebe und Wein fern der Heimat geweilt. Nein, eine rührige Teilnahme am Dorfleben war das gewiß bislang nicht!
Natürlich fragten Wandas Besucher auch nach Ruth. Zumindest die älteren erinnerten sich noch gut daran, wie die mittlere der Steinmann-Schwestern vor mehr als achtzehn Jahren Lauscha samt Wanda verlassen hatte, um mit ihrem amerikanischen Liebhaber – dem Assistenten des großen Mister Woolworth – ein neues Leben in Amerika zu beginnen. Und alle erinnerten sich ebenfalls daran, wie Thomas, ihr Mann, seine Wut und seine Verzweiflung in Bier und Schnaps ertränkt hatte. Was für eine Tragödie! Was für ein Skandal!
Nun sollte Ruth zurückkommen – das Glitzern in den Augen der Leute, wenn sie nach ihrem genauen Anreisetag fragten, zeigte Wanda, daß nicht wenige mit einem neuerlichen Skandal rechneten.
Die Aufregung der Leute weckte Wanda ebenfalls aus ihrer Lethargie. Sie mußte alles dafür tun, daß Ruths Besuch in Lauscha ein Erfolg wurde. Damit die Mutter verstand, warum sie, Wanda, ihr Herz an das gläserne Paradies verloren hatte. Und an Richard natürlich.
In den nächsten Tagen hastete sie mehrmals die steile Straße vom Haus ihres Vaters hinab zu Johanna. Ruth sollte in Cousine Annas Zimmer schlafen – war dort schon alles vorbereitet? Konnte man nicht anstelle der verwaschenen Tagesdecke einen frischen geblümten Überwurf aufs Bett legen? Und würde der kleine Schrank für Ruths Gepäck reichen? Wie Wanda ihre Mutter kannte, brachte diese sicher Berge von Kleidern mit – vielleicht konnte Magnus wenigstens eine weitere Kleiderstange zwischen Fenster und Schrank anbringen?
Mit gekräuselter Nase lief Wanda durch den Raum. Täuschte sie sich, oder hing der Mief von Mottenkugeln in der Luft? Vielleicht sollte man Schalen mit getrockneten Rosenblättern aufstellen … Auf Knien rutschte sie halb unters Bett – waren wirklich die letzten Staubflusen aufgewischt worden?
Irgendwann wurde es Johanna zu bunt. In diesem Haus habe Ruth ihre Kindheit und Jugend verbracht, und es habe ihren Ansprüchen genügt. Ihre Schwester wisse, daß sie keinen Palast zu erwarten habe. Und nein, man werde nicht in der guten Stube speisen, sondern wie jeden Tag in der Küche. Für feine Tischwäsche und derlei Mätzchen habe im Hause Steinmann-Maienbaum niemand Zeit. Am Ende sagte Johanna noch, daß Wanda sie mit ihrem Geflatter an ein flügelschlagendes Huhn erinnere. Und daß sie solchen Hühnern am liebsten den Hals umdrehe …
Halb lachend und halb verärgert mußte sich Wanda Johannas Auffassung beugen.
Dann würde sie sich eben Richards Hütte vornehmen. War das nicht sowieso viel wichtiger? Mutter sollte schließlich einen guten Eindruck von ihrem neuen Zuhause gewinnen!
Auf dem Weg durch Lauscha versuchte Wanda, alles mit Ruths Augen zu sehen.
Zum Glück war es Sommer! Im Sonnenlicht erschienen die mit Schiefer ummantelten Häuser nicht gar so düster, ganz im Gegenteil, das Spiel von Licht und Schatten, von Hell und Dunkel wirkte sehr fröhlich. In den kleinen Gärten neben den Häusern lugte zartes Kohlrabi- und Möhrengrün aus der Erde, die Beete waren sauber gehackt und frei von Unkraut, soweit Wanda das beurteilen konnte. Der Kirschbaum im Garten von Karl dem Schweizer Flein war über und über mit winzigen, noch gelben Kirschen übersät, vielleicht würden die Früchte bis zu Ruths Besuch reifen? Bestimmt würde Karl ihr eine Schüssel davon abgeben – Mutter liebte Kirschen. In New York mußte Ruth dafür einen der unzähligen Feinkostläden aufsuchen. Wanda wollte ihr auf alle Fälle klarmachen, daß sie dieses einfache, ländliche Leben dem in der Großstadt vorzog.
Wanda seufzte zufrieden. Ja, so würde sie mit Mutter reden.
Aber was war das? Abrupt blieb sie stehen und runzelte die Stirn.
Mußte die Witwe Grün ihre Abfälle unbedingt direkt vor dem Haus stapeln? Und mußten die mageren Ziegen vom Nachbarhaus ausgerechnet die Löwenzahnblüten am Rande der Straße abknabbern? Die gelben Farbtupfer hätten einen solch schönen Blickfang abgegeben …
Ein paar Häuser weiter machte sie erneut halt und hielt die Nase wie ein Hund, der Witterung aufnimmt, in die Luft. Täuschte sie sich oder wehte hier der Geruch eines stillen Örtchens bis auf die Straße herüber?
Am liebsten wäre Wanda in jedes Haus gegangen, hätte den Leuten gesagt: Stellt Blumen ins Fenster! Repariert eure halbzerfallenen Gartenzäune! Bringt alles in Ordnung, damit Mutter es hier schön findet! Statt dessen hastete sie ins Oberland. Vielleicht – wenn sie Mutter auf dem Gang durch Lauscha in komplizierte Gespräche verwickelte, sie ablenkte – würden ihr solch kleine Mängel gar nicht auffallen …
Unter Richards konsterniertem Blick stellte Wanda Wiesenblumen auf den Tisch – eine Tischdecke konnte sie im ganzen Haus nicht auftreiben. Sie erwärmte Wasser und wusch unter Richards Argusaugen sämtliche Glasteile, die er auf langen Regalen wie Trophäen sammelte. Als endlich jedes Glas staub- und fleckenfrei funkelte, fiel Wandas Blick auf ein unscheinbares Metallteil über dem Herd. Das war doch … eine Backform, wahrscheinlich noch von Richards Mutter! Wanda nahm sie vom Haken und polierte sie, bis das Kupfer rotgolden glänzte. Zufrieden hängte sie die Form dann wieder über dem Herd auf. Sie klopfte die gewebten Bodenläufer so lange hinterm Haus auf einer Stange aus, bis sie in Schweiß gebadet war. Die Teppiche waren danach zwar sauber, aber ihre Farben blieben verschossen, ihre Ränder ausgefranst.
Doch an ein paar alten Teppichen würde sich Ruth bestimmt nicht stören, oder? Richard steckte seine ganzen Verdienste in sein Geschäft, zudem hatte er andere Dinge zu tun, als sein Zuhause zu schmücken. Bestimmt würde Mutter erkennen, daß eine weibliche Hand in der kleinen Hütte wahre Wunder bewirken konnte – oder?
5. KAPITEL
»Wie großzügig das alles geworden ist – ich erkenne unsere alte Werkstatt kaum wieder!« Kopfschüttelnd machte Ruth eine allumfassende Handbewegung. Die aufwendig plissierten, spitzenbesetzten Ärmel ihres Kleides kamen dabei bedenklich nahe an eine Glasbläserflamme. Hastig zog sie ihren Arm zurück.
Wanda seufzte stumm in sich hinein. War es nicht typisch Mutter, daß sie ihren ersten Auftritt in einem derart vornehmen Kleid haben mußte? Das vielleicht zu einer Theaterpremiere in New York gepaßt hätte, aber völlig deplaziert war an diesem Ort, wo am offenen Feuer gearbeitet wurde, wo ständig Leute hin und her liefen, die Arme voller Glaswaren, Kartons oder Seidenpapier, wo es nach Chemikalien stank und nach ungewaschenen Leibern.
Ruth klatschte in die Hände, und die goldenen Armbänder an ihrem Handgelenk klimperten dazu. »Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, nach so langer Zeit wieder einmal hierzusein! Diese Atmosphäre … Dieses Heimelige … In New York bekomme ich ja immer nur das Endprodukt eurer Arbeit zu sehen. Und jetzt stehe ich hier, inmitten der vielen Glasrohlinge, der Farben und des Versilberungsbads. Wie in früheren Zeiten – ach, wie traumhaft!«
Belustigt bemerkte Wanda, die mit Sylvie auf dem Arm am Fenster saß, wie Cousine Anna der Tante aus Amerika einen argwöhnischen Blick zuwarf – im Gegensatz zu ihrem Bruder Johannes, der fast ehrfürchtig auf den Gast starrte.
Johanna schmunzelte. »Das erste, was Peter und ich getan haben, als wir unsere Werkstätten zusammenlegten, war, die Wand zu Peters Haus durchzubrechen. So ist dieser große Raum hier entstanden. Aber eigentlich reicht der Platz vorne und hinten nicht mehr aus, wir überlegen seit Jahren, ob wir die ganze Produktion nicht vollständig auslagern sollten. Doch bisher …« Sie verdrehte die Augen. »Vor lauter Arbeit hab ich nicht einmal die Zeit, mich nach einem geeigneten Gebäude umzusehen.«
»Ihr könnt doch nicht allen Ernstes mit dem Gedanken spielen, unser Elternhaus zu verlassen?« Ruths Stimme hatte einen fast scharfen Ton angenommen.
Das sagte ja genau die Richtige! Wanda schaute hinüber zu Johanna, gespannt auf deren Antwort, doch die Tante zuckte nur unverbindlich mit den Schultern, was alles und nichts bedeuten konnte.
»Fünf Bolge, dazu ein eigenes Lager für Rohlinge und Fertigprodukte … Das hat wirklich nichts mehr mit Vaters alter Werkstatt gemein.« Ruth sah von ihrer Schwester zu Peter, ihrem Schwager. »Natürlich war mir klar, daß ihr heutzutage in einem ganz anderen Stil Christbaumschmuck herstellt als früher – ich meine, diese Mengen an Kugeln könnte man ja gar nicht an einem einzigen Bolg blasen. Aber daß ihr derartig professionell arbeitet …«
»Ja, man glaubt es kaum, auch bei uns ist die Zeit nicht stehengeblieben«, sagte Peter mit leicht ironischem Unterton. »Aber falls es dich beruhigt – manches ist noch genau so, wie du es von früher kennst. Komm!« Er deutete in Richtung seines speziellen Arbeitsplatzes, wo er Glasaugen für Menschen herstellte, die durch einen Unfall oder ein anderes Unglück ihr eigenes Auge verloren hatten. Doch Ruth flatterte just in diesem Moment in die andere Richtung.
»Vaters Bolg …« Vorsichtig, fast andächtig strich sie mit ihrer Hand über die geschwärzte, hölzerne Oberfläche der alten Werkbank. »Daß ihr den behalten habt! Dieser Anblick ruft so viele Erinnerungen wach …« Sie lächelte Johanna wehmütig an. »Hier hat unsere kleine Marie gesessen und ihre ersten Glaskugeln geblasen. Ganz heimlich, keiner hat etwas von ihrem Treiben geahnt, nicht einmal wir! Erinnerst du dich noch an das Weihnachtsfest, an dem sie uns mit einem geschmückten Christbaum überrascht hat? Ihre Kugeln waren so einzigartig! Silbern und mit …« Sie runzelte die Stirn.
»Tante Marie hat ihre ersten Kugeln mit weißen Eiskristallen verziert«, warf Wanda ein. »Und an Weihnachten hat Tante Johanna den Christbaum damit dekoriert. Sie sind wirklich wunderschön.«
»Diese Kugeln hängen jedes Jahr an unserem Baum, ohne sie wäre es kein Weihnachten«, fügte Johanna hinzu.
»Wie romantisch«, hauchte Ruth. Dann drückte sie Johanna einen Kuß auf die Wange. »Wie schön, daß ihr die alten Traditionen wahrt! Ach, es tut so gut, wieder zu Hause zu sein! Auch wenn der Anlaß mehr als traurig ist …« Ihr Blick wanderte hinüber zu Wanda und Sylvie. Nach einem tiefen Seufzer straffte sich ihr Körper, und ein fast verschmitztes Lächeln zeigte sich auf ihrem Gesicht.
»Weißt du noch, Johanna, wie ich damals mit Maries Kugeln nach Sonneberg gegangen bin, um sie Woolworth zu zeigen?« Sie schüttelte den Kopf. »Der große amerikanische Geschäftsmann – alle wollten Verträge mit ihm abschließen. Und dann kam ich daher mit Christbaumkugeln, die eine Frau geblasen hatte. Du meine Güte, was war ich aufgeregt! Ihn überhaupt erst einmal zu fassen zu kriegen war eine Kunst. Aber am Ende ist es mir ja gelungen.« Sie schaute triumphierend von Johanna zu Peter. »Das habt ihr mir damals nicht zugetraut, was? Daß ausgerechnet ich es sein würde, die den Karren aus dem Dreck zieht?«
Peter zuckte mit den Schultern. »Johanna war zu dieser Zeit sehr angeschlagen, sonst hätte sie bestimmt auch den Mut gehabt. Weißt du nicht mehr, was dieser elende Verleger mit ihr angestellt –«
»Peter!« unterbrach Johanna ihn. Ihre Augen funkelten wütend. »Du hast schon recht, Ruth«, sagte sie. »Was du damals getan hast, war wirklich sehr mutig. Und unsere Rettung! Aber sehr bald danach habe ich die Zügel übernommen, das mußt du mir zugestehen.«
Konsterniert schaute Wanda von einer zur anderen. Mußten die beiden ihre alten Rivalitäten jetzt schon ausgraben? Mutter war noch keinen halben Tag da! Es war doch völlig gleichgültig, wer damals welchen Stein ins Rollen gebracht hatte.
Ruth war inzwischen zum nächsten Bolg weitergegangen, wo Johannes gerade dabei war, im Akkordtempo Glaskugeln zu blasen. Ihre Finger glitten über die perfekt runden durchsichtigen Formen.
»Wie hat Marie immer gesagt: Jede Kugel ist wie eine kleine Welt. Es gibt kein Oben und kein Unten, es gibt keinen Anfang und kein Ende …« Sie verstummte. Dann sprach sie stockend weiter: »Und jetzt … hat ausgerechnet Maries Leben so … so … ein jähes Ende genommen!« Unvermittelt rannen Tränen über Ruths Gesicht. Sie griff nach Johannas Händen und schaute ihre Schwester eindringlich an.
»Was waren wir für eine eingeschworene Gesellschaft! Die drei Steinmänner haben sie uns immer genannt. Nichts und niemand kam zwischen uns. Das stimmt doch, oder?«
Johanna nickte stumm.
»Und dann … am Ende … haben wir gar nichts für Marie tun können. Sie … sie war ganz allein!«
Hastig schaukelte Wanda Sylvie auf ihrem Arm hin und her. Hoffentlich würde die Kleine nicht auch noch anfangen zu weinen!
»Ach, Ruth, Marie war doch nicht allein, Wanda war bei ihr – Gott sei Dank. Wenn mich eines tröstet, dann ist es das!« sagte Johanna mit gepreßter Stimme und nahm Ruth in den Arm.
Wanda schaute auf die beiden Frauen in der Mitte des Raumes und fühlte sich seltsam allein.
Seit der Ankunft ihrer Mutter kam sie sich vor wie die Zuschauerin eines Schauspiels, in dem Ruth die Hauptrolle übernommen hatte. An die Seite gedrängt, zur Untätigkeit verdammt, nicht mehr richtig wahrgenommen. Da tat es gut, Johannas Worte zu hören.
Auch die anderen Rollen schienen perfekt verteilt worden zu sein: Da war Johanna, die sich ihre eigene Trauer nicht anmerken lassen und für Ruth stark sein wollte. Da war Cousine Anna, die, als Ruth ihre neuen Entwürfe für Christbaumkugeln lobte, Sätze sagte wie: »Wir haben uns mit einigem arrangieren müssen …« und dabei einen giftigen Seitenblick auf Wanda warf. Dann gab es Johannes, der nur sprachlos glotzte und seinen Freunden später erzählen würde, daß die »Amerikanerin«, wie Wanda im Dorf genannt wurde, nichts war im Vergleich zu ihrer Mutter.
Peter war eigentlich der einzige, der sich wie immer benahm. Er hatte Ruth begrüßt wie die alte Kameradin aus Jugendzeiten, die sie für ihn war – herzlich und völlig unkompliziert.
Und was Wandas Rolle anging … Natürlich hatte die Mutter sie umarmt und so fest an sich gedrückt, als wolle sie sie nie mehr loslassen. Sie hatte Sylvie bewundert – nicht ohne gleichzeitig ihre feingezupften Brauen mißbilligend nach oben zu ziehen, als ihre Hände dabei das rauhe, abgetragene Kleidchen des Kindes berührten. »Endlich bist du da, Mutter!« hatte Wanda ihr ins Ohr geflüstert. Arm in Arm waren sie ins Haus spaziert, Wanda schon auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen für sie beide. Sie hatte der Mutter so viel zu erzählen! Von Marie, von Richard – und ihren Heiratsplänen –, von der Tatsache, daß sie im Oberland, im Haus von Thomas Heimer wohnte … Das alles wollte sie der Mutter erzählen. Wegen all dieser Fragen war sie doch gekommen, oder?
Statt dessen hatte Ruth zur Verblüffung aller den Wunsch geäußert, als erstes der alten Werkstatt einen Besuch abzustatten. Und da waren sie nun, während nebenan in der Küche der von Johanna gebackene Kuchen wartete und der Kaffee kalt wurde.
Ruth und Johanna weinten immer noch eng umschlungen. Hilflos schaute Peter zu den beiden Frauen hinüber. »Wenn bloß dein Vater, äh, ich meine Steven, hätte mitkommen können«, flüsterte er in Wandas Richtung. Laut sagte er: »Vielleicht würde eine Tasse Kaffee helfen …« Doch er brach ab, als im selben Moment Sylvie zu plärren begann.
Abrupt löste sich Ruth aus Johannas Umarmung. »Das arme Waisenkind! Ob die Werkstatt der richtige Ort für so ein kleines Würmchen ist?« Der Vorwurf in ihren Worten war nicht zu überhören.
»Sylvie ist die Tochter einer Glasbläserin, natürlich ist die Werkstatt der richtige Ort für sie! Du hast sie mit deinem Weinen angesteckt, sonst fehlt ihr nichts. Außerdem – ich habe als Säugling auch viel Zeit in der Werkstatt verbracht, hast du mir das nicht selbst erzählt?«
»Das waren doch ganz andere Zeiten.« Ruth machte eine abwehrende Handbewegung.
»Aber wenn wir schon dabei sind …« Wanda räusperte sich. »Weißt du schon, wann du der Heimerschen Werkstatt einen Besuch abstatten willst? Auch dort hat sich einiges verändert.« Unwillkürlich hielt sie den Atem an.
»Der … Heimerschen Werkstatt?« Ruths Lippen kräuselten sich. »Wozu? Sollte ich Thomas einmal auf der Straße über den Weg laufen, kann ich nichts daran ändern. Ansonsten sehe ich keinen Grund, ihn aufzusuchen.«