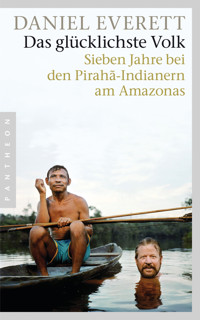
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vom Missionar zum Bekehrten
Als Daniel Everett 1977 mit Frau und Kindern in den brasilianischen Urwald reiste, wollte er als Missionar den Stamm der Pirahã, der ohne Errungenschaften der modernen Zivilisation an einem Nebenfluss des Amazonas lebt, zum christlichen Glauben bekehren. Er begann die Sprache zu lernen und stellte schnell fest, dass sie allen Erwartungen zuwiderläuft. Die Pirahã kennen weder Farbbezeichnungen wie rot und gelb noch Zahlen, und folglich können sie auch nicht rechnen. Sie sprechen nicht über Dinge, die sie nicht selbst erlebt haben – die ferne Vergangenheit also, Fantasieereignisse oder die Zukunft. Persönlicher Besitz bedeutet ihnen nichts.
Everett verbrachte insgesamt sieben Jahre bei den Pirahã, fasziniert von ihrer Sprache, ihrer Sicht auf die Welt und ihrer Lebensweise. Sein Buch ist eine gelungene Mischung aus Abenteuererzählung und der Schilderung spannender anthropologischer und linguistischer Erkenntnisse. Und das Zeugnis einer Erfahrung, die das Leben Everetts gründlich veränderte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Daniel L. Everett
Das glücklichste Volk
Sieben Jahre bei den Pirahã-Indianern am Amazonas
Aus dem Englischen von Sebastian Vogel
Pantheon
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Don’t Sleep, There are Snakes. Life and Language in the Amazonian Jungle« bei Pantheon Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Pantheon Verlag ist ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Alle Fotos: © Martin Schoeller
Copyright © 2008 Daniel Everett
Copyright © 2010 für die deutsche Ausgabe by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Jorge Schmidt, München
Redaktion: Claudia Jürgens, Berlin
Satz: DTP im Verlag
ISBN 978-3-641-32889-4V001
www.pantheon-verlag.de
Dieses Buch handelt von Ereignissen in der Vergangenheit. Im Leben geht es aber um Gegenwart und Zukunft. Deshalb widme ich dieses Buch meiner Frau Linda Ann Everett, die mich ständig ermutigt. Liebe ist etwas Wunderbares.
Inhalt
Vorbemerkung
Prolog
Teil I LEBEN
1Die Welt der Pirahã
2Das Amazonasgebiet
3Der Preis der Jüngerschaft
4Manchmal macht man Fehler
5Materielle Kultur und das Fehlen von Ritualen
6Familie und Gemeinschaft
7Die Natur und die Unmittelbarkeit des Erlebens
8Ein Teenager namens Túkaaga: Mord und Gesellschaft
9Das Land für ein freies Leben
10Caboclos: Bilder aus dem brasilianischen Leben am Amazonas
Teil II SPRACHE
11Kanalwechsel mit Pirahã-Klängen
12Pirahã-Wörter
13Wie viel Grammatik braucht ein Mensch?
14Werte und Gespräche: die Partnerschaft von Sprache und Kultur
15Rekursion: Sprache als russische Puppe
16Krumme Köpfe, gerade Köpfe: Sichtweisen auf Sprache und Wahrheit
Teil III SCHLUSS
17Der Missionar wird bekehrt
Epilog: Warum kümmern wir uns um andere Kulturen und Sprachen?
Anmerkungen zur Pirahã-Sprache
Dank
»So lernte ich meine erste große Lektion über die Forschung auf diesen abgelegenen Wissensgebieten: Miss dem Unglauben großer Männer oder ihren Vorwürfen der Anmaßung oder der Dummheit nicht das geringste Gewicht bei, wenn sie im Widerspruch zur wiederholten Beobachtung von Tatsachen durch andere, zugegebenermaßen geistig gesunde und ehrliche Männer stehen. Die gesamte Geschichte der Wissenschaft zeigt es uns: Wenn die gebildeten Männer der Wissenschaft eines Zeitalters die Tatsachen anderer Forscher von vornherein mit der Begründung der Absurdität oder Unmöglichkeit geleugnet haben, hatten die Leugner immer unrecht.«
Alfred Russel Wallace (1823 – 1913)
»Die Vorstellung, dass das Wesen des Menschseins sich am deutlichsten in jenen Aspekten der menschlichen Kultur zeigt, die allgemeingültig sind, nicht aber in denen, die typisch für dieses Volk oder jenes sind, ist ein Vorurteil, das wir nicht teilen müssen … Vielleicht finden sich gerade in den kulturellen Besonderheiten der Menschen – in ihren Seltsamkeiten – einige äußerst aufschlussreiche Erkenntnisse darüber, was es eigentlich heißt, ein Mensch zu sein.«
Clifford Geertz (1926 – 2006)
Vorbemerkung
Wissenschaft besteht nicht nur darin, dass eine Gruppe von Forschern in weißen Kitteln unter der Leitung eines herausragenden Wissenschaftlers arbeitet. Auch im Alleingang können Männer und Frauen in schwierigen Zeiten und an schwierigen Orten Wissenschaft betreiben; dabei fühlen sie sich vielleicht allein und überfordert, und doch reizt sie die Herausforderung, trotz so vieler Probleme neues Wissen zu erwerben.
Von solchen wissenschaftlichen Bemühungen handelt dieses Buch. Es beschreibt geistiges Wachstum im Schmelztiegel der Amazonaskultur und ein Leben unter den Pirahã-Indianern (sprich: Pi-da-HAN) Brasiliens. Im Mittelpunkt stehen sie und das, was ich – wissenschaftlich und persönlich – von ihnen gelernt habe, neue Ideen, die mein Leben tief greifend verändert und mich zu einer neuen Lebensweise angeleitet haben.
Es sind meine Lektionen. Ein anderer hätte zweifellos etwas anderes gelernt. Zukünftige Wissenschaftler werden ihre eigenen Geschichten zu erzählen haben. Am Ende ist es immer am besten, wenn wir einfach und klar reden können.
Prolog
»Schau! Da ist er, Xigagaí, der Geist.«
»Ja, ich sehe ihn. Er bedroht uns.«
»Kommt alle her, seht euch Xigagaí an! Er ist am Strand!«
Ich erwache aus tiefem Schlaf. Habe ich geträumt oder tatsächlich dieses Gespräch mit angehört? Es ist halb sieben morgens an einem Samstag im August, in der Trockenzeit des Jahres 1980. Die Sonne scheint bereits, es ist aber noch nicht allzu heiß. Eine warme Brise weht vom Maici herauf, dem Fluss vor meiner bescheidenen Hütte, die auf einer Lichtung am Ufer steht. Ich öffne die Augen und sehe über mir das mit Palmwedeln gedeckte Dach, dessen Gelb vom Staub und Ruß vieler Jahre grau geworden ist. Beiderseits meiner Behausung stehen zwei ähnlich gebaute, aber kleinere Hütten der Pirahã. Dort wohnen Xahoábisi, Kóhoibiíihíai und ihre Familien.
Schon oft habe ich den Morgen bei den Pirahã erlebt, wenn der schwache Rauchgeruch von ihren Herdfeuern herüberweht und die brasilianische Sonne mein Gesicht wärmt. Ihre Strahlen werden von meinem Moskitonetz gedämpft. Normalerweise lachen die Kinder, spielen Fangen oder weinen lautstark, weil sie gestillt werden wollen. Überall im Dorf hallen die Geräusche wider. Hunde bellen. Wenn ich hier die Augen aufschlage und benommen aus einem Traum in die Wirklichkeit trete, starrt mich häufig ein Pirahã-Kind oder auch ein Erwachsener an. Sie spähen zwischen den paxiuba-Palmenmatten hindurch, die die Seitenwände meiner großen Hütte bilden. Aber heute Morgen ist es anders.
Ich bin jetzt völlig bei Bewusstsein, aufgeweckt durch den Lärm und die Rufe der Pirahã. Ich setze mich auf und sehe mich um. Ungefähr sechs Meter von meinem Lager entfernt, auf der Uferböschung des Maici, hat sich eine Menschenmenge versammelt. Alle schreien und gestikulieren energisch. Sie schauen ans andere Ufer, auf eine Stelle gegenüber von meiner Hütte. Ich stehe auf, um besser sehen zu können – an Schlaf ist bei dem Lärm ohnehin nicht mehr zu denken.
Ich hebe meine Sporthose vom Boden auf und achte genau darauf, dass sich keine Taranteln, Skorpione, Hundertfüßer oder andere unerwünschte Gäste in ihr niedergelassen haben. Ich ziehe sie an, schlüpfe in meine Flipflops und trete aus der Tür. Die Pirahã stehen in lockeren Gruppen gleich rechts von meiner Hütte am Flussufer. Ihre Erregung wächst. Ich sehe, wie Mütter den Weg hinuntereilen, während ihre Kinder sich bemühen, die Brust im Mund zu behalten.
Die Frauen tragen die ärmel- und kragenlosen, halblangen Kleidungsstücke, die sie bei der Arbeit wie auch beim Schlafen anhaben. Von Staub und Rauch sind sie dunkelbraun. Die Männer sind in Turnhosen oder Lendentücher gekleidet. Keiner von ihnen hat Pfeil und Bogen bei sich – ich bin erleichtert. Kleine Kinder sind nackt, ihre Haut ist ständig den Elementen ausgesetzt und ledrig-braun. Die Babys haben Hornhaut am Gesäß, weil sie dauernd auf dem Boden herumrutschen, eine Art der Fortbewegung, die sie aus irgendeinem Grund gegenüber dem Krabbeln bevorzugen. Alle sind fleckig von Asche und Staub, die sich auf ihnen ansammeln, wenn sie schlafen oder auf dem Boden am Feuer sitzen.
Noch ist die Luft zwar feucht, aber nur um die zwanzig Grad warm; gegen Mittag werden es 38 Grad sein. Ich reibe mir den Schlaf aus den Augen. Dann erkundige ich mich bei Kóhoi, meinem wichtigsten Sprachlehrer, was da los ist. Er steht rechts von mir. Sein kräftiger, schlanker brauner Körper ist angespannt angesichts dessen, was er betrachtet.
»Siehst du ihn nicht da drüben?«, fragt er ungeduldig. »Xigagaí, eines der Wesen, die über den Wolken wohnen. Er steht am Strand und schreit uns an, sagt uns, dass er uns töten wird, wenn wir in den Dschungel gehen.«
»Wo?«, frage ich. »Ich kann ihn nicht sehen.«
»Na, genau da«, gibt Kóhoi gereizt zurück und starrt auf die Mitte des offenkundig leeren Strandes.
»Im Dschungel hinter dem Strand?«
»Nein! Da am Strand. Sieh doch!«, erwidert er empört.
Wenn ich mit den Pirahã im Dschungel bin, übersehe ich regelmäßig Tiere, die ihnen auffallen. Meine unerfahrenen Augen sehen einfach nicht so gut wie ihre.
Hier ist es anders. Selbst ich kann erkennen, dass da auf dem weißen, höchstens hundert Meter entfernten Sandstrand nichts ist. Aber so sicher ich mir auch bin, die Pirahã sind sich genauso sicher, dass dort etwas ist. Vielleicht war etwas da, was ich nicht gesehen habe, aber sie bestehen darauf, dass Xigagaí auch jetzt noch dort ist.
Immer noch blicken alle zum Strand. Neben mir höre ich Kristene, meine sechsjährige Tochter, sagen: »Was gucken die da alle, Papa?«
»Ich weiß nicht. Ich kann nichts sehen.«
Kris stellt sich auf die Zehenspitzen und schaut über den Fluss. Dann sieht sie mich an. Dann die Pirahã. Sie ist genauso verwirrt wie ich.
Kristene und ich gehen zurück in unsere Hütte. Was habe ich da gerade miterlebt? Seit jenem Sommermorgen sind mehr als zwanzig Jahre vergangen, und immer noch bin ich mit einer Frage nicht im Reinen: Was bedeutet es, dass zwei Kulturen, unsere ursprünglich europäische und die der Pirahã, die Realität so unterschiedlich wahrnehmen können? Ich hätte den Pirahã nie beweisen können, dass der Strand leer war. Und ebenso wenig hätten sie mich davon überzeugen können, dass sich dort irgendetwas befand, und erst recht kein Geist.
Für mich als Wissenschaftler ist Objektivität einer der höchsten Werte. Früher glaubte ich, wir müssten uns nur genug Mühe geben, dann könnten wir die Welt genauso sehen wie andere und leichter lernen, fremde Ansichten zu respektieren. Aber wie ich bei den Pirahã erfahren habe, können unsere Erwartungen, unsere Kultur und unsere Erfahrungen dazu führen, dass schon die Wahrnehmung unserer Umwelt über die Kulturgrenzen hinweg sich kaum in Einklang bringen lässt.
Die Pirahã sagen unterschiedliche Sätze, wenn sie abends meine Hütte verlassen und ins Bett gehen. Manchmal erklären sie einfach: »Ich gehe.« Manchmal bedienen sie sich aber auch einer Formulierung, die, so überraschend sie auch anfangs war, zu einer meiner liebsten Arten des Gutenachtsagens geworden ist: »Schlaf nicht, hier gibt es Schlangen.« Die Pirahã sagen das aus zwei Gründen. Erstens glauben sie, dass sie sich durch weniger Schlaf »abhärten« können, was ihnen allen sehr wichtig ist. Zweitens wissen sie, dass sie im Dschungel von Gefahren umgeben sind; wenn sie tief schliefen, wären sie also schutzlos den vielen Raubtieren in der Umgebung ihres Dorfes ausgeliefert. Die Pirahã lachen und reden bis tief in die Nacht. Sie schlafen nie lange am Stück. Ich habe nur selten erlebt, dass es nachts im Dorf einmal völlig still war oder dass jemand mehrere Stunden durchgeschlafen hat. Ich habe im Laufe der Jahre viel von den Pirahã gelernt, aber dies war vielleicht meine Lieblingslektion: Sicher, das Leben ist hart und voller Gefahren. Es kann dazu führen, dass wir von Zeit zu Zeit etwas zu wenig schlafen. Aber es macht auch Spaß. Es geht immer weiter.
Als ich zu den Pirahã kam, war ich 26 Jahre alt. Jetzt bin ich alt genug, um Seniorenvergünstigungen in Anspruch zu nehmen. Ich habe ihnen meine Jugend geschenkt. Ich habe mich viele Male mit Malaria angesteckt. Ich kann mich erinnern, dass Pirahã und andere mehrmals mein Leben bedrohten. Ich habe so viele schwere Kisten, Taschen und Fässer auf dem Rücken durch den Dschungel geschleppt, dass ich mir nicht mehr die Mühe mache, mich an alle zu erinnern. Aber alle meine Enkel kennen die Pirahã. Dass meine Kinder so und nicht anders sind, liegt zum Teil an den Pirahã. Und wenn ich einige dieser alten Männer (sie sind so alt wie ich) ansehe, die einst gedroht haben, mich umzubringen, so erkenne ich in ihnen heute einige meiner engsten Freunde – Männer, die nun ihr Leben für mich aufs Spiel setzen würden.
Über drei Jahrzehnte hinweg habe ich immer wieder bei den Pirahã gelebt und sie studiert. Dieses Buch handelt von dem, was ich dabei gelernt habe. Ich habe getan, was ich konnte, um zu begreifen, wie sie die Welt sehen, verstehen und darüber reden, und ich habe mich bemüht, diese Erkenntnisse meinen Wissenschaftskollegen zu vermitteln. Mein Weg hat mich an viele Orte von verblüffender Schönheit geführt, aber auch in Situationen, die ich lieber vermieden hätte. Dennoch bin ich glücklich, dass ich diese Reise unternommen habe: Sie hat mir kostbare, nützliche Erkenntnisse über Leben, Sprache und Denken geliefert, die ich auf keine andere Weise hätte gewinnen können.
Die Pirahã haben mir gezeigt, dass es Würde und tiefe Zufriedenheit mit sich bringt, wenn man sich ohne den Trost des Himmels und ohne die Angst vor der Hölle mit Leben und Tod auseinandersetzt und dem großen Abgrund mit einem Lächeln entgegengeht. Solche Dinge habe ich von den Pirahã gelernt, und dafür werde ich ihnen dankbar sein, solange ich lebe.
Teil I
LEBEN
1Die Welt der Pirahã
Es war ein sonniger Morgen in Brasilien, dieser 10. Dezember 1977. In einem sechssitzigen Passagierflugzeug, das meine Missionsbehörde, das Summer Institute of Linguistics (SIL), zur Verfügung gestellt hatte, warteten wir auf den Start. Dwayne Neal, der Pilot, nahm vor dem Flug die üblichen Überprüfungen vor. Er ging um das Flugzeug herum und vergewisserte sich, dass die Ladung gleichmäßig verteilt war. Er suchte nach äußerlich erkennbaren Schäden. Er zog ein kleines Gefäß aus dem Kraftstofftank und sah nach, ob kein Wasser im Benzin war. Er prüfte den Propeller. Seine Routinekontrolle ist für mich heute genauso normal wie das Zähneputzen vor dem Weg zur Arbeit, aber damals war es das erste Mal.
Als wir bereit zum Abflug waren, dachte ich über die Pirahã nach, den Stamm der Amazonasindianer, bei dem ich leben würde. Was mache ich hier eigentlich?, dachte ich. Wie soll ich mich verhalten? Ich fragte mich, wie diese Menschen wohl reagieren würden, wenn sie mich zum ersten Mal sähen. Und wie würde ich auf sie reagieren? Ich würde mit Menschen zusammentreffen, die in vielerlei Hinsicht anders waren als ich – manche Unterschiede konnte ich vorhersehen, andere nicht. Nun ja, eigentlich flog ich nicht nur dorthin, um sie kennenzulernen. Ich kam als Missionar zu den Pirahã. Mein Gehalt und meine Reisekosten wurden von den evangelikalen Kirchen in den Vereinigten Staaten bezahlt, damit ich »die Herzen der Pirahã veränderte« und sie dazu brachte, den Gott anzubeten, an den ich glaubte. Sie sollten die Moral und die Kultur annehmen, die sich mit dem Glauben an den christlichen Gott verbinden. Obwohl ich die Pirahã noch nicht einmal kannte, war ich überzeugt, dass ich sie verändern kann und verändern sollte. Das ist der Hintergrund nahezu jeder Missionstätigkeit.
Dwayne nahm auf dem Pilotensitz Platz, und wir alle senkten die Köpfe, während er für einen sicheren Flug betete. Dann rief er »Livre!« (Portugiesisch für »Zurücktreten«) aus dem Pilotenfenster und ließ den Motor an. Während die Maschine warmlief, sprach er mit dem Kontrollturm von Porto Velho, und dann rollten wir zur Startbahn. Porto Velho, die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Rondônia, sollte für mich zum Ausgangspunkt aller weiteren Reisen zu den Pirahã werden. Am Ende der nicht asphaltierten Piste beschrieben wir eine Kurve, und Dwayne gab Gas. Die Maschine beschleunigte, die rostrote Erde des cascalho (Schotter) verschwamm und blieb dann schnell unter uns zurück.
Ich sah zu, wie das gerodete Land rund um die Stadt dem Dschungel wich. Je zahlreicher die Bäume wurden, desto mehr schrumpften die freien Flächen. Wir flogen quer über den gewaltigen Fluss Madeira (Holz), und nun war der Wandel vollkommen: Ein Meer aus grünen, brokkoliförmigen Bäumen erstreckte sich in allen Richtungen bis zum Horizont. Mir fiel ein, wie viele Tiere da unten sein mussten, genau unter uns. Angenommen, wir stürzten ab und überlebten – würde ich dann von einem Jaguar gefressen? Es gibt viele Geschichten über Absturzopfer, die nicht durch den Unfall selbst, sondern von wilden Tieren getötet wurden.
Mein Ziel war eine der am wenigsten erforschten Bevölkerungsgruppen der Welt, die eine der ungewöhnlichsten Sprachen spricht – jedenfalls wenn man nach den Spuren urteilt, die enttäuschte Linguisten, Anthropologen und Missionare hinterlassen haben. Soweit man weiß, ist Pirahã mit keiner anderen lebenden Sprache verwandt. Ich wusste eigentlich nur, wie sie sich auf Tonband anhört und dass frühere Linguisten und Missionare, die sich mit dieser Sprache beschäftigt hatten, irgendwann zu anderen Forschungsgebieten übergegangen waren. Sie klingt ganz anders als alles, was ich jemals gehört hatte. Es schien, als sei diese Sprache völlig unzugänglich.
Je mehr wir an Höhe gewannen, desto kühler wurde die Luft, die aus der kleinen Düse über meinem Sitz kam. Ich versuchte es mir bequem zu machen. Während ich mich zurücklehnte, dachte ich darüber nach, was ich vorhatte und dass die Reise für mich eine ganz andere Bedeutung hatte als für die übrigen Passagiere. Der Pilot ging seiner täglichen Arbeit nach und würde zum Abendessen wieder zu Hause sein. Sein Vater war als Tourist mitgekommen. Mein Begleiter, der Missionar und Mechaniker Don Patton, machte einen Kurzurlaub von der anstrengenden Aufgabe, das Anwesen der Mission instand zu halten. Ich dagegen war auf dem Weg zu meiner Lebensaufgabe. Zum ersten Mal würde ich den Menschen begegnen, mit denen ich den Rest meines Daseins teilen wollte, Menschen, die ich hoffentlich mit in den Himmel nehmen würde. Dazu musste ich lernen, ihre Sprache fließend zu sprechen.
Als das Flugzeug von den Aufwinden des späten Vormittags – die für das Amazonasgebiet in der Regenzeit typisch sind – durchgerüttelt wurde, unterbrach eine akute Sorge unsanft meine Träumereien. Ich wurde reisekrank. Während wir in den nächsten 105 Minuten bei starkem Wind über den Regenwald flogen, war mir entsetzlich übel. Gerade als mein Magen sich wieder ein wenig beruhigt hatte, reichte Dwayne ein Thunfischsandwich voller Zwiebeln nach hinten. »Hat einer von euch Hunger?«, fragte er hilfsbereit. »Nein, danke.« Ich hatte noch den Geschmack von Magensaft im Mund.
Schließlich kreisten wir über der Landepiste nicht weit von dem Pirahã-Dorf Posto Novo. Der Pilot wollte sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Durch das Flugmanöver verstärkte sich die Zentrifugalkraft in meinem Magen, und ich musste meine ganze Willenskraft aufwenden, um mich nicht zu übergeben. Während einiger düsterer Augenblicke vor der Landung ging mir der Gedanke durch den Kopf, ein Absturz mit nachfolgender Explosion sei immer noch besser als diese ständige Übelkeit. Zugegeben: Es war ein recht kurzsichtiger Gedanke, aber er war einfach da.
Die Landepiste im Dschungel war erst zwei Jahre zuvor von Steve Sheldon, Don Patton und einer Gruppe junger Leute aus US-amerikanischen Kirchen gerodet worden. Um eine solche Urwaldpiste zu bauen, muss man zuerst einmal über tausend Bäume fällen. Anschließend müssen die Stümpfe entfernt werden, denn sonst verrottet das Holz im Boden, die Erde über dem Stumpf gibt nach, und ein Flugzeug verliert das Fahrwerk und vielleicht auch alle Passagiere. Wenn man die rund tausend Baumstümpfe – manche davon mit einem Durchmesser von einem Meter oder mehr – aus dem Boden geholt hat, füllt man die Löcher auf. Dann muss man dafür sorgen, dass die Landepiste so eben ist, wie man es ohne schweres Gerät bewerkstelligen kann. Wenn alles klappt, ist am Ende eine zwanzig Meter breite und 600 bis 700 Meter lange Piste fertig. Ungefähr diese Ausmaße hatte auch die Landebahn bei den Pirahã, auf der wir jetzt aufsetzten.
Am Tag unserer Ankunft stand hüfthohes Gras auf der Piste. Ob sich darunter Baumstämme, Hunde, Fässer oder andere Dinge befanden, die das Flugzeug – und uns – beschädigen könnten, wussten wir nicht. Dwayne »fegte« einmal über die Piste und hoffte, dass die Pirahã verstanden, was auch Steve ihnen erklärt hatte: Sie sollten hinlaufen und die Piste nach gefährlichem Müll absuchen. (Einmal hatten die Pirahã mitten auf der Piste ein Haus gebaut. Es musste erst abgerissen werden, bevor wir landen konnten.) Tatsächlich liefen mehrere Pirahã los, und wir sahen sie mit einem kleinen Baumstamm von der Piste kommen – er war nicht groß, aber wenn das Flugzeug bei der Landung darauf gestoßen wäre, hätte es sich überschlagen. Am Ende ging alles gut, und Dwayne legte eine sichere, glatte Landung hin.
Als die kleine Maschine schließlich zum Stillstand gekommen war, trafen mich die windstille Hitze und Feuchtigkeit des Dschungels mit voller Wucht. Benommen und blinzelnd stieg ich aus. Die Pirahã umringten mich, plapperten laut, lächelten und zeigten anerkennend auf Dwayne und Don. Don versuchte den Pirahã auf Portugiesisch klarzumachen, dass ich ihre Sprache lernen wollte. Sie sprachen zwar so gut wie kein Portugiesisch, aber ein paar Männer kamen auf den Gedanken, ich sei als Ersatz für Steve Sheldon gekommen. Auch Sheldon hatte geholfen, sie auf meine Ankunft vorzubereiten: Bei seinem letzten Besuch hatte er ihnen auf Pirahã erklärt, dass ein kleiner, rothaariger Bursche kommen und bei ihnen wohnen werde. Er hatte ihnen gesagt, ich wolle lernen, so zu sprechen wie sie.
Als wir den Pfad von der Landepiste zum Dorf entlanggingen, stand mir das Sumpfwasser zu meiner Überraschung bis zu den Knien. Ich trug das Gepäck durch das warme, schlammige Wasser, ohne zu wissen, wer oder was mich in die Füße und Beine beißen würde. Zum ersten Mal erlebte ich den Wasserstand des Maici am Ende der Regenzeit.
Eines ist mir von meiner ersten Begegnung mit den Pirahã am stärksten in Erinnerung geblieben: Alle schienen glücklich zu sein. Jedes Gesicht zierte ein Lächeln. Anders als so oft bei kulturübergreifenden Begegnungen wirkte hier niemand gleichgültig oder zurückhaltend. Die Menschen zeigten auf dies und das, redeten begeistert mit mir und wollten mich auf Dinge aufmerksam machen, die ich nach ihrer Ansicht interessant finden könnte: Vögel über unseren Köpfen, Pfade für die Jäger, die Hütten im Dorf, junge Hunde. Manche Männer trugen Kappen mit den Parolen und Namen brasilianischer Politiker, bunte Hemden und kurze Sporthosen, die sie von schwimmenden Händlern bekommen hatten. Die Frauen waren alle gleich gekleidet: kurze Ärmel, der Kleidersaum knapp über dem Knie. Ursprünglich hatten ihre Kleidungsstücke unterschiedliche, bunte Muster gehabt, aber jetzt waren die Farben vom blassen Braun des Erdbodens in ihren Hütten überdeckt. Kinder im Alter bis zu zehn Jahren liefen nackt herum. Alle lachten. Manche kamen zu mir und berührten mich sanft, als wäre ich ein neues Haustier. Eine herzlichere Begrüßung hätte ich mir nicht wünschen können. Die Menschen nannten mir ihre Namen, die meisten konnte ich mir aber nicht merken.
Der erste Mann, an dessen Namen ich mich noch erinnere, war Kóxói (KO-oi). Ich sah ihn rechts vom Pfad auf einer hellen Lichtung hocken. Neben einem Feuer, das in der Sonne brannte, war er mit irgendetwas beschäftigt. Kóxói trug ausgefranste Turnhosen, aber weder Hemd noch Schuhe. Er war dünn und nicht sonderlich muskulös. Die dunkelbraune Haut war faltig wie feines Leder, die breiten Füße mit den dicken Hornschwielen sahen kräftig aus. Er blickte zu mir auf und rief mich zu sich: Auf einem Stück glühend heißem Sandboden sengte er das Fell von einem großen, rattenähnlichen Tier ab. Auf seinem freundlichen Gesicht strahlten Mund und Augen in einem Lächeln, das mich an diesem Tag der neuen Erfahrungen an einem neuen Ort willkommen hieß und tröstete. Er sprach mich freundlich an, ich verstand aber kein einziges Wort. Mir war immer noch übel, und der stechende Geruch des Tiers ließ mich fast würgen. Die Zunge des Kadavers hing aus der Schnauze, ihre Spitze berührte die Erde, Blut tropfte daran herunter.
Ich berührte mich selbst an der Brust und sagte »Daniel«. Er erkannte, dass es sich um meinen Namen handelte, deutete sofort auf seine Brust und nannte den seinen. Dann zeigte ich auf das Nagetier am Feuer.
»Káixihí« (Kai-i-hii) benannte er das Objekt, auf das ich gedeutet hatte.
Ich wiederholte das Wort sofort (wobei ich dachte: Heiliger Zwanzig-Pfund-Rattenhamburger!). Sheldon hatte mir erklärt, dass es sich wie beim Chinesischen, Vietnamesischen und bei Hunderten anderen um eine tonale Sprache handelte. Ich musste also nicht nur auf Vokale und Konsonanten achten, sondern auch genau auf die Tonlage der einzelnen Vokale hören. Es war mir gelungen, das erste Wort auf Pirahã auszusprechen.
Als Nächstes bückte ich mich, hob einen Stock auf, zeigte darauf und sagte: »Stock.«
Kóxoí lächelte und erwiderte: »Xií« (iI).
Ich wiederholte: »Xií.« Dann ließ ich ihn fallen und sagte: »Ich lasse den xií fallen.«
Kóxói sah mich an, dachte nach und sagte dann schnell: »Xií xi bigí káobíi« (iI ich bigI KAoBIi). (Wie ich später erfuhr, bedeutet das wörtlich: »Stock es Boden fällt«, in genau dieser Reihenfolge der Wörter.)
Ich wiederholte auch das. Dann zog ich einen Notizblock und einen Stift heraus, die ich mir in Porte Velho genau zu diesem Zweck in die Gesäßtasche gesteckt hatte, und schrieb alles in internationaler Lautschrift auf. Den letzten Satz übersetzte ich mit »Stock fällt auf den Boden« oder »Du lässt den Stock fallen«. Dann nahm ich einen zweiten Stock und ließ beide gleichzeitig fallen.
Er sagte: »Xií hoíhio xi bigí káobíi«, »Zwei Stöcke fallen auf den Boden« – jedenfalls dachte ich das damals. Später lernte ich, dass es »Eine geringfügig größere Menge (hoíhio) von Stöcken fällt auf den Boden« bedeutet.
Nun nahm ich ein Blatt und begann mit der ganzen Prozedur von vorn. Ich ging zu anderen Verben wie »springen«, »sitzen«, »schlagen« und so weiter über; die ganze Zeit diente Kóxoí mir als bereitwilliger und zunehmend begeisterter Lehrer.
Ich hatte mir die Sprache oft auf Tonbändern angehört, die ich von Steve Sheldon erhalten hatte, und ich hatte auch einige von ihm zusammengestellte kurze Wortlisten gesehen. Die Sprache war mir also nicht völlig unbekannt, Sheldon selbst hatte mir allerdings den Rat gegeben, seine Vorarbeit zu ignorieren: Er war sich ihrer Qualität nicht sicher, und tatsächlich war es ein großer Unterschied, ob man die Sprache hörte oder in geschriebener Form vor sich sah.
Als Nächstes wollte ich herausfinden, wie gut ich die Intonation heraushören konnte. Deshalb fragte ich nach Wörtern, von denen ich wusste, dass sie sich vor allem in der Tonlage unterscheiden. Ich erkundigte mich nach dem Wort für »Messer«.
»Kaháíxíoi« (ka-HAI-I-oi), sagte er.
Dann nach dem Wort für »Pfeilschaft«.
»Kahaixíoi« (ka-hai-I-oi), erwiderte er, als ich auf den Pfeil neben seiner Hütte zeigte.
Bevor ich nach Brasilien kam, habe ich beim SIL sehr gute Kurse in Feldforschung besucht und bei mir selbst ein Talent für die Linguistik entdeckt, das ich zuvor nicht gekannt hatte. Nachdem ich eine Stunde mit Kóxoí und anderen gearbeitet hatte (wir waren von interessierten Pirahã umgeben), konnte ich frühere Befunde Sheldons und seines Vorgängers Arlo Heinrichs bestätigen: Es gibt im Pirahã nur ungefähr elf Phoneme, der Grundaufbau der Sätze folgt dem Prinzip SOV (Subjekt, Objekt, Verb), das unter den Sprachen der ganzen Welt die häufigste Reihenfolge darstellt, und die Verben sind sehr kompliziert (heute weiß ich, dass zu jedem Verb mindestens 65 000 verschiedene Formen möglich sind). Allmählich erschien mir die Situation weniger beunruhigend. Ich konnte es schaffen!
Neben der Sprache wollte ich auch die Kultur dieser Menschen kennenlernen. Zuerst sah ich mir die Anordnung ihrer Häuser an. Der Grundriss des Dorfes schien auf den ersten Blick keinem sinnvollen Prinzip zu folgen. Ansammlungen von Hütten befanden sich an verschiedenen Stellen entlang des Pfades, der von der Landepiste zu Steve Sheldons ehemaliger – und jetzt meiner – Unterkunft führte. Irgendwann wurde mir aber klar, dass alle Hütten auf der dem Fluss zugewandten Seite des Weges standen. Alle konnten den Fluss von einer Biegung bis zur nächsten überblicken. Sie waren nah am Ufer – keine stand weiter als zwanzig Schritte vom Wasser entfernt – und in Längsrichtung parallel zu ihm errichtet. Jedes Haus war von Dschungel und Unterholz umgeben. Insgesamt waren es ungefähr zehn Hütten. In dieser Dorfgemeinschaft wohnten Brüder nebeneinander (wie ich später erfuhr, lebten in anderen Dörfern die Schwestern nebeneinander, und in wieder anderen gab es offenbar keinen Zusammenhang zwischen Verwandtschafts- und Wohnverhältnissen).
Nachdem wir unser Gepäck ausgeladen hatten, gingen Don und ich daran, in Sheldons Lagerraum ein wenig Platz für unseren kleinen Proviantvorrat zu schaffen. Er bestand aus Speiseöl, Tütensuppen, Corned Beef in Dosen, Instantkaffee, Salzgebäck, einem Laib Brot sowie ein wenig Reis und Bohnen. Nachdem Dwayne und sein Vater sich umgesehen und ein paar Fotos gemacht hatten, begleiteten wir sie zum Flugzeug. Als sie abhoben, winkten Don und ich ihnen nach. Die Pirahã schrien vor Begeisterung, als das Flugzeug sich in die Luft erhob, und riefen »Gahióo xibipíío xisitoáopí« (Das Flugzeug hat uns nach oben verlassen).
Es war jetzt ungefähr 14 Uhr. Zum ersten Mal spürte ich die Welle der Energie und die Abenteuerlust, die sich am Maici bei den Pirahã ganz von selbst einstellen. Don ging zu dem Sears-&-Roebuck-Fischerboot, das Steve hergebracht hatte, einem breiten, stabilen Aluminiumfahrzeug mit einer Ladekapazität von fast einer Tonne. Er ließ es zu Wasser, um den Außenbordmotor auszuprobieren. Ich setzte mich im vorderen Zimmer von Sheldons Haus – das wie eine größere Pirahã-Hütte gebaut war – zu einer Gruppe von Männern. Das Haus stand auf Stelzen und hatte nur halbhohe Wände – es gab keine Türen und keine Privatsphäre außer im Kinderschlafzimmer und im Lagerraum. Ich holte Notizblock und Stift heraus, um den Sprachunterricht fortzusetzen. Alle Männer sahen sportlich, schlank und kräftig aus – sie schienen nur aus Muskeln, Knochen und Sehnen zu bestehen. Sie lächelten über das ganze Gesicht, und fast hatte es den Anschein, als wollten sie sich gegenseitig in ihrem Ausdruck von Fröhlichkeit überbieten. Mehrmals wiederholte ich meinen Namen: Daniel. Nachdem die Männer die Köpfe zusammengesteckt hatten, stand einer von ihnen mit Namen Kaaboogí auf und sprach mich in sehr gebrochenem Portugiesisch an: »Pirahã chamar você Xoogiái« (Die Pirahã werden dich OO-gi-Ai nennen). Damit hatte ich meinen Pirahã-Namen.
Dass die Pirahã mir einen neuen Namen geben würden, wusste ich: Wie Don mir erklärt hatte, tun sie das bei jedem Besucher, denn sie sprechen die fremdartigen Namen nicht gern aus. Später erfuhr ich, dass sie sich bei der Auswahl des Namens von der Ähnlichkeit leiten lassen, die der Fremde nach ihrer Wahrnehmung mit einem der Pirahã hat. Unter den Anwesenden war damals ein junger Mann namens Xoogiái, und ich musste zugeben, dass man zwischen ihm und mir eine gewisse Ähnlichkeit erkennen konnte. Der Name Xoogiái sollte mich während der nächsten zehn Jahre begleiten; dann erklärte mir Kaaboogí, der nun Xahóápati hieß, mein Name sei mittlerweile zu alt und ich werde ab sofort Xaíbigaí heißen. (Nochmals sechs Jahre später wurde ich wiederum umbenannt und erhielt meinen heutigen Namen Paóxaisi – so heißt ein sehr alter Mann.) Auf diesem Wege erfuhr ich, dass die Pirahã ihren Namen von Zeit zu Zeit wechseln, insbesondere wenn sie ihn mit den Geistern tauschen, die ihnen im Dschungel begegnen.
Auch die Namen der anderen anwesenden Männer erfuhr ich: Kaapási, Xahoábisi, Xoogiái, Baitigií, Xaikáibaí, Xaaxái. Die Frauen standen vor der Hütte und blickten herein. Sie weigerten sich, etwas zu sagen, aber wenn ich sie direkt ansprach, kicherten sie. Ich schrieb verschiedene Sätze auf: »Ich lasse den Bleistift fallen«, »Ich schreibe auf Papier«, »Ich stehe auf«, »Mein Name ist Xoogiái« und so weiter.
Mittlerweile hatte Don den Bootsmotor gestartet, und nun liefen alle Männer eilig hinaus: Sie wollten mitfahren, und er drehte auf dem Fluss vor dem Haus ein paar Runden. Als ich mich im Dorf umsah, war ich plötzlich ganz allein. Ich stellte fest, dass es keinen zentralen Dorfplatz gab: Nur zwei oder drei Hütten standen, fast im Dschungel verborgen, nebeneinander und waren mit den anderen Häusern des Dorfes durch schmale Fußwege verbunden. Ich roch den Rauch der Feuer in den Hütten. Hunde bellten. Babys weinten. Um diese Nachmittagszeit war es sehr heiß. Und sehr feucht.
Nachdem ich jetzt bei den Pirahã arbeitete, war ich entschlossen, so schnell und sorgfältig wie möglich neue Erkenntnisse über ihre Sprache zu sammeln. Aber jedes Mal, wenn ich einen einzelnen Pirahã fragte, ob ich mit ihm »Papier markieren« (Untersuchungen anstellen – kapiiga kaga-kai) könne, ließ er sich zwar freundlich befragen, er erzählte mir aber auch von einem anderen Pirahã, mit dem ich ebenfalls arbeiten sollte. Dazu sagte er: »Kóhoibiíihíai hi obáaxáí. Kapiiga kaagakaáíbaaí.« Das verstand ich schon: Es gebe jemanden namens Kóhoibiíihíai, der mir beibringen werde, Pirahã zu sprechen. Ich fragte meinen Missionarskollegen, ob er jemanden mit diesem Namen kannte.
»Ja. Die Brasilianer nennen ihn Bernardo.«
»Warum Bernardo?«, wollte ich wissen.
»Die Brasilianer geben allen Pirahã portugiesische Namen, weil sie die Namen in deren Sprache nicht aussprechen können.« Dann fuhr er fort: »Ich nehme an, aus dem gleichen Grund geben auch die Pirahã allen Fremden Pirahã-Namen.«
Also wartete ich den ganzen Tag, bis Bernardo/Kóhoibiíihíai von der Jagd zurückkam. Als die Sonne allmählich unterging, sprachen die Pirahã auf einmal laut miteinander und zeigten auf die am weitesten entfernte Flussbiegung stromabwärts. Im schwindenden Licht erkannte ich die Silhouette eines Kanus, mit dem ein Mann in Richtung des Dorfes paddelte. Er hielt sich dicht am Ufer, um die starke Strömung in der Mitte des Maici zu meiden. Die Pirahã aus dem Dorf riefen dem Mann im Kanu etwas zu, und er antwortete. Die Leute lachten und waren aufgeregt, aber ich hatte keine Ahnung, warum. Als der Mann sein Kanu am Ufer festgemacht hatte, erkannte ich den Grund für die Begeisterung: Auf dem Boden des Kanus lagen ein Stapel Fische, zwei tote Affen und ein großes Hokkohuhn.
Ich ging am schlammigen Ufer entlang zu dem Kanu und sprach den zurückgekehrten Jäger an. Dabei übte ich einen Satz, den ich am Nachmittag gelernt hatte: »Tii kasaagá Xoogiái« (Mein Name ist Xoogiái). Die Arme über der Brust verschränkt, blickte Kóhoi (die Pirahã kürzen Namen ganz ähnlich ab, wie es die Engländer tun) mich an und brummte etwas. Kóhois Gesicht wirkte eher afrikanisch, im Gegensatz zu den asiatischen Gesichtszügen vieler Pirahã – Kaaboogí zum Beispiel erinnerte mich an einen Kambodschaner. Kóhoi hatte krause Haare, eine hellbraune Haut und Stoppeln am Kinn. Er hatte sich im Kanu gemütlich zurückgelehnt, aber seine angespannten Muskeln verrieten, dass er jederzeit zu schnellen Bewegungen bereit war, während er mich durchdringend musterte. Er wirkte kräftiger als andere Pirahã, aber soweit ich erkennen konnte, war er nicht größer oder stämmiger als die anderen Männer aus dem Dorf. Sein kantiger Unterkiefer und der feste Blick verliehen ihm eine Aura von Selbstbewusstsein und Macht. Als andere Pirahã gelaufen kamen und etwas zu essen holen wollten, verteilte er Stücke der Tiere, und gleichzeitig gab er Anweisungen, wer welchen Teil bekommen sollte. Er trug eine orangefarbene Hose, aber weder Schuhe noch Hemd.
Am zweiten Tag fing ich an, mit Kóhoi zu arbeiten. Vormittags saßen wir an einem Tisch im vorderen Raum von Sheldons großer Dschungelhütte. Nachmittags schlenderte ich durch das Dorf und befragte verschiedene Pirahã nach ihrer Sprache. Nach wie vor bediente ich mich der linguistischen Standardmethode, mit der man Daten sammelt, wenn man keine gemeinsame Sprache spricht: Ich zeigte auf etwas, fragte nach den Wörtern in der Sprache der Einheimischen und schrieb auf, was sie mir antworteten – wobei ich hoffte, dass es die richtige Antwort war. Dann übte ich das Erlernte sofort mit anderen Einheimischen.
Zu den Dingen, die mich am Pirahã von Anfang an faszinierten, gehörte das Fehlen der »phatischen« Kommunikation, wie man sie in der Linguistik nennt – eines sprachlichen Austauschs, der vorwiegend dazu dient, die sozialen und zwischenmenschlichen Bindungen aufrechtzuerhalten oder, wie es manchmal formuliert wird: den Gesprächspartner zu erkennen und zu bestätigen. Ausdrücke wie »Hallo«, »Auf Wiedersehen«, »Wie geht es Ihnen?«, »Tut mir leid«, »Gern geschehen« oder »Danke« vermitteln oder beschaffen keine neuen Informationen über die Welt, sondern sie sind ein Zeichen für guten Willen und gegenseitigen Respekt. Eine solche Form der Kommunikation ist in der Kultur der Pirahã nicht erforderlich. Ihre Sätze sind im Wesentlichen entweder eine Bitte um Information (Fragen), Mitteilungen neuer Informationen (Erklärungen) oder Anweisungen. Wörter für »Danke«, »Entschuldigung« und Ähnliches gibt es nicht. Ich habe mich im Laufe der Jahre daran gewöhnt und vergesse meistens, wie überraschend dies für Außenstehende sein kann. Jedes Mal, wenn ich mit einem Besucher zu den Pirahã komme, werde ich gefragt, wie man solche Dinge sagt. Und jeder Besucher blickt mich misstrauisch an, wenn ich erkläre, dass es eine solche Form der Kommunikation bei den Pirahã nicht gibt.
Wenn ein Pirahã ins Dorf kommt, sagt er oder sie vielleicht: »Ich bin angekommen.« Aber in der Regel sagt man überhaupt nichts. Wenn man einem anderen etwas gibt, sagt dieser manchmal: »Das ist richtig« oder »Es ist in Ordnung«, aber damit ist eher eine Bestätigung der Transaktionen als ein »Danke« gemeint. Dankbarkeit wird unter Umständen später ausgedrückt, vielleicht durch ein Gegengeschenk oder durch einen unerwarteten Gefallen, beispielsweise wenn man einem anderen hilft, etwas zu tragen. Das Gleiche gilt, wenn jemand einen anderen beleidigt oder verletzt hat. Ein Wort für »Entschuldigung« gibt es nicht. Man kann zwar »Ich war schlecht« oder etwas Ähnliches sagen, aber das geschieht nur selten. Auch Reue wird nicht mit Worten, sondern mit Taten ausgedrückt. Selbst in westlichen Kulturkreisen bestehen im Ausmaß der phatischen Kommunikation beträchtliche Unterschiede. Als ich Portugiesisch lernte, hörte ich von Brasilianern häufig: »Ihr Amerikaner sagt viel zu oft ›danke‹.«
An meinem zweiten Nachmittag im Dorf der Pirahã, nach einem langen Tag mit Sprachunterricht, machte ich mir eine Tasse starken, heißen Instantkaffee, setzte mich auf den Rand einer steilen Uferböschung und blickte auf den Maici hinaus. Einige Pirahã-Männer waren mit Don im Boot zum Angeln hinausgefahren, deshalb war es im Dorf ziemlich ruhig. Es war ungefähr 17.45 Uhr, die schönste Zeit des Tages, wenn die Sonne orange leuchtet und die dunkel spiegelnde Oberfläche des Flusses sich von der rostroten Farbe des Himmels und dem üppigen Dunkelgrün des Dschungels abhebt. Als ich müßig dasaß und an meinem Kaffee nippte, fielen mir plötzlich zwei Delphine auf, die gleichzeitig aus dem Fluss sprangen. Ich hatte keine Ahnung, dass es Süßwasserdelphine gibt. Im nächsten Augenblick schossen zwei Kanus mit Pirahã um die Flussbiegung. Die Männer paddelten mit aller Kraft hinter den Delphinen her und versuchten, sie mit ihren Paddeln zu erreichen. Sie spielten Fangen – Delphinefangen.
Auch die Delphine hatten offenbar Spaß daran: Immer wieder tauchten sie knapp außerhalb der Reichweite der Kanufahrer aus dem Wasser auf. Eine halbe Stunde ging das so, dann machte die Dunkelheit der Jagd ein Ende. Die Pirahã in den Booten und am Ufer (wo sich mittlerweile eine Menschenmenge versammelt hatte) lachten hysterisch. Als sie die Jagd einstellten, verschwanden die Delphine. (Ich habe solche Wettbewerbe jahrelang beobachtet und nie gesehen, dass ein Delphin »abgeklatscht« worden wäre.)
Ich musste daran denken, wo ich hier eigentlich saß und was für ein Privileg es war, mich in dieser großartigen Welt der Pirahã und der Natur aufzuhalten. Schon an den beiden ersten Tagen hatte ich so unendlich viel Neues erlebt – unter anderem hatte ich die quietschend-metallischen Geräusche der Tukane und das raue Geschrei der Aras gehört. Ich hatte die Düfte von Bäumen und Blumen gerochen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte.
An den folgenden Tagen sah ich den Pirahã bei ihren Alltagstätigkeiten zu und zwischendurch arbeitete ich immer wieder an ihrer Sprache. Die Pirahã stehen früh auf, meist schon gegen fünf Uhr. Aber bei Menschen, die nachts so wenig schlafen, stellt sich ohnehin die Frage, ob sie den Tag beginnen oder ob sie ihn nie beenden. Jedenfalls wurde ich morgens in der Regel wach, weil Frauen aus dem Dorf sich aus ihren Hütten heraus unterhielten. Laut und ohne sich an jemand Bestimmtes zu wenden, sprachen sie über die Ereignisse des Tages. Eine Frau kündigte an, dieser oder jener werde auf die Jagd oder zum Angeln gehen, und dann sagte sie, was für Fleisch sie sich wünsche. Darauf antworteten andere Frauen aus ihren Hütten oder sie nannten ebenfalls ihre kulinarischen Vorlieben.
Die Männer beschäftigen sich nach Tagesanbruch meistens mit dem Fischfang. Noch bevor es hell wird, machen sie sich auf den Weg zu den besten Fanggründen, die sich einige Stunden zu Fuß stromaufwärts oder stromabwärts befinden. Ist damit zu rechnen, dass der Angelausflug über Nacht dauert, nehmen sie ihre Familie mit. Normalerweise gehen sie aber allein oder mit einem oder zwei Freunden. Hat das abfließende Flusswasser einen Tümpel gebildet, sammeln sich dort mehrere Männer, denn ein solches Gewässer ist voller Fische, für die es keinen Fluchtweg mehr gibt. Gefischt wird meist mit Pfeil und Bogen, Schnur und Haken kommen aber ebenfalls zum Einsatz, wenn jemand sie sich durch Tauschhandel beschaffen konnte. Die Männer paddeln meist frühmorgens im Dunkeln aus dem Dorf, wobei sie laut lachen und sich mit ihren Kanus zu Wettrennen herausfordern. Mindestens ein Mann bleibt aber immer im Dorf und führt Aufsicht.
Wenn die Männer weg sind, machen sich Frauen und Kinder auf den Weg, um Nahrung zu sammeln oder Maniok – auch Kassava oder Yuca genannt – aus ihren Gärten im Dschungel zu holen. Das dauert Stunden und ist harte Arbeit. Es erfordert Ausdauer, aber die Frauen begeben sich (wie die Männer) lachend und scherzend in den Wald. Am frühen Nachmittag sind sie in der Regel wieder im Dorf. Sind die Männer dann noch nicht zurück, sammeln sie Brennholz für die Zubereitung der Fische, die hoffentlich bald eintreffen werden.
Dieser erste Besuch bei den Pirahã dauerte nur wenige Tage. Im Dezember 1977 mussten alle Missionare auf Anweisung der brasilianischen Regierung die Reservate verlassen. Wir mussten packen. Ich hatte allerdings ohnehin nicht vorgehabt, lange zu bleiben, sondern ich wollte mir nur einen ersten Eindruck von den Pirahã und ihrer Sprache verschaffen. Und ein wenig hatte ich in jenen zehn Tagen bereits gelernt.
Als ich nun gezwungenermaßen das Dorf verließ, fragte ich mich, ob ich jemals zurückkehren würde. Auch beim Summer Institute of Linguistics machte man sich Sorgen und wollte einen Weg finden, um das Missionsverbot der Regierung zu umgehen. Deshalb bat mich das SIL, mich an der Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) des brasilianischen Bundesstaates São Paulo für das Graduiertenkolleg in Linguistik einzuschreiben. Man hoffte, UNICAMP werde von den Behörden trotz des allgemeinen Berufsverbots für Missionare die Genehmigung für einen längeren Forschungsaufenthalt bei den Pirahã für mich erhalten. Aber obwohl ich die Hochschule vorwiegend deshalb besuchte, weil ich mir die Genehmigung für einen neuen Besuch im Pirahã-Dorf beschaffen wollte, erwies sie sich als das beste akademische und intellektuelle Umfeld, das ich jemals erlebt hatte.
Meine Arbeit bei der UNICAMP hatte den vom SIL erhofften Erfolg. Der Präsident der nationalen brasilianischen Indianerstiftung (FUNAI), General Ismarth de Araujo Oliveira, gestattete mir die Rückkehr zu den Pirahã. Zusammen mit meiner Familie durfte ich sechs Monate bleiben und Daten für meine Master-Arbeit an der UNICAMP sammeln. Mit meiner Frau Keren, unserer siebenjährigen Tochter Shannon, unserer vierjährigen Tochter Kris und unserem einjährigen Sohn Caleb bestieg ich im Dezember in São Paulo einen Bus nach Porto Velho. Unser erster Familienausflug zu den Pirahã hatte begonnen. Drei Tage dauerte die Fahrt nach Porto Velho, wo eine Gruppe von SIL-Missionaren stationiert war, die uns bei der Reise zum Dorf der Pirahã helfen würden. Wir blieben eine Woche in der Stadt, bereiteten uns auf das Dorf vor und machten uns geistig bereit für das bevorstehende Abenteuer.
Sich auf das Leben in einem Dorf am Amazonas einzustellen ist für eine Familie aus dem Westen nicht einfach. Die Vorbereitungen hatten schon Wochen zuvor begonnen. In PV, wie die Missionare Porto Velho nannten, kauften wir unsere Vorräte. Keren und ich mussten überschlagen, was wir in den sechs Monaten in der Einsamkeit des Dschungels brauchen würden, um dann alles einzukaufen und vorzubereiten. Vom Waschpulver bis hin zu Geburtstags- und Weihnachtsgeschenken musste alles auf Monate im Voraus geplant werden. Während des größten Teils der Zeit, die wir zwischen 1977 und 2006 bei den Pirahã verbrachten, waren wir nahezu allein für die medizinische Versorgung der Familie wie auch der Pirahã verantwortlich; also gaben wir vor jeder Reise mehrere hundert Dollar für Medikamente von Aspirin bis zu Schlangengift-Antiserum aus. Ganz oben auf unserer Liste standen alle möglichen Malariapräparate – Daraprim, Chloroquin und Chinin.
Wir mussten Schulbücher und Lehrmaterialien mitnehmen, damit wir unsere Kinder in dem Dorf unterrichten konnten. Jedes Mal, wenn wir aus dem Dorf nach Porto Velho zurückkamen, wurden sie an der Schule des SIL geprüft, die ihrerseits vom US-Bundesstaat Kalifornien zugelassen war. Die Bücher (darunter eine mehrbändige Enzyklopädie und ein Wörterbuch) und anderes Schulmaterial gehörten zu dem umfangreichen Inventar, das wir für unseren Haushalt brauchten: Hunderte von Litern Benzin, Petroleum und Propan, ein propanbetriebener Kühlschrank, Dutzende und Aberdutzende von Dosen mit Fleisch, Milchpulver, Mehl, Reis, Bohnen, Toilettenpapier, Tauschwaren für die Pirahã und so weiter.
Nach allen Einkäufen und sonstigen Vorbereitungen entschloss ich mich, zusammen mit dem Missionar Dick Need eine Woche früher als meine Familie ins Dorf zu fliegen, um dort das Haus für die Ankunft der Kinder vorzubereiten. Dick und ich schufteten jeden Tag von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends, wobei wir uns fast ausschließlich von Paranüssen ernährten. (Wir hätten von den Pirahã zwar Fisch bekommen können, aber ich kannte ihre Kultur noch nicht gut genug und wusste nicht, ob unsere Bitte als aufdringlich empfunden würde. Deshalb entschieden wir uns für die Paranüsse, die von den Pirahã freigebig angeboten wurden.) Lebensmittel hatten wir noch nicht mitgebracht, denn die Werkzeuge allein waren schon so schwer, dass wir im Flugzeug nichts zu essen mitbringen konnten. Wir reparierten Dach und Fußboden von Sheldons Hütte und bauten eine neue Küche. Mehrere Tage waren wir auch mit Macheten unterwegs, um mithilfe einiger Pirahã das Gras auf der Landepiste zu schneiden, bevor die Cessna kam. Ich wusste, dass der erste Eindruck vom Haus zumindest für meine Kinder entscheidend mit darüber bestimmen würde, ob sie bleiben wollten. Ohnehin verlangte ich viel von ihnen: Sie sollten ihre Freunde und das Leben in der Stadt hinter sich lassen, im Dschungel bei einem Volk leben, das sie nicht kannten, und eine Sprache hören, die keiner von uns beherrschte.
An dem Tag, als meine Familie eintreffen sollte, war ich schon vor dem Morgengrauen wach. Beim ersten Tageslicht ging ich die Landepiste ab und sah nach, ob sie Löcher hatte. Dort taten sich ständig neue Bodenvertiefungen auf. Außerdem suchte ich sie sorgfältig nach größeren Holzstücken ab, beispielsweise Brennholz, das die Pirahã vielleicht liegen gelassen hatten. Ich war aufgeregt. Eigentlich begann unsere Mission bei den Pirahã erst jetzt – ohne meine Familie hätte ich niemals durchgehalten, das wusste ich ganz genau. Ich brauchte ihre Unterstützung. Es war auch ihre Mission. Wir begaben uns in eine Welt ohne westliche Unterhaltungsmedien, ohne Strom, ohne Arzt, Zahnarzt oder Telefon; in vielerlei Hinsicht war es eine Reise in die Vergangenheit. Von Kindern verlangt man damit sehr viel, aber ich war zuversichtlich, dass Shannon, Kristene und Caleb gut damit fertig werden würden. Keren hatte von uns allen die meiste Erfahrung mit einem solchen Leben, und ich wusste, dass sie gut zurechtkommen würde; aus ihren Erfahrungen würden auch die Kinder Kraft und Selbstvertrauen schöpfen. Schließlich war Keren bei den Sateré-Mawé-Indianern aufgewachsen und hatte von ihrem achten Lebensjahr an im Amazonasgebiet gelebt. Sie liebte das Land, und nichts am Leben einer Missionarin war ihr zu schwierig. Auch ich bezog meine Kraft in vielerlei Hinsicht aus ihrer Zuversicht. Sie war die engagierteste Missionarin, die ich jemals kennengelernt hatte.
Als das Flugzeug noch fünf Minuten entfernt war, fingen die Pirahã an zu schreien und zur Landepiste zu laufen. Ein paar Minuten später hörte ich die Maschine und lief aufgeregt hin, um meine Familie zu begrüßen. Meine Kinder und Keren winkten begeistert, als sie landeten. Nachdem das Flugzeug zum Stehen gekommen war und der Pilot seine Kanzel geöffnet hatte, ging ich zu ihm und schüttelte ihm energisch die Hand. Keren stieg aus. Sie war begeistert, lächelte und versuchte sofort mit den Pirahã zu reden. Dann traten Shannon mit ihrem Hund Glasses, Kris und Caleb durch die Luke. Die Kinder blickten sich unsicher um, freuten sich aber, mich zu sehen. Außerdem lächelten sie über das ganze Gesicht, als sie Pirahã erblickten. Der Pilot schickte sich an, nach Porto Velho zurückzukehren, und Dick stieg in die Maschine und sagte: »Dan, ich werde an dich denken, wenn ich heute Abend in Porto Velho ein saftiges Steak esse.«
Mithilfe der Pirahã brachten wir alle Vorräte zu unserer Hütte, dann ruhten wir uns ein paar Minuten aus. Keren und die Kinder besichtigten ihr neues Zuhause, zu dem ich sie gebracht hatte. Noch war für mich viel Organisatorisches zu erledigen, aber in ein paar Tagen würde bei der Arbeit und im Familienleben der Alltag einkehren.
Nachdem wir alles ausgepackt hatten, richteten wir unser Haus ein. Keren hatte Moskitonetze angefertigt und auch Hängebeutel für Geschirr, Kleidung und andere Habseligkeiten mitgebracht. Für die Kinder begann der häusliche Schulunterricht, Keren führte den Haushalt, und ich stürzte mich von morgens bis abends in die Sprachforschung. Wir gaben uns Mühe, in einem Dorf mitten im Amazonasgebiet das Leben einer christlichen amerikanischen Familie aufrechtzuerhalten. Dabei hatten wir alle viel zu lernen.
Keiner von uns, noch nicht einmal Keren, hatte sich vorstellen können, was alles zu unserem neuen Leben gehören würde. An einem der ersten Abende nahmen wir im Schein einer Gaslampe das Abendessen ein. Im Wohnzimmer jagte Glasses, Shannons kleiner Hund, hinter irgendetwas her, das im Dunkeln herumhüpfte. Was es war, konnte ich nicht genau sehen, aber es kam auf mich zu. Ich hörte auf zu essen und beobachtete es. Plötzlich sprang das dunkle Etwas auf meinen Schoß. Ich richtete den Strahl meiner Taschenlampe darauf: Es war eine grau-schwarz gemusterte, mindestens zwanzig Zentimeter große Tarantel. Aber ich war darauf vorbereitet. Da ich mir wegen der Schlangen und Insekten Sorgen machte, hatte ich immer einen Holzknüppel bei mir. Ohne die Hände in Richtung der Tarantel zu bewegen, stand ich schnell auf und machte mit dem Becken eine Bewegung nach vorn, sodass die Spinne zu Boden fiel. Die anderen hatten gerade erst gesehen, was mir da auf den Schoß gesprungen war, und starrten die haarige Spinne mit aufgerissenen Augen an. Ich griff nach dem Knüppel und schlug sie tot. Die Pirahã im vorderen Zimmer hatten alles mit angesehen. Als ich die Spinne getötet hatte, fragten sie, was es gewesen sei.
»Xóooí« (Tarantel), erwiderte ich.
»Die töten wir nicht«, sagten sie. »Die fressen die Küchenschaben und tun nichts.«
Nach einiger Zeit hatten wir uns an solche Situationen gewöhnt. Wir hatten das Gefühl, dass Gott für uns sorgt und dass wir hinterher immer etwas zu erzählen hätten.
Ich war zwar Missionar, aber bei meinen ersten Aufträgen vom SIL ging es um Sprachforschung. Ich musste herausfinden, nach welcher Grammatik diese Sprache funktionierte, und meine Erkenntnisse schriftlich festhalten; erst dann würde das SIL mir gestatten, mit einer Bibelübersetzung zu beginnen.
Wie ich schon bald bemerkte, fordert linguistische Feldforschung nicht nur den Geist, sondern den ganzen Menschen. Sie verlangt vom Wissenschaftler nichts Geringeres, als in einem heiklen, häufig unangenehmen Umfeld in die fremde Kultur einzutauchen; dabei besteht die große Gefahr, dass man sich durch unzureichende Belastbarkeit aus der Situation des Forschers entfernt. Körper, Geist, Emotionen und insbesondere das Selbstwertgefühl eines Forschers werden bei längerem Aufenthalt in einem fremden Kulturkreis stark belastet, und dabei verhält sich das Ausmaß der Belastung direkt proportional zum Ausmaß der Unterschiede zwischen der fremden Kultur und seiner eigenen.
Machen wir uns einmal klar, in welchem Dilemma ein Feldforscher steckt: Er befindet sich an einem Ort, an dem alles, was er bisher gekannt hat, verborgen und versteckt ist, wo Bilder, Geräusche und Gefühle die gewohnte Vorstellung vom irdischen Leben infrage stellen. Das Ganze ähnelt ein wenig den Episoden aus der Fernsehserie Unwahrscheinliche Geschichten: Man begreift nicht, was einem geschieht, weil es so unerwartet kommt und so weit außerhalb des eigenen Bezugsrahmens steht.
Ich machte mich voller Zuversicht an die Feldforschung. Auf grundlegende Tätigkeiten wie das Sammeln, die richtige Speicherung und die Analyse von Daten hatte meine linguistische Ausbildung mich gut vorbereitet. Morgens stand ich um 5.30 Uhr auf. Nachdem ich in Zwanzig-Liter-Kanistern mindestens 200 Liter Wasser zum Trinken und Geschirrspülen herangeschleppt hatte, machte ich für die Familie das Frühstück. Gegen acht Uhr saß ich meistens am Schreibtisch und begann mit meiner »Informantenarbeit«. Dabei richtete ich mich nach mehreren Handbüchern und stellte mir selbst überprüfbare Aufgaben. Während der ersten Tage im Dorf fertigte ich grobe, aber nützliche Skizzen von der Lage aller Hütten an, die jeweils von einer Liste der Bewohner begleitet waren. Ich wollte erfahren, was sie den Tag über taten, was ihnen wichtig war, worin sich die Tätigkeiten der Kinder von denen der Erwachsenen unterschieden, worüber sie sich unterhielten, warum sie ihre Zeit so und nicht anders verbrachten und so weiter. Ich war entschlossen, ihre Sprache sprechen zu lernen.
Dazu bemühte ich mich, mir jeden Tag mindestens zehn neue Wörter oder Redewendungen einzuprägen und verschiedene »semantische Felder« (Gruppen verwandter Gegenstände wie Körperteile, Begriffe, die Gesundheit betreffend, Vogelnamen usw.) sowie syntaktische Konstruktionen (Aktiv/Passiv, Vergangenheit/Gegenwart, Aussage/Frage usw.) zu untersuchen. Alle neuen Wörter schrieb ich auf 7,5 mal 12,5 Zentimeter große Karteikarten. Dabei transkribierte ich nicht nur jedes Wort in Lautschrift, sondern ich notierte auch, in welchem Zusammenhang ich das Wort gehört hatte und was es nach meiner Vermutung wahrscheinlich bedeutete. Dann stanzte ich ein Loch in die linke obere Ecke der Karte. Ich hängte zwanzig Karten an einen Ring (der aus einem Ringbinder stammte, das heißt, ich konnte ihn öffnen und schließen) und zog ihn durch eine Gürtelschlaufe meiner Hose. So konnte ich die Karten in meinen Gesprächen mit den Pirahã einsetzen und meine Aussprache sowie mein Verständnis der Wörter überprüfen. Durch das ständige Gelächter der Pirahã über falsch angewandte oder falsch ausgesprochene Wörter ließ ich mich dabei nicht aus dem Konzept bringen. Worin mein erstes linguistisches Ziel bestehen musste, wusste ich genau: Ich musste wissen, ob die Laute, die ich in der Sprache der Pirahã heraushörte, für sie wirklich bedeutungsunterscheidend sind. Diese Elemente – Sprachwissenschaftler sprechen von Phonemen – sollten zur Grundlage für die Entwicklung einer Schrift werden.
In der Frage, wie die Pirahã sich selbst im Verhältnis zu anderen sehen, hatte ich die erste wichtige Erkenntnis, als ich mit einigen Pirahã-Männern durch den Dschungel wanderte. Ich zeigte auf den Ast eines Baumes. »Wie heißt das?«, fragte ich.
»Xií xáowí«, erwiderten sie.
Ich zeigte noch einmal auf den Ast, dieses Mal auf ein längeres Stück, und wiederholte: »Xií xáowí.«
»Nein«, sagten sie lachend und wie aus einem Mund. »Das ist xií xáowí.« Dabei zeigte er auf die Stelle, wo der Ast vom Stamm abzweigte, und auch auf die Gabelung zwischen einem größeren und einem kleineren Ast. »Das hier« (der gerade Zweig, auf den ich gezeigt hatte) »ist xii kositii.«
Dass xii »Holz« bedeutet, wusste ich bereits. Außerdem war ich mir ziemlich sicher, dass xáowí »krumm« und kositii »gerade« hieß. Aber diese Vermutungen musste ich noch überprüfen.
Als wir gegen Abend über den Pfad im Dschungel nach Hause gingen, fiel mir auf, dass der Weg auf einem längeren Abschnitt gerade verlief. Ich wusste auch, dass xagí »Pfad« bedeutet. Also probierte ich es mit »Xagí kositii« und zeigte auf den Weg.
Die Antwort kam umgehend: »Xiaó!« (Richtig!) »Xagí kositii xaagá« (Der Weg ist gerade).
Als der Weg eine scharfe Kurve nach rechts machte, versuchte ich es mit: »Xagí xáowí.«
»Xiaó!«, erwiderten sie alle und grinsten. »Soxóá xapaitíisí xobáaxáí« (Du sprichst die Pirahã-Sprache schon gut). Dann fügten sie hinzu: »Xagí xaagaia píaii« – wie mir später klar wurde, bedeutet das: »Der Weg ist auch krumm.«
Es war großartig. In wenigen kurzen Schritten hatte ich die Wörter für »krumm« und »gerade« gelernt. Auch die Namen der meisten Körperteile kannte ich bereits. Als wir weitergingen, fiel mir ein, welche Wörter die Pirahã mir für »Volk der Pirahã« (Híaitíihí), »Sprache der Pirahã« (xapaitíisí), »Fremder« (xaoói) und »fremde Sprache« (xapai gáisi) genannt hatten. »Sprache der Pirahã« ist eindeutig eine Zusammensetzung aus xapaí (Kopf), tii (gerade) und dem Suffix -si, das anzeigt, dass das entsprechende Wort ein Name oder ein echtes Substantiv ist: »gerader Kopf«. »Volk der Pirahã« besteht aus hi (er), ai (ist) und tii (gerade) sowie -hi, einer weiteren Endung, die dem -si ähnelt: »Er ist gerade.« »Fremder« heißt »Gabel« wie in der »Astgabel«, und »fremde Sprache« heißt wörtlich »krummer Kopf«.
Ich kam voran! Allerdings kratzte ich bisher nur an der Oberfläche.
Die Gründe, warum die Pirahã-Sprache so schwer zu erlernen und zu analysieren ist, erkennt man nicht an den ersten Arbeitstagen, ganz gleich, wie motiviert man angesichts sofortiger Erfolge ist. Der schwierigste Aspekt beim Lernen ist nicht die Sprache selbst, sondern die Tatsache, dass man sich in einem »einsprachigen« oder »monolingualen« Umfeld befindet. Eine monolinguale Situation kommt in der Feldforschung nur selten vor: Der Wissenschaftler hat mit den Muttersprachlern keine gemeinsame Sprache. Dies war bei den Pirahã mein Ausgangspunkt, denn sie sprechen – von wenigen Redewendungen abgesehen – weder Portugiesisch noch Englisch, sondern ausschließlich ihre eigene Sprache. Um ihre Sprache zu erlernen, muss man also ihre Sprache lernen – ein klassisches Dilemma. Ich kann nicht nach der Übersetzung in irgendeine andere Sprache fragen und ich kann keinen Pirahã in einer anderen Sprache als Pirahã um Erklärungen bitten. Es gibt Vorgehensweisen, mit denen man in einer solchen Situation arbeiten kann. Wie nicht anders zu erwarten, entwickelte auch ich einige davon im Laufe meiner Bemühungen. Aber die meisten Methoden für eine monolinguale Feldforschung gab es schon, lange bevor ich auf der Bildfläche erschien.
Dennoch ist es schwierig. Nachdem ich lange genug dort gewesen war, um zu lernen, was »Wie sagt man … auf Pirahã?« auf Pirahã heißt, lief ein typischer Wortwechsel beispielsweise so ab:
»Wie sagt man das?« (Ich zeige auf einen Mann, der mit seinem Kanu stromaufwärts angefahren kommt.)
»Xigihí hi piiboóxio xaaboópai« (Der Mann stromaufwärts kommt).
»Ist das richtig so: ›Xigihí hi piiboóxio xaaboópai‹?«
»Xaió. Xigihí piiboó xaaboópaitahásibiga« (Richtig. Der Mann stromaufwärts kommt).
»Was ist der Unterschied zwischen ›Xigihí hi piiboóxio xaaboópai‹ und ›Xigihí piiboó xaaboópaitahásibiga‹?«
»Kein Unterschied. Das ist das Gleiche.«
Aus Sicht des Sprachwissenschaftlers muss es natürlich einen Unterschied zwischen den beiden Sätzen geben. Aber bevor ich selbst Pirahã lernte, konnte ich nicht wissen, worin der Unterschied besteht: Der erste Satz bedeutet »Der Mann kommt stromaufwärts zurück«, der zweite dagegen »Ich bin Augenzeuge der Tatsache, dass der Mann stromaufwärts zurückkehrt«. So etwas macht das Erlernen der Sprache wahrhaft schwierig.
Eine andere Schwierigkeit wurde bereits erwähnt: Pirahã ist tonal. Man muss für jeden Vokal lernen, ob er in hoher oder tiefer Stimmlage ausgesprochen wird. Diese Eigenschaft haben viele Sprachen auf der Welt, europäische Sprachen sind allerdings so gut wie nicht darunter. Das Englische ist in diesem Sinne nicht tonal. Ich hatte mich bereits entschieden, Vokale in hoher Stimmlage mit einem Akut (´) über dem Buchstaben und solche, die tief ausgesprochen werden, ohne Markierung zu schreiben. Dies kann man an einem einfachen Wortpaar verdeutlichen, das »Ich« und »Exkrement« bedeutet:
Tií (Ich) wird mit einem tiefen ersten und einem hohen zweiten i ausgesprochen. Lautmalerisch könnte man auch »tiI« schreiben.
Bei tíi (Exkrement) dagegen hat das erste i eine hohe und das zweite eine tiefe Tonlage – »tIi«.
Die Sprache ist auch deshalb schwierig zu erlernen, weil es nur drei Vokale (i, a, o) und acht Konsonanten (p, t, h, s, b, g, den Knacklaut und k) gibt. Wegen dieser geringen Zahl der Laute müssen die Wörter in Pirahã viel länger sein als in einer Sprache, die über mehr Sprachlaute verfügt. Wenn Wörter kurz sind, muss jedes von ihnen so viele Lautunterschiede aufweisen, dass man es von den meisten anderen kurzen Wörtern unterscheiden kann. Gibt es in einer Sprache dagegen wie im Pirahã nur wenige unterschiedliche Laute, lassen sich Wörter nur unterscheiden, wenn in jedem von ihnen mehr Platz ist – das heißt, sie müssen länger sein. Für mich hatte das zur Folge, dass anfangs die meisten Wörter auf Pirahã nahezu gleich klangen.
Und schließlich besteht eine bekannte Schwierigkeit der Pirahã-Sprache darin, dass ihr viele Dinge fehlen, die es in anderen Sprachen gibt, insbesondere was den Satzbau betrifft. So existiert beispielsweise kein Komparativ, das heißt, ich konnte keine Ausdrücke wie »dies ist groß«/«jenes ist größer« finden. Ebenso fand ich keine Wörter für Farben: Es gibt keine einfachen Adjektive für rot, grün, blau und so weiter, sondern nur Umschreibungen wie »das ist wie Blut« statt rot oder »das ist noch nicht reif« für grün. Auch Geschichten über die Vergangenheit findet man nicht. Wenn man etwas nicht entdeckt, mit dem man rechnet, verschwendet man unter Umständen Monate mit der Suche nach etwas, das nicht existiert. Viele Dinge, die ich aufgrund meiner Ausbildung in linguistischer Feldforschung erwartete, fand ich überhaupt nicht. Das machte die Sache nicht nur schwieriger, sondern es war hin und wieder auch regelrecht entmutigend. Dennoch war ich optimistisch, dass ich diese Sprache erforschen konnte, wenn ich nur genügend Zeit und Anstrengung darauf verwendete.
Aber niemand kann in die Zukunft blicken, und unsere Pläne sind nichts als Wünsche. Zu glauben, ich könnte mein Umfeld ignorieren und mich ausschließlich auf die Sprachforschung konzentrieren, war töricht. Schließlich befanden wir uns im Amazonasgebiet.
2Das Amazonasgebiet
W





























