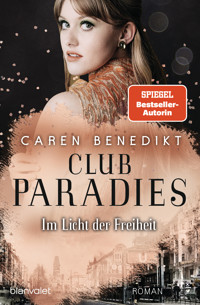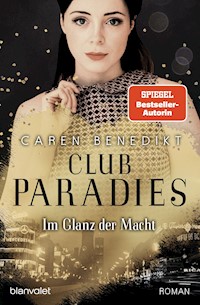9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Grand-Hotel-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein elegantes Hotel an der Ostsee, ein verruchtes Varieté in Berlin und eine Familie, deren Geschichten von der ersten bis zur letzten Seite fesseln - das Finale!
Bernadette von Plesow, Inhaberin des feudalen Grand Hotels in Binz auf Rügen, hatte einen Traum: Sie sah ihren Sohn Constantin vor sich, der vor ihren Augen stirbt. Sie weiß, es war nur ein Traum, aber sie macht sich große Sorgen. Constantin hat sich mit der Unterwelt angelegt und befindet sich zur Zeit im Gefängnis, wo er auf seinen Prozess wartet. Sogar die Todesstrafe könnte ihn erwarten. Natürlich muss Bernadette etwas tun, sonst wäre sie nicht die Frau, die sie ist. Während ihre Tochter Josephine das Grand führt, versucht Bernadette alles, um ihrem Sohn einen Freispruch zu garantieren. Dabei kommt sie der Unterwelt gefährlich nah und verärgert einen äußerst gefährlichen Mann …
Die Grand-Hotel-Trilogie:
Das Grand Hotel. Die nach den Sternen greifen.
Das Grand Hotel. Die mit dem Feuer spielen.
Das Grand Hotel. Die der Brandung trotzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Bernadette von Plesow, Inhaberin des feudalen Grand Hotels in Binz auf Rügen, hatte einen Traum: Sie sah ihren Sohn Constantin vor sich, der vor ihren Augen stirbt. Sie weiß, es war nur ein Traum, aber sie macht sich große Sorgen. Constantin hat sich mit der Unterwelt angelegt und befindet sich zurzeit im Gefängnis, wo er auf seinen Prozess wartet. Sogar die Todesstrafe könnte ihm drohen. Natürlich muss Bernadette etwas tun, sonst wäre sie nicht die Frau, die sie ist. Während ihre Tochter Josephine das Grand führt, versucht Bernadette alles, um ihrem Sohn einen Freispruch zu garantieren. Dabei kommt sie der Unterwelt gefährlich nah und verärgert einen äußerst gefährlichen Mann …
Autorin
Caren Benedikt ist das Pseudonym der Autorin Petra Mattfeldt. Sie liebt den Norden, eine steife Brise und das Reisen an die Orte, über die sie schreibt. Nach einer eher nüchternen Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten arbeitete sie als freie Journalistin. Inzwischen ist die Schriftstellerei ihr Hauptberuf, und sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in einem kleinen Ort in der Nähe von Bremen.
Von Caren Benedikt bereits erschienen:
Das Grand Hotel. Die nach den Sternen greifen. Band 1
Das Grand Hotel. Die mit dem Feuer spielen. Band 2
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
CAREN BENEDIKT
DASGRAND HOTEL
Die der Brandung trotzen
Band 3
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2022 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Kristina Lake-Zapp
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Shutterstock.com (rdonar; 100ker; Falk Herrmann; weerawath.p; zakaz86; Artiste2d3d)
NG · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27654-6V002
www.blanvalet.de
Ich widme dieses Buch meiner Familie.Eure Liebe und Unterstützung überwältigt mich! Und das jeden einzelnen Tag. Danke!
Prolog
Ich mag nicht in die Vergangenheit sehen. Es ist stets ein Schritt zurück.
BERNADETTE VON PLESOW
Das Holztor des kleinen Vorgärtchens knarrt noch immer. Es hat sich nichts verändert in all den Jahren, rein gar nichts. Schon auf diese Entfernung glaube ich den Ledergeruch wahrnehmen zu können, der aus der Werkstatt meines Vaters herüberdringt. Nur das Geräusch der Schleifmaschine, die sonst fast immer zu hören war, und das Hämmern fehlen, um die Erinnerung zu komplettieren.
Ich zögere, die wenigen Schritte bis zum Eingang zu gehen. Sollte ich nicht doch lieber umkehren? Noch kann ich zurück, niemand hat mich bisher bemerkt. So viele Jahre sind seit meinem letzten Besuch hier vergangen. Damals war ich eine junge Frau, fast noch ein Kind. Meine Josie ist heute bereits um einiges älter als ich es damals war, als ich dieses Grundstück das letzte Mal betrat. Wie lange mag das jetzt her sein? Fünfunddreißig Jahre oder sogar mehr?
Ich gehe ein paar Schritte, bleibe abermals stehen und sehe die Fassade hinauf. Früher war sie strahlend weiß, doch nun ist sie vergilbt und oben unter dem Giebel in großen Stücken abgeblättert. Um die Fenster herum hat sich Schmutz abgesetzt, sodass man meinen könnte, es hätte gebrannt. Ich blicke mich um. Auch der Vorgarten wirkt ungepflegt. Kein Vergleich zu den akkuraten Rasenflächen und Beeten, die das Grand Hotel in Binz umgeben. Überhaupt ist es für mich kaum noch vorstellbar, dass ich in dieser Armut tatsächlich meine Kindheit verbracht haben soll. Unwillkürlich schüttele ich den Kopf, hebe dann etwas zögernd die Hand und klopfe. Sogleich schwingt die Tür mit einem knarrenden Geräusch auf. Offenbar war sie nicht richtig geschlossen. Vor Schreck mache ich einen Schritt zurück, doch dann trete ich ein, rufe nach meinen Eltern und lausche einen Moment, erhalte aber keine Antwort. Alles bleibt still. Mein Atem lässt vor meinem Mund eine kleine Dampfwolke entstehen. Erst jetzt bemerke ich, wie kalt es hier drinnen ist. Ich schaudere. Mein Blick fällt auf den alten Ofen, in dem früher außer in den Sommermonaten stets ein Feuer brannte. Hinter der alten, verrußten Glasscheibe ist keine Flamme auszumachen. Ich lege meine Hand auf die Kachelfläche. Alles kalt, schon seit Monaten, wenn nicht gar Jahren kann dieser Ofen nicht mehr entzündet worden sein. Nachdenklich ziehe ich die Hand zurück und reibe die Finger aneinander, um den Staub der Kacheln zu entfernen. Das Haus wirkt verlassen, aber keiner hat sich die Mühe gemacht, die Möbel abzudecken. Oder lebt doch noch jemand hier und hat sich in eines der anderen Zimmer zurückgezogen? Ich gehe zur Tür, die in die Küche führt, und öffne sie. Auch hier ist niemand, aber in der Luft hängt noch ein Hauch von Essensduft. Noch einmal rufe ich nach meinen Eltern, dann betrete ich die Küche. Sofort fällt mein Blick auf eine weitere Tür im hinteren Teil des Raumes, die früher nicht da war. Dort hatte immer ein Geschirrschrank mit einer Anrichte gestanden. Wohin mochte die Tür führen? Nach draußen? Oder hatte man einen Durchbruch gemacht, um in den dahinterliegenden Raum zu gelangen? Doch welcher Raum lag dahinter? Ich versuche verzweifelt, mich zu erinnern, gehe in Gedanken wieder und wieder den Grundriss des Hauses durch. Die Werkstatt des Vaters schloss auf der rechten Seite ans Haus an, hier jedoch, auf der linken Seite, war nichts. Ob die Tür in den Garten führte? Ich zögere, als ich darauf zugehe und nach der Klinke greife. Ein fast unheilvolles Gefühl steigt in mir auf, ganz so, als versuchte meine innere Stimme mich zu warnen. Trotzdem drücke ich die Klinke hinunter und öffne die Tür. Vor mir sehe ich eine Brücke, einen Holzsteg, der über einen schmalen, leise plätschernden Bach zu einer weiteren Tür führt. Nach ein paar Schritten bin ich in einem Raum, der wunderschön ist, mit edlem Marmorfußboden, hohen Wänden und großen, fast bodentiefen Fenstern. Auch hier gibt es wieder kleine Holzstege, die bogenförmig einen nicht erkennbaren dunklen Untergrund überspannen. Sie erinnern mich ein wenig an die Seebrücke in Binz. Scheinbar verbinden sie die verschiedenen Bereiche des Raumes miteinander. In der Mitte laufen diese Stege wie ein Stern zusammen, sodass man von hier aus in jede Richtung gehen kann. Ich setze mich wieder in Bewegung, bleibe dann in der Mitte stehen und überlege, welchen Steg ich nun wählen soll. Kurz drehe ich mich um. Die Tür hinter mir, die zurückführt in das kleine Schusterhaus meiner Eltern, ist immer noch geöffnet, doch ich weiß, dass ich nicht umkehren werde. In diesem Moment schwingt sie zu und fällt krachend ins Schloss. Ich zucke erschrocken zusammen. Die Tür ist verschwunden, genau wie der Steg, über den ich eben noch gegangen bin. Ich wende den Blick nach vorn. Wo eben noch viele Brücken waren, liegt nun nur noch ein einziger Holzsteg vor mir, an dessen Ende sich eine weitere Tür befindet. Auf einmal wird mir klar, dass ich in der Empfangshalle des Grand stehe. Der Steg führt mitten hindurch, über den prächtigen Marmorboden, auf diese eine Tür zu. Ich atme kurz durch, dann setze ich mich, ohne zu zögern, in Bewegung. Mein Blick wandert zu den großen Fenstern an der Seite der Empfangshalle. Dahinter befindet sich ein Rasenstück, das offenbar im Meer endet und unter dichtem Nebel liegt. Ich bleibe kurz stehen, als ich eine Person wahrnehme. Ist das Johannes Blumberg dort hinten in der Ferne? Der Mann sieht zu mir herüber. Ich hebe die Hand. Ja, jetzt bin ich sicher: Es ist Johannes’ Silhouette dort im Nebel. Ich winke, freue mich aufrichtig, ihn wiederzusehen. Er hebt ebenfalls die Hand, und auch wenn ich es nicht richtig erkennen kann, so erahne ich doch sein Lächeln. Ich bleibe stehen und überlege, ob ich vom Holzsteg steigen und zu ihm nach draußen in den Nebel laufen soll, doch wie komme ich hinaus? Wieder hebe ich die Hand, um zu winken, doch statt Johannes mache ich nun meine Eltern aus, die dort im Nebel stehen und in meine Richtung sehen. Sofort nehme ich den Arm herunter. Ich will nicht, dass sie auf mich aufmerksam werden. Ein Mann tritt an die Seite meiner Eltern. Ein beklommenes Gefühl steigt in mir auf. Ist das Karl? Mein Karl? Ich stelle mich auf die Zehenspitzen, recke den Hals, um besser sehen zu können. Nein, es ist nicht Karl. Es ist Alexander, mein Sohn, und noch ein weiterer Mann tritt zu ihm, setzt sich an den perlmuttweißen Flügel und beginnt zu spielen. Das Herz klopft mir bis zum Hals. Maximilian? Ich verharre in der Bewegung. Ist das, was ich dort sehe, die andere Seite? Ist es der Ort, an dem sich all jene treffen, die bereits gegangen sind? Ein weiterer Mann tritt hinzu und nimmt auf der Klavierbank neben Maximilian Platz. Die beiden spielen ein Duett, bringen die Anschläge der Tasten zu einer herrlichen Melodie in Einklang. Ihn erkenne ich sofort. Constantin! Nein, nicht Constantin, das darf nicht sein. Die Menschen dort hinten sind tot, alle sind sie tot. Aber nicht Constantin. Ich muss dorthin, irgendwie muss ich dorthin gelangen und ihn zu mir holen. Constantin darf nicht dort sein. Er gehört auf diese Seite, hierher zu mir. Ob dort hinter der Tür ein Weg zu ihm führt? Eine Brücke, ein Steg, eine Verbindung zur anderen Seite, sodass ich hinlaufen und ihn holen kann? Ich haste los, versuche verzweifelt, die Tür zu öffnen, doch sie ist fest verschlossen. Ich trommle mit beiden Händen dagegen, rufe wieder und wieder Constantins Namen.
Schweißgebadet fahre ich hoch. Ich brauche einen Moment, um mich zu sammeln und zu realisieren, dass ich mich in meinem Bett befinde. Es war ein Traum, nichts als ein Traum, dennoch spüre ich, dass mir dieser Traum etwas sagen will. Ich werde handeln müssen. Ich werde nicht zulassen, dass man mir Constantin nimmt. Nicht auch noch ihn.
Ich stehe auf, gehe ans Fenster und öffne es. Eiskalt strömt die Nachtluft herein. Es ist noch dunkel, nur ganz entfernt kann man das Licht des nahenden Tages erahnen. Ein weiterer Tag, für den es sich zu kämpfen lohnt. So wie ich schon mein ganzes Leben gekämpft habe.
1. Kapitel
Binz, Montag, 24. August 1925
Für den Erfolg braucht es keine Rechtfertigung, für das Versagen gibt es keine.
BERNADETTE VON PLESOW
Gleich am Morgen hatte Bernadette in Berlin angerufen, um mit ihrem Sohn Constantin zu sprechen. Zwar erzählte sie ihm nichts von dem eigenartigen Traum, doch konnte sie auch nicht gänzlich die Sorge um ihn aus ihrer Stimme vertreiben. In drei Tagen, am Donnerstag, dem 27. August 1925, stand der erste Prozesstag an, und Bernadette ging davon aus, dass es längst nicht so einfach werden würde, die gegen ihn vorliegende Anklage aus der Welt zu schaffen, wie Constantin sie glauben machen wollte. Sie hatte des Öfteren mit Dr. Wilhelm Rebenschlag, Constantins Rechtsanwalt, telefoniert, und dieser sah die Sache ebenso kritisch wie Bernadette. Womöglich wollte er auch nur die Erwartungen an ihn dämpfen, doch Bernadette hielt den Juristen für einen klugen und vor allem realistischen Menschen, dessen Einschätzung sie weit mehr traute als der übermäßig optimistischen, ja sogar fast schon überheblichen Siegesgewissheit ihres Sohnes.
Doch das war eben Constantins Art. Wahrscheinlich hatte er nie genug kämpfen müssen für das, was er heute besaß. Das lag zum einen daran, dass Bernadette ihm – wie auch ihren anderen Kindern – nur allzu gern geholfen hatte und ihm, ohne zu zögern, unter die Arme gegriffen hatte, als er mit dem Vorschlag gekommen war, in Berlin ein Hotel mit angeschlossenem Varieté zu eröffnen. Zum anderen jedoch hatte Constantin sehr rasch begriffen, was notwendig war, um in Berlin bestehen zu können, und sich bereitwillig in die Rolle des skrupellosen Machers begeben, der über Leichen ging. Ja, sie hatte früher nicht wahrhaben wollen, wozu Constantin bereit war, wenn es darum ging, seine Macht zu sichern oder weiter auszubauen. Doch inzwischen hegte sie nicht mehr den geringsten Zweifel daran, wer und vor allem was Constantin war. Ihr Sohn war ein skrupelloser Gangster geworden, dem jedes Mittel recht war, um seine Ziele zu erreichen. Prostitution, Drogenhandel, Glücksspiel und Bestechung waren sein tägliches Geschäft, und wenn es nötig war, schreckte er selbst vor Mord nicht zurück. Doch diesen Mord, der ihm nun vorgeworfen wurde und für den er sogar eine kurze Zeit im Gefängnis gewesen war, hatte er nicht begangen. Zum Glück hatte Dr. Rebenschlag dafür gesorgt, dass er gegen Zahlung einer Kaution und mit der Auflage, die Stadt nicht zu verlassen, bis zum Prozess auf freien Fuß gesetzt wurde. Und aus diesem Grund und einfach weil er ihr Sohn war, würde Bernadette alles tun, um für Constantin zu kämpfen. Vor allem aber ging ihr der nächtliche Traum einfach nicht mehr aus dem Kopf. Er war für sie wie eine Warnung gewesen, dass Constantin schon bald auf der anderen Seite landen könnte, dort, wo die Toten waren. Und das durfte sie nicht zulassen, auf gar keinen Fall. Bernadette wusste, dass sie es nicht verkraften würde, noch eines ihrer Kinder zu Grabe zu tragen. Maximilian war im Krieg gefallen. Ungeachtet der offiziellen Todesnachricht, hatte sie noch lange nach Kriegsende die Hoffnung auf seine Rückkehr nicht aufgeben wollen und weiter auf ihn gewartet. Sie hatte seinen Tod einfach nicht akzeptieren können, zumal sie niemals seinen toten Körper gesehen hatte. Genau das machte es ihr so schwer, das Endgültige zu akzeptieren.
Bei Alexander war es anders gewesen. Ein Unfall, ein vollkommen sinnloser Tod. Doch ihn hatte sie aufgebahrt gesehen, mit geschlossenen Augen und einer Miene, die verriet, dass er nicht mehr bei ihr war. Das hatte ihr das Abschiednehmen erleichtert. Einen weiteren Tod würde sie allerdings nicht verkraften. Niemand sollte eines seiner Kinder überleben. Bei ihr waren es nun schon zwei, die sie hatte gehen lassen müssen.
Sie trat ans Fenster ihres Arbeitszimmers im Grand und ließ den Blick über die See schweifen. Soeben hatte Hauptmann Winkler, der Akkordeonspieler, seinen Platz an der Promenade eingenommen und begonnen, seinem Instrument die ersten Töne zu entlocken. Bernadette lächelte. Nur sie wusste, dass dort ein überaus vermögender Mann saß, der trotz seines Reichtums offenbar seine Lebensaufgabe darin sah, an der Promenade zu sitzen und für die Gäste zu spielen. Was Bernadette früher vollkommen unverständlich gewesen war, konnte sie heute verstehen. Seit Johannes Blumberg, der Halbbruder ihres verstorbenen Mannes, in ihr Leben getreten und ebenso rasch wieder daraus verschwunden war, hatte bei Bernadette ein Umdenken stattgefunden. Sie war nicht mehr die gleiche Frau wie noch im letzten Jahr oder gar vor fünf Jahren oder mehr. Damals hatte sie alles darangesetzt, das Grand immer weiter voranzubringen und so aufzustellen, dass sie keine Sorgen mehr zu haben brauchte. So viele Jahre hatte sie nichts anderes gesehen als den Erfolg und den Status, der damit verbunden war. Sie hatte bis zur vollkommenen Erschöpfung gearbeitet und war sich für nichts zu schade gewesen. Doch nach Alexanders Tod und dem damit einhergehenden Verlust eines Nachfolgers hatte vieles für sie an Bedeutung verloren. Erst durch Josie und deren Pläne, das Palais zu neuem Leben zu erwecken – ein ehedem wunderschönes Hotel an der Promenade von Binz und der größte Konkurrent des Grand –, hatte Bernadette neuen Mut fassen können und freute sich nun sogar darauf, dieses Projekt gemeinsam mit ihrer Tochter anzugehen. Doch erst einmal musste die Sache mit Constantin bereinigt werden. Es war wichtig, dass es ihr endlich gelang, Margrit, ihre Schwiegertochter, ausfindig zu machen, die einfach ihre knapp vierjährigen Zwillinge zurückgelassen hatte und deren Spur sich am Bahnhof in Berlin verlor. Josie kümmerte sich wirklich rührend um ihre Neffen, doch so konnte es nicht weitergehen. Die Jungen waren zwar noch klein, aber beiden war anzumerken, dass sie ihr nicht länger glaubten, wenn sie wieder einmal die dringende Angelegenheit vorschob, derentwegen Margrit so überstürzt hatte abreisen müssen. Erich und Paul würden bald eine bessere Erklärung verlangen, denn auch wenn sie momentan noch keine Zusammenhänge herstellen konnten, spürten sie doch, dass etwas an dem Verhalten der Mutter nicht stimmte. Und auf die Fragen, die hieraus erwuchsen, wusste Bernadette zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Antwort zu geben. Wie auch? Sie hatte nicht das geringste Verständnis für eine Mutter, die ihre Kinder zurückließ. Und zwar nicht aus Verzweiflung, Angst um Leib und Leben oder weil sie versuchen wollte, für sich und die Zwillinge etwas Neues, Besseres aufzubauen – nein, Margrit war gegangen, weil sie ein verantwortungsloses, egoistisches Miststück war, das sich nicht im Geringsten um die Zwillinge oder sonst jemanden scherte. Für sie ging es immer nur um sie selbst. Das war die einfache, hässliche Wahrheit.
Bernadette lauschte einige Momente den Klängen des Akkordeons, dann wandte sie sich vom Fenster ab und schloss es wieder. Anschließend ging sie zu ihrem Schreibtisch und hatte sich gerade auf ihren Stuhl gesetzt, als es an der Tür klopfte.
»Herein!«
»Guten Morgen, maman«, flötete Josephine, als sie das Büro ihrer Mutter betrat.
»Guten Morgen, Josie.« Bernadette betrachtete ihre Tochter, ein liebes, wenngleich ein wenig ungestümes, mitunter naives Mädchen, das mit seiner ansprechenden äußeren Erscheinung so manchem männlichen Gast den Kopf verdrehte. Nach einem kurzen Moment wandte sie den Blick ab und hielt Josie die Wange hin, die einen Kuss darauf hauchte. »Wie ich sehe, bist du bester Laune.«
Josephine setzte sich auf den Besucherstuhl vor Bernadettes Schreibtisch und lächelte zufrieden. »O ja. Und willst du auch wissen, warum?«
»Bitte.«
»Ich weiß jetzt, was ich will.«
»Wunderbar! Das freut mich für dich.«
Josephine zog die Stirn in Falten und strich sich über die inzwischen wieder langen, dunklen Haare, die denen ihrer Mutter so ähnlich waren. »Ach, maman, du musst jetzt fragen, was es ist. Oder interessiert es dich gar nicht?«
»Natürlich interessiert es mich. Doch du wirst es mir sicherlich gleich erzählen.«
»Liebe Mutter, mitunter bist du wie eine sich absenkende Bahnschranke, die ein Weitergehen unmöglich macht«, schmollte Josie.
Bernadette schmunzelte. »Soll das etwa eine Beleidigung sein?«
»Es ist natürlich keine Beleidigung, aber doch eine kritische Feststellung«, bemerkte Josephine.
»Nun gut«, befand Bernadette, dann fragte sie mit gespielt förmlicher Stimme: »Möchtest du mir mitteilen, welche Erkenntnis dir im Hinblick auf das, was du willst, gekommen ist, mein Kind?«
»Von Herzen gern, maman.« Josephine deutete eine Verbeugung an und musste lachen. Sie liebte es, die Mutter zu necken. Vor allem aber genoss sie die Nähe zwischen ihnen, die früher so nicht bestanden hatte.
»Also, raus mit der Sprache«, forderte Bernadette ihre Tochter auf. »Was sind deine Pläne?«
»Es geht ums Palais«, begann Josephine, was Bernadette nicht überraschte. Nachdem sie das Hotel von Johannes mehr oder weniger geschenkt bekommen hatte, war ihr immer wieder der Gedanke gekommen, Josephine als Geschäftsführerin einzusetzen – eine Überlegung, die bei ihrer Tochter großen Anklang gefunden hatte. Natürlich waren erst einmal umfangreiche Umbauten notwendig, außerdem musste das Gebäude vom Keller bis zum Dachgeschoss renoviert werden. Doch dann, in ein paar Jahren, wenn alles fertig war, konnte Bernadette sich durchaus vorstellen, dass Josephine hier ihren Platz fand.
Josie strahlte ihre Mutter an. »Ich weiß jetzt endlich, was wir daraus machen.«
»Und?«
»Ein Künstlerhotel.«
»Ein was?« Bernadette hob die Augenbrauen, wie sie es immer tat, wenn sie glaubte, nicht richtig verstanden zu haben, oder dies zumindest zum Ausdruck bringen wollte.
»Ein Künstlerhotel«, wiederholte Josephine und reckte leicht herausfordernd das Kinn. »Ich sehe es schon vor mir, maman. Es wird nicht eines dieser hochherrschaftlichen Gebäude, an denen alles spießig aufeinander abgestimmt ist, um die hochwohlgeborenen Gäste zufriedenzustellen.«
»So wie das Grand, meinst du?«
»Exakt«, rutschte es Josephine heraus. Erschrocken riss sie die Augen auf. »Natürlich ist das Grand ein ganz wunderbares Haus«, versicherte sie eilig, konnte aber am Blick der Mutter ablesen, dass ihr dieser Rettungsversuch nichts mehr nützen würde.
»Was genau stört dich denn am Grand, wenn ich fragen darf?« Es klang interessiert, doch Josephine kannte ihre Mutter gut genug, um zu wissen, dass sie ihre Worte jetzt ganz genau wählen sollte.
»Gar nichts. Es ist wunderschön. Und deshalb würde es überhaupt keinen Sinn ergeben, ein ebenso schönes Hotel nur wenige Meter entfernt aufzubauen. Das Palais muss sich vom Grand abheben, muss vollkommen anders sein. Sonst kann es niemals bestehen.«
Bernadette schmunzelte. »Da hast du ja gerade noch mal die Kurve gekriegt.«
»Du weißt genau, dass ich das Grand nicht schlechtmachen wollte«, sagte Josephine versöhnlich.
»Ja, das weiß ich. Doch du bist inzwischen alt genug, deine Worte mit etwas mehr Bedacht zu wählen.«
»Ich bemühe mich wirklich darum«, versicherte Josephine. »Nenn mir ein einziges Abendessen mit unseren Gästen oder Geschäftspartnern, bei dem ich mich nicht als deine wohlerzogene Tochter präsentiert habe.«
»Da gebe ich dir recht, Josie. Doch du musst lernen, bei allen Gesprächen, die du führst, jedes einzelne Wort und dessen Wirkung genau zu bedenken.«
»Ich werde darauf achten, Mutter«, versprach Josephine und fühlte sich wieder einmal wie ein kleines Kind, das eine Zurechtweisung einzustecken hatte. »Und, was sagst du nun zu meiner Idee?«, fragte sie dann etwas eingeschüchtert.
»Nun, offen gesagt habe ich nicht die geringste Vorstellung davon, was ein Künstlerhotel sein soll. Denn wenn es dem eigentlichen Wortsinn folgt, wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt. Meiner Erfahrung nach haben Künstler nicht das Geld, um in einem gehobenen Hotel unterzukommen.«
Josephine nickte. Darüber hatte sie auch schon nachgedacht, allerdings waren ihr keine wirklich guten Argumente eingefallen, mit denen sie die Bedenken der Mutter entkräften konnte. Denn hier standen die Kreativität und das Geld einander gegenüber. Zwei Dinge, die im echten Leben oft nicht in Verbindung zu bringen waren.
»Es kommt darauf an, welche Künstler wir ansprechen wollen«, entgegnete sie daher etwas zaghaft. »Ich habe mir Folgendes überlegt: Wir laden einen Künstler ein, seine Gemälde, Skulpturen oder was auch immer für eine Zeit im Palais auszustellen. Dafür wird er kostenfrei im Hotel wohnen und die Möglichkeit erhalten, seine Kunst zu verkaufen. Wir sorgen dafür, dass in allen Zeitungen darüber berichtet wird, was gewiss viele Menschen anlockt. Hier können sie seine Werke bewundern und sich mit dem Künstler selbst austauschen.«
»Das klingt für mich nach einer Art Vernissage …«, gab Bernadette zögernd zu bedenken. »Was genau ist daran neu?«
»Es ist eine Vernissage, doch eine, die beispielsweise zwei Wochen andauert. In dieser Zeit herrscht hier ein einziges Kommen und Gehen, die Menschen kommen miteinander ins Gespräch, unterhalten sich über Kunst und lassen sich von diesem Ort inspirieren.«
»Und womit verdienen wir unser Geld?«, wollte Bernadette wissen.
»Mit den Übernachtungen«, antwortete Josephine wie aus der Pistole geschossen. »Genau wie im Grand. Mit den Übernachtungen und natürlich auch mit den Speisen und Getränken im Restaurant.«
»Und wenn der Künstler dann wieder abgereist ist und wir ein ganz normales Hotel sind, das nichts weiter zu bieten hat?«
»Dann holen wir uns den nächsten Künstler. Es gibt doch so viele, die glücklich sind, wenn ihre Kunst gesehen wird.« Josies Stimme bebte vor Begeisterung.
»Ja, unbekannte Künstler, von denen noch niemand gehört hat«, versetzte Bernadette dem Enthusiasmus ihrer Tochter einen Dämpfer.
»Auch sie müssen irgendwann einmal anfangen«, hielt Josephine dagegen.
»Da gebe ich dir recht. Doch das hier ist kein Sozialprojekt, Josephine.«
»Sozialprojekt … Wie abfällig das klingt. Als wären wir Künstler Aussätzige. Warum hast du mich zum Kunststudium nach Paris geschickt, wenn du gar nicht an junge Künstler glaubst, maman?«
»Josie, wenn du mich falsch verstehen willst, dann bitte. Es geht mir nicht darum, deine Idee grundsätzlich auszuschließen, doch ich bin realistisch und wahrlich lange genug in diesem Geschäft, um gewisse Haken zu erkennen.«
»Aber du denkst ja nicht einmal über die Möglichkeit nach!«, beschwerte sich Josephine.
Bernadette legte den Kopf schräg. »Das ist nicht richtig, Josie. Du musst allerdings dringend lernen, dass nicht jede deiner Ideen für Begeisterung sorgt und du dennoch die Contenance zu wahren hast.«
Josephine musste sich zusammenreißen, um nicht die Augen zu verdrehen. »Ja, maman.«
Bernadette stand auf und trat ans Fenster, um wieder einmal hinaus auf die See zu blicken. Die kabbeligen grauen Wellen spiegelten ihre innere Aufgewühltheit wider. »Dieses Künstlerhotel, von dem du sprichst, wie würdest du dir die Einrichtung vorstellen? Und wie hoch wären deiner Meinung nach die Kosten?«
Josephine sah die Mutter überrascht an, dann schob sie ihren Stuhl zurück und stand ebenfalls auf. »Das Thema ist für dich also nicht vom Tisch?«
»Aber nein, durchaus nicht.« Bernadette drehte sich zu ihrer Tochter um. »Du bist die kommende Generation, Josephine. Und es ist immer klug, sich das, was die Jüngeren zu sagen haben, anzuhören.«
Josephine machte einen großen Schritt auf ihre Mutter zu und legte ihr vorsichtig die Hand auf den Unterarm. »Ich dachte, du hältst meine Idee für dumm, so wie du eben reagiert hast.«
Bernadette nahm die Hand ihrer Tochter und strich sanft darüber. »Deine Idee ist nicht dumm, sie ist nur nicht ausgereift. Du bist sehr schnell zu begeistern, Josie, und das ist auch gut so. Doch ich wäge stets das Für und Wider ab, was du eben nicht tust. Wenn du einen Gedanken hast, siehst du nur noch das Gute daran und vergisst die Kehrseiten.« Sie schaute ihre Tochter prüfend an. Als Josie schwieg, fuhr sie fort: »Wir können sehr gern über deinen Vorschlag sprechen, und es ist an dir, mich mit deinem Enthusiasmus anzustecken. Denn so viel ist sicher: Wenn du nicht einmal mich als deine Mutter überzeugen kannst, wirst du es nicht schaffen, dich anderweitig mit deiner Idee durchzusetzen. Dann können wir das beste und schönste Künstlerhotel bauen, das wir uns nur vorstellen können, und werden doch niemanden davon überzeugen, darin auszustellen oder seine Zeit dort zu verbringen, so viel ist sicher.«
Josephine betrachtete ihre Mutter, setzte sich und straffte die Schultern. »Ich habe mir Folgendes überlegt«, begann sie, und dann beschrieb sie ihrer Mutter das Palais so detailliert, dass diese das Gefühl hatte, von der Promenade direkt durch den Haupteingang zu treten und all das vor sich zu sehen, was ihre Tochter ihr so lebhaft beschrieb. »Ich werde ein paar Zeichnungen anfertigen, damit du es dir besser vorstellen kannst«, endete sie schließlich.
Ein Lächeln huschte über Bernadettes Lippen. »Das klingt für mich nach einem wunderschönen Hotel, das so ganz anders ist als das Grand. Ich muss schon sagen, Josie, ich bin sehr stolz auf dich.«
»Wirklich?« Josephine war aufrichtig überrascht. »Du findest es gut?«
»Mehr als nur gut. Wie sehen deine Kalkulationen aus?«
Josephine wurde unruhig. »Genau dabei benötige ich deine Hilfe, maman.«
»Gut, dann werden wir diesen Teil zusammen erledigen«, sagte Bernadette.
Josie, die mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet hatte, nickte dankbar. »Ich freue mich darauf, maman.«
»Und welche Rolle siehst du für dich in diesem Hotel?«, hakte Bernadette weiter nach.
Josephine zögerte. Sie hatte kein Geld, das sie einbringen konnte, keine echte Erfahrung in der Hotelleitung und außer einem abgeschlossenen Kunststudium nichts weiter vorzuweisen. Vor allem hatte sie den Hotelbetrieb nicht von der Pike auf gelernt wie ihre Freundin Marie, die schon ganz früh als Zimmermädchen im Grand begonnen hatte und nun als Hausdame im Hotel ihres Bruders Constantin in Berlin tätig war.
Sie hob das Kinn. »Ich sehe mich als Geschäftsführerin des Hotels, genauso wie du es seinerzeit mit meinem Bruder Alexander gehandhabt hast. Und eines Tages möchte ich das Hotel ganz übernehmen.« Josephine wagte kaum zu atmen. Einen solchen Vorstoß hatte sie sich selbst nicht zugetraut.
Ein Lächeln umspielte Bernadettes Lippen. »Sehr gut«, lobte sie. »Das ist ganz und gar in meinem Sinne.«
Auch mit dieser Reaktion hätte Josephine nie und nimmer gerechnet.
»Du findest meinen Wunsch nicht überheblich?«
»Ganz im Gegenteil. Gerade entdecke ich sehr viel von mir in dir. Und was könnte eine Mutter wohl stolzer machen? Fordere das, was du denkst zu verdienen, und dann tu alles dafür, es zu bekommen, Josie. Denn schenken wird dir niemand etwas.« Bernadette riss sich vom Fenster los und kehrte an ihren Schreibtisch zurück.
»Aber du müsstest das ganze Geld vorstrecken«, gab Josie zu bedenken.
»Ich werde es investieren, nicht vorstrecken. Und zu gegebener Zeit erwarte ich die Rückzahlung und außerdem eine Beteiligung.«
»Die bekommst du«, bestätigte ihr Josephine, noch immer unsicher, ob ihre Mutter es wirklich ernst meinte.
»Ich freue mich darauf, die Verantwortung künftig mit dir zu teilen. Schon morgen wirst du dich beweisen können, indem du mich hier im Grand vertrittst, während ich in Berlin bin.«
»Selbstverständlich, maman. Aber wäre es nicht besser, wenn ich dich begleite und vor Ort unterstütze? Es wird bestimmt nicht einfach, Constantin vor Gericht stehen zu sehen.«
»Nein.« Bernadette schüttelte entschieden den Kopf. »Ich brauche dich hier.« Sie wollte auf keinen Fall, dass ihre Tochter während des Prozesses mit alldem konfrontiert wurde, was ihr Bruder an Geschäften betrieb, auch wenn Josephine während ihrer Zeit im Astor in Berlin so einiges mitbekommen hatte, doch das behielt sie für sich. Außerdem wäre es in der Tat eine hervorragende Gelegenheit für Josie, ihre Führungsqualitäten hier, im Hotel in Binz, unter Beweis zu stellen.
»Gut. Ich werde dich nicht enttäuschen«, versprach Josephine, die gleich viel selbstbewusster wirkte.
»Das weiß ich. Und nun entschuldige mich bitte, ich habe noch einiges vorzubereiten bis morgen.«
»Natürlich, maman.« Josephine stand auf und wandte sich zum Gehen. »Ich danke dir für dein Vertrauen.« Als sie den liebevollen Blick ihrer Mutter bemerkte, machte sie noch einmal kehrt und drückte ihr einen Kuss auf die Wange.
Bernadette lächelte. »Wir sehen uns zum Abendessen, Josie. Ich bin gespannt auf deine Zeichnungen. Wenn du magst, kannst du ja schon mal mit einer Aufstellung der größeren Anschaffungen beginnen und überlegen, wie viel Kapital dafür deiner Meinung nach vonnöten ist.«
Als ihre Tochter das Zimmer verlassen hatte, atmete Bernadette einmal tief durch und widmete sich dann der noch zu erledigenden Korrespondenz. Gleich morgen früh würde sie mit dem Zug nach Berlin fahren und den Tag mit Constantin verbringen, bevor zwei Tage später der Prozess begann.
Sie war auch mit Götz verabredet – mit Major Götz Wilhelm, dem Mann, der einst ihr Verlobter gewesen war. Sie wusste noch nicht recht, ob sie sich darauf freuen sollte. Es sollte bei dem Treffen um ihre Schwiegertochter Margrit und deren Verbleib gehen, da Götz in den letzten Wochen umfangreiche Ermittlungen über diese angestellt und nun offenbar eine erste Spur hatte. Gewiss würde es auch um sie beide gehen, war doch zwischen ihnen längst nicht alles ausgesprochen, was zu besprechen war. Zum jetzigen Zeitpunkt hätte Bernadette nicht sagen können, was sie für Götz empfand. Aber etwas in ihr drängte, es herauszufinden, und wenn es auch nur dazu gut war, um einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen.
2. Kapitel
Ich bin voller Hoffnung. Aber die Angst, dass am Ende womöglich doch nicht alles gut wird, schnürt mir die Kehle zu.
MARIE REIDEL
Marie lächelte, als Constantin ihr Büro betrat, obwohl ihr eigentlich nicht danach zumute war. In zwei Tagen würde der Prozess beginnen, der darüber entschied, ob der Mann, den sie liebte, von den Anklagepunkten freigesprochen wurde oder für einen Mord, den er nicht begangen hatte, ins Zuchthaus kam. An Letzteres mochte sie nicht einmal denken.
»Na?« Er schloss die Tür hinter sich und umrundete ihren Schreibtisch.
Marie stand auf, umarmte und küsste ihn liebevoll.
»Wann hast du dich denn heute früh rausgeschlichen?«, fragte Constantin mit diesem zärtlichen Unterton in der Stimme, von dem Marie wusste, dass er nur ihr vorbehalten war.
»So gegen vier, halb fünf«, antwortete sie. »Ich weiß es nicht genau.«
»Schöner wäre es, du würdest noch neben mir liegen, wenn ich aufwache.«
»Du weißt doch, dass niemand von uns erfahren darf«, antwortete Marie, und die Beklemmung darüber war deutlich herauszuhören.
»Ja, ich weiß.« Constantin zog sie noch einmal an sich und gab ihr einen langen Kuss, der Maries zarten Körper vor Leidenschaft beben ließ. Dann löste er die Umarmung und nahm auf einem der Besucherstühle Platz. »Aber schön wäre es trotzdem«, beharrte er lächelnd. »Also gut, Fräulein Reidel, was liegt denn an diesem wunderbaren Sommertag in unserem ausgezeichneten Hotel an?«
Marie atmete einmal tief durch und tastete nach ihrem hellblonden Haarknoten, den sie wie ihr großes Vorbild Bernadette im Nacken geschlungen hatte. Sie musste sich zusammennehmen, um Constantin nicht zurechtzuweisen. Seine unbeschwerte Art, mit der er den Prozess und dessen mögliche Folgen überspielte, ja sogar einfach nicht ernst zu nehmen schien, machte ihr zu schaffen. Die Überzeugung, nichts und niemand könne ihm etwas anhaben, brachte Marie schier zur Weißglut. Anfangs hatte sie geglaubt, er versuche damit nur seine eigenen Befürchtungen zu überspielen, doch dann hatte sie erkannt, dass er es vollkommen ernst meinte. Constantin dachte nicht im Traum daran, dem bevorstehenden Prozess die Bedeutung beizumessen, die er verdiente. Da war kein bisschen Demut oder gar Sorge in Constantin. Nein. Er erwartete schlicht, dass die gegen ihn vorliegende Anklage niedergeschlagen wurde und er als freier Mann den Saal verließ – eine Arroganz, mit der Marie nicht zurechtkam. Sicher, er hatte den Mord an Gustav von Kempner nicht begangen. Das stand fest. Trotzdem wurde er dessen beschuldigt, und von Kempners Leiche war hier im Astor gefunden worden, auch wenn der Tote ganz offensichtlich ins Hotel gebracht und dort abgelegt worden war – auf welchem Wege auch immer. Denn obwohl man dem Mann die Kehle durchtrennt hatte, war kaum Blut auf der Bettdecke gewesen. Genau darauf baute Constantins Rechtsanwalt Dr. Wilhelm Rebenschlag seine Verteidigung auf. Allerdings gab es Zeugen, die bestätigten, dass Constantin Streit mit von Kempner gehabt hatte, außerdem war allgemein bekannt, dass er nicht zu den Männern gehörte, die viel Federlesens mit ihren Gegnern machten. Und dass die Leiche im Hotel entdeckt worden war, erklärte sich nach Meinung der Anklage so, dass Constantin von Kempner an einem anderen Ort so schwer verletzt hatte, dass er sich gerade noch bis zu seinem Zimmer schleppen konnte, wo er schließlich verstarb. Hätte die Polizei nicht einen Hinweis erhalten und sogleich im Astor nachgesehen, hätte Constantin den Toten vermutlich einfach wegschaffen und irgendwo vergraben lassen. So war ihm die Polizei zuvorgekommen. In der Hotelwäscherei waren die Beamten auf Constantins Anzug gestoßen, der über und über mit Blut besudelt gewesen war, was die Anklage deutlich stützte. Constantin hatte erklärt, dass das Blut von einem Boxkampf stammte. Er habe direkt danebengestanden, als einer der Kämpfer, Fritz Langkamp, seinen Gegner mit einem Schlag so schwer verletzte, dass das Blut in alle Richtungen schoss. Diese Aussage hatte Fritz Langkamp bestätigt, doch das schien für die Polizei nicht zu zählen. Und sowohl der Ermittler als auch der Staatsanwalt schienen an Constantin ein Exempel statuieren zu wollen, um damit den immer mehr an Macht gewinnenden Ringvereinen entgegenzutreten. Da kam ihnen ein Verfahren gegen den obersten Chef in Berlin gerade recht.
Doch Constantin schien das alles nicht zu interessieren, er hatte Marie sogar gebeten, sich am Donnerstagnachmittag nichts vorzunehmen, da er nicht vorhabe, allzu lange im Gerichtssaal zu bleiben. Diese Überheblichkeit machte Marie wütend, so wütend, dass sie ihn manchmal hätte ohrfeigen mögen.
»Was ist denn?«, fragte er, als sie seine Frage bezüglich der Vorkommnisse im Hotel nicht beantwortete.
»Ach, nichts«, wehrte sie ab, um nicht erneut das Thema anzuschneiden, das ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte und über das sie in letzter Zeit schon so oft gesprochen hatten. Sie klappte die Mappe auf, die vor ihr auf dem Schreibtisch lag. »Hier ist nichts Außergewöhnliches passiert. Ein Ehepaar hat sich über den Lärm aus dem Nachbarzimmer beschwert. Wir haben es daraufhin in eine der Suiten umquartiert, mit der sie offenbar sehr zufrieden sind.«
»Wer war denn im Nachbarzimmer?«, wollte Constantin wissen.
»Zwei Herren, die heute Nacht zwei Mädchen aus dem Varieté mitgebracht haben. Martin Klein hatte Dienst an der Rezeption. Ich werde ihm nachher noch einmal klarmachen, dass solche Gäste im Hotel unerwünscht sind.«
»Du siehst das zu eng, Marie. Lass sie doch ihren Spaß haben.«
»Zum einen ist es, wie du sehr genau weißt, gegen das Gesetz, sie zu beherbergen, wenn sie sich mit ihrer Begleitung nicht als Ehepaar ausweisen können«, erklärte Marie und hielt schulmeisterlich den Zeigefinger in die Luft. »Und zum anderen«, nun nahm sie auch den Daumen hinzu, »leidet der Ruf des Hotels darunter und schreckt gehobene Gäste ab.«
»Und trotzdem ist das Leben zu kurz, um auf jeden Spaß zu verzichten«, stellte Constantin grinsend fest.
Marie musterte ihn. In Momenten wie diesen wusste sie nicht, weshalb sie sich in ihn verliebt hatte. Alles, wofür er stand und was er nach außen trug, verabscheute sie. Sie konnte und wollte nicht über schlechtes und unmoralisches Benehmen hinwegsehen, und es war lächerlich zu glauben, dass Constantin dies jemals verstehen würde. Für ihn schien alles nur ein Spiel zu sein, nichts nahm er ernst oder dachte auch nur einen Augenblick darüber nach. Nein, für ihn war jede gesellschaftliche Konvention ein lächerliches Relikt aus der Kaiserzeit. Constantin und sie waren so verschieden wie Tag und Nacht, und eigentlich war es nahezu ausgeschlossen, dass sie einander liebten. Dennoch taten sie es. Und das so sehr, dass sie der Gedanke, jemand könnte versuchen, ihr Constantin zu nehmen, in blanke Panik verfallen ließ. Sie liebte ihn, und er liebte sie. Daran zweifelte sie keinen Augenblick. Bei all seinen Schwächen und Verfehlungen war Constantin doch der Mann, von dem sie wusste, dass er alles, wirklich alles für sie tun würde – ohne Wenn und Aber. Allein dafür liebte sie ihn, war doch die erste Liebe ihres Lebens mehr als nur eine Enttäuschung gewesen. Es war noch gar nicht lange her, nicht einmal eineinhalb Jahre, dass sie sich auf die Affäre mit dem Arzt Dr. Robert Herbst, einem verheirateten Mann, eingelassen hatte und sogar schwanger von ihm geworden war. Sie hatte das Unfassbare zugelassen und das Kind abgetrieben. Er hatte es von ihr verlangt, angeblich, damit sie gemeinsam glücklich werden könnten. Marie konnte nur den Kopf schütteln über die Naivität, die sie damals an den Tag gelegt hatte. Sie hatte an die große Liebe geglaubt, und er hatte sich einfach nur von ihr geholt, was er wollte, und sie dann fallen lassen. Nein, nicht fallen lassen – er hatte sie weggeworfen, als wäre sie Müll. Noch immer stieg Übelkeit in ihr auf, wenn sie an den Sommer des Jahres 1924 zurückdachte. Noch immer glaubte sie, den Geruch des Reinigungsmittels wahrnehmen zu können, mit dem Robert nach der Abtreibung das Zimmer gereinigt hatte. Warum nur hatte sie das getan? Diese Übelkeit, das wusste sie genau, würde sich nie ganz vertreiben lassen, würde bleiben, solange sie lebte.
Constantin wusste nichts von dem, was sie mit Robert verbunden hatte, und so sollte es auch bleiben. Auch wenn sie sich manchmal, in einem stillen Moment, ausmalte, wie es wohl wäre, ihm von alldem zu erzählen und anschließend zuzusehen, was er mit ihrem früheren Geliebten anstellen würde, der noch immer als Arzt hier im Hotel arbeitete. In diesen Augenblicken stieg ein Gefühl der Befriedigung in Marie auf, doch sie wusste, dass sie sich Constantin niemals anvertrauen würde. Täte sie es, wäre das Leben von Dr. Robert Herbst keinen Pfennig mehr wert, und sie hatte schon die Seele ihres eigenen, ungeborenen Kindes auf dem Gewissen. Noch mehr wollte sie sich nicht aufladen.
»Marie?«, holte Constantin sie aus ihren Gedanken zurück. »Was ist denn los mit dir? Du bist so abwesend.«
Sie hob den Blick und zwang sich zu einem Lächeln. »Gerade habe ich mich gefragt, warum ich dich eigentlich so liebe.«
Constantin grinste noch breiter. »Das kann ich dir sagen. Weil ich einfach unwiderstehlich bin.« Er stand auf und wollte zu ihr herüberkommen, doch sie hob die Hand.
»Bleib bitte dort sitzen. Sonst werden wir die Hotelangelegenheiten niemals klären«, wehrte sie ab.
Constantin seufzte. »Erst redest du von Liebe, und dann weist du mich zurück. Das ist nicht sehr nett, Fräulein Reidel.« Er setzte sich wieder. »Doch ich verzeihe dir.«
Marie konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. »Ich werde es künftig bedenken«, gab sie zurück und blätterte in ihren Unterlagen. »Hm, was gab es sonst noch? Wir haben einen Gast, der seine Rechnung nicht bezahlen konnte. Ich habe ihm eine Frist von einer Woche eingeräumt, das dürfte genügen, um sie zu begleichen. Sollte er das nicht tun, würde ich ihm gern zwei deiner Leute vorbeischicken, damit sie ihn an den Außenstand erinnern.«
»Wo wohnt der Kerl?«
»In Wuppertal. Er war mit einem weiteren Gast in Berlin und hat sich wohl ein paar recht teure Tage gegönnt. Allerdings hat er mir mehrfach versichert, die Zahlung so bald wie möglich anzuweisen.«
»Hast du ihm gesagt, was passiert, wenn er es rein zufällig vergessen sollte?«, fragte Constantin, in dessen Stimme sich sofort ein drohender Unterton schlich.
»Ich denke, er hat mich verstanden.« Marie nickte. »Offenbar möchte er unbedingt vermeiden, dass jemand bei ihm vorstellig wird. Ich denke, er ist einer dieser Kerle, die zu Hause eine Familie haben und anderswo das Vergnügen suchen.« Sie hob die Augenbrauen und schüttelte missbilligend den Kopf.
»Hätten wir ein gemeinsames Zuhause, würde ich keinen Augenblick daran denken, anderswo mein Vergnügen zu suchen«, sagte Constantin ernst.
»Ich weiß«, erwiderte Marie. Sie war fest davon überzeugt, dass seine Worte der Wahrheit entsprachen. Das war es, was sie an Constantin über die Maßen schätzte. Er stellte sich nicht besser dar, als er war, und er heuchelte nicht. Niemals. Wenn er etwas sagte, konnte man sich zu hundert Prozent darauf verlassen, dass er hielt, was er versprach.
»Ich meine es ernst, Marie. Welches Bild du auch immer von mir gehabt haben magst, als du nach Berlin gekommen bist, es ist nichts als Show. Ich spiele eine Rolle, genau wie die Darsteller im Varieté auf der Bühne.« Er sah sie nachdenklich an. »Alles, was ich habe, würde ich sofort eintauschen, um mit dir leben zu können.«
»Du weißt doch, dass das nicht geht, Constantin.« Sie lächelte, doch etwas Trauriges lag in ihrem Blick. »Du hast es mir gesagt, als wir uns näherkamen. Ich wusste also, worauf ich mich einlasse, und habe es akzeptiert. Wenn jemand von uns wüsste, wäre ich in Gefahr und du damit erpressbar. Also haben wir eben nur die wenigen gestohlenen Stunden. Und damit kann und will ich leben.«
Constantin stand abermals auf, um Marie in die Arme zu schließen. Diesmal hielt sie ihn nicht zurück.
»Ich kann ebenfalls damit leben«, flüsterte er in ihr helles, seidiges Haar. »Doch ich will es nicht.«
Sie schmiegte sich an ihn. »Wir haben keine Wahl.«
»Man hat immer eine Wahl«, widersprach er, beugte sich hinunter und sagte leise: »Ich liebe dich, Marie. Das habe ich noch zu keiner Frau vor dir gesagt. Vertrau mir und darauf, dass ich alles regeln werde.«
Sie nickte, dann senkte sie den Blick. »Und was, wenn du nicht freigesprochen wirst?«
»Ich habe den Mord nicht begangen.«
»Das weiß ich.« Dennoch war seine Weste alles andere als weiß, doch diese Bemerkung verkniff sich Marie. Stattdessen sagte sie: »Aber dieser Staatsanwalt hat es auf dich abgesehen. Das hat Dr. Rebenschlag auch gesagt.«
»Dieser Staatsanwalt ist ein Emporkömmling und machthungrig«, stellte Constantin ohne jede Emotion fest. »Solche Kerle sind alle gleich. Sie haben ein Ziel vor Augen und rennen mit Scheuklappen darauf zu. Wenn man allerdings nicht nach rechts und links blickt, verliert man schnell mal die Umgebung aus den Augen und sieht vieles nicht kommen.«
Marie trat einen Schritt zurück und suchte seinen Blick. »Was hast du vor, Constantin? Du wirst diesem Staatsanwalt doch nichts antun lassen?«
»Damit man mich dafür drankriegt?« Er lächelte abschätzig. »Das wäre dann doch zu wenig subtil und vermutlich genau das, was sich die Behörden wünschen. Einen jungen Staatsanwalt können die gut und gerne entbehren, wenn sie dafür einen dicken Fisch wie mich an Land ziehen.«
»Manchmal macht mir die Art, wie du denkst, wirklich Angst.« Marie schauderte.
»Du brauchst keine Angst zu haben«, versicherte er ihr. »Ich verspreche dir: Staatsanwalt Junghans wird nichts geschehen. Ich werde ihm sogar einen Schutzengel zur Seite stellen«, fuhr Constantin fort, und wieder umspielte ein Lächeln seine Lippen, doch es erreichte seine Augen nicht.
»Du führst doch etwas im Schilde«, mutmaßte Marie. »Ich kenne diesen Gesichtsausdruck.«
»Selbstverständlich«, stimmte er ihr zu. »Doch was, werde ich dir nicht verraten. Schließlich wirst du so bei jeder möglichen Befragung die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagen können, nämlich dass du von gar nichts gewusst hast und auch in Zukunft nichts wissen wirst. Ich halte dich da raus, Marie. Du musst mir einfach vertrauen, dass ich weiß, was ich tue.«
»Ich vertraue dir«, versicherte sie ihm. »Und zwar voll und ganz.«
»Das ist gut.« Er strich ihr zärtlich eine Strähne, die sich aus ihrer Frisur gelockert hatte, aus dem Gesicht. »Denn ich werde alles in unserem Sinne regeln, Marie. Ich verspreche es dir.«
»Versprich mir nur, dass du nicht ins Zuchthaus kommst.«
»Auch das verspreche ich dir. Das und noch so viel mehr.« Noch einmal berührte er zärtlich ihr Gesicht. »Ich hätte nie gedacht, für eine Frau jemals so empfinden zu können wie für dich. Und deshalb werde ich auf keinen Fall zulassen, dass uns irgendjemand trennt, weder ein Staatsanwalt noch ein Richter noch sonst wer.« Er drückte seine Lippen auf ihre. Als sie sich wieder voneinander lösten, raunte er: »Nicht mehr lange, dann ist das alles überstanden.«
»Ich hoffe es«, gab sie etwas bang zurück und lehnte ihren Kopf an seine warme, breite Brust. »Was hast du jetzt vor?«, flüsterte sie und wünschte sich, sie könnten für immer so verharren.
»Ich mache mich auf den Weg zur Boxhalle am Westhafen«, antwortete er und strich mit seinen großen Händen über den glatten, glänzenden Stoff ihres eleganten Kleides, der ihren schmalen Rücken bedeckte. »Heute sollen sich zwei neue Boxer vorstellen, und Gerd hat mich gebeten hinzuzukommen.«
Marie war ein wenig überrascht, hatte doch Constantins Interesse an den Boxkämpfen seit Gustav von Kempners Tod und seiner darauffolgenden Verhaftung merklich nachgelassen. Fast hatte sie geglaubt, er sei nicht länger daran interessiert, das Geschäft weiter voranzutreiben, da er nach und nach alles, was damit zusammenhing, seiner rechten Hand Gerd Nolte überlassen hatte. Als sie von Binz nach Berlin kam, hätte sie nie gedacht, dass sich Constantin einem anderen Menschen öffnen würde als Gerd – obwohl sie natürlich nicht wusste, wie weit er das tatsächlich getan hatte, doch er schien ihm zu vertrauen. Jetzt aber war sie seine engste Vertraute.
Sie kannte Constantin, seit sie ein kleines Mädchen war, weil ihre Mutter Gertrud viele Jahre als Zimmerfrau im Grand Hotel in Binz gearbeitet hatte, bis die Schwindsucht sie viel zu früh aus dem Leben riss. Marie und ihre jüngere Schwester Lisa hatten sie häufig ins Hotel begleitet, und später war Marie wie selbstverständlich in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten. Constantin und sie hatten sich immer gut verstanden, sie war nur damals so unglaublich schüchtern gewesen, eine kleine graue Maus, die hastig an ihm vorbeihuschte und sogleich wieder in ihrem Mauseloch verschwand, sodass sie kaum Gelegenheit hatten, einander wirklich kennenzulernen. Doch seitdem sie Binz den Rücken gekehrt und ihn im Hotel Astor um eine Anstellung gebeten hatte, war sie ein anderer Mensch geworden. Sie hatte sich nicht mit einer Stellung als Zimmermädchen begnügt, stattdessen hatte sie ihm ohne Umschweife mitgeteilt, dass sie sich in der Rolle der Hausdame sehe und sich eine Chance wünsche, dies zu beweisen. Er hatte ihr diese Chance gegeben, und sie hatte ihn nicht enttäuscht. Sie bewältigte jede Aufgabe mühelos und hielt Constantin den Rücken frei. Ja, er konnte sich auf sie verlassen, nicht nur, was die Belange des Astor betraf. Sie war verschwiegen und wusste, wann es besser war, nur zuzuhören, statt selbst etwas zu sagen. Vor allem aber wusste sie, dass niemand von ihrer Liebe erfahren durfte, da sie ihn angreifbar machte.
»Noch eins, bevor du zur Boxhalle aufbrichst«, sagte sie und zwang sich, die Gedanken an die Vergangenheit zu verdrängen und sich auf die Gegenwart zu konzentrieren. »Deine Mutter hat bestätigt, dass sie morgen in Berlin eintrifft. Sie würde gern mit uns essen, doch ich fürchte, es erweckt unnötige Aufmerksamkeit, wenn wir zu dritt mit ihr an einem Tisch sitzen …«
Constantin durchquerte das Büro und legte die Hand auf die Türklinke. »Im Gegenteil. Jeder weiß, dass du aus Binz kommst und viele Jahre für meine Mutter gearbeitet hast. Es wäre eher überraschend, wenn du nicht dabei wärst.«
»Da hast du natürlich recht«, pflichtete Marie ihm bei. »Ich werde den Koch anweisen, morgen viel frischen Fisch zu kaufen. Bernadette liebt es, eine Auswahl zu haben.«
»Und ich liebe dich dafür, dass du an solche Sachen denkst. Weißt du das?«
Marie nickte, dann tat sie so, als wollte sie ihn zur Tür hinausschieben, und drängte: »Und jetzt raus mit dir, sonst schaffe ich meine viele Arbeit nicht, Herr von Plesow.«
»Ganz wie Sie wünschen, Fräulein Reidel.« Er verbeugte sich und tat so, als zöge er einen Hut. »Dann noch einen angenehmen Tag.«
»Verbindlichsten Dank und ebenso.« Sie schüttelte lachend den Kopf und sah ihm nach, wie er zur Tür hinaus und durch den langen Gang in Richtung Treppe verschwand.
Noch immer lächelnd, kehrte sie an ihren Schreibtisch zurück und vertiefte sich in ihre Korrespondenz, bis ein Klopfen sie aus ihrer Arbeit riss.
»Ja, bitte?«
Die Tür ging auf, und Dr. Robert Herbst, ihr früherer Geliebter, trat ein. Sofort spürte Marie die vertraute Übelkeit in sich aufsteigen, gepaart mit einem zunehmenden Unbehagen.
»Guten Tag, Marie.«
»Guten Tag, Robert.«
»Ich bin auf der Suche nach Herrn von Plesow, und mir wurde mitgeteilt, dass er vermutlich hier ist.«
»Er ist bereits gegangen und dürfte das Hotel schon verlassen haben. Frag am besten an der Rezeption nach. Wenn er dort nicht vorbeigegangen ist, könnte er noch in seinen Privaträumen sein.«
»Danke.«
Sie nickte ihm zu und blickte wieder auf ihre Korrespondenz, doch der Arzt blieb noch stehen. »Ist noch etwas?«
»Ich wollte dir gern etwas sagen. Etwas Persönliches.«
Ihre Miene blieb unbewegt. »Ich denke nicht, dass du mir etwas Persönliches anvertrauen solltest. So nahe stehen wir uns nun wirklich nicht.«
»Nein«, pflichtete er ihr bei, doch er trat einen Schritt näher und schloss die Tür hinter sich. Maries Unbehagen verstärkte sich noch mehr. »Genau genommen bist du die Einzige, der ich davon erzählen möchte.«
»Ich wüsste nicht …«, begann Marie, doch Robert fiel ihr ins Wort.
»Ich werde mich von meiner Frau trennen, Marie. Wir haben die Entscheidung gestern getroffen. Ich werde mich noch heute auf Wohnungssuche begeben.«
Marie sah ihn einen Moment lang wortlos an. Sie wusste nicht, wie sie auf diese Ankündigung reagieren sollte. Was hätte sie vor gut einem Jahr für diese Nachricht gegeben! Sie nahm sich einen Augenblick, in sich hineinzuhorchen, ob da irgendein anderes Gefühl als Verachtung für diesen Mann war, der hier in ihrem Büro stand und ihr Derartiges verkündete, doch da war kein Widerhall, kein Echo. Nichts.
»Offen gestanden, ist mir nicht klar, weshalb du ausgerechnet mir davon erzählst. Oder möchtest du mich auf diesem Wege um ein Hotelzimmer bitten, in dem du unterkommen kannst, bis du eine geeignete Wohnung gefunden hast? Wenn du einen Sonderpreis haben möchtest, werde ich mit Constantin darüber sprechen.«
»Du weißt doch genau, warum ich dir das sage, Marie.« Seine Stimme schwoll an. »Ganz bestimmt nicht, weil ich ein Hotelzimmer billiger haben möchte. Der einzige Grund, warum ich nicht mehr mit meiner Frau leben will, nicht mehr mit ihr leben kann, bist du. Ich kann nicht vergessen, was zwischen uns war.«
Maries Miene wurde ernst. Sie dachte an Bernadette, ihr großes Vorbild, und überlegte, wie diese wohl in einer solchen Situation reagieren würde. Langsam stand sie von ihrem Stuhl auf, straffte die Schultern und hob den Kopf.
»Zum einen, Robert, bitte ich dich – nein, ich fordere dich auf –, in meinem Büro nicht die Stimme zu erheben, denn das steht dir nicht zu. Und zum anderen kann ich dir versichern, dass auch ich niemals vergessen werde, was zwischen uns war.« Sie atmete einmal tief durch, bevor sie weitersprach. »Denn du und dein Verhalten waren die bittersten Erfahrungen meines Lebens, und ich werde mir bis ans Ende meiner Tage vorwerfen, dass ich die Abtreibung habe vornehmen lassen. Ich hätte dich mit allen Mitteln davon abhalten und für das Leben meines Kindes kämpfen müssen. Doch das habe ich nicht getan.«
Sein Gesichtsausdruck wurde zerknirscht. Er machte einen vorsichtigen Schritt auf sie zu. »Ich weiß ja, dass ich das nie hätte tun dürfen, aber versteh doch …«
Sie hob die Hand und brachte ihn so zum Schweigen. »Da gibt es nichts zu verstehen. Und wenn du glaubst, ich würde irgendwelche anderen Gefühle für dich empfinden als Abneigung, Wut und Verachtung, irrst du gewaltig.« Sie verschränkte die Arme vor dem Körper. »Ich habe sogar überlegt, die Abtreibung zur Anzeige zu bringen, weil ich der Überzeugung bin, dass jemandem wie dir die Approbation entzogen werden sollte. Allerdings ist es mir einfach zu peinlich, dass ich auf einen wie dich hereingefallen bin.« Sie baute sich drohend vor ihm auf. »Ich warne dich, Robert, sollte mir irgendwer das Gerücht zutragen, dass du und ich einander jemals anders verbunden waren als in der Funktion des Arztes und der Hausdame des gleichen Hotels, dann werde ich meine Befindlichkeiten hintanstellen und dich, ohne zu zögern, melden.« Sie hob das Kinn und fügte mit ruhiger, fester Stimme hinzu: »Leg dich nicht mit mir an, Robert. Sonst wirst du es bereuen.« Damit machte sie kehrt und setzte sich wieder an ihren Schreibtisch.
»Ich erkenne dich nicht wieder, Marie«, stieß der Arzt fassungslos hervor.
»Das nehme ich als Kompliment. Und nun wünsche ich dir einen guten Tag und wäre dir verbunden, wenn du die Tür von außen schließen würdest.« Damit wandte sie den Blick ab und widmete sich erneut den Unterlagen auf ihrem Schreibtisch. Erst als sie das leise Klicken des Türschlosses hörte, sah sie wieder auf. Er war gegangen, ohne etwas zu erwidern. Ein grimmiges Lächeln trat auf ihre Lippen. Wie sehr sie diesen Kerl doch hasste!
3. Kapitel
Ich freue mich so sehr auf das, was vor mir liegt. Endlich kann ich mich beweisen.
JOSEPHINE VON PLESOW
Am liebsten hätte sich Josephine direkt nach dem Gespräch mit ihrer Mutter an die Arbeit gemacht und eine Aufstellung begonnen mit den Dingen und Gegenständen, die ihrer Meinung nach für das Hotel anzuschaffen waren, und deren etwaigen Wert zu ermitteln. Doch das könnte sie auch noch in den nächsten Tagen erledigen, wenn ihre Mutter in Berlin war, um Constantin während des Prozesses zu unterstützen. Jetzt würde sie sich erst einmal den Zeichnungen widmen, auf denen sie ihre Vorstellungen vom künftigen Palais zum Ausdruck bringen wollte, doch zuallererst waren ihre Neffen dran. Sie kümmerte sich um die beiden, hatten die armen Kerlchen doch niemanden mehr, der sich für sie zuständig fühlte, seit ihre Mutter sie so schnöde im Stich gelassen hatte. Natürlich sorgte auch Bernadette als Großmutter für die beiden, doch fehlte dieser wegen der vielen Arbeit im Hotel oftmals die nötige Zeit. Josephine hoffte inständig, dass es ihrer Mutter gelänge, in Berlin neben dem Prozessgeschehen die Zeit zu finden, Margrit ausfindig zu machen und dazu zu bewegen, nach Binz zurückzukehren und sich ihrer mütterlichen Verantwortung zu stellen. Wie kaltherzig diese Frau doch war, die Dreijährigen einfach zurückzulassen, und das nur, weil sie sie daran hinderten, ihr eigenes Leben zu führen. Allein bei dem Gedanken hätte Josephine am liebsten ausgespuckt vor Verachtung. Sie hatte die Frau ihres verstorbenen Bruders Alexander von Anfang an nicht leiden können und verstand nicht, was dieser je an ihr gefunden hatte. Immerhin war er ein gut aussehender und überaus erfolgreicher Mann gewesen, der gewiss keine Schwierigkeiten gehabt hätte, jede Frau von sich zu überzeugen, die er nur wollte. Doch offenbar hatte er sich ausgerechnet in die zickige und arrogante Margrit verliebt. Weshalb, war für Josephine ein Rätsel. Genau wie ihr Bruder ein Rätsel für sie dargestellt hatte, war er doch keineswegs der Mann gewesen, für den sie ihn gehalten hatte. Er war offenbar ein großer Anhänger der NSDAP gewesen, überzeugt davon, dass dieser Hitler der richtige Mann war, um Deutschland aus der Krise zu holen, was Josephine vollkommen anders sah. Zwar folgte sie in politischer Hinsicht zugegebenermaßen im Grunde niemandem wirklich und wusste auch, dass sie viel zu leicht beeinflussbar war, weil sie sich für politische Themen nur mäßig interessierte, doch die Tendenzen der NSDAP machten ihr mitunter sogar Angst. Andererseits glaubte sie nicht daran, dass nach der langen Zeit der Monarchie wieder jemand an die Macht käme, der sich als Alleinherrscher sah, aber wirklich wusste sie es nicht. So vielen im Land ging es schlecht – den meisten, um genau zu sein. Nur für die, die mehr Geld zur Verfügung zu haben schienen, als sie ausgeben konnten, war scheinbar alles in Ordnung. Josephine hatte während ihrer Zeit in Berlin die eine wie die andere Seite gesehen. Und das meiste von dem, was sie mitbekommen hatte, hatte sie einfach nur erschreckt. Das zügellose Leben mit Unmengen an Luxus, Alkohol, Drogen und Partys auf der einen und Menschen, die kaum mehr ein Dach über dem Kopf oder genug zu essen hatten, auf der anderen Seite. Ganz zu schweigen von denen, die auf die übelste Art und Weise für die Reichen da zu sein hatten, Menschen wie ihre Freundin Lotte. Lotte hatte für Constantin gearbeitet, eigentlich als Bedienung im Varieté, doch in Wahrheit hatte sie sich für die wohlhabenden Gäste prostituieren müssen. Auch diesen Bruder hatte sie offenbar nie richtig gekannt, genauso wenig wie Alexander. Josephine hatte es anfangs nicht fassen können, was für ein Mann Constantin in Wirklichkeit war, hatte sie doch immer nur den lieben großen Bruder in ihm gesehen, der sie stets in Schutz nahm. Mittlerweile hatte sie verstanden, dass sie die Dinge so nehmen musste, wie sie waren, konnte sie doch ohnehin nichts daran ändern. Wenigstens hatte sie Lotte helfen können, die inzwischen eine Lehre als Zimmermädchen im Grand hier in Binz machte und damit ein sicheres Leben führte – auch wenn das nichts an der Lage all der anderen jungen Frauen änderte, die in ähnlichen Situationen gefangen waren. Es war wichtig, dass man half, wenn man dazu imstande war, das hatte ihr ihre Mutter schon als kleines Mädchen beigebracht, und nun würde sie ihren Neffen helfen. Entschlossen sprang sie die Stufen zum Privathaus hinauf und trat ein.
Sie wollte die Zwillinge ins Palais mitnehmen und sich dort ein wenig umsehen, bevor sie mit den beiden an den Strand ging, um Friedrich zu treffen, der während der Sommermonate stets für mehrere Wochen seine Eltern in Binz besuchte, um sich von seinem anstrengenden Jurastudium zu erholen. Sie kannte Friedrich schon seit der Kindheit, und ganz früher hatte sie sogar eine Weile für ihn geschwärmt. Doch das war eine kleine Ewigkeit her, und tatsächlich hatte Josephine damals eigentlich immer jemanden aus dem Ort toll gefunden, der ungefähr mit ihr in einem Alter war. Heute waren fast alle der damaligen Freunde in sämtliche Richtungen verstreut, weil die meisten von ihnen studierten und viele nicht vorhatten, je nach Binz zurückzukehren. So war es im Grunde auch bei ihr selbst gewesen, war sie doch fürs Kunststudium sogar bis nach Paris gegangen. Irgendwann hatte sie jedoch gemerkt, dass das beschauliche Binz genau der Ort war, an dem sie leben wollte, und sie war froh darüber, endlich ihren Platz in der Welt gefunden zu haben.
»Erich, Paul, seid ihr fertig?«, rief sie laut, als sie das Haus betrat.
»Wir sind hier oben, gnädiges Fräulein!«, rief Inge, das Kindermädchen, ebenso laut zurück. »Nein, Erich, warte!« Im nächsten Moment sah Josephine ihren Neffen durch den oberen Flur eilen.
»Tante Josie!«, rief er voller Begeisterung und erreichte schon die Treppe.
»Halt!«, rief Josephine, hob die Hand und blieb selbst stehen. »Eine Stufe nach der anderen, Erich! Sonst nehme ich dich nicht mit.«
Der Kleine gehorchte augenblicklich, hielt sich an den Treppenstäben fest und ging langsam Stufe für Stufe herunter, während nun auch Inge mit Paul an der Hand am Treppenabsatz erschien. Die Erleichterung war ihr anzusehen, als sie sah, wie brav Erich der Aufforderung seiner Tante nachkam. Paul fest an der Hand, stieg sie ebenso langsam die Stufen herunter wie er.
Als Erich schließlich die drittletzte Stufe erreichte, machte Josephine einige schnelle Schritte, rief »Spring!« und fing ihren Neffen auf, um sich mit ihm einige Male um die eigene Achse zu drehen.
Inge wartete mit Paul, bis er an die Reihe kam. Es war dem Jungen anzusehen, dass er sich riesig darauf freute, von seiner Tante durch die Luft gewirbelt zu werden.
»Die beiden sind schon ganz aufgeregt!«, rief Inge lachend.
»Hast du die Badekleidung bereitgelegt?«, fragte Josephine, die dem Kindermädchen schon gestern aufgetragen hatte, sich darum zu kümmern, und stellte Paul auf dem Boden ab.
Inge nickte. »Ja, es ist alles bereit, der Handwagen ist gepackt.«