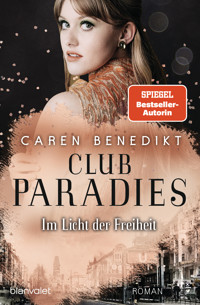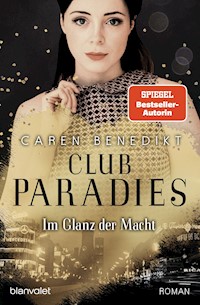6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bremen, 14. Jahrhundert: In einer Zeit der Pest und des Umbruchs macht sich die mutige Duftnäherin Anna auf die Suche nach ihrem vermissten Großvater – und gerät in das Abenteuer ihres Lebens ... Die Stadt Bremen hat mit den Nachwirkungen der Pest zu kämpfen, doch Anna hat sich längst einen Namen als "Duftnäherin" gemacht. Ihr Geheimnis, Seife in die Säume der von ihr geschneiderten Kleider zu nähen, hat sich als wahre Sensation entpuppt. Sie lebt mit ihrer Familie im Haus ihres Großvaters, des Ratsherrn Siegbert von Goossen. Als dieser von einer Reise nach Flandern nicht mehr zurückkehrt, macht sich Anna in höchster Sorge auf, ihn zu suchen. Ihre Reise führt sie in die flämische Handelsmetropole Brügge, wo ein erbitterter Konflikt zwischen der Hanse und den Einheimischen schwelt. Inmitten von Intrigen und Gefahren begegnet Anna dem charismatischen Kaufmann Jean van Laaken. Eine schicksalhafte Begegnung, die nicht nur Annas Herz in Aufruhr versetzt, sondern sie auch dem Geheimnis um das Verschwinden ihres Großvaters näherbringt. Doch kann sie Jean wirklich vertrauen? Ein fesselnder historischer Roman über eine starke Frau, die mutig ihren Weg geht – trotz aller Widerstände einer von Umbrüchen geprägten Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Caren Benedikt
Die Rache der Duftnäherin
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Bremen im 14. Jahrhundert. Anna hat sich in der Stadt, die mit den Nachwirkungen der Pest zu kämpfen hat, längst einen Namen als »Duftnäherin« gemacht. Ihr Geheimnis, Seife in die Säume der von ihr geschneiderten Kleider zu nähen, hat sich als wahre Sensation entpuppt. Sie lebt mit ihrer Familie im Haus ihres Großvaters, des Ratsherrn Siegbert von Goossen. Als dieser von einer Reise nach Flandern nicht mehr zurückkehrt, macht sich Anna in höchster Sorge auf, ihn zu suchen – und gerät in das Abenteuer ihres Lebens …
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Nachwort
Danksagung
Quellenliste
Ich widme dieses Buch meinen Leserinnen und Lesern.
So viele wollten unbedingt wissen, wie es mit meiner Anna weitergeht.
All denen wünsche ich ein besonderes Lesevergnügen, verbunden mit meinem herzlichen Dank für ihre Treue.
»So konnte, wer – zumal am Morgen – durch die Stadt gegangen wäre, unzählige Leichen liegen sehen. Dann ließen sie Bahren kommen oder legten, wenn es an diesen fehlte, ihre Toten auf ein bloßes Brett. Auch geschah es, dass auf einer Bahre zwei oder drei davongetragen wurden, und nicht ein Mal, sondern viele Male hätte man zählen können, wo dieselbe Bahre die Leichen des Mannes und der Frau oder zweier und dreier Brüder und des Vaters und seines Kindes trug.«
Giovanni Boccaccio, Il Decamerone
Das große Sterben breitete sich über die Handelswege zu Wasser an der gesamten Mittelmeerküste aus. Im Jahre des Herrn 1347 erreichte es Konstantinopel und Sizilien, und von dort über die Landwege ganz Europa. Ob es die Ratten oder die Menschen gebracht hatten, wusste am Ende niemand mehr zu sagen. Der Schwarze Tod kannte weder Stand noch Religion. Er machte keine Unterschiede. Einem blind wütenden Monster gleich drang er in die Häuser der Menschen ein, riss ihre Seelen an sich und zeichnete die Nachricht ihres baldigen Todes mit schwarzen Flecken auf ihre ausgezehrten Körper. Kaum eine Familie wurde von ihm verschont. Als die Pestilenz endlich nachließ, waren manche Landstriche entvölkert und in den großen Städten gar bis zu zwei Dritteln der Einwohner tot. Kinder waren zu Waisen geworden, Frauen zu Witwen und Männer verscharrten ihre Lieben mit bloßen Händen in der Erde. Der Schock über die hohen Verluste an Menschenleben lähmte die, die dem Tod entkommen waren. Soziale Strukturen zerbrachen. Viele bedeutende Bürger waren verstorben und ließen ihre Angehörigen ebenso schutzlos zurück wie ihre Ämter. Nicht zu schließende Lücken klafften auf.
Die gesellschaftliche Ordnung und das öffentliche Leben mussten wiederhergestellt, Aufgaben neu verteilt werden. Und so manche Fehlentscheidung, die aus der Not der Zeit heraus geboren wurde, sollten die Menschen noch Jahre später bereuen.
Bremen, im Jahre 1358
1. Kapitel
Schweiß lief ihm über das Gesicht. Das Rauschen in seinen Ohren übertönte das heftige Pochen seines Herzens. Er rannte, so schnell er konnte, blickte sich gehetzt um, stolperte und konnte im letzten Moment verhindern, dass er stürzte. Nur noch um diese Ecke, dann könnte er sich im Haus in Sicherheit bringen. Sein Verfolger war ihm dicht auf den Fersen. Schon glaubte er, dessen Atem in seinem Nacken zu spüren. Eine Hand griff nach ihm, ließ ihn erneut straucheln und diesmal tatsächlich zu Boden stürzen.
Schon war sein Verfolger über ihm und trat ihm mit dem Fuß in die Seite. Obwohl er kaum noch Luft bekam, wehrte er sich verzweifelt gegen die auf ihn niederprasselnden Schläge.
»Gib es her!«
»Nein!«
»Gib es her, oder ich hau dich tot!«
»Nein!« Mit aller Kraft hielt er das Holzstück in seinen Händen und presste es an seinen Körper.
»Es gehört mir!«
Aus den Augen seines Bruders schienen Funken zu sprühen. Der ließ sich auf die Knie fallen und schlug wieder und wieder auf ihn ein.
»Na, na. Auseinander, ihr zwei!«
Robert wurde an seiner Jacke in die Höhe gezerrt.
»Wirst du wohl aufhören?« Der Mann hielt ihn fest und griff dann nach Rafaels Arm, um auch ihn in den Stand zu befördern. »Und jetzt vertragt ihr beide euch wieder!«
»Er hat angefangen!«, beschwerte sich Rafael und zeigte mit dem Finger auf seinen Zwillingsbruder. In der anderen Hand hielt er noch immer die hölzerne Figur fest umklammert.
»Er hat mir meinen Roland gestohlen!« Robert schnaubte vor Wut.
»Trotzdem darfst du mich nicht hauen.«
»Das wirst du schon sehen.«
Mit erhobenen Fäusten ging Robert erneut auf seinen Bruder los.
»Jetzt ist aber Schluss! Ihr seid doch die von Goossen’schen Enkel, nicht?«
Robert ließ die Hände sinken und nickte schuldbewusst mit dem Kopf.
»Dachte ich mir doch, dass ich euch schon einmal gesehen habe.« Er packte jeden mit einer Hand im Nacken und schob sie vor sich her. »Dann werde ich euch jetzt nach Hause bringen. Eure Mutter wird gewiss nicht erfreut sein, zwei solche Lausejungen abgeliefert zu bekommen.«
»Wir finden den Weg schon.« Rafael versuchte, sich aus dem Griff des Hünen zu befreien.
»Das kann ich mir vorstellen. Und dabei werdet ihr euch gleich wieder rangeln.«
Unbeirrt brachte er die Zwillingsbrüder bis vor das prächtige Stadthaus der Familie von Goossen, ging die Stufen zur Eingangstür hinauf, ließ die Jungen los und klopfte. Ein Wachmann öffnete die Tür. Ein paar Schritte hinter ihm tauchte auch schon ein Knecht auf.
»Ich hab hier was, das Euch gehört. Sie haben sich auf der Straße geprügelt wie Lumpenburschen. Ihre Eltern sollten ihnen einmal gehörig den Hintern versohlen und Manieren beibringen, wenn Ihr mich fragt.«
Der Wachmann bedeutete Rafael und Robert mit einer Geste, ins Haus zu gehen.
»Habt Dank, dass Ihr sie heimgebracht habt.«
»Schon recht.« Der Mann stieg die Stufen wieder hinab und ging davon. Krachend wurde die Tür hinter ihm geschlossen.
»Geht euch waschen, bevor eure Mutter euch so sieht. Los doch!«
Kaum hatte Rudolf die Worte ausgesprochen, trat auch schon Anna, die Enkelin des Alten von Goossen aus der Stube in den Flur.
»Was um Himmels willen ist denn mit euch geschehen?« Sie eilte ihren Söhnen entgegen und beugte sich zu ihnen hinab. »Das darf doch wohl nicht wahr sein!«
Wütend hob sie den zerrissenen Ärmel Rafaels in die Höhe. Sein Arm schnellte nach oben.
»Das war Robert!«
Annas Blick wanderte zu ihrem zweiten Sohn. »Stimmt das?«
»Ja.« Es klang kleinlaut.
Rafael lächelte triumphierend.
»Und erklärst du mir bitte auch mal, warum du das gemacht hast?«
»Er hat mir meinen Roland gestohlen.«
»Deinen was?«
Robert griff nach der Hand seines Bruders, die noch immer die kleine Holzstatue umklammerte. Trotzig wehrte dieser sich, bis seine Mutter einschritt und ihm die Figur abnahm.
»Wo habt ihr die her?«
»Wir waren bei Vater, er hat sie uns geschenkt.«
»Und er hat euch nur eine gegeben?«
»Nein! Wir haben beide eine bekommen, aber Rafael hat der seinen beim Spielen den Kopf abgeschlagen. Dann hat er mir meine abgenommen und gesagt, dass ich sie nicht wiederbekäme.«
»Weil ich keine kaputte haben will«, fügte Rafael erklärend hinzu.
»Und deshalb nimmst du deinem Bruder die seine ab?«
»Ja!« Der Junge schien sich keiner Schuld bewusst zu sein.
»Rafael!« Seine Mutter stemmte die Hände in die Hüften. »Die Figur gehört deinem Bruder. Du kannst deinen Vater fragen, ob er dir eine neue macht. Doch du musst ein für alle Mal lernen, dass du nicht das Recht hast, dir von anderen einfach zu nehmen, was du haben willst.«
Sie reichte Robert das hölzerne Spielzeug.
»Danke.«
»Du hast Robert lieber als mich.« Rafael verschränkte die Arme vor der Brust.
»So etwas, junger Mann«, sie fuchtelte mit dem Finger vor seinem Gesicht, »möchte ich nicht noch einmal hören. Du musst lernen, das Eigentum anderer zu respektieren.«
»Mein Patenonkel ist der Bürgermeister dieser Stadt.« Der Achtjährige hob trotzig das Kinn.
»Ja, allerdings. Und wenn ich ihm davon erzähle, wie du dich verhältst, wird er gewiss alles andere als stolz auf dich sein.«
Rafael wollte etwas erwidern, suchte nach Worten. Schließlich konnte er die Tränen nicht länger zurückhalten und stürmte die Stufen zum Obergeschoss hinauf.
»Ich war noch nicht fertig, die Sache wird noch ein Nachspiel haben!«, rief ihm Anna hinterher, hörte aber nur noch, wie die Tür seines Zimmers krachend hinter ihm ins Schloss fiel.
»Es tut mir leid, Mutter.«
Anna ging in die Hocke und fasste Robert bei den Schultern.
»Du musst besonnener sein. Warum bist du nicht nach Hause gekommen und hast die Sache hier geklärt, anstatt dich mit ihm zu prügeln?«
»Aber er ist so ein …« Er brach ab und ballte die Hände zu Fäusten.
»Schscht. Ich will so etwas nicht hören. Ihr seid Brüder und müsst füreinander einstehen.«
»Sosehr ich mir auch wünsche, es wäre anders, kann ich ihn doch nicht ausstehen.«
»Geh dich jetzt waschen. Wir reden später mit deinem Vater über das Ganze.«
Robert nickte und schlug mit hängenden Schultern folgsam den Weg in Richtung Badehaus ein.
»Haben sie sich schon wieder gestritten?« Vorsichtig lugte die sechsjährige Sophie aus der offen stehenden Tür des Tuchzimmers.
Anna nickte, ging zu ihrer Tochter hinüber und schob sie zärtlich zurück in den Raum. »Komm, lass uns das Gewand fertigschneidern.« Sie ließ einen tiefen Seufzer vernehmen. Wenn sich doch ihre Zwillinge nur einmal einen einzigen Tag lang nicht streiten würden.
»Sie bringen mich noch um den Verstand.« Erschöpft und zärtlich zugleich schlang Anna die Arme um den Hals ihres Mannes, der ihre Geste erwiderte und sie an sich drückte.
»Hätte ich gewusst, was ich damit auslöse, wäre ich gewiss nicht auf den Gedanken gekommen, die Figuren zu fertigen.« Gawin schüttelte den Kopf. »Ich mache Rafael eine neue. Dann kehrt wieder Ruhe ein.«
»Aber das löst doch das eigentliche Problem nicht. Sie sind wie Feuer und Wasser.«
»Es sind Jungen, und sie sind acht Jahre alt. Du musst Geduld mit ihnen haben.«
Anna machte sich aus seiner Umarmung frei. »Das ist es nicht, Gawin. Rafael misst stets mit zweierlei Maß und hat keine Achtung vor anderen. Er glaubt, nur weil wir in der Stadt ein gewisses Ansehen genießen, könne er sich alles erlauben. Er nimmt sich einfach, was er will.«
»Dass er sich zu viel herausnimmt, habe ich auch schon bemerkt«, stimmte ihr Mann zu. »Neulich, in der Werkstatt, hat er Andres Anweisungen erteilen wollen.«
»Ein Achtjähriger, der einem Zimmermannsgesellen Befehle gibt?« Anna lachte bitter auf. »Und, wie hat Andres darauf reagiert?«
Gawin seufzte. »Gar nicht. Er hat im Moment andere Sorgen.«
Anna zog ihren Mann zum Bett hinüber und drückte ihn sanft auf die Lagerstatt hinab. »Was ist geschehen? Stimmt etwas nicht mit Judith oder den Kindern? Sind sie krank?«
»Das ist es nicht.« Gawin ließ die Schultern sinken. »Andres hat Angst, nach Hoya zurückzumüssen.«
»Weshalb?«
»Der Druck scheint größer zu werden.« Gawin fuhr sich mit der Hand über die Augen. Er wirkte müde und erschöpft, sein sonst so heiteres und stets zuversichtliches Naturell war in den vergangenen Monaten immer öfter von düsteren Gedanken und ernsthaften Sorgen getrübt worden.
Seit nunmehr sieben Jahren lagen die Stadt Bremen und die beiden Grafen Gerhard III. und Johann II. von Hoya schon miteinander im Streit. Nachdem die Pest im Jahre 1350 beide Orte mit ihrer alles vernichtenden Macht erreicht hatte, waren die menschlichen Verluste auf beiden Seiten enorm angestiegen. Die Bevölkerung Bremens, die vor dem Ausbruch der Seuche etwa an die fünfzehntausend Köpfe zählte, war halbiert. Und die Anzahl der Todesfälle rund um Hoya fiel nicht geringer aus. Viele der dort lebenden Leibeigenen gingen fort, um in Bremen und anderen Städten ihr Glück zu suchen. Und sie wurden belohnt. Bremen nahm sie mit offenen Armen auf, verlieh ihnen gar das Bürgerrecht. Als Neubürger lehnten sie es nunmehr unter Berufung auf die Stadt Bremen und das erhaltene Bürgerrecht strikt ab, als Unfreie wieder in die frühere Abhängigkeit nach Hoya zurückzukehren, um dort die Felder zu bewirtschaften. Selbst ein vor zwei Jahren übermitteltes, offizielles Auslieferungsbegehren der Grafen von Hoya hatte der Bremer Rat zurückgewiesen.
Als weiterer Streitpunkt zwischen Hoya und Bremen kam noch die bereits seit Jahren bestehende Feindschaft zwischen dem Bremer Erzbischof Moritz von Oldenburg und Gottfried von Arnsberg hinzu, der sich seinerzeit bei der Bischofswahl nicht gegen den Oldenburger hatte durchsetzen können und deshalb nun als Verbündeter der Grafschaft Hoya auftrat, was der Fehde weiteren Nährboden gab. Die Angelegenheit war verfahren. Von keiner der beiden Seiten war ein Einlenken zu erwarten.
Im vergangenen Monat, dem 20. Juni des Jahres 1358, waren zudem einhundertfünfzig Bremer Bürger während eines Gefechts an der Aller, einem Fluss zwischen den Gebieten der beiden streitenden Parteien, in die Gefangenschaft Hoyas geraten. Besonders beklagenswert war dabei für Bremen der Umstand, dass sich auch acht von insgesamt zwölf Ratsherren unter den Gefangenen befanden. Die Verhandlungen über eine Auslöse der Bürger dauerten noch an. Siegbert von Goossen, Annas Großvater, führte als einer der wenigen verbliebenen Ratsherren die Verhandlungen mit den verhassten Gegnern. Eine Einigung war auch hierin zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Sicht. Dabei hatte der andauernde Krieg nicht nur die Körper und Geister beider Seiten erschöpft, sondern vor allem in Bremen ein tiefes Loch in die städtischen Kassen gerissen. Es galt also, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Die Befürchtung des in Gawins Diensten stehenden Zimmermannsgesellen Andres, womöglich mit einer Zwangsauslieferung an seinen früheren Herrn rechnen zu müssen, war also keinesfalls unbegründet.
»Hast du schon etwas von Siegbert gehört?«
Anna verneinte. »Noch nicht. Aber er wird eine Lösung finden, glaub mir.« Sie lehnte ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes.
»Das muss er auch. Wenn nicht bald eine Klärung erfolgt, weiß ich nicht, was geschieht.«
»Mit Andres?«
Gawin schüttelte den Kopf. »Es betrifft ja nicht nur Andres, sondern mal hier einen Gerber, mal da einen Gemüsehändler, dort wieder einen Knochenhauer oder Schmied. Bremen würde zusammenbrechen, würden die Menschen gezwungen werden, in die Leibeigenschaft zurückzukehren und als Bauern die Felder zu bestellen. Ganz abgesehen von dem Leid, das ihren Familien dadurch widerfahren würde.«
»Gibt es denn gar nichts, was wir für sie tun können?«
Gawin erhob sich. »Nichts, außer zu beten, dass Siegbert und Bürgermeister Doneldey den Hoyaer Grafen ein Entgegenkommen abringen und sich nicht darauf einlassen, die Menschen wie Schlachtvieh wieder ihren Lehnsherren zuzuführen.«
Er stand auf, küsste seine Frau auf die Stirn und verließ das Zimmer in Richtung der hauseigenen Badkammer.
Als er den Flur durchquerte, öffnete der Wachmann gerade die Haustür, an die fordernd geklopft wurde, und Annas Großvater, Siegbert von Goossen, betrat erschöpft sein Haus. Sofort hellte sich Gawins Miene auf.
»Siegbert!« Mit ausgestreckten Armen ging er auf den Ratsmann zu. »Was für eine Freude, dich wohlbehalten wieder hier zu haben.«
»Mein Lieber.« Von Goossen umarmte den Mann seiner Enkelin herzlich. »Ich werde langsam zu alt für so was. Du glaubst gar nicht, wie schön es ist, wieder zu Hause zu sein.«
»Mein Herr!« Durch die Geräusche aus dem Eingangsbereich informiert, trat die Haushälterin aus der Küche. »Ihr seid zurück. Gott sei es gelobt.«
»Ach, meine Gertrud. Wie sehr habe ich deine Speisen doch vermisst. Du musst wissen, die Hoyaer haben nicht nur keine Manieren, sie können auch nicht kochen.«
»Ihr habt noch Zeit, Euch bis zum Abendessen zu erfrischen. Ich werde Lisbeth Bescheid geben, Euch eine Wasserschale in Euer Zimmer zu bringen.« Sie rieb ein Tuch zwischen ihren Händen und verschwand geschäftig wieder in der Küche.
»Danke.«
»Anna!«, rief Gawin nach oben. »Komm herunter und sieh, wer heimgekehrt ist.«
Nur einen Wimpernschlag später erschien diese am oberen Treppenabsatz. »Großvater!« Sie hob die Röcke und rannte die Stufen hinab.
»Nicht so schnell, mein Kind. Du fällst sonst noch.« Siegbert öffnete die Arme und drückte seine Enkelin fest an seine Brust.
»Der Herr hat dich wohlbehalten zurückgebracht«, sagte Anna erleichtert und umfasste sein Gesicht mit beiden Händen.
»Ich bin froh, wieder daheim zu sein.« Siegbert küsste seine Enkelin auf die Wange.
»Ich war eben auf dem Weg in die Badekammer. Wenn du aber dorthin möchtest«, bot Gawin an. »Dein Tag war gewiss härter und anstrengender als der meine.«
»Geh du nur. Ich werde mich vor dem Essen mit der Waschschale begnügen und mir dann später, bevor ich ins Bett gehe, noch ein langes, warmes Bad gönnen. Jetzt würde ich eh nur einschlafen, sobald ich aus dem Zuber steige.«
»Dann sehen wir uns beim Essen. Und Siegbert …«
»Ja?«
»Schön, dass du gesund und munter wieder heimgekehrt bist.«
Der Ältere lächelte zufrieden, klopfte Gawin auf die Schulter und ging schleppend die Stufen zu seiner Kammer hinauf.
Sie saßen zu dritt am Esstisch in der Wohnstube. Anders als gewöhnlich, hatte Anna ihren Kindern in der Küche das Abendessen gegeben und sie danach zeitig ins Bett geschickt. In aller Ruhe wollte sie den Abend mit Siegbert und ihrem Ehemann verbringen, um zu hören, was bei den Verhandlungen mit den Gegnern aus Hoya herausgekommen war.
»Die Grafen verlangen wie viel?« Annas Stimme klang ungläubig. »Diese Summe gibt es in ganz Bremen nicht.«
»Ich weiß. Das ist es ja, was mir solche Sorgen bereitet.« Siegbert nahm einen tiefen Schluck aus seinem Weinbecher. »Sie wollen Bremen ruinieren, das ist offensichtlich.«
»Und was ist, wenn wir nicht darauf eingehen?«
»Dann bleiben sämtliche Gefangenen in ihrer Gewalt. Zumindest so lange«, fügte Siegbert bitter hinzu, »wie sie am Leben gelassen werden.«
»Sie haben wirklich gedroht, sie hinzurichten?«
Ihr Großvater nahm noch einen Hieb und stellte den Krug geräuschvoll auf dem Holztisch ab. »Nein, von Hinrichten war keine Rede. So einfältig sind sie nicht, die Herren Grafen.« Die letzten drei Worte stieß er verächtlich zwischen den Zähnen hervor. »Aber sie haben uns zu verstehen gegeben, dass sie der andauernde Krieg einen Großteil ihrer finanziellen Mittel gekostet hat und sie deshalb gerade noch ihre eigenen Leute durchfüttern können. Für die gefangenen Bremer bliebe nichts übrig.«
»Sie wollen sie also elendig verhungern lassen.« Gawin schüttelte fassungslos den Kopf.
»So sieht’s aus. Sie haben uns eine Frist von drei Tagen gesetzt, während der unsere Männer noch versorgt werden. Erhalten die Grafen am vierten Tage keine Nachricht von uns, überlassen sie die Gefangenen in irgendeinem Kerker ihrem Schicksal. Die gesamte Rückreise über habe ich mich mit dem Bürgermeister darüber beraten, was wir nun tun sollen.«
»Und, was werdet ihr tun?«
»Heinrich hat für morgen eine Ratssitzung einberufen. Eine Ratssitzung!«, wiederholte Siegbert spöttisch seine letzten Worte. »Als ob es eine solche noch gäbe, mit gerade noch einmal vier verbliebenen Räten, die eine Stadt wie Bremen vor dem Untergang bewahren sollen.« Mit einer raschen Bewegung stopfte er sich ein großes Stück Fleisch in den Mund.
»Was wirst du deinen Ratskollegen anraten?«, fragte Anna zögerlich, als hätte sie Angst vor der Antwort. Viele der Gefangenen waren ihr gut bekannt. Die Vorstellung, dass deren Leben auf dem Spiel stand, ließ sie frösteln.
»Wir haben gar keine andere Wahl, als die Forderungen der Grafen zu erfüllen. Auch wenn wir kaum die Mittel haben, das Geld aufzutreiben.« Siegbert seufzte, während Anna erleichtert aufatmete.
»Bremen ist eine große Handelsstadt«, meinte sie. »Wir werden das Geld wieder hereinverdienen, wenn nur dieser elende Streit erst einmal beigelegt ist.«
»Ich widerspreche dir nur ungern. Zumal ich mir nichts anderes wünsche, als dass du recht behältst. Doch Bremens Blütezeit ist vorüber. Der Handel läuft schlecht. Und dein Mann wird dir bestätigen, dass selbst ein guter Zimmermann immer weniger Arbeit hat.«
»Arbeit wäre schon da«, schränkte Gawin ein. »Nur kann sie kaum noch einer bezahlen.«
»So oder so, die Geschäfte werden nicht unmittelbar besser. Wir werden den Schoss erhöhen müssen.«
»Ich glaube, die Bürger werden die erhöhten Steuern gern bezahlen, wenn es darum geht, Bremer vor dem sicheren Untergang zu bewahren.« Anna bemühte sich um Zuversicht.
»Im Moment, ja. Aber schon bald wird das vergessen sein, die zusätzlichen Abgaben aber bleiben. Das wird für erneute Unruhe sorgen.« Siegbert schob seine leere Schale von sich. »Bitte entschuldigt mich jetzt. Die letzten Tage waren lang und anstrengend.« Er stand auf.
»Gute Nacht, Großvater. Erhole dich und schlaf gut. Und glaub mir, es wird sich schon alles richten.« Anna griff nach seiner Hand und drückte sie liebevoll.
»Was bin ich doch für ein glücklicher Mann, dass ich euch zwei und die Kinder habe.«
Mit schweren Schritten verließ er den Raum.
»Er ist alt geworden«, stellte Gawin mit Sorge in der Stimme fest, sobald Siegbert außer Hörweite war. »Die Sache setzt ihm weit mehr zu, als gut für ihn ist.«
Anna nickte. »Ich weiß. Deshalb muss auch endlich Schluss sein mit diesem unnötigen Krieg, der auf beiden Seiten nur Verlierer zurücklässt.« Sie erhob sich von ihrem Stuhl und setzte sich auf seinen Schoß. »Doch lass uns jetzt nicht länger davon sprechen. Es gibt mehr als nur Handel, Handwerk und Geld.« Sie nahm seinen Kopf zwischen ihre Hände und küsste ihn auf den Mund. »Wir sollten in unsere Kammer gehen und vergessen, was dort draußen tobt.« Ein verführerisches Lächeln umspielte ihre Lippen.
Sofort spürte Gawin, wie sein Glied steif wurde. Ohne ein Wort bedeutete er seiner Frau aufzustehen, erhob sich dann selbst und trug sie die Stufen hinauf zu ihrer Schlafkammer. Sanft setzte er sie, dort angekommen, auf dem Bett ab. Die Sonne war längst untergegangen, nur wenig Licht drang noch in ihre Kammer. Voller Vorfreude ließ er sich neben ihr nieder, entkleidete sie und begann, ihren Körper mit Küssen zu bedecken.
2. Kapitel
Margrite wischte sich rasch ihre vom Seifensieden rot und fleckig gewordenen Hände trocken, als es an der Tür des kleinen Fischerhauses klopfte. Schon seit Jahren lebte sie allein und hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, bis in den späten Abend hinein ihrer Arbeit nachzugehen, um sich von den wehmütigen Gedanken an schönere, längst vergangene Tage abzulenken. Sie griff nach der Talgleuchte und ging in die Diele. Noch ehe sie den Eingang erreichte, wurde erneut heftig gegen die Tür getrommelt.
»Ich komm ja schon, verdammt noch mal.« Sie schlurfte weiter. »Wer ist da?«, rief sie barsch.
»Lena.«
Sofort öffnete Margrite und erschrak beim Anblick der jungen Frau, deren Gesicht tränenüberströmt war, die Augen verquollen, das Haar wirr und zerzaust. »Mein Gott, Kindchen, was ist denn geschehen? Komm erst einmal herein.«
Sie zog Lena an der Hand ins Haus.
»Lorenz ist verschwunden.«
»Was?«
»Er wollte Holz holen gehen und ist nicht mehr heimgekehrt.« Sie schluchzte heftig auf.
»Komm, setz dich an die Kochstelle und trink etwas. Und dann erzähl in aller Ruhe.«
Margrite zog ihren unverhofften Gast hinter sich her und drückte ihn auf einen der zwei Schemel. Rasch holte sie zwei Becher, die sie mit Würzwein füllte und stellte einen davon vor ihrer Besucherin ab.
»Hier. Und jetzt noch einmal ganz von vorne. Wo genau wollte Lorenz das Holz holen, und seit wann ist er fort?«
Lena griff nach dem Becher, stellte ihn jedoch, ohne zu trinken, wieder ab. »Seit heute Morgen. Er hätte schon vor Stunden wieder zurück sein müssen.«
Etwas gefasster berichtete Lena nun, dass ihr Mann sich in aller Frühe auf den Weg gemacht hatte, um im nahe gelegenen Wald Holz zu sammeln.
»Außerhalb der Stadtmauern? Obwohl ihr Neubürger seid und euch die Häscher der Hoyaer dort auflauern können, um euch dorthin zurückzuzerren? Das war nicht sehr klug von deinem Mann.« Margrite trank einen Schluck.
Lena schluchzte auf. »Aber was sollen wir denn tun? Die Menschen haben immer weniger Geld, sich Schuhe fertigen zu lassen. Wir hoffen auf den Winter, wo viele das wenige, was sie noch haben, für das Fußwerk ihrer Kinder ausgeben. Doch jetzt, mitten im Sommer, denkt niemand, der sie nicht dringend braucht, daran, sie in Auftrag zu geben.«
»Ich weiß ja, dass ihr keine andere Wahl habt, als die Stadt ab und an zu verlassen, wenn ihr Feuerholz braucht.« Margrite bedauerte, dass ihre Sorge wie ein Vorwurf auf Lena gewirkt haben musste. »Vielleicht steckt ja auch gar nichts weiter dahinter, und dein Lorenz wurde nur aufgehalten.«
Margrite sah aus dem Fenster. »Es ist bereits zu dunkel. Die Stadttore sind gewiss längst geschlossen. Selbst die Büttel werden sich wegen der unruhigen Zeiten zu dieser Stunde nicht mehr vor die Mauern wagen.«
»Aber was ist, wenn ihm etwas zugestoßen ist und er nun hilflos irgendwo am Boden liegt?«
Margrite tätschelte die Hand der Jüngeren. »Dein Lorenz ist ein kräftiger Kerl. Den bringt so leicht nichts um. Selbst wenn ihm etwas geschehen sein sollte, wird er klug genug sein, sich bis zum Morgengrauen im Wald zu verbergen und erst dann heimzukehren.«
»Und wenn nicht?«
»Dann werden wir Hilfe holen und morgen nach ihm suchen.«
»Glaubst du wirklich, die Büttel würden helfen, einen einfachen Schuhmacher zu suchen, der den Weg nach Hause nicht gefunden hat?«
»O ja, das würden sie.« Es klang entschieden. »Vergiss nicht, dass ihr Bürger der Stadt Bremen seid.«
Ein Lächeln huschte über das Gesicht der Jüngeren. Als Lorenz und sie vor sieben Jahren in diese Stadt gekommen waren, hatte man sie mit offenen Armen empfangen. So gut wie alle ihre Freunde und Nachbarn hatten sie Hoya hinter sich gelassen und sich auf den Weg in eine unbekannte Zukunft gemacht. Doch die Aussicht auf ein besseres, freies Leben und die Gelegenheit, als Hoyaer Leibeigene in Bremen nach einem Jahr die Bürgerfreiheit zu erhalten und nicht mehr den größten Teil ihrer erwirtschafteten Einnahmen sofort wieder abführen zu müssen, waren stärker gewesen. Anfangs waren ihnen die Möglichkeiten, die sich ihnen boten, wie ein Traum vorgekommen. Früher, in Hoya, hatte Lorenz nur nebenher Schuhe hergestellt, sowohl für die eigenen Kinder als auch gelegentlich für einige Bekannte. Im Tausch dafür hatte er stets einen guten Schinken, einige Säcke Mehl oder Hühner bekommen. Nachdem jedoch die Pest sich über das Land hergemacht und so viele unschuldige Seelen dahingerafft hatte, reichten die Ernten nicht einmal mehr aus, die von den Grafen immer weiter angehobenen Abgabemengen einzubringen. Sogar das wenige, das Lorenz mit der Schusterei zusätzlich verdiente, mussten sie einsetzen, um ihre Schulden beim Meier begleichen zu können. So entschlossen sie sich zur Flucht und wagten den Weg nach Bremen. Seither war es ihnen von Jahr zu Jahr bessergegangen. Lorenz konnte als freier Bürger Schuhe fertigen. Zwar wurden auch hier Steuern erhoben, doch in einem Maße, das noch von jedermann gut getragen werden konnte und ihm genug für ein auskömmliches Leben übrigließ. Dann aber hatten Gerhard III. und Johann II. von Hoya die Auslieferung der Neubürger vom Rat der Stadt Bremen gefordert, und die alte Angst, doch wieder zurückzumüssen, war wieder da. Lena und Lorenz hatte es mit Stolz erfüllt, dass Bürgermeister Heinrich Doneldey dieses Begehren rundweg abgelehnt hatte. Die Folgen dieser Weigerung hatten alle Bremer zu spüren bekommen, doch statt mit den Fingern auf sie zu zeigen, wie es Lena erwartet hatte, rückten sie noch enger zusammen und stellten sich hinter die zugezogenen Neubürger, um den Grafen von Hoya zu zeigen, dass diese wie sie selbst ein Teil dieser Stadt waren. Sie waren Bremer und wurden geschützt durch Bremer. Nur außerhalb der Stadtmauern lauerte Gefahr.
»Wo sind die Kinder?«, unterbrach Margrite ihre Gedanken.
»In ihren Betten. Ich wollte sie nicht beunruhigen und habe ihnen gesagt, dass ihr Vater bald kommen würde. Nachdem sie eingeschlafen waren, bin ich zu dir gekommen. Was soll ich jetzt nur tun?«
Margrite stand auf. »Du gehst zurück zu deinen Kindern und wachst über ihren Schlaf. Ich werde mich darum kümmern, dass sich gleich morgen in aller Frühe die Büttel auf die Suche begeben.« Sie schenkte der anderen ein aufmunterndes Lächeln. »Wirst schon sehen, Lena. Ehe du dich versiehst, sitzt dein Lorenz wieder bei dir am Tisch und schaufelt mit den Kindern den Morgenbrei in sich hinein.«
Lena schluchzte. »Ich bete darum, dass du recht hast.« Sie drückte sich kurz an die Ältere. An der Tür angekommen, drehte sie sich noch einmal um. »Und du glaubst wirklich, dass alles gut wird, ja?«
»Aber natürlich wird es das.« Margrite bemühte sich, ihrer Stimme einen festen Klang zu verleihen, obwohl sie das Schlimmste befürchtete.
»Gib mir Bescheid, sowie du etwas hörst.« Lena trat hinaus, zog trotz der Wärme, die auch am Abend noch in den Gassen Bremens lag, ihren Umhang fester um sich und hastete mit eiligen Schritten das kurze Stück bis zu ihrem kleinen Schusterhaus zurück.
Margrite sah ihr noch nach, als sie schon außer Sichtweite war. Das ungute Gefühl war noch immer da, sogar stärker als zu Beginn von Lenas Besuch. Sie blickte ein letztes Mal die menschenleere Gasse hinauf und hinunter, als erwarte sie, Lorenz dort jeden Moment auftauchen zu sehen. Mit einem Seufzer schloss sie die Tür hinter sich. Sie wusste, wie es war, einen geliebten Menschen zu verlieren. Neun Jahre war es jetzt her, dass Anderlin, der Mann, mit dem sie zusammengelebt und den sie mehr als irgendjemand sonst auf dieser Welt geliebt hatte, sein Leben gegeben hatte, um das ihre und Annas zu retten. Bis zu seinem letzten Atemzug hatte er alles getan, um sie zu schützen und ihnen die Flucht zu ermöglichen. Kein einziger Tag war seither vergangen, an dem Margrite nicht an ihn gedacht hatte. Bis heute hatte sie es nicht wieder fertiggebracht, sich zu einem anderen zu legen. Und glaubte inzwischen auch nicht mehr, dass sie dies je wieder tun würde. Mit Anderlin war ein Teil von ihr gestorben, und das Glück, das sie damals empfunden hatte, würde sich wohl nie wieder über sie legen. Hoffentlich bliebe Lena diese Erfahrung erspart.
In der Nacht hatte Margrite kein Auge zugetan. Irgendwann in den frühen Morgenstunden, lange bevor die Dunkelheit an Kraft verlor, war sie aufgestanden und hatte mit dem Seifensieden begonnen. Mit ihren Gedanken war sie bei Lena, die sicher ebenso keinen Schlaf finden und sich in Sorgen um ihren Ehemann von einer Seite auf die andere wälzen würde. Arme Lena! Margrite wusste, wie sehr sie ihren Lorenz liebte. Ein Herz und eine Seele waren die beiden, und sie mochte sich kaum ausmalen, was es für die Familie mit ihren drei Kindern bedeuten mochte, kehrte Lorenz womöglich nicht heim.
Sie nahm ein Stück fertige Seife und atmete tief den Lavendelduft ein, den diese verströmte. Ihre Atmung verlangsamte sich, die Schultern lockerten sich und eine große innere Ruhe überkam sie. Schon vor vielen Jahren hatte sie die wohltuende Wirkung der Düfte auf sich entdeckt, und es war vor allem dieser Duft – weit mehr als das gesamte Haus mit all seinen Möbelstücken darin -, der ihr das Gefühl von Heimat gab. Noch einmal atmete sie tief ein, legte das Stück Seife dann zurück und ging in ihre Kammer, um sich zu waschen und anzukleiden. Die ersten Lichtstrahlen des Tages drangen durch die kleinen Fenster. Noch schwach, doch es würde nicht mehr lange dauern, bis sie den Weg zum Rathaus einschlagen könnte, um dort die Bitte vorzutragen, die Büttel mit der Suche nach Lorenz zu beauftragen.
Nachdem sie aufgebrochen war, mahnte sie sich bei jedem ihrer Schritte selbst zur Ruhe. Obgleich sie sich Lena gegenüber so zuversichtlich gezeigt hatte, war es keineswegs sicher, dass man ihrer Bitte Gehör schenken würde. Zu viele Widrigkeiten trieben die Bürger Bremens in dieser Zeit um. Die Büttel hatten auch so schon genug zu tun, um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Ein verschwundener Schuhmacher, der sich noch dazu selbst in Gefahr gebracht hatte, indem er die sicheren Stadtmauern verließ, würde wahrscheinlich nicht wichtig genug sein, um die wenigen verbliebenen Stadtbüttel nach ihm suchen zu lassen. Mit gemischten Gefühlen betrat sie das Rathaus und traf sogleich auf einen Wachmann, der wahrscheinlich die Nachtwache im Gang übernommen hatte. Die Müdigkeit war ihm ins Gesicht geschrieben, und Margrite empfand Mitleid mit dem übernächtigten Kerl.
»Seid gegrüßt. Ich bin die Bürgerin Margrite Schonau und möchte zum Stadtvogt.«
Der Wachmann straffte seinen Körper. »Der Stadtvogt ist noch nicht da. Kann ich Euch helfen?«
»Es geht um einen Neubürger, der verschwunden ist.«
»Hm, da ist in der Tat der Vogt gefragt. Ich könnte nach ihm schicken lassen, oder Ihr wartet, bis er kommt. Meist ist er dieser Tage recht früh im Haus.«
»Dann werde ich gern auf ihn warten, wenn es Euch nichts ausmacht.«
»Dort drüben stehen Bänke. Macht es Euch auf einer von ihnen bequem.«
Margrite nickte lächelnd und musterte ihn erneut. Er war ein gestandener Mann, etwa in ihrem Alter und trotz der frühen Stunde ausgesprochen höflich. Er hatte irgendetwas an sich, was ihr gefiel. Es war das erste Mal seit Anderlins Tod, dass sie einen Mann auf diese Weise betrachtete und dessen Vorzüge abwog. Zwar würde sie nicht so weit gehen, sich auf eine Plänkelei mit ihm einzulassen, doch es tat ihr gut, zu spüren, dass der Schmerz über den unsagbaren Verlust nach so vielen Jahren offensichtlich an Kraft verlor.
Sie hätte nicht sagen können, wie lange sie gewartet hatte, als ihr Blick auf das Eingangsportal fiel, durch das in diesem Moment der Stadtvogt trat. Sofort stand sie auf und strich sich die Röcke glatt.
»Diese Bürgerin wünscht Euch zu sprechen, Vogt«, beschied ihm der Wachmann und begleitete ihn zu Margrite hinüber.
»Guten Morgen, Vogt. Mein Name ist Margrite Schonau. Ich bin Seifensiederin. Ein Neubürger, er ist Schuhmacher und heißt Lorenz, wird seit gestern vermisst.«
»Wartet Ihr schon lange auf mich? Warum habt Ihr nicht nach mir schicken lassen?« Er sah den Wachmann an.
»Ich wollte nicht, dass Ihr allzu früh gestört werdet«, wandte Margrite ein. »Euer Büttel hier bot mir sehr wohl an, nach Euch rufen zu lassen. Doch ich habe es abgelehnt.«
»Dann ist es ja gut. Begleitet mich in mein Schreibzimmer, Bürgerin. Dort werden wir alles Weitere besprechen.«
Margrite folgte ihm und beschrieb ihm, nachdem beide Platz genommen hatten, anhand der vagen Angaben, die Lena ihr gemacht hatte, was sie über das Verschwinden des Schuhmachers wusste.
»Ich hoffe, es steckt nicht das dahinter, was ich vermute«, murmelte der Vogt.
Seine Besucherin musste nicht erst fragen, was er damit meinte. Der dunkle Schatten, der derzeit über allen Neubürgern schwebte, war zu groß, um ihn nicht bemerkt zu haben.
»Und? Werdet Ihr nach ihm suchen lassen?«
»Das ist nicht so einfach.« Der Vogt stand auf, trat ans Schreibpult und legte seine gefalteten Hände darauf. »Wir haben kaum Leute. Viele gute Männer befinden sich in der Gefangenschaft des Feindes.«
Margrite presste die Lippen aufeinander.
»Aber ich werde schon ein paar Männer auftreiben, die nach dem Schuhmacher suchen. Wir werden die Neubürger nicht im Stich oder gar fallenlassen.«
Er fuhr mit den Armen durch die Luft. Seine letzte Bemerkung und Geste wirkte auf Margrite, als glaubte der Vogt, vor einer großen Menschenmenge zu sprechen. Sie stand nun ebenfalls auf.
»Ich danke Euch. Und glaubt mir, ich weiß, wie schwierig es für Euch ist, in diesen Zeiten Euren Aufgaben nachzukommen, obwohl Ihr kaum Hilfe habt. Umso mehr sollt Ihr Gottes Segen erfahren für Eure Taten.«
Der Vogt senkte den Kopf zum Dank, trat um das Schreibpult herum und öffnete ihr die Tür. »Ich werde eine Nachricht an des Schuhmachers Weib schicken lassen, sobald es etwas zu berichten gibt. Gebe der Herr, dass es keine schlechte Botschaft sein möge.«
»Gebe es der Herr«, wiederholte Margrite.
Vom Rathaus ging Margrite direkt zu dem Haus, in dem Lorenz und Lena mit ihren Kindern lebten. Kaum dass sie geklopft hatte, wurde die Tür auch schon aufgerissen.
»Margrite! Weißt du etwas Neues? Suchen die Büttel nach Lorenz?«
Die Seifensiederin trat ein und umarmte Lena. »Der Vogt hat mir zugesichert, dass sie sich auf die Suche nach ihm machen werden. Sobald sich etwas tut, schickt dir der Vogt eine Nachricht. Ich werde hier gemeinsam mit dir warten.«
»Ich danke dir so sehr!« Lenas Augen füllten sich mit Tränen.
Götz, mit seinen sieben Jahren der älteste Sohn des Schuhmacherpaares, trat aus der angrenzenden Kammer und rieb sich verschlafen die Augen.
»Tante Margrite?« Er trottete zu dem frühen Besuch und lehnte sich gegen die Hüfte der Seifensiederin. »Ich bin noch so müde.«
»Dann legst du dich am besten wieder hin, mein Kleiner. Ich habe sowieso noch etwas mit deiner Mutter zu besprechen. Und gib acht, dass du deine Geschwister nicht weckst.«
Ohne ein weiteres Wort trottete Götz die wenigen Schritte in die Kammer zurück und schloss die Tür hinter sich. Angestrengt lauschten die beiden Frauen einen Augenblick. Als kein Geräusch von der Schlafstatt zu ihnen nach draußen drang, bedeutete Lena Margrite mit einem Fingerzeig, ihr in die Arbeitskammer samt Herdstelle zu folgen.
»Was soll ich ihnen nur sagen, wenn sie wach werden?«
»Erst einmal gar nichts. Wenn sie nach Lorenz fragen, sagst du einfach, dass er etwas Wichtiges zu erledigen hatte.«
»Und was, wenn er nicht wiederkommt?« Lenas Stimme war nicht mehr als ein Flüstern.
»Daran darfst du nicht einmal denken.«
»Ich bemühe mich ja, aber der Gedanke kommt immer wieder. Ich habe solche Angst. Was soll denn dann aus uns werden?«
»Ganz ruhig. Erst einmal warten wir ab, welche Nachricht die Büttel bringen. Vielleicht kommt dein Lorenz ja schon im nächsten Moment zur Tür herein. Dann hast du dir vollkommen umsonst solche Sorgen gemacht.«
»Ach, wenn’s doch nur so wäre.«
Die Stunden vergingen. Götz, Bruno und die kleine Jutte hatten bereits gefrühstückt und spielten nun draußen auf der Gasse. Mit der von ihrer Mutter gegebenen Erklärung, der Vater hätte etwas Dringendes zu erledigen, hatten sich die Kinder zufriedengegeben. Margrite bezweifelte zwar, dass sie Lenas bedrückte Stimmung nicht bemerkt hatten. Doch nur Götz zögerte kurz, als seine Mutter alle drei zum Spielen hinausschickte. Eine Weile stand er noch unter der Tür, unschlüssig, ob er noch einmal nachfragen sollte. Dann aber hatte auch er kehrtgemacht und war seinen kleineren Geschwistern nach draußen gefolgt.
Nervös spielte Lena mit ihren Fingern. Schon eine Weile hatten Margrite und sie kein Wort mehr gesprochen. Jeder hing seinen eigenen Gedanken über Lorenz’ mögliches Schicksal nach. Als es heftig an der Tür klopfte, setzte Lenas Herzschlag einen Augenblick lang aus.
»Lorenz!«
Sie sprang auf, stürmte zur Tür und riss sie rückartig auf. Zwei Männer standen ihr gegenüber. Lena sah flehend von einem zum anderen, unfähig, ein Wort über die Lippen zu bringen.
»Seid Ihr das Weib des Schuhmachers Lorenz?«
Sie nickte.
Der Größere der beiden wollte soeben etwas sagen, als Lena ihm ins Wort fiel.
»Ihr habt ihn gefunden, ja? Meinem Lorenz geht es gut, nicht wahr?« Sie blickte hastig zwischen den Männern hin und her. Ein hoffnungsvolles Lächeln huschte über ihr Gesicht.
Margrite trat hinter ihr an die Tür. Ein einziger Blick in die Augen der Stadtbeauftragten genügte ihr, um zu wissen, welche Nachricht sie brachten. Mit einer fürsorglichen Geste umfasste sie Lenas Schultern.
Der Büttel, der Lena angesprochen hatte, trat von einem Fuß auf den anderen, die Augen starr auf seine Lederschuhe gerichtet. Er warf seinem Kameraden einen verstohlenen Seitenblick zu, mit dem er ihn aufforderte, das Wort zu ergreifen. Doch der andere schwieg.
»Es tut mir leid«, kam er nun doch selbst seiner Pflicht nach. »Wir haben Euren Mann gefunden.«
»Geht es ihm gut?«
Der Büttel kniff die Augen zusammen, warf einen verwirrten Blick auf Margrite und schüttelte dann langsam den Kopf.
»Du solltest jetzt ins Haus gehen, Lena. Ich werde alles Weitere hier klären.« Margrite verstärkte den Griff um Lenas Schultern und zog sie sanft zurück. »Komm, komm jetzt«, forderte sie mit leiser Stimme.
Stocksteif stand Lena da. Es war, als habe sie weder gehört noch verstanden, was der Mann und Margrite ihr gerade bedeutet hatten. Ganz im Gegenteil meinte sie nun:
»Aber ich muss warten. Sonst wird Lorenz sich wundern, wo ich bin, wenn er heimkommt.«
»Aber, habt Ihr denn nicht verstanden, was …«
Margrite bedeutete dem Büttel mit einer Handbewegung, nicht weiterzusprechen.
»Komm, Lena. Geh hinein.« Margrite zog die Jüngere nun entschieden in die Diele und schob sie in die Arbeitskammer. »Setz dich dort hinein. Ich komme gleich.« Sie sah Lena in die Augen. Deren Gesichtsausdruck hatte sich verändert. Verklärt, mit einer Art glückseligen Gleichmuts, blickte sie die Seifensiederin an.
»Sagst du Lorenz, dass die Kinder noch draußen spielen? Er hat sie heute ja noch gar nicht gesehen.«
Margrite lief ein kalter Schauer über den Rücken. Lena schien ihr vollkommen entrückt, fast schon wirr und nicht mehr von dieser Welt zu sein. Die Nachricht war anscheinend noch immer nicht zu ihr durchgedrungen, oder aber sie hatte sie einfach weit von sich fortgeschoben, weil sie sie nicht wahrhaben wollte.
»Setz dich und warte hier auf mich. Ich komme gleich wieder.« Margrite drehte sich um und ging die paar Schritte über den Flur bis zur geöffneten Eingangstür, an der die Büttel noch immer ausharrten.
»Ist alles mit ihr in Ordnung?« Der Büttel warf einen besorgten Blick in Richtung der Kammer.
»Gar nichts ist in Ordnung. Aber ich werde mich um sie kümmern«, versprach Margrite. »Wo habt Ihr ihren Mann gefunden?«
Wieder warf er seinem Kollegen einen Blick zu, der daraufhin zum ersten Mal das Wort ergriff. »Wir haben kaum nach ihm suchen müssen. Jemand hatte das, was von ihm übrig war, vor das geschlossene Stadttor gelegt. Die Wachen auf den Türmen haben nichts bemerkt. Es muss mitten in der Nacht geschehen sein, als nicht einmal der Mond genug Licht spendete, um etwas sehen zu können.«
»Wo ist der Leichnam jetzt?«
»Wir haben ihn zum Medikus in der Langenstraße gebracht. Zwar konnte niemand mehr etwas für ihn tun, doch hat der Vogt befohlen, ihn zunächst dort hinzubringen. Er wollte nicht, dass die Witwe ihren Mann in diesem Zustand sieht.« Er schluckte schwer. »Fürwahr, ein schöner Anblick war das nicht.«
Margrite fragte nicht nach, um sich selbst die genaueren Einzelheiten zu ersparen.
»Was kann ich dem Medikus sagen, wann der Leichnam abgeholt wird?«
»Sagt ihm, so schnell wie möglich.« Es klang ungehaltener, als Margrite es beabsichtigt hatte. »Verzeiht, aber ich muss mich nun um sie kümmern.« Sie deutete mit dem Kopf ins Innere des Hauses.
»Es tut uns leid, dass wir keine bessere Nachricht bringen konnten.«
Die unbeholfene Geste, mit der der Büttel die Worte vorbrachte, rührte Margrite. Sie lächelte, nickte ihnen zum Abschied zu und schloss dann zögernd die Tür.
Drinnen lehnte sie sich einen Moment lang gegen das rauhe Türblatt. Die unterschiedlichsten Gedanken gingen ihr durch den Kopf. Was sollte sie jetzt tun? Würde sie zu Lena durchdringen? Könnte sie sie trösten, und was sollte sie ihr sagen, wie es weiterginge? Sie wusste auf keine dieser Fragen eine Antwort, nahm jedoch all ihren Mut zusammen, stieß sich von der Tür ab und ging in die Arbeitskammer. Mit einem tiefen Seufzer betrat sie den Raum.
3. Kapitel
Man sollte ihn im Turm aufhängen und die Glocke mit seinem leblosen Körper schlagen.« Die Faust des Ratsmannes Johannes Grote sauste auf die Platte des großen Eichentisches im Arbeitszimmer Bürgermeister Doneldeys nieder.
Sie hatten darauf verzichtet, im Ratssaal zusammenzukommen, da es ihrer nur noch vier an der Zahl waren, die über das Wohl und Weh der Bremer zu entscheiden hatten. Siegbert von Goossen hatte zusammen mit Heinrich Doneldey von den Verhandlungen berichtet, die sie mit den beiden Grafen von Hoya über die Auslösung der Gefangenen geführt hatten. Als er die Summe nannte, die die Grafen von ihnen verlangten, zog Berthold von Hoheneck geräuschvoll die Luft ein, und Johannes Grote war nach seiner Geste beinahe vom Stuhl aufgesprungen.
»Da können sie unsere Leute ja auch gleich am nächsten Galgen aufknüpfen. So viel können wir nicht auftreiben, und das wissen diese Schweinehunde ganz genau.«
»Was ist mit den Steuern aus dem Weinhandel?« Doneldey rieb sich die schmerzenden Augen.
»Du denkst also allen Ernstes darüber nach, zu bezahlen?«
»Hast du einen besseren Einfall?«
»Was ist, wenn wir alle uns noch verbliebenen Männer zusammenziehen und unsere Leute mit Gewalt zurückholen?« Johannes Grotes Augen blitzten gefährlich auf.
»Wir wissen ja noch nicht einmal, wo sie gefangen gehalten werden«, gab Siegbert von Goossen zu bedenken. »Und wo wollen wir noch Kämpfer hernehmen? Die besten Leute, die wir in Bremen haben, befinden sich unter den Gefangenen.«
»Sie befreien zu wollen, ist aussichtslos«, urteilte Bürgermeister Doneldey. »Wir würden dabei nur noch mehr unserer Leute ans Messer liefern.« Er stand auf, ging zum Fenster hinüber und ließ nachdenklich seinen Blick nach draußen schweifen. Einen Augenblick beobachteten die anderen ihn schweigend, bis er sich ihnen wieder zuwandte. »Wir müssen das Lösegeld auftreiben und ein für alle Mal den Krieg mit Hoya beenden. Das ist die einzige Möglichkeit.«
Ohne die Reaktion der anderen abzuwarten, stand Siegbert von Goossen auf und öffnete die Tür, vor der ein Wachmann stand, um möglichen Besuchern den Zutritt zu verwehren.
»Der Kämmerer soll zu uns kommen«, trug von Goossen ihm auf.
»Ja, Herr.«
»Und er soll seine Listen mitbringen!«, rief er der Wache noch hinterher, als diese sich eilte, den Auftrag des Ratsherrn so schnell wie möglich auszuführen.
Siegbert trat an den Tisch zurück, setzte sich kurz, stand im nächsten Moment wieder auf und ging erneut zur Tür. Auf dem Gang war niemand zu sehen.
»Wache!«
Es dauerte nur einen Wimpernschlag, bis ein weiterer Büttel die Stufen des Rathauses hochgeeilt kam.
»Ratsherr von Goossen?« Er deutete eine Verbeugung an.
»Schick nach dem Erzbischof. Wenn er keine Zeit haben sollte, ins Rathaus zu kommen, so fragt ihn, wann die Ratsherren der Stadt Bremen zu ihm kommen können.«
»Ja, Herr!«
»Und das Treffen muss noch heute stattfinden.«
»Ich werde es ausrichten, Herr.«
Der Wachmann machte auf dem Absatz kehrt, und die Sohlen seiner Schuhe verursachten bei jedem seiner Schritte die Treppen hinab ein klackendes Geräusch, das noch länger nachhallte.
»Der Erzbischof?« Der Bürgermeister sah seinen Freund fragend an.
»Wir haben ihm beigestanden, als es darum ging, Gottfried von Arnsberg aus der Stadt zu jagen. Ich denke, jetzt schuldet der Erzbischof uns Bremern etwas.«
»Und du glaubst, dass er über die nötigen Mittel verfügt?«
»Er selbst vielleicht nicht. Die Kirche hingegen schon. Wir müssen ihm womöglich ein paar Zugeständnisse machen, was seine Machtbefugnisse angeht. Doch wenn wir dafür unsere Leute freikaufen können, soll es mir recht sein.«
Bürgermeister Doneldey nickte schweigend.
Schnelle Schritte näherten sich dem Zimmer. Obwohl die Tür offen stand, klopfte der Stadtkämmerer an.
»Ihr habt mich rufen lassen?«
Heinrich Doneldey ging auf ihn zu. »Markus. Vielen Dank, dass Ihr so schnell unserer Bitte gefolgt seid. Nehmt Platz.«
Noch während sich Siegbert und Heinrich wieder setzten, begann Letzterer auch schon, dem Stadtkämmerer die vertrackte Situation zu erklären.
»Puh, das ist eine gewaltige Summe.« Der Kämmerer schlug die Ledermappe auf, nahm das oberste, unbeschriebene der sorgsam gestapelten Pergamente zur Hand und legte es rechts neben sich auf den Tisch.
Als Nächstes zog er aus einem kleinen Beutel einen Federkiel und ein Tintenfässchen hervor, stellte beides sorgsam auf eine quadratische Samtunterlage, die er zuvor auf dem Tisch ausgebreitet hatte, und begann sogleich, die beschriebenen Pergamentseiten vor sich zu überfliegen.
»Hier sind sämtliche Steuereinnahmen aus Handel und Handwerk einzeln aufgeführt. Auch alle erhobenen Zölle und weiteren Abgaben sind getrennt voneinander aufgelistet.« Er sortierte die Pergamente in acht Stapel, griff nach dem Federkiel und rechnete die einzelnen Zahlen danach neu zusammen. Hierbei lugte er jeweils auf das letzte Blatt jedes Stapels und übertrug die dort stehende Endsumme auf das noch leere Pergament vor sich.
Schweigend verfolgten die Ratsherren sein zielgerichtetes Tun.
»Wir haben noch die Möglichkeit, von den Handwerks- und Handelsbetrieben bis zum Ende dieses Monats eine Zwischenabrechnung einzufordern und die Abgaben mit einzurechnen. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass damit sämtliche Außenstände Bremens aufgezehrt sind.«
Er sah in die Runde, um mögliche Fragen zu beantworten.
»Ihr beherrscht Eure Aufgabe«, lobte der Bürgermeister. »Wenn alle ihre Geschäfte so führen würden wie Ihr die Bücher der Stadt, müssten wir uns keine Gedanken mehr um das Fortkommen Bremens machen.«
Der Kämmerer nahm die Worte mit einem dankbaren Kopfnicken zur Kenntnis.
»Soll ich also die Abrechnungen zum Ende des Monats hin in Auftrag geben und Boten zu den Gewerken schicken lassen?«
»Noch nicht«, schaltete sich Siegbert ein. »Lasst uns erst das Gespräch mit dem Erzbischof abwarten, bevor wir Handwerker, Händler und Bürger in Unruhe versetzen. Die Zeiten sind schon schwer genug. Da genügt ein kleines Feuer, um einen Flächenbrand auszulösen.«
»Was ist, wenn der Erzbischof es ablehnt, uns zu helfen?«, warf Johannes Grote in die Runde.
»Vielleicht sollte ich allein mit ihm sprechen«, schlug von Goossen vor. »Wenn nötig, werde ich ihn daran erinnern, was er der Stadt und ihren Bürgern schuldig ist.«
»Ohne uns?« Berthold von Hoheneck blickte ihn fragend an.
»Wenn wir alle eine offene Forderung gegen ihn aussprechen, könnte er sich in die Enge gedrängt fühlen und keinen Fußbreit nachgeben, um sich nur ja keine Blöße zu geben. Spreche aber nur ich mit ihm, ist es eine geschäftliche Unterredung zwischen zwei Männern. Das könnte es ihm leichtermachen, einzulenken.«
»Wohl überlegt, Siegbert. Ich stimme dir zu. Sprich allein mit dem Erzbischof und gib uns danach Nachricht.« Der Bürgermeister wandte sich wieder dem Kämmerer zu.
»Wir brauchen alles Geld, das die Stadt flüssig machen kann innerhalb von zwei Tagen. Ich wünsche eine Aufstellung darüber.«
Der Angesprochene nickte, schloss das Tintenfässchen und wickelte den Federkiel in die samtene Unterlage, um dann alles zusammen wieder in seinem kleinen Beutel zu verstauen. Sorgsam legte er die Pergamente zurück in die Ledermappe und klappte sie zu.
»Dann werde ich mich jetzt entschuldigen.« Er erhob sich. »Ich habe noch einiges zu tun.« Der Kämmerer nickte den Anwesenden zu und ging.
»Es scheint, als gäbe es für ihn nur seine Zahlen«, murmelte von Hoheneck. »Die Schilderung der Situation, in der sich die Gefangenen befinden, hat ihn jedenfalls kaltgelassen.«
»Er ist ein guter Mann, pflichtbewusst und klar auf Lösungen bedacht.« Johannes Grote schmunzelte. »Aber ich gebe dir recht: Besonders mitfühlend scheint er nicht zu sein. Kein Wunder, dass er kein Weib hat, das ihm das Bett wärmt.«
»Wahrscheinlich findet er mehr Gefallen an seinen Rechnungsbüchern. Aber das kann uns nur recht sein. So stellt er seine ganzen Bemühungen in den Dienst unserer Stadt.«
Es klopfte, und nach der Aufforderung des Bürgermeisters, einzutreten, öffnete der Wachmann die Tür, den Siegbert zum Erzbischof geschickt hatte.
»Und? Was hat er gesagt?«, fragte von Goossen sogleich. »Wird er ins Rathaus kommen?«
Dem Boten war anzusehen, dass er nach den richtigen Worten suchte. »Ehm, der Erzbischof bittet Euch, ihn doch bitte in seinem Amtssitz aufzusuchen. Bis zum Mittag wird er dort aufhältig sein.«
»Hat er das so gesagt?« Der Spott in der Stimme des Bürgermeisters war unüberhörbar. »Lasst es gut sein, Ihr braucht darauf nicht zu antworten«, fügte er hinzu. »Wir können uns schon denken, wie freundlich er sich geäußert hat. Das ist dann alles.«
Der Büttel deutete eine Verbeugung an und verließ das Zimmer.
»Deine Einschätzung war gewiss richtig«, wandte sich Doneldey wieder an Siegbert. »Der Bischof hat mit seinen Machtspielchen schon begonnen. Es ist eine gute Entscheidung, dass du ihn allein aufsuchst.«
Von Goossen nickte. »Gibt es sonst noch etwas zu besprechen? Ansonsten schlage ich vor, dass ich mich alsbald auf den Weg zum Erzbischof mache und euch Nachricht schicke, sobald das Gespräch beendet ist.« Er überlegte kurz. »Oder noch besser, kommt ihr am frühen Abend alle in mein Haus. Dort können wir alles Weitere klären.« Er blickte sich missmutig im Zimmer um. »Im Rathaus zu sitzen, mit nicht einmal einer Handvoll Männern, lässt die Situation nur noch trostloser wirken.« Er stand auf, und auch die anderen erhoben sich.
Nach einer kurzen Verabschiedung ging ein jeder seiner Wege.
Siegbert von Goossen war nie ein zurückhaltender Mensch gewesen. Auch seinen Reichtum zu zeigen, hatte ihn stets mit einer gewissen Genugtuung erfüllt. Der Bischofssitz, der wohl eher die Bezeichnung Palast verdient hätte, war jedoch auch ihm zu viel der Prachtentfaltung. Zwar wusste er, dass nur wenige bauliche Veränderungen auf die Amtszeit von Moritz von Oldenburg entfielen und dessen Vorgänger Gottfried von Arnsberg ihm an Eitelkeiten noch einiges voraus hatte, was so manche neue Grundsteinlegung betraf. Dennoch war der jetzige Erzbischof Moritz alles andere als ein Muster an Bescheidenheit.
Noch bevor Siegbert die Stufen emporgestiegen war, stellte sich ihm ein Wachmann breitbeinig in den Weg.
»Mein Name ist Siegbert von Goossen. Der Erzbischof erwartet mich.«
»Davon ist mir nichts bekannt.« Die Miene des Hünen zeigte keine Regung.
»Dann fragt nach.« Siegbert knirschte mit den Zähnen. Er hatte noch nie viel mit dem Oberpfaffen, wie er den Erzbischof insgeheim nannte, anzufangen gewusst. »Wird’s bald?«
Der Wachmann reagierte sofort, drehte sich um und ging ins Haus. Er wechselte einige Worte mit einer zweiten Wache im Inneren des Hauses und kam dann wieder zurück.
»Bitte, tretet ein.«
Mit selbstgefälliger Miene schritt Siegbert an ihm vorbei in den Eingangsbereich, der weit weniger feudal war, als es die Außenansicht vermuten ließ. Ob es Moritz von Oldenburg folglich nur wichtig war, nach außen hin möglichst vielen Menschen seine Macht zu demonstrieren, es dagegen aber nicht mehr für nötig hielt, dieses Bild gegenüber den wenigen, die ins Innere des Hauses vorgelassen wurden, aufrechtzuerhalten, wusste Siegbert nicht so recht zu sagen.
»Ratsherr von Goossen, welch Glanz in meiner bescheidenen Behausung.« Der Erzbischof trat auf ihn zu und bot ihm die Hand zum Kuss.
Mit einem scheelen Grinsen griff Siegbert nach Moritz’ Rechter und schüttelte sie ihm.
»Erzbischof! Wie Ihr ja wisst, habe ich nicht allzu viel mit der Kirche zu schaffen.«
»Eine etwas laxe Bemerkung, findet Ihr nicht? Ein weniger toleranter Kirchenmann als ich würde Euch dafür anzeigen.«
»Ich bin zu alt, um mich darum zu sorgen, wie meine Worte bei meinem Gegenüber ankommen. Dafür kann es sich aber immer sicher sein, dass ich ehrlich mit ihm bin. Ob es ihm nun gefällt oder nicht.«
»Eine bemerkenswert kluge und doch unüberlegte Antwort, wie ich meine.«
»Ich habe keine Zeit für lange Überlegungen, und es ist auch nicht die Stunde hierfür. Ich suche Euch in einer für die Stadt wichtigen Angelegenheit auf und erwarte Eure Hilfe.«
»So fordernd?« Der Erzbischof zog die Augenbrauen hoch. »Dabei könnt Ihr froh sein, mich überhaupt in Bremen anzutreffen. Offiziell bin ich gar nicht hier und reise auch sogleich wieder im Auftrag des Herrn und seiner Heiligkeit, des Papstes, ab. Woher wusstet Ihr, dass ich mich zurzeit im Bischofssitz aufhalte?«
»Alles, was in dieser Stadt geschieht oder auch nicht geschieht, kommt mir zu Ohren, Erzbischof. Auch wenn Ihr Euer Kommen und Hiersein den Oberen nicht durch einen Boten habt ankündigen lassen, weiß ich doch, was in diesem Palast vor sich geht.«
»Ihr lasst mich bespitzeln?«
»Wie auf jeden anderen habe ich auch auf Euch ein wachsames Auge, Erzbischof. Es sind gefährliche Zeiten. Ihr solltet Euch freuen, nicht nur dem Schutze Eurer eigenen Leute zu unterstehen.«
Moritz von Oldenburg war die Wut über Siegberts Worte deutlich anzusehen. Doch er bezwang sich, lächelte und bedeutete Siegbert mit einer Geste seiner Hand, sich in eines der angrenzenden Zimmer zu begeben.
»Was kann ich also für Euch tun?«
Siegbert nahm auf dem ihm angebotenen, vor dem Schreibtisch des Erzbischofs stehenden Stuhl Platz. Der Kirchenmann selbst ließ sich ihm gegenüber nieder.
Der Ratsherr kam sofort auf den Punkt. In kurzen Worten schilderte er das Ergebnis der Verhandlungen und die Forderungen der verhassten Gegner.
»Und was habe ich damit zu tun?«
»Bremen hat nicht die finanziellen Mittel, um die geforderte Summe allein zu stellen.«
Moritz von Oldenburg hob in einer Geste des Bedauerns die Arme.
»Ich bin ein Diener Gottes. Wie kommt Ihr darauf, dass ich Euch helfen könnte?«
»Ihr habt die Kirche hinter Euch. Und wir brauchen uns wohl nicht darüber zu unterhalten, dass es für diese ein Leichtes wäre, das notwendige Geld zu beschaffen.«
»Nun, ich werde Euer Anliegen gern vortragen, kann Euch aber nur wenig Hoffnung machen. Die Zeiten sind für uns alle schlecht, das bekommt auch unsere heilige Gemeinschaft zu spüren. Und sich in Euren Krieg einzumischen, entspricht weder unserem geistlichen Auftrag noch unserem Plan.«
»So? Und dessen seid Ihr Euch sicher? Meiner Meinung nach tätet Ihr gut daran, die Eurigen zu überzeugen.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Wie Ihr wisst, hat sich Gottfried von Arnsberg auf die Seite der Hoyaer Grafen geschlagen. Wollt Ihr zusehen, wie diese an Macht gewinnen?«
»Mir ist Gottfried einerlei.« Moritz fuchtelte mit der Hand vor seinem Gesicht herum, als müsse er eine lästige Fliege verscheuchen.
»Ach ja?« Siegbert beugte sich weiter nach vorne. »Was glaubt Ihr wohl, was geschieht, wenn Bremen nicht bezahlt und dadurch den Hoyaer Grafen die Möglichkeit gibt, hier auch nur einen kleinen Teil der städtischen Macht zu übernehmen? Wen werden sie dann wohl doch noch auf den Stuhl des Erzbischofs hieven?«
Moritz’ Gesichtsausdruck veränderte sich. »Ich verstehe.«
»Auch solltet Ihr nicht vergessen, wer Euch seinerzeit dabei geholfen hat, von Arnsberg aus der Stadt zu jagen. Wie Ihr Euch erinnern werdet, habt Ihr es vor allem meinem Geld und meinem Einfluss zu verdanken, dass Ihr heute hinter diesem Schreibtisch sitzt. Überzeugt Eure Kirche, sich auf die Seite Bremens zu stellen und uns zu unterstützen, dann wird dieser Stuhl noch lange der Eure sein.«
»Wie schnell braucht Ihr das Geld?«
»Sofort!« Siegbert stand auf. »Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren und müssen dem Gegner umgehend eine Nachricht übermitteln, dass das Lösegeld gezahlt wird. Gewiss können wir noch ein paar Tage heraushandeln. Doch ich habe den Grafen von Hoya in die Augen gesehen. Diese Männer sind zu allem entschlossen. Wenn wir versuchen, sie hinzuhalten, krepieren unsere Leute, die Ratsherren zuerst.«
Auch der Erzbischof erhob sich nun. »Ich werde Euch eine Nachricht senden lassen, sobald das Geld bereitliegt. Ihr könnt Euch auf mich verlassen.«
Siegbert streckte ihm die Hand entgegen. »Vielleicht sollte ich mein Urteil über Kirchenmänner doch noch einmal überdenken. Eure Entschlussfähigkeit steht der eines Ratsherren in nichts nach.«
»Ich nehme an, dass Ihr das als Kompliment meint, wenngleich ich mich schwer tue, es als solches zu nehmen.«
»Dann nehmt es als persönliche Anerkennung für einen Mann, dem ich Respekt zolle.«
Der Erzbischof nickte und erwiderte den Händedruck.
»Ihr hört von mir!«
»Danke! Ich finde allein hinaus.«
4. Kapitel
Du musst mir jetzt zuhören.« Margrite hatte Lenas Schultern umfasst und schüttelte sie leicht. Es war offenkundig, dass die junge Witwe die letzten Stunden in einer Traumwelt verbracht hatte. Die Aufforderung der Freundin, sich hinzulegen und ein wenig auszuruhen, hatte sie mit der Begründung zurückgewiesen, dass sie nicht schlafen wolle, wenn Lorenz nach Hause käme. Margrites Antwort, dass ihr Geliebter nie mehr zurückkäme, schien Lena überhört zu haben.
»Lena, du musst an eure Kinder denken. Sie werden dich jetzt mehr denn je brauchen.«
»Du hast recht.« Die Witwe seufzte. »Ich sollte das Essen kochen. Die Kinder werden hungrig sein, wenn sie kommen. Wo Lorenz nur bleiben mag?« Sie streckte den Hals und sah zum Fenster hinaus. In diesem Augenblick verpasste Margrite ihr eine schallende Ohrfeige.
Erschrocken riss Lena die Augen auf und hielt sich die Wange.
»Was soll das?«
Margrite betrachtete Lena genauer. Sie schien ihr das erste Mal seit der Nachricht vom Tode ihres Mannes wieder ganz bei sich zu sein.
»Lena!«, sagte sie mit fester Stimme und sah sie durchdringend an. »Lorenz ist tot.« Mit angehaltenem Atem wartete sie auf die Reaktion der Jüngeren.
»Was?« Lena riss die Augen auf. Fassungslos starrte sie Margrite an.
So schrecklich es auch war, empfand die Seifensiederin doch Erleichterung.
»Lorenz ist tot«, wiederholte sie. »Die Stadtbüttel waren vorhin da.«
»Aber, das kann doch nicht sein.« Lenas Lippen zitterten. »Was ist geschehen?«
Margrite setzte sich auf einen Schemel, zog Lena auf den Stuhl neben sich und erzählte ihr mit ruhiger Stimme, was die Stadtbüttel berichtet hatten. Auch wo sich Lorenz’ Leichnam befand, ließ sie nicht unerwähnt.
Lena schlug sich die Hand vor den Mund. »Weiß man, wer ihm das angetan hat?«
Margrite schüttelte den Kopf. »Davon haben sie nichts gesagt.«
»Aber was soll ich denn jetzt nur tun?« Lena zuckte zusammen, als sie die Schritte ihrer Kinder im Eingang vernahm. Hastig sah sie Margrite an.
»Kinder!«, rief diese. »Kommt ihr bitte in die Küche? Wir müssen euch etwas berichten.« Sie griff nach der Hand der Witwe und bedeutete ihr, dass sie die schwere Aufgabe übernehmen würde, die Kinder vom Tode ihres Vaters zu unterrichten.