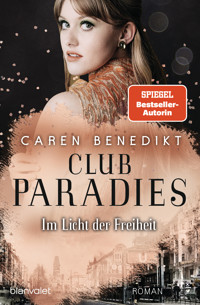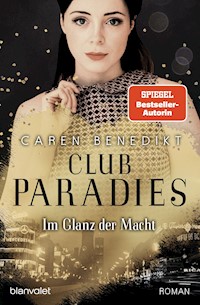9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Grand-Hotel-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ein elegantes Hotel an der Ostsee, ein verruchtes Varieté in Berlin, eine starke Frau, die ihren Weg geht, und ein Geheimnis, das alles in Gefahr bringt.
Rügen, 1924. Weiß und prächtig steht es an der Uferpromenade von Binz: das imposante Grand Hotel der Familie von Plesow. Vieles hat sich hier abgespielt, und es war nicht immer einfach, trotzdem blickt Bernadette voller Stolz auf ihr erstes Haus am Platz. Hier hat sie ihre Kinder großgezogen: den ruhigen Alexander, der einmal der Erbe des Grand Hotels sein wird; Josephine, die rebellische Künstlerin, die ihren Weg noch sucht; und den umtriebigen Constantin, der bereits sein eigenes Hotel, das Astor, in Berlin führt. Alles scheint in bester Ordnung. Natürlich gibt es hier und da Streitigkeiten mit ihrer Tochter, und irgendetwas stimmt auch nicht mit dem sonst so fröhlichen Zimmermädchen Marie –, aber all das ist nichts gegen das, was der unangekündigte Besuch eines Mannes auslösen könnte, der Bernadette damit droht, ihr dunkelstes Geheimnis aufzudecken …
Die Grand-Hotel-Trilogie:
Das Grand Hotel. Die nach den Sternen greifen.
Das Grand Hotel. Die mit dem Feuer spielen.
Das Grand Hotel. Die der Brandung trotzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 647
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Rügen, 1924. Weiß und prächtig steht es an der Uferpromenade von Binz: das imposante Grand Hotel der Familie von Plesow. Vieles hat sich hier abgespielt, und es war nicht immer einfach, trotzdem blickt Bernadette voller Stolz auf ihr erstes Haus am Platz. Hier hat sie ihre Kinder großgezogen: den ruhigen Alexander, der einmal der Erbe des Grand Hotels sein wird; Josefine, die rebellische Künstlerin, die ihren Weg noch sucht; und den umtriebigen Constantin, der bereits sein eigenes Hotel, das Astoria, in Berlin führt. Alles scheint in bester Ordnung. Natürlich gibt es hier und da Streitigkeiten mit ihrer Tochter, und irgendetwas stimmt auch nicht mit dem sonst so fröhlichen Zimmermädchen Marie –, aber all das ist nichts gegen das, was der unangekündigte Besuch eines Mannes auslösen könnte, der Bernadette damit droht, ihr dunkelstes Geheimnis aufzudecken …
Autorin
Caren Benedikt ist das Pseudonym der Autorin Petra Mattfeldt. Sie liebt den Norden, eine steife Brise und das Reisen an die Orte, über die sie schreibt. Nach einer eher nüchternen Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten arbeitete sie als freie Journalistin. Inzwischen ist die Schriftstellerei ihr Hauptberuf, und sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in einem kleinen Ort in der Nähe von Bremen.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
CAREN BENEDIKT
DASGRAND HOTEL
Die nach den Sternen greifen
Band 1
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2020 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München und Johannes Wiebel/punchdesignCovermotiv: © Bildkomposition aus Motiven von shutterstock
NG · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24355-5V003www.blanvalet.de
Für Ulrich, Ciara, Alin und Uli.Ihr seid immer an meiner Seiteund gebt so unglaublich viel Kraft.DANKE!
Prolog
Ich bin meinen Weg gegangen. Und niemand außer mir kann beurteilen, wie tief die Schlaglöcher waren, die ihn prägten.
BERNADETTE VON PLESOW
Ich muss etwa fünf, vielleicht auch sechs Jahre alt gewesen sein, als ich für mich festlegte, was ich im Leben unbedingt einmal werden wollte: schön und reich! Es ist nicht etwa so, dass meine Kindheit nicht zu ertragen gewesen wäre oder ich nie etwas zu essen gehabt hätte. Und im Gegensatz zu anderen Kindern meines Alters hatte ich durch den Beruf meines Vaters wenigstens immer ein Paar Schuhe, die mir passten, meinen Füßen genug Platz boten und diese sogar noch wärmten. Doch das war auch die einzige Annehmlichkeit, die er als Schuster seiner Familie bieten konnte. Jeder einzelne Pfennig, den er mit seinem Handwerk verdiente, war dringend vonnöten, um uns fünf Kinder, meine Mutter und auch sich selbst durchzubringen. Er war ein redlicher Mann, keine Frage, und meine Mutter hatte getan, was wohl sie selbst und alle anderen von ihr erwarteten. Doch sollte das wirklich alles sein, was man sich vom Leben erträumen konnte? Breite Hüften von den vielen Geburten und am Ende einer jeden Woche nur die erschöpfte Erleichterung, alle durchgebracht zu haben? Ich bin die Älteste von uns Geschwistern, und immer wieder habe ich mir in meiner Kindheit anhören dürfen, die Schönheit von meiner Mutter geerbt zu haben. Ich nahm dieses vermeintliche Kompliment mit gemischten Gefühlen an, denn ich konnte mir nie vorstellen, dass die Frau, die ich außer an den Feiertagen immer nur in einem Arbeitskittel gesehen hatte, jemals so etwas wie eine Schönheit gewesen sein sollte.
Doch nun ja, die Geschmäcker sind eben verschieden, und ich wurde tatsächlich mit jedem Jahr meiner Entwicklung zufriedener mit meinem Aussehen. Ich konnte von Glück sagen, dass ich die Größe von meinem Vater mitbekommen hatte. Als ich etwa zwölf Jahre alt war, überragte ich die anderen Mädchen meines Alters bereits um eine Kopflänge. Und ich war schon immer schlank gewesen, was zusammen mit meiner Größe dazu führte, dass ich unweigerlich alle Blicke auf mich zog, sobald ich einen Raum betrat. Gewiss wäre es schicklicher gewesen, diesem Umstand mit Zurückhaltung zu begegnen. Doch danach stand mir nicht der Sinn. Ja, ich gebe es zu: Ich genoss die Aufmerksamkeit, wann immer sie mir zuteilwurde. Und ich wusste, dass es genau dieses Aussehen und der mich umgebende Hauch von Arroganz waren, die Karl von Plesow auf mich aufmerksam werden ließen.
Ich war zwar die Tochter eines Schusters, doch ich hatte das Auftreten einer jungen Frau aus bestem Hause. Und niemand wäre auch nur auf die Idee gekommen, dass ich mich mit jemand anders als einem reichen, mir ebenbürtigen Mann abgeben würde. Ich strahlte aus, dass man mir etwas bieten müsste, und Karl von Plesow fühlte sich dieser Aufgabe offenbar gewachsen. Ich wusste nach unserem ersten Tanz, dass ich ihn dazu bringen würde, mir einen Heiratsantrag zu machen, und dass aus der Tochter eines einfachen Schusters die Freifrau Bernadette von Plesow würde. Ich war damals achtzehn und teilte mir mit einer anderen jungen Frau, die ebenfalls als Lehrling in der Schneiderei arbeitete, ein Zimmer bei einer Witwe, der Schwester unseres Lehrherrn. Nur eine Woche nachdem ich Karl kennengelernt hatte, legte ich meine Prüfung zur Schneiderin ab. Hätte ich ihn ein halbes Jahr früher getroffen – wer weiß, ob ich die Lehre in der kleinen Schneiderei in Berlin dann überhaupt noch beendet hätte.
Meine Eltern und Geschwister hat Karl nie kennengelernt. Ich ließ alles hinter mir, vor allem den provinziellen Mief Bad Harzburgs, wo ich aufgewachsen war und bis zum Antritt meiner Lehre gelebt hatte. Eine Weile schrieb ich noch Briefe und hielt den Kontakt, bis ich auch das einschlafen ließ. Ich musste eine Entscheidung treffen, und genau das tat ich. Ich sagte Karl, dass meine Eltern tot seien und ich nie Geschwister gehabt hätte, denn ich fand es besser, diesen endgültigen Schlussstrich zu ziehen.
Ich hatte mich für mein neues Leben entschieden und tat, was meiner Meinung nach notwendig war. Dies und nichts anderes ist meine Natur.
1. Kapitel
Eine Reise birgt stets die Gefahr, nicht zurückzukommen. Oder auch die Chance, je nachdem, wo man im Leben steht.
BERNADETTE VON PLESOW
Der Zug der Deutschen Reichsbahn von Berlin nach Greifswald ruckelte in gleichmäßigem Tempo die Gleise entlang und brachte Bernadette Meter für Meter ihrem Zuhause ein wenig näher. Sie genoss es, die grüne Mai-Landschaft an sich vorüberziehen zu lassen und noch etwas Zeit für sich zu haben, bevor sie in das enge Korsett ihrer Verantwortung zurückkehren musste. Versonnen spielte sie mit der goldenen Uhr an ihrem Handgelenk, die sie über dem Ärmel ihrer schmal geschnittenen Jacke trug. Um das Zifferblatt war sie mit kleinen funkelnden Brillanten besetzt, das Armband aus feinen Gliedern gefasst. Das Schmuckstück musste sündhaft teuer gewesen sein. Kein Geschenk, das ein Sohn üblicherweise für seine Mutter kaufte. Doch Constantin war eben nicht wie andere Söhne. Er war über die Maßen großzügig, liebte es, teure Geschenke zu machen, und verstand es spielend, die Menschen für sich zu gewinnen. Er hatte eine ganz besondere charmante Art, und die Menschen fühlten sich in seiner Gegenwart wohl. Constantin war freigebig und zuvorkommend. Nie zögerte er, wenn es darum ging, die Wünsche seiner Gäste wahr werden zu lassen. Es war ihm in Fleisch und Blut übergegangen, sich überaus spendabel zu zeigen, und er verstand es, seinem Gesprächspartner ein gutes Gefühl zu vermitteln, ganz gleich, mit welcher Art von Anliegen sich dieser an ihn wandte.
Sowohl das Hotel als auch das angeschlossene Varieté Astor liefen hervorragend und waren nicht nur jetzt, im Frühjahr 1924, komplett ausgebucht. Doch Bernadette machte sich nichts vor. Der Reichtum, mit dem Constantin sich umgab, konnte unmöglich aus diesen Gewinnen allein stammen. Das eine oder andere Mal hatte sie Gerüchte vernommen, Andeutungen nur, doch sie genügten ihr, um sich ein Bild zu machen. Aber nie wäre sie so dumm gewesen, Constantin mit ihren Vermutungen oder besser: ihrem Wissen zu konfrontieren. Was auch immer ihr Sohn tat, um seine Geschäfte zu betreiben, es ging sie nichts an, auch wenn sie Anteile am Astor besaß. Ganz abgesehen davon, dass sie mit ihrem eigenen Hotel in Binz durchaus von ihm profitierte.
Bernadette löste ihren Blick von der Uhr und sah wieder aus dem Fenster. Rasch zogen die Bäume entlang der Bahnstrecke an ihr vorbei. Sie konnte die Menschen schon verstehen, die die modernen Fortbewegungsmittel mit Skepsis betrachteten. Es war nicht von der Hand zu weisen, dass Züge wie Straßenbahnen in einer Geschwindigkeit fuhren, für die der Mensch nicht gemacht sein konnte. Dennoch genoss Bernadette die Fahrt, wenngleich ihr beim Blick aus dem Fenster und auf die an ihr vorbeirauschende Landschaft ein wenig mulmig wurde. Sie atmete tief durch, um die aufsteigende Übelkeit zu vertreiben, griff dann in ihre Handtasche und zog den Brief hervor, den sie seit nunmehr dreizehn Jahren immer bei sich trug. Was zum einen sentimentale Gründe hatte, denn er war das Letzte, was ihr von ihrem verstorbenen Ehemann noch geblieben war. Aber das war es nicht allein. Der andere Grund war, dass auf keinen Fall jemand anders als sie diesen Brief lesen durfte. Niemals!
Mit einem kleinen Seufzer nahm sie den schon leicht vergilbten Umschlag, dessen Papier im Laufe der Jahre noch trockener, fast schon porös geworden war, zog die beschriebenen Seiten heraus und begann zu lesen, auch wenn sie die Zeilen inzwischen auswendig kannte:
Meine geliebte Bernadette!
Es ist an der Zeit, dir meine Gefühle zu beschreiben, und zwar von dem Moment an, als du in mein Leben getreten bist. Als ich dich das erste Mal sah, damals, in dem Tanzlokal mit den kleinen Leuchten an den holzverkleideten Wänden, verschlug es mir fast den Atem. Mir schien es, als seist du vom Moment deines Eintretens an das Metronom, das für alle im Saal den Takt vorgab. Du warst so vollkommen anders als all die anderen jungen Frauen im Lokal, die gekommen waren, um sich zu vergnügen und die eine oder andere Bekanntschaft zu schließen. Der Schein des Kronleuchters ließ dein dunkles Haar fast bläulich schimmern, und mein Blick folgte dir bei jedem deiner Schritte, deinem stolzen Kopfnicken, gepaart mit einem unwiderstehlichen, geheimnisvollen Lächeln, das demjenigen, dem du es schenktest, eine Auszeichnung war. Wie ein Magnet zogst du alle Blicke auf dich, und ich bin sicher, das war dir bewusst. Deine Aura und dein Charisma waren anders als alles, was ich je zuvor erlebt hatte. Ich weiß noch, dass es mir schwerfiel, damals dein Alter zu schätzen. Dein Gesicht war jung und irgendwie auch wieder nicht, was an diesen wunderbar markanten Zügen lag, doch deine Ausstrahlung war schon damals die einer erfahrenen Frau. Ich erinnere mich genau, als ich auf dich zuging und mich dir vorstellte. Ich vermochte das Funkeln in deinen Augen zu erkennen, das zweifelsohne dem von in meinem Namen geschuldet war. Bitte verzeih mir die Offenheit, doch mir war selbstverständlich vollkommen klar, dass dein Interesse unmöglich meinem äußeren Erscheinungsbild gelten konnte. Schließlich war ich nicht besonders stattlich und noch dazu um einiges älter als du. Darüber vermochten auch meine teure Kleidung und die italienischen Schuhe nicht hinwegzutäuschen.
Ich weiß noch genau, wie du mich angesehen hast, als ich dir den Champagnerkelch reichte. Erinnerst du dich noch? Wir tanzten an diesem Abend, bis die Kapelle ihre Instrumente weglegte. Ich sehe alles noch vor mir, als wäre es gestern geschehen …
»Verzeihung, gnädige Frau?«
Bernadette zuckte erschrocken zusammen. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass der Fahrkartenkontrolleur durch die offene Waggontür eingetreten war.
»Oh«, sagte sie. »Gewiss.« Rasch faltete sie den Brief zusammen und ließ ihn in ihrer Handtasche verschwinden, ohne ihn in den Umschlag zurückzustecken. Dann zog sie ihren Fahrschein hervor und reichte ihn dem Kontrolleur. »Bitte.«
»Haben Sie vielen Dank, gnädige Frau.« Er betrachtete den Fahrschein.
»Wie lange werden wir noch brauchen bis Greifswald?«, fragte Bernadette, mehr aus Unsicherheit, weil sie sich beim Lesen ertappt gefühlt hatte.
»Noch etwa eine halbe Stunde, gnädige Frau. Wünschen Sie Hilfe mit Ihrem Gepäck? Dann werde ich jemanden kommen lassen.«
Bernadette lächelte ihn an und schüttelte kurz den Kopf. »Nein, haben Sie vielen Dank! Ich habe nicht viel zu tragen und werde außerdem am Bahnhof abgeholt.«
»Wie Sie wünschen, gnädige Frau.« Er gab ihr den Fahrschein zurück. »Dann noch eine gute Weiterfahrt.«
»Danke.« Bernadette steckte das Billett wieder ein, zog den Brief noch einmal hervor und verstaute ihn sorgfältig im Umschlag. Dann schob sie ihn zurück in die Handtasche und legte ihr Stofftaschentuch darüber, so dass er nicht gleich auf den ersten Blick zu sehen war.
Sie schaute wieder auf die Uhr. Kurz nach zehn. In weniger als einer Viertelstunde würden sie Greifswald erreichen.
Unruhe stieg in ihr auf. Sie konnte nur hoffen, dass es im Grand, ihrem Hotel in Binz, keine besonderen Vorkommnisse gegeben hatte. Bernadette beruhigte sich mit dem Gedanken, dass gewiss alles in Ordnung war, schließlich konnte sie sich auf Alexander, ihren ältesten Sohn, den sie vor einigen Jahren zum Geschäftsführer gemacht hatte, stets verlassen. Und sie brachte gute, ja beste Nachrichten mit nach Hause. Ihr Besuch bei Constantin war ein voller Erfolg gewesen. Er hatte sich großzügig gezeigt. Bernadette war nach Berlin gereist, um Constantin ihre Anteile am Astor zu übertragen und sich hierfür auszahlen zu lassen. Doch das hatte ihr Sohn abgelehnt. Er gab ihr einfach das Geld, das sie brauchte, um die neuen Strandkörbe für das Hotel fertigen zu lassen, damit sie zum Beginn der Sommersaison ein gutes Geschäft machen konnte.
Es war nicht zu verhehlen, dass das Grand noch längst nicht so dastand, wie Bernadette es sich wünschte. Gewiss, es war das prächtigste Gebäude, das an der Strandpromenade zu finden war. Hochherrschaftlich und luxuriös, gepaart mit dem Charme gelebter Sorglosigkeit, stand es da und verkörperte das, was Bernadette so unglaublich wichtig war: Eleganz und Klasse. Doch es war ihr in den Jahren nach dem verheerenden Brand nicht gelungen, das Hotel finanziell so unabhängig zu stellen, wie sie es sich gewünscht hätte. Der Krieg hatte das, was sie in den Jahren zuvor mühsam aufgebaut hatte, zum Großteil zunichtegemacht.
Bernadette hatte einiges unternehmen müssen, was sie lieber vergessen hätte, um das Hotel überhaupt am Laufen zu halten und die wenigen Gäste mit der Art von Speisen und Getränken zu versorgen, die diese von einem Hotel dieses Standards zu Recht erwarteten. Einzig die Tatsache, dass sie das Haus für diskrete Treffen von Politikern geöffnet hatte, die auf Geheimhaltung und Verschwiegenheit Wert legten, hatte ihr so manchen Monat beim bloßen Überleben geholfen. Für sie wie für jeden anderen im Land war es ein Aufatmen, als der Krieg vor sechs Jahren zu Ende gegangen war und ihre Söhne endlich nach Hause zurückkehrten.
Bis auf einen. Während Alexander und Constantin schon wenige Wochen nach dem ausgerufenen Kriegsende nach Binz heimkehrten, dauerte es weitere zwei Monate, bis Bernadette die Nachricht erhielt, dass Maximilian, ihr jüngster Sohn, im Kampf gefallen war. Jeden Tag hatte sie bis dahin gebangt, und selbst nachdem sie die Botschaft erhalten hatte, hatte sie die Hoffnung immer noch nicht ganz aufgegeben. Schließlich war ihr der Leichnam ihres Sohnes niemals übergeben worden. Es vergingen Wochen, Monate, fast drei Jahre, in denen Bernadette die Hoffnung nicht aufgeben wollte, dass Maximilian womöglich doch noch lebte und sich an einem unbekannten Ort in Gefangenschaft befand.
Doch sie musste weitermachen, für ihre Tochter Josephine, ihre Söhne Alexander und Constantin, ihr Hotel mit den Angestellten und auch für sich selbst. Aber die schmerzhafte Wunde in ihrem Herzen, die nur eine Mutter nachempfinden konnte, würde nie ganz heilen, dessen war sie sicher.
Doch es waren nicht nur die Erinnerungen daran, die sie in manchen Nächten nicht schlafen ließen. Es war vor allem auch die Sorge, wie es weitergehen sollte. Schon bald nach seiner Rückkehr eröffnete ihr Constantin seine Idee, in Berlin ein eigenes Hotel, vergleichbar mit dem Grand in Binz, sowie ein gleichnamiges angeschlossenes Varieté für die abendliche Unterhaltung eröffnen zu wollen. Dem Widerstand ihres Sohnes Alexander zum Trotz hatte Bernadette eine Hypothek auf das Grand aufgenommen, um Constantin so den Start zu ermöglichen.
Und es war die richtige Entscheidung gewesen. In den vergangenen Jahren hatte sie mehr vom Astor profitiert als dieses vom Grand, und Constantin ließ sie großzügig an dem Erfolg ihrer damaligen Investition teilhaben. Bernadette war froh, ihn zum Sohn zu haben, und schämte sich gleichzeitig für das leise Bedauern tief in ihrem Innern, dass Alexander nicht ein klein wenig mehr Ähnlichkeit mit seinem jüngeren Bruder hatte.
Sie spürte, wie der Zug die Geschwindigkeit verringerte. In diesem Moment ging der Fahrkartenkontrolleur an ihrem Abteil vorbei. »Verzeihen Sie, ist der nächste Halt schon Greifswald?«
»Ja, gnädige Frau. Wir werden in wenigen Minuten dort einfahren.«
»Danke.«
Er nickte ihr zu und ging weiter.
Bernadette griff nach der ledernen Reisetasche, die sie links von sich abgestellt hatte, nahm ihre Handtasche und verließ das Abteil, um vor der nächsten Wagentür zu warten, bis der Zug vollständig zum Halten kam. Die Tür wurde von außen geöffnet, und ein junger Mann reichte ihr helfend die Hand. Sie stieg aus, drückte ihm etwas Kleingeld in die Hand und sah sich suchend auf dem Bahnsteig um. Ein Stück entfernt hob jemand grüßend den Arm und kam dann auf sie zu.
»Willkommen zu Hause, Frau von Plesow!« Der Mann deutete eine Verbeugung an und nahm ihr die Reisetasche ab.
»Guten Tag, Horst. Na, zu Hause bin ich noch nicht ganz.« Sie lächelte ihn an.
»Die See ist ruhig. Ich werde Sie sicher nach Binz hinüberbringen.«
»Das weiß ich doch. Danke, Horst.«
Ein Wagen stand bereit, der sie zum Anleger nach Wieck brachte. Hier hatte Horst das Boot festgemacht, das Bernadette vor zwei Jahren für das Grand angeschafft hatte und das die Gäste von den Anlegeplätzen um den Greifswalder Bodden, von Göhren und Sellin oder auch von Stralsund aus sicher zum Hotel brachte. Bernadette genoss die kleine Freiheit, wenngleich sie auch mit dem Zug hätte weiterfahren können.
Sie legte sich ein Kopftuch um und verknotete es unter dem Kinn, als Horst das Boot langsam aus dem kleinen Hafen steuerte. Dann setzte sie sich entspannt auf eine Bank an der Reling und genoss die letzten Momente, bevor sie ins Grand heimkehrte. In nicht einmal einer halben Stunde würden sie den Anleger erreichen, und sie würde ihre Arbeit wieder aufnehmen. Es war nicht leicht, Bernadette von Plesow zu sein. Doch sie würde ihr Bestes geben, um die Rolle wie immer auszufüllen.
Sanft trug der Wind die Klänge des Akkordeons bis zum Anleger herüber, als Horst das Boot seitlich brachte. Er half Bernadette, bis diese sicheren Stand auf dem Holzsteg fand.
»Die Tasche bringe ich gleich mit«, bot er an, und Bernadette nickte. Sie waren ein eingespieltes Team. Horst wusste, dass Bernadette es genoss, ganz allein den langen Weg über die Seebrücke zurückzulegen. Also erklärte er, noch das Boot in Ordnung bringen und später nachkommen zu wollen. Bernadette dankte es ihm mit einem Lächeln, öffnete den Knoten des Kopftuchs und nahm es ab. Sie war froh, wieder daheim zu sein, wenngleich sie die Reisen, die ihre Stellung mit sich brachte, als Abwechslung vom Alltag durchaus genoss. Sie sah über den lang gezogenen Steg zum Hotel hinüber, zu ihrem Hotel, das herrschaftlich an der Promenade von Binz emporragte. Noch immer faszinierte sie der Anblick jedes Mal aufs Neue, wenngleich das Hotel nun schon im dreizehnten Jahr seit dem Wiederaufbau nach dem verheerenden Feuer in Betrieb war. Sie verabschiedete sich mit einer Geste von Horst und ging dann mit langsamen Schritten den Holzsteg entlang. Fünfhunderteinundachtzig Schritte. So viele waren es, bis man vom Steg auf die befestigte Promenade trat. Die Akkordeonmusik brach mitten im Stück kurz ab. Oder nahm Bernadette sie nur nicht mehr wahr, weil die Möwen ihr eigenes kleines Konzert gaben und mit unablässigen Schreien ihren Teil zu der Atmosphäre dieses Ortes beitrugen? Bernadette hörte genauer hin. Tatsächlich war die Musik verstummt, doch nur einige Schritte weiter erklang sie von Neuem. Die melancholische Melodie verriet Sehnsucht und Verträumtheit und berührte sie in diesem Moment tief im Herzen. Bernadette ging langsam, schlenderte fast, ganz entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, wenn sie zielstrebig und mit festem Schritt durch die Flure ihres Hotels eilte, gewohnt, alles zu kontrollieren und unablässig Entscheidungen zu treffen.
Doch nicht heute Morgen. Alles hatte sich zum Guten gewendet, alles war geregelt. Schon bald würden die zunehmenden Temperaturen mehr und mehr Gäste zur Sommerfrische in ihr Hotel locken. Constantin hatte ihr nicht nur das Geld gegeben, sondern zugesagt, auch weiterhin seine Geschäftsgäste in Berlin auf eine kurze Erholung mit ihren Familien nach Binz zu schicken, wie er es schon seit einiger Zeit tat. So trafen sich immer wieder Geschäftsleute, die sich kannten, in ihrem Hotel, während ihre Frauen und Kinder die Zeit am Strand verbrachten.
Alexander betrachtete dies mit einem gewissen Misstrauen. Er hatte seiner Mutter oft genug gesagt, dass ihm diese Geschäftsleute häufig zwielichtig erschienen, da sie nicht nur Geld, sondern auch Ärger ins Haus brachten. Bernadette weigerte sich, ihm zuzuhören. Geschäft war Geschäft, und Geld war Geld. Ihr war egal, mit wem man es verdiente. Wenn sich alles weiterhin so entwickelte, könnte dieser Sommer den monetären Befreiungsschlag bringen, den sie schon so lange herbeisehnte. Bernadette hoffte inständig darauf.
Die Klänge des Akkordeons, die sie sonst gegenüber ihren Angestellten oft als »Gejaule« oder »Katzenmusik« bezeichnete, zauberten ihr heute ein Lächeln aufs Gesicht und begleiteten sie mit jedem Schritt über den Holzsteg nach Hause. Bernadette atmete tief ein und ließ ihren Blick genussvoll über die See schweifen, dann über den Strand. Doch ihre eben noch entspannte Miene verzog sich rasch wieder. Sie kniff die Augen zusammen und beschattete sie mit der Hand, um besser erkennen zu können, was sie dort zu sehen meinte. Nach ein paar Schritten blieb sie stehen. Sie konnte mehrere Personen ausmachen, gleich vorn am Strand, auf der Höhe ihres Hotels. Eilig ging sie weiter, den Blick starr auf das Geschehen gerichtet. Was tat sich dort? Sie lief ein Stück, beherrschte sich jedoch, um nicht aufzufallen. Es gehörte sich für eine Dame nicht, in der Öffentlichkeit zu rennen, und sie würde sich keinesfalls dazu hinreißen lassen, nur um sehen zu können, was sich dort am Strand tat. Eilig ging sie weiter, bis sie schließlich erkannte, was vorging. Abrupt blieb sie stehen. Zwei Männer waren in die See gewatet, um einen leblosen Körper aus dem Wasser zu ziehen. Fünf weitere Männer standen am Strand und sahen zu, wie die anderen einen Mann aus der Ostsee bargen. Allem Anschein nach war er tot. Bernadette eilte weiter, bis sie auf der Seebrücke fast gleichauf mit den Männern am Strand war. Zwei von ihnen kannte sie namentlich, die anderen hatte sie auf jeden Fall schon einmal gesehen.
»Hans«, rief sie hinunter. »Was ist denn geschehen?«
Der Polizist sah zu ihr auf. »Bernadette, das solltest du dir lieber nicht ansehen. Keine Sorge. Wir schaffen ihn, so rasch es geht, fort.«
»Ist der Mann ertrunken?«
»Ja«, rief er zurück. »Aber erst nachdem jemand auf ihn geschossen hat.«
Bernadette presste die Lippen aufeinander, als sie einen Blick auf die Leiche warf und das Loch in der Mitte der Stirn entdeckte. Sie kannte den Mann.
»Weißt du, wer er ist?«, rief Oberwachtmeister Hans Bender ihr zu.
Bernadette schüttelte heftig den Kopf. »Ich habe ihn noch nie gesehen.«
Bender nickte. »Na dann. Wir schaffen den Leichnam jetzt fort. Einen guten Tag, Bernadette. Lass ihn dir hiervon nicht verderben.«
»Dir auch einen guten Tag, Hans. Adieu!« Bernadette ging die wenigen Meter bis zum Ende der Seebrücke und warf dem Akkordeonspieler einen kurzen Blick zu. Er saß ganz aufrecht, zeigte immer noch soldatische Haltung. Die Uniformjacke hatte er trotz der Wärme akkurat bis obenhin geschlossen, die Haare zum Seitenscheitel gekämmt, das Gesicht glatt rasiert. Auf seiner Brust prangte das Eiserne Kreuz I. Klasse, das nur dann zu sehen war, wenn er sein Akkordeon zusammenschob. Sein linkes Bein war gerade ausgestreckt, sein rechtes in der Mitte des Oberschenkels abgetrennt, die Uniformhose darunter umgeschlagen. Neben ihm lag seine Uniformmütze mit einigen Münzen darin. Sein Blick war ausdruckslos. Er nickte grüßend, doch Bernadette von Plesow hätte sich nie dazu herabgelassen, den Gruß zu erwidern. Sie hob den Kopf und beeilte sich, das Grand zu erreichen. Die Leichtigkeit, mit der sie von ihrem Boot getreten war, war verflogen.
Der Boy hielt ihr schon die Tür auf, als sie noch gut zehn Meter vom Eingang entfernt war. Er grüßte sie mit einer formvollendeten Verbeugung und wünschte einen guten Tag. Bernadette bedachte ihn mit einem Nicken und trat ein.
»Guten Morgen, gnädige Frau.« Das Zimmermädchen knickste und wollte mit dem Eimer und dem Lappen in der Hand rasch weiterhuschen, doch Bernadette hielt sie zurück.
»Marie! Einen Moment. Was machst du hier in der Empfangshalle?« Die Verärgerung in ihrer Stimme war nicht zu überhören. Es war den Gästen nicht zuzumuten, dass sie außer den Pagen und den Rezeptionisten irgendwelches Personal sehen mussten.
Die junge zarte Frau mit der blassen Haut und den hellblonden, straff zum Knoten gebundenen Haaren blieb stehen. Ihre Wangen röteten sich. »Ich bitte um Verzeihung.« Sie sah Bernadette aus ihren großen blauen Augen fast ängstlich an, dann senkte sie den Kopf. »Der Junge von den Forenbergs, der kleine Richard.«
»Was ist mit ihm?«
»Er hat sich übergeben müssen. Gleich dort vorn.« Sie deutete mit dem Finger. »Es ist alles wieder bereinigt, gnädige Frau.« Wieder senkte sie den Blick.
»Nun gut. Das ist natürlich etwas anderes«, lenkte Bernadette ein. Sie deutete in Richtung Strand. »Haben die Gäste mitbekommen, was dort draußen vor sich geht?«
»Es tut mir leid, das weiß ich leider nicht.« Marie schüttelte den Kopf. »Ich bin nur rasch von oben gekommen und habe aufgewischt.« Sie folgte Bernadettes Blick. »Was ist denn am Strand geschehen?«
»Ach nichts, nichts.« Bernadette machte eine Handbewegung, als wollte sie eine Fliege verscheuchen. »Geh wieder an die Arbeit.«
»Jawohl, gnädige Frau.« Marie knickste und beeilte sich, zu den anderen Zimmermädchen zurückzulaufen. Rasch huschte sie davon.
Bernadette schaute sich in der Eingangshalle ihres Hotels um, nahm den Anblick in sich auf. Es hatte sich bezahlt gemacht, dass sie seinerzeit den teuren Marmor für den Fußboden hatten verlegen lassen. Alles wirkte immer noch nagelneu, ganz so, als wäre es erst vor wenigen Wochen fertiggestellt worden. Sie sah auf die großen Kübel, die genau dort standen, wo sie sie haben wollte, elegant bestückt mit frischen Blumen. Sie war zufrieden. Erst jetzt ging sie zur Rezeption, an der Werner Druminski seinen Dienst tat.
»Guten Morgen, gnädige Frau. Wie schön, Sie wohlbehalten im Hause begrüßen zu können. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise?«
»Guten Morgen, Werner. Ja, alles war zufriedenstellend. Gab es etwas Besonderes während meiner Abwesenheit?«
Eifrig hob der etwas untersetzte Mann mit dem schütteren Haar das Reservierungsbuch auf den Tresen und drehte es zu ihr herum. »Wir sind ausgebucht für die nächsten zwei Monate.« Er deutete eifrig mit dem Stift. »Lediglich hier, an dem Wochenende des zweiten Juli, wären noch zwei Zimmer zu haben.« Er strahlte über das ganze Gesicht. Verschwörerisch und mit gesenkter Stimmte stellte er fest: »Es wird ein vortrefflicher Sommer für das Hotel werden, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, gnädige Frau.«
Bernadette lächelte verhalten. »Ja, Werner. Ich sehe es. Ich bin mehr als zufrieden.«
»Es freut mich über die Maßen, dies aus Ihrem Munde zu hören, gnädige Frau.«
Sie gab ihm das Reservierungsbuch zurück. »Sind schon viele unserer Gäste unterwegs?«
»Noch nicht, soweit ich weiß, gnädige Frau. In den letzten Tagen wurden die ersten Kutschen nie vor elf Uhr bestellt.«
»Gut.« Sie ersparte es sich, auch ihn zu dem Geschehen am Strand zu befragen. Offenbar hatte noch niemand etwas mitbekommen, und die Wachtmeister würden nicht mehr lange brauchen, bis der Leichnam fortgeschafft war. Es war besser, wenn kein weiteres Aufhebens gemacht wurde. Je weniger Aufregung, desto zufriedener die Gäste.
»Ich gehe nach oben in mein Arbeitszimmer«, verkündete Bernadette. »Ich erwarte im Laufe des Vormittags einige Anrufe.«
»Ich werde sogleich verbinden, sobald jemand Sie zu erreichen versucht, gnädige Frau.«
»Wo ist mein Sohn Alexander?«
»Noch nicht im Haus, gnädige Frau. Soll ich mich melden, sobald er kommt?«
»Er ist noch nicht da?« Sie zog die rechte Augenbraue hoch, ein untrügliches Zeichen dafür, dass sie über diese Nachricht nur wenig erfreut war. »Schicken Sie ihn in mein Büro, sobald er da ist«, ordnete sie an.
»Sehr wohl, gnädige Frau.«
Bernadette machte kehrt und ging zu den Treppen hinüber. Den Fahrstuhl benutzte sie nur, wenn ein geschäftliches Treffen anstand und sie die Gäste begleitete. Sonst nahm sie stets die Stufen in dem Bestreben, nicht zu bequem zu werden.
Ihr Büro im zweiten Stock war wie immer verschlossen. Selbst wenn sie ihren Arbeitsplatz nur für wenige Momente verließ, weil sie im Hotel zu tun hatte, war es ihr zur Gewohnheit geworden abzusperren. Dies galt natürlich erst recht, wenn sie wie jetzt, insgesamt vier Tage, nicht im Hotel war. Mit den Jahren war sie noch misstrauischer geworden, als sie es ohnehin schon immer gewesen war. Manchmal fast schon argwöhnisch. Doch konnte man es ihr verdenken, nach allem, was sie erlebt hatte? Um sie herum gab es mehr Neider als Freunde, und selbst die, die ihr verbunden waren, hatten stets ihren eigenen Vorteil im Auge. Sie ging zum Schreibtisch hinüber, schloss ihn auf und legte die Papiere und das Geld, das sie mit sich führte, in die unterste Schublade. Nur der Brief ihres verstorbenen Ehemannes blieb in ihrer Handtasche verborgen. Bernadette atmete erleichtert aus, als sie das Fach wieder zuschob. Es war geschafft. Endlich!
Es klopfte. »Mutter?«
»Komm herein, Alexander.«
Die Tür wurde geöffnet, und ihr ältester Sohn trat ein. Dreißig Jahre alt wurde er im November, und Bernadette war froh, dass er ebenso wie der eineinhalb Jahre jüngere Constantin die Größe und auch das Aussehen von ihr geerbt hatte. Genau genommen hatten das all ihre Kinder, auch die vierundzwanzigjährige Josephine, die genau so aussah wie Bernadette in diesem Alter.
»Guten Morgen, Mutter.« Alexander kam zu ihr herüber und küsste sie auf die Wange.
»Guten Morgen, Alexander.« Sie setzte sich an ihren Schreibtisch, während Alexander auf einem der Besucherstühle davor Platz nahm.
»Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise, Mutter? Konntest du in Berlin alles erledigen, was du vorhattest?«
»Ja, Alexander. Danke. Constantin hat mir den neuen Varieté-Saal gezeigt. Er bietet Platz für über einhundert Gäste und ist tatsächlich jeden Abend voll besetzt.«
»Die Menschen gieren eben nach Ablenkung«, meinte er.
»Berlin ist lauter und rasanter als je zuvor«, erklärte Bernadette. »Constantin macht es richtig, diese Tatsache für seine Unternehmungen zu verwenden.«
»Es war keineswegs als Kritik gemeint«, beeilte sich Alexander zu versichern. »Wenngleich ich zugebe, dass ich froh darüber bin, dieses Hotel hier führen zu dürfen. In Binz ist alles ein wenig bedächtiger und ruhiger, obwohl auch hier eine gewisse …«, er suchte nach dem richtigen Wort, »… Entwicklung abzusehen ist, die mich ein wenig beunruhigt. Und nicht nur mich.«
»Wir haben das Geld für neue Strandkörbe bekommen«, berichtete Bernadette, ohne auf seine letzte Bemerkung einzugehen.
»So gut läuft es also in Berlin, ja?« Es klang schnippisch.
»In der Tat, das tut es. Ich gehe doch davon aus, dass dich der Erfolg deines Bruders ebenso freut wie mich?« Ihre Worte waren als Frage formuliert, aber wer Bernadette kannte, wusste auch, dass eine Warnung darin mitschwang.
»Gewiss, Mutter. Warum sollte es anders sein?«, gab Alexander ausweichend zur Antwort.
»Gut. Das hatte ich erwartet.« Sie sah ihn ernst an. »Als ich heute Morgen ankam, haben Hans Bender und seine Männer gerade eine Leiche aus dem Wasser gezogen.«
»Eine Leiche?« Alexander seufzte, überrascht wirkte er jedoch nicht. »Ein Badeunfall?«
»Der Mann hatte eine Kugel im Kopf«, stellte Bernadette klar. »Er war einer von denen, die für Bischoff, den Bankier, arbeiten.«
»Das ist nun schon der Zweite«, stellte Alexander fest.
»Du meinst den anderen Toten in Hiddensee?«, fragte Bernadette nach.
»Er wurde nur dort angespült, weil man ihn irgendwo vom Boot in die Ostsee geworfen hat. Doch er war einer von Gideon Kaubs Leuten.«
»Und damit gehörte er zum Personal eines unserer wichtigsten Binzer Geschäftsleute«, erkannte Bernadette bedrückt.
»Ich habe Gerüchte gehört, dass es einen Streit um die Lizenzen von Kaub gegeben haben soll«, sagte Alexander. »Es hieß, er habe sich geweigert zu zahlen.«
»Und das war auch richtig so. Du weißt, ich habe nicht besonders viel für die Konkurrenz übrig. Gideon Kaub macht mir nun schon seit Jahren das Leben schwer und würde nur zu gern das Grand übernehmen, aber in diesem Punkt stehe ich hinter ihm.« Bernadette funkelte ihn aufgebracht an. »Ich habe das Problem mit Constantin besprochen. Sollte irgendjemand an uns herantreten, wird er uns helfen.«
»Von Berlin aus?«
»Ja.«
»Und wie stellt er sich das vor?«
Bernadette zuckte mit den Schultern. »Überlass das Constantin. Er hat gute Kontakte und wird nicht zulassen, dass solche Verbrecher sich hier breitmachen.«
Alexander wollte etwas erwidern, beließ es aber dabei. Er wusste, dass seine Mutter große Stücke auf seinen jüngeren Bruder hielt und dass es aussichtlos war, ihr seine Bedenken mitzuteilen. »Dann werde ich jetzt auch an die Arbeit gehen«, erklärte er und stand auf.
»Alexander, eine kurze Frage noch. Weshalb bist du heute so spät zum Dienst erschienen?«
»Eine Privatangelegenheit«, gab er knapp zurück.
»Das ist eine Antwort für das Personal. Ich bin deine Mutter. Also?«
»Nun, wenn du es unbedingt wissen willst: Ich hatte ein Treffen mit einigen Geschäftsleuten wegen der Entwicklung im Land.«
»Wegen der Entwicklung im Land?«, echote sie. »Geht es etwas konkreter?«
Alexander zögerte. »Wir haben den Krieg verloren und müssen nun dafür geradestehen, aber die Reparationszahlungen führen uns alle an unsere Grenzen. Viele von uns waren ganz vorn an der Front und sollen nun zusehen, wie die Unterwanderung durch gewisse Mitbürger«, er brachte das letzte Wort spöttisch gepresst hervor, »direkt vor unseren Augen geschieht. Das ist nur schwer hinzunehmen.«
»Und du denkst, dass du mit einer Handvoll Männer etwas daran ändern kannst?«
»Wenn nicht wir, wer dann?«
»Alexander. Ich gebe dir einen guten mütterlichen, vor allem aber auch geschäftlichen Rat. Es sind schwierige Zeiten. Überlass es Friedrich Ebert und seinen Leuten, dafür zu sorgen, dass alles wieder in Ordnung kommt.«
Alexander sah sie einen Moment nachdenklich an. Offenbar lag ihm eine Erwiderung auf der Zunge, doch er schluckte sie hinunter. »Es ist schön, dass du zurück bist, Mutter. Essen wir zusammen zu Mittag?«
Bernadette bedauerte, dass er offenbar eine weitere Unterhaltung mit ihr über die politische Lage ablehnte, doch sie wusste, dass sie bei Alexander auf taube Ohren stieß. Seine Überzeugungen hatten sich in letzter Zeit noch verfestigt. Es beunruhigte sie, doch sie wusste auch, dass sie derzeit nichts dagegen unternehmen konnte. »Das wäre wunderbar, mein Sohn«, antwortete sie deshalb nur. »Was ist mit Josie?«
»Was soll mit ihr sein?«
»Hattest du Schwierigkeiten, deine Schwester an den Abenden zu Hause zu halten?«
»Aber nein. Sie war ganz friedlich.«
»Ist der Baron noch im Haus zu Gast?«
»Ja. Und um deine nächste Frage vorwegzunehmen: Sein Sohn wird am Wochenende aus dem Studium kommen und seine Zeit hier verbringen.«
»Gut«, befand Bernadette. »Josie soll ein kleines Programm für ihn zusammenstellen und sich persönlich um ihn kümmern.«
»Das wird ihr nicht gefallen. Sie sagt, sie stecke gerade in einer überaus kreativen Phase und möchte das Atelier am liebsten gar nicht verlassen.«
Bernadette lächelte kühl. »Sie wird das Atelier bald gar nicht mehr betreten dürfen, wenn sie nicht mit Freude und erkennbar großem Eifer tut, was ich ihr auftrage.«
»Ich werde mit ihr sprechen, Mutter.«
»Tu das. Sonst übernehme ich das.«
»Das wird nicht nötig sein. Wir sehen uns heute Mittag. Adieu, Mutter.«
»Adieu, Alexander. Bis später.«
Alexander verließ das Büro. Bernadette lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Neunundvierzig Jahre war sie nun, und ihr Ehrgeiz war ungezügelt. Doch manchmal hätte sie nichts dagegen, ihre Ziele etwas leichter zu erreichen.
2. Kapitel
Sicher ist, dass jeder kriegt, was ihm zusteht. Nur die Meinungen darüber, was das ist, gehen auseinander.
CONSTANTIN VON PLESOW
Gerd Nolte eilte mit gesenktem Kopf die letzten Meter, bis er mit seinem Begleiter den Eingang des Berliner Varietés erreichte. Sein Blick fiel auf das Werbeschild vor dem Astor, das in grellbunten Farben den spektakulären Auftritt der Volants Marocains, der »Fliegenden Marokkaner«, ankündigte. Die kleinen Lämpchen rund um das Schild waren nicht eingeschaltet, obwohl Constantin darauf bestand, dass diese auch am Tag brannten. Nolte öffnete die Tür und ließ seinen Begleiter schweigend eintreten. »Warte kurz«, sagte er, zog seinen Schlüssel hervor, ging durch eine Seitentür in den Nebenraum und schaltete die Außenbeleuchtung an. Dann kam er wieder heraus, zog die Tür hinter sich zu und atmete laut aus. »Komm. Der Chef ist um diese Zeit immer in seinem Büro.« Der andere nickte, doch er sagte kein Wort. Zusammen gingen sie die Treppen hinauf, dann über den Flur bis zu einer Tür, vor der seitlich rechts und links je zwei Stühle standen. Der Holzboden knarrte leicht unter ihren Schritten. »Setz dich hierhin und warte. Ich sag dir dann Bescheid.« Nolte klopfte kurz und trat in das Büro, ohne eine Antwort abzuwarten.
»Kassier die Nutten ab und schick sie zum Waschen. Erst danach kriegen sie ihr Frühstück.« Constantin von Plesow blätterte einige Papiere durch. Als Gerd Nolte das Büro betrat, sah er auf.
»Geht klar, Chef.« Ludger Schnurr, ein hochgewachsener, breitschultriger ehemaliger Boxer, der aussah, als hätte er keinen Hals, stand direkt vor dem Schreibtisch und wartete auf weitere Anweisungen. Schnurr war fürs Grobe zuständig, und jeder der sechs Männer, die außer ihm anwesend waren und allesamt in Constantins Dienst standen, wusste, dass mit ihm nicht zu spaßen war. Seine schiefe Nase verriet, dass seine Deckung nicht die Beste gewesen sein konnte und er manchen Schlag hatte einstecken müssen. Doch im Austeilen, das wussten sie ebenfalls, war Schnurr noch stärker.
»Und pass auf, dass dich die Neue – wie heißt sie doch gleich? – nicht verarscht. Die kassiert extra, das habe ich schon ein paar Mal mitbekommen.« Constantin von Plesow nahm einen letzten Zug von seiner Zigarette und drückte sie dann im Aschenbecher aus. Er warf einen Blick auf einen der Briefumschläge und legte ihn umgedreht links neben sich, während die weiteren Schreiben ungelesen im Papierkorb landeten.
»Ich werde drauf achten. Wenn sie’s nicht freiwillig rausrückt, durchsuch ich sie eben.« Schnurr grinste schief.
»Durchsuchen ja, aber nichts weiter«, wies Constantin ihn an. »Für zerschundene Ware können wir kein Geld verlangen. Also halt dich zurück.«
Schnurr nickte, machte kehrt und verließ das Büro.
Constantin warf Gerd Nolte, seiner rechten Hand, einen kurzen Blick zu. »Du bist spät dran.«
»Ich hatte noch was zu erledigen«, erklärte Nolte.
Constantin nickte kurz und sah die anderen fünf Männer an, von denen zwei in den Sesseln saßen, einer an den Tisch gelehnt war und zwei im Hintergrund standen. »Heute Abend wird Ministerialrat Hermann von Hohewald zu Gast sein. Ich will, dass es ihm und seinen Begleitern an nichts fehlt.«
»Geht klar«, erwiderte Eduard Köhler, der zusammen mit Nolte dafür zuständig zeichnete, dass die Bar stets gut gefüllt war. »Wir haben gerade den neuen Champagner bekommen, so viel, dass wir ganz Berlin darin ersäufen können.«
»Und die härteren Sachen?«, fragte Constantin.
»Alles da, für noch mindestens einen Monat. Die Lager sind voll.«
»Heute Abend will ich keine Nutten sehen, es könnte nämlich sein, dass seine Frau mitkommt. Ich hab gehört, dass sie ihn oft begleitet. Heute Abend gibt’s Alkohol in Maßen und leichte Varietéunterhaltung. Alles andere folgt, wenn sich das Verhältnis gefestigt hat.«
»Also auch keine Nutten anderswo im Lokal?«
»Nur die, die auch als ›Bekanntschaften‹ durchgehen würden. Ich will keine dabeihaben, die ihre Titten nicht im Kleid lassen kann. Amüsement und Ablenkung von der Politik und den Sorgen des Alltags, aber so, dass es auch ehefrauentauglich ist.«
»Geht klar«, sagte Nolte und trat vor Constantins Schreibtisch. Sein Blick fiel auf den umgedrehten Briefumschlag. Er sah seinen Chef kurz an, dann konzentrierte er sich wieder auf den bevorstehenden Abend. »Wir kümmern uns um alles. Vor allem um Catherine. Seit sie selbst das Koks für sich entdeckt hat, muss man bei der mit allem rechnen.«
»Sie soll sich gefälligst zusammenreißen und ihr dämlicher Bruder auch. Sonst vermasseln sie am Ende noch alles«, polterte Constantin.
»Mach dir keine Gedanken. Zwei Tassen starken Kaffee, und wir kriegen sie schon wieder in die Spur.«
Constantin sah in die Runde. »In Ordnung. Dann ist es das für den Moment. Ich muss ein Telefonat führen.«
Während die Männer einer nach dem anderen das Büro verließen, blieb Nolte stehen. »Kann ich dich gleich noch mal sprechen?«
»Ja. Aber erst das Telefonat.«
»In Ordnung.« Nolte ging zur Tür. »Ich komme gleich wieder.«
Kaum hatte seine rechte Hand die Tür hinter sich geschlossen, nahm Constantin den Telefonhörer ab und wartete, bis sich die Vermittlung meldete. »Ich möchte eine Verbindung zum Grand Hotel in Binz.«
»Einen Moment, bitte.«
Es knackte einige Male in der Leitung, dann hörte Constantin das Freizeichen.
»Grand Hotel Binz, Werner Druminski am Apparat.«
»Constantin von Plesow. Guten Tag, Herr Druminski. Ist meine Mutter im Haus?«
»Oh, Herr von Plesow. Welche Freude. Ja, sie ist da. Ich verbinde Sie. Einen kurzen Augenblick, bitte.«
Wieder knackte es in der Leitung.
»Constantin. Wie schön, dass du dich meldest.«
»Guten Morgen, Mutter. Ich wollte nur sichergehen, dass du gut zu Hause angekommen bist.«
»Ich danke dir. Ja, ich bin gut angekommen, und es ist alles zu meiner Zufriedenheit. Vor allem, seit ich gesehen habe, wie wunderbar die Geschäfte bei dir laufen. Da muss ich mir keine Sorgen machen.«
Constantin lachte auf. »Um mich? Nein, bestimmt nicht. Meldet euch bei mir, wenn ihr noch etwas braucht. Ich werde euch in Kürze weitere Gäste vermitteln.«
»Unsere Reservierungsbücher sind gut gefüllt«, berichtete Bernadette. »Dank dir. Es scheint sich herumzusprechen, dass man in unserem Hause die Sommerfrische am besten genießen kann.«
»Ist der Baron mit seiner Familie noch da?«
»Ja. Mit seiner Frau und zweien seiner Kinder. Sein Sohn wird am Wochenende erwartet, er soll ein wenig Ablenkung haben vom anstrengenden Studium.«
Constantin lachte kehlig. »Vom Studium? Erzähl es nicht seinem alten Herrn, Mutter, doch das Studium macht der längst nicht mehr. Der ist die meiste Zeit hier in Berlin und geht seinem Vergnügen nach. Wenn er am Wochenende bei euch in Binz sein sollte, dann nur, um sich von seinem ausschweifenden Leben zu erholen.«
»Was sagst du da? Dann ist also nicht damit zu rechnen, dass er einmal in die Fußstapfen seines Vaters tritt?«
»Mutter, er ist ein Nichtsnutz und bringt das Geld seines Vaters schneller durch, als der es verdienen kann.«
Bernadette schnaufte kurz. »Gut, dass du mir das sagst. Ich hatte ihn als Kandidaten für Josie ins Auge gefasst.«
»Lieber nicht. Sonst wäre das, was meine Schwester mit in die Ehe bringt, am Ende auch noch weg.« Wieder lachte er auf, diesmal lauter. »Ich muss Schluss machen, Mutter. Die Geschäfte warten. Ich wollte nur sichergehen, dass du wohlbehalten heimgekehrt bist.«
»Ach Constantin, eines noch.«
»Ja?«
»Es hat hier heute Morgen einen Zwischenfall gegeben. Ein Mann wurde am Strand angespült. Stell dir vor: Er hatte eine Kugel im Kopf.«
»Wer war es?«
»Einer der Männer von Bankier Bischoff.«
»Verdammt noch mal. Es gerät immer mehr außer Kontrolle.«
»Kannst du dir erklären, was dahintersteckt?«
Constantin konnte es sich nicht nur erklären, er kannte auch die Hintergründe ganz genau, trotzdem sagte er: »Nein, noch nicht, doch ich höre mich mal um. Sollte sich bei euch irgendetwas tun, melde dich sofort bei mir. Ich kümmere mich darum.«
»Von Berlin aus?«
»Ja. Meine Leute sind zuverlässig, ob in Berlin oder Binz. Mach dir keine Sorgen, Mutter.«
»Gut, Constantin. Danke. Und nun geh wieder an deine Arbeit. Auf bald, mein Lieber.«
»Auf bald, Mutter.«
Beide legten auf.
Constantin dachte noch einen Moment über das Gehörte nach. Er wusste, dass der Markt immer härter umkämpft wurde und es alles andere als zimperlich zuging, wenn man seinen Platz behaupten wollte. Hier waren Durchsetzungsvermögen und klares Handeln gefragt. Kurz überlegte er, ob es klug wäre, bereits jetzt etwas zu unternehmen, entschied sich aber dagegen. Es gab derzeit keine konkrete Bedrohung, das Grand betreffend. Und erst wenn dies der Fall war, wäre es sinnvoll, seine Leute loszuschicken. Und das würde er auch tun. Zunächst galt es, hier in Berlin die Fäden fest in der Hand zu halten.
Es klopfte. »Ja?«
Nolte trat ein. »Renaldo will dich sprechen, und danach hab ich auch noch was.«
Constantin verdrehte die Augen. Er hatte jetzt kaum die Nerven für den Artisten. »In Ordnung. Schick ihn rein.«
Nolte nickte und trat beiseite. Constantin setzte ein verbindliches Lächeln auf und erhob sich von seinem Stuhl. »Renaldo, mein Guter. Ich hoffe, du bist in Höchstform? Wir erwarten heute Abend wichtige Gäste.« Er trat auf den dunkelhäutigen Varietékünstler zu, gab ihm die Hand und legte die andere in einer freundschaftlichen Geste darauf.
»Es ist wegen Catherine«, begann Renaldo. »Sie fühlt sich nicht besonders. Ich glaube nicht, dass sie heute Abend auftreten kann.«
»Möchtest du etwas trinken? Whisky? Er ist aus Irland importiert. Feine Ware.«
»Nein danke.« Renaldo schüttelte den Kopf. Ihm war deutlich anzusehen, dass ihm bei dem Gespräch alles andere als wohl war.
Constantin ging zum Bartisch hinüber, auf dem etliche Flaschen und Gläser standen, und schenkte sich ein. Er trank einen Schluck, dann wandte er sich wieder seinem Besucher zu.
»Kannst du dich noch an eure Anfänge hier erinnern, Renaldo? Vor zwei Jahren hat euch keiner gekannt, und heute werdet ihr gut gebucht. Wir haben eigens für euch umgebaut. Das Trapez, die Aufhängungen an der Decke für die Seile, die Leitern.«
»Ich weiß, Constantin«, beeilte sich der Angesprochene zu versichern. »Und ich bin dir wirklich dankbar. Wir«, korrigierte er rasch, »wir sind dir dankbar.«
Constantin trank noch einen Schluck und legte Renaldo jovial den Arm um die Schultern. »Weißt du, ihr müsst mir nicht dankbar sein.« Plötzlich schwang etwas Gefährliches in seiner Stimme mit. »Ich brauche keinen Dank. Wir sind schließlich Freunde. Genau genommen, mag ich es nicht einmal, wenn man mir dankt. Allerdings erwarte ich von meinen Freunden Loyalität und dass ich mich ebenso auf sie verlassen kann, wie sie sich auf mich verlassen können. Verstehst du, Renaldo?« Er nahm den Arm von der Schulter des Artisten, prostete ihm zu und trank den letzten Schluck.
Renaldo nickte ergeben. »Du kannst dich auf uns verlassen. Ganz bestimmt. Wir wollen keinen Ärger, Constantin.«
»Aber, aber.« Er winkte ab. »Wer wird sich denn hier ärgern? Ihr macht einfach, was ihr am besten könnt: Ihr tretet heute Abend auf, wie überall auf den Plakaten angekündigt. Catherine wird schön und begehrenswert aussehen, wenn sie am Trapez durch die Luft schwingt und dann sicher in deinen Armen landet, wenn sie auf deinen Schultern balanciert oder ihr an den Leitern eure Kunststücke darbietet. Ihr werdet das Publikum begeistern. Dann setzt ihr eure Reise fort und liefert aus, was ich euch mitgebe.« Er öffnete die Arme und lächelte breit. »Und schon, mein lieber Renaldo, sind wir alle glücklich.«
»Ich weiß nicht, ob Catherine bei den Hebefiguren und am Trapez das Gleichgewicht halten kann. Sie ist wirklich nicht in bester Verfassung.« Renaldo sah zu Boden.
»Dann sorgst du eben dafür, dass sie bis heute Abend in guter Verfassung ist.« Constantin lächelte, doch in seiner Stimme lag etwas Warnendes. »Es ist doch ganz einfach. Gib ihr etwas von dem, was sie so gern mag. Aber nicht zu viel. Dann wird es schon werden.«
»Sie geht daran zugrunde.« Renaldo schluckte hart.
»Möglich«, erwiderte Constantin. »Doch nicht heute Abend. Denn heute Abend wird sie eine ganz unglaubliche Vorstellung bieten, nicht wahr? Und du wirst dafür Sorge tragen. Ich verlasse mich auf dich, mein Freund.« Er betonte das letzte Wort.
Renaldo wollte etwas erwidern, doch Constantin kam ihm zuvor.
»Entschuldige mich bitte, die Geschäfte rufen.«
Renaldo nickte, den Blick zu Boden gerichtet. Offenbar rang er mit sich, doch dann verließ er ohne einen weiteren Gruß den Raum.
Constantin verdrehte die Augen, ging zu seinem Schreibtisch und setzte sich, um sich einige Papiere vorzunehmen. Nach kaum fünf Minuten klopfte es erneut.
»Ja?«
»Chef, der Freund ist hier, von dem ich dir erzählt habe«, vermeldete seine rechte Hand.
»Welcher Freund?«
»Der Freund meines Vetters, der Arbeit sucht.«
Constantin seufzte. »Schick ihn rein.«
Gerd Nolte war mit seinen fast fünfzig Jahren der älteste unter den Männern, die für Constantin arbeiteten. Er war früher Buchhalter gewesen und noch heute vor allem für die Papiere sowohl des Hotels als auch des Varietés zuständig. Er war Constantins Problemlöser und gleichzeitig derjenige, der sich mit den Rechtsanwälten beriet, sobald es Schwierigkeiten gab. Ein Privatleben kannte er nicht. Niemand wusste, dass seine Frau vor drei Jahren verstorben war. Constantin und er sprachen nie über etwas anderes als das Geschäft, das Nolte zum Lebensinhalt geworden war. Er war für seinen Chef ein unentbehrlicher Berater – doch ein Freund war er nicht. Nun betrat er, gefolgt von einem Mann, der um die eins neunzig groß sein mochte, Constantins Arbeitszimmer und schloss hinter ihnen die Tür.
Constantin deutete auf die Besucherstühle vor seinem Schreibtisch. »Bitte.«
»Danke, Herr von Plesow.«
Die beiden nahmen ihre Plätze ein.
»Wie heißen Sie?«
»Klaus Denker.«
»Und was haben Sie bisher gemacht?«
»Er hat nicht weit von meinem Vetter entfernt gewohnt, Constantin. Gerald, mein Vetter, sagt, dass er sich immer auf Klaus verlassen konnte«, mischte Nolte sich ins Gespräch ein. Aber seine Stimme klang unsicher.
Constantin hob die Brauen. Er kannte Nolte nun schon lange genug, um zu wissen, wann dieser ihm etwas zu verheimlichen versuchte. »Wie schön, dass dein Vetter das sagt. Also, Klaus – ich darf doch Klaus sagen?«
»Ganz wie Sie wollen.«
»In Ordnung, Klaus, nennen Sie mich Constantin. Also, was haben Sie beruflich gemacht?«
»Ich war Elektriker, bevor der Krieg kam. Dann musste ich an die Front.«
»Einen Elektriker brauche ich nicht. Ich habe schon jemanden, der sich um solche Dinge im Hotel kümmert.«
»Ich nehme jede Arbeit an«, erklärte Denker.
»Was haben Sie nach dem Krieg gemacht? Er ist immerhin sechs Jahre her.«
Denker warf Nolte einen fragenden, fast hilfesuchenden Blick zu. Dieser zuckte mit den Schultern.
Denker seufzte. »Ich habe gesessen.«
»In Ordnung«, erwiderte Constantin. »Weshalb?«
Der andere sah schweigend zu Boden.
»Ich habe kein Problem damit«, stellte Constantin klar. »Sagen Sie mir nur, weshalb Sie im Gefängnis waren.«
»Es ist nicht so, wie es sich im ersten Moment anhört«, warf Nolte schon wieder ein.
»Weshalb?«, fragte Constantin nur.
»Totschlag«, antwortete Klaus Denker.
Sofort stand Constantin auf. »Was soll das, Gerd? Du kennst die Regeln. Kein Mord, kein Totschlag, keine Vergewaltigung.«
»Hör dir seine Geschichte an, Constantin.«
»Das muss ich nicht.«
»Tu es. Aus Freundschaft zu mir. Bitte.«
Constantin setzte sich wieder, sagte aber nichts. Nolte stieß Denker auffordernd an.
Dieser brauchte einen Moment, bevor er zu sprechen begann. »Ich hatte eine Frau und zwei Kinder«, erklärte er. »Konnte es kaum erwarten, sie endlich wiederzusehen. Ich war in russischer Gefangenschaft, hab die letzte Kriegszeit eingesperrt verbracht. Irgendwann sagten sie, der Krieg sei vorbei, und haben uns freigelassen.« Er presste die Lippen aufeinander. »Ich bin dann zurück nach Tremsbüttel.«
»Tremsbüttel?«, fragte Constantin.
»Das ist in der Nähe von Hamburg«, erklärte Denker. »Da haben wir damals gewohnt. Ist nicht groß da.«
»Ich verstehe.«
»Na ja, ich hab mich gefreut, endlich wieder heim zu dürfen. Doch als ich dort ankam, war niemand da.« Er schluckte schwer, knetete seine Hände, kaute auf der Unterlippe. »Gerufen hab ich, aber keiner hat geantwortet. Hab überall nachgesehen. In den Zimmern, sogar im Keller. Dann bin ich zur Werkstatt rüber.«
Constantin legte die Stirn in Falten und sah zu Gerd, der fast unmerklich nickte.
»Da hab ich sie dann gefunden. Alle drei lagen sie da.«
»Ihre Frau und Kinder waren tot?«
Denker nickte, den Blick weiter zu Boden gerichtet. »Else war vergewaltigt worden, und allen dreien hatte man die Schädel eingeschlagen.« Seine Augen füllten sich mit Tränen.
»Das tut mir leid«, sagte Constantin. »Warum hat man Sie für die Tat verantwortlich gemacht?«
Denker zuckte mit den Schultern. »Es hieß, es habe dort schon eine Weile so ein Kerl bei Else und den Kindern gelebt. Die Nachbarn haben das gesagt. Angeblich hatte Else irgendwann die Nachricht erhalten, dass ich gefallen war.«
»Aber deshalb hängt Ihnen doch niemand die Morde an.«
Wieder zuckte er mit den Schultern. »Sie haben behauptet, Else hätte mich nach meiner Heimkehr aus dem Krieg fortgeschickt. Angeblich hab ich sie und die Kinder deshalb erschlagen. Doch das stimmt nicht. Sie waren schon tot. Das schwöre ich.« Er sah Constantin an. »Ich schwöre es bei meinem Leben.«
»Aber Ihnen hat niemand geglaubt?«
Denker schüttelte den Kopf. »Der Prozess war schneller vorbei, als ich gucken konnte. Der Anwalt, den sie mir gegeben haben, meinte, ich könne froh über das Urteil sein. Totschlag im Affekt. Acht Jahre. Ich habe nicht alles absitzen müssen. Seit ich wieder raus bin, halte ich mich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser.« Er sah zu Boden, dann wieder hoch und Constantin direkt in die Augen. »Ich werde keinen Ärger machen. Hab ich nie. Bitte geben Sie mir die Chance. Ich mache alles, was Sie sagen, Herr von Plesow.«
Constantin rang mit sich. Nicht, weil ihn die Geschichte besonders gerührt hätte, wenngleich er sicher war, dass dieser Mann die Wahrheit sagte. Vielmehr glaubte er, auf ihn zählen zu können, wenn er ihm jetzt die Chance gab, um die er bat. »Ich werde es mir überlegen.« Er stand auf, und auch Denker und Nolte erhoben sich. Er reichte Klaus die Hand. »Gerd wird sich bei Ihnen melden.«
»Danke, Herr von Plesow.« Er schüttelte ihm die Rechte.
»Constantin«, wiederholte dieser.
»Danke.« Die beiden Männer gingen zur Tür.
»Ach, eines noch«, rief Constantin ihnen nach. »Werden Sie versuchen, den Kerl zu finden, der Ihre Familie getötet hat?«
Denkers Miene versteinerte. »Nein. Das ist für mich erledigt.«
»In Ordnung. Danke. Ich melde mich.« Jetzt war Constantin sicher, dass Denker, was die Geschichte über seine Familie anging, nicht gelogen hatte. Denn gerade eben stand ihm die Lüge, nicht nach deren Mörder suchen zu wollen, so deutlich ins Gesicht geschrieben, dass er es auch in großen Lettern auf ein Plakat hätte drucken können.
»Gerd, warte.«
»Ja?«
Constantin bedeutete ihm, noch einmal zurückzukommen. Nolte verabschiedete sich von Klaus und ging wieder zu Constantins Schreibtisch.
»Ich sage es dir nur ein einziges Mal.« Constantins Stimme klang warnend. »Schlepp mir nie wieder einen hier an, der wegen so etwas gesessen hat, ist das klar?«
»Ich … ich dachte nur, weil er ja unschuldig ist …«
»Dann denk nicht.« Constantin hob den Zeigefinger. »Nie wieder, haben wir uns verstanden?«
»Ja, Chef. Nie wieder.«
»In Ordnung. Und nun geh ihm nach. Er hat die Stelle.«
Nolte sah ihn überrascht an. Sein Gesicht hellte sich auf. »Danke, Constantin. Ich wusste es. Ich …«
»Raus jetzt, bevor ich es mir anders überlege.« Sein Blick fiel auf den Brief auf seinem Schreibtisch. »Ach, eines noch, Gerd.« Er nahm den Brief und reichte ihn Nolte. »Geh da hin und schmier die Leute. Die wollen die Hauszinssteuer noch mal anheben. Mach denen klar, dass wir schon bezahlt haben, und dann leg ihnen was auf den Tisch, damit sie uns in Ruhe lassen. Wenn das nicht hilft, soll Ludger denen mit ein paar anderen begreiflich machen, dass wir mehr nicht zahlen werden. Neuer Erlass hin oder her. Das ist mir scheißegal.«
»Mach ich, Chef!« Nolte griff nach dem Brief und beeilte sich. Bevor er die Tür von außen schloss, drehte er sich noch einmal um. »Danke, Chef. Du hast was gut bei mir wegen Klaus.«
Constantin winkte ab. »Als ob mir das je etwas nützen würde.«
3. Kapitel
Für eine Frau ist vor allem eines wichtig, um in der Geschäftswelt bestehen zu können: ein falsches Lächeln, das nicht als solches erkannt wird.
BERNADETTE VON PLESOW
»Was für ein zauberhaftes Kleid, Baronin.« Bernadette lächelte bewundernd. »Fast zu schade für den Strand, nicht wahr?«
Die Baronin hatte an der Rezeption gerade eine Kutsche zum Strand ordern wollen, als Bernadette zu ihr trat.
»Liebe Frau von Plesow, danke für das reizende Kompliment! Ja, es fällt ganz weich, nicht wahr? Ach, wenn ich Ihre Figur hätte, könnte ich auch alles tragen. Seit ich die Kinder bekommen habe, passe ich in viele Sachen einfach nicht mehr hinein.«
Bernadette lächelte. »Aber Baronin, Sie werden mir doch nicht wirklich weismachen wollen, dass ausgerechnet Sie nicht zufrieden mit Ihrem Äußeren sind.« Sie legte den Kopf schräg. »Sie wollen wohl eine einfache Hoteliersfrau auf den Arm nehmen?«
Die Baronin kicherte verzückt. »Aber das würde ich mir nie erlauben, meine Teuerste.«
»Werner, die Baronin möchte mit ihrer Familie an den Strand. Lassen Sie den Esel einspannen und alles zu den Körben hinüberschaffen«, ordnete Bernadette an, und der Rezeptionist verneigte sich sofort und eilte davon.
»Ich wünsche Ihnen einen wunderbar erholsamen Tag, liebe Baronin.«
»Danke sehr. Wir genießen hier jeden Augenblick, wenngleich ich ja die Wärme fast schon zu arg finde.«
»Aber Sie sehen dadurch so frisch aus, Baronin. Gönnen Sie Ihrer Haut einige Sonnenstrahlen, und Sie werden nochmals um Jahre verjüngt wirken.« Verschwörerisch neigte Bernadette sich noch weiter zu ihr. »Obwohl wir beide sehr genau wissen, dass Sie dies nicht im Mindesten nötig haben.«
»Ach, Sie sind zu freundlich, Frau von Plesow. Oder darf ich Sie vielleicht Bernadette nennen?«
»Sie glauben gar nicht, welche Freude mir das bereiten würde«, gab Bernadette mit einem warmen Lächeln zurück.
»Ach, ich merke schon, wir werden noch die besten Freundinnen. Bitte nennen Sie mich Viktoria.«
»Sehr gerne, liebe Viktoria.«
Werner, der durch den Seitenausgang verschwunden war, trat nun durch die Vordertür wieder in die Eingangshalle. »Der Esel steht bereit, Madame.«
»Dann möchte ich Ihnen keinen weiteren Moment dieses wunderbaren Tages stehlen, Viktoria.« Sie deutete mit der Hand Richtung Tür. »Werner, ich verlasse mich darauf, dass meine Freundin Viktoria und ihre Kinder den besten Strandplatz bekommen.«
»Gewiss, gnädige Frau. Ich werde mich selbst darum kümmern.«
»Und sobald der Baron wiederkommt, werde ich ihm den Boy an die Seite geben, damit er Ihrem Gatten zeigt, wo er Sie finden kann«, wandte sich Bernadette wieder an die Baronin.
»Vielen Dank, meine Liebe. Das ist wirklich zu freundlich. Mein Mann musste noch einige Telegramme aufgeben und kommt sicher bald nach. Hach, die Männer und ihre Geschäfte! Sie sind darin ganz anders als die Frauen. Ach Bernadette, Sie sind eine so reizende und bewundernswerte Dame«, schwärmte Viktoria nun. »Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen plaudern. Und wie Sie das Personal befehligen! So ruhig und geschickt. Erstaunlich.«
Bernadette lächelte ob des Kompliments, wollte nun jedoch dringend die Unterhaltung beenden, um sich wieder ihren Geschäften zu widmen. »Haben Sie herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Strandtag, meine Teure.«
»Die Kinder werden für Sie ein paar hübsche Muscheln sammeln!«, rief die Baronin Bernadette noch zu, als sie schon fast draußen war. Bernadette winkte ihr und den Kindern nach, bis sie aus ihrem Blickfeld verschwunden waren. Dann ließ sie erleichtert den Arm sinken und atmete tief aus. Diese Person war einfach nervtötend!
* * *
Gott ist groß und voller Güte. Er vergisst keines seiner Schafe, und blökt es auch noch so leis’.
MARIE REIDEL
Welch eine wunderbare Musik. Marie öffnete die Fenster, so weit es eben ging. Wie sehr sie es doch liebte, dem versehrten Akkordeonspieler zu lauschen, der in den warmen Monaten Tag für Tag an der Promenade saß und seine sehnsuchtsvollen Melodien spielte. Oft hatte sie sich ausgemalt, er spiele nur ihretwegen, nur für sie allein, weil er wusste, wie sehr sie der Klang berührte. Natürlich war ihr klar, dass das Unsinn war. Kein Mensch spielte für Marie Reidel. Die meisten wussten wahrscheinlich nicht einmal, dass es sie gab, auch wenn sie direkt neben ihnen stand. Es machte ihr durchaus zu schaffen, obwohl sie sich ein wenig schämte, sich dies einzugestehen. Zu gern wäre sie ein bisschen mehr wie Josephine gewesen, die Tochter der von Plesows, die stets voller Übermut nur das tat, wonach ihr der Sinn stand, und die alle mit ihrer guten Laune ansteckte. Josephine war für Marie das, was einer Freundin wohl am nächsten kam, wenngleich sie so unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten entstammten, dass eine Freundschaft auf Augenhöhe vollkommen ausgeschlossen war. Josephines Mutter war Bernadette von Plesow, eine Grande Dame