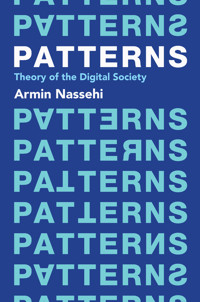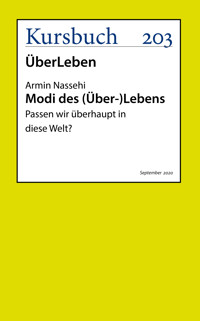Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: kursbuch.edition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Klimaproteste, Gelbwesten, PEGIDA, Occupy, Hongkong, Arabellion – die Anlässe sind vielfältig, die Inhalte unterschiedlich, und doch ist all diesen Protestbewegungen eines gemein: ihre formale Ähnlichkeit. Protest wird dann wahrscheinlich, wenn Interessen, Geltungsansprüche und Kritik an sich selbst erleben, dass sie sich in den eingefahrenen Routinen einer trägen Gesellschaft nicht durchsetzen können. Einerseits wird Protest damit zum Demokratiegenerator, versucht andererseits aber jener Vetospieler zu sein, den moderne Gesellschaftsstrukturen nicht zulassen. Die Grenzen, an die der Protest hierdurch stößt, initiieren eine merkwürdige Steigerungslogik und münden in einer strukturell tragischen Konstellation: In den Mühlsteinen der Gesellschaft, die es schafft, alle Opposition zu integrieren, verpufft der Protest. Dieses Buch erklärt, wie aus Kritik Protest wird, wie er eingebettet ist in die Kommunikationslogik unserer Zeit, wie sich seine Eigendynamik entfaltet und worin genau die Tragik des Protests besteht – ein Vademecum für all diejenigen, die gegenwärtige Protestformen ganz unterschiedlicher Couleur verstehen wollen. Keine Protestschrift, sondern eine Schrift über den Protest – über einen Sichtbarkeitsgenerator, der gesellschaftlichen Konflikten einen Ausdruck verleiht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
armin nassehi
das große nein
Eigendynamik und Tragik des gesellschaftlichen Protests
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Das Protestpotenzial von Kommunikation
Die Institutionalisierung von Nein-Stellungnahmen und ihre Grenzen
Das symmetrische Nein
Die Unmöglichkeit des Vetospielers als Protestgenerator
Die Funktion des Protests
Protest als Themengenerator
Charisma und das Zeitproblem des Protests
Die Steigerungslogik des Protests und die Attraktivität von Gewalt
Protest im Netz
Protest als Demokratiegenerator
Über den Autor
Impressum
Vorwort
Dieses Buch ist keine Gesamtdarstellung von Protestformen und Protestkultur, auch keine historische Rekonstruktion solcher Protestformen. Was dieses Buch leisten soll, gleicht eher einer Phänomenologie von Protest und nähert sich den Fragen, welche Funktion Protest in einer modernen Gesellschaft hat und unter welchen Bedingungen Protest wahrscheinlicher wird. Im Fokus habe ich dabei den Protest als Form, nicht bestimmte Proteste, denn diese unterscheiden sich empirisch, politisch und normativ enorm, aber lassen sich tatsächlich unter einer gemeinsamen Form des Protests subsumieren. So erscheinen dann so ungleiche Dinge wie etwa rechte Demonstrationen gegen die ethnische Pluralisierung der Bevölkerung und die aktuellen Klimaproteste im selben Fokus der Untersuchung. Grundintuition ist dabei nicht die Annahme, rechten und linken Protest identisch zu setzen, zumal es derzeit keinen Zweifel geben kann, dass in der Bundesrepublik der rechte Protest das höhere Gewalt- und Terrorpotenzial hat als linker Protest. Überhaupt wird eine der Hauptthesen dieses Buches sein, dass die Steigerungslogik von Protest durchaus einen inneren Zusammenhang zu gewaltsamen Formen hat – und dies lässt sich auf der rechten Seite derzeit ziemlich deutlich beobachten.
Diese Sparsamkeitsregel, also das bewusste Absehen von den konkreten Inhalten freilich dient dazu, Protest als Protest zu verstehen – auch um dann ein Kriterium an der Hand zu haben, worin sich strukturell ähnliche Protestformen unterscheiden und wo sie doch Ähnlichkeiten aufweisen. Ziel ist ein Vademecum für all jene, die sich einen Überblick darüber verschaffen wollen, wie Proteste funktionieren, wie sie zustande kommen, was sie vermögen und wozu sie nicht in der Lage sind. Vielleicht hilft es bei der Diagnose, dass der Text selbst einen ziemlich weiten Sicherheitsabstand zu Protestkommunikation hält. Er wird an keiner Stelle selbst unter Protestverdacht geraten, sondern nur über den Protest handeln.
Zu danken habe ich Irmhild Saake, die die Genese des Hauptarguments kritisch begleitet hat, Magdalena Göbl für das Mitlesen, Peter Felixberger für sehr hilfreiche Anregungen zu verschiedenen Stellen des Buches sowie Luise Ritter für das sensible Lektorat des Textes. Alle etwaigen Dussligkeiten des Textes sind freilich allein mir zuzurechnen.
München, im Februar 2020
Einleitung
Der Protest kehrt wieder – weltweit. Gelbwesten in Frankreich, die Sardinenbewegung in Italien, Widerstand in Chile, Demokratiebewegung in Hongkong, Proteste in der arabischen Welt, rechtspopulistische Protestmärsche, weltweite Klimaproteste, Netz-Proteste gegen sexuelle Belästigung/Übergriffe, Proteste gegen Bauvorhaben oder Infrastrukturmaßnahmen – der Beispiele wären in ihrer Vielfalt viele. Protest ist ohne Zweifel ein demokratischer Vorgang, in rechtsstaatlichen Demokratien sogar ein verbrieftes Recht der Bürgerinnen und Bürger. Protest macht auf Missstände aufmerksam, auch auf Interessen, er zeigt Konflikte an oder erzeugt sie, er kann universalistische hehre Ziele verfolgen, er kann auch für partikulare Belange stehen. Oft ist er nicht mehr als der Ausdruck von Unbehagen oder sogar Ressentiments, oft auch ein mehr oder minder auffälliger Hinweis auf die Notwendigkeit, bestimmte Probleme zu lösen, manchmal auch nur popkulturelles Event. Protest ist nicht per se etwas Gutes oder Schlechtes – Protest ist eine soziale Tatsache, die empirisch vorkommt. Deshalb ist sie – wiewohl Protest durchaus emotional vorgetragen wird, bisweilen mit Regelverletzungen aufwartet, mit eklatanter Verkürzung von Problemlagen arbeitet und vom Beobachter stets eine Stellungnahme verlangt – hier sine ira et studio zu analysieren.
Es wird im Folgenden nicht um die Inhalte unterschiedlicher Proteste gehen, nicht darum, worum Protest ringt und welche Themen protestförmig und -fähig waren oder sind. Der Fokus liegt auf der Form des Protests, also auf Protest als einer Sozialform, die offensichtlich ein bestimmtes Problem löst. Es mag fast einer Provokation gleichkommen, von Protest zu handeln, ohne zu Inhalten und Zielen, zur Legitimität oder gar Notwendigkeit Stellung zu nehmen. Es ist aber nötig, eine solche Perspektive einzunehmen, denn ganz offensichtlich ist Protest nicht der Normalfall der Konfliktbearbeitung und Handlungskoordination in modernen Gesellschaften, die stärker als alle früheren Sozialformen daran gewöhnt sind, mit unterschiedlichen Perspektiven und Interessen umzugehen und diese Unterschiedlichkeit als wenigstens prinzipiell legitim anzusehen. Es gehört zur Grundausstattung aktueller gesellschaftlicher Selbstbeschreibungen, in Rechnung zu stellen, dass Äußerungen von Akteuren, Positionen, semantische Formen und Interessen sich aus den jeweiligen Perspektiven und sozialen Lagen ergeben, aus denen sie stammen. Das Institutionenarrangement moderner Vergesellschaftung ist davon geprägt, gerade diese Gegensätze zu integrieren, indem sie als Differenzen abgebildet werden, indem also die Unterschiedlichkeit dieser Lagen institutionell abgebildet wird – man denke an Parlamente, an Tarifverhandlungen, an Gerichtsverfahren, an Betriebsräte, an Lobbyismus oder auch an die Beteiligung von Interessengruppen an Entscheidungen in Organisationen unterschiedlicher Provenienz. Auch der Repräsentationsgedanke, das heißt die Abbildung unterschiedlicher Milieus und Gruppen der Gesellschaft in entsprechenden Gremien gehört dazu, vielleicht sogar der Streit der Fakultäten in Universitäten.
Protest dagegen ist eine besondere Form der Bearbeitung solcher Differenzen. Protest hat stets mindestens einen Adressaten, und er nimmt Formen in Anspruch, die gerade nicht zu den genannten Formen der Konfliktbearbeitung und damit -minderung gehören. Protest verweist offensichtlich darauf, dass die sonstigen gesellschaftlichen Formen der eher leisen beziehungsweise erwartbaren Konfliktbearbeitungsroutinen gestört sind. Wer protestiert, macht auf eine Perspektive aufmerksam, die offensichtlich aus solchen Routinen herausfällt – was übrigens nicht bedeutet, dass Protest nicht auch zur Routine werden kann.
Proteste sind womöglich die sichtbarste Form von Kritik. Nicht jede Kritik ist Protest, aber Kritik wird dann zum Protest, wenn sie sichtbar wird, eben weil sie Routinen unterbricht und dadurch einen hohen Informationswert bekommt. Protest hebelt Erwartbarkeiten aus und zwingt das Gegenüber, sich zu ihm zu verhalten. Deshalb sind die meisten Protestformen nicht nur an den Gegenstand der Kritik gewandt, sondern ebenso an Dritte, womit die Demonstration nicht der einzige, aber der vielleicht sinnfälligste Ausdruck von Protest ist. Die Demonstration ist die klassische Form der Visibilisierung von Konflikten. Denkt man an die klassischen öffentlichen Konflikte der letzten Jahrzehnte, dann sind es oftmals Bilder von Demonstrationen, an denen sich Protestformen ablesen lassen. Nur auf den deutschen Fall bezogen: Die Protestklassiker der frühen Bundesrepublik sind – neben eher institutionalisierten Arbeitskämpfen – die Ostermärsche in den Zeiten der Wiederbewaffnung in den 1950er-Jahren, die vor allem studentischen Proteste in den späten 1960er-Jahren hin zu den Alternativbewegungen der 1970er-Jahre und der Anti-AKW-Bewegung. Dann die Friedensbewegung der 1980er-Jahre mit dem Höhepunkt der großen Kundgebung 1983 in Bonn, die zu einer der größten Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik gehört, zugleich rechtsradikale Protestformen in den 1990er-Jahren. Protest ist also keineswegs ein Privileg der klassischen sozialen Bewegungen, wie Friedens-, Frauen-, Ökologiebewegung etc., sondern kommt auch auf der ganz anderen Seite des politischen Spektrums vor. Die DDR ist aus vielen Gründen zugrunde gegangen, aber der sinnfälligste Ausdruck der Umwälzung waren die Montagsdemonstrationen in Leipzig und anderen Städten, an denen niemand vorbeisehen konnte. In den Nullerjahren waren es antikapitalistische Proteste aus Anlass von G-7- oder G-8-Treffen, aber auch die Proteste gegen die Banken während der Finanzkrise. PEGIDA und seine Derivate gehören auch zur Protestgeschichte der Bundesrepublik, genauso wie die großen Gegenproteste. Und derzeit schicken sich die Klimaproteste an, die Dimension der 68er-Proteste zu übersteigen.
Man kann die Geschichte der Bundesrepublik (und natürlich auch anderer Länder) als Protestgeschichte erzählen, weil sich in den Protesten die wesentlichen Konflikte öffentlicher Debatten materialisieren.1 Protest ist ein Seismograf für Grundkonflikte, die sich nicht von selbst auflösen und nicht mit den üblichen Routinen bearbeiten lassen. Man denke an die Arabellion, die vor zehn Jahren begann, oder an die Proteste in Hongkong oder in Lateinamerika, um nur wenige zu nennen. Man kann daran eine der Funktionen von Protesten ablesen: Es geht nicht nur um die Adressierung eines Gegners oder um die Bearbeitung eines empfundenen Missstands, sondern auch darum, eine Form der Sichtbarkeit herzustellen, die vor allem politische Öffentlichkeiten adressiert.
Der protestantische Klassiker schlechthin ist der Protestantismus der Reformation.2 Protestant zu sein, war eine Fremdzurechnung. Diejenigen, die evangelisch sein wollten, also die Praxis der Kirche an der Auslegung der Heiligen Schrift orientieren wollten, erschienen aus der Perspektive der katholischen Kirche als Protestanten, also als solche, die gegen die Praktiken der Kurie opponierten. Protestanten waren die Evangelischen zunächst tatsächlich aus der Perspektive des Adressaten von Kritik. Es geht hier nun nicht um den Protestantismus, sondern darum, die Form des Protests zu verstehen. Zunächst fällt an diesem historischen Beispiel auf, wie sehr Protest sich über den kritisierten Gegenstand definiert. Die Evangelischen sind eben nicht nur jene, die das Evangelium und seine Auslegung zur Richtschnur des eigenen Glaubenslebens machen wollten – sola scriptura –, sondern vor allem jene, die gegen die Praktiken der mächtigen Kirche angingen. Deutlich wird daran: Protest hängt stärker an seinem Gegenstand, als es zunächst den Anschein hat. Die definierende Größe ist das Gegenüber, gegen das der Protest sich richtet.
Dabei ist der Wortsinn ganz anders. Es ist nicht von Contratest die Rede. Das Verb protestari hat eine positive Konnotation. Es bedeutet bezeugen, Zeugnis ablegen, für etwas stehen. Der Protestanlass freilich ist eine Opposition, lebt von einem Gegenüber, das offensichtlich dazu zwingt, Zeugnis abzulegen, für etwas zu stehen, weil die Strukturen des kritisierten Gegenstandes nicht ausreichen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Protest wird immer dann wahrscheinlich, wenn der Protestierende seine Ziele nicht mit den Mitteln, die der kritisierte Gegenstand bereithält, erreichen kann. Wenn sich ein politisches Ziel nicht mit den Bordmitteln des parlamentarischen Verfahrens erreichen lässt, wenn eine Tarifverhandlung nicht innerhalb der Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu einem Ergebnis kommen kann, wenn ein Jugendlicher bei Eltern oder Lehrerinnen und Lehrern nicht mit Argumenten durchkommt, steigt die Wahrscheinlichkeit für Protest. Protest ist zwar im Wortsinne ein positives Zeugnis, aber Protestanlässe sind zunächst Negationen, Nein-Stellungnahmen, in diesem Sinne Formen, die sich gegen etwas wenden, was sich nicht aus sich selbst heraus ändert. Um der Form des Protests auf die Spur zu kommen, ist es sinnvoll, zunächst diese Bedeutung von Nein-Stellungnahmen in der Kommunikation genauer zu untersuchen. Darin wird nämlich deutlich, dass Protestpotenziale schon in der Struktur von Kommunikation angelegt sind.
1 Vgl. dazu für die frühe Bundesrepublik Wolfgang Kraushaar: Die Protestchronik, 4 Bände. Hamburg 1996.
2 Vgl. Friedrich-Wilhelm Graf: Der Protestantismus. Geschichte und Gegenwart. 3. Aufl., München 2017.
Das Protestpotenzial von Kommunikation
Man kann wohl die Qualität von soziologischen Theorien daran bemessen, ob sie die Dynamik, die Operativität ihres Gegenstandes, die Verzeitlichung von Strukturen in den Blick nehmen können oder nicht. Die grundlegende Einsicht des soziologischen Denkens besteht darin, dass sich alle Strukturen, alles Feststehende, alle routinierte Dynamik, alles Erwartbare, alles Geschehen im Vollzug selbst ereignet. Wenn wir einen Prozess beobachten, etwa eine typische Handlungskoordination zwischen Rollenträgern, zum Beispiel ein Verkaufsgespräch in einem Geschäft, erscheint uns dies als ziemlich festgelegt und strukturiert. Solche Formen laufen immer wieder in sehr ähnlicher Form ab. Sie folgen Strukturen und Mustern, Regelmäßigkeiten und nicht zuletzt Routinen des Alltäglichen – und doch müssen sie stets praktisch wiederhergestellt werden. Soziale Strukturen kann man vor allem an Wiederholungen erkennen, also darin, wie sie sich durch immer neue, aber eben erwartbare und sich wiederholende Ereignisse selbst bestätigen. Es ist manchmal frappierend, wie regelgeleitet und musterhaft das Alltagsverhalten ist und wie unwahrscheinlich Abweichung in den meisten Situationen. Sieht man aber genau hin, sind Strukturen einerseits stabil, andererseits aber ebenso fragil, weil sie sich in jeder Gegenwart neu bewähren müssen, oder anders gewendet: stets negiert werden können. Soziale Ordnung ist genau genommen der Versuch, das Risiko der Abweichung zu minimieren und Systeme für sich selbst kalkulierbar zu machen, ja Kontingenz zu vernichten.3 Alle Ordnung ringt um die Suspendierung ihrer selbst – gerade das macht sie zu einer Ordnung. Es ist nötig, das so abstrakt zu formulieren, um zu verstehen, dass Handlungs- und Kommunikationsprozesse stets mit der Handhabe von möglichen Ja- und Nein-Stellungnahmen zu tun haben. Ordnung ist die andere Seite der Kontingenz, die andere Seite der Beliebigkeit. Ordnung ist gewissermaßen an die Abweichung gebunden, wohlgemerkt: an den Versuch der Vermeidung von Abweichung. Ordnungen können immer auch anders sein, sonst wären sie keine – und sie sind stabiler, als wir oft denken, auch sonst wären sie keine.
Wer kommuniziert, setzt sich dem Risiko des Protests aus. Dieser sehr einfache, selbstverständlich übertrieben formulierte Satz hat es in sich, weil er den Protest bereits in die Struktur der Kommunikation einbaut. Kommunikation wäre keine, wenn sie nicht die grundlegende Möglichkeit der Negation in sich trüge. Es ist kein Zufall, dass die meisten Selbstbeschreibungen der gesellschaftlichen Moderne auf Kommunikation setzen. Wissenschaftliche Selbstbeschreibungen der Gesellschaft, gerade sozialwissenschaftliche, setzen auf symbolische Interaktion oder auf kommunikative Verständigung, auf selbstreferenzielle Kommunikationsprozesse oder Benennungspraktiken. Überall dort wird Kommunikation als Grundbegriff gebraucht. So unterschiedlich solcherlei Modelle sind, so ist ihnen doch gemein, dass sie auf die Organisation oder Bearbeitung von Alternativen, auf Widerspruch und Differenzen setzen.4
Kommunikationsprozesse, auch wenn man sie an Handlungsketten beobachtet, zeichnen sich dadurch aus, dass sie andere Verläufe nehmen können als man es erwarten würde. So würde man etwa das Nacheinander von Reaktionen von Kugeln auf einem Billardtisch nicht als Kommunikation auffassen. Wenn eine Kugel auf eine andere trifft und ihr einen kinetischen Impuls verleiht, kommunizieren die Kugeln nicht miteinander – weil sie keinen Handlungsspielraum haben. Eine Kugel könnte sich nicht weigern, sich in exakt dem Winkel zu bewegen, der durch den Aufprallwinkel der impulsgebenden Kugel bewirkt wird. Da sie nicht anders kann, würden wir der Kugel keinen Handlungsspielraum unterstellen und das Verhältnis der Kugeln nicht als ein Kommunikationsverhältnis auffassen. Erst dort, wo die Kugel auch anders könnte, wenn sie eine Wahl hätte, würden wir ihr erstens ihre Bewegung selbst zurechnen und das Verhältnis der Kugeln als ein Kommunikationsverhältnis auffassen.
Wir würden die ziemlich genau berechenbare Reaktion der Kugel auch nicht als ein Ja auffassen, nicht als Zustimmung. Sie kann schlicht nicht anders. Sie tut es nicht einmal. Es geschieht ihr. Es geschieht nicht einmal ihr. Es geschieht einfach. Die Kugel kann nicht zustimmen, nicht Ja sagen, weil sie nicht Nein sagen kann. Erst wenn das Risiko von Nein-Stellungnahmen vorliegt, kann man von Kommunikation sprechen. Kommunikation ist gewissermaßen das Management möglicher Nein-Stellungnahmen. Kommunikation ist das Management von Nicht-Kausalität in dem Sinne, dass wir alle kausalen Bewirkungsformen eben nicht Kommunikation nennen würden. Das Nein, nicht das Ja ist der positive Wert der Kommunikation, denn nur wenn in einer Ereigniskette das nächste Ereignis auch anders ausfallen könnte, kann man von Kommunikation sprechen.
Sozialtheorie und soziale Praxis auf diesem spezifischen Verständnis von Kommunikation aufzubauen, rechnet also systematisch mit der Möglichkeit der Nein-Stellungnahme: Wer auch immer die Instanz der Erwartung sein mag, sie könnte als Adressat auch Nein sagen oder zumindest anders reagieren als erwartet. Genau genommen ist in Kommunikationsprozessen die vollständige Erwartungserfüllung der voraussetzungsvollere Vorgang als die Abweichung von konkreter beziehungsweise festgelegter beziehungsweise kausalähnlich gebauter Erwartung. Der analytische Normalfall von Kommunikation ist die Abweichung, wie klein sie immer sein mag, oder wenigstens ihre Vermeidung, die mit der Abweichung rechnen muss. In newtonphysikalischen Räumen wie auf einem Billardtisch wäre das Gegenteil, die Abweichung, der erklärungsbedürftige Fall, der letztlich nicht auftritt.
Wer auf Kommunikation setzt, setzt auf den Umgang mit Abweichung. Einige Beispiele illustrieren das:
■Die Demokratie im politischen System setzt geradezu eine epidemische Form der Kommunikation in Gang, weil sie ja nicht einfach die Exekution irgendeiner Mehrheitsentscheidung ist, sondern einen Kommunikationskreislauf initiiert, in dem die Nein-Stellungnahme institutionalisiert wird. Selbst wenn eine Entscheidung kollektiv völlig unumstritten wäre, könnte der politische Prozess gar nicht anders, als hier auch noch so etwas wie Opposition, Widerspruch, neue Kommunikationsanlässe einzubauen, eben weil genau dies institutionalisiert ist und für die Legitimation wie die Legitimität einer Entscheidung unvermeidlich ist. Für manche Akteure in politischen Verfahren ist die Nein-Stellungnahme mit einer Art Notwendigkeit ausgestattet, denn der Widerspruch ist deren Existenzberechtigung.
■Rechtliche Verfahren verfahren ähnlich. Sie bringen Rede und Gegenrede in Gang, institutionalisieren Rederechte, Gehörzwang und ordnen Kommunikatoren in unterschiedlichen Rollen an. Der Klassiker ist in Seligsprechungsverfahren die Institution des Advocatus Diaboli, der dem Advocatus Angelorum oder dem Kirchenanwalt Paroli bieten muss, damit das Seligsprechungsverfahren Legitimität erhält.5 In rechtsstaatlichen Verfahren sind dann später die antipodischen Rollen so verteilt, dass Nein-Stellungnahmen ins Verfahren als geradezu notwendig eingebaut werden müssen. Die Umsetzung von Rechtsregeln ist zugleich nicht die Eins-zu-eins-Übertragung von Vorschriften oder Gesetzen in eine gesellschaftliche Praxis, sondern letztlich ihre kommunikative Begleitung mit Entscheidungs- und Widerspruchskompetenz in Verfahrensform.
■Beide, Recht und demokratische Politik, ermutigen Sprecherinnen und Sprecher, sich als solche zu inszenieren. Sie gewöhnen ein Publikum daran, unerwartete Kommunikationsbeiträge zu präsentieren und damit einen Informationswert zu erhalten. Fast nichts, wenigstens nicht die Demokratie selbst oder die Geltung des Rechts, kann dafür sorgen, was da kommuniziert wird, gerade weil kommunikative Anschlüsse und damit die Etablierung von Sprecherpositionen geradezu unvermeidlich werden. Selbst die Klage darüber, wer keine Stimme hat oder bekommt, muss kommuniziert werden und dementiert damit paradoxerweise, was sie behauptet.
■Massenmedien bilden nicht einfach die Welt ab, sondern überziehen die Gesellschaft mit einem Kommunikationsnetz, in dem es einen Unterschied macht, wer was wann wie zu wem und zu welchem Anlass sagt. Und einen Unterschied macht eher die Negation als die Affirmation. Besonders interessante Medienformate sind die, die nicht einfach simulieren, die Welt abzubilden (was sie selbstverständlich nicht können), sondern solche, die explizit das Kommunizieren von anderen kommunikativ abbilden. In Talkshows oder in Interviews, aber auch in Filmen und Dokumentationen sieht man anderen beim Kommunizieren zu – und einen Informationswert (die Währung des Mediensystems) hat das dann nur, wenn sich der eine Satz nicht notwendig aus dem anderen ergibt. Dass in den Medien meistens auch bestimmte Abweichungen erwartbar sind, variiert nur die besondere Funktion von Kommunikation.
■Mehr noch als in den klassischen Massenmedien wird Kommunikation im Internet, in sozialen Medien durch die Erwartbarkeit von Widerspruch, Differenz und Nein-Stellungnahmen geprägt. Diese entfesselte Form der Kommunikation fast ohne die Gatekeeper-Funktion, die in klassischen Medien für Struktur und Selektivität sorgt, ist geradezu prädestiniert für das Nein, und zwar für ein Nein mit wenig Risiko, was die Überhitzung von Kommunikationsverläufen in sozialen Medien erklärt.
■Bildung etabliert sich zumeist als Einübung von Kommunikation. Gebildet ist, wer in der Lage ist, auf einen Satz entweder einen kompetenten oder richtigen Satz folgen zu lassen und/oder eine gepflegte Abweichung zu formulieren. Deshalb sind Bildungsprozesse in erster Linie Prozesse in Form von Kommunikationsproduktion – man muss sprechen und schreiben, fragen und antworten, anschließen und anschlussfähig sein. Und Bildungsprozesse erzeugen Kritikfähigkeit, Einübung in Widerspruch, Umgang mit Nein-Stellungnahmen. Und sie erzeugen korrigierende Nein-Stellungnahmen durch Lehrpersonal, gerne in roter Tinte.
■Wissenschaftliche Forschung findet die Wahrheit nicht einfach vor, sondern erzeugt wissenschaftlichen Fortschritt vor allem durch Widerspruch gegen vorherige Ergebnisse. In der Wissenschaft ist die Nein-Stellungnahme geradezu konstitutiv für die Herstellung neuen Wissens.
■Es etabliert sich in den Medien ein eigenes Kritikwesen, das Literatur, Kunst oder Musik unter die Lupe nimmt und Kritik gewissermaßen zivilisiert. Die Nein-Stellungnahme wird erwartet, denn niemals kann eine Kritik ohne Kritik, also ohne ein Nein auskommen, wenn sie einen Informationswert haben soll.
■Vielleicht ist die Leittechnik der vordigitalen Welt, der Buchdruck, das treffendste Beispiel dafür, wie sehr sich die Gesellschaft an Kommunikation gewöhnt hat. Sollte das Ziel des Buchdrucks tatsächlich je gewesen sein, für eindeutige Informationslagen zu sorgen, dann wäre dies kläglich gescheitert. Die Distribution der Heiligen Schrift (und dann auch noch in der Verkehrssprache der Gläubigen) jedenfalls hat nicht nur zu ihrer Kenntnis und Verbreitung beigetragen, sondern noch mehr die Wahrscheinlichkeit für Widerspruch erhöht. Aus der Verkündigung des Gotteswortes wurde Kommunikation dazu und darüber, wurden Anschlüsse mit dem Risiko der Nein-Stellungnahme. Überhaupt ist die Verbreitung der Schrift ein Generator dafür, dass Bedeutungen kontingent werden, und führt damit selbst wieder zu Anlässen für weitere Kommunikation. Dass man die Dinge unterschiedlich lesen kann, heißt ja nur, dass kommunikative Anschlüsse offen, kontingent, nicht eindeutig bestimmt sind.
Gerade am letztgenannten Beispiel ist zu erkennen, wie sich an der epidemischen Ausbreitung des Schriftlichen die Abweichungswahrscheinlichkeit von Kommunikation drastisch erhöht und es gewissermaßen zu einem Sondermedium für Nein-Stellungnahmen und Kritik wird. Der Widerspruch und die Abweichung sind vielleicht die drängendsten Schreibanlässe, denn bloße Wiederholung bietet für den Aufwand des Schreibens und Publizierens zu wenig Informationswert. Information selbst ist nichts anderes als Abweichung, etwas, das einen Unterschied macht, Erwartungen enttäuscht oder schlicht ein Nein in die Welt bringt, wo man zuvor mit unproblematischem Anschluss gerechnet hätte.