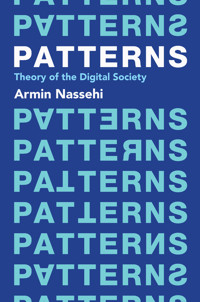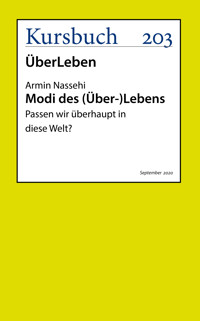Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sven Murmann Verlagsgesellschaft mbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Komplexität – mehr als ein Schlagwort! Eindimensionales Denken regiert eine mehrdimensionale Welt. Doch die Ära der Eindeutigkeiten geht zu Ende. An ihre Stelle tritt ein neues vernetztes Denken, das die Komplexität der Gesellschaft versteht und würdigt, statt sie zu bekämpfen. Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten: Das Vertrauen in Politik schwindet, Märkte sind nur schwer zu bändigen, gesellschaftliche Konflikte werden kaum mehr zivilisiert geführt, Demokratie verliert ihre Integrationskraft, gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten lösen sich auf. Wir bleiben verfangen in politischen und gesellschaftlichen Konzepten des 19. Jahrhunderts und scheitern damit an der erreichten Komplexität unserer Gesellschaft – im richtigen Leben ebenso wie auch in unseren Theorien und Denkkonzepten. Worum es geht, ist ein vernetztes Denken zu entwickeln, das mit Instabilität rechnet und Abweichungen liebt, das Komplexität nicht vermeidet und wegredet, sondern versteht und entfaltet und sie mit ihren eigenen Mitteln schlägt. Das Buch ist eine grundlegend überarbeitete, in Teilen neu geschriebene und aktualisierte Ausgabe von "Die letzte Stunde der Wahrheit.Warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss" (2015).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armin Nassehi
Die letzte Stunde der Wahrheit / Kritik der komplexitätsvergessenen Vernunft
Inhalt
Vorwort / Ein Vademecum für den Umgang mit Komplexität
Erstes Kapitel / Welterschaffung / Die Konsistenz des weißen Blattes und die Inkonsistenz der Welt
Zweites Kapitel / Weltveränderung / Zwischen kollektiver Einheit und besserer Einsicht
Drittes Kapitel / Komplexität / Die Heliozentrik dezentriert die Welt
Viertes Kapitel / Zwei Welten. / Gibt es analoges Leben in digitalisierten Welten?
Fünftes Kapitel / It’s the society, stupid! / Ökonomisierung als Metapher gesellschaftlicher Komplexität
Sechstes Kapitel / Übersetzungskonflikte / Vom Umgang mit Perspektivendifferenz
Über den Autor
Impressum
Vorwort / Ein Vademecum für den Umgang mit Komplexität
Dieses Buch stellt eine völlig überarbeitete und in Teilen neu beziehungsweise umgeschriebene Ausgabe meines 2015 erschienenen Buches Die letzte Stunde der Wahrheit. Warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss dar. Weil die Akzentuierung dieser ersten Ausgabe inzwischen nicht mehr die Fragestellung trifft, um die es mir entscheidend geht, habe ich mich zu dieser Neuausgabe entschlossen. Seit 2015 wird noch deutlicher als zuvor schon, wie unübersichtlich und steuerungsresistent sich die Gesellschaft darstellt und wie sehr es an intellektuellen Mitteln fehlt, diese Komplexität jenseits akademischer Schreibroutinen auf den Begriff zu bringen. Dieses Defizit auszugleichen scheint mir eine wesentliche Aufgabe nicht nur im Rahmen der wissenschaftlichen Diktion.
Komplexität – das ist mehr als ein Schlagwort. Wir müssen endlich ernst nehmen, dass sich Eingriffe in die Gesellschaft nicht zwangsläufig gegen ihre Komplexität, ihre Perspektivendifferenz richten müssen. Die Frage, die heute gestellt werden muss, lautet vielmehr: Was muss man tun, um Steuerungsstrategien nicht gegen die Kraft der komplexen Gesellschaft zum Einsatz zu bringen, sondern mit ihrem eigenen Drive, mit der Dynamik ihrer eigenen Struktur, ihrer eigenen Zugzwänge, etwas zu erreichen – ganz so, wie ein asiatischer Kampfsportler den Drive seines Gegners aufnimmt und mitgeht, um ihn zu besiegen, und eben nicht einfach zerstörerisch dagegenhält. Meine denkerische Bemühung um die Frage, wie die Welt verbessert werden kann, was Komplexität in der Konsequenz heißt und warum diese Gesellschaft schon ohne die entsprechende Computertechnik eine digitalisierte Gesellschaft ist, steht hier im Vordergrund und wird akzentuiert, offensiv und komprimiert entfaltet. Im Zentrum steht also vor allem unser gegenwärtiges Bild von einer Gesellschaft, die sich unserem Zugriff immer wieder entzieht und in ihrer ganzen Dynamik stabiler ist, als es uns erscheint.
Was wir derzeit an der Oberfläche erleben, ist gravierend: ein völlig veränderter Politikstil in den USA, der drohende Zerfall der Europäischen Union, der Legitimationsverlust der parlamentarischen Demokratie, das Aufkommen neuer Handelskriege, die Krise der wissenschaftlichen Expertise, die Veränderung von öffentlicher Kommunikation durch neue elektronische Verbreitungsmedien, ein Strukturwandel der industriellen Produktion, nicht zuletzt die Herausforderung durch soziale Ungleichheit und Gerechtigkeit und die Frage der Kopplung von Arbeit und Versorgung. All diese Aspekte werden hier nicht einfach handstreichartig abgefertigt und die entsprechenden Probleme – zumindest der Theorie nach – einer Lösung zugeführt. Nein: Es geht mir darum, eine Denkungsart bereitzustellen, die dazu verhilft, die richtigen Fragen zu stellen. Ich bin davon überzeugt, dass uns die Lösung der anstehenden Probleme nur mit einem Paradigmenwechsel gelingen wird, nur mit der Umstellung unserer Denkungsarten auf ein vernetztes Denken, für das uns manchmal die Kategorien, vor allem aber die Ausdrucksformen fehlen. Diese vorbereitend bereitzustellen ist das Ziel dieses Buches.
Die Rezeption der ersten Ausgabe hat mir gezeigt, wie sehr die Konzentration auf die darin ausführlich diskutierten politischen Chiffren doch in die altbekannten Pfade führt. Das, worum es mir geht und was dringlicher denn je geworden ist, trage ich in dieser neu konzipierten Ausgabe offensiver und konzentrierter vor – um so eine Art Vademecum für diejenigen anzubieten, die weder an die einfachen Lösungen glauben noch ob der Komplexität der Probleme verzweifeln wollen. Dieses Buch ist für alle geschrieben, die beim Bemühen, einen kritischen Impetus zu entwickeln, sich selbst handlungsfähig zu halten, schon heute versuchen, nicht gegen, sondern mit den Strukturen der Gesellschaft zu arbeiten. Ihnen sei eine Perspektive angeboten – eine Kritik der komplexitätsvergessenen Vernunft!
Das Buch erscheint in der von Sven Murmann, Peter Felixberger und mir herausgegebenen kursbuch.edition, auch weil es mit seiner Grundintuition die Idee dieser Editionsreihe auf den Punkt bringt: den Umgang mit Perspektivenverschiebungenzu verbessern, sie nicht zu bekämpfen, sondern zu begrüßen und sich auf keine Form festlegen zu lassen – nicht um Beliebigkeit zu demonstrieren, sondern um zu zeigen, dass keine der Perspektiven und ihre Verschiebungen beliebig sind.
München, im März 2017
PS: Die frühere Ausgabe wird vom Verlag nach wie vor vorgehalten.
Erstes Kapitel / Welterschaffung / Die Konsistenz des weißen Blattes und die Inkonsistenz der Welt
Die Utopie ist eine Textsorte, die eine Welt vorstellt, für die es keinen Ort gibt – deshalb heißt sie so. Als literarische Gattung kann sie erzählerisch wünschenswerte Welten aufbauen und wieder zusammenstürzen lassen. Um einen Entwurf dieser Art geht es in diesem Buch ausdrücklich nicht. Vielmehr geht es um den Versuch, die moderne Gesellschaft zu beschreiben und dabei die Frage zu beantworten, wie auf diese Gesellschaft eingewirkt werden kann. Der Text stammt von einem Sozialwissenschaftler, gehört demnach zur wissenschaftlich informierten Gattung, möchte aber in der Darstellungsform auf die meisten Formvorgaben für wissenschaftliche Texte verzichten. Ein Vorhaben, das nur schwer gelingen kann, aber versucht werden muss.
Die Grundfrage des Buches lautet, wie man die Komplexität der modernen Gesellschaft beschreiben kann, ohne dabei die Beschreibung so komplex werden zu lassen, dass sie nicht oder nur von Fachleuten gelesen werden kann. Viele der öffentlich anschlussfähigen Diagnosen der modernen Gesellschaft, also ihre sichtbar werdenden und folgenreichen Selbstbeschreibungen, scheinen besonders einen Zweck zu verfolgen: die Komplexität und Unübersichtlichkeit, die Perspektivendifferenz und Widersprüchlichkeit der Gesellschaft zu negieren und zu ignorieren. Es werden entweder Diagnosen gestellt, die relativ leicht an persönliche Erfahrungen angeschlossen werden können oder die schon mit ihrer Diagnose klare Lösungsstrategien anbieten. Ich will hier nicht mit einem Katalog oder einer Liste beginnen und mich an diesen Diagnosen abarbeiten, die oftmals die Form der Kapitalismuskritik, einer Kritik belastender Lebensformen annehmen und sich dann an Theorien des guten Lebens versuchen, Kritikformen, die große Schuldzusammenhänge aufspannen oder das einfache Leben gegen die ökologische Katastrophe oder das kulturell einfältige Leben gegen die Abschaffung des eigenen Landes in Anschlag bringen. Im Unterschied dazu möchte ich versuchen, das, was ich soziologisch und gesellschaftstheoretisch seit 25 Jahren betreibe und in Form wissenschaftlicher Fachpublikationen vielfach dokumentiert habe,1 in eine Form zu bringen, die auch außerhalb der Academia lesbar sein kann.
Meine Grundidee hat viel mit der Grunderfahrung jedes Schreibenden zu tun, nämlich der, vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen, selbst wenn dieses weiße Blatt Papier heute wohl eher in digitaler Form vorliegt – aber das macht keinen Unterschied. Warum der Hinweis auf das weiße Blatt? Wer vor einem weißen Blatt Papier sitzt, kann eine ganze Welt erschaffen, indem er sie beschreibend fixiert. Es ist gewissermaßen eine Gottesposition, die aus dem Nichts beginnt, allein eingeschränkt durch den eigenen Willen – freilich ist dies das grundlegende Missverständnis des Schreibens. Denn der Autor ist nicht Schöpfer der Welt, die er da (be)schreibt, er ist Teil von ihr. Und als solcher muss er, um sie tatsächlich beschreiben zu können, sich allererst von dieser Welt belehren lassen.
Damit meine ich Folgendes: Ich werde im Laufe dieses Buches die These vertreten, dass die moderne Gesellschaft in ihrer ganz eigenen Form der Komplexität davon geprägt ist, dass es keinen Ort gibt, von dem her man sie konkurrenzlos und gültig beschreiben kann. Mehr noch: Sie kennt keinen Ort, der es ermöglicht, auf die Gesellschaft zuzugreifen. Man kann nicht durchregieren, man muss vielmehr lernen, dass sich die Gesellschaft dem regulierenden Zugriff schon deswegen entzieht, weil Unterschiedliches gleichzeitig abläuft und nirgendwo ein Hebel zu finden ist, von dem her sie wirklich beeinflusst werden kann. Und das gilt folgerichtig auch für ihre Beschreibung.
Ein Buch über diese Gesellschaft zu beginnen heißt für mich also zunächst, anzuerkennen, dass ich nicht vor einem weißen Blatt Papier sitze. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich die Gesellschaft nach dem eigenen Bilde zu formen, etwa ökologischer oder gerechter oder demokratischer oder auf sonst eine Art besser, so wünschenswert das auch sei. Nach meinem Dafürhalten braucht man Soziologie, um vor solchen Positionen – eine Aufklärung ohne Folgen, aber mit großer Pose – zu warnen (auch wenn es Soziologen gibt, die sie tatsächlich einnehmen).
Mir geht es um etwas anderes. Ich möchte zeigen, wie es ist, sich in einer Gesellschaft vorzufinden, in der man zwar weiße Blätter beschreiben kann, in der man aber noch viel mehr bereits beschriebene Blätter vorfindet – als Metapher für Praktiken, Routinen, Strukturen, Erwartungen und Konstellationen –, die sich zum Teil wechselseitig neutralisieren, verstärken oder eben ganz unterschiedliche Probleme lösen. Dies gilt auch für den, der schreibt und der zugleich an sich selbst sehen lernen muss, wie verführerisch die Illusion des weißen Blattes ist – eine Illusion, die so tut, als könne man eine konsistente Geschichte über eine inkonsistente Welt schreiben. Die Omnipotenzfantasie des Schreibens ist die kleine Schwester der theoretischen Impotenz, bei der Beschreibung an unbeschriebene Blätter zu glauben.
Die Praxis des (Be-)Schreibens
Pierre Bourdieu, der große französische Soziologe, nannte den Habitus des schreibenden Intellektuellen einen scholastischen Epistemozentrismus.2 Bourdieus Soziologie ist eine Soziologie der Praxis, die an empirischen Situationen beschreibt, wie Menschen sich vor allem praktisch an das gewöhnen, was sie tun, dass für sie die Welt nicht in Form von abstrakten Ideen und Überzeugungen plausibel erscheint, sondern deswegen, weil sich diese Plausibilitäten praktisch bewährt haben. Praktische Bewährung meint nicht, dass diese Plausibilitäten an sich richtig sind, sondern es bedeutet, dass wir uns innerhalb sozialer Bezüge nach bewährter Art verhalten. Das lässt sich letztlich konkret in alltagsweltlichen Selbsttests überprüfen. In unterschiedlichen Milieus oder Berufsgruppen lassen sich problemlos spezielle Habitusformen unterscheiden – das fällt uns zumeist bei anderen Habitus auf, besonders bei denen, die wir selbst irgendwie skurril finden oder die unerwartete Ausprägungen zeitigen. Man denke etwa, um es in Form von Klischees zu formulieren, an den Habitus des Verwaltungsbeamten, dessen Weltsicht stark von Ordnung und Einpassung der Welt in Vorschriften geprägt ist; oder an den Lehrer, der sich kaum vom beurteilenden und didaktisierenden Kommunikationsstil emanzipieren kann; oder an den Medienmenschen, der noch den komplexesten Satz in die Form einer meldungsfähigen Information übersetzen muss; oder den Psychiater, der auch konformes Verhalten in seinen Abweichungsdimensionen wahrnimmt. Noch mehr als für Berufe gilt das für milieubedingtes Verhalten. In einem zweiten Schritt wird man feststellen, dass auch das eigene Verhalten einem solchen Habitus unterliegt und insofern von anderen als fremd oder wenigstens anders dechiffriert wird. Bourdieus Soziologie ist eine Soziologie der Praxis, weil sie sich für die praktischen Bedingungen interessiert, unter denen bestimmte Habitus und ihre Plausibilitäten entstehen.
Bourdieus größte Leistung freilich ist für mich die, dass er darüber nicht einfach intellektuell aufklärt, sondern auch dem Intellektuellen einen beschränkten Horizont zuschreibt, eine eingeschränkte und einschränkende Perspektive, in der die Vorstellung, dass andere anders urteilen als er selbst, nicht auftaucht. Nimmt man Bourdieus Denken wirklich ernst, kann man es auch als intellektuelle Selbstaufklärung des aufklärerischen Intellektuellen lesen.
Dem Intellektuellen wirft Bourdieu einen unrealistischen Habitus vor, den er, wie bereits erwähnt, einen scholastischen Epistemozentrismus nennt. Gemeint ist damit, dass der intellektuelle Kritiker anderer Klassen, anderer Kulturen und anderer Habitus einen analogen »Fehler« begeht wie all diese anderen Felder und Milieus, indem sie den eigenen Habitus als eine Art natürliche Form behandeln. Wie die anderen Milieus in ihrer Praxis gefangen sind, ist der Intellektuelle in dem Denken gefangen, dass alle anderen auch nur das für real halten, was sich der Praxis des Erschreibens guter Gründe, vernünftiger Motive und universalistischer Erklärungen fügt.
Darin sieht er einen doppelten blinden Fleck. Der eine besteht darin, dass die Praxis des Schreibtischs und des Zugzwangs von Texten mit ihren Konsistenz- und Begründungspflichten eben auch nur eine Praxis ist wie jede andere auch. Der andere besteht darin, dass die vernünftige Begründung nicht der Normalfall von Praxis ist, sondern eine Partikularpraxis. Als besonders verblendet muss dann wohl derjenige dastehen, der seine Praxis nicht blind und unausgesprochen verallgemeinert, sondern es explizit und mit dem Gestus des Sendungsbewusstseins dessen tut, der weiß, wie es eigentlich sein müsste.
Aber genau hingesehen dann doch wieder nicht so genau. Wenn man es provokativ formulieren möchte, sind viele der derzeitig erfolgreichen sozialwissenschaftlichen Kategorien der Kritik alles andere als aufgeklärt im Hinblick darauf, was sie als Kriterien ihrer Kritik ansetzen. Das bleibt oft erheblich im Dunkeln. Ich will es an drei Denkfiguren andeuten: Die derzeitig wohl erfolgreichste Figur ist die Kritik am »neoliberalen Selbst«. Byung Chul Han etwa entwickelt eine Kritik der durch neue Arbeitsformen und vor allem durch digitale Techniken verschärften Form des individuellen Selbstverhältnisses. Ohne Zweifel kann man beobachten, dass solche Selbsttechniken tatsächlich eine starke Arbeit an sich selbst nahelegen – und das ist im Hinblick auf Überlastungssyndrome auch durchaus diskutabel und in konkreten Fällen auch kritikwürdig. Es »unternehmerisches Selbst«3 zu nennen ist semantisch gelungen, weil es wie eine Beschimpfung daherkommen kann, aber letztlich auch die Versprechungen der liberalen Aufklärung der Projektierung des eigenen Lebens enthält. Diese Kritik aber interessiert sich gar nicht für die konkrete Gemengelage, sondern konstatiert in den Worten Hans: »Das Ich als Projekt, das sich von äußeren Zwängen und Fremdzwängen befreit zu haben glaubt, unterwirft sich nun inneren Zwängen und Selbstzwängen in Form von Leistungs- und Optimierungszwang.«4 Das ist schön gesagt – aber gibt es nicht das deutliche Versprechen der aufklärerischen Moderne wieder, dessen große Leistung doch in der Form der Innenleitung zu suchen ist? Was diese Diagnose für mich so zweifelhaft macht, ist nicht die berechtigte Kritik an Entwicklungen auf Arbeitsmärkten und übertriebenen Formen der körperlichen und biografischen Selbstoptimierung, sondern die Frage nach dem Kriterium der Kritik. Man muss doch als Kritiker des neoliberalen Selbst oder des unternehmerischen Selbst eine Idee der Alternative haben. Wer soll nun die Instanz der individuellen Entscheidung sein? Ist an eine nun wirklich echte Individualität gedacht? Dann hat man die Inklusionsform des modernen Menschen in die Gesellschaft nicht verstanden. Oder ist daran gedacht, dass andere Instanzen dafür sorgen, dass man selbst nicht entscheiden muss?
Die Kritik am »Neoliberalismus« als Chiffre für das strategische Verhältnis des Menschen zu sich selbst ist eine inzwischen generationsbildende Kritikform, die schon deshalb keine Kriterien der Kritik formulieren kann, weil sie von jenen formuliert wird, die als Kulturkritiker das Privileg des weißen Blattes besitzen und gewissermaßen aus der Perspektive einer privilegierten Position sich so etwas wie eine authentische Form des Selbstverhältnisses als eine gewisse déformation professionelleangeeignet haben, ohne nach den empirischen Bedingungen solcher Maßstäbe zu suchen. All das gerinnt dann letztlich zu Kulturkritik.
Ein zweites Beispiel wäre für mich die Resonanztheorie des Soziologen Hartmut Rosa. Rosa schreibt als Maßstab seiner Kritik an der »beschleunigten Gesellschaft«: »Gelingende Weltbeziehungen sind solche, in denen die Welt den handelnden Subjekten als ein antwortendes, atmendes, tragendes, in manchen Momenten sogar wohlwollendes, entgegenkommendes oder ›gültiges Resonanzsystem‹ erscheint.«5 Das ist schön gesagt, und ich stimme Rosa zu, wenn er meint, dass sich beim Erleben von Musik, Natur oder Religion oder auch in einer authentisch unverstellten Beziehung zwischen konkreten Menschen Resonanzerfahrungen einstellen, die tatsächlich zeitweise als eine Art Aufhebung der prinzipiellen Distanz zwischen Menschen aufscheinen können. Aber dass dies in einer hochgradig differenzierten Gesellschaft nicht fürs Ganze vorgehalten werden kann, ist kein Zufall. Es gehört auch zu den Versprechungen der Moderne, manche Resonanzbeziehung gekappt zu haben – zum Beispiel die zwischen Kollektivitäten und politischer Repräsentation oder die zwischen einzelnen Milieus und der Gesamtgesellschaft. Nicht in Abrede stellen will ich das Anliegen. Aber als einer der klügsten Kritiker der gegenwärtigen Verhältnisse merkt Rosa wohl selbst, dass hier aus einer Theorie der Gesellschaft, für deren Analyse am Ende doch nur die altbekannten Chiffren einer leider am Wachstum und leider am Kapitalismus und leider am Neoliberalismus hängenden Gesellschaft übrig bleiben, dann eine Art Kulturkritik oder Philosophie des guten Lebens wird. Mehr nicht.
Ein drittes Beispiel stammt aus einem aktuellen Forschungsprojekt, das wir derzeit betreiben und in dem es um die Frage der Diskurse um die Organspende geht. Sehr beliebt sind dabei – neben der üblichen Kritik am ärztlichen Habitus und der Forderung nach Partizipation der Betroffenen – zwei Figuren: zum einen die Kritik der »Anrufung« des Subjekts, das sich aufgrund gesetzlicher Regelungen (»Zustimmungslösung«) zu sich als potenziellem Organspender verhalten muss, zum anderen die Rekonstruktion der Organspende als einer »Gabe«. Der Begriff der Anrufung stammt von dem französischen Marxisten Louis Althusser und seiner Ideologietheorie, nach der jedes Subjekt durch die Anrufung durch ideologische Staatsapparate unterworfen wird.6 Der Kontext dieser Theorie muss nicht interessieren – aber mit dem Begriff der »Anrufung« ist schon ausgemacht, dass mit der rechtlichen Regulierung der Organspende und damit der Herstellung von Erwartungssicherheit und nicht zuletzt Versuchen einer gerechten Allokationslösung eine illegitime »Anrufung« erfolgt.7 Wer so argumentiert, kann überhaupt keine Kriterien mehr dafür nennen, unter welchen Bedingungen eine solche Praxis nicht illegitim sein könnte. Es bleibt dann auch nur eine kulturkritische Perspektive, die im Bewusstsein einer empiriefernen Distanz mit wirklich merkwürdigen Kriterien der Kritik arbeitet. Gerne wird die Organspende als »Gabe« rekonstruiert. Das Kriterium der Kritik wäre also die Idee einer eher authentisch und persönlich als rechtlich und anonym gebauten Praxis.8
Auch hier ist das Kriterium der Kritik eher eine kulturkritische Attitüde als eine empirienahe Beschreibung des Problems, etwa eine Reflexion darüber, dass Settings wie die Organspende vor allem dadurch geprägt sind, dass ganz unterschiedliche Logiken gleichzeitig am Werke sind, etwa die Logik einer Hochleistungsmedizin, die sich an abstrakten wissenschaftlichen Kriterien zu bewähren hat, aber auch die ärztliche Perspektive, die den konkreten Patienten im Blick hat. Rechtliche Akteure, die in Form des Richters beziehungsweise der Rechtssystematik für universale Perspektiven stehen oder in Form des Anwalts für die konkrete Partei, Perspektiven des Patienten als betroffener Person und nicht zuletzt politische Versuche der Regulierung. Am interessantesten ist, dass etwa die politische Vorgabe, Dringlichkeit und Erfolgsaussicht der Organspende bei der Allokation zu berücksichtigen, auf Widersprüche stößt, die schwer zu lösen sind. Um es kurz zu sagen: Wer nur die kulturkritische Attitüde der »Anrufungskritik« kennt und das komplexe Geschehen auf eine »Gabe« reduziert, sieht empirisch nur das, was seine professionelle Perspektive eines Milieus hergibt, das kaum darauf reflektiert, dass die Sache nicht an einem weißen Blatt Papier gelöst werden kann. Es geht dann kritisch nur darum, verfremdende Sätze sagen zu können, statt die Komplexität des Problems zur Kenntnis zu nehmen.
Vielleicht kann man so weit gehen und sagen, dass alle drei Beispiele – die Neoliberalismuskritik, die Resonanztheorie des guten Lebens und die Anrufungskritik – ihre kulturkritische Attitüde nur deshalb durchhalten können, weil sie einen Charakterzug der europäischen Moderne völlig aus dem Blick verloren haben. Man könnte diesen das Prinzip der Gewaltenteilung nennen. In allen gesellschaftlichen Bereichen reden inzwischen unterschiedlichste Instanzen gleichzeitig mit. Die Zentralperspektive wird aufgehoben. Es entsteht eine komplexe Wechselseitigkeit von Unkoordiniertem, das doch aufeinander bezogen werden muss. Es entsteht damit das, worum es in diesem Buch geht: Komplexität.
Kritik möchte gerne solche Zentralperspektiven beibehalten und schafft das in einer kulturkritischen Attitüde, die sich gar nicht erst auf die empirischen Bedingungen einer Gesellschaft einlässt, die eben nicht aus einem Guss ist – wie der Text auf einem weißen Blatt Papier. Diese selbstbezogene und selbstverliebte Denkungsart hat Pierre Bourdieu in einem an Schärfe kaum überbietbaren Beitrag eine »narzisstische Reflexivität« genannt, die zu wenig »wissenschaftliche Reflexivität« besitze, um die Bedingungen ihrer eigenen Normativitäten und Perspektiven zu verstehen.9
Um nicht falsch verstanden zu werden: Bourdieu ist der Letzte, der so etwas wie eine generelle Intellektuellenschelte im Blick hätte. Im Gegenteil: Für ihn muss der Intellektuelle als kritischer Geist in der Lage sein, die Beschränkung der Perspektiven als Perspektiven zu verstehen, und damit besonders selbstkritisch den Vorrang der Praxis vor dem Räsonieren anerkennen – eben weil Letzteres auch eine Praxis ist. Eine unmittelbare Konsequenz dieses Gedankens ist, dass der Intellektuelle vor allem seine eigene begrenzte Position anerkennen muss, um die Logik der Praxis auf den Begriff bringen zu können. Ohne diese kritische Selbstanwendung, so Bourdieu, könne eine intellektuelle Beobachtung heute nicht mehr auskommen. Das ist jedenfalls Bourdieus spezifische Idee soziologischer Aufklärung.
Der Intellektuelle unterstellt dem Subjekt die Fähigkeit, das Leben beziehungsweise Lösungen durch vernünftige Entwürfe präskriptiv zu erzeugen – also dem Wortsinne nach erst aufzuschreiben, bevor es praktisch wirksam wird. Bourdieu ist ein Denker, der sehr genau gezeigt hat, dass das, was wir denken, Resultat unseres Tuns ist, nicht umgekehrt. Und er hat das nicht einfach nur beschrieben, sondern sich auch dafür interessiert, was Leute, die etwas beschreiben, eigentlich machen. Als linker Soziologe hat er zum Beispiel scharf kritisiert, wie Intellektuelle am Schreibtisch sitzen und jene Klassen definieren, die sie von sich selbst befreien wollen. Er war also so radikal, auch sich selbst dabei zu beobachten, was ein kritischer Denker tut, wenn er kritisiert. Besonders lesenswert dazu ist seine Antrittsvorlesung, die er am 23. April 1982 unter dem Titel Leçon sur la leçon am Collège de France gehalten hat.10
Was der kritische Denker vor allem tut, ist, an sich selbst zu erleben, wie Wirklichkeiten durch eigene kreative Konstruktionsarbeiten entstehen und nach eigenem Bilde geformt werden können. Solche Konstruktionsarbeit arbeitet sich am Bestehenden ab, ihr natürlicher Feind ist die Reaktion, wie man jene in der Nationalversammlung rechts sitzenden Kräfte nach der Französischen Revolution nannte, die sich eben gegen die Neukonstruktion der Welt gewendet haben. Die Selbsterfahrung, sich die Welt nach dem eigenen Bilde zu formen, die Idee, einen »neuen Menschen« zu formen, von dem man Einsicht ins Notwendige fordern kann, und nicht zuletzt das Konstruktionsprinzip der Gesellschaft auf den Begriff bringen zu können, das ist nicht nur die Grunderfahrung des Intellektuellen, sondern auch das Konstruktionsprinzip einer als links definierbaren Denkungsart. Mich interessiert dabei weniger die inhaltliche Definition dessen, was man auf bestimmten Politikfeldern als links beschreiben kann, also das Eintreten für die »kleinen Leute« – was ja seinerseits bereits eine interessante Differenz zu denen symbolisiert, die man beschreibt. Interessanter ist vielmehr die Diskursposition selbst, die die Gesellschaft für konstruierbar hält, also für etwas, das der eigenen Gestaltungskraft unterworfen ist und damit der Konstruktionsarbeit am Schreibtisch nahekommt.
Noch einmal: Das ist nicht als Kritik am Intellektuellen zu verstehen – denn es ist ja gewissermaßen die Natur seiner Praxis. Aber womöglich liegt hier der Schlüssel für die Frage, um die es mir geht: Warum gibt es keine Beschreibungstradition für Komplexität, also für ein Phänomen, das sich der Gestaltungsmöglichkeit durch einen souveränen Konstrukteur gerade entzieht? Womöglich kann eine solche Beschreibungstradition dann tatsächlich nicht links sein, zumindest was die grundlegende Denkungsart angeht. Es geht dabei nicht darum, den Intellektuellen und das Intellektuelle zu dementieren – was ein performativer Selbstwiderspruch wäre. Es geht darum, eine Sprecherposition zu entwickeln, die eben nicht jener präskriptiven Selbstüberschätzung auf den Leim geht.
Komplexitätsvergessenheit
Der Begriff der Komplexität ist leider ein belasteter Begriff. Er ist oftmals ein Lückenbüßer – dort, wo man nicht weiterkommt oder wo keine Kausalitäten mehr genannt werden können, wo Unübersichtlichkeit herrscht, werden die Verhältnisse damit erklärt oder besser: wird die Diskussion damit beendet, auf Komplexität hinzuweisen. Die Dinge seien eben komplex – da könne man nichts machen. Interessanterweise ist da etwas dran. Auf Komplexität stoßen wir in der Tat dort, wo es nicht von selbst weitergeht. Komplexität bedeutet – das werde ich weiter unten noch ausführlich erläutern –, dass der jetzige Zustand mehrere weitere Zustände annehmen und nicht eindeutig kausal aus der Vergangenheit hergeleitet werden kann. Komplexität verweist auf die generell vorhandene Mehrfachcodierung. Sie verweist darauf, dass sich in einer Welt wie der unseren keine Position denken lässt, von der her alles gleich aussieht. Eine Gesellschaft, die ausschließlich als konkreter Herrschaftsverband aufgebaut ist, in der alles sich der Codierung von oben und unten fügt, in der alles, was geschieht, sich einer Hierarchie von Ämtern, Positionen und Bedeutungen einfügt, erzeugt zwar schon prinzipiell keine Gleichheit – aber sie erzeugt ein einheitliches Schema, dem man alles andere unterordnen kann. Deshalb sind solche klar geordneten Verhältnisse zwar oft Gewaltverhältnisse, herrschaftsnah und strikt rigoros – aber eben wenig komplex, weil leicht durchschaubar. Man könnte es auf die etwas banale Formel bringen: Ober sticht Unter.
Wo aber Unterschiedliches nebeneinander angeordnet ist, kann man nicht durchregieren – nicht einmal, wenn man das Gute will, was immer das sei. Unter Komplexitätsvergessenheit subsumiere ich solche Denkungsarten, die nach dem einen Hebel suchen, die einlinige Erklärungen abgeben, die die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Gesellschaft überschätzen, die mit einem Grundprinzip arbeiten oder einen wünschenswerten Zustand der Welt kennen. Dazu gehören fast alle Diagnosen, die die Einwirkungsmöglichkeit des Politischen überschätzen. Nicht umsonst gilt der Intellektuelle gerne als politischer Intellektueller, der bestimmte kollektiv bindende oder wirksame Aktionen, Zustände oder Entscheidungen präferiert.
Komplexitätsvergessenheit liegt auch dann vor, wenn, so Bourdieu, der intellektuelle Gestus des Epistemozentrischen sein Einwirken auf die Gesellschaft mit der welterschaffenden Praxis am Schreibtisch verwechselt, deren einzige Selbstkontrolle im Zugzwang epistemozentrischer Textproduktion liegt. Ich habe oben drei Beispiele solcher Denkungsarten genannt. So kann man aber auch beschreiben, wie eine Gesellschaft mit nachhaltiger Wirtschaftsweise aussehen könnte und entsprechend konstruiert oder umgebaut werden muss. Man kann imaginieren, die Welt sei eine Gründewelt, und dann versuchen, die Handlungen unterschiedlicher Provenienz mit entsprechenden guten, verallgemeinerbaren Gründen zu versorgen. Dies ist vielleicht die stärkste Form, mit der Konsistenz des weißen Blattes die Inkonsistenz der Welt zu verfehlen. Letztlich entspricht dem Epistemozentrischen in der intellektuellen Beschreibung der Welt das Heroische im Führungshabitus von Managern in Unternehmen. Ein männlich-heroischer Führungsstil mit direktiven Formen der Einflussnahme scheint mir so etwas wie ein funktionales Äquivalent für den Intellektuellen vor einem weißen Blatt Papier zu sein.
Was die Metapher des weißen Blattes noch zusätzlich plausibel macht, ist eine Art theologisches Argument. Die Erschaffung der Welt wird in der jüdischen und später christlichen Tradition in einem geoffenbarten Buch bezeugt. Gott saß also vor einem weißen Blatt, das er vollschreiben musste. Am Anfang war das weiße Blatt, nicht das Wort – aber nur am Anfang, danach nicht mehr, danach gibt es kein Anfangen mehr, sondern nur ein Weitermachen.
Der Hinweis auf den Irrtum des weißen Blattes, auf dem man ganze Strukturen und Modelle errichten kann, ist mehr als nur ein Bonmot. Das weiße Blatt entzieht sich der Komplexität der Welt geradezu, sein Zugzwang ist nicht die Komplexität des Beschriebenen. Die Zugzwänge des Schreibens verlangen eher Geschichten, die aufgehen, und genau deshalb erzeugt die Praxis des Schreibtisches und des Beschreibens des weißen Blattes meistens kohärente Geschichten, die aufgehen in einer inkohärenten Welt, die eben nicht aufgeht. Was ich im Folgenden versuche, ist, eine Geschichte darüber zu erzählen, warum die meisten Geschichten eben nicht aufgehen – und dass das kein Mangel ist, sondern der Status von Komplexität, mit dem stets begonnen werden muss. Daraus ergibt sich auch der programmatische Titel des Buches. Die letzte Stunde der Wahrheit ist nicht die letzte Stunde von Wahrheitsansprüchen, auch nicht die Dementierung besserer gegenüber schlechteren Lösungen, schon gar nicht ein Plädoyer für die Beliebigkeit von Geltungsansprüchen – im Gegenteil. Es geht um die letzte Stunde jener Wahrheit, die so tut, als könne sie die Gesamtheit der Gesellschaft auf den Begriff bringen und mit Hilfe einfacher Hebelbewegungen agieren. Dass es dafür anderer Tools bedarf, ist das Hauptanliegen dieses Buches. Es ist in diesem Sinne eine Kritik der komplexitätsvergessenen Vernunft.
Ein neuer Kulturkampf
Bevor ich meine Argumentation beginne, sei ein Hinweis auf die jüngste Form öffentlicher Debatten erlaubt. Was wir derzeit erleben, ist eine Renaissance dessen, was man Populismus nennt. Der Begriff ist inzwischen ein politischer Kampfbegriff geworden, aber man kann ihn durchaus sozial-/politikwissenschaftlich eingrenzen. Unter Populismus wären dann solche politischen Kommunikationsformen zu verstehen, die erstens im Namen des wirklichen Volkes zu sprechen vorgeben und dabei klare Aussagen darüber machen, wer dazugehört und wer nicht, die zweitens eliten- und institutionenkritisch sind und die Geltung autoritativer Sprecher wie Wissenschaftler, Medien, Kirchenleute usw. nicht anerkennen und die, drittens, einfache Lösungen für komplexe Probleme und Fragestellungen bereithalten.11 Letzteres ist für unser Thema von einiger Bedeutung. Der Populismusist gewissermaßen der natürliche Gegner eines komplexitätssensiblen Denkens. Man kann sicher die These vertreten, dass Komplexität und Unübersichtlichkeit den Grund für die Renaissance des Populismus darstellen.
In Deutschland und ganz Europa sind Gegenstand populistischer Semantiken vor allem Migration und Flucht, aber auch Fragen der Sexualität und der Geschlechterrollen, die Anerkennung des »Normalen« im Sinne traditionell (klein-)bürgerlicher Lebensformen und nicht zuletzt die Experten- und Elitenkritik. All diese Themen haben mit Komplexitätssteigerungen zu tun. Migration und Flucht, wiewohl ganz ohne Zweifel Themen von erheblicher Brisanz, sind Trigger einer Debatte um die Frage nach dem Eigenen und nach Normalität und Bedrohung durch Abweichung. Fragen der Sexualität und die Genderfrage sind geradezu Symbole dafür, dass sich die Dinge verkompliziert haben und dass Sprecher auftreten, die man zuvor vielleicht tolerieren konnte, die nun aber selbst sprechen. Und die Experten- und Elitenkritik zielt direkt ins Zentrum dessen, worum es hier geht. Die Komplexität von Expertise steigt mit der Komplexität der Probleme. Was man in den 1960er- und 1970er-Jahren einmal von den Experten erhoffte: Orientierung nämlich, istins Gegenteil umgeschlagen. Experten können sich komplexe Gemengelagen heute kaum gegenseitig angemessen erklären, geschweige denn einer Öffentlichkeit mit deren Bedürfnis nach narrationsfähigen Sätzen.
Die Folge ist ein Kulturkampf um sagbare Sätze. Es ist sehr bezeichnend, dass der Kampf vor allem ein Kampf um Sagbarkeiten ist. Das gilt für die Seite der »neuen« Sprecher ebenso wie für die Seite der »alten« Sprecher. »Neu« meint hier diejenigen, die vor allem in den akademischen, bildungsnahen, zum Teil universitären, oft feministischen Milieus um Bezeichnungen ringen und Korrektheit gegenüber Sprecherpositionen einfordern, bisweilen mit einem erheblichen semantischen Überschuss.»Alt« meint die Gegenbewegung, die darauf pocht, die Dinge so beim Namen zu nennen, wie es autoritative Sprecher und Eliten bis vor Kurzem noch konnten. Dieser Kulturkampf ist ein Kampf um die Definitionsmacht – es ist ein Kampf um narrative authority, den zurzeit letztlich niemand gewinnen kann. Dieser Kulturkampf hat den Fokus von den materiellen Verteilungsfragen auf die Frage der Sagbarkeit, der kulturellen Bedeutung verlagert. Das lässt sich übrigens mit neuesten Daten über die US-amerikanische Präsidentschaftswahl im November 2016 belegen. Diese Analysen zeigen, dass das Hauptmotiv der Trump-Wähler in viel geringerem Maße ökonomische Motive und Fragen der Verteilungsgerechtigkeit waren als traditionelle Einstellungen und rassistische und sexistische Motive.12Trump hat seinen Wählern also vor allem für sie sagbare Sätze