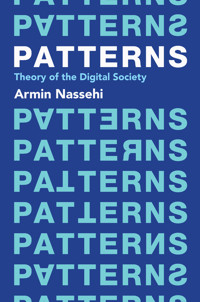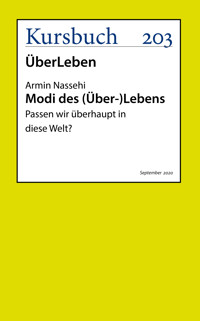22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Armin Nassehi erklärt in seinem neuen Buch die zentralen gesellschaftlichen Grundbegriffe der Gegenwart. Was bedeutet es, wenn wir von Demokratie, Freiheit, Gleichheit/ Ungleichheit, Identität, Krise und Fremdheit sprechen? Diese Begriffe haben allesamt auch eine Herkunft im akademischen Kontext, haben in öffentlichen Debatten aber mit ihrem praktischen Gebrauch längst ein Eigenleben entwickelt. Von dort wirken sie übrigens auf den akademischen Begriffsgebrauch zurück. Nassehi bringt nun Ordnung in den Diskurs – nicht indem er eine «richtige» Begriffsbedeutung festlegen will, sondern indem er darüber aufklärt, welche offensichtlichen, aber auch welche versteckten Funktionen der Gebrauch dieser Grundbegriffe erfüllt. Er ist sich freilich dessen gewiss, dass, wie Niklas Luhmann einmal bemerkte, die Soziologie «neue Selbstbeschreibungen der Gesellschaft allenfalls anbrüten, nicht aber durchsetzen» kann. Armin Nassehis Sammlung gesellschaftlicher Grundbegriffe ist keine oberlehrerhafte Aufforderung zum richtigen Sprechen. Vielmehr werden die Begriffe methodisch danach abgeklopft, welche Funktion sie in Debatten haben. Die Grundfrage ist stets, für welches Problem solche Begriffe und ihr Gebrauch die Lösung sind. Gesellschaftliche Grundbegriffe wie Demokratie, Freiheit, Gleichheit/Ungleichheit, Identität, Krise und Fremdheit haben nicht nur eine lexikalische Bedeutung, die man historisch herleiten kann, sondern eben auch eine praktische Bedeutung durch ihren Gebrauch in Debatten. Wer erkennt, welche Funktion manche Begriffe haben, was sie zeigen und was sie verbergen, hat womöglich das Rüstzeug, öffentliche Debatten besser zu verstehen. Dabei richtet sich der Fokus in Nassehis Buch nicht nur auf den öffentlichen Gebrauch jener begrifflichen Vernunft, sondern auch auf die soziale Herkunft der Begriffe aus den Sozialwissenschaften – und auf die Art und Weise, wie sie vom öffentlichen Diskurs auf jene Wissenschaft zurückwirken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Armin Nassehi
GESELLSCHAFTLICHE GRUNDBEGRIFFE
EIN GLOSSAR DER ÖFFENTLICHEN REDE
C.H.BECK
Über das Buch
Armin Nassehi legt in seinem neuen Buch ein Glossar der öffentlichen Rede in Deutschland vor. Die von ihm ausgewählten, aufeinander verweisenden gesellschaftlichen Grundbegriffe haben eines gemein: Sie stammen aus dem akademischen Kontext, sind aber längst in der öffentlichen Debatte angekommen. In oft unheilbar verzerrter Form entfalten sie in dort ihre Wirkung, und aus der öffentlichen Debatte wirken die Begriffe auch auf die Sozialwissenschaften zurück. Nun geht es hier nicht um eine «eigentliche» Bedeutung von Begriffen, nicht um eine oberlehrerhafte Aufforderung zum richtigen Sprechen. Vielmehr werden in Nassehis Buch die Begriffe methodisch danach abgeklopft, welche Funktion sie in Debatten haben. Die Grundfrage ist stets, für welches Problem solche Begriffe und ihr Gebrauch die Lösung sind. Gesellschaftliche Grundbegriffe wie Freiheit, Gleichheit/Ungleichheit oder Identität, Krise und Fremdheit haben nicht nur eine lexikalische Bedeutung, die man historisch herleiten kann, sondern eben auch eine praktische Bedeutung durch ihren Gebrauch in Debatten. Wer weiß, welche Funktion manche Begriffe haben, was sie zeigen und was sie verbergen, hat womöglich das Rüstzeug, öffentliche Debatten besser zu verstehen. Dabei richtet sich der Fokus nicht nur auf den öffentlichen Gebrauch jener begrifflichen Vernunft, sondern auch auf die soziale Herkunft der Begriffe aus den Sozialwissenschaften. All das gemäß der Grundfrage: Für welche Probleme bieten diese Begriffe eine Lösung?
Über den Autor
Armin Nassehi ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und seit 2012 Herausgeber der Kulturzeitschrift «Kursbuch». Von ihm erschienen bei C.H.Beck zuletzt «Unbehagen. Theorie der überforderten Gesellschaft» (2021) und «Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft» (2019).
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Zwei Wörterbücher
Gesellschaftliche Grundbegriffe
Textsorte
Methodik
Haben wir nicht andere Probleme als Begriffe?
→ Demokratie
Zwei Umwege
Demokratische Gesellschaft oder demokratische Politik?
Passen Lösungen zu den Problemen?
Das Bezugsproblem der Demokratie
→ Freiheit
Das Bezugsproblem
Lücken der Freiheit
Freiheit als Notwendigkeit?
Freie Entscheidungen
→ Fremdheit; der Fremde
Das Bezugsproblem des «Fremden»
Das Eigene und das Fremde
Zugehörigkeiten
Die Renaissance des Eigenen
→ Gesellschaft
Wahrscheinlichkeiten
Das Bezugsproblem
Vertrag und Organismus
Komplexe Schnittstellen
→ Gleichheit/Ungleichheit
Gleichheitspostulate in einer Welt der Ungleichen
Gleichheitsversprechen und Ungleichheitseffekte
Die Funktion von «Gleichheit»
Inklusionsdruck
Gleichberechtigung und Gleichstellung
→ Handeln
Emanzipation und Sichtbarkeit
Zurechnungsfähigkeit
Das Bezugsproblem des «Handelns»
Die Soziodizee des «Handelns»
→ Identität
Selbstähnlichkeit
Bezugsproblem
Kampf um Identitäten
→ Kommunikation
Signale
Rückkopplungen und role-taking
Das Bezugsproblem
Entfesselung und Dauerreflexion
Kommunikationsprobleme
→ Konflikt
Integrierende Konflikte
Multiple Konflikte
Nein
Das Bezugsproblem
→ Krise
Zwischen Erleben und Handeln
Der forensische Prozess
Horizonte der Lösbarkeit
Zentralperspektive
Das Bezugsproblem
→ Kritik
Die Bürgerlichkeit der Kritik
Ist Dauerkritik institutionalisierbar?
«Gesellschaftskritik» – ein Pleonasmus?
Das Bezugsproblem
Ein neuer Kritiktypus?
→ Kultur
Unsichtbare Bedingungen
Kulturvergleich
Kultur als Distinktionsbegriff
Kunst und Kultur
→ Lebenswelt
«immer schon»
Bezugsproblem
Die Trägheit der «natürlichen Einstellung»
Typisierungen
→ Macht
… gegen Widerstreben
Macht als Medium
Das Bezugsproblem
Organisationsmacht
Produktivität der Macht
Rohe Gewalt
→ Natur
Notwendigkeit und Freiheit
Die menschliche Natur
Die Latenz der Natur
Freiheit und Notwendigkeit reversed
Das Bezugsproblem
Renaturalisierung des Geschlechts?
→ Öffentlichkeit
Lesende Öffentlichkeit
Exerzitien und Projektionen
Das Bezugsproblem
Öffentlichkeiten
Öffentlichkeit als Adresse
→ Populismus
Die Eliten und das Volk
Das Bezugsproblem
Der linke Populismus
→ Technik
Technik als «Ideologie»
Das Funktionieren
Das Bezugsproblem
Überraschende Technik
→ Wissen
Die Performanz des Wissens
Das Bezugsproblem
Wissenschaftliches Wissen
Wissensgesellschaft?
Anmerkungen
Einleitung
→ Demokratie
→ Freiheit
→ Fremdheit; der Fremde
→ Gesellschaft
→ Gleichheit/Ungleichheit
→ Handeln
→ Identität
→ Kommunikation
→ Konflikt
→ Krise
→ Kritik
→ Kultur
→ Lebenswelt
→ Macht
→ Natur
→ Öffentlichkeit
→ Populismus
→ Technik
→ Wissen
Register
Vorwort
Ein Glossar der öffentlichen Rede zu erstellen, ist ein merkwürdiges Unterfangen. Ein Glossar ist ein Wörterverzeichnis, eine Liste, eine Sammlung von Begriffen, deren Bedeutung Erläuterung verlangt. Genau darum geht es in diesem Buch. Es nimmt sich Begriffe vor, die aus den Sozialwissenschaften, speziell der Soziologie, ausgewandert sind, aber auch außerhalb der academia vorkommen und dort von Bedeutung sind. Ein solches Glossar dient nicht dazu, eine Orthodoxie zu begründen, also eine rechtgläubige Form des Begriffsgebrauchs anzuregen. Vielmehr geht es um die Rekonstruktion des Eigensinns und des Sinnüberschusses von Begriffen, die allzu selbstverständlich klingen. Es sind neunzehn Begriffe, nach lexikalischer Manier in alphabetischer Reihenfolge angeordnet, ohne dass dieses Buch ein Lexikon im engeren Sinne wäre.
Geschrieben habe ich das Buch im Winter 2022/23. Dem ging allerdings eine längere Suchbewegung voraus, wie die Textsorte anzulegen sei. Die nun gefundene Form soll für an öffentlichen Debatten interessierte Leserinnen und Leser ebenso lesbar sein wie für ein Fachpublikum, dem hier eine eigensinnige Lesart solcher Begriffe angeboten wird. Die Lemmata können je für sich gelesen werden und stehen je für sich – aber es dürfte bei der Lektüre deutlich werden, dass es einen inneren Zusammenhang der Texte gibt.
Das Schreiben an diesen Texten hat mir großes Vergnügen bereitet – was natürlich weder ein Gütekriterium ist, noch aber gegen die Texte sprechen sollte. Unterstützt haben mich dabei Leserinnen und Leser, von denen ich viel profitiert habe. An erster Stelle ist besonders Irmhild Saake zu nennen, mit der ich auch die Gesamtkonzeption mehrfach diskutiert habe. Ihr sei besonders gedankt. Während des Schreibprozesses mitgelesen haben Lena Göbl und Gina Atzeni, den gesamten Text hat am Ende Niklas Barth kritisch unter die Lupe genommen. Allen Genannten verdanke ich viele wertvolle Hinweise – dass alle Eseleien im Text allein mir zuzurechnen sind, versteht sich natürlich wie immer von selbst.
Matthias Hansl und dem Verlag C. H.Beck danke ich für die gute Zusammenarbeit und Simon Lindner für das kompetente Lektorat bei diesem nunmehr dritten gemeinsamen Buchprojekt.
München, im März 2023.
Einleitung
Zum Material der öffentlichen Rede gehören nicht nur Themen, sondern auch bestimmte Sprechweisen, was als einer der Grundsätze der Rhetorik gelten kann[1] – und Sprechweisen nutzen vor allem Begriffe. Man kann die Konjunktur von Begriffen an den Konjunkturen öffentlicher Themen festmachen; so erklärt sich die Konjunktur virologischer Begriffe angesichts einer Pandemie oder militärischer Begriffe während eines Krieges. Um debattieren zu können, bedarf es semantischer Voraussetzungen und der Unterstellung, dass auch andere die verwendeten Kategorien kennen. Erst diese Unterstellung macht gebrauchte Wörter zu Begriffen. Themenkonjunkturen sind Begriffskonjunkturen, so dass man an Begriffskarrieren etwas über die entsprechenden Themen und Konflikte ablesen kann, die in der Öffentlichkeit verwendet werden.
Alle Reflexion der Gesellschaft findet in der und als Gesellschaft statt. Und alle Reflexion findet in, mit und an Begriffen statt. Diese Begriffe haben spätestens seit den 1960er Jahren auch eine soziologische oder sozialwissenschaftliche Herkunft und sind Teil der außerakademischen Rede geworden. Die öffentliche Sprache ist mit Begriffen soziologischer Herkunft geradezu imprägniert – insbesondere wenn die öffentliche Rede das, worüber sie debattiert, als gesellschaftliche Themen behandelt. In diesem Buch geht es um solche Begriffe – und die Untiefen, die in solchem Begriffsgebrauch drohen. Wenn man so will, unternimmt das Buch eine Rückholaktion solcher Begriffe: Eingedenk ihrer Herkunft soll nach längerem Gebrauch reflektiert werden, ob die Begriffe noch angemessen funktionieren – und dieses Funktionieren ist wörtlich gemeint, doch dazu gleich mehr.
Eine Rückholaktion erfolgt dann, wenn ein Produkt sich als schadhaft oder untauglich, gefährlich oder insuffizient herausgestellt hat. Das kann man von den hier zu verhandelnden Begriffen nicht sagen. Wenn hier über Begriffe wie Lebenswelt, Ungleichheit, Handeln, Konflikt, Kultur, Fremdheit, Identität, Macht, Wissen und natürlich Gesellschaft und andere verhandelt wird, dann werden diese Begriffe nicht deshalb einer Rückholaktion unterzogen, weil sie untauglich oder gar unbrauchbar geworden wären. Sie sollen vielmehr überprüft werden im Hinblick auf ihre Funktion in Debatten, auf ihr Eigenleben, mit dem Sprecherinnen und Sprecher innerhalb und außerhalb der Soziologie womöglich gar nicht rechnen, und auf ihren bisweilen haltlosen Gebrauch.
Es geht hier darum, Begriffe daraufhin zu befragen, was sie selbst tun. Es geht aber nicht darum, irgendjemanden auf einen «richtigen» oder «legitimen» Begriffsgebrauch festzulegen. Auch das wäre naiv – und ziemlich problematisch. Es geht eher um die Einsicht, dass sich die Begriffe unabhängig von den Intentionen ihrer Sprecherinnen und Sprecher selbst bewegen, dass sie selbst einen Eigensinn haben, in ihrer Persistenz einen Sinnüberschuss enthalten, den man letztlich nur durch theorieförmige oder wenigstens theorieinformierte Reflexion aufdecken kann. Dazu soll dieses Buch beitragen. Als Glossar der öffentlichen Rede ist es keine Anleitung fürs richtige Sprechen. Es ist keine versteckte Orthodoxie, sondern ein Reflexionsangebot, das darauf hofft, dass sich mancher Begriffsgebrauch nach der Lektüre anders darstellt als zuvor – und wenn nicht der Begriffsgebrauch, dann wenigstens dessen Beobachtung.
Die Arbeit an den Begriffen dient nicht dazu, sich passende bessere Begriffe zu entwerfen, wie man «Freiheit» eigentlich verstehen sollte, was die «Demokratie» denn nun wirklich leisten könnte, dass wir einen besseren Umgang mit «Gleichheit» und «Ungleichheit» pflegen oder wie die «Gesellschaft» am besten aussehen sollte. Solche Texte gibt es viele. Sie schließen an Begriffe an, interessieren sich aber weniger für den Begriff und seine Funktion, sondern nutzen diese. Davon wollen die nachfolgenden Lemmata Distanz halten, denn es geht tatsächlich nicht um eigentliche und wirkliche Bedeutungen, sondern um den performativen Sinn des jeweiligen Begriffsgebrauchs. Dass die Analysen einen vielleicht reflexiveren Begriffsgebrauch zumindest anregen oder wenigstens darauf hinweisen wollen, dass die Funktion des Begriffsgebrauchs seiner mehr oder weniger intendierten Bedeutung widersprechen kann, ist freilich eingeschlossen.
Dieses Buch und seine Begriffsanalysen folgen dem Glauben, dass es sich lohnt, die Trägheit von Konzepten mitzusehen und auf die Nicht-Beliebigkeit von Begriffen und argumentativen Figuren hinzuweisen. In vielen (akademischen) Diskursen herrschen allzu große Freiheitsgrade, was mögliche Argumente angeht. Die öffentliche, auch die akademische Rede kennt in diesem Sinne bisweilen kaum Grenzen. Es scheint fast alles möglich zu sein, wenn es nur einen Effekt erzielt oder in einem Binnenmilieu Identität stiftet. Eine theorieförmige Beobachtung bedeutet dagegen: diese Beliebigkeit einzuschränken und den Dingen damit eine Gestalt zu geben. Dass es dafür keine objektive Form, keine allein mögliche gibt, versteht sich von selbst, denn die hier vorgetragenen theorieförmigen Analysen von Begriffen folgen einer reflexiven Selektivität: Das Selektionsprinzip besteht darin, eine bestimmte Perspektive stark zu machen, die methodisch und theoretisch reflektiert ist und genau genommen empirische Forschung an Begriffen und ihrem Gehalt darstellt. Gute Gründe sind stets ein Selektionsprinzip, weil sie sich gegen schlechtere Gründe zu behaupten trachten – oder gegen jene Form, die nur Wortgebrauch, aber keine Begriffsverwendung ist. Wäre man so naiv, zu glauben, dass sich argumentative Haltlosigkeit vollständig aufklären ließe, wäre das ein großer Fehler und würde die performative Logik des Begriffsgebrauchs unterschlagen, die ja gerade Gegenstand der Analysen ist – solche Aufklärung aber nicht einmal zu erwägen, würde eine ganz eigene Art der Kapitulation bedeuten, wenigstens für einen wissenschaftlichen Forscher, akademischen Lehrer und öffentlichen Sprecher.
Die Rückholaktion belässt die Begriffe nicht in der Maschinenhalle, sondern setzt sie wieder frei. Der Eigensinn und das Eigenleben der Begriffe, die sich nicht in einem kanonischen Bedeutungsfeld, sondern nur in ihrem praktischen Gebrauch aufweisen lassen, sollen ihr Potential entfalten. Ziel ist es, Debatten über sich selbst aufzuklären und sie mit der Möglichkeit auszustatten, Begriffe als Begriffe und nicht nur als Wörter zu gebrauchen.
Der Impetus der folgenden Lemmata speist sich aus dem Glauben, dass der Nachweis der Theoriebedürftigkeit öffentlicher Rede dabei helfen könnte, gesellschaftliche Auseinandersetzungen auf ein höheres Niveau zu heben – nicht weil die inhaltlichen Aspekte zu lösender Probleme präjudiziert werden könnten, sondern weil ein methodisches Instrumentarium bereitgestellt wird, um die Funktion von Begriffen in ihrem unmittelbaren Gebrauch und ihre Bezugsprobleme in Debatten zu begreifen. Zu glauben, dass das etwas ändert, ist zugleich aber auch Ausdruck einer besonderen Tragik, die im Gesellschaftsbegriff bzw. in der Totalität dieses Begriffs zum Ausdruck kommt. Wie gesagt: Alle Reflexion der Gesellschaft findet in der und als Gesellschaft statt. Daraus gibt es kein Entkommen, es könnte nur den Vorschein eines angemesseneren Umgangs mit der Komplexität der Gesellschaft darstellen, wenn deutlich wird, dass der öffentliche Gebrauch von «Gesellschaft» in der Gesellschaft stattfindet. Insofern sind die Lemmata dieses Glossars auf eine stupende Art immanent gehalten.
Zwei Wörterbücher
Dieses Buch ist inspiriert von zwei großen – von mir seit dem Studium immer wieder gern genutzten – Wörterbüchern, die interessanterweise beide Anfang der 1970er Jahre entstanden sind. Die Frage, ob es für diese zeitliche Koinzidenz einen besonderen Grund gibt, könnte womöglich so beantwortet werden, dass sich die Zeiten seitdem verändert haben.
Es lohnt sich, sich diese beiden Vorlagen genauer anzusehen, um die Ziele dieses Buches genauer zu bestimmen – nicht ohne zu erwähnen, dass diese mehrbändigen Werke einen ganz anderen Fokus und eine andere Reichweite haben als dieses Unterfangen, aber unter epistemologischen und methodischen Gesichtspunkten ist die Parallele durchaus von Bedeutung.
Es geht um die folgenden beiden Wörterbücher: das Historische Wörterbuch der Philosophie, ab 1971 konzipiert auf zwölf Bände und einen Registerband,[2] und die Geschichtlichen Grundbegriffe, seit 1972 auf sieben Bände und zwei Registerbände angelegt.[3] Um es deutlich zu sagen: Ein Vergleich mit diesen für die deutschsprachigen Geistes- und Sozialwissenschaften und die Philosophie epochalen und monumentalen Projekten verbietet sich von selbst. Aber sie sind unverzichtbare Begleiter dafür, sich im Dickicht der Begriffe zurechtzufinden, die für die genannten Wissenschaftsbereiche relevant sind.[4] Mich haben Begriffe stets fasziniert – vor allem weil ihre Bezeichnungsfunktion kontingent ist. Der Herausgeber Joachim Ritter zitiert 1970 im Vorwort zum Historischen Wörterbuch der Philosophie René Descartes. Dieser hatte die Vorstellung, «dass fast alle Kontroversen entfallen würden, wenn sich die Philosophen über die Bedeutung der von ihnen verwendeten Wörter einigen könnten». Daraus spreche das «Ideal voller ‹Verständlichung›» einer «wesentlich der positivistischen und der mathematischen Logik verbundenen Wissenschaftstheorie», die «aber in Spannung zu der sich geschichtlich begreifenden Philosophie und ihrem kritischen Bewusstsein»[5] stehe. Darin bildet sich schon in den 1970er Jahren jene Kontroverse zwischen «analytischer» und «kontinentaler» Philosophie ab, die heute nachgerade zu einer Polarisierung der akademischen Philosophie geführt hat. Dieser Gedanke soll hier nicht weiter vertieft werden, schon weil mir dazu die Sachkenntnis fehlt.[6]
An der programmatischen Einleitung von Joachim Ritter wird deutlich, dass Begriffsgeschichte nicht einfach eine definitorische Festlegung von Sachverhalten ist, sondern eben die Frage nach der Gegenstandskonstitution durch Begriffe. Begriffe sind nicht einfach semantische Entsprechungen von Anschauungen, sondern Abstraktionen und Verallgemeinerungen, oder in der Diktion Kants: «Die Anschauung ist eine einzelne Vorstellung (repraesentat. singularis), der Begriff eine allgemeine (repraesentat. per notas communes) oder reflektierte Vorstellung (repraesnetat. discursiva).» Daraus folgt für ihn: «Der Begriff ist der Anschauung entgegengesetzt, denn er ist eine allgemeine Vorstellung dessen, was mehreren Objekten gemein ist, also eine Vorstellung, sofern sie in verschiedenen enthalten sein kann.»[7]
Nun soll es hier nicht um den Begriff des Begriffs bei Kant gehen, überhaupt nicht um eine philosophisch befriedigende Begriffsbestimmung des Begriffs.[8] Für meine Zwecke ist aber Kants geradezu funktionalistisches Begriffsverständnis hilfreich. Die Frage lautet: Welches Problem löst der Begriff? Seine Antwort: Der Begriff trennt das Denken nicht von der bloßen Anschauung, sondern fügt der Anschauung erst jene Allgemeinheit und Abstraktion hinzu, die sie von ihrer Singularität emanzipiert und den Begriff erst zum Begriff macht.[9] Diese soeben schon funktionalistisch genannte Frage ist die erkenntnisleitende Frage dieses Buches. Aber dazu später mehr.
Reinhart Koselleck, der federführende Herausgeber der Geschichtlichen Grundbegriffe, erläuterte in der Einleitung zu diesem Werk, was ein Begriff sei, so: «Ein Wort kann eindeutig werden, weil es mehrdeutig ist. Ein Begriff dagegen muss vieldeutig bleiben, um Begriff sein zu können. Der Begriff haftet zwar am Wort, ist aber zugleich mehr als das Wort. Ein Wort wird – in unserer Methode – zum Begriff, wenn die Fülle eines politisch-sozialen Bedeutungszusammenhangs, in dem – und für den – ein Wort gebraucht wird, insgesamt in das eine Wort eingeht.»[10] Die Fragestellung seines Wörterbuchs ist es, «die Auflösung der alten und die Entstehung der modernen Welt in der Geschichte ihrer begrifflichen Erfassung zu untersuchen».[11]
Auch in dieser Begriffsbestimmung des Begriffs kann man einen funktionalistischen Gedanken finden. Es ging Koselleck nicht einfach um eine lexikalische Sammlung von Definitionen und Bedeutungen, sondern um die Verstrickung der Begriffe und vor allem ihrer Verwendung in der Geschichte. Auch hier wird gefragt, für welches Problem die jeweiligen Begriffe Lösungen sind. Die Geschichtlichen Grundbegriffe nehmen die Begriffe als Indikatoren dafür, wie sich die Zeitläufte verändert haben, die sich methodisch wiederum nur mit diesen Begriffen fassen lassen. Wie also die philosophische Begrifflichkeit nicht einfach etwas begreift, sondern als praktischer Vollzug die Sache selbst ist,[12] sind die historisch auftretenden Begriffe nicht einfach Repräsentationen eines Geschehens, sondern haben eine bestimmte Funktion innerhalb dieses Geschehens.
Es sollte deutlich geworden sein, dass der Rekurs am Anfang dieses Buches auf die beiden vielleicht bedeutendsten deutschsprachigen Publikationsprojekte in den entsprechenden Disziplinen methodischer oder methodologischer Natur ist. Die Unterschiede zu meinem Unterfangen sind freilich nicht nur quantitativer Natur, denn auch die Art und Weise, wie hier mit Begriffen umgegangen wird, ist anders. Das Historische Wörterbuch der Philosophie rekonstruiert die Philosophiegeschichte im Hinblick auf die philosophische Arbeit des Begriffs. Es ist ein großes Netzwerk intertextueller Bedeutungsentwicklungen in der Philosophie, selbstverständlich orientiert an den Namen von Autoren (und manchmal Autorinnen), aber vor allem interessiert an der historischen Entfaltung der Begriffe und ihrer argumentativen Form. Das Ziel ist dabei eine Bestandsaufnahme nebst Historisierung philosophischer Grundbegriffe. Die Geschichtlichen Grundbegriffe dagegen sind weniger an der Genese der Begriffe selbst orientiert, sondern eher am performativen Gebrauch der Begriffe und ihrer Beteiligung an den denkerischen Umstellungen an der Schwelle zur Moderne. Das Interesse ist ganz nach Kosellecks methodischem Verständnis die Rekonstruktion gepflegter Semantiken als historischen Indikatoren für die Veränderung der historisch-gesellschaftlichen Welt.[13]
Ich habe oben die Frage gestellt, ob es Zufall sei, dass diese beiden monumentalen Werke Anfang der 1970er Jahre konzipiert wurden – und angedeutet, dass sich seitdem die Zeiten geändert hätten. Das freilich gilt stets, aber es lässt sich bezüglich der Entwicklung öffentlicher Debatten doch behaupten, dass Begriffsverwendungen beliebiger, idiosynkratischer und wohl auch weniger selbstkontrolliert sind. Vielleicht sind diese beiden Wörterbücher Ausdruck einer historischen Situation, in der womöglich zum letzten Mal eine kanonisierbare Bestandsaufnahme gemacht werden konnte. Sie sind gewissermaßen Selbstvergewisserung einer Tradition im Moment ihres beginnenden Verschwindens. Heute stellt sich die Situation anders dar, nämlich geprägt durch eine geradezu programmatische Fluidität und Freihändigkeit, die etwas mit Pluralisierung und der prinzipiellen Symmetrisierung von Sprecherpositionen zu tun hat, was hier nicht per se zu kritisieren ist. Insofern unterscheidet sich dieses Projekt fundamental von den beiden großen Vorlagen, ohne diese zu negieren, eher um sie zu historisieren. Haben diese Perspektiven eröffnet und schlicht informiert und Hilfestellung geboten, geht es jetzt eher um eine Wiedereinführung von Selbsteinschränkungen. Um nicht falsch verstanden zu werden: Selbsteinschränkung meint nicht, bestimmte Redeweisen, Bedeutungen oder gar Inhalte unter Verdacht zu stellen, heute sagt man womöglich: zu canceln. Es geht um eine methodisch kontrollierte Selbsteinschränkung, wie weiter unten noch zu zeigen sein wird.
Gesellschaftliche Grundbegriffe
Die in diesem Buch, den Gesellschaftlichen Grundbegriffen, rekonstruierten Begriffe und Begriffsanalysen sind weder wie in der philosophischen Vorlage an der Arbeit des Begriffs im engeren Sinne orientiert, noch wird mit ihnen wie in der historischen Vorlage behauptet, die Begriffe seien Indikatoren für eine gesellschaftliche Entwicklung oder gar für eine historisch-strukturelle Umstellung. Die Begriffe in diesem Buch werden vielmehr empirisch daraufhin befragt und bearbeitet, welche performative, also praktische Funktion sie in gegenwärtigen Debatten haben und wofür sie gebraucht werden, ohne dass das im Begriffsgebrauch unmittelbar ansichtig würde.
Für die hier behandelten Begriffe gilt: Es sind gesellschaftliche Grundbegriffe, weil sie die Gesellschaft (im weitesten Sinne) zum Gegenstand haben und weil sie im gesellschaftlichen Diskurs durch öffentlichen Gebrauch in Debatten von Bedeutung sind. Sie nehmen rekonstruierbare Funktionen in der öffentlich zugänglichen, hauptsächlich medienvermittelten Form der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung und ihren Debatten ein. Genau genommen entspricht der Terminus des Gesellschaftlichen im Titel des Buches jenem Bezugsproblem, das im Lemma Gesellschaft herausgearbeitet wird: Der öffentliche Gebrauch des Begriffs dient vor allem der Identifizierung einer Adresse und der Ansprechbarkeit jener imaginierten Einheit, die als «Gesellschaft» angesprochen werden kann (→ Gesellschaft). Der öffentlich (und sehr oft auch akademisch) gebrauchte Gesellschaftsbegriff bringt eine eher amorphe Adresse ins Spiel, die fachwissenschaftlich nicht wirklich gedeckt ist, aber den performativen Sinn des Begriffs ausmacht. Der Hinweis auf den Begriffsgebrauch impliziert auch, dass die Rekonstruktion einiger Begriffe aus der Denk- und Ideengeschichte und der philosophischen Tradition eher sparsam erfolgt. Der Schwerpunkt liegt nicht in der Rekonstruktion eingeführter Doxographien, auch nicht in einer textnahen Form der Begriffsrekonstruktion, sondern tatsächlich darin, die praktische, die performative Problemlösungskapazität von Begriffen herauszuarbeiten.
Die Auswahl der Begriffe ist kontingent und ohnehin unvollständig. Es sind explizit nicht die Grundbegriffe der Soziologie; damit ist dieses Buch weder ein soziologisches Wörterbuch, noch ein soziologisches Lehrbuch über deren Fachbegriffe.[14] Die hier gewählten Begriffe haben aufgrund ihrer Migrationsgeschichte in der akademischen Welt eine besondere Bedeutung in öffentlichen Debatten, schleppen einen Bedeutungshof mit, sie «funktionieren» in der öffentlichen Debatte.
Als Grundbegriffe werden die Begriffe hier also nicht bezeichnet, weil sie innerhalb ihrer wissenschaftlichen Herkunft grundbegrifflicher Natur wären. Es sind zwar allesamt Begriffe, die im akademischen und wissenschaftlichen Kontext eine Rolle spielen, aber es sind keine fachkonstituierenden Grundbegriffe. Grundbegriffe nenne ich diese Begriffe, weil sie grundlegende Funktionen in öffentlichen Debatten einnehmen können – und zugegebenermaßen auch wegen der gelungenen semantischen Nähe zu den Geschichtlichen Grundbegriffen, die ähnlich zwischen Fachdiskurs und politischer Rede changieren.
Dieses Buch richtet sich auch an die soziologische Fachdiskussion, die oft genug von der «gesellschaftlichen» Funktion ihrer Begriffe zehrt oder sich an sie anpasst, und oftmals allzu schnell das Akademische mit dem Wissenschaftlichen gleichschaltet.[15] Ohnehin genießt die Soziologie oftmals besonders dann öffentliche Aufmerksamkeit, wenn sie sich als Reflexionstheorie des eigenen Milieus darstellt – von kreativen neuen Mittelklassen über Resonanzerfahrungen bis hin zur Partei in den Kulturkämpfen der Gegenwart. Etwas mehr Distanz neben dem Engagement bietet womöglich ein reflexiver Umgang mit Begriffen, vor allem wenn sie an der Schnittstelle zwischen akademischen und öffentlichen Publika lagern.[16] Insofern sind die Texte in diesem Buch auch als eine (Selbst-)Kritik der Soziologie zu verstehen, die bisweilen allzu ungenau mit ihren eigenen Grundbegrifflichkeiten umgeht.
Textsorte
Wer je einen Marketing-Kurs besucht hat (ich übrigens nicht), weiß, dass man niemals damit beginnen sollte, was man nicht anbietet. Dennoch: Die hier vorliegenden Texte erfüllen keine neutrale Chronistenpflicht, sie sind nicht unparteiisch in dem Sinne, dass sie im oben mit Ritter angedeuteten cartesischen Sinne «volle Verständlichung» suggerieren. Sie haben keine «enzyklopädische» Absicht im Sinne Diderots und d’Alemberts, denen es in der Aufklärung Ende des 18. Jahrhunderts darum zu tun war, das Weltwissen zu sammeln, um es späteren Generationen überliefern zu können.[17] Sie sind nicht einmal «gerecht» im Sinne einer neutralen Gesamtschau zu bestimmten Diskursen. Es sind vielmehr Versuche einer soziologischen Erklärung der Funktion dieser Begriffe für die gesellschaftliche Selbstbeschreibung – und als soziologische Erklärungen bewegen sie sich selbst an der Schwelle zwischen akademischer Gelehrsamkeit und Beiträgen zu den entsprechenden Debatten. Im Klartext: Die Argumente in diesem Buch sollen einen Unterschied machen – und dieser Unterschied speist sich auch aus einer bestimmten Art des soziologischen Argumentierens.
Die Lemmata lesen sich nicht wie übliche Lexikoneinträge, es sind eher Aufsätze, die den Begriff entfalten, die sozialwissenschaftliche Herkunft darlegen, vor allem aber die Funktion und das Bezugsproblem des Begriffs zwischen akademischer Herkunft und debattenfähiger Verwendung rekonstruieren. Es wird also nicht die Bedeutung von Wörtern erklärt, sondern deren Funktion als Begriff. Begriffe und Begriffsbestimmungen erfolgen nicht zufällig, sie fungieren als «Einschränkung der Möglichkeit weiterer Begriffsbestimmungen»[18] und haben Konsequenzen für den weiteren Begriffs- und Bedeutungsgebrauch. Die Textsorte ist also der Essay, der in zwei Welten funktionieren sollte: in der soziologisch-wissenschaftlichen und der öffentlichen. Im Idealfall sollten die Texte so gelesen werden können, dass nachvollziehbar wird, wie sich die Arbeit am Begriff selbst entfaltet und wie die Funktion der Begriffe sich daraus ergibt.
Methodik
Es wurde schon mehrfach erwähnt, dass die Begriffsanalysen methodisch kontrolliert erfolgen sollen – auch methodische Kontrolle ist eine Form der Selbsteinschränkung. Die funktionalistische Grundintuition lautet, dass etwas, das persistiert, das sich stabil in einer volatilen Umwelt erhält und das einen Eigensinn entwickelt, offensichtlich die Lösung für ein Problem sein muss – und in diesem Fall muss dann sowohl die Lösung als auch das (Bezugs-)Problem gefunden werden, und zwar im Horizont von alternativen Lösungen/Problemen. Diese Grundintuition ist es, die die soziologische Bedeutung dieser Rekonstruktion soziologischer Begriffe in außersoziologischen Feldern ausmacht. Es werden nicht einfach Begriffe danach untersucht, was sie «eigentlich» bedeuten, auch nicht danach, wer sie «falsch» und wer «richtig» gebraucht. Der Kampf ums richtige Sprechen ist zumeist ein Hinweis darauf, dass man überhaupt keine Kriterien für den Begriffsgebrauch hat. Hier herrschen oftmals Naivitäten vor, die offenbaren, dass kaum Kategorien vorhanden sind, mit der Komplexität von Situationen umzugehen. Man braucht dafür aber Kategorien, eine reflexive Form der Selektivität, eine Methode, einen Weg – also eine Idee davon, warum man zu Ergebnissen kommt und dass diese sich weder beliebig, noch im Sinne der eigenen Wünsche und Vorurteile ergeben.
Die hier versammelten Lemmata mit neunzehn Begriffen folgen einer solchen methodischen Vorentscheidung. Die methodisch kontrollierte Grundidee besteht darin, was ich oben schon eine funktionalistische Methode genannt habe.[19] Die Ausgangsfragen lauten:
Welche Funktion hat der öffentliche Gebrauch dieser Begriffe?
Wie unterscheidet sich das wissenschaftliche vom außerwissenschaftlichen Bezugsproblem dieser Begriffe?
Für welches Problem ist der Begriffsgebrauch die Lösung?
Was meint eine funktionalistische Methode? Der Begriff des Funktionalismus hat innerhalb der Sozialwissenschaften eine merkwürdig schlechte Presse, weil ignoriert wird, dass es sich um eine Methode handelt, die sich selbst weiterentwickelt hat. Es ist hier nicht der Ort, dies ausführlich zu entwickeln, aber Andeutungen zum Verständnis der hier angewandten Methode sind doch vonnöten.[20]
Anders als der klassische, aus der Ethnologie stammende Funktionalismus in der Tradition von Alfred Radcliffe-Brown und Bronislaw Malinowski, in dem ein gewissermaßen vorempirisches Bezugsproblem vorausgesetzt wurde, wird Funktionalismus hier modifiziert verstanden. In der klassischen Figur wurden Bezugsprobleme absolut gesetzt (etwa die Erhaltung der normativen Ordnung oder Bedürfnisbefriedigung), während die empirische Beobachtung stets nur die Lösung dieses einen Bezugsproblems im Blick haben konnte. Aus dieser Konstellation ist dann der Vorwurf entstanden, der Funktionalismus unterstelle eine teleologische Struktur. Der Vorwurf wurde auch gegenüber Claude Lévi-Strauss oder Talcott Parsons formuliert und kulminierte bei Anthony Giddens in dem Teleologie-Vorwurf, den er damit zu bekräftigen meinte, man könne soziale Ordnung nur aus intentionalen Handlungen und ihren Nebenfolgen deduzieren.[21] Wie und warum es zu welchen intentionalen Handlungen kommt, bleibt aber im Dunkeln (→ Handeln).
Ausführlich habe ich das etwa als Grundlage einer soziologischen Theorie der Digitalisierung durchgespielt, indem ich nicht fragte, was Digitalisierung sei, sondern welches Problem sie löse. Die Leitfrage lautete: Für welches Problem ist die Digitalisierung eine Lösung?[24]
Solche persistierenden Erscheinungen können auch Begriffe sein. Die in diesem Buch behandelten Begriffe sind Entitäten, die sich gegen eine sich verändernde Umwelt durchsetzen und erhalten – nur deshalb gibt es eine historische Forschungsperspektive auf Begriffe im Sinne von «Begriffsgeschichte».[25] Daraus entsteht die Frage, für welches Problem ein Begriff die Lösung ist. Der Untersuchungsgegenstand ist dann nicht der Begriff als eine ontologische Gegebenheit, sondern sein praktischer Gebrauch in unterschiedlichen Kontexten. Dieses Buch nimmt zwei Kontexte gleichzeitig in den Blick; den, der etwas unpräzise gesellschaftlich genannt wird, sowie den soziologischen Herkunftskontext.
Die einzelnen Lemmata folgen alle diesem Schema, dieser methodischen Kontrolle – unterscheiden sich aber am empirischen Fall, je nachdem, wie unterschiedlich die Lösungen respektive Probleme in ihren jeweiligen Kontexten ausfallen. Gelesen werden können die Texte als je einzelne, für sich stehende Stücke, verbunden durch die gemeinsamen Kriterien der Auswahl und die methodische Form. Das Register am Ende ist kein vollständiges Register, sondern ein Querverweisregister. Hier kommen die Begriffe selbst noch einmal vor, um mit Hilfe dieses Verweissystems auf unterschiedliche Kontexte der jeweiligen Begriffsverwendung an unterschiedlichen Stellen des Buches aufmerksam zu machen.
Haben wir nicht andere Probleme als Begriffe?
Diese Frage könnte durchaus ein legitimer Einwand dagegen sein, sich angesichts der grundlegenden Krisenerfahrungen unserer Zeit nur mit Begriffen zu beschäftigen. Dass die Lebensweise unserer Gattung seit der industriellen Revolution nicht nur extreme Wohlstands-, Pluralitäts-, Freiheits- und Gesundheitsgewinne gebracht hat, sondern auch die eigene Lebensgrundlage gefährdet, ist die vielleicht größte Herausforderung im nun so genannten Anthropozän.[26] Vielleicht werden alsbald die entscheidenden öffentlich wirksamen Begriffe aus den Klima- und Geowissenschaften kommen, aus der Biologie und womöglich der Katastrophenforschung. Aber vielleicht gilt auch exakt das Gegenteil. Denn die Gefährdung unserer Lebensgrundlagen und alles, was an Folgen daran hängt, sind nicht in erster Linie Klimaphänomene, sondern Phänomene, die etwas damit zu tun haben, ob es der modernen Form von Gesellschaftlichkeit gelingen kann, sich auf solche kollektiven Herausforderungen einzustellen. Schon zu wissen, dass auf solche kollektiven Herausforderungen nicht kollektiv reagiert werden kann, weil man Gesellschaft kaum als ein sozial integriertes Kollektiv angemessen beschreiben, aber unangemessen adressieren kann, setzt Arbeit an den Begriffen voraus (→ Gesellschaft; → Kritik).
Und die ökologische Herausforderung ist nur eine unter mehreren – es geht um die Gefährdung des Friedens, um weltweite soziale Ungleichheit, um Migrationsfragen, um Interessenausgleich, um die Gestaltung kalkulierbarer Lebenswelten, auch darum, ob die politische Form der Demokratie und die kulturelle Form des Pluralistisch-Liberalen eine Zukunft haben werden. Es stehen Debatten bevor, die vielleicht mehr als je zuvor auch begriffshygienische Maßnahmen erfordern, damit man weiß, worüber man redet. Es kommt hier aber nicht nur darauf an, worüber man redet, sondern auch wie. Spätestens seit Ludwik Flecks Untersuchung zur Entstehung von Denkstilen aus den 1930er Jahren kann man wissen, dass die Plausibilität von Argumenten und Theorien eine ästhetische, gewissermaßen eine vortheoretische Dimension hat und dass diese mehr erschließt, als man theoretisch womöglich einholen kann. Zur Aufklärung dessen soll hier auch beigetragen werden.[27] Dieses Buch wird dazu nicht die ultimativen Blaupausen liefern – ein solcher Anspruch wäre vermessen. Aber es soll zumindest einen Raum des Nachdenkens eröffnen und zeigen, dass im Begriffsgebrauch Möglichkeiten und Beschränkungen liegen, überhaupt angemessene Problembeschreibungen anfertigen zu können – und wenigstens kontrovers darüber zu diskutieren, dass Beliebigkeit über Begriffe und ihre Verwendung sich einschränken muss, um sprachfähig zu sein angesichts von Problemlagen, die sich erst durch angemessene Beschreibung als diejenigen erweisen, die sie sind. In diesem Buch wird explizit darauf verzichtet, diese drängenden Debatten explizit zu führen. Es nimmt sich aber die Freiheit, die Begrifflichkeit der Begriffe selbst zu begreifen, um sie dann zur Anwendung zu bringen. Auf die Rückholaktion folgt die Wiederauslieferung.
→ Demokratie
If voting changed anything, they’d make it illegal. Dieser oft Kurt Tucholsky zugeschriebene Satz stammt von der amerikanischen Anarchistin und Feministin Emma Goldman (1869–1940). Nun bildet ein solcher Satz aus anarchistischer Perspektive gewissermaßen das gesamte Geschäftsmodell bereits ab. Wenn man auf freie Assoziation im Sinne Proudhons setzt oder im Sinne Kropotkins auf eine dem Menschen bereits inhärente Sozialität, erscheint jegliche intermediäre Form zwischen dem Willen von Mitgliedern eines (vorgestellten) Kollektivs und kollektiv verbindlichen Entscheidungen schon als Abweichung von einem demokratischen Ideal.[1] Das gilt zumindest dann, wenn man den Terminus wirklich beim Wort nimmt: als Herrschaft des Volkes. Wer diese Bezeichnung ernst nimmt, kann die Delegation von Entscheidungsbefugnissen an gewählte Akteure und Strukturen nur für eine uneigentliche Form der politischen Entscheidungsfindung halten.[2]
Spuren solcher anarchistischer Kritik finden sich immer wieder dort, wo Protestbewegungen ihren Unmut gegen politische Entscheidungen zu einer generellen Kritik aufrunden, die Demokratie werde durch falsche Entscheidungen abgeschafft. Die sogenannte Querdenkerbewegung während der Pandemie hat es sogar geschafft, für falsch gehaltenen politischen Entscheidungen Um-zu-Motive zu unterstellen, in dem Sinne, dass etwa Pandemiemaßnahmen explizit darauf zielten, unangemessene Macht auf die Bevölkerung auszuüben und zu testen, was möglich wäre. Man kann daran sehen, dass der performative Gebrauch des Demokratiebegriffs durchaus auch ein Kampfbegriff sein kann, der sich an Inhalten orientiert. Was man selbst will, ist demokratisch, die Gegenauffassung nicht. Demokratie als Begriff changiert zwischen einem deskriptiven Begriff für ein politisches Programm bzw. Verfahren und einem postulierenden normativen Begriff für die eigene Selbstwirksamkeit. Gerade Protestbewegungen berufen sich auf Demokratie, wenn sie die Entscheidungen in demokratischen politischen Verfahren kritisieren.[3] «Demokratie» hat einen appellativen Charakter, so appellativ, dass sich auch Autokratien und Diktaturen gerne demokratisch nennen oder genannt haben.
Begrifflich gesehen, herrscht das Volk in der Demokratie über sich selbst. Demnach ist die Demokratie eine Autokratie. Die Auswanderung der Selbstherrschaft des Volkes in eigens dafür geschaffene politische Institutionen und Verfahren erzeugt die merkwürdige Paradoxie der Demokratie, dass zwischen Herrschern und Beherrschten eine Identität herrschen soll, dass sie zugleich aber nicht dieselben sind. Zwischen den einen und den anderen stehen Wahlen und ein staatliches Organisationsarrangement, das kollektiv verbindliche Entscheidungen ermöglicht, moderiert und mit Macht durchsetzt. Man muss also schon in einem ersten Schritt konzedieren, dass demokratische Wahlen Partizipation sowohl ermöglichen und organisieren als auch deutlich begrenzen. Sie organisieren und moderieren sie, indem zumindest in der repräsentativen Demokratie Wahlakte stattfinden, aber nicht zu Einzelfragen, sondern im Hinblick auf unterschiedliche programmatische Angebote, die üblicherweise durch Parteien repräsentiert werden, deren Differenzen zugleich institutionalisierte politische Konflikte abbilden. In westlichen Industrieländern gab es nach dem Zweiten Weltkrieg die Regel zweier großer Parteien – mitte-rechts und mitte-links orientiert –, die einen Großteil der Wählerstimmen einfingen und in ihrer Differenz zugleich die Richtlinienkompetenz in der Beschreibbarkeit gesellschaftlicher Konflikte und ihrer politischen Entsprechung hatten. Das Sozialistische/Sozialdemokratische war die andere Seite des Christdemokratischen/Konservativen/Bürgerlichen – und daneben entstanden kleine Klientelakteure fürs Nationalistische, fürs Liberale, später für ökologische Belange. Dieses Organisationsarrangement hat nicht auf ein existierendes «Volk» reagiert, sondern gab und gibt dem demos der Demokratie eine zurechnungsfähige und darin intern differenzierte Gestalt – und es bindet Kommunikation schon dadurch, dass eingeführte Grundkonflikte die vielfältig auftretenden Konflikt- und Interessenfragen einfangen und damit zivilisieren können. Das ermöglicht Partizipation weniger dadurch, dass Teile des «Volkes» jeweils abgebildet werden, sondern dadurch, dass jenes «Volk» dadurch entsteht, dass es sich in einer kommunikativen Arena verhandelbarer Konflikte und lösbarer Probleme wiederfindet. Engagierter politischer Bürger zu sein ist dann eine Form der Partizipation. Es ist deshalb kein Zufall, dass das nation building vor allem mit der hoch voraussetzungsreichen Idee einer entstehenden öffentlichen Sphäre der Kommunikation assoziiert wird, einer Sphäre, in der es um so etwas wie gemeinsame Belange geht, die als solche dadurch entstehen, dass sie kommunikativ sichtbar werden und damit aktive Zugehörigkeit ermöglichen.[4]
Dieser inkludierende Mechanismus wird durch beschränkte Partizipationsmöglichkeiten konterkariert. Große Teile der Bevölkerung werden von der unmittelbaren Form der Machtausübung ausgeschlossen und auf die Rollen als Wählerinnen und Wähler und eine mehr oder weniger engagierte Publikumsrolle des politischen Prozesses begrenzt.[5] Die Paradoxie der Identität von Herrschern und Beherrschten wird letztlich dadurch aufgehoben, dass die Rollen dieser beiden Seiten tatsächlich auseinandertreten und die «demokratische» Legitimation dieser Rollendifferenzierung über diese Paradoxie hinweghilft. Insofern changiert der Begriff der Demokratie zwischen einer starken normativen Idee der Partizipation und der gemeinschaftlichen Teilhabe einerseits und einer eher institutionellen Idee der verfahrensförmigen und legitimen Entscheidungsgenerierung andererseits.[6]
In einem ersten Schritt auf der Suche nach dem Bezugsproblem des Begriffsgebrauchs von «Demokratie» stoßen wir also darauf, dass die Demokratie ein Repräsentationsproblem und ein Entscheidungsproblem lösen will oder muss, man könnte auch sagen, ein soziales Problem («wer entscheidet?») und ein sachliches Problem («was wird entschieden?»). Dieses doppelte Bezugsproblem findet sich bereits in den frühen griechischen Quellen über die Demokratie, die diese Spannung zwischen sozialer Beteiligung und Sachkompetenz breit und kontrovers diskutieren. Auf die historische «Erfindung» der Demokratie wird zurückzukommen sein, aber zunächst seien zwei Umwege erlaubt, die sich vom Begriff der Demokratie wegbewegen, aber darauf zurückkommen.
Zwei Umwege
Gemeint sind zunächst die Pariser «ökonomisch-philosophischen Manuskripte» aus den Frühschriften von Karl Marx, in denen er 1844 aus dem Privateigentum die Differenz von Kapital und Arbeit ableitet und daraus als logische Folge die Entfremdung des Menschen von seinen Möglichkeiten.[7] Er schreibt: «Die Arbeit produziert nicht nur Waren; sie produziert sich selbst und den Arbeiter als eine Ware, und zwar in dem Verhältnis, in welchem sie überhaupt Waren produziert.»[8] Weil Arbeit zu einem Kostenfaktor im Produktionsprozess wird und der Kapitalist seinerseits gegenüber Konkurrenten und dem Bodenbesitzer unter Kostendruck steht, verselbständigt sich die Dynamik dieser Produktionsverhältnisse in dem Sinne, dass der Arbeitslohn geradezu von selbst sinken muss und damit knapp kalkuliert ist.[9] Entfremdete Arbeit liege also nicht primär an der Arbeit, sondern an den Bedingungen des Privatbesitzes, die wiederum auf die Arbeit zurückwirken. Nun geht es hier nicht darum, die ökonomischen Analysen des frühen Marx zu würdigen oder sie gar den späteren Analysen gegenüberzustellen, die als «wissenschaftlicher» und weniger polemisch-politisch gelten.[10] Stattdessen kann Marx‘ Utopie des Kommunismus etwas über das mögliche Bezugsproblem der Demokratie lehren, auch wenn Marx überhaupt nicht über die Demokratie als Lösung nachdenkt, im Gegenteil.
Marx stellt sich in den Pariser Manuskripten einen dreistufigen Weg zum Kommunismus vor. In der ersten Phase löst sich der «rohe Kommunist»[11] noch nicht vom Privateigentum, sondern möchte seine Logik auf alle übertragen und bringt damit eher primitive Verhältnisse hervor. In diesem Stadium sei der Kommunismus «nur eine Erscheinungsform von der Niedertracht des Privateigentums, das sich als das positive Gemeinwesen setzen will».[12] In der zweiten Phase dann passt sich der Mensch an die Kritik des Privateigentums an, ist aber «noch von demselben befangen und infiziert. Er hat zwar seinen Begriff erfaßt, aber noch nicht sein Wesen.»[13] Diese Phase ist für Marx «noch politischer Natur, demokratisch oder despotisch».[14] Gemeint ist wohl eine politische Aufhebung des Privateigentums. Die Alternative zwischen Demokratie und Despotie ist für Marx gar keine wirkliche Alternative, weil beide nur die staatliche Organisation der Verteilung meinen und letztlich zwischen Gemein- und Privateigentum changieren. Es dürfte diese Kritik am demokratischen Despotismus sein, die die ökonomisch-philosophischen Manuskripte für die realsozialistischen Regime eher unattraktiv machten, deren eigene Despotie unverkennbar war und die die eine Entfremdung nur durch eine andere ersetzten. Diese konnten genau genommen nicht einmal richtige Marxisten sein – und nicht ohne Grund nannten sie ihren Despotismus meistens demokratisch. Erst die dritte Stufe hebt das Privateigentum auf. Die Überwindung des Despotismus (die auch die Überwindung der bürgerlichen Demokratie wäre[15]) sei erreicht, wenn der Kommunismus eine freie Assoziation der Menschen darstelle, in der die Freiheit der Menschen einvernehmlich ermöglicht wird. Marx schreibt: «Dieser Kommunismus ist als vollendeter Naturalismus Humanismus, als vollendeter Humanismus Naturalismus, er ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreites zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen, die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbestätigung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung.»[16] Zwischen Individuum und Gattung und zwischen Freiheit und Notwendigkeit zu vermitteln, wie Marx es formuliert, beschreibt eine Utopie, die gerade die Folgen der gesellschaftlichen Interessen- und Besitzdifferenzen aufzuheben trachtet. Es geht letztlich darum, das Wollen und Sollen der Einzelnen zusammenzubringen und damit auch die internen Differenzen der Gesellschaft aufzuheben. «Es ist vor allem zu vermeiden, die ‹Gesellschaft› wieder als Abstraktion dem Individuum gegenüber zu fixieren. Das Individuum ist das gesellschaftliche Wesen. Seine Lebensäußerung – erscheine sie auch nicht in der unmittelbaren Form einer gemeinschaftlichen, mit andern zugleich vollbrachten Lebensäußerung – ist daher eine Äußerung und Bestätigung des gesellschaftlichen Lebens.»[17] Die Utopie besteht in der Aufhebung aller Entzweiungen, aller Widersprüche, aller Differenzen in einer Form, in der die Gattung und das Individuum keine Schnittstellen mehr kennt.
Was hat all das nun mit der Demokratie zu tun? Man kann die Pariser Manuskripte als eine romantische Utopie abtun, als eine Art Verschmelzungsfantasie, gewissermaßen eine antigesellschaftliche Gesellschaftstheorie, die spätestens der Marx des «Kapitals» weit hinter sich gelassen haben wird. Und man kann auch darauf hinweisen, dass die historische Logik, die Marx hier beschreibt, historisch in jenem «Despotismus» stecken geblieben ist, der sich dann realpolitisch demokratisierte und die Folgen des Privateigentums allenfalls entschärfen oder durch Umverteilung mäßigen konnte – so würde man wohl im Anschluss an Marx formulieren.
Vor allem zeigt der Umweg über die Marxsche Utopie aber sehr deutlich, worauf das Problem der Demokratie als politischem Programm am Ende hinausläuft: auf die Befriedung von unterschiedlichen Perspektiven, Interessen und Aspirationen innerhalb eines kollektiv verbindlichen Rahmens, den man Politik nennen kann. Worauf Marx nämlich in seiner unrealistischen Utopie abzielt, ist die Frage der Versöhnung jenes Unterschiedlichen, das man als das Grundproblem des Gesellschaftlichen ansehen kann: die Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem (→ Gesellschaft). Das Bezugsproblem, das Marx’ historische Stufentheorie des Kommunismus offensichtlich hat, ist die Frage, wie sich eine Kollektivität denken lässt, die mit unterschiedlichen Perspektiven umgeht. Bemerkenswert an der Utopie der Pariser Manuskripte ist, dass die Menschen in einer gewissen Generationenfolge die Erinnerung an das Privateigentum erst vergessen müssen, um es zu überwinden – offensichtlich reichen hier Überzeugung und ein gutes Argument nicht aus, damit die Gesellschaft sich als Gesellschaft des Privateigentums überwinden kann, damit das gesellschaftliche Wesen des Menschen zu sich selbst kommt.
Und dieses gesellschaftliche Wesen komme erst dann zu sich selbst, wenn die freie Assoziation der Menschen nicht durch Differenzierung, durch Ungleichheit, nicht einmal durch Interessendifferenzen durchbrochen wird. Es wäre tatsächlich die radikalisierte Idee einer Demokratie als Lebensform, die den Staat nicht braucht, die aber wohl an der Gesellschaftlichkeit der Gesellschaft scheitert. Marx wäre dann derjenige Autor, dem das sozialwissenschaftliche Denken mit am stärksten die Einsicht verdankt, wie sehr das Handeln der Menschen durch ihre Gesellschaftlichkeit geprägt ist, zugleich aber eben auch derjenige, der die Gesellschaftlichkeit des Menschen fast aufheben muss, um die Gesellschaft auf die freie Assoziation zu bauen. Dass individuelle Interessen dafür zugunsten kollektiver Anforderungen eingeschränkt werden müssen, macht wahrscheinlich die Tragik dieses Denkens aus, das am Ende das Gegenteil dessen erzeugt, was Marx im Sinn hat: Zentralität als Form und eine autoritäre Notwendigkeit, Differenzen aufzuheben. Die Lösung des Problems des Umgangs mit unterschiedlichen Positionen liegt dann in der Eliminierung unterschiedlicher Positionen. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass Demokratie bisweilen eher mit Konsens als mit Konflikt, mit Einigkeit statt Umgang mit unterschiedlichen Positionen und Interessen verwechselt wird.
Der Umweg zeigt, wie voraussetzungsreich es ist, an kollektiv verbindliche Übereinkünfte zu kommen, wenn innerhalb dieses Kollektivs unterschiedliche Perspektiven vorkommen, die einander ausschließen, und das im existentiellen Sinne einer durch gesellschaftliche Arbeit und Produktionsverhältnisse determinierten Weise. Marx löst das Problem darin auf, die gesellschaftlichen Differenzen aufzuheben – seine Utopie will die Gesellschaft gewissermaßen loswerden (was natürlich historisch gesehen keine korrekte Formulierung ist). Wenn man sie erst loswerden muss, um sie zu retten, muss das Problem tatsächlich radikal sein. Und es sollte nun deutlich geworden sein, dass es sich lohnt, bei einer Bestimmung des Demokratiebegriffs nicht wie üblich mit den griechischen Vorlagen zu beginnen, sondern mit dieser modernen Utopie, die am Ende nur so gelesen werden kann, dass die Demokratie letztlich nicht als gesellschaftliches Prinzip taugen kann. Ob die einzige Alternative dazu der Despotismus sein kann, den Marx als zweite Stufe auf dem Weg zum Kommunismus bestimmt und der als real existiert habender Sozialismus historische Wirklichkeit geworden ist, sei dahingestellt. Aber was Marx offensichtlich gesehen hat, ist das Grundproblem, dass eine moderne Gesellschaft mehr Differenz erzeugt, als es die Idee der kollektiven Willensbildung vertragen kann.
Moderner formuliert laboriert Marx an der Komplexität einer Klassengesellschaft, in der die Handlungen der Menschen eben keine freie Assoziation bedeuten, sondern Ausdruck jener Klassenzugehörigkeit sind, die ihnen gar keine Wahl lässt, etwas anderes zu tun, als es dem gesellschaftlichen Differenzierungsschema entspricht. Vier Jahre nach den Pariser Manuskripten, also 1848, erschien das «Manifest der kommunistischen Partei», in dem Marx und Engels die bürgerliche Gesellschaft als eine Gesellschaft von Umwälzungen und Komplexitätssteigerungen beschreiben: «Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen anderen aus.»[18] Diese Komplexitätssteigerungen erzeugen Handlungsnotwendigkeiten für die Angehörigen unterschiedlicher Klassen, die übrigens auch den bürgerlichen Klassen als Klassenschicksal erscheinen muss und genau genommen auch als eine Entfremdung von einer freien Vergesellschaftung, die erst so etwas wie eine nicht-entfremdete Form des Interessenausgleichs ermöglichen würde. Die Bedingung dafür wäre eine Freiheit (→ Freiheit) und Gleichheit (→ Gleichheit/Ungleichheit), die aber von der Komplexität der modernen Gesellschaft (→ Gesellschaft) ausgeschlossen wird.
Und dies ist nun der Link zur griechischen Vorlage des Demokratiebegriffs, der den Umweg rechtfertigt und einen zweiten einleitet: Wäre Demokratie das Ziel der Marxschen Bemühungen, also freie Vergesellschaftung, in der tatsächlich der Demos herrscht, nicht einfach das Proletariat diktiert, wie in der zweiten historischen, der despotischen Stufe des Kommunismus, dann würde Demokratie die Freiheit und Gleichheit nicht herstellen, sondern voraussetzen. Genau diese Denkfigur ist es, die etwa in Platons Politeia eine gewisse Skepsis an der Demokratie aufscheinen lässt, denn die Demokratie mache aus den Ungleichen Gleiche in der Hinsicht,[19] dass sie alle die Freiheit eigener Interessen entdecken.[20] Die Gefahr der Demokratie liege dann darin, dass sich aus den Einzelwillen gerade keine Gemeinschaftlichkeit forme, sondern eher das Gegenteil: «So kommt denn natürlicherweise die Tyrannei aus keiner andern Staatsverfassung zustande als aus der Demokratie, aus der übertriebensten Freiheit die strengste und wildeste Knechtschaft.»[21] Die Demokratie vermag nach diesem Verständnis keine kollektiv verbindlichen Entscheidungen zu treffen. Deshalb führte Aristoteles eine ökonomische Dimension ein und meinte, die vernünftigsten Bürger seien ökonomisch die Mittleren: «Die Polis will aus möglichst Gleichen und Ähnlichen bestehen, und dies ist am meisten bei den Mittleren der Fall. Daher wird notwendig die Polis am besten regiert, die aus solchen besteht.»[22] Auch Aristoteles misstraut dem bloßen Mehrheitsprinzip der Demokratie und schlägt als eine Art Mischform mit der Aristokratie eine Regierungsform vor, in der «die besten regieren»[23].
All das bedeutet, dass nicht die Demokratie Gleichheit und Freiheit herstellt, sondern dass diese vorausgesetzt sein müssen, damit Demokratie nicht in Despotie umschlägt. Dass Gleichheit und Freiheit betont werden, hat für Aristoteles nicht nur soziale Gründe, im Sinne von Gerechtigkeit oder sozialer Partizipation, sondern vor allem sachliche Gründe: Er sieht das Bezugsproblem des Regierens darin, wie sachadäquate Lösungen hervorgebracht werden können, ohne dass diese durch die Eigeninteressen der handelnden Personen korrumpiert werden. Die Aristotelische Politie[24] setzt bereits eine Bürgerschaft voraus, die sich dem Gemeinwohl gewissermaßen von selbst verpflichtet fühlt, ähnlich wie Marx erst dann die wahrhafte Auflösung des Widerstreits zwischen den Menschen für möglich hält, wenn diese das Privateigentum und damit das egoistische Interesse historisch vergessen haben. Beide, Aristoteles und Marx, nennen die Lösung der Demokratie nicht einmal Demokratie, weil sie sehen, dass die Aufrundung der Individualinteressen mit dem Prinzip der bloßen Mehrheitsfindung vor der Gefahr des Despotismus steht, ähnlich wie Alexis de Tocqueville dies als Gefahr einer «Tyrannei der Mehrheit»[25] gebrandmarkt hat.
Die beiden Umwege noch einmal zusammengefasst: An Marx’ Pariser Manuskripten lässt sich ablesen, dass sich die Widersprüche der Gesellschaft, bei ihm repräsentiert in der Frage des Privateigentums, nicht durch die Illusion einer Einheit auflösen lassen, zumindest wenn man den historischen Stand der Komplexität der Gesellschaft nicht zurückbauen will. Marx’ Konsequenz wäre die Notwendigkeit, die Widersprüche und die Komplexität der Gesellschaft zu «vergessen», um mit ihr zurande zu kommen. Das ruft die Utopie einer demokratischen Gesellschaft auf, die dann in sich selbst jene Komplexität wieder auffinden würde, die die Demokratie durch die Ausdifferenzierung eines politischen Systems bearbeitet. Insofern dürfte die Demokratie davon profitieren, dass sie nur ein politisches Programm ist und kein gesellschaftliches – aber nur mit der Demokratie dürften in den anderen Funktionssystemen genug Entscheidungsalternativen vorgehalten werden können, um mit der Komplexität der Gesellschaft umzugehen.
Aristoteles dagegen erweist sich womöglich als der modernere Demokratietheoretiker, weil seine Politie die beiden Seiten der sozialen Anschlussfähigkeit und der Sachkompetenz und Komplexitätsbewältigung verbindet. Dass er das meiste den «Mittleren» zutraut, ist ein Hinweis darauf, dass das Problem der Bewältigung sozialer Ungleichheit als Sachproblem womöglich die größte Herausforderung für die politische Demokratie ist. Es entfaltet eine gewisse Ironie, dass ausgerechnet diese aus Marx’ Sicht aus einer Sklavenhaltergesellschaft stammende Demokratietheorie in der Beschränkung der Demokratie einen entscheidenden Hinweis auf die Gefahr des ökonomischen Egoismus für die Demokratie enthält.
Aber ist der Weg über die Politikbücher Platons und Aristoteles’ überhaupt ein Umweg? Nein, denn in ihnen wird genau die Spannung deutlich, in der eine aktuelle Begriffsbestimmung von Demokratie sich bewegt. Man könnte es als die Spannung zwischen Demokratie als «Lebensform» und Demokratie als Programmformel für die Entscheidungsformen des politischen Systems bezeichnen. Im ersten Sinne wird die gesamte Gesellschaft demokratisch, kulminiert in der Forderung, dass sich die Gesellschaft mittels «Solidarität» in einer «kooperativen, performativen und transformativen»[26] Praxis nicht einfach auf eine «Regierungs-, sondern eine Lebensform»[27] stützt. Diese Forderung ist nicht falsch, aber sie muss gewissermaßen eine gute Gesellschaft voraussetzen, damit der politische Entscheidungsprozess zu angemessenen Lösungen kommt – dieser muss gewissermaßen die individuellen Interessen «vergessen» (das meint Solidarität), und er muss die Gemeinwohlorientierung bereits voraussetzen. So verstandene Demokratie muss das, was sie erreichen will, voraussetzen. Das logische Problem ähnelt den späteren Vertragstheorien, wie sie bei Thomas Hobbes[28] im 17. Jahrhundert oder bei Jean Jacques Rousseau[29] im 18. Jahrhundert auftraten (→ Gesellschaft).[30] Hegel kritisierte an Hobbes, dass ein Gesellschaftsvertrag nicht wie ein privatrechtlicher Vertrag verstanden werden darf, sondern gerade jene Allgemeinheit des Staates immer schon voraussetzen müsse, die durch ihn erst hervorgebracht werden soll.[31]
Demokratische Gesellschaft oder demokratische Politik?
Wer Demokratie verstehen will, muss die Lebensform immer mit dem zweiten Verständnis des Demokratischen zusammendenken, nämlich mit seiner politisch-administrativen und damit staatlichen Seite. Der Gebrauch des Demokratiebegriffs in öffentlichen Debatten stellt meistens auf beide Seiten ab, einerseits auf den Aspekt einer Lebensform, andererseits auf die Regierungsform. In öffentlichen Debatten wird Demokratie in vier idealtypischen Fällen eingefordert:
wenn darauf beharrt wird, dass alle Seiten, alle Meinungen und Auffassungen zu hören sind und dass die Pluralität der Gesellschaft abzubilden sei;
wenn auch marginalisierte Positionen zu ihrem Recht kommen sollen;
wenn auf das Gefühl der Selbstwirksamkeit in «gesellschaftlichen» Debatten hingewiesen wird;
wenn auf Verfahren der demokratischen politischen Entscheidungsfindung Bezug genommen wird.
Diese Fragen sind die klassischen Fragen der politikwissenschaftlichen «Demokratietheorie», die sich sowohl mit den empirischen Bedingungen demokratischer Verfahren als auch mit der normativen Dimension der Legitimation, der Repräsentation und der Bedingungen für Deliberation beschäftigen.[32] Demokratietheorien, vor allem in ihrer normativen Variante, sind so etwas wie Reflexionstheorien des Politischen selbst, weil sie den internen Prozess abbilden, wie sich das politische System einen Reim auf sich selbst macht. Es geht vor allem um Legitimationsfragen und am Ende um die Frage in der Sozialdimension, ob tatsächlich so etwas wie ein Volkswille identifizierbar ist, ein Wille eines Demos, der dann durch Verfahren bestimmt wird und die Grundlage für Entscheidungen darstellt.
Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Opposition zu.[33] Ämter sind in Demokratien Ämter auf Zeit – und deshalb ist nicht das Wählen der entscheidende Akt der Demokratie, sondern das Abwählen. Damit aber jemand abgewählt werden kann, muss innerhalb des politischen Systems eine Opposition etabliert werden, die im Falle der Abwahl gewählt ist – und die mit den entsprechenden Mitteln und Kompetenzen, mit einem angemessenen semantischen Vorrat und Programm, mit Personal und ansprechbaren Zielgruppen ausgestattet ist. Man kann freilich keine Landesverräter, keine abtrünnigen Untertanen ins Amt wählen, also nicht die, die man zuvor noch politisch verfolgt hat. Kritik an der Regierung ist keine Abweichung mehr, sondern wird in das politische System hineingeholt. Man hat die opponierende Seite als legitimen Teil des politischen Systems anzusehen begonnen. Aus zuvor fehlgeleiteten und illoyalen Untertanen wurde deshalb, wie es im Viktorianischen England in einer schönen Formulierung heißt, Her Majesty’s Loyal Opposition.[34] Die Einheit des politischen Streits wird damit in der postabsolutistischen konstitutionellen Monarchie und in parlamentarisch-demokratischen Republiken nicht durch Versöhnung der Positionen, sondern durch Fokussierung auf ein politisches Zentrum ermöglicht, das immer schon gespalten ist. Demokratische Politik operiert mit einer Doppelspitze, deren beide Seiten von eigenem Recht sind.[35]
Von Demokratie kann erst gesprochen werden, wenn der Herrscher abgewählt werden kann. Für Monarchen bleibt mehr noch als in der alten Welt nur die Existenz als Körper übrig, nun nicht mehr als doppelcodierter Körper zwischen natürlicher und übernatürlicher Existenz im Zentrum der Macht,[36] sondern als performatives Symbol für die Einheit des politischen Systems oder als abgebildeter Körper in der Boulevardpresse.[37]
Wenn das Argument stimmt, dass die Abwahl bzw. ihre Möglichkeit das besondere Charakteristikum der Demokratie ist, dann lässt sich daraus schließen, dass es in erster Linie die andere Seite der Regierung ist, die den demokratischen Herrscher zum Demokraten macht. Der positive Wert der Demokratie ist die Opposition, nicht die Regierung. Regierungen gibt es überall. Man kann fast sagen: Regieren ist trivial, wenn man die Macht hat. Herrschaft ist dann ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Herrschern und Beherrschten. Nicht trivial ist die Institutionalisierung von Opposition, was nichts an der Asymmetrie einer Herrschaftsbeziehung ändert, was aber die Frage, wer herrscht und wie geherrscht wird, selbst zum Gegenstand des politischen Prozesses macht. Wenn also Herrschaft selbst zum Thema wird, sind Wahlen dasjenige Scharnier, das die politischen Beobachter dazu zwingt, Herrschaft zu beobachten – und eine Abwahl zu erwägen.
Die demokratietheoretischen Forderungen an die Demokratie thematisieren vor allem ein Problem in der Sozialdimension: wie sich alle Gruppen eines (Wahl-)Volkes in den Institutionen des politischen Systems repräsentiert und abgebildet fühlen können. Dieser Gedanke kann zweierlei bedeuten: Er könnte von der Existenz eines Volkes ausgehen, das in seiner internen Differenziertheit eine parallel differenzierte Form der Repräsentation in den Parlamenten wiederfindet. Er könnte aber auch bedeuten, dass erst die politisch institutionalisierten Konflikte ein Spektrum erzeugen, innerhalb dessen sich die Grundgesamtheit des politischen Volkes wiederfindet bzw. wiederfinden soll. In Zeiten, in denen es gelungen ist, zentrale gesellschaftliche Konflikte zur Grundlage der politischen Auseinandersetzung zu machen, ist Repräsentation wahrscheinlicher als in Zeiten, in denen sich die Dinge nicht so sichtbar ordnen. Der Klassiker dazu ist sicher Ralf Dahrendorfs Der moderne soziale Konflikt von 1992. Dahrendorf entwickelt die These, dass sich politische Konflikte um die Achsen der Bürgerrechte, der Rechte um ökonomische Teilhabe und um eher fordernde und eher saturierte Gruppen herum ordnen, für die es dann politische Gestalten in Form von politischen Bewegungen und Parteien gibt.[38] Für Dahrendorf geht es darum, dass die Voraussetzungen der Demokratie tatsächlich nicht nur in den staatlich-politischen Verfahren zu finden sind, sondern als gesellschaftliche Voraussetzungen gedacht werden müssen, zu denen eben auch kulturelle und vor allem ökonomische Formen des Konflikts und damit auch der Teilhabe gehören.[39] Dahrendorfs Konflikttheorie zeigt sehr deutlich den integrativen Aspekt von Konflikten: Ein institutionalisierter Konflikt integriert, indem er die Konfliktparteien auf ein Konfliktschema verpflichtet und damit Ordnung in der Differenz schafft (→ Konflikt).[40]
In den meisten westlichen Industrieländern hatten große Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Parteien eine integrative Funktion, deren Sog für eine vollständige Repräsentation sorgte, so dass eine Diversifikation solcher Angebote als krisenhaft erscheinen muss. Demokratietheoretisch gesehen sollte es so aussehen, als minimiere ein möglichst diverses Angebot an politischen Alternativen die Wahrscheinlichkeit von Repräsentationslücken. Aber es ist offensichtlich nicht die Frage der vollständigen Repräsentation einer bestehenden Grundgesamtheit, sondern eine Eigenleistung des politischen Systems, im Antagonismus politischer Angebote, Konflikte so zu strukturieren, dass sie Drittes weitgehend ausschließen oder in ihren Sog hineinziehen können – unter den Unterscheidungen einer eher rechten und eher linken Politik, einer eher angebots- oder nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik und eher «progressiven» oder konservativen Wertorientierungen lässt sich alles abbilden – alles in dem Sinne, dass diese Unterscheidungen alles andere absorbieren. Die Differenzierung des politischen Publikums durch politische semantische Angebote ist tatsächlich eine Eigenleistung des politischen Systems, das solche Unterscheidungen nicht vorfindet, sondern unter Mühe herstellen muss. Und je genauer sich Sachkonflikte als soziale Konflikte abbilden lassen, desto übersichtlicher ist der politische Prozess. Die klassischen Konflikte der Industriegesellschaft haben es geschafft, politische Sachangebote und Lösungen, Programme und Problemformulierungen parallel zu sozialen Gruppen zu sortieren.
Passen Lösungen zu den Problemen?
Der berühmte Satz von Wolfgang Böckenförde über die Voraussetzungen des Staates argumentiert zwar nicht konflikttheoretisch, adressiert aber das Problem der Bindekräfte in einem heterogenen Raum. Er lautet: «So stellt sich die Frage nach den bindenden Kräften von neuem und in ihrem eigentlichen Kern: der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.»[41] Böckenförde und die daran anschließende Diskussion beschäftigt sich vor allem mit den kulturellen Voraussetzungen.[42] Der säkularisierte Staat ist eben säkular und kann nicht weiter auf religiöse Bindekräfte zugreifen, muss sich also ein anderes Band erschaffen – eines dieser Bande könnte die Demokratie sein, nun verstanden in dem Sinne einer vorpolitischen oder vorstaatlichen Idee eines Diskurses, der Differenzen aushält, Pluralität ermöglicht und Konflikte zivilisiert austrägt. Demokratie und Demokratien müssen mit unterschiedlichen Differenzkategorien umgehen: mit Klassenbildung, Schichtung und sozialer Ungleichheit, mit unterschiedlichen kulturellen und sozialmoralischen Milieus, mit divergierenden Interessen und nicht zuletzt mit unterschiedlichen Konzepten der Problemlösung. Es geht also um mehr als um die kulturelle Integration – gewissermaßen als funktionales Äquivalent für frühere, v.a. religiös und ständisch imprägnierte Weltbilder. Diese sind für moderne komplexe Gesellschaften nicht mehr möglich – ihr funktionales Äquivalent ist deshalb die politische Gemeinschaft. Die Funktion des politischen Systems in einer ausdifferenzierten modernen Gesellschaft ist nicht nur die Herstellung kollektiv bindender Entscheidungen, sondern auch die Herstellung zurechenbarer Kollektive, zurechenbar für die Geltung und Legitimierung politischer Entscheidungen. Es geht schlicht darum, das «Volk» überhaupt als Adresse zu etablieren, als Deutsche, als Franzosen, als Dänen oder Polen, und damit zugleich zu demonstrieren, wer nicht angesprochen wird bzw. wer außen steht.[43] Insofern ist die historische Parallele von Nationalstaat und Demokratie als politischer Form kein Zufall.
Die Nation als imagined community[44] war gewissermaßen der gesellschaftliche Ausdruck für die Gleichheitszumutung und das Gleichheitsversprechen des modernen Rechts und des Staatsbürgerstatus, das einen Widerspruch zu sozialen Ungleichheiten ökonomischer, kultureller und schichtspezifischer Natur darstellte. Die Nation war ein Versprechen von Gleichheitszumutungen und Gemeinschaftserwartungen, nicht generell, sondern in bestimmten Hinsichten. Diese Kollektivfigur war das funktionale Äquivalent für das, was der säkulare Staat nicht garantieren kann, aber politisch erzeugen muss. Deshalb kam es stets zu Übersteigerungen dieser vorgestellten Gemeinschaften im Nationalismus als Ersatzreligion,[45] im Faschismus, aber auch in realsozialistischen Regimen, die ihrerseits in den meisten Fällen trotz aller internationalistischen Rhetorik mit nationalistischen Konnotationen versehen waren.[46] Diese Übersteigerungen waren kein historischer Rückfall hinter Modernitätsstandards, sondern ganz im Gegenteil Modernisierungsfolgen mit einer bisweilen religiösen Form von Glaubensgemeinschaften, die den Aspekt der Gleichheit und Zugehörigkeit vor die Ungleichheiten und Differenzierungen des Gesellschaftlichen schoben.[47]
Es gehört zur Tragik der Geschichte der Demokratie, dass sie einerseits historisch darauf angewiesen ist, das Gleichheitsversprechen der Moderne in Anspruch zu nehmen (→ Gleichheit/Ungleichheit),[48] andererseits aber in ihren Gemeinschaftsideologien exakt an diesem Gleichheitsmechanismus der Zugehörigkeit ansetzt und ihm einen totalen Sinnüberschuss gibt – mit starken Abgrenzungen nach außen und der Verzerrungen von Ungleichheiten nach innen.
Interessanterweise operiert die Kritik an nationalen und faschistischen Formen des Politischen mit gewissermaßen sublimierten Formen von Kollektivitäten, die den Sinnüberschuss des Gemeinschaftlichen mit einem Sinnüberschuss des Rechts kompensieren wollen – man denke etwa an das Konzept des Verfassungspatriotismus, das ebenfalls an der Herstellung einer zurechenbaren Kollektivität ansetzt.[49] Solche Versuche der Zivilisierung von Kollektivadressen haben auch im Blick, die Gleichheitsangebote von kollektivistischen Ideologien ethnischer, nationaler und bisweilen auch religiös-konfessioneller Natur sowohl zu entdramatisieren als auch zu pluralisieren.
Demokratie ist gewissermaßen die postheroische Lösung dafür, Zugehörigkeiten trotz Verschiedenheit, kollektiv bindende politische Entscheidungen trotz innerer Pluralität und Partikularinteressen zu ermöglichen. Das Medium dafür sollte Kommunikation und Diskurs sein, die die konfligierenden Parteien verbinden und als Horizont das Austragen von Konflikten ermöglichen.[50] Kombiniert mit dem Umstand, dass die politischen Parteien und Programme komplementär gebaut waren, lösen demokratische Öffentlichkeiten und Verfahren das Problem der Adressierbarkeit der Gesellschaft in der Sozialdimension. Daraus entsteht dann die Konjunktur der Repräsentationsfrage – Werden alle Gruppen der Gesellschaft politisch angemessen «abgebildet»? – und der Frage nach den angemessenen Lösungen, die gerade aufgrund der komplementären Parteigestalten auf einige sich ergänzende Alternativen eingeschränkt sind. Wie oben schon formuliert: In einer eingeführten Unterscheidung kann alles abgebildet werden, aber eben nur innerhalb dieser Unterscheidung. Alles Dritte hat es schwer im Kampf um Aufmerksamkeit und Realisierbarkeit, schon weil es die eingeführten Konfliktlinien in Gefahr bringen würde (→ Konflikt).
Diese demokratische Integrationsfähigkeit gerät spätestens dann in Gefahr, wenn sich die Ergebnisse politischer Entscheidungen nicht in dem integrierenden Konflikt zwischen den Parteien wiederfinden. Als «Krise der Demokratie» wird unter anderem die Erfahrung diskutiert, dass sich Probleme und Problemlösungen nicht dem politischen Schema integrierender Konflikte fügen.[51] Man kann das im europäischen Parteiensystem deutlich beobachten: Es entstehen neue Parteien, die Parteibindung nimmt ab, Wechselwahlen werden wahrscheinlicher, populistische Parteien entstehen, und zugleich geraten Verfahren unter Druck, die selbst das Ergebnis integrierter und integrierender Konflikte sind und dadurch Legitimation spenden können (→ Populismus).[52] Es sind in Krisen vor allem die Angriffe auf die Verfahren selbst, die zeigen, wie integrativ stabile Konflikte sind und wie desintegrativ die Aufkündigung der entsprechenden Verfahren ist – das paradigmatische Beispiel dafür ist sicherlich die Regierungszeit von Donald Trump und das Chaos der Regierungsübergabe nach seiner Abwahl 2021. Der Lackmustest für die Demokratie besteht wohl darin, ob solche Parteien/Bewegungen auch wieder abwählbar sind, im Fall von Trump und Bolsonaro in Brasilien im Oktober 2022 wurde dies sorgenvoll beobachtet.