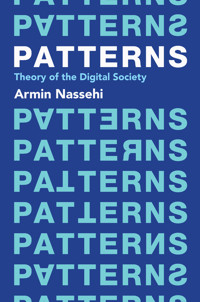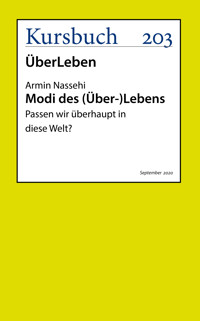12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Über Transformation wird zumeist mit großer Geste und noch größerer Betroffenheit gesprochen. Ob es um die Bekämpfung des Klimawandels, den Umbau von Staat und Wirtschaft oder die Frage nach der Beendigung von Kriegen geht: Von der Dringlichkeit wird auf die Möglichkeit und Zustimmungsfähigkeit geschlossen, oft mit mahnendem Blick. In Vergessenheit gerät dabei, dass alle Transformation in einer Welt stattfinden muss, die bereits da ist und mit ihren eigenen Mitteln darauf reagiert, unter anderem mit populistischen Gefährdungen der Demokratie. Armin Nassehi fragt in seiner deutlichen Intervention, was jenseits der großen Geste zu finden ist: eine Gesellschaft, die anders über Transformation nachdenken muss und am Ende von der Logik kleiner Schritte profitieren wird. Multiple Krisenerfahrung bedeutet: Viele Bedingungen unserer Lebensweise der letzten Jahrzehnte sind fragwürdig geworden, ihre Verletzlichkeit und ihre Voraussetzungen werden immer sichtbarer. Das erzeugt allerorts einen Ruf nach rascher, möglichst umfassender Transformation. Denn: Eine andere Welt sei möglich, wir müssten sie nur wollen. Aber dieser Triumph des Willens rechnet nicht mit dem Eigensinn, mit der inneren Komplexität und den Widerständen einer Gesellschaft, die eben kein ansprechbares Kollektiv ist. Und sie rechnet nicht mit der populistischen Reaktion auf Krisenerfahrungen. Dabei wird immer deutlicher: Man kann nicht gegen die Gesellschaft transformieren, sondern nur in ihr und mit ihr – und nur mit ihren eigenen Mitteln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Armin Nassehi
Kritik der großen Geste
Anders über die gesellschaftliche Transformation nachdenken
C.H.BECK
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Textbeginn
Inhaltsverzeichnis
Titel
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
0: Incipit Oder: Eine Verwunderung
1: Gegenwarten Oder: Warum spielen alle ihre Rollen?
2: Multiple Krisen Oder: Drohende Visibilisierungserfahrungen
3: Kollektive Herausforderungen Oder: Warum das Gemeinsame eine Illusion ist
4: Von weißen Blättern und Zinnsoldaten Oder: Warum tun sie nicht, was sie sollen?
5: Kapitalismuskritik als Selbstberuhigung Oder: Das Maß der Maßlosigkeit
6: Vertikale versus horizontale Ordnungen Oder: Woher die Unübersichtlichkeit?
7: Exkurs: Das Problem der Textförmigkeit Oder: Warum man das alles kaum beschreiben kann und wie die Polyphonie uns rettet
8: Zielkonflikte Oder: Warum Einigkeit das Schlimmste wäre
9: Ein eklatanter Fehlschluss Oder: Warum der Selbstbetrug nur den anderen nützt
10: Träge Arrangements Oder: Unhintergehbare Verstrickungen
11: Konservative Bezugsprobleme Oder: Warum mit starker Schwäche gerechnet werden muss
12: Was- versus Wer-Fragen Oder: Worüber streiten wir da?
13: Kompetente Politik Oder: Neue Konflikte, bitte!
14: Steuerung und Transformation Oder: Warum die Begriffe versagen
15: Und nun? Oder: Die Stärke kleiner Schritte
16: Coda: Die Moral von der Geschichte
Zum Buch
Vita
Impressum
Vorwort
«Transformation» – das ist ein veritabler Stimmungskiller, eine Drohung, ein Menetekel, aber auch ein Programm, eine Verheißung, eine manchmal fast eschatologische Kategorie, die auf Rettung zielt, auf Erlösung, gar auf existentielle Herausforderungen. In der Forderung nach Transformation schwingt einerseits etwas von unvermeidlicher Veränderung mit, andererseits hört es sich an wie ein Programm. Es ist die Spannung zwischen passivischer und aktivischer Form: Werden wir transformiert, oder transformieren wir? Jedenfalls ist Transformation der Anlass für die große Geste und für die verpflichtende Rede, die gerne manchmal etwas Pastorales hat – und wie alles Pastorale auch Abwehr erzeugt, vor allem bei den Ungläubigen.
Dieses Buch misstraut der großen Geste und schickt sich deshalb an, wenn überhaupt, anders über Transformation nachzudenken. Anders heißt nicht: eine andere große Geste, sondern eher, über den Eigensinn jener Gesellschaft nachzudenken, in der etwas stattfinden soll, was Transformation genannt wird. Alles, was transformiert, gesteuert, verändert, verbessert werden soll, reagiert auf entsprechende Versuche und Eingriffe mit seinen eigenen Mitteln. Um diese Mittel soll es hier gehen. Das Buch bietet keine Lösungen für Krisen an und nimmt keine explizite politische Position dazu ein, sondern fragt danach, in was für einer Welt solches stattfindet.
Zu schreiben begonnen habe ich das Buch im Spätsommer 2023 in einem ehemaligen Klosterhof in der Nähe von Lucca in der Toscana, fertiggestellt wurde das Manuskript am Dreikönigstag des Jahres 2024. Die barrierefreie Form des Textes ohne wissenschaftlichen Apparat soll das Lesen erleichtern – und es sollte zugleich leichter zu schreiben sein. Im Idealfall sollte man das dem Text ansehen.
Viele Gedanken des Buches habe ich in Vorträgen vor sehr unterschiedlichen Publika entwickelt und an meiner eigenen Sprachperformance und an den Reaktionen des Publikums darauf getestet. Sehr früh war wie stets Irmhild Saake in die Konzeption des gesamten Projekts einbezogen, und sie hat unterschiedliche Versionen mitgelesen. Ich bin ihr sehr dankbar für diese Zusammenarbeit.
Den gesamten Text haben nach Fertigstellung des Manuskripts mehrere Personen gelesen. Ihnen verdanke ich wertvolle Hinweise, nicht nur inhaltlicher Natur, sondern auch im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit des Arguments. Im Einzelnen waren das Niklas Barth, Juliane Engel, Lena Göbl, Claudia Salowski und Peter Unfried. Ihnen sei herzlich gedankt.
Dem Verlag C.H.Beck danke ich für die erneut sehr gute Zusammenarbeit bei dem nunmehr vierten gemeinsamen Buchprojekt. Zu der guten Zusammenarbeit gehört auch das kompetente Lektorat von Matthias Hansl.
München, im Februar 2024
0
Incipit Oder: Eine Verwunderung
Auch an multiple Krisen, an Transformationsaufforderungen und an Zeitenwenden kann man sich gewöhnen. Vielleicht steckt in diesem etwas lapidaren Satz fast alles, worum es in diesem Buch geht. Dass es Gewöhnungseffekte gibt, Trägheiten in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, Wiederholungen und Festhalten am Bewährten, kann einen Soziologen kaum erstaunen. Unser Gegenstand, die Gesellschaft, ist ohnehin von mehr Gewöhnung und Bewährung geprägt, als es das Gerede der Gesellschaft in der und über die Gesellschaft nahelegt. Sich darüber zu wundern, wäre also naiv – auch, sich über Veränderungsdruck und multiple Krisen zu wundern.
Aber vielleicht könnte es recht produktiv sein, sich doch darüber zu wundern. Jedenfalls soll das die Grundhaltung dieses Buches sein, denn der Gewöhnungseffekt, der mich interessiert, meint nicht in erster Linie die Gewöhnung an Krisen oder das, was wir Krisen nennen. Denn viele Parameter – vor allem in der Protestkultur, in einem Teil der Presse (nicht nur der üblichen verdächtigen Boulevardpresse), in der Form der politischen Auseinandersetzung, in der generalisierten Elitenkritik, in der Ausrufung von politischen Feinden innerhalb des demokratischen Spektrums – weisen darauf hin, dass Teile der Bevölkerung sich eher an einen Generalzweifel «der Gesellschaft» oder «dem System» gegenüber gewöhnt haben. Solche Formen erzeugen starke Bilder – und nicht zuletzt eine Normalisierung autoritärer Fantasien im politischen Raum. Anders ist der Höhenflug der AfD, einer offen rechtsextremen Partei, in Umfragen und womöglich später in Wahlen nicht zu erklären. Aber all das ist eher eine Reaktion auf merkwürdig gegenläufige Erfahrungen: Auf der einen Seite hält ein permanenter Transformations- und Nachhaltigkeitsdiskurs die öffentliche Kommunikation mit ihrem Versprechen in Atem, wie kurz wir vor der Lösung planetarer Probleme hin zu einem neugeordneten Zustand sind – auf der anderen Seite weist das Versprechen darauf hin, dass gewohnte Selbstverständlichkeiten, Sicherheiten und Routinen in Frage gestellt werden. Das kann man aus einer akademischen Perspektive schön als die Bedingung allen Wandels ansehen, aber von denjenigen, deren Geschäfts-, Lebens-, Glaubens- und Alltagsmodelle in einem fragilen Gleichgewicht von den bestehenden Bedingungen abhängig sind, wird das anders empfunden. Ein Großteil jener generalisierten Elitenkritik und der Lautstärke der extremen Seiten des politischen Spektrums, auch die antiszientistische Kritik wissenschaftlichen Wissens und nicht zuletzt die Kritik an vor allem urban-akademischen Lebensentwürfen ist sicher auch auf diese Spannung zurückzuführen.
Mich interessieren nicht die Krisen selbst, also nicht, welche CO2-Bepreisung die angemessene ist, welche Anpassungsleistungen an den bereits stattfindenden Klimawandel vonnöten sind, welches Verhältnis von Geboten/Verboten und Anreizen und Selbststeuerung am wirkungsvollsten ist, wie man richtig mit der Bekämpfung von Seuchen umgeht, welche militärpolitischen Konsequenzen neue internationale Sicherheitslagen erfordern, welche Subventions- und Schuldenpolitik die richtige ist, um klimaneutrale Produktionsformen und Produkte zu ermöglichen, welche Produktgruppen und Konsumstile angemessen sind, mit welcher Steuerpolitik man den Ausgleich zwischen ökonomischer Dynamik und der Kontinuität von Lebensformen am besten managen kann, wie man migrationspolitisch mit den unterschiedlichen Wanderungsformen umgeht oder welche Art von individueller Moral in all den Krisensituationen angemessen ist.
Mich interessiert vielmehr, wie sehr sich gesellschaftliche Routinen an sich selbst gewöhnen, wie sehr sie sich in einer Praxis einrichten, die mögliche Verunsicherungen geradezu wegmoderieren und den Alltag stärker werden lassen als jede Einsicht – übrigens etwas, das die Soziologie ohnehin lehrt. Mich interessiert, wie unbeeindruckt das bisweilen geschieht. Gesellschaftliche Praxis ist vor allem von Selbstbestätigung, von Wiederholungen, von der Selbststabilisierung des Bewährten geprägt. Man muss freilich aufhören, das nur im Modus der Anklage zu registrieren, denn auch diese bewährt sich ziemlich gut als Geschäftsmodell, das nur ein Geschäftsmodell sein kann, wenn es sich wiederholt – mit diesem Wiederholungsaspekt wird übrigens geschäftsmäßiges Handeln definiert.
Produktives Nachdenken fängt erst dort an, wo nicht nur Lösungen dekretiert werden, sondern wo man sich erstens Gedanken darüber macht, ob und wie solche Lösungen in der bestehenden Gesellschaft andocken können, und wo man zweitens mit Gegenreaktionen dieser Gesellschaft rechnet – und zwar nicht einfach in dem Sinne, diese Gegenreaktionen mit der Verstocktheit, der mangelnden Bereitschaft oder dem falschen Glaubenssystem der Adressaten zu erklären. Es stimmt schon, man kann ernsthaft daran verzweifeln, wie stabil und erwartbar viele Verhaltensweisen und Sprechakte, Strategien und Beschwörungsformeln sind. Theoretisch ausgedrückt: Systeme sind stabiler, träger als ihre Umwelt. Diese Trägheit ist genau genommen die Ordnungsleistung von Systemen, die nur deshalb dauerhaft bestehen können, weil sie die internen Möglichkeiten nicht-zufällig einschränken. Das gilt für Systeme aller Art, auch für gesellschaftliche. Das gilt für biologische, organische Systeme, die einen Trägheitsmechanismus haben, nicht alle Umweltveränderungen eins zu eins umzusetzen; das gilt für die menschliche Psyche, die sich in Mustern einrichtet und sich nicht durch jede überraschende Information verunsichern lässt; das gilt für kulturelle Systeme, deren Bedeutungen und Symbole, Zeichen und Formen stabiler bleiben als ihre kulturellen Verarbeitungsformen – und das gilt eben auch für soziale Systeme, die Routinen, Praktiken, Rollen, Erwartbarkeiten usw. ausbilden. Das ist das Terrain, auf dem sich die Soziologie bewegt, wenn sie nicht einfach nur großsprecherische Programmanzeigen und Entlarvungsgesten hinbekommt oder als Reflexionstheorie privilegierter Milieus daherkommt, auch wenn sie sich als Anwältin der weniger Privilegierten geriert.
Trägheit ist nicht einfach ein Programm, eine Marotte oder ein abzulegender Charakterzug, auch keine Geschmacksfrage, sondern ein struktureller Schutzmechanismus, der freilich auch Kosten hat. Die Krisendiagnosen jedenfalls sagen, dass schnell etwas getan werden müsste, und zwar von «uns allen». Aber es bleibt aus, zumindest sieht es so aus. Klassisch lässt es sich am Dauerthema Klimawandel beobachten, dessen disruptive Dringlichkeits- und Katastrophensemantik sich selbst routinisiert hat. Um es klar zu sagen: Die Dringlichkeit ist sehr hoch und wird immer höher, aber dringlich-schnelle Veränderungen erzeugt das nicht – eher langsame, in kleinen Schritten – und Abwehrreaktionen, die man moralisch kritisieren kann, aber wenigstens begreifen sollte. Und eher kleine Schritte taugen nicht für große Beschreibungen, aber sind womöglich wirksamer als die Disruptionssemantiken des Typs «Alles könnte anders sein» und wir könnten «Unsere Welt neu denken» oder «Wir könnten es so schön haben». Das sind Formulierungen aus Buchtiteln, auf die ich nicht direkt eingehen möchte – es reicht der Diskurstypus, der die affirmative und kritische öffentliche Wahrnehmung etwa der Klimakrise durchaus abbildet und bei aller Expertise und hohen Informationsdichte, die hier auch vermittelt wird, mit geradezu unrealistischen Chiffren versieht. Solche Perspektiven werden von vielen zu Unrecht, aber nicht grundlos gehasst. Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma?
Um es klar zu sagen: Es könnte keineswegs alles anders sein. Als Sozialwissenschaftler kann man, nein, muss man wissen, wie stabil, wie manchmal kaum auszuhalten stabil und erwartbar sich Praktiken und Routinen darstellen, wie widerständig vor allem die bewährten Alltagsroutinen, die kulturellen Chiffren und Überzeugungen, wie schwer aufklärbar Einstellungen sind und wie mächtig die Gewohnheit ist. Genau deswegen kann man sich auch daran gewöhnen, permanent damit beschallt zu werden, dass alles anders wird und nichts so bleibt, wie es ist. Dass keineswegs alles anders sein kann, bestätigt sich auch darin, dass man das Gegenteil immer wieder behaupten kann – nicht folgenlos, aber weit entfernt von der disruptiven Verve der Forderungen.
Am Anfang meiner Argumentation seien zwei auf den ersten Blick gegenläufige Beispiele genannt, die auf Trägheit und Persistenz verweisen. Vielleicht ist einer der sichtbarsten Hinweise auf die Macht der Trägheit und Persistenz von Formen der nach den barbarischen Angriffen der Hamas auf israelische Zivilisten im Oktober 2023 grassierende extreme Antisemitismus in unterschiedlichen Milieus der Gesellschaft. Es handelt sich um eine kulturelle Trägheit, die Persistenz eines Musters abrufbarer antisemitischer Reflexe, die je nach kulturellem Milieu eine je eigene Ausprägung erfahren: ein aus dem Anlass besonders sichtbarer muslimischer und islamistischer Antisemitismus, ein entsetzlicher linker Antisemitismus in universitären und künstlerischen Milieus, der dort keineswegs ein Fremdkörper ist, ein rechter und rechtsradikaler Antisemitismus, der sich angesichts des islamistischen Imports in eine merkwürdige Form des Philosemitischen camoufliert, ein bürgerlicher Antisemitismus, der ohnehin zur Grundausstattung gehört. Geradezu unbrauchbar sind Bekenntnisse, gar kein Antisemit zu sein, denn die genannten Muster sind stabiler als die Selbstbeschreibung jener, die dann doch wieder in die erwartbaren Routinen zurückfallen. Am deutlichsten werden sie in der Behauptung, man brandmarke jede Kritik an Israel als antisemitisch – das wäre in der Tat falsch. Es gibt an Israel genug zu kritisieren. Aber international eklatant unterschiedliche Maßstäbe anzuwenden, wenn es um Israel geht und nicht andere Länder, folgt dem Muster. Noch beliebter ist es, diese Israel-Kritik damit zu legitimieren, dass es auch Juden gebe, die so denken. Das ist nur die invertierte Form des bürgerlichen Antisemitismus, der gerne damit kaschiert wird, man habe einen Juden im Freundeskreis. Dieses Beispiel soll nur ein Hinweis auf die Trägheitserfahrung einer an Regelmäßigkeiten und Wiederholbarkeit orientierten Form von Ordnung sein. Ob kulturelle Bedeutungen oder soziale Formen – ihre Berechenbarkeit und Erwartbarkeit ist erstaunlich und tritt erstaunlicherweise auch (oder gerade) in plötzlichen, in disruptiven, in als krisenhaft erlebten Situationen zutage.
Das zweite Beispiel stammt aus neuen Forschungen über die sogenannte Polarisierung der Gesellschaft in Deutschland – eine der erfolgreichsten semantischen Formen zur Selbstbeschreibung der Gesellschaft. Da diese Selbstbeschreibung stärker in den Massenmedien der Gesellschaft als in der Soziologie stattfindet, ist die Rede von der in immer gegensätzlichere Lager gespaltenen Gesellschaft schon aus strukturellen Gründen plausibel, denn die interne Logik der Massenmedien kennt einerseits Neuigkeit und Aktualität als Grundcharakteristikum, daneben aber auch den Konflikt, der sich aufgrund seiner zweiseitigen Formen für mediale Darstellungen besonders eignet. Forschungen im Umfeld des Berliner Soziologen Steffen Mau freilich geben eine solche Diagnose nicht her. Zwar gibt es Themen, «Triggerpunkte» genannt, die herausfordern und die sehr konfliktfähig sind, aber in der Grundstruktur repräsentativer Einstellungen hat sich nichts wirklich Grundlegendes geändert – trotz vielfältiger Krisenerfahrungen. Das Unbehagen ist gestiegen und die Sensibilität für bestimmte Themen und Erfahrungen, aber keineswegs die Bereitschaft zu einer scharfen und kompromisslosen Spaltung, obwohl diese immer wieder herbeigeschrieben wird. Die pluralistische Gesellschaft bleibt trotz dieser Erfahrungen erstaunlich stabil pluralistisch – und profitiert von einer Trägheit und Persistenz von Formen, die sich bewährt haben. Selbst für einen als ausgemacht geltenden Rechtsruck gibt es weniger wissenschaftliche Evidenz als erwartet – freilich auf einem nicht niedrigen Niveau rechter Einstellungen und trotz wachsender Zustimmungsraten für eine rechtsradikale Partei, die keinen Hehl aus ihrer Gesinnung macht. Eine inzwischen aus den Rudern laufende Protestkultur, man denke etwa an die Bauernproteste im Winter 2023/24, angesichts derer die «Letzte Generation» wie ein Kindergeburtstag wirkt, ist ebenfalls ein Hinweis darauf, dass sich an den «Triggerpunkten» viel kommunikative Aufregung anlagert, an die man sich gewöhnt. Der Protest hatte semantisch nicht nur die Dieselbesteuerung auf dem Schirm, sondern ein Muster an Vorwürfen gegenüber der Regierung, die viel mit Transformations- und Veränderungsdruck, aber auch mit der Sichtbarkeit von Krisenerfahrungen zu tun hatte. Man gewöhnt sich einfach auch an die eigenen Argumente und Bornierungen.
Mit der Trägheitsdiagnose ernte ich oft Widerstand und Unverständnis, sogar die Unterstellung, damit Nichtstun zu rechtfertigen oder gar «die Verantwortlichen» aus der Pflicht zu nehmen. Beliebt ist auch die oft mit entlarvender Geste formulierte Provokation, ich dächte wohl, dass Lösungen ganz ohne Zumutungen und Verzichte auskommen würden. Aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil Krisenbewältigung, Transformationserfordernisse, Veränderungsdruck, Anpassungsleistungen nicht ohne Zumutungen, nicht ohne Verzichte, nicht ohne Ungewohntes auskommen, wird die Trägheit der Systeme, wird die Trägheit des Verhaltens und wird die Trägheit des Denkens so sichtbar und wirksam. Außerdem beweist der Vorwurf nur reflexiv die These: Aus der Trägheit, einen Schuldmechanismus generieren zu müssen, um sich einen Reim auf die Welt zu machen, kommen solche Kritiken nicht heraus. Es reicht die Betonung der Drastik.
Es muss doch mehr möglich sein, oder? Ich habe in den letzten Jahren in meiner eigenen Arbeit immer wieder versucht, genau das zu kritisieren und mit einer methodisch kontrollierten Form der Gesellschaftsbeschreibung auf Komplexitätsprobleme, auf Differenzierungsfolgen, auf Perspektivendifferenzen aufmerksam zu machen. Das Motiv der Überforderung spielte dabei ebenso eine Rolle wie die Einsicht, dass sich die Lösungen nicht einfach dekretieren und politisch durchsetzen lassen – übrigens garniert mit dem genau genommen recht simplen Gedanken, dass das Politische nicht außerhalb der gesellschaftlichen Dynamik steht, sondern dazugehört. Politik ist Teil des Problems – so viel Reflexivität muss sein.
Diese Arbeiten waren alle durch eine engagierte Distanziertheit geprägt – sie kamen neutral oder besser abgeklärt daher, mit möglichst sparsamen Wertungen und in einem Duktus des erklärenden Angebots, dessen Gehalt zugleich mitliefert, warum man dieses Angebot nicht als Gesamtpaket annehmen kann – denn die Grundthese ist die, dass so etwas wie Gesamtpakete ausgeschlossen sind, auch wenn sie sich so schön formulieren lassen. Es ist also vielleicht an der Zeit, dass ich ansatzweise die Textsorte wechsele, aber nicht in einer Übersprungshandlung, nun auch endlich angemessene politische Forderungen mit großer Verve und engagierter Betroffenheit zu stellen und das Ganze auf ein Erweckungserlebnis zurückzuführen, etwa im Stile der confessiones. Das sicher nicht, aber doch mit jenem Drive, der nötig ist, um diesen einen Gedanken stark zu machen: dass man zwar perfekte Ziele imaginieren, große Dringlichkeiten postulieren, moralische Ansprüche begründen und gute Lösungen entwerfen kann, und all das mit großem Nachdruck, dass aber all das nichts wert ist, wenn nicht ins Kalkül gezogen wird, dass der Gegenstand, um den es geht, selbst und eigensinnig auf jeden Versuch der Intervention reagiert. Der moderierende Faktor – das will der Soziologe zum Thema beitragen – ist die Gesellschaft selbst, ihre innere Dynamik, ihre Selbstlimitation – und die spezifische Form ihrer Möglichkeiten.
Dieser Perspektive liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Expertise, zumal wissenschaftliche Expertise, ein merkwürdiges Kontrollproblem hat. Jeder Experte, jeder Wissenschaftler und auch jede Wissenschaftlerin muss selbstverständlich von der Illusion ausgehen, dass «Wissen» und «Expertise» das entscheidende oder wenigstens ein entscheidendes Medium der Veränderung, der Transformation und der Problemlösung ist. Man sollte diese Illusion nicht vollständig aufgeben, natürlich nicht.
Aber vielleicht fehlt einer solchen Perspektive ein genaueres Wissen und genauere Expertise über die Bedeutung und die Potenz dessen, was wir «Wissen» nennen. Denn suggeriert wird oft ein merkwürdiges Kontrollverhältnis, das fast als eine Art déformation professionelle von Akademikern mit Klientenkontakt gelten könnte: Man muss es den Leuten nur sagen, wie es wirklich ist, dann werden sie sich schon entsprechend verhalten oder sich der Einsicht in jene Notwendigkeit fügen, die die Expertise so kunstvoll zu begründen sich anschickt. Es reicht nicht, in milieubedingter Naivität zu behaupten, man müsse den Leuten nur «ehrlich» sagen, dass jetzige Transformationskosten später einen Ertrag für sie haben werden – daran haben sich schon frühere Revolutionäre die Zähne ausgebissen. Wenn man solche Sprecher manchmal reden hört, wie schön die zukünftige, die transformierte Welt sein wird, wenn man jetzt wie aus einem Guss an einem Strang zieht, sieht das manchmal aus, als sei das geradezu designed als Generator zur Erzeugung von Abwehr, von Unverständnis, sogar von Hass. Bisweilen hat solche Überzeugung aus einem Guss, die auf Transformation aus einem Guss zielt, auch etwas Autoritäres, was gerade diese beseelten Sprecher weit von sich weisen würden.
In vorgestellten Kontrollverhältnissen weiß man nie, wer Kontrolleur ist und wer kontrolliert wird. Das ist ein Gedanke aus der Kybernetik. Wer ist in einem Regelkreis der Kontrolleur? Kontrolliert nicht auch die kontrollierte Seite den Kontrolleur? Verwirrt nicht schon ein einfaches soziales Kontrollverhältnis den Beobachter, wenn er sich nicht einfach auf die «offizielle» Beschreibung verlässt? Wenn jemand qua Amt oder Position die Macht hat, dann kontrolliert er als Mächtiger sein Gegenüber – aber nur solange das Gegenüber durch sein subalternes Verhalten die Konstellation bestätigt. Der Mächtige ist vom Unterworfenen eindeutig abhängig – wenn man das mitsieht, weiß man nicht mehr so genau, wer eigentlich die Kontrolle hat. Das ist mannigfaltig diskutiert worden – etwa als die Dialektik von Herr und Knecht oder auch soziologisch als Beschreibung von Macht als einer prinzipiell instabilen Form.
Wer Kontrolle (also Einfluss, Macht, Wirkung usw.) ausüben will – und sei es nur durch ein gutes Argument oder durch Expertise –, muss immer mit dem Eigensinn des Gegenübers rechnen, das nach eigenen Kriterien auf die Einflussnahme reagiert. Damit beschäftigt sich dieses Buch: wie die Gesellschaft und ihre Instanzen auf Veränderungsdruck, Verunsicherung, Lösungsperspektiven, Transformationsversuche und Einflussnahme reagieren und wie solche Formen auf ein Gegenüber treffen, das selbst permanent aktiv ist und nicht einfach reaktiv. Überzeugen kann man nur die, die für Überzeugungen offen sind – und steuern kann man nur das, was sich als steuerbar erweist. Dass das nicht immer der Fall ist, und das nicht zufällig, ist Gegenstand der folgenden Erörterungen.
Dies ist kein Buch über konkrete Krisen, auch wenn das Beispiel der Klimafrage am häufigsten vorkommt – aber letztlich nur als Parabel dafür, wie eine Gesellschaft wie die moderne mit kollektiven Herausforderungen umgeht, wie sie dies als Krise rahmt und was man daraus lernen kann. Dieses Buch beteiligt sich nicht an der Diskussion, welche konkreten Programme, Mittel, Strategien und Entscheidungen es braucht, um sich in den vielfältigen Krisen zurechtzufinden und Gefahren abzuwenden. Der Autor will hier auch nicht über seine konkreten Kompetenzen hinaus dilettieren. Programmatische und strategische Vorschläge zur Bewältigung verschiedener Krisen gibt es viele, sie werden kontrovers diskutiert, und man darf im Sinne einer differenzierten Gesellschaft davon ausgehen, dass diese unterschiedlichen Konzepte aus je unterschiedlichen Perspektiven formuliert werden. Und im Sinne einer liberalen Demokratie darf man hoffen, dass es im politischen Raum einen Wettbewerb um die besten Konzepte gibt. Aber daran beteiligt sich dieses Buch kaum. Es geht hier eher um Wie- als um Was-Fragen. Wenn man es metaphorisch ausdrücken will: nicht um einzelne Programme, sondern darum, wie das Betriebssystem funktioniert, auf dem die Programme laufen.
Was ich herausarbeiten will, ist die Beantwortung der Frage, wie eine moderne Gesellschaft mit ihren Ressourcen und Limitationen auf kollektive Herausforderungen und Krisen reagiert. Genau genommen lautet die Frage nicht, welche Sätze es braucht, um all die Krisen zu lösen, sondern wie die Leute auf ihre Sätze kommen.
Meine Verwunderung darüber, wie unbeeindruckt gesellschaftliche Routinen, Praktiken und Lösungskonzepte von den Herausforderungen selbst sind, ist mir Anlass, nach den Bedingungen zu fragen, unter denen Lösungen als solche erscheinen. Dass dies mit der Struktur der Gesellschaft, der Trägheit ihrer Bedingungen und den eingespielten Formen ihrer Institutionen zu tun hat, ist gewissermaßen der Beitrag eines Soziologen, der kein Klimawissenschaftler ist, kein Ökonom, kein Ingenieur und auch nicht einfach ein engagierter Bürger. Dieses Buch soll insofern anders sein als diejenigen, die uns sagen, was nun zu tun ist. Man kann mit den lautersten Motiven eine Revolution der Demokratie ausrufen, ein Umdenken fordern, Menschen auf ihre globale Privilegierung hinweisen, auf falsch verstandene Freiheitsvorstellungen, auf die Nebenfolgen ihrer Lebensweise hinweisen. Der Hinweis auf eine «Revolution» löst letztlich nicht das Sachproblem, sondern ein Darstellungsproblem. Einer drastischen Sache muss mit drastischen Begriffen begegnet werden – und schon ist man mitten drin in jenem Spiel, dessen Folgen man beklagt: dass der Rechtspopulismus wächst, die Elitenkritik steigt und das Vertrauen in demokratische Verfahren schwindet. Mit all dem hätte man dann sogar recht, aber übersieht, dass all das in genau der Welt stattfindet, die da beklagt wird. Und mit dem Glauben, dass eine funktionierende Demokratie sich daran messen lässt, dass das wünschenswerte Ergebnis herauskommt, ist man seinen populistischen, antidemokratischen Antipoden näher, als man es sich in seinen schlimmsten Träumen vorstellen kann. Der semantische Ausweg einer «Revolution» ist eben nur ein semantischer Ausweg – und eben von der Grundidee beseelt, dass alles anders sein könnte. Denn diese Grundidee könnte konventioneller nicht sein. Was freilich anders sein könnte, ist das Nachdenken über Transformationen und Veränderungen. Dem, und nur dem, soll hier nachgegangen werden.
Schon deshalb ist es explizit kein klassisches politisches Buch – und will es auch nicht sein –, aber schon ein appellierendes: Es muss möglich sein, einen Stand sozialwissenschaftlicher Forschung und gesellschaftstheoretischer Einsichten zur Grundlage für einen wenigstens partiell anderen Blick jenseits der großen Gesten, der Verwechslung der Dringlichkeit mit der Möglichkeit und vor allem jenseits des allein moralischen Appells nutzbar zu machen. Die Illusion ist nicht, ein im engeren Sinne umsetzbares Kontroll-Wissen zu präsentieren, aber vielleicht einige Hinweise darauf, wie sich Perspektiven verschieben, wenn man die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen von einer anspruchsvolleren Denkungsart inspirieren lässt als den immergleichen Posen und Selbstverständlichkeiten. Vielleicht sind dann auch produktivere Konflikte möglich als jene Pro-Contra-Konstellation, die letztlich den Wettbewerb um handhabbare Lösungen behindert und beide Seiten von klarer Reflexion entlastet. Am Ende werde ich darauf kommen, dass sich in dieser Gesellschaft bereits Formen etablieren, die mit Krisenbewältigung durchaus umgehen können – und empirisch wird sich zeigen, dass es eher eine evolutionäre als eine disruptive Form ist, die gesellschaftliche Praktiken lernfähig macht. Diese lassen sich nicht so einfach erzählen wie die großen Geschichten und die posenhaften Formen, aber sie entsprechen der Praxisform dieser Gesellschaft. Oder anders gewendet: Bei aller Dringlichkeit und allem Veränderungsdruck stehen nur die Mittel und Formen zur Verfügung, die auch wirklich zur Verfügung stehen. Vielleicht ist das ein wirklich revolutionärer Satz!
Wer Revolutionen ausruft und mit starker Verve formulieren will, zitiert gerne diesen berühmten Satz von Karl Marx aus dem «18. Brumaire» von 1852: «Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen» – dabei spricht hier ein eher desillusionierter Marx nach dem Staatsstreich Napoléons III. Es geht weiter mit dem Alp der Geschichte, der auf dem Gehirn der Lebenden lastet. Gemeint ist es als Aufforderung, diesen Alp hinter sich zu lassen – beschrieben wird aber, dass auch den Revolutionären nur die Mittel zur Verfügung stehen, über die sie verfügen. Vielleicht ist das der wichtigste methodische Hinweis auf alle Krisenbewältigung und Transformation: dass stets nur in konkreten Gegenwarten mit begrenzten Mitteln gehandelt werden kann. Wie gesagt: Angesichts großer Transformationsideen ist das wirklich ein revolutionärer Satz.
Geprägt ist das Buch von einer Sorge: All die starken Transformationsnarrative und Geltungsansprüche auf Veränderung, all die Versprechen, dass nichts so bleibt, wie es ist, und alles Wissen darüber, wie notwendig manche Neuanpassungen auf unterschiedlichen Gebieten sind, brechen sich daran, dass sie auf eine Welt treffen, die schon da ist. Aber was bringt alles Wissen um die Dringlichkeit von Veränderungsbedarf, um existentielle Probleme zu lösen, wenn der ausgedachte Lösungsweg selbst existentielle Gefahren heraufbeschwört? Wie kann man mit demokratischen Mitteln Dinge politisch durchsetzen, die für Viele zunächst unplausibel erscheinen? Wie fängt man den Widerstand gegen die mindestens «große» Transformation wieder ein, ohne die rechtlichen, die kulturellen, die politischen Standards zu gefährden? Wie kann man ganze Ökonomien verändern, während sie ökonomisch überleben müssen? Und wie kann man Lebensformen ändern, deren Alltagssorge vor allem darin besteht, kontinuierlich zu bleiben? Wer diese Fragen unter dem Hinweis auf Transformationsnotwendigkeiten nicht ernst nimmt, wird jede Möglichkeit einer Veränderung by design unmöglich machen und Veränderung by desaster präferieren.
Die im Titel dieses Buches formulierte «Kritik der großen Geste» ist auch eine operative Kritik. Große Teile von Transformationsdiskursen sind oft ein Kampf um Gesten, also um die Formulierung starker Sätze, ihre Bestätigung und Wiederholung. So sind es oft Protestbewegungen und aktivistische Strategien, die von ihren Adressaten wie Politikern, Parteien, Unternehmen, Verbänden oder sonstigen Institutionen letztlich nur eine Wiederholung oder Bestätigung ihrer starken Sätze fordern. Man muss es deutlich sagen: Die Wiederholung solcher Sätze löst noch kein Problem – kein operatives Problem der Implementation und Umsetzung, kein Zustimmungs- und Gefolgschaftsproblem, keine Bearbeitung von Nebenfolgen. Und diejenigen, die vor allem orthodoxe Sätze fordern, sind zumeist diejenigen, deren berufliche Tätigkeit in der Formulierung von Beschreibungen liegt. Sie können konsistente Sätze in eine diskontinuierliche Welt bringen und von einer widerspruchsfreien Wirklichkeit träumen.
Die Funktion von Protestbewegungen, etwa der Klimabewegung, besteht sehr wohl darin, solche Gesten zu vermitteln und aufmerksamkeitsökonomische Geländegewinne zu machen. Aber diese Ebene der Beschreibung und der Forderung hat selbst noch keine Konsequenzen. Sie sind in evolutionstheoretischen Begriffen, auf die ich später noch kommen werde, allenfalls Variationen auf der Ebene des kommunikativen Haushalts und noch keine Selektionen oder gar Restabilisierungen von Lösungen. Insofern muss sich auch die Reflexion von Transformationsfragen stärker auf die Frage konzentrieren, wie Strategien in einer Welt, die schon da ist, Wirkungen über die bloße kommunikative Provokation hinaus erzielen können.
Ich beginne in den ersten beiden Kapiteln mit zwei Thesen. Die erste verlängert die hier schon explizierte Verwunderung: In den öffentlichen Debatten mit ihren konkurrierenden Handlungskonzepten spielen alle ihre ziemlich erwartbaren Rollen, und das nicht aus mangelnder Einsicht, sondern aus strukturellen Gründen. Die zweite zeigt auf, dass es kein Zufall ist, dass sich gerade derzeit die Selbsterfahrung des Krisenhaften so plausibel anhört – es hat ohne Zweifel etwas damit zu tun, dass zuvor latent gebliebene Selbstverständlichkeiten mit einem Mal sichtbar werden. Ich nenne das eine große Visibilisierungserfahrung, die mit der Häufung von als krisenhaft erlebten Ereignissen und Zuständen zu tun hat. Exakt damit beginnen die beiden ersten Kapitel, die dann auch das weitere Programm entfalten.
Daraus ergeben sich weitere Fragen, die alle an diese Grunddiagnose anschließen – und die sich sowohl an der Darstellbarkeit des Problems abarbeiten wie auch meine Verwunderung auf den Begriff bringen, wie wenig kontextsensibel die Diskurse auch derer laufen, die es besser wissen könnten. Am Ende steht nicht der große gestenreiche Appell für die eine konkrete Lösung – wofür auch immer. Am Ende wird es eine Apologie kleiner Schritte geben, die viel mit dem angedeuteten Kontrollproblem zu tun hat. Das hört sich wieder danach an, als solle gebremst werden – was bisweilen jeder Autofahrer weiß. Wer mit zu hoher Geschwindigkeit in eine Kurve fährt, fliegt eher aus der Kurve als derjenige, der zuvor die Geschwindigkeit gedrosselt hat. Im Scheitelpunkt der Kurve kann man dann wieder Gas geben, zugegebenermaßen für das Klimathema eine riskante Metapher. Aber es bleiben schon aufgrund der Struktur der modernen Gesellschaft fast nur evolutionäre, orts- und zeitgebundene, konkrete Schritte möglich. Und es könnte sein, dass diese Not den Schlüssel für eine Tugend enthält, die Lösungsperspektiven sichtbar macht, die in der gesellschaftlichen Praxis längst aufscheinen – nicht für die freilich, deren Geschäftsmodell die große Geste und die zitierbare Pose ist.
Kein politisches Buch zu sein, heißt auch, dass in diesem Buch nicht der Aufmerksamkeitsökonomie der medialen Selbstbeschreibung gefolgt wird, sondern die Genese der Argumente als eine wissenschaftliche Genese deutlich werden sollte, auch wenn das Buch nicht den Formvorschriften eines wissenschaftlichen Textes folgt. Es macht einen Unterschied, ob man als Wissenschaftler nur einen weiteren Beitrag in weniger einfacher Sprache zu dem beifügt, was sich die Gesellschaft vor allem in Formen ihrer Massenmedien ohnehin erzählt – eine Gefahr, der insbesondere die Soziologie oft erliegt. Der Unterschied, der gemacht werden muss, ist auch der, ob die eigenen Fragestellungen schon da sind oder aber wissenschaftlich generierte Fragen sein können. Ich habe auf dem Buchrücken eines theoretischen soziologischen Buches über die Neukartierung der soziologischen Systematik gefragt, welche Probleme die Soziologie lösen könne, die wir ohne sie nicht hätten. Es hat gelegentlichen Spott über diese Frage gegeben, was ja nur ein Hinweis darauf ist, wie wenig Gesellschaftswissenschaftler bisweilen den Unterschied zwischen selbstgenerierten Fragen und der Selbstbefragung ihres Gegenstandes als Herausforderung sich zumuten. Die hier präsentierte Perspektive soll wenigstens ansatzweise vermitteln, was sich ändert, wenn etwas Distanz zu allzu erwartbaren Perspektiven gewahrt wird.
Wissenschaft soll sagen, was der Fall ist – und letztlich kann Wissenschaft das am allerwenigsten, denn Wissenschaft beginnt nicht bei konkreten Theorien und Methoden, nicht bei einer bestimmten Auffassung, und mit «Meinungen» hat sie am allerwenigsten zu tun. Wissenschaft beginnt mit einer gewissen Reflexivität der eigenen Voraussetzungen. Genau genommen ist alles, was man als Wissenschaft sagen kann, von den eigenen Prämissen abhängig, von Vorentscheidungen, von einem Immer-schon-Begonnenhaben, bevor man irgendeinen Gegenstand und irgendeinen Sachverhalt beschreibt. Das gilt nicht nur für die Wissenschaft – aber hier wird es reflexiv, hier muss man damit umgehen, es bisweilen auch sichtbar machen. Nur deshalb gibt es Theorien- und Methodenreflexion und nur deshalb gibt es zur selben Fragestellung bisweilen konkurrierende, unterschiedliche Antworten – auch in den sogenannten harten Wissenschaften.
Dies sei hier an den Anfang gestellt, denn dieses Buch ist ein Angebot – es bietet seinen Leserinnen und Lesern an, auszuprobieren, was dabei herauskommt, wenn man mit jenem Blick auf die Dinge schaut, der hier vorgeführt wird. Und zugegebenermaßen hält sich dieses Buch nicht an wissenschaftliche Gepflogenheiten im engeren Sinne – es ist aber schon das Buch eines Wissenschaftlers, der wenigstens teilweise zeigen will, wie er auf Sätze darüber kommt, was der Fall ist. Ich hoffe jedenfalls, dass diese Reflexivität deutlich durch den Text hindurchscheint.
Der Text verzichtet bewusst auf jeglichen wissenschaftlichen Apparat, auf Literaturangaben, Anmerkungen, Belege und Zitate. Er nennt selten Namen und ist darin an manchen Stellen auch ungerecht. Vereinzelt wird auf Literatur im Text hingewiesen. Manche Äußerung und Position wird nur sachlich angedeutet und nicht konkret angesprochen – auch deswegen, weil das Meiste dessen, was gezeigt wird, eher typisch als individuell zurechenbar ist. Wo eine solche Zurechnung sichtbar gemacht werden muss, geschieht das auch. Es ist ein Essay, der einen Gedanken entfaltet und der sich darin wenig stören lassen will. Es ist ein möglichst barrierefreier Essay. Die Absicht ist es, dabei zu helfen, klarer zu sehen, warum so Vieles unklar ist – eben: anders über Transformation nachzudenken.