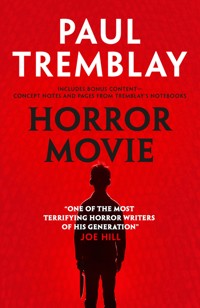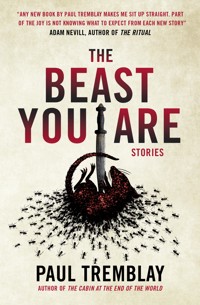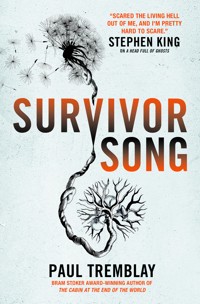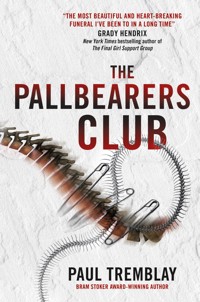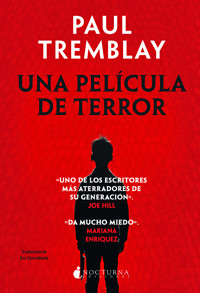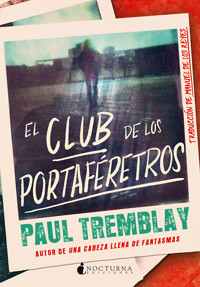9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine abgelegene Ferienhütte am See in den Wäldern New Hampshires: Hier wollen Eric und Andrew gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Adoptivtochter Wen eine Woche Urlaub machen. Kein Smartphone, kein Internet – nur Ausspannen und Zeit mit der Familie verbringen. Mit der Idylle ist es dann aber schnell vorbei, als eines Tages vier merkwürdige, bis an die Zähne bewaffnete Gestalten auftauchen. Sie versprechen, die junge Familie nicht zu verletzen. Sie sagen, dass sie Hilfe brauchen. Doch die vier verbergen ein dunkles Geheimnis und für Eric, Andrew und Wen beginnt der schlimmste Albtraum ihres Lebens ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Eine abgelegene Ferienhütte am See in den Wäldern New Hampshires: Hier wollen Eric und Andrew gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Adoptivtochter Wen ein paar Tage Urlaub machen. Kein Stress, kein Internet – nur Ausspannen, Lesen und Zeit mit der Familie verbringen. Mit der Idylle ist es dann aber schnell vorbei, als eines Tages der etwas unheimliche Leonard auftaucht und darauf besteht, mit der Familie zu sprechen. Eric und Andrew versuchen alles, um ihn abzuwimmeln, doch Leonard ist nicht alleine gekommen. Mit einem Mal tauchen noch drei weitere bis an die Zähne bewaffnete Gestalten aus den Büschen auf. Sie sagen, dass sie der jungen Familie nicht wehtun wollen. Sie sagen, dass Eric und Andrew eine wichtige Entscheidung zu treffen hätten, vorher könnten sie sie nicht gehen lassen. Für Eric, Andrew und Wen beginnt der schlimmste Albtraum ihres Lebens …
Der Autor
Paul Tremblay hat den Bram Stoker, Britisch Fantasy und Massachusetts Book Award gewonnen und ist Autor zahlreicher Romane, Essays und Kurzgeschichten, die in Los Angeles Times, Entertainment Weekly online und Year’s Best-Anthologien erschienen sind. Er hat einen Master-Abschluss in Mathematik, und lebt mit seiner Familie außerhalb von Boston.
Paul Tremblay
DAS HAUS AM ENDE DER WELT
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Julian Haefs
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Für Lisa, Cole, Emma und für uns
»Und wenn wir in der Erde sind, betrachten wir unsere Hände und fragen uns laut, ob irgendwer freiwillig beschließt zu sterben. Am Ende gewinnen wir alle. Am Ende gewinnen wir alle.«
– Future of the Left, »The Hope That House Built«
»Währenddessen fallen Flugzeuge vom Himmel. Menschen verschwinden und Kugeln fliegen … Würde mich nicht wundern, wenn sie ihren Willen durchsetzen. (Schmeckt wie Hühnchen, behaupten sie.)«
– Clutch, »Animal Farm«
»… denn als sich das Leichentuch über uns legte, strampelten wir uns frei und waren der Welt nackt und zitternd ausgeliefert.«
– Nadia Bulkin, She said Destroy
Erster Teil KOMMT UND SCHAUT
1
Das Mädchen mit den dunklen Haaren kommt die hölzerne Vordertreppe herunter und setzt sich in die vergilbte Lagune aus knöcheltiefem Gras. Eine warme Brise lässt Halme, Laub und die krabbenförmigen Blätter der Kleeblüten erzittern. Das Mädchen beobachtet die Wiese vor dem Haus und hält Ausschau nach den zuckenden mechanischen Bewegungen und hektischen Sprüngen der Grashüpfer. Das Einmachglas, das sie vor ihrer Brust umklammert hält, riecht ein bisschen nach Traubengelee und ist innen noch klebrig. Sie schraubt den belüfteten Deckel auf.
Wen hat Papa Andrew versprochen, die Grashüpfer wieder freizulassen, bevor sie in ihrem selbst gebauten Terrarium gekocht werden. Aber erst mal wird es den Grashüpfern gut gehen, denn sie achtet genau darauf, das Glas nicht direkt in die Sonne zu stellen. Allerdings macht Wen sich Sorgen, ihre Schützlinge könnten sich an den scharfen Kanten der Luftlöcher verletzen, die sie von außen in den Deckel gestochen hat. Also wird sie zunächst kleinere Grashüpfer fangen, die weder so hoch noch so stark springen können und außerdem mehr Beinfreiheit im Glas hätten. Sie wird mit sanfter, beruhigender Stimme auf die Grashüpfer einreden und dadurch hoffentlich verhindern, dass sie in Panik geraten und sich gegen die gefährlichen Metallstalaktiten werfen. Wen ist zufrieden mit ihrem aktualisierten Plan und rupft eine Handvoll Gras mitsamt Wurzeln aus. Zurück bleibt eine kleine Narbe im Vorgarten, diesem Meer aus Grün und Gelb. Vorsichtig bugsiert sie das Gras ins Einmachglas, richtet es ordentlich her und wischt sich die Finger an ihrem grauen Wonder-Woman-T-Shirt ab.
In sechs Tagen ist Wens achter Geburtstag. Ihre Väter fragen sich (nicht wirklich heimlich, denn sie hat die beiden darüber reden gehört), ob es tatsächlich der Tag ihrer Geburt ist oder bloß der Stichtag, den das Waisenhaus im chinesischen Hubei festgelegt hat. Für ihr Alter liegt sie auf der 56. Perzentile für die Körpergröße und der 42. für das Körpergewicht, zumindest ist das der Stand von vor sechs Monaten, als sie zuletzt beim Kinderarzt war. Da hatte sie Dr. Meyer aufgefordert, ihr die Bedeutung dieser Zahlen genau zu erklären. So froh sie war, über der Fünfziger-Linie für die Größe zu liegen, hat es sie doch geärgert, beim Gewicht darunter zu liegen. Wen ist nicht nur sehr direkt und resolut, sondern auch athletisch und drahtig. Oft schlägt sie ihre Väter bei Rätseln oder den aufwendig inszenierten Wrestlingpartien auf deren Doppelbett. Sie hat große dunkelbraune Augen und buschige Augenbrauen, die fast wie von selbst herumwackeln. Am rechten Rand ihres Oberlippengrübchens ist ganz schwach eine Narbe auszumachen, aber nur bei besonderen Lichtverhältnissen und wenn man weiß, wonach man sucht (hat man ihr zumindest gesagt). Die dünne weiße Linie ist das letzte Anzeichen der Hasenscharte, die man ihr im Alter zwischen zwei und vier Jahren in mehreren Operationen korrigiert hat. Sie erinnert sich an den ersten und an den letzten Besuch im Krankenhaus, aber nicht an die Male dazwischen. Es stört sie, dass diese Krankenhausaufenthalte und Prozeduren irgendwo in ihrem Kopf verloren gegangen sind. Wen ist freundlich, aufgeschlossen und so albern wie jedes andere Kind in ihrem Alter, schenkt ihr rekonstruiertes Lächeln aber nicht jedem. Man muss es sich schon verdienen.
Es ist ein wolkenloser Sommertag im Norden von New Hampshire, kaum eine Handvoll Meilen von der kanadischen Grenze entfernt. Das Sonnenlicht schimmert zwischen den Blättern der Bäume hindurch, die großmütig auf das kleine Ferienhaus herabschauen, den einsamen roten Fleck am Südufer des Gaudet-Sees. Wen stellt ihr Einmachglas im Schatten neben der Vordertreppe ab. Mit ausgebreiteten Armen watet sie ins Grasmeer hinaus, als müsse sie sich über Wasser halten. Immer wieder wischt sie mit dem rechten Fuß in weitem Bogen durch die Spitzen der Halme, wie Papa Andrew es ihr gezeigt hat. Er ist auf einem Bauernhof in Vermont aufgewachsen und dementsprechend ein echter Experte im Grashüpferfinden. Er hat gesagt, dass ihr Fuß wie eine Sense funktionieren soll, ohne dabei wirklich die Wiese zu mähen. Da Wen nicht wusste, was das bedeutet, hat er ihr ausführlich erklärt, was das für ein Werkzeug ist und wie man es benutzt. Er hat sein Smartphone gezückt und wollte Bilder von Sensen suchen, bis beiden einfiel, dass man hier draußen in der Hütte keinen Empfang hat. Also hat Papa Andrew ihr stattdessen eine Sense auf eine Serviette gemalt; ein Messer wie eine Mondsichel an einem langen Stock, wie es vielleicht ein Krieger oder Ork aus den Herr der Ringe-Filmen tragen würde. Das Ding sah sehr gefährlich aus, und Wen konnte nicht recht begreifen, warum Leute so ein furchtbar riesiges Werkzeug brauchen, um Gras zu schneiden. Trotzdem fand sie die Idee großartig, sich vorzustellen, dass ihr Bein der Schaft und ihr Fuß das lange gebogene Messer ist.
Ein brauner Grashüpfer, der beinahe so groß ist wie ihre Hand, flieht mit laut schabenden Flügeln vor ihrem Fuß und prallt von ihrer Brust ab. Wen stolpert ein wenig und stellt sich vor, von dem Zusammenstoß fast zu Boden zu gehen.
Sie kichert und sagt: »Okay, du bist zu groß.«
Mit ihrem Sensenfuß setzt sie die forschenden Schwünge fort. Ein viel kleinerer Grashüpfer springt so hoch, dass sie ihn irgendwo am Zenit seiner elliptischen Bahn gen Himmel aus den Augen verliert, aber dann sieht sie ihn keine zwei Meter neben sich landen. Er ist leuchtend grün wie ein Tennisball und hat genau das richtige Format, kaum größer als die Samenbüschel am Kopfende der langen Grashalme. Wenn sie ihn nur erwischen kann. Seine Bewegungen sind hastig und schwer vorauszuahnen, immer wieder springt er davon, als die zitternde Falle ihrer Hände gerade zuschnappen will. Sie lacht und folgt ihm auf seinem fieberhaften Zickzackkurs durch den Vorgarten. Sie ruft ihm zu, dass sie ihm nichts Böses will, dass sie ihn bald wieder freilassen wird und nur mehr über ihn erfahren möchte, damit sie all den anderen Grashüpfern dabei helfen kann, auch so gesund und fröhlich zu sein.
Endlich bekommt Wen den Miniaturakrobaten an der Grenze zwischen Wiese und Kiesweg zu fassen. Dieser Grashüpfer in der sanften Höhle ihrer Hände ist der erste, den sie je gefangen hat. Flüsternd triumphiert sie: »Ja!« Der Grashüpfer ist so leicht, dass sie ihn nur spürt, wenn er versucht, zwischen ihren geschlossenen Fingern hindurchzuspringen. Die Versuchung, ihre Hände einen Spaltbreit zu öffnen, um hineinzuspähen, ist überwältigend, aber Wen widersteht ihr tapfer. Sie rennt quer über die Wiese, setzt den Hüpfer ins Einmachglas und schraubt schnell den Deckel zu. Er springt wie ein Elektron umher, klopft hell gegen Glaswand und Blechdeckel, hält dann aber unvermittelt inne, lässt sich auf der grünen Innenausstattung nieder und ruht sich aus.
Wen betrachtet ihn. »Alles klar. Du bist Nummer eins.« Sie zieht ein handflächengroßes Notizbuch aus ihrer Gesäßtasche, dessen Vorderseite bereits sorgfältig in leicht verwackelte Zeilen und Spalten mit den entsprechenden Überschriften eingeteilt ist. Dann notiert sie die Nummer eins, einen Schätzwert der Größe (den sie nicht ganz zutreffend mit »5 cm« angibt), die Farbe (»grün«), Junge oder Mädchen (»Mädchen, Caroline«) und das Niveau des Tatendrangs (»sehr hoch«). Sie stellt das Glas wieder an seinen schattigen Platz und spaziert zurück auf die Wiese. Schnell hat sie vier weitere Grashüpfer von ähnlicher Größe gefangen: zwei braune, einen grünen und einen, der irgendwo dazwischenliegt. Alle werden nach Freundinnen aus der Schule benannt – Liv, Orvin, Sara und Gita.
Als sie sich gerade auf die Pirsch nach dem sechsten Hüpfer begeben will, hört sie, dass jemand den unendlich langen Waldweg entlangjoggt. Die unbefestigte Straße schlängelt sich an ihrem Ferienhaus vorbei und verläuft ein Stück am Ufer des Sees, bevor sie zwischen den Bäumen verschwindet. Als sie vor zwei Tagen angekommen sind, haben sie genau einundzwanzig Minuten und neunundvierzig Sekunden gebraucht, um auf dieser Straße die Hütte zu erreichen. Wen hat es gemessen. Zugegeben, Papa Eric ist natürlich wie immer viel zu langsam gefahren.
Das Geräusch der stampfenden Füße auf Erde und Schotter ist jetzt lauter. Irgendetwas Großes stapft da die Straße entlang. Etwas richtig Großes. Vielleicht ein Bär. Sie musste Papa Eric versprechen, sofort zu rufen und ins Haus zu laufen, wenn sie ein Tier sieht, das größer ist als ein Eichhörnchen. Soll sie jetzt aufgeregt sein oder Angst haben? Die Bäume drängeln sich so dicht aneinander, dass sie noch nichts erkennen kann. Wen steht fluchtbereit mitten auf der Wiese. Ist sie schnell genug, rechtzeitig die Tür zu erreichen, falls es wirklich ein gefährliches Tier sein sollte? Sie hofft, dass es ein Bär ist. Sie will unbedingt einen sehen. Falls nötig, kann sie sich einfach totstellen. Der Vielleicht-Bär hat den von Baumstämmen verborgenen Anfang der Auffahrt erreicht. Wens Neugier schlägt in Verärgerung um, sich mit wem oder was auch immer befassen zu müssen, das da kommt, denn schließlich steckt sie mitten in einem wichtigen Projekt.
Ein Mann biegt um die Ecke und marschiert so forsch die Auffahrt herauf, als käme er nach Hause. Wen ist nicht sonderlich gut darin, die Größe von Erwachsenen einzuschätzen, denn sie leben alle weit über ihr in den Wolken, aber dieser Mann ist auf jeden Fall größer als ihre Väter. Er mag sogar der größte Mann sein, den sie je gesehen hat, außerdem ist er so breit wie zwei Baumstämme, die man aneinandergeschoben hat.
Der Mann winkt mit einer Hand, die genauso gut eine Bärentatze sein könnte, und lächelt Wen an. Durch die Erfahrungen ihrer vielen Lippenrekonstruktionen hat Wen sich lange darauf verlegt, anderer Leute Lächeln genau zu studieren. Zu viele Menschen haben ein Lächeln, das nicht so gemeint ist, wie ein Lächeln eigentlich gemeint sein sollte. Oft ist es gemein und spöttisch, und das Grinsen eines Schlägers ist von seiner Faust kaum zu unterscheiden. Noch schlimmer ist das verwirrte oder traurige Lächeln, das Erwachsene so oft zeigen. Wen erinnert sich an viele Situationen vor und nach Operationen, in denen sie keinen Spiegel gebraucht hatte, um zu wissen, dass ihr Gesicht noch immer nicht so aussah wie das von allen anderen, allein wegen der vielen Gesichter mit einem brüchigen Du-armes-armes-Ding-Lächeln, die ihr in Wartezimmern und Eingangshallen und Parkhäusern zugeworfen wurden.
Das Lächeln dieses Mannes ist warm und breit. In seinem Gesicht öffnet sich der Vorhang wie von selbst. Wen könnte den Unterschied zwischen einem echten und einem gestellten Lächeln nicht wirklich erklären, aber sie weiß es, wenn sie es sieht. Bei ihm ist es nicht gestellt. Sein Lächeln ist echt, so echt, dass es fast ansteckend wirkt, und Wen erwidert es mit einem schmallippigen Grinsen, das sie hinter ihrem Handrücken versteckt.
Fürs Joggen oder Wandern im Wald ist der Mann sehr unpassend angezogen. Die klobigen schwarzen Schuhe mit den dicken Gummisohlen, die sich unter seinen Füßen auftürmen, lassen ihn noch größer wirken; es sind weder Sneakers noch hübsche Herrenschuhe, wie Papa Eric sie trägt. Sie sind eher wie die Doc Martens, die Papa Andrew oft anhat. Wen erinnert sich an den Markennamen, weil es ihr gefällt, dass seine Schuhe nach einer Person benannt sind. Der Mann trägt eine verstaubte blaue Jeans und ein weißes Anzughemd, das säuberlich in die Hose gesteckt und bis ganz oben zugeknöpft ist. Der Kragen spannt sich um seinen geröteten Stiernacken.
»Hallo du«, sagt er. Seine Stimme ist nicht so groß wie er selbst, lange nicht. Er klingt eher wie ein Teenager, wie einer der Studenten, die das Nachmittagsprogramm an ihrer Schule betreuen.
»Hi.«
»Ich bin Leonard.«
Wen gibt ihren Namen nicht preis, und bevor sie Ich werde lieber mal meine Papas holen sagen kann, stellt Leonard ihr eine Frage.
»Hast du was dagegen, wenn wir uns ein bisschen unterhalten, bevor ich mit deinen Eltern rede? Ich will natürlich auch mit ihnen sprechen, aber ich würde lieber zunächst ein Weilchen mit dir plaudern. Wäre das in Ordnung?«
»Ich weiß nicht. Ich soll nicht mit Fremden reden.«
»Das ist auch ganz richtig so und klug von dir. Ich verspreche dir, dass ich hier bin, um dein Freund zu sein und ganz bald kein Fremder mehr sein werde.« Wieder lächelt er. Fast so breit, als wäre es ein lautes Lachen.
Sie lächelt zurück, und dieses Mal verbirgt sie es nicht hinter ihrer Hand.
»Darf ich fragen, wie du heißt?«
Wen weiß, dass sie nichts mehr sagen, sondern sich umdrehen und ins Haus laufen sollte, und zwar schnell. Sie hat mit ihren Vätern unzählige Male über gefährliche Fremde geredet, und da sie eigentlich in der Stadt leben, versteht sie auch, dass sie wachsam sein muss, denn dort wohnen furchtbar viele Menschen. Eine unglaubliche Menge von Leuten bevölkert die Bürgersteige und schwappt durch die U-Bahn, geht shoppen und lebt und arbeitet in all den riesigen Gebäuden, sitzt in den Autos und Bussen, die rund um die Uhr die Straßen verstopfen, und Wen kann sich durchaus vorstellen, dass sich unter all den netten Menschen auch ein böser befinden könnte, der sich in einer Seitenstraße oder einem Kleinbus oder am Spielplatz oder im Laden an der Ecke herumtreibt. Aber hier draußen, im Wald mit Blick auf den See, mit den Füßen im hohen Gras und der Sonne im Gesicht, mit den schläfrigen Bäumen und dem blauen Himmel, fühlt sie sich sicher und befindet, dass Leonard in Ordnung aussieht. Das sagt sie sich auch innerlich so: Er sieht in Ordnung aus.
Leonard steht nur ein paar Schritte von ihr entfernt auf der Grenze zwischen Auffahrt und Wiese. Seine Haare haben eine Farbe wie reifer Weizen und sind ganz wuschelig, ein bisschen gelockt und gekringelt wie Zuckergussschrift auf einer Torte. Er hat runde braune Augen wie ein Teddybär. Er ist jünger als ihre Papas. Sein Gesicht ist blass und glatt und zeigt nicht einmal eine Spur der Stoppeln, die bei Papa Andrew jeden Abend aufs Neue zu sehen sind. Vielleicht geht Leonard wirklich noch aufs College. Sollte sie ihn fragen, auf welches? Sie könnte ihm erzählen, dass Papa Andrew an der Boston University unterrichtet.
Sie sagt: »Ich heiße Wenling. Aber meine Papas und meine Freunde und alle anderen in der Schule nennen mich Wen.«
»Freut mich sehr, dich kennenzulernen, Wen. Und was machst du gerade? Warum bist du an so einem herrlichen Nachmittag nicht unten am See beim Schwimmen?«
Das ist nun wieder ein typischer Erwachsenenspruch. Vielleicht ist er doch kein Student mehr. »Der See ist sehr kalt. Also fange ich Grashüpfer.«
»Echt? Ah, ich liebe es, Grashüpfer zu fangen. Als Kind habe ich das sehr oft getan. Das macht total Spaß.«
»Stimmt. Aber in diesem Fall ist es eine ernste Sache.« Sie schiebt den Unterkiefer vor und ahmt damit absichtlich Papa Eric nach, wenn sie ihm eine Frage stellt, bei der sie weiß, dass die Antwort zwar nicht Ja lautet, sich aber in Ja verwandeln wird, sofern sie beharrlich genug ist.
»Ernst?«
»Ich fange sie ein und gebe ihnen Namen und untersuche sie, damit ich herauskriege, ob sie gesund sind. So machen das Leute, die Tiere untersuchen, und wenn ich groß bin, will ich auch Tieren helfen.« Wen ist fast schwindelig, so schnell redet sie. Die Lehrer in der Schule sagen ihr immer wieder, dass sie langsamer reden soll, weil man sie kaum verstehen kann, wenn sie richtig loslegt. Einmal hat Mrs. Iglesias, die Vertretungslehrerin, gesagt, dass es sich anhört, als würden die Worte einfach aus ihrem Mund sickern, und danach konnte Wen Mrs. Iglesias nicht mehr leiden.
»Da bin ich aber schwer beeindruckt. Brauchst du Hilfe? Ich würde dir gerne helfen. Ich weiß, ich bin jetzt viel größer als damals.« Er hält seine Hände hoch und zuckt mit den Schultern, als könnte er kaum fassen, was aus ihm geworden ist. »Aber ich bin immer noch sehr sanft.«
Wen sagt: »Okay. Ich halte das Einmachglas fest, damit die anderen nicht raushüpfen, und du kannst vielleicht noch ein paar für mich fangen. Aber keine Großen bitte. Sie dürfen nicht groß sein. Kein Platz. Nur die Kleinen. Ich zeige sie dir.« Sie geht zur Treppe, um ihr Glas zu holen. Kurz stellt sie sich auf die Zehenspitzen und späht durchs offene Fenster neben der Eingangstür. Sie sucht nach ihren Papas und will sehen, ob sie vielleicht zugucken oder zuhören. Aber sie sind weder in der Küche noch im Wohnzimmer. Sie müssen hinten auf der Veranda in ihren Liegestühlen sitzen und sich sonnen (Papa Eric holt sich bestimmt wieder einen Sonnenbrand und behauptet dann steif und fest, dass seine krebsrote Haut weder wehtut noch Aloe braucht). Vielleicht lesen sie oder hören Musik oder einen dieser langweiligen Podcasts. Sie überlegt kurz, ums Haus zu gehen und ihnen zu erzählen, dass sie jetzt mit Leonard Grashüpfer fängt. Stattdessen hebt sie das Einmachglas auf. Die Grashüpfer benehmen sich wie erhitztes Popcorn und prasseln gegen den Deckel. Wen flüstert ihren Schützlingen beruhigend zu und geht zurück zu Leonard, der schon mitten auf der Wiese hockt und wachsam das Gras absucht.
Wen gesellt sich zu ihm und hält ihr Glas hoch. »Siehst du? Keine Großen bitte.«
»Verstanden.«
»Soll ich sie lieber fangen, und du schaust zu?«
»Ich würde gerne wenigstens einen fangen. Das ist schon so lange her. Ich bin bestimmt nicht mehr so flink wie du, also bewege ich mich ganz langsam, damit ich sie nicht erschrecke. Ach, sieh mal, da ist einer.« Er beugt sich vor und breitet die Arme links und rechts von dem Grashüpfer aus, der kopfüber am Ende eines ausgetrockneten Halms hängt. Der Hüpfer rührt sich nicht und wirkt wie hypnotisiert von dem Riesen, der die Sonne verdunkelt. Ganz langsam nähern sich Leonards Hände und verschlucken das Tierchen.
»Wow. Sehr gut.«
»Danke. Wie wollen wir das jetzt machen? Vielleicht solltest du das Glas auf den Boden stellen, damit sich die Bewohner ein bisschen beruhigen, und dann können wir den Deckel aufmachen und den hier dazusetzen.«
Wen folgt seinem Ratschlag. Leonard kniet sich mit einem Bein hin und starrt das Glas an. Wen ahmt seine Bewegung nach. Sie will ihn fragen, ob der Grashüpfer in der Dunkelheit seiner Hände herumspringt, ob er ihn über seine Haut krabbeln spürt.
Sie warten ganz leise, bis er sagt: »Alles klar. Versuchen wir’s.« Wen schraubt den Deckel auf. Leonard schiebt vorsichtig seine Hände übereinander, bis er den Grashüpfer nur noch in einer mächtigen Faust hält, und hebt dann mit der freien Hand ganz sachte den Deckel an. Er lässt den Hüpfer ins Glas fallen, macht den Deckel wieder zu und dreht ihn einmal im Uhrzeigersinn fest. Sie sehen einander an und lachen.
Er sagt: »Wir haben’s geschafft. Willst du noch einen?«
»Klar.« Wen hat ihr Notizbuch gezückt und trägt in den entsprechenden Spalten ein: »5 cm, grün, Junge Lenard, mittl.« Sie kichert leise, weil sie den Grashüpfer nach ihm benannt hat.
Schnell hat Leonard einen weiteren Hüpfer gefangen und setzt ihn ohne Zwischenfall oder Ausbruch der Insassen im Glas ab.
Wen notiert: »3 cm, braun, Mädchen Izzy, niedrig.«
Er fragt: »Wie viele hast du jetzt?«
»Sieben.«
»Das ist eine mächtige magische Zahl.«
»Heißt das nicht Glückszahl?«
»Nein, Glück bringt sie nur manchmal.«
Seine Antwort verärgert Wen ein bisschen, schließlich weiß jeder, dass die Sieben eine Glückszahl ist. »Ich glaube, das ist eine Glückszahl, besonders für Grashüpfer.«
»Da hast du wahrscheinlich recht.«
»Gut. Das sollte reichen.«
»Was machen wir jetzt?«
»Du kannst mir helfen, sie zu beobachten.« Wen stellt das Einmachglas auf den Boden, und die beiden setzen sich im Schneidersitz gegenüber, das Glas zwischen ihnen. Wen hält Notizbuch und Stift griffbereit. Ein Windstoß raschelt durch das Papier, das zwischen ihren Handflächen geborgen liegt.
Leonard fragt: »Hast du die Löcher selber in den Deckel gestanzt?«
»Nein, Papa Eric. Wir haben einen alten Hammer und Schraubenzieher im Keller gefunden.« Der Keller war ein unheimlicher Ort, mit Schatten und Spinnweben in jeder Ecke. Da unten roch es wie am tiefen dunklen Grund eines Sees. Der Boden aus Zementplatten war kalt und körnig unter ihren nackten Füßen. Sie hatte sich Schuhe anziehen sollen, bevor sie hinabstieg, war aber zu aufgeregt gewesen und hatte es vergessen. Seile, verrostete Gartengeräte und alte Schwimmwesten hingen von entblößten Holzbalken, den geschundenen Knochen des Ferienhauses. Wen wünschte, ihre Wohnung in Cambridge hätte auch so einen Keller. Sobald sie wieder hochgeklettert waren, erklärte Papa Eric den Keller natürlich sofort zum Sperrgebiet. Wen protestierte, aber er sagte, es gebe da unten einfach zu viele scharfkantige und rostige Dinge – Dinge, die sowieso nicht ihnen gehörten und die man deshalb auch nicht anfassen oder benutzen sollte. Angesichts dieses Zutritt-zum-Keller-verboten-Vortrags stöhnte Papa Andrew vom kleinen Sofa im Wohnzimmer und sagte: »Papa Spaß ist schrecklich streng.« Papa Spaß war der meistens liebevoll gemeinte Spitzname für den Bedenkenträger der Familie, der am schnellsten Nein sagte. Papa Eric, wie immer die Ruhe selbst, sagte: »Ich meine es ernst. Guck dich da unten mal um. Das ist eine wahre Todesfalle.« Papa Andrew sagte: »Ist bestimmt alles ganz furchtbar. Wo wir gerade von Fallen reden!« Er packte Wen mit einem Überraschungsangriff, zog sie an sich, drehte sie um und gab ihr, was er als seinen »Gesichtskuss« bezeichnete: Er setzte die Lippen zwischen ihre Wange und ihre Nase und drückte sein großes Gesicht an ihres. Seine Bartstoppeln kitzelten und kratzten, und sie kicherte, schrie und schlängelte sich wie ein Wurm davon. Sie rannte mit ihrem Einmachglas zur Tür, und Papa Andrew rief ihr hinterher: »Aber wir müssen auf Papa Spaß hören, weil er uns ganz doll lieb hat, stimmt’s?« Wen rief »Nein«, und ihre Väter reagierten mit gespielter Entrüstung, als sie die Tür hinter sich zuzog.
Wen sieht vom Glas auf. Leonard starrt sie an. Er ist größer als ein Felsen, hat den Kopf schief gelegt und die Augen zusammengekniffen, entweder, weil die Sonne so hell ist oder weil er sie sehr aufmerksam beobachtet.
»Was? Warum schaust du so?«
»Tut mir leid, das war unhöflich von mir. Ich fand das nur irgendwie, ich weiß nicht, süß …«
»Süß?« Wen verschränkt die Arme vor der Brust.
»Cool wollte ich sagen. Cool! Dass du den Vornamen deines Vaters so benutzt. Papa Eric, richtig?«
Wen seufzt. »Ich habe zwei Väter.« Sie hält ihre Arme weiter verschränkt. »Ich benutze ihre Vornamen, damit sie wissen, mit wem ich rede.« Einer ihrer Freunde aus der Schule, Rodney, hat auch zwei Väter, aber sie werden im Spätsommer nach Brookline umziehen. Und Sasha hat zwei Mütter, aber Wen kann sie nicht wirklich leiden; sie ist viel zu rechthaberisch. Manche anderen Kinder in der Nachbarschaft und in der Schule haben nur eine Mutter oder einen Vater, und einige haben einen sogenannten Stiefelternteil oder jemanden, den sie Mamas oder Papas Partner nennen oder jemand anders, der gar keine spezielle Bezeichnung hat. Aber die meisten Kinder, die sie kennt, haben eine Mutter und einen Vater. Alle Kinder in ihren Lieblingsserien auf dem Disney Channel haben eine Mutter und einen Vater. Es gibt Tage, da geht Wen in der Pause oder auf dem Spielplatz (aber niemals in der chinesischen Schule) umher, tippt anderen Kindern auf die Schulter und erzählt ihnen, dass sie zwei Väter hat, nur um zu sehen, wie sie reagieren. Die meisten Kinder lassen sich dadurch nicht aus der Fassung bringen; es hat ein paar gegeben, die wütend auf einen Teil ihrer Eltern sind und ihr sagen, sie hätten auch gern zwei Väter oder zwei Mütter. An anderen Tagen glaubt sie, alles Geflüster und jedes Gespräch im Raum drehe sich um sie, und dann wünscht sie sich, die Lehrer und Nachmittagsbetreuer würden aufhören, ihr dauernd Fragen über ihre Väter zu stellen und zu sagen, das sei so toll.
Leonard sagt: »Ah, verstehe. Das leuchtet ein.«
»Ich finde, alle sollten sich nur mit Vornamen anreden. Das ist viel netter. Ich verstehe nicht, warum ich Leute mit Mr. und Mrs. und Miss anreden soll, bloß weil sie älter sind. Wenn du Papa Eric kennenlernst, wird er mir sagen, dass ich dich Mr. Soundso nennen soll.«
»Das ist aber nicht mein Nachname.«
»Was?«
»Soundso.«
»Hä?«
»Egal. Du hast von mir offiziell die Erlaubnis, mich Leonard zu nennen.«
»Okay. Leonard, findest du es komisch, zwei Väter zu haben?«
»Nein. Auf keinen Fall. Sagen andere Leute zu dir, dass es komisch ist, zwei Väter zu haben?«
Sie zuckt mit den Schultern. »Vielleicht. Manchmal.« Da gab es einen Jungen namens Scott, der ihr sagte, dass Gott ihre Väter nicht möge und sie Schwuchteln seien, aber er wurde vom Unterricht suspendiert und in eine andere Klasse gesteckt. Wen und ihre Väter hielten eine Familiensitzung ab und führten, in deren Worten, ein wichtiges, ernstes Gespräch. Ihre Väter warnten sie davor, dass einige Leute ihre Art von Familie nicht verstehen konnten und ihr gegenüber womöglich ignorante (deren Formulierung) und verletzende Dinge sagen würden, es aber vielleicht nicht die Schuld dieser Leute sei, weil sie von anderen ignoranten Leuten erzogen worden waren, die viel zu viel Hass im Herzen trugen, und ja, das alles war sehr traurig. Wen ging davon aus, dass es sich dabei um die gleichen bösen oder gefährlichen Fremden handelte, die sich in der Stadt versteckten und sie entführen wollten, aber je mehr sie darüber sprachen, was Scott gesagt hatte und warum auch andere Leute solche Dinge sagen könnten, desto mehr bekam sie das Gefühl, ihre Väter redeten von ganz alltäglichen Leuten. Waren sie drei nicht auch ganz alltägliche Leute? Ihren Vätern zuliebe hat Wen so getan, als würde sie es verstehen, aber das tat sie nicht, weder damals noch heute. Warum sollten sie und ihre Familie sich irgendwem gegenüber erklären, von irgendwem verstanden werden müssen? Sie ist glücklich und auch stolz, dass ihre Väter ihr genug vertrauen, um das wichtige, ernste Gespräch mit ihr geführt zu haben, trotzdem mag sie darüber nicht nachdenken.
Leonard sagt: »Ich finde das überhaupt nicht komisch. Ich finde, du und deine Väter, ihr seid eine wunderbare Familie.«
»Finde ich auch.«
Leonard setzt sich anders hin und verdreht den Kopf, sieht sich nach dem schwarzen SUV um, das nahe dem Haus auf dem kleinen Schotterparkplatz steht, und folgt mit den Augen der leeren Auffahrt und der Straße, bis sie zwischen den Bäumen verschwindet. Er dreht sich wieder um, atmet aus, reibt sich das Kinn und sagt: »Die tun nicht so viel, was?«
Wen glaubt, dass er über ihre Väter redet, und ist drauf und dran, ihn anzuschreien, dass sie sehr wohl eine Menge tun und wichtige Leute mit wichtigen Jobs sind.
Leonard scheint den drohenden Vulkanausbruch zu spüren, zeigt auf das Einmachglas und sagt: »Ich meine die Grashüpfer. Sie tun nicht viel. Sitzen eigentlich nur da und entspannen sich. Wie wir.«
»O nein. Glaubst du, sie sind krank?« Wen beugt sich vor, bis ihr Gesicht nur wenige Zentimeter vom Glas entfernt ist.
»Nein, denen geht es sicher gut. Grashüpfer hüpfen nur, wenn sie müssen. Man braucht viel Energie für solche Sprünge. Die sind wahrscheinlich erschöpft davon, dass wir sie gejagt haben. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn sie wie verrückt gegen das Glas sprängen.«
»Kann schon sein. Aber ich mach mir trotzdem Sorgen.« Wen setzt sich gerade hin und schreibt »müde, krank, unglücklich, hungrig, ängstlich?« in ihr Notizbuch.
»Hey, darf ich fragen, wie alt du bist, Wen?«
»In sechs Tagen werde ich acht.«
Leonards Lächeln scheint ein bisschen zu stocken, als wäre ihre Antwort auf die Frage eine traurige Sache. »Tatsache. Na dann, fast herzlichen Glückwunsch.«
»Ich mache zwei Feiern.« Wen holt tief Luft und rattert dann los. »Eine hier oben in der Hütte mit nur uns dreien und wir gehen richtige Bisonburger essen, nicht nur nach Bisonart mit Hühnchen, und dann Maiskolben und Eistorte und am Abend zünden wir ein kleines Feuerwerk und ich darf bis Mitternacht aufbleiben und nach Sternschnuppen Ausschau halten. Und dann …« Wen unterbricht sich und kichert, weil sie sich selbst nicht hinterherkommt, so schnell will sie reden. Auch Leonard muss lachen. Wen fängt sich wieder und fährt fort: »Und wenn wir wieder zu Hause sind, gehe ich mit meinen beiden besten Freunden Usman und Kelsey und vielleicht auch Gita ins Wissenschaftsmuseum in die Ausstellung über Elektrizität und ins Schmetterlingshaus und vielleicht ins Planetarium, und dann fahren wir noch mit den Entenbooten, glaube ich, und dann noch mehr Kuchen und Eis.«
»Wow. Das ist aber wirklich alles sehr sorgsam durchgeplant und ausgearbeitet.«
»Ich kann’s nicht erwarten, acht zu werden.« Eine Haarsträhne löst sich aus ihrem Pferdeschwanz und fällt ihr ins Gesicht. Flink schiebt Wen sie hinters Ohr zurück.
»Weißt du was? Ich glaube, ich habe da was für dich. Nichts Großes, aber vielleicht als vorzeitiges Geburtstagsgeschenk.«
Wen zieht die Stirn kraus und verschränkt abermals die Arme vor der Brust. Ihre Väter haben ihr sehr unmissverständlich gesagt, Fremden vor allem dann nicht zu trauen, wenn sie Geschenke anbieten. Sie ist noch nicht allzu lange hier draußen mit Leonard allein, aber jetzt kommt es ihr doch etwas zu lange vor. »Was denn? Warum willst du mir das geben?«
»Ich weiß, das klingt komisch, ist auch echt verrückt, aber irgendwie habe ich damit gerechnet, heute jemanden wie dich zu treffen, und da bin ich dort hinten die Straße entlanggegangen und habe das hier gesehen«, er fummelt an der Brusttasche seines Hemds herum, »und aus irgendeinem Grund gedacht, ich sollte sie mitnehmen, auch wenn ich so was normalerweise nie tue. Also habe ich sie gepflückt. Und jetzt würde ich sie dir gern schenken.«
Leonard zieht ein schlaffes Blümchen mit einem Kranz dünner weißer Blütenblätter hervor.
So unangenehm ihr der Gedanke eines Geschenks von einem Fremden gerade eben noch war – Wen ist trotzdem enttäuscht und gibt sich auch keine Mühe, das zu verbergen. »Eine Blume?«
»Wenn du sie nicht behalten willst, können wir sie zu den Grashüpfern ins Glas setzen.«
Plötzlich fühlt Wen sich schlecht, als hätte sie etwas Gemeines gesagt, obwohl sie das gar nicht vorhatte. Sie versucht es mit einem Scherz. »Die heißen Grashüpfer, nicht Blumenhüpfer.« Aber dann fühlt sie sich noch schlechter, weil das nun wirklich gemein klingt.
Leonard lacht und sagt: »Stimmt. Wahrscheinlich sollten wir nicht zu sehr in ihren Lebensraum eingreifen.«
Fast lässt sich Wen theatralisch ins Gras sinken, so erleichtert ist sie. Leonard hält die Blume über das Einmachglas, über das Wiesenstück, das zwischen ihnen liegt. Wen nimmt sie entgegen, sehr darauf bedacht, nicht aus Versehen seine Hand zu berühren.
Er sagt: »Sie ist ein bisschen gequetscht davon, dass ich sie in der Tasche hatte, aber ansonsten noch heil.«
Wen setzt sich aufrecht und drückt vorsichtig den gebogenen Stängel gerade, der etwa so lang ist wie ihr Zeigefinger. Der Stängel fühlt sich lose an und wird wahrscheinlich bald abfallen. Inmitten der Blüte sitzt ein kleiner gelber Ball. Die sieben Blütenblätter sind lang, dünn und weiß. Erwartet er von ihr, dass sie sich die Blume ins Haar oder hinters Ohr steckt oder ins Haus läuft, um sie in ein Glas Wasser zu stellen? Sie hat eine bessere Idee und sagt: »Die sieht schon etwas tot aus. Sollen wir sie auseinanderzupfen und daraus ein Spiel machen?«
»Du kannst mit ihr machen, was immer du willst.«
»Wir zupfen abwechselnd ein Blütenblatt ab und stellen dabei eine Frage, die der andere beantworten muss. Ich fange an.« Wen zupft ein Blatt. »Wie alt bist du?«
»Ich bin vierundzwanzigeinhalb Jahre alt. Noch ist mir das halbe Jahr wichtig.«
Wen gibt Leonard die Blume zurück und sagt: »Pass auf, dass du wirklich nur eins abrupfst.«
»Ich werde mir Mühe geben, mit diesen Riesenpranken.« Er befolgt Wens Anweisung und zieht vorsichtig ein Blütenblatt ab. Er drückt die Fingerspitzen ganz fest zusammen, um sicherzugehen, dass er auch wirklich nur ein einziges erwischt. »Da. Puh.« Er reicht ihr die Blume.
»Und meine Frage?«
»Ach stimmt. Tut mir leid. Ähm …«
»Die Fragen müssen schnell gestellt werden und die Antworten auch schnell kommen.«
»Alles klar, Verzeihung. Äh, was ist dein Lieblingsfilm?«
»Baymax.«
»Den mag ich auch sehr.« Er sagt es beiläufig, und zum ersten Mal, seit sie ihn kennengelernt hat, fragt Wen sich, ob er sie vielleicht belügt.
Leonard händigt ihr die Blume aus. Wen zieht mit flinken Fingern ein Blatt ab. Sie sagt: »Normalerweise fragen alle immer, was ist dein Lieblingsessen. Ich will wissen, welches Essen du am wenigsten magst.«
»Das ist einfach. Brokkoli. Ich hasse Brokkoli.« Leonard nimmt die Blume und zupft ein Blütenblatt. Er dreht sich um, wirft wieder einen kurzen Blick die Einfahrt hinunter und fragt: »Was ist deine früheste Erinnerung?«
Mit der Frage hat Wen nicht gerechnet. Fast sagt sie, dass die Frage unfair und zu schwer ist, aber sie will sich nicht vorwerfen lassen, die Regeln einfach zu ihren Gunsten zu erfinden, was ihre Freunde schon mehr als einmal behauptet haben. Sie ist sehr auf Ehrlichkeit bedacht, wenn es um Spiele geht. »Meine früheste Erinnerung ist, dass ich in einem großen Raum bin.« Sie breitet weit die Arme aus, und das Notizbuch rutscht ihr vom Schoß und fällt in die Wiese. »Ich war ganz klein, vielleicht sogar noch ein Baby, und da waren Ärzte und Krankenschwestern, die mich alle angeguckt haben.« Sie erzählt Leonard nicht die ganze Geschichte, dass da auch noch andere Betten und Kinderbettchen in dem Raum standen und die Wände grün bemalt waren (an den hässlichen grünen Farbton kann sie sich noch lebhaft erinnern), und dass da andere Kinder waren, die geschrien haben, und sich die Ärzte und Krankenschwestern ganz dicht über sie gebeugt haben, mit Köpfen so groß wie der Mond, und sie alle Chinesen waren, ganz wie sie selbst.
Wen inspiziert das Einmachglas und stößt es fast um, will so schnell wie möglich die Blume zurückhaben, bevor Leonard die Regeln bricht und eine Zusatzfrage stellt. Ein weiteres Blütenblatt wird gezupft, das sie zwischen ihren Fingern zu einem kleinen Ball einrollt. »Vor welchem Monster hast du Angst?«
Leonard zögert keine Sekunde. »Vor den riesigen wie Godzilla. Oder den Dinosauriern aus Jurassic Park. Bei den Filmen habe ich mich halb zu Tode gegruselt. Ich hatte ständig Albträume, dass mich der T-Rex auffrisst oder zertrampelt.«
Wen hat sich nie vor riesigen Monstern gefürchtet, aber da sie Leonard jetzt so darüber reden hört, sich umschaut und die Bäume betrachtet, die höher wachsen, als sie je greifen kann, wie sie sich sanft im Wind biegen und winken, kann sie gut verstehen, dass man vor großen Dingen Angst hat.
Leonard ist wieder an der Reihe. Er zupft und fragt: »Woher hast du diese winzige weiße Narbe an der Lippe?«
»Du kannst sie sehen?«
»Kaum. Nur gerade so eben, wenn du dich in eine bestimmte Richtung drehst.«
Wen schaut nach unten, schürzt die Lippen und versucht, sie selbst zu erspähen. Natürlich ist sie da. Wen sieht sie, wann immer sie in den Spiegel schaut, und manchmal wünscht sie, die Narbe würde verschwinden und sie müsste sie nie mehr sehen, und manchmal hofft sie, die Narbe wird immer bleiben, und dann fährt sie mit einem Finger den Schnitt entlang, als ob sie mit einem Stift eine Linie nachzeichnet.
»Tut mir leid, falls dir das unangenehm ist. Ich hätte das nicht fragen sollen. Entschuldige.«
Wen rutscht herum, positioniert ihre Beine bequemer und sagt: »Schon gut.«
Ihre Lippenspalte ging einmal bis hinauf zu ihrem rechten Nasenloch, sodass die beiden leeren, dunklen Zwischenräume einander überlappten und zu einem wurden. Letzten Herbst hat Wen ihre Väter angefleht, Babyfotos sehen zu dürfen, die frühesten, die sie von ihr besaßen, aus der Zeit vor den Operationen, bevor sie Wen adoptiert hatten. Es hatte eine Menge Überzeugungsarbeit gekostet, aber schließlich willigten ihre Väter ein. Sie hatten eine Reihe von fünf Fotos, auf denen sie auf dem Rücken auf einem weißen Laken lag, mit wachem Blick und geballten Fäustchen, die neben dem nicht wiederzuerkennenden Gesicht schwebten. Die Bilder setzten ihr unerwartet stark zu und überzeugten sie kurzzeitig davon, zum ersten Mal ihr eigentliches Selbst vor sich zu sehen, das nicht mehr existierte, vergessen und verbannt worden war – oder schlimmer noch, dass dieses ungewollte Kind versteckt worden war, irgendwo tief in ihr eingeschlossen. Wen war so bestürzt, dass ihre Hände zitterten und sich das Beben durch den ganzen Körper ausbreitete. Nachdem ihre Väter sie beschwichtigt hatten, beruhigte sie sich langsam und bedankte sich seltsam förmlich bei ihnen, die Fotos gesehen haben zu dürfen. Sie bat darum, die Bilder zu entfernen, denn sie sagte, sie wolle sie nie wieder betrachten. Aber das wollte sie sehr wohl, und gar nicht selten. Ihre Väter hielten die Holzkiste mit den Fotos unter ihrem Bett verwahrt, und wann immer sie konnte, schlich Wen sich in das elterliche Schlafzimmer, um sie zu betrachten. Da waren auch noch andere Bilder in dieser Kiste, Bilder von ihren Vätern in China; Papa Eric sah extrem komisch aus mit den dünnen, strähnigen Haaren, die sich an seinen Kopf klammerten – seit sie sich erinnern kann, läuft er immer mit frisch rasierter Glatze herum –, und Papa Andrew sah aus wie immer, mit seinen dunklen langen Haaren. Es gab auch Bilder von ihnen zu dritt im Waisenhaus, und auf einem hielten ihre Väter sie zwischen sich erhoben. Sie war so groß wie ein Laib Brot und fest in eine Decke gehüllt, nur Stirn und Augen waren zu sehen. Erst sah sie sich die Bilder von ihren Vätern an, dann die Bilder, auf denen nur sie selbst zu sehen war. Je länger sie die Bilder betrachtete, desto mehr schwand das beängstigende Ihr-echtes-Selbst-steckt-in-diesem-Baby-gefangen-Gefühl. Ja, da war ihr kleiner Kopf mit dem ungezähmten schwarzen Haarschopf oberhalb des unförmigen Klumpens, der einmal ihr Gesicht werden sollte. Wen fuhr mit dem Finger die Grenze von Haut und Leere an ihrer Lippenspalte entlang, bewegte und verzog dann ihren Mund und versuchte sich vorzustellen, wie es sich angefühlt haben musste, diese klaffende Lücke und all den leeren Raum besessen zu haben. Sooft sie die Kiste wieder unter das Bett zurückschob, fragte sie sich, ob ihre biologischen Eltern sie wegen ihres Aussehens im Waisenhaus abgegeben hatten. Eric und Andrew haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie in China geboren und von ihnen adoptiert worden ist. Sie haben ihr eine Menge Bücher gekauft, sie stets darin bestärkt, so viel wie möglich über chinesische Kultur zu lernen, und letzten Januar haben sie Wen in einer chinesischen Schule angemeldet (zusätzlich zur normalen Schule, die sie jeden Tag besucht). Seitdem sitzt sie dort jeden Samstagmorgen im Unterricht und lernt, Chinesisch zu lesen und zu schreiben. Nur selten fragt sie ihre Väter nach ihren biologischen Eltern. Über sie ist so gut wie nichts bekannt; ihren Vätern wurde gesagt, Wen sei anonym beim Waisenhaus abgegeben worden. Einmal hat Papa Andrew vermutet, ihre Eltern könnten zu arm gewesen sein, um sich angemessen um sie zu kümmern, und könnten ganz einfach gehofft haben, ihr würde anderswo ein besseres Leben zuteilwerden.
Sie sagt: »Als Baby hatte ich eine sogenannte Lippenspalte. Die ist gerichtet worden. Es hat viele Ärzte viel Zeit gekostet, sie zu richten.«
»Die haben beeindruckende Arbeit geleistet, dein Gesicht ist wunderschön.«
Sie wünscht, er hätte das nicht gesagt, und ignoriert ihn. Vielleicht ist es an der Zeit, einen ihrer Väter oder beide zu holen. Sie hat keine Angst vor Leonard, nicht wirklich, aber langsam kommt ihr die ganze Situation seltsam vor. Sie bringt einen ihrer Väter zur Sprache, als sei die Erwähnung seines Namens fast so gut, wie ihn herbeizurufen. »Papa Andrew hat auch eine große Narbe, die hinter seinem Ohr anfängt und bis runter zum Hals läuft. Er trägt die Haare immer lang, damit man sie nicht sehen kann, es sei denn, er zeigt sie einem.«
»Was ist passiert?«
»Als Kind ist er aus Versehen am Kopf getroffen worden. Irgendwer hat einen Baseballschläger geschwungen und ihn nicht gesehen.«
Leonard sagt: »Aua.«
Wen überlegt, ihm zu erzählen, dass Papa Eric sich den Kopf rasiert und Wen manchmal darum bittet, seine Glatze nach Schnittwunden und Narben abzusuchen. Da sind nie solche Narben wie ihre oder Papa Andrews, und wenn sie doch einen kleinen roten Schnitt findet, ist er jedes Mal verheilt und verschwunden, wenn sie das nächste Mal nachschaut.
Sie sagt: »Das ist schon ungerecht.«
»Was denn?«
»Du kannst meine Narbe sehen, aber bei dir ist alles in Ordnung.«
»Nur weil man keine sichtbaren Narben hat, heißt das noch lange nicht, dass alles in Ordnung ist, Wen. Das ist sehr wichtig. Ich …«
Wen unterbricht ihn mit einem Seufzer. »Ich weiß. Ich weiß. So meine ich das nicht.«
Leonard dreht sich schon wieder um und bleibt so verdreht sitzen, als hätte er etwas entdeckt, aber hinter ihm ist nichts zu sehen, bis auf das Auto, die Auffahrt und die Bäume. Dann sind von irgendwo tief im Wald leise Geräusche zu hören, vielleicht auch von der Straße. Sie sitzen beide ganz still da und lauschen. Langsam werden die Geräusche lauter.
Leonard dreht sich wieder zu Wen um und sagt: »Ich habe nicht so eine Narbe wie du oder dein Vater, aber wenn du mein Herz sehen könntest, würdest du sehen, dass es gebrochen ist.« Er lächelt jetzt nicht mehr. Er schaut ganz traurig und ernst, als müsste er gleich anfangen zu weinen.
»Warum ist es gebrochen?«
Die Geräusche sind jetzt problemlos zu hören, ohne dass sie leise sein müssen. Bekannte Geräusche, Füße, die mit Trampeln und Stampfen über die unbefestigte Straße durch den Wald näher kommen wie vorhin, als Leonard aufgetaucht ist. Wo ist Leonard überhaupt hergekommen? Sie hätte ihn fragen sollen. Sie weiß, das hätte sie tun müssen. Er muss von weit weg gekommen sein. Und jetzt klingt es nach einer ganzen Menge Leonards (oder Bären? Vielleicht sind es dieses Mal wirklich Bären), die da die Straße entlangkommen.
Wen fragt: »Kommen noch mehr Leute her? Sind das deine Freunde? Sind sie nett?«
Leonard sagt: »Ja, es kommen noch ein paar Leute. Wir sind jetzt auch Freunde, Wen. Ich würde dich nicht anlügen. Also will ich dich auch, was sie angeht, nicht belügen. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich als Freunde bezeichnen würde. Ich kenne sie nicht besonders gut, aber wir haben etwas sehr Wichtiges zu erledigen. Das Wichtigste, was es je in der Weltgeschichte gegeben hat. Ich hoffe, du verstehst das.«
Wen steht auf. »Ich muss jetzt gehen.« Die Geräusche sind sehr nah. Sie kommen vom Ende der Auffahrt, sind aber noch nicht ganz um die Kurve und die Bäume gebogen. Sie will diese anderen Leute nicht sehen. Wenn sie sie nicht sieht, sich weigert, sie zu sehen, gehen sie vielleicht wieder weg. Sie sind so laut. Vielleicht kommen statt Bären Leonards riesige Monster und Dinosaurier, um sie beide zu fressen.
Leonard sagt: »Bevor du rein zu deinen Vätern gehst, musst du mir zuhören. Das ist sehr wichtig.« Leonard krabbelt aus seinem Schneidersitz und stützt sich auf einem Knie ab. Seine Augen sind voller Tränen. »Hörst du mir zu?«
Wen nickt und macht einen Schritt zurück. Drei Leute kommen um die Biege und betreten die Auffahrt. Zwei Frauen und ein Mann. Sie tragen Jeans und verschiedenfarbige Hemden; schwarz, rot und weiß. Die größere der beiden Frauen hat blasse Haut und braune Haare, und ihr weißes Hemd ist anders weiß als das von Leonard. Sein Hemd leuchtet wie der Mond, ihres dagegen ist matt, ausgewaschen, fast grau. Wen prägt sich die offenbar absichtliche Abstimmung, wie sich Leonard und die drei Fremden kleiden, als etwas Wichtiges ein, das sie ihren Vätern mitteilen muss. Sie wird ihnen alles erzählen, und sie werden wissen wollen, warum diese vier Leute allesamt Jeans und Hemden tragen. Vielleicht können ihre Väter ihr dann auch erklären, warum die drei Neuankömmlinge solche komischen Werkzeuge mit langen Stielen dabeihaben.
Leonard sagt: »Du bist ein wunderbarer Mensch, innerlich wie äußerlich. Einer der wunderbarsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, Wen. Und deine Familie ist auch perfekt und wunderbar. Bitte glaube mir das. Es geht hier nicht um dich. Es geht um uns alle.«
Keins dieser Geräte ist eine Sense, sie sehen aber wie bedrohliche Albtraumversionen von Sensen aus, mit groben Formen am Ende der Stiele statt glatter, geschwungener Klingen. Die drei hölzernen Schäfte sind lang und dick und mochten vielleicht einst von Schaufelblättern oder Harken gekrönt worden sein. Der stämmige Mann im roten Hemd hat am oberen Ende seines Schafts mit Nägeln und Schrauben einen Blumenstrauß aus Schaufeln und Spachteln montiert. Das untere Ende in der Nähe seiner Füße ziert ein großer, stumpfer, roter Block aus verbeultem und abgeplatztem Metall, der Kopf eines häufig gebrauchten Vorschlaghammers. Jetzt, als er näher kommt, sieht sein Schaft besonders dick aus, wie das Ruder eines Boots mit abgesägtem Blatt. Während Wen schon rückwärts auf die Hütte zugeht, sieht sie die Kränze aus Schrauben und Nagelköpfen, die beide Enden seines Holzstiels wie Fliegenhaare umringen. Die kleinere Frau trägt ein schwarzes Hemd, und ihr Holzstiel endet in einem Windrädchen aus den Zinken mehrerer Harken wie gekrümmte Metallfinger, die zu einem großen zerklüfteten Ball arrangiert sind, sodass ihr Werkzeug wie der gefährlichste Lutscher der Welt aussieht. Die andere Frau trägt das mattweiße Hemd, und am Ende ihres Stiels steckt eine einzige lange Klinge, verbogen und um sich selbst gedreht wie eine Schriftrolle, die sich zu einem rechtwinkligen Dreieck verjüngt und in einer scharfen Spitze endet.
Wens abgehackte, zögerliche Rückwärtsschritte werden zu weiten, ebenso ungelenken Sprüngen. Sie sagt: »Ich gehe jetzt rein.« Sie muss es laut aussprechen, um sich selbst davon zu überzeugen, dass sie das Haus betreten wird, statt stehen zu bleiben und die Fremden anzustarren.
Leonard kniet noch immer im Gras, die dicken schrecklichen Arme weit ausgebreitet. Sein Gesicht ist groß und traurig, wie alle ehrlichen Gesichter traurig wirken. Er sagt: »Nichts von dem, was passieren wird, ist deine Schuld. Du hast nichts falsch gemacht, aber ihr drei habt ein paar schwere Entscheidungen vor euch. Grässliche Entscheidungen, fürchte ich. Ich wünsche mit jeder Faser meines gebrochenen Herzens, ihr müsstet das nicht tun.«
Wen stolpert die Stufen hinauf, noch immer rückwärts, hat nur noch Augen für die verstörenden Gebilde aus Holz und Metall in den Händen der Fremden.
Leonard schreit, aber es klingt weder wütend noch verzweifelt. Er schreit, damit Wen ihn auf die wachsende Entfernung noch hören kann. »Deine Väter werden uns nicht reinlassen wollen, Wen. Aber das müssen sie. Sage ihnen, dass sie das müssen. Wir sind nicht hier, um euch wehzutun. Wir brauchen eure Hilfe, um die Welt zu retten. Bitte.«
2
Kleine Schaumkronen zieren das Wasser wie winzige Pinselstriche, branden lautlos ans felsige Ufer und gegen die Metallröhren, die den funktionstüchtigen, wenn auch arg heruntergekommenen Bootssteg der Hütte stützen. Die Holzplanken sind grau ausgebleicht, in sich verzogen und wirken wie die Knochen eines Fossils, der Brustkorb eines sagenumwobenen Seeungeheuers. Andrew hat Wen versprochen, ihr beizubringen, vom Rand des Anlegers nach Barschen zu angeln, bevor Eric vorschlagen konnte, dass sie alle einen Bogen um das knirschende, vernachlässigte Gebilde machen sollten. Aber Eric ist zuversichtlich, dass Wen vom Angeln nichts mehr wissen will, sobald der erste Wurm auf seinen Haken gespießt wird. Und wenn der zuckende, ringelnde Todeskampf und die Innereien des Wurms nicht reichen, wird sie es spätestens aufgeben, sobald sie die Widerhaken mit Gewalt aus dem runden Maul eines Barschs reißen muss. Natürlich könnte es auch sein, dass sie es liebt und darauf besteht, alles selbst zu machen, das Beködern des Hakens eingeschlossen. Ihr Drang nach Selbstständigkeit ist so ausgeprägt, dass es oft an Trotz grenzt. Sie ist Andrew so ähnlich geworden, dass Eric sie umso mehr liebt – und sich umso größere Sorgen um ihre Sicherheit macht. Als Wen gestern spätabends in ihren Badeanzug schlüpfte, hat Andrew Erics Versuch, eine Diskussion über den klapprigen Anleger zu starten, damit unterbunden, dass er zu einem Sprint ansetzte, das Gebilde mit erdbebenhaften Stößen der Länge nach überquerte und wie eine Kanonenkugel in den See klatschte.
Eric und Andrew fläzen sich auf der erhöhten Veranda hinterm Haus, die den ausgedehnten Gaudetsee überblickt; er ist tief und dunkel, denn sein Becken wurde vor fünfzehntausend Jahren von Gletschern aus dem Boden gemeißelt und wird von einem schier endlosen Wald aus Kiefern, Tannen und Birken umsäumt. Jenseits des Walds, so fern und unerreichbar wie die Wolken, ragen im Süden die uralten Buckel der White Mountains auf, die natürliche Festung des Sees, unbezwingbar und unumgänglich. Die umgebende Landschaft ist nicht nur das spektakuläre Neuengland in Reinform, sondern auch vollkommen fremdartig, verglichen mit ihrem normalen Leben in der Großstadt. Rings um den See stehen eine Handvoll Hütten und Ferienlager, aber von ihrer Veranda aus ist davon nichts zu sehen. Das einzige Boot, das sie seit ihrer Ankunft ausgemacht haben, war ein gelbes Kanu, das stumm auf der gegenüberliegenden Seite des Sees vorbeiglitt. Wortlos standen sie zu dritt da und sahen es außer Sichtweite verschwinden, als sei es vom unsichtbaren Rand der Erde gefallen.
Das nächste Ferienhaus liegt zwei Meilen entfernt entlang der ehemaligen Holzabfuhrstraße. Ganz früh heute Morgen, lange bevor Andrew oder Wen aufgewacht sind, ist Eric zu der leer stehenden Hütte gejoggt, die vor Kurzem einen frischen dunkelblauen Anstrich bekommen hat, mit weißen Fensterläden und einem dekorativen Paar Schneeschuhe neben der weißen Vordertür. Er musste einem unerklärlich starken Drang widerstehen, durch die Fenster zu spähen und das Grundstück zu erkunden. Nur die irrationale Angst davor, von den abwesenden Besitzern erwischt zu werden und sich durch eine peinliche Rechtfertigung seines Verhaltens stammeln zu müssen, ließ ihn umkehren.
Eric liegt halb versunken in einer Chaiselongue im gleißenden Sonnenlicht. Er hat vergessen, ein Handtuch über den Stuhl zu legen, weshalb das Kunststoffgeflecht an seinem nackten Rücken klebt. Wenn er sich nicht bald etwas Sonnencreme besorgt, wird er in wenigen Minuten einen leichten Sonnenbrand haben. Als Kind hat er sich den stechenden Schmerzen des Sonnenbrands oft absichtlich ausgesetzt, um seine großen Schwestern mit der sich abschälenden Haut anzuekeln. Ganz sorgfältig hat er große Flocken Haut abgezogen und sie an seinem Körper hängen lassen, wie Miniaturen der Rücken- und Schwanzplatten des Stegosaurus, seines Lieblingsdinosauriers.
Andrew ist kaum zwei Meter entfernt, aber kein Stück seiner blassen Haut ist der Sonne ausgesetzt. Er sitzt mit angewinkelten Beinen auf einer schmalen Bank unter einem beinahe durchsichtigen Schirm, der den alten Picknicktisch überdacht. Die rote Lackierung des Tischs blättert in langen Streifen ab. Andrew trägt eine kurze schwarze Schlabberhose und ein langärmeliges graues T-Shirt mit dem Wappen der Boston University, seine langen Haare stecken als Pferdeschwanz unter einer armeegrünen Schiebermütze. Er ist über eine Sammlung von Essays über südamerikanische Schriftsteller und den magischen Realismus des zwanzigsten Jahrhunderts gebeugt. Eric weiß genau, um welches Buch es sich handelt, denn seit ihrer Ankunft im Ferienhaus hat Andrew schon dreimal erzählt, was er gerade liest, und in den zwanzig Minuten, die sie jetzt auf der Veranda sitzen, hat er bereits zwei Passagen über Gabriel García Márquez laut vorgetragen. Eric hat Hundert Jahre Einsamkeit damals im College gelesen, zu seiner Schmach aber kaum etwas davon behalten. Dass Andrew jetzt unverhohlen angibt und um Erics Beifall buhlt, ist ebenso liebenswert wie nervtötend.
Eric liest seit mehreren Minuten immer wieder den gleichen Absatz des Romans, über den diesen Sommer angeblich alle reden. Es ist ein typischer Thriller über das Verschwinden einer Figur, und der gekünstelte, fast schon absurde Plot langweilt ihn längst. Aber trotzdem ist nicht das Buch daran schuld, dass er sich nicht konzentrieren kann.
»Einer von uns sollte mal nachschauen, was Wen treibt.« Er hat seinen Satz absichtlich nicht als Frage formuliert, die Andrew direkt verneinen kann. Es ist eine Feststellung; etwas, auf das er aktiv reagieren muss.
»Und mit einer von uns meinst du mich?«
»Nein.« Eric sagt es so, dass Andrew es sofort in Ja, natürlich, sonst hätte ich es gar nicht erst erwähnt übersetzen kann. Er weiß wirklich nicht, wie er zum überbesorgten Elternteil geworden ist, der Wert auf Disziplin legt (Himmel, wie er dieses Wort hasst), dessen Gedanken so schnell um die schlimmstmöglichen Szenarien kreisen. Eric ist stolz darauf, ein freundlicher Kerl zu sein, wie man das im Westen Pennsylvanias eben lernt, mit dem man über alles reden kann, der einen kühlen Kopf bewahrt und stets gewillt ist, auf Konsens und Kompromisse hinzuarbeiten. Als zweitjüngstes von neun Kindern aus streng katholischem Elternhaus hatte ihn seine Begabung, mit fast jedem reden und für sich einnehmen zu können, sicher durch die verstörenden Jahre der Pubertät und die geradezu turbulenten frühen Zwanziger gebracht, nachdem er sich geoutet hatte und seine Eltern sich weigerten, ihm das letzte Semester an der Universität von Pittsburgh zu bezahlen. Erics Antwort bestand darin, bei vielen großzügigen Freunden reihum auf dem Sofa zu schlafen und zwei Jahre lang in einem beliebten Sandwichladen in der Nähe vom Campus zu arbeiten, bis er den Rest der Studiengebühren selbst bezahlen und seinen Abschluss machen konnte. All die Zeit über telefonierte er immer wieder mit seinen Eltern (hauptsächlich mit seiner Mutter) und blieb zuversichtlich, dass sie sich schon noch besinnen würden. Was sie auch taten. An dem Tag, als Eric sein Abschlusszeugnis bekam, tauchten seine Eltern mit Tränen in den Augen in der Wohnung seines Freunds auf, entschuldigten sich wortreich und händigten ihm einen Scheck aus, der die Höhe der College-Gebühren plus Bonus beinhaltete, ein Scheck, den Eric auf der Stelle einlöste, um nach Boston umzuziehen. Er war jetzt Marktanalytiker für eine Firma namens Financeer und wurde aufgrund seiner unübersehbaren sozialen Kompetenz hin und wieder darum gebeten, kontroverse Sitzungen zwischen dem Verwaltungsrat und dem Direktor seiner Abteilung als Mediator zu betreuen. Eric steht allen Belangen seines Lebens entspannt gegenüber, mit einer Ausnahme, nämlich der Erziehung. Andrew musste ihn praktisch auf die Veranda hinterm Haus zerren, damit er nicht im Wohnzimmer blieb, zum Fenster hinausstarrte und pflichtbewusst observierte, wie Wen allein auf der Wiese spielt.
Andrew schaut nicht von seinem Buch auf, sondern sagt: »Bären. Wen steckt bis zum Hals zwischen Bären.«
Eric lässt sein Buch fallen, das laut auf die Holzbohlen kracht. »Du bist so was von unlustig.« Die Besitzer der Hütte haben in Großbuchstaben strikte Anweisungen hinterlassen, keine ungesicherten Müllsäcke draußen zu lagern, weil es Bären anziehen könnte. Weiter hinten auf dem Gelände gibt es einen kleinen Schuppen, der nur dazu dient, den Müll zu beherbergen und zu verstecken. Später sollen sie die Säcke zu einer Müllkippe im nächsten Städtchen bringen (die für Ortsfremde nur am Dienstag, Donnerstag und Samstag geöffnet ist), vierzig Autominuten entfernt und zu einer Abgabe von zwei Dollar pro Sack. Sie hätten auch ein Ferienhaus am beliebten Winnipesaukeesee mieten können, einem Touristen-Hotspot im mittleren Süden des Staats, wo Eric sich keine (oder weitaus weniger) Sorgen über Bären hätte machen müssen, statt dieser wundervollen, aber entlegenen Hütte, die so verloren im Wald steht wie Goldlöckchen (noch mehr Bären …), einen Steinwurf von der Grenze zu Kanada. Eric setzt sich aufrecht hin und reibt sich die Glatze, die unverschämt heiß ist und definitiv einen Sonnenbrand abgekriegt hat.
Andrew sagt: »Bin ich gar nicht.«
»Jetzt gerade sehr wohl.«
»Ich kann von hier im Sitzen nach ihr rufen. Aber das könnte die Bären aufschrecken. Dann greifen sie schneller an.«
Eric lacht. »Du bist echt ein Arsch.« Er steht auf, geht zur Reling der Veranda, streckt sich und tut so, als würde er entspannt über den See schauen, statt gleich ins Haus oder die Treppe von der Veranda runter und schnurstracks ums Haus herum zu gehen.
»Vielleicht wäre es gar nicht so schlimm, wenn ein paar Bären vorbeikommen. Ich mag Bären.« Andrew klappt das Buch zu. Seine großen dunkelbraunen Augen und sein breites Lächeln sagen: Wie pfiffig und süß ich doch bin.