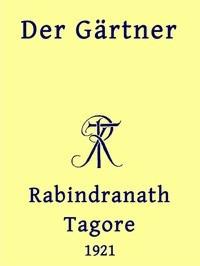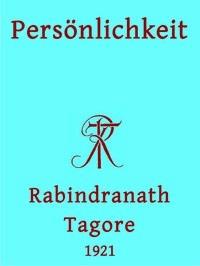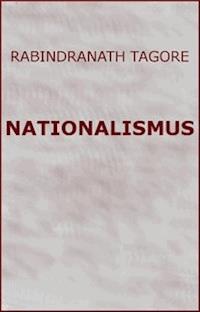0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Ähnliche
The cover image was created by the transcriber and is placed in the public domain.
RABINDRANATH TAGORE
GESAMMELTE WERKE
SECHSTER BAND
DAS HEIM UND DIE WELT
MÜNCHEN KURT WOLFF VERLAG
RABINDRANATH TAGORE
DAS HEIM UND DIE WELT
ROMAN
MÜNCHEN KURT WOLFF VERLAG
Einzig autorisierte deutsche Ausgabe. Nach der von Rabindranath Tagore selbst veranstalteten englischen Ausgabe ins Deutsche übertragen von Helene Meyer-Franck
Copyright 1920 by Kurt Wolff Verlag in München
DAS HEIM UND DIE WELT
ERSTES KAPITEL
BIMALAS ERZÄHLUNG
I
Mutter, heute sehe ich wieder vor meinem Geiste dein rotes Stirnzeichen[1], den Sari[2], den du zu tragen pflegtest, mit seinem breiten, roten Saum, und deine wundervollen Augen voll Tiefe und Frieden. Sie kamen am Anfang meiner Lebensbahn wie das erste Licht des dämmernden Morgens und gaben mir goldenen Vorrat mit auf den Weg.
Das Antlitz meiner Mutter war dunkel, aber es hatte einen Heiligenschein, und ihre Schönheit beschämte alle Eitelkeit der Schönen.
Jeder sagt, daß ich meiner Mutter ähnlich sehe. In meiner Kindheit mochte ich dies gar nicht hören. Ich hatte das Gefühl, daß Gott ungerechterweise eine Hülle um meine Glieder gelegt hätte, — daß mein dunkles Antlitz mir eigentlich nicht zukäme, sondern durch irgend ein Versehen mir zuteil geworden wäre. Alles, was ich von Gott als Entschädigung dafür erbitten konnte, war, daß ich zu der Idealgestalt eines Weibes heranwachsen möchte, wie sie die großen Heldengedichte schildern.
Als der Heiratsantrag für mich kam, prüfte der begleitende Astrolog meine Handfläche und sagte: »Dies Mädchen hat gute Zeichen. Sie wird eine ideale Ehefrau werden.«
Und alle Frauen, die es hörten, sagten: »Das ist kein Wunder, denn sie gleicht ihrer Mutter.«
Ich wurde mit einem Radscha[3] vermählt. Als Kind war ich ganz vertraut mit den Schilderungen von Märchenprinzen. Aber das Gesicht meines Gatten war nicht so, daß die Phantasie ihn ins Märchenland verpflanzen würde. Es war dunkel, ebenso dunkel wie meines. Das Gefühl der Scheu, das ich wegen meines Mangels an körperlicher Schönheit hatte, wich dadurch etwas; doch zugleich empfand ich im Herzen ein leises Bedauern.
Aber wenn unser Antlitz dem prüfenden Blick der Sinne ausweicht und sich ins Heiligtum des Herzens rettet, da kann es sich selbst vergessen. Ich weiß noch aus der Erfahrung meiner Kindheit, wie hingebende Liebe die Schönheit selbst ist, von innen gesehen. Wenn meine Mutter die verschiedenen Früchte, die sie selbst mit ihren liebenden Händen sorgfältig geschält hatte, auf dem weißen Steinteller ordnete und sanft mit dem Fächer wedelte, um die Fliegen zu verscheuchen, während mein Vater beim Mahl saß, strömte ihre dienende Liebe in einer Schönheit aus, die über alle äußere Form war. Schon in meiner frühen Kindheit konnte ich die Macht dieser Schönheit fühlen. Sie war erhaben über alle Worte und Zweifel und Berechnungen, sie war ganz Musik.
Ich erinnere mich noch deutlich, wie ich nach meiner Heirat früh am Morgen vorsichtig und leise aufzustehen pflegte, um meines Gatten Füße ehrfurchtsvoll zu berühren[4], ohne ihn zu wecken, und wie mir in solchen Augenblicken war, als ob das rote Abzeichen auf meiner Stirn wie der Morgenstern strahlte.
Eines Tages wachte er zufällig auf und fragte mich lächelnd: »Was ist das, Bimala? Was tust du denn da?«
Ich werde nie vergessen, wie ich mich schämte, daß er mich ertappt hatte. Er konnte möglicherweise denken, daß ich versuchte, mir heimlich ein Verdienst zu erwerben. Aber nein, nein! Dies hatte nichts mit Verdienst zu tun. Es war mein Frauenherz, das anbeten mußte, wenn es lieben sollte.
Das Haus meines Schwiegervaters gehörte zu den altangesehenen seit den Zeiten der Pâdischâhs[5]. Es hielt zum Teil noch an den altindischen Gesetzen Manus und Paraschars fest, zum Teil hatten sich mongolische und afghanische Sitten bei ihm eingebürgert. Aber mein Gatte war durchaus modern. Er war der erste aus seinem Hause, der die Universität besuchte und zum Magister promovierte. Sein ältester Bruder war dem Trunk ergeben und jung gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen. Mein Gatte trank nicht und hatte keine Neigung zu Ausschweifungen. Diese Enthaltsamkeit war der Familie so fremd, daß sie vielen kaum schicklich erschien. Sie waren der Ansicht, daß Enthaltsamkeit nur denen ziemte, die nicht vom Glück begünstigt sind. Denn der Mond hat Platz für Flecke, nicht die Sterne.
Die Eltern meines Gatten waren schon lange tot, und seine alte Großmutter war die Herrin des Hauses. Mein Gatte war ihr Augapfel, ihr höchstes Kleinod. Und so wurden ihm nie Schwierigkeiten gemacht, wenn er sich nicht an die alten Bräuche hielt.
Als er Miß Gilby ins Haus brachte, damit sie mich unterrichte und mir Gesellschaft leiste, setzte er seinen Willen durch, trotz der geschwätzigen, giftigen Zungen zu Hause und draußen.
Mein Gatte hatte damals gerade seine erste akademische Prüfung bestanden und bereitete sich auf die zweite vor; daher mußte er in Kalkutta wohnen und Vorlesungen an der Universität hören. Er pflegte mir jeden Tag zu schreiben, nur ein paar schlichte Zeilen, aber seine kühn geschwungene, charaktervolle Handschrift blickte mich, ach, so zärtlich an! Ich bewahrte seine Briefe in einer Schachtel von Sandelholz und bedeckte sie jeden Tag mit frischen Blumen aus dem Garten.
Damals war schon das Bild des Prinzen aus dem Märchen verblaßt wie der Mond im Licht des Morgens. In meinem Herzen thronte jetzt der Fürst meiner wirklichen Welt. Ich war seine Königin. Ich hatte meinen Platz an seiner Seite. Doch mein höchstes Glück bestand darin, daß mein wahrer Platz zu seinen Füßen war.
Inzwischen bin ich in den Geist der modernen Zeit eingeführt und habe seine Sprache sprechen gelernt. Daher ist es mir, als ob diese schlichten Worte, die ich jetzt hier schreibe, schamhaft erröteten. Abgesehen von meiner Bekanntschaft mit der modernen Lebenshaltung würde mein natürliches Gefühl mir sagen, daß, wie es nicht von meinem Willen abhing, daß ich als Weib auf diese Welt kam, so auch die Hingebungsfähigkeit in der Liebe eines Weibes sich nicht lernen läßt wie eine abgedroschene Stelle aus einer romantischen Dichtung, die ein Schulmädchen andächtig in schöner Rundschrift in ihr Heft schreibt.
Aber mein Gatte gab mir nie Gelegenheit, ihm meine Verehrung zu zeigen. Das war gerade seine Größe. Es sind Schwächlinge, die von ihren Frauen unbedingte Hingabe als ihr Recht fordern; das ist eine Erniedrigung für beide.
Seine Liebe zu mir schien die meine noch zu übertreffen, indem sie mich mit Huldigungen und Reichtümern überschüttete. Aber ich hatte mehr das Bedürfnis zu geben als zu empfangen; denn die Liebe will nicht geschont und behütet sein: sie ist eine Landstreicherin, deren Blumen besser im Staub der Straße als in den Kristallvasen des Gesellschaftszimmers gedeihen.
Mein Gatte konnte nicht ganz mit den alten überlieferten Gewohnheiten brechen, die in unserer Familie herrschten. Daher war es für uns schwer, uns zu jeder beliebigen Tagesstunde zu sehen[6]. Ich wußte genau die Zeit, wo er zu mir kommen konnte, und so war unser Zusammensein immer mit liebender Sorgfalt vorbereitet. Es kam wie der Reim eines Gedichtes im regelmäßigen Schritt des Rhythmus.
Wenn ich am Nachmittage meine Tagesarbeit beendet und mein Bad genommen hatte, steckte ich mein Haar auf, erneuerte das rote Stirnzeichen und legte meinen sorgfältig gefältelten Sari an und dann, nachdem ich mich körperlich und geistig von allen häuslichen Pflichten freigemacht hatte, widmete ich mich zu dieser bestimmten festlichen Stunde ganz dem Einen. Die Zeit mit ihm an jedem Tage war kurz, und doch war sie unendlich.
Mein Gatte pflegte zu sagen, daß Mann und Weib gleich seien in ihrer Liebe, weil sie gleichen Anspruch aneinander hätten. Ich widersprach ihm nicht, aber mein Herz sagte mir, daß die Liebe bei zwei Menschen in Wirklichkeit nie auf gleicher Höhe steht; nur hebt die höhere bei dem Zusammensein den andern zur gleichen Höhe empor. Daher herrscht dauernd die Freude der höheren Liebe; sie sinkt nie auf die Stufe der gemeinen Alltäglichkeit herab.
Mein Geliebter, es war deiner würdig, daß du nie Verehrung von mir erwartetest. Aber wenn du sie gelitten hättest, so hättest du mir in Wahrheit einen Dienst erwiesen. Du zeigtest mir deine Liebe, indem du mich schmücktest, mich ausbildetest, indem du mir alles gabst, um was ich dich bat und um was ich dich nicht bat. Ich sah die Tiefe deiner Liebe in deinen Augen, wenn du mich anblicktest. Ich habe den heimlichen Seufzer des Schmerzes gesehen, den du aus Liebe zu mir unterdrücktest. Du liebtest meinen Körper, als ob er eine Blume aus dem Paradiese wäre. Du liebtest mein ganzes Wesen, als ob die Vorsehung es dir als seltene Gabe anvertraut hätte.
Diese verschwenderische Liebe machte mich stolz und ließ mich glauben, daß der Reichtum, der dich an meine Tür zog, ganz mir gehörte. Aber solche Eitelkeit hemmt nur den Strom der freien Hingabe in der Liebe eines Weibes. Wenn ich als Königin throne und Huldigung fordere, so wächst diese Forderung beständig, sie ist nie befriedigt. Kann eine Frau ihr wahres Glück in dem bloßen Bewußtsein finden, daß sie Macht über einen Mann hat? Das einzige Heil des Weibes ist es, ihren Stolz in Liebe aufzugeben.
Ich muß heute daran denken, wie damals, in jenen Tagen unseres Glückes, die Flammen des Neides rings um uns aufsprangen. Dies war nur natürlich; war ich doch durch bloßen Zufall und ohne mein Verdienst zu meinem Glück gekommen. Aber die Vorsehung läßt den Born des Glückes nicht endlos fließen, wenn die Ehrenschuld nicht immer wieder manchen langen Tag hindurch bezahlt und somit der Besitz des Glückes gesichert wird. Gott gibt uns wohl Gaben, aber die Kraft, sie recht zu fassen und festzuhalten, müssen wir selbst haben. Ach um die Gaben, die unwürdigen Händen entgleiten!
Sowohl die Mutter wie die Großmutter meines Gatten waren wegen ihrer Schönheit berühmt gewesen. Und auch meine verwitwete Schwägerin war von seltener Schönheit. Als nun das Schicksal sie dafür so einsam ließ, gelobte die Großmutter, nie zu verlangen, daß ihr einziger Enkel bei seiner Heirat auf Schönheit sähe. Nur die glückverheißenden Zeichen verschafften mir den Eintritt in diese Familie; — sonst hatte ich keinen Anspruch darauf, hier zu sein.
In diesem Hause des Luxus war nur wenigen seiner Frauen die ihnen gebührende Achtung zuteil geworden. Sie hatten sich jedoch an die Art und Weise der Familie gewöhnt und es fertig gebracht, ihren Kopf über Wasser zu halten, getragen von ihrer Würde als Fürstinnen eines alten Hauses, wenn auch ihre Tränen in schäumendem Wein ertränkt und ihr Weinen vom Geklingel der Fußspangen tanzender Mädchen übertönt wurde. War es mein Verdienst, daß mein Gatte keine geistigen Getränke anrührte noch seine Mannheit auf den Weibermärkten vergeudete? Welchen Zauber wußte ich, der den wilden, unsteten Sinn des Mannes bändigte? Es war mein Glück, nichts weiter. Denn meiner Schwägerin gegenüber war das Schicksal sehr gefühllos gewesen. Ihr Festtag war zu Ende, als es noch früh am Abend war, und das Licht ihrer Schönheit erleuchtete umsonst die leeren Hallen und brannte herab, nachdem die Musik längst verstummt war.
Meine Schwägerin begegnete den modernen Anschauungen meines Gatten mit Verachtung. Wie lächerlich, daß er das Familienschiff, das mit dem ganzen Reichtum seines altehrwürdigen Ruhmes beladen war, unter der Flagge solch einer unbedeutenden kleinen Frau segeln ließ! Wie oft mußte ich die Geißel des Spottes fühlen! »Diebin, die sich die Liebe eines Gatten gestohlen, Heuchlerin, die sich unter der Schamlosigkeit ihres neumodischen Putzes verbirgt!« Die bunten modernen Gewänder, mit denen mein Gatte mich zu schmücken liebte, erweckten ihre eifersüchtige Wut. »Schämt sie sich denn gar nicht, ein Schaufenster aus sich zu machen, — und noch dazu bei ihrem Äußern!«
Mein Gatte merkte dies alles, aber seine Sanftmut kannte keine Grenzen. Er bat mich inständig, ihr zu verzeihen.
Ich weiß noch, wie ich einmal zu ihm sagte: »Die Seele der Frau ist so klein und verkrüppelt.« »Wie die Füße der Chinesinnen«, erwiderte er. »Hat die Gesellschaft sie nicht so eingezwängt, daß sie klein und verkrüppelt werden mußten? Sie sind nur Opfer eines launischen Schicksals. Wie kann man sie dafür verantwortlich machen?«
Es gelang meiner Schwägerin immer, alles, was sie wollte, von meinem Gatten zu bekommen. Er überlegte nicht erst, ob ihre Bitten berechtigt oder vernünftig wären. Aber am meisten empörte mich, daß sie ihm gar nicht dankbar dafür war. Ich hatte meinem Gatten versprochen, auf ihr Schelten nichts zu erwidern, aber dies brachte mich innerlich nur um so mehr auf. Ich fühlte, daß Güte eine Grenze hat und, wenn man über diese hinausgeht, leicht in Schwäche ausartet. Ja, soll ich ganz aufrichtig sein? Ich habe oft gewünscht, daß mein Gatte die Männlichkeit haben möchte, etwas weniger gut zu sein.
Meine Schwägerin, die Bara Rani[7], war noch jung und machte keinen Anspruch auf Heiligkeit. Im Gegenteil, ihre Reden und Späße hatten leicht etwas Keckes. Auch die jungen Mädchen, die sie um sich hatte, waren ziemlich unverschämt. Aber niemand verwies ihr ihre Art; war dies doch der Ton, an den man im Hause gewöhnt war. Was sie mir vor allem mißgönnte, war, so schien es mir, das Glück, einen so untadelhaften Gatten zu haben. Er jedoch empfand weniger die Fehler ihres Charakters als die Traurigkeit ihres Schicksals.
II
Mein Gatte hatte den sehnlichen Wunsch, mich aus der Abgeschlossenheit meines Frauengemaches hinaus in die Welt zu führen.
Eines Tages sagte ich zu ihm: »Wozu brauche ich die Welt da draußen?«
»Die Welt da draußen braucht dich vielleicht«, erwiderte er.
»Wenn sie so lange ohne mich fertig geworden ist, kann sie es auch noch etwas länger. Sie wird schon nicht aus Sehnsucht nach mir zugrunde gehen.«
»Ach, meinetwegen mag sie zugrunde gehen. Darum mache ich mir keine Sorge. Ich denke an mich selbst.«
»O, wirklich! Was ist es denn mit dir?«
Mein Gatte lächelte schweigend.
Ich kannte seine Art und wehrte mich sogleich dagegen:
»Nein, nein, so entkommst du mir nicht. Ich muß wissen, was es ist.«
»Läßt sich denn alles mit Worten sagen?«
»Bitte, höre auf in Rätseln zu sprechen! Sag' mir...«
»Was ich möchte, ist, daß wir draußen auch in der Welt unser Leben ganz miteinander teilten. Hier bleiben wir uns beide noch etwas schuldig.«
»Fehlt denn irgend etwas in der Liebe, die wir hier zu Hause einander geben?«
»Hier gehst du ganz in mir auf. Du weißt weder, was du hast, noch, was dir fehlt.«
»Ich mag nicht hören, wenn du so redest.«
»Ich möchte, daß du mitten in das Leben und Treiben hinauskämest und die Wirklichkeit kennenlerntest. Du bist nicht dazu geschaffen, nur Tag für Tag deine häuslichen Pflichten zu erfüllen und dein ganzes Leben in der Plackerei des Haushalts zwischen den engen Mauern zuzubringen, die die Traditionen um die Frau aufgerichtet haben. Erst wenn wir draußen in der Welt der Wirklichkeit uns sehen und erkennen, wird unsere Liebe vollkommen und wahr sein.«
»Wenn uns hier irgend etwas daran hindert, uns ganz zu erkennen, kann ich nichts sagen. Aber ich meinesteils fühle nicht, daß irgend etwas fehlt.«
»Gut, aber wenn auch das Hindernis nur auf meiner Seite ist, solltest du da nicht helfen, es zu beseitigen?«
Solche Gespräche wiederholten sich öfters. Eines Tages sagte er: »Der Mensch, der Verlangen hat nach seinem geschmorten Fisch, hat in seiner Gier keine Gewissensbisse, wenn er den Fisch nach seinem Bedürfnis zerschneidet. Aber der, der den Fisch liebt, möchte sich im Wasser an ihm freuen, und wenn das unmöglich ist, wartet er am Ufer, und selbst wenn er nach Hause kommt, ohne ihn erblickt zu haben, so hat er den Trost, zu wissen, daß der Fisch gut aufgehoben ist. Jemanden in seiner Vollkommenheit besitzen dürfen, ist der höchste Gewinn, aber wenn dies unmöglich ist, so ist der zweithöchste, auf den Besitz zugunsten der Vollkommenheit des andern zu verzichten.«
Ich hörte meinen Gatten nicht gern so über diesen Gegenstand sprechen, aber nicht das war der Grund, weshalb ich mich weigerte, die Frauengemächer zu verlassen. Seine Großmutter war noch am Leben. Mein Gatte hatte mehr als neunundneunzig Prozent des Hauses mit dem zwanzigsten Jahrhundert angefüllt, sehr gegen ihren Geschmack, aber doch hatte sie es, ohne zu klagen, geduldet. Sie würde es ebenso geduldet haben, wenn die Gemahlin des Radscha[8] ihre Zurückgezogenheit aufgegeben hätte. Sie war sogar darauf gefaßt, daß dies geschehen könnte. Aber mir schien die Sache nicht wichtig genug, um ihr diesen Schmerz anzutun. Ich habe in Büchern gelesen, daß man uns als »Vögel im Käfig« bezeichnet. Ich weiß nicht, wie es mit andern ist, aber für mich umschloß dieser Käfig so viel, daß es in der ganzen Welt nicht Platz gehabt hätte, — so empfand ich es wenigstens damals.
Die Großmutter, die schon sehr alt war, hielt sehr viel von mir. Ihrer Liebe lag wohl der Gedanke zugrunde, daß ich mit Hilfe der mir günstigen Sterne es vermocht hatte, die Liebe meines Gatten zu gewinnen. Hatten nicht die Männer von Natur den Hang, in Laster zu versinken? Keine von den andern war mit all ihrer Schönheit imstande gewesen, ihren Gatten davon zurückzuhalten, daß er Hals über Kopf dem höllischen Abgrund zustürzte, der ihn verschlang und vernichtete. Sie glaubte, daß ich das Mittel gewesen sei, jene Leidenschaften auszulöschen, die den Männern ihrer Familie so verderblich geworden waren. Daher hütete sie mich wie ihren größten Schatz und zitterte, sobald mir nur das Geringste fehlte.
Die Großmutter mochte die Kleider und Schmucksachen nicht leiden, die mein Gatte in europäischen Läden kaufte, um sie mir umzuhängen. Aber sie überlegte: Die Männer müssen nun einmal irgendein närrisches Steckenpferd haben, das allemal viel Geld kostet. Es hat keinen Zweck, zu versuchen, sie daran zu hindern; man kann nur froh sein, wenn sie sich nicht ganz dabei zugrunde richten. Wenn mein Nikhil nicht immer damit beschäftigt wäre, seine Frau mit schönen Kleidern zu umhängen, wer weiß, an wen er sonst sein Geld verschwenden würde. Daher ließ sie, immer wenn ein neues Kleid für mich ankam, meinen Gatten rufen und freute sich mit ihm darüber.
Und so kam es, daß sie es war, die ihren Geschmack änderte. Ja, sie wurde so sehr von dem modernen Geist beeinflußt, daß kein Abend hingehen durfte, ohne daß ich ihr Geschichten aus englischen Büchern erzählte.
Nach dem Tode seiner Großmutter wollte mein Gatte gern, daß ich mit ihm nach Kalkutta übersiedelte. Aber ich konnte mich nicht dazu entschließen. War dies nicht unser Haus, das sie in allen Leiden und Kümmernissen unter ihrer sorgenden Hut gehabt hatte? Würde nicht ein Fluch mich treffen, wenn ich es verließe und fortzöge in die Stadt? Dies war der Gedanke, der mich zurückhielt, als ihr leerer Platz mich vorwurfsvoll ansah. Diese edle Frau war mit acht Jahren in dies Haus gekommen, und als sie starb, war sie achtundsiebzig. Sie hatte kein glückliches Leben gehabt. Das Schicksal hatte Pfeil auf Pfeil gegen ihre Brust geschleudert und hatte doch nur immer mehr die unzerstörbare Kraft ihrer Seele hervorströmen lassen. Dies große Haus war durch ihre Tränen geweiht. Was sollte ich fern von ihm, im Staub von Kalkutta?
Mein Gatte hatte die Vorstellung, daß wir auf diese Weise meiner Schwägerin den Trost verschaffen könnten, Herrin im Hause zu sein, und zugleich unserm Leben mehr Raum verschaffen würden, sich auszudehnen. Aber gerade hierin konnte ich ihm nicht zustimmen. Sie hatte mir das Leben zur Plage gemacht, sie mißgönnte meinem Gatten sein Glück, und dafür sollte sie jetzt belohnt werden! Und wenn wir nun eines Tages hierher zurückkehren wollten? Würde ich da den ersten Platz wiederbekommen?
»Was willst du mit dem ersten Platz?« pflegte mein Gatte zu sagen. »Gibt es denn nichts Wertvolleres im Leben?«
Die Männer verstehen solche Dinge nie. Sie haben ihre Nester draußen, sie kennen nicht die ganze Bedeutung des häuslichen Lebens. In diesen Dingen sollten sie der weiblichen Führung folgen. — So dachte ich damals.
Für mich war der Hauptpunkt der, daß man sein Recht vertreten müsse. Fortgehen und alles in den Händen des Feindes lassen, das wäre so gut wie das Eingeständnis einer Niederlage gewesen.
Aber warum zwang mein Gatte mich nicht, mit ihm nach Kalkutta zu gehen? Ich weiß den Grund. Er machte keinen Gebrauch von seiner Gewalt, gerade weil er sie hatte.
III
Wenn jemand nach und nach die Kluft zwischen Tag und Nacht ausfüllen wollte, so würde er eine Ewigkeit dazu brauchen. Aber die Sonne geht auf, und die Dunkelheit ist verscheucht — ein Augenblick genügt, einen unendlichen Abstand zu überwinden.
Eines Tages begann in Bengalen die neue Zeit der Swadeschi-Bewegung[9]; aber wie es dazu kam, davon hatten wir keine klare Vorstellung. Es war kein allmählicher Übergang von der Vergangenheit zur Gegenwart. Das ist, glaube ich, der Grund, warum die neue Epoche wie eine Flut über unser Land kam, die Deiche durchbrechend und all unsre Klugheit und Furcht mit sich fortreißend. Wir hatten nicht einmal Zeit, darüber nachzudenken oder zu begreifen, was geschehen war oder was geschehen sollte.
Mein Herz und meine Sinne, meine Hoffnungen und meine Wünsche flammten auf in der Leidenschaft dieser neuen Zeit. Wenn auch bis jetzt die Mauern des Heims, das meinem Geiste doch letzten Endes die Welt bedeutet hatte, noch nicht zerbrochen waren, so blickte ich doch über sie hinaus in die Weite und hörte vom fernen Horizonte her eine Stimme, deren Worte ich zwar nicht deutlich verstand, aber deren Ruf mir unmittelbar zum Herzen ging.
Seit der Zeit, wo mein Gatte auf der Universität studierte, hatte er versucht, dahin zu wirken, daß unser Volk die Dinge, die es brauchte, im eigenen Lande erzeugte. Es gibt in unserer Gegend sehr viele Dattelpalmen. Er versuchte, einen Apparat zu erfinden, womit der Saft aus den Früchten ausgepreßt und dann zu Zucker und Sirup verkocht würde. Man sagte mir, der Apparat funktioniere sehr gut, aber er preßte doch noch mehr Geld aus dem Unternehmer heraus als Saft aus den Datteln. Bald kam mein Gatte zu dem Schluß, daß unsre Versuche, unsre Industrie wieder zu beleben, keinen Erfolg haben konnten, solange wir keine eigene Bank hatten. Er versuchte damals, mich in die Volkswirtschaft einzuführen. Dies allein hätte nun zwar nicht viel geschadet, aber er hatte es sich in den Kopf gesetzt, auch seinen Landsleuten seine Ideen beizubringen und so den Weg für eine Bank zu bahnen; und dann eröffnete er auch tatsächlich ein kleines Bankgeschäft. Die hohen Zinsen jedoch, die bewirkten, daß die Dorfleute begeistert herbeiströmten, um ihr Geld hineinzutun, richteten bald die Bank gänzlich zugrunde.
Die alten Gutsverwalter waren bekümmert und ängstlich. Die Feinde triumphierten. Von der ganzen Familie blieb nur meines Gatten Großmutter gelassen und ruhig. Sie schalt mich, indem sie sagte: »Warum quält ihr ihn alle so? Kümmert ihr euch sonst um das Schicksal des Gutes? Wie oft habe ich schon erlebt, daß dies Gut dem Steuereinnehmer verpfändet wurde! Sind die Männer denn wie die Frauen? Die Männer sind geborene Verschwender und können nur Geld durchbringen. Sieh einmal, mein Kind, du solltest dich glücklich schätzen, daß dein Gatte nicht auch noch seine Gesundheit durchbringt!«
Die Liste derer, die von meinem Gatten unterstützt wurden, war sehr lang. Wer nur einen neuen Webstuhl oder eine neue Reisenthülsungsmaschine erfinden wollte, dem stand er bei bis zum gänzlichen Ruin. Aber was mich am meisten ärgerte, war die Art, wie Sandip Babu ihn ausbeutete, indem er seine Arbeit für die Swadeschi-Bewegung als Vorwand gebrauchte. Was es auch war, sei es nun, daß er eine Zeitung gründen oder eine Vortragsreise für die Sache unternehmen wollte, oder daß er nach Ansicht seines Arztes Luftveränderung brauchte, mein Gatte gab immer hin, ohne zu fragen. Und dies gewährte er Sandip Babu noch außer der festgesetzten Summe, die dieser regelmäßig für seinen Unterhalt von ihm erhielt. Das Merkwürdigste dabei war, daß mein Gatte und Sandip Babu in ihren Ansichten gar nicht übereinstimmten.
Sobald der Sturm der Swadeschi-Bewegung auch mir ins Blut gefahren war, sagte ich zu meinem Gatten: »Ich muß alle meine ausländischen Kleider verbrennen.«
»Warum willst du sie verbrennen?« sagte er. »Du brauchst sie ja nicht zu tragen, solange du nicht willst.«
»Solange ich nicht will! Mein ganzes Leben lang...«
»Gut, trage sie denn nicht mehr! Aber wozu gleich feierlich einen Scheiterhaufen errichten?«
»Wolltest du mich in meinem Entschluß hindern?«
»Was ich dir sagen möchte, ist dies: Warum wollt ihr nicht lieber versuchen aufzubauen? Ihr solltet auch nicht einmal den zehnten Teil eurer Kraft in diesem zerstörenden Haß vergeuden.«
»Dieser Haß wird uns die Kraft geben, aufzubauen.«
»Das ist, als ob ihr sagtet, ihr könntet das Haus nicht erleuchten, ohne es anzuzünden.«
Bald kam ein neuer Verdruß. Als Miß Gilby zuerst in unser Haus gekommen war, hatte es große Aufregung gegeben, die sich dann allmählich beruhigte, als man sich an sie gewöhnte. Jetzt wurde die ganze Sache von neuem aufgerührt. Ich hatte mich vorher nicht darum gekümmert, ob Miß Gilby Europäerin oder Indierin sei, aber jetzt war es mir nicht mehr einerlei. Ich sagte zu meinem Gatten: »Wir müssen Miß Gilby aus dem Hause schaffen.«
Er schwieg.
Ich wurde heftig, und er ging traurig fort.
Nachdem ich mich ausgeweint hatte, war ich des Abends, als wir uns wiedersahen, etwas ruhiger gestimmt. »Ich kann Miß Gilby nicht durch einen Nebel von abstrakten Theorien ansehen,« sagte mein Gatte, »nur weil sie Engländerin ist. Kannst du nach einer so langen Bekanntschaft nicht über die Schranke eines bloßen Namens wegkommen? Kannst du nicht daran denken, daß sie dich liebt?«
Ich war ein wenig beschämt und antwortete etwas gereizt: »Meinethalben laß sie bleiben. Ich bin nicht darauf erpicht, sie fortzuschicken.«
Und Miß Gilby blieb.
Aber eines Tages hörte ich, daß ein junger Bursche sie auf dem Wege zur Kirche beschimpft hatte. Es war ein Junge, den wir unterstützten. Mein Gatte wies ihn aus dem Hause. Es gab an jenem Tage niemand, der meinem Gatten diese Tat verzeihen konnte, — selbst ich nicht. Diesmal ging Miß Gilby von selbst. Sie weinte, als sie kam, um uns Lebewohl zu sagen, aber mein Zorn schmolz nicht. Den armen Jungen so zu verklatschen, — und dabei war er ein so prächtiger Junge, der über seiner Begeisterung für die nationale Sache Essen und Trinken vergaß.
Mein Gatte brachte Miß Gilby in seinem eigenen Wagen zur Bahn. Ich fand, daß er viel zu weit ging. Und als übertriebene Gerüchte von diesem Vorfall Anlaß zu einem öffentlichen Skandal gaben, über den die Zeitungen herfielen, fand ich, daß ihm ganz recht geschehen sei.
Ich war durch meines Gatten Tun oft in Unruhe versetzt, aber nie vorher hatte ich mich seiner geschämt; doch jetzt mußte ich für ihn erröten. Ich wußte nicht genau, und es war mir auch gleichgültig, welches Unrecht der arme Noren Miß Gilby getan hatte oder getan haben sollte; aber wie konnte man in solcher Zeit über so etwas zu Gericht sitzen! Ich hätte die Gesinnung, die den kleinen Noren antrieb, der Engländerin seine Verachtung zu zeigen, nicht unterdrücken mögen. Ich konnte nicht anders als ein Zeichen von Schwäche darin sehen, daß mein Gatte eine so einfache Sache nicht begriff. Und daher errötete ich für ihn.
Und doch lag es nicht so, daß mein Gatte sich weigerte, die Swadeschi-Bewegung zu unterstützen oder daß er irgendwie der nationalen Sache entgegenarbeitete. Er war nur nicht imstande, sich mit ganzem Herzen dem Geist des »Bande Mataram«[10] hinzugeben.
»Ich will gern meinem Lande dienen,« sagte er, »aber die Gerechtigkeit steht mir höher als das Vaterland. Wer Götzendienst mit seinem Vaterlande treibt, ruft einen Fluch darauf herab.«
ZWEITES KAPITEL
BIMALAS ERZÄHLUNG
IV
Um diese Zeit geschah es, daß Sandip Babu mit seinen Anhängern in unsere Gegend kam, um Reden im Dienste der Swadeschi-Bewegung zu halten.
Es soll eine große Versammlung in unsrer Tempelhalle stattfinden. Wir Frauen sitzen dort auf der einen Seite, hinter einem Vorhang. Das Triumphgeschrei Bande Mataram kommt näher, und ein Schauer läuft durch alle meine Adern. Plötzlich strömt eine Schar von barfüßigen Jünglingen im gelben Asketengewand und Turban in den Tempelhof, wie ein schlammgeröteter Bach beim ersten Regenguß sich in das ausgetrocknete Flußbett ergießt. Der ganze Raum ist angefüllt von einer ungeheuren Menge, durch die man Sandip Babu trägt, auf einem großen Stuhl thronend, den zehn bis zwölf Jünglinge auf den Schultern tragen.
Bande Mataram! Bande Mataram! Bande Mataram! Es ist, als ob der Himmel bersten und in tausend Stücke zerreißen wollte.
Ich hatte Sandip Babus Bild schon früher gesehen. Es war etwas in seinem Gesicht, was ich nicht mochte. Nicht, daß er häßlich war, — im Gegenteil, er hatte ein auffallend schönes Gesicht. Doch, ich weiß nicht, es schien mir, daß trotz all der Schönheit zuviel gemeiner Stoff hineingearbeitet war. Das Licht in seinen Augen schien mir nicht ganz echt zu sein. Darum mochte ich nicht, daß mein Gatte unbedenklich allen seinen Forderungen nachgab. Den Verlust des Geldes konnte ich schon ertragen, aber es ärgerte mich, daß er meinen Gatten hinterging und seine Freundschaft ausbeutete. Sein Benehmen war nicht das eines Asketen, nicht einmal das eines Menschen in beschränkten Verhältnissen, sondern durchaus stutzerhaft und verriet Liebe zum Luxus... Eine ganze Reihe solcher Betrachtungen kommen mir heute wieder in den Sinn, aber genug davon!
Als Sandip Babu jedoch an jenem Nachmittag zu sprechen anfing und die Herzen der Menge bei seinen Worten wogten und schwollen, als ob sie alle Schranken durchbrechen wollten, sah ich ihn wunderbar verklärt. Besonders als seine Züge plötzlich von einem Strahl der untergehenden Sonne erleuchtet wurden, die langsam unter die Linie des Tempeldaches sank, da erschien er mir wie ein Gottgesandter.
Von Anfang bis zu Ende war seine Rede ein stürmischer Ausbruch. Sein Vertrauen auf den Sieg der Sache war felsenfest. Ich weiß nicht, wie es kam, aber ich merkte plötzlich, daß ich den Vorhang ungeduldig zurückgeschlagen und den Blick fest auf ihn gerichtet hatte. Aber niemand unter der Menge beachtete, was ich tat. Nur einmal bemerkte ich, wie seine Augen mich anfunkelten, wie die Sterne des schicksalsvollen Orions.
Ich hatte mich ganz vergessen. Ich war nicht mehr die Gemahlin des Radscha, sondern die einzige Vertreterin von Bengalens Frauen. Und er war der Streiter für Bengalen. Wie der Himmel sein Licht über ihn ausgegossen hatte, so mußte auch der Segen einer Frau ihn für seine Aufgabe weihen...
Es schien mir ganz deutlich, daß, seit er mich erblickt hatte, das Feuer seiner Rede noch leidenschaftlicher emporgeflammt war. Indras Roß ließ sich nicht bändigen, und nun kam das Rollen des Donners und das Leuchten der Blitze. Ich sagte mir, daß seine Rede sich an meinen Augen entzündet hatte; denn wir Frauen wachen nicht nur über das Feuer des häuslichen Herdes, sondern über die Flamme der Seele selbst.
Als ich an jenem Abend heimkehrte, strahlte ich von einem neuen Gefühl des Stolzes und der Freude. Der Sturm in mir hatte mein ganzes Wesen aufgewühlt und seinen Schwerpunkt verschoben. Wie die Jungfrauen der alten Griechen hätte ich gern meine langen, glänzenden Flechten abgeschnitten, um eine Bogensehne für meinen Helden daraus zu machen. Wenn mein äußerer Schmuck mit meinen Gefühlen in Verbindung gestanden hätte, so würden Halsband und Armspangen ihren Verschluß gesprengt und sich wie ein Schauer von Meteoren über die Versammlung ergossen haben. Ich fühlte, daß ich ein persönliches Opfer bringen mußte, um den Sturm der leidenschaftlichen Erregung in mir aushalten zu können.
Als mein Gatte später nach Hause kam, zitterte ich vor Angst, er könne etwas sagen, was mit dem Siegeslied, das noch in meinen Ohren klang, in Disharmonie wäre; ich fürchtete, sein Wahrheitsfanatismus könne ihn verleiten, sich über irgend etwas, was am Nachmittag gesagt war, mißbilligend zu äußern. Denn dann würde ich ihm offen getrotzt und ihn gedemütigt haben. Aber er sagte kein Wort... und dies war mir auch nicht recht. Er hätte sagen sollen: »Sandip hat mich zur Vernunft gebracht. Jetzt sehe ich ein, wie sehr ich mich diese ganze Zeit geirrt habe.«
Ich hatte das Gefühl, daß er aus Ärger und Bosheit schwieg, daß er sich eigensinnig der Begeisterung verschloß. Ich fragte ihn, wie lange Sandip Babu bei uns bleiben würde.
»Er wird morgen in der Frühe nach Rangpur aufbrechen«, sagte mein Gatte.
»Muß es schon morgen sein?«
»Ja, er hat versprochen, dort zu reden.«
Ich schwieg eine Weile, dann fragte ich wieder: »Könnte er es nicht möglich machen, noch einen Tag zu bleiben?«
»Das wird er schwerlich können. Aber warum möchtest du es?«
»Ich möchte ihn zum Mittagessen einladen und ihn dabei selbst bedienen.«
Mein Gatte war überrascht. Er hatte mich oft gebeten, dabei zu sein, wenn er nahe Freunde zum Mittagessen bei sich hatte, aber ich hatte mich nie dazu überreden lassen. Er sah mich einen Augenblick schweigend und aufmerksam an, mit einem Blick, den ich nicht ganz verstand.
Plötzlich überkam mich ein Gefühl der Scham.
»Nein, nein,« rief ich, »das geht auf keinen Fall.«
»Warum nicht?« sagte er. »Ich will ihn selbst fragen; wenn es irgend möglich ist, wird er sicher morgen noch bleiben.«
Es erwies sich als durchaus möglich.
Ich will ganz aufrichtig sein. An jenem Tage machte ich meinem Schöpfer Vorwürfe, daß er mich nicht mit hervorragender Schönheit geschmückt hatte, — nicht daß ich damit hätte Herzen stehlen wollen, sondern weil Schönheit verklärt. An diesem großen Tage sollten die Männer die Gottheit des Landes im Weibe erkennen. Aber ach, die Augen der Männer erkennen die Gottheit nicht, wenn es ihr an äußerer Schönheit fehlt. Würde Sandip Babu die Schakti[11] unseres Landes in mir offenbart sehen? Oder würde er mich nur für eine gewöhnliche Hausfrau halten?
An jenem Morgen besprengte ich mein herabhängendes Haar mit wohlriechendem Wasser und band es in einen losen Knoten mit einem rotseidenen Bande, das ich geschickt hindurchschlang. Das Mittagessen sollte schon um zwölf sein, da hatte ich begreiflicherweise nicht die Zeit, es nach meinem Bade noch in der gewohnten Weise in Flechten hochzustecken. Ich zog einen goldgesäumten weißen Sari an, und auch mein kurzärmeliges Muslinjäckchen hatte einen Goldsaum.
Ich war der Meinung, daß meine Kleidung eigentlich recht diskret sei und daß nicht leicht etwas einfacher hätte sein können. Aber meine Schwägerin, die zufällig vorbeiging, blieb plötzlich vor mir stehen, sah mich von Kopf zu Fuß an und lächelte mit zusammengepreßten Lippen ein vielsagendes Lächeln. Als ich sie nach dem Grunde fragte, sagte sie: »Ich bewundere deinen Aufputz.«
»Was ist daran so Belustigendes?« fragte ich sehr geärgert.
»Er ist prächtig«, sagte sie. »Ich dachte mir eben, daß eine von jenen tiefausgeschnittenen englischen Taillen ihn vollkommen machen würde.« Nicht nur ihr Mund und ihre Augen, sondern ihr ganzer Körper schien von unterdrücktem Lachen zu zucken, als sie das Zimmer verließ.
Ich war sehr, sehr böse und wollte im ersten Augenblick alles ausziehen und meine Alltagskleider anlegen. Ich kann nicht genau sagen, was mich hinderte, diesem Impuls zu folgen. Die Frauen sind die Zierde der Gesellschaft — so redete ich mir ein — und mein Gatte würde es nicht mögen, wenn ich nicht standesgemäß gekleidet vor Sandip Babu erschiene.
Meine Absicht war, erst zu erscheinen, nachdem sie sich schon zum Mittagessen gesetzt hatten.
Bei der Beaufsichtigung des Bedienens hätte ich die erste Scheu am besten überwinden können. Aber das Essen war nicht zur rechten Zeit fertig, und es wurde spät. Inzwischen ließ mein Gatte mich rufen, um mir den Gast vorzustellen.
Ich war schrecklich verlegen, als ich Sandip Babu ins Gesicht sehen sollte. Es gelang mir jedoch, mich zu fassen, und ich sagte: »Es tut mir sehr leid, daß es mit dem Essen so spät wird.«
Er kam ohne jede Verlegenheit auf mich zu und nahm an meiner Seite Platz. »Ein Mittagessen,« sagte er, »bekomme ich irgendwie jeden Tag, aber die Göttin des Überflusses bleibt hinter der Szene. Nun, da die Göttin selbst erschienen ist, macht es wenig, wenn das Essen auf sich warten läßt.«
Er war im Privatverkehr eben so emphatisch wie in seinen öffentlichen Reden. Er zögerte nicht und schien daran gewöhnt, unaufgefordert den Platz einzunehmen, den er sich wählte. Er erhob mit solcher Zuversicht den Anspruch auf Vertraulichkeit, daß man sich im Unrecht gefühlt hätte, wenn man sie ihm hätte streitig machen wollen.
Es war mir ein schrecklicher Gedanke, daß Sandip Babu mich für ein schüchternes, altmodisches Häufchen Unbedeutendheit halten könnte. Aber ich hätte ihn um mein Leben nicht mit geistreichen Erwiderungen bezaubern oder blenden können. Wie war ich nur auf den unglücklichen Einfall gekommen, so fragte ich mich zornig, solche lächerliche Figur vor ihm zu spielen?
Als das Mittagessen vorüber war, wollte ich mich zurückziehen, aber Sandip Babu, kühn wie immer, stellte sich mir in den Weg.
»Sie müssen mich nicht für so materiell halten«, sagte er. »Nicht das Mittagessen veranlaßte mich zu bleiben, sondern Ihre Einladung. Wenn Sie jetzt die Flucht ergriffen, so würden Sie mit Ihrem Gast kein ehrliches Spiel treiben.«
Wenn er diese Worte nicht in heiterm und ungezwungenem Ton gesagt hätte, so hätten sie mich wohl verstimmt. Aber ich mußte mir ja sagen, er stand meinem Gatten so nahe, daß ich mich als seine Schwester ansehen konnte.
Während ich versuchte, mich innerlich auf diesen vertraulichen Ton einzustellen, kam mir mein Gatte zu Hilfe, indem er sagte: »Könntest du denn nicht wiederkommen, wenn du dein Mittagessen gehabt hast?«
»Aber Sie müssen uns Ihr Wort geben, bevor wir Sie fortlassen«, sagte Sandip Babu.
»Ich verspreche es«, sagte ich mit einem leichten Lächeln.
»Ich will Ihnen sagen, warum ich Ihnen nicht trauen kann«, fuhr Sandip Babu fort. »Nikhil ist nun schon neun Jahre verheiratet, und diese ganze Zeit sind Sie mir ausgewichen. Wenn Sie dies nun wieder neun Jahre lang tun, werden wir uns überhaupt nicht wiedersehen.«
Ich ging auf den Geist seiner Bemerkung ein und fragte leise: »Aber warum sollten wir uns selbst dann nicht wiedersehen?«
»Mein Horoskop sagt mir, daß ich früh sterben werde. Keiner von meinen Vorfahren hat sein dreißigstes Jahr überlebt. Ich bin jetzt siebenundzwanzig.«
Er wußte, daß dies Eindruck machen würde. Und er mußte diesmal einen leisen Ton von Besorgnis in meiner Stimme hören, als ich flüsternd sagte: »Der Segen des ganzen Landes wird sicher den bösen Einfluß der Sterne abwenden.«
»Dann muß die Gottheit des Landes selbst diesem Segen ihre Stimme leihen. Dies ist der Grund, warum ich so eifrig wünsche, Sie möchten wiederkommen, damit mein Talisman schon heute anfangen kann zu wirken.«
Sandip Babu hatte eine solche Art, alles im Sturm zu nehmen, daß ich gar nicht dazu kam, ihm etwas übelzunehmen, was ich einem andern nie erlaubt haben würde.
»Also«, schloß er lachend, »werde ich Ihren Gatten so lange als Geisel hierbehalten, bis Sie zurückkommen.«
Als ich im Begriff war zu gehen, rief er: »Darf ich Sie um eine Kleinigkeit bemühen?«
Ich wandte mich etwas erschrocken um.
»Erschrecken Sie nicht«, sagte er. »Es ist nur ein Glas Wasser. Sie haben vielleicht bemerkt, daß ich beim Essen kein Wasser trank. Ich trinke es etwas später.«
Ich mußte hierauf etwas Interesse zeigen und nach dem Grund fragen. Er erzählte mir, daß er seit länger als einem halben Jahr an Verdauungsbeschwerden gelitten und nun endlich, nachdem er alle möglichen allopathischen und homöopathischen Mittel vergeblich versucht hatte, mit einheimischen Heilmitteln ganz wundervolle Resultate erzielt hätte.
»Sehen Sie,« fügte er mit einem Lächeln hinzu, »Gott hat selbst meine Gebrechen so eingerichtet, daß sie nur dem Bombardement mit Swadeschi-Pillen weichen.«
Hier mischte sich mein Gatte ein. »Du mußt zugeben,« sagte er, »daß du eine ebenso große Anziehungskraft für ausländische Medizin hast, wie die Erde für Meteore. Du hast in deinem Wohnzimmer drei Schränke...«
Sandip Babu unterbrach ihn. »Weißt du, was die sind? Die sind die Strafpolizei. Sie sind da, nicht weil man ihrer bedarf, sondern weil sie uns durch die moderne Gesellschaftsordnung aufoktroyiert sind, daß sie uns Geldstrafen auferlegen oder andere Unbill zufügen.«
Mein Gatte kann Übertreibungen nicht leiden, und ich merkte, daß er verstimmt war. Aber jede Verzierung ist eine Übertreibung. Sie stammt nicht von Gott, sondern vom Menschen. Ich weiß noch, wie ich einmal mich meinem Gatten gegenüber verteidigte, als ich eine Unwahrheit gesagt hatte: »Nur die Bäume und Tiere und Vögel sagen die Wahrheit ganz nackt, weil es diesen armen Dingern an Erfindungsgabe fehlt. Hierin zeigen die Menschen ihre Überlegenheit über die niedern Geschöpfe, und die Frauen sind noch den Männern über. Wie reicher Schmuck der Frau wohl ansteht, so auch Ausschmückung der Wahrheit.«
Als ich hinaustrat auf den Korridor, der zu den Frauengemächern führte, sah ich meine Schwägerin an einem Fenster stehen, durch das man ins Empfangszimmer sehen konnte. Sie versuchte durch die Jalousien zu spähen.
»Du hier?« fragte ich überrascht.
»Auf dem Lauscherposten«, erwiderte sie.
V
Als ich zurückkam, entschuldigte sich Sandip Babu. »Ich fürchte, ich habe Ihnen den Appetit verdorben«, sagte er besorgt.
Ich schämte mich sehr. Ich war wirklich unziemlich schnell mit meinem Essen fertig geworden. Man konnte mir leicht nachrechnen, daß ich in der Zeit nicht viel hatte essen können. Aber mir war nicht der Gedanke gekommen, daß jemand nachrechnen würde.